POSITIONEN! Jazz und Politik
(Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung, Band 16)
herausgegeben von Wolfram Knauer
Hofheim 2020 (Wolke Verlag)
248 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-95593-016-5
 Das Buchcover sieht wie ein Nachrichtenbild dieser Tage aus, ein Rapper vor einem Foto, das einen bewaffneten Polizeieinsatz zu zeigen scheint. Das Bild, aufgenommen vom Fotografen Wilfried Heckmann, stammt vom Konzert der Band The Anarchist Republic of Bzzz letztes Jahr in der Darmstädter Centralstation, und es bebildert den Umschlag unseres just erschienenen neuen Buchs, “POSITIONEN! Jazz und Politik”, in dem wir das 16. Darmstädter Jazzforum dokumentieren.
Das Buchcover sieht wie ein Nachrichtenbild dieser Tage aus, ein Rapper vor einem Foto, das einen bewaffneten Polizeieinsatz zu zeigen scheint. Das Bild, aufgenommen vom Fotografen Wilfried Heckmann, stammt vom Konzert der Band The Anarchist Republic of Bzzz letztes Jahr in der Darmstädter Centralstation, und es bebildert den Umschlag unseres just erschienenen neuen Buchs, “POSITIONEN! Jazz und Politik”, in dem wir das 16. Darmstädter Jazzforum dokumentieren.
Dabei fragten Wissenschaftler:innen, Journalit:innen und Musiker:innen nach dem politischen Bewusstsein in unserer eigenen Gesellschaft, im Deutschland des Jahres 2019. So blickt Stephan Braese zu Beginn des Buchs zurück auf frühere politische Diskurseim deutshen Jazz. Henning Vetter diskutiert Musik und Haltung der Band The Dorf. Nina Polaschegg fragt nach den Unterschieden zwischen zeitgenössischer improvisierter und komponierter Musik in ihrem Verhältnis zur politischen Haltung. Benjamin Weidekamp und Michael Haves sprechen darüber, wie politische Haltung ihre Kunst beeinflusst.
Wolfram Knauer diskutiert Argumente für ein politisches Bewusstsein in der deutschen Jazzszene und gleicht diese mit konkreten Beispielen ab. Mario Dunkel analysiert populistische Bewegungen in Deutschland und Österreich und ihre Verwendung afrodiasporischer Musiken. Martin Pfleiderer diskutiert musikalische Interaktion als demokratischen Akt. Nadin Deventer, Lena Jeckel, Tina Heine und Ulrich Stock sprechen über die politische Verantwortung von Jazzfestival-Veranstalter:innen. Nikolaus Neuser und Florian Juncker machen auf den intermedialen Zusammenhang zwischen Musik und gesellschaftlicher Wahrnehmung aufmerksam. Hans Lüdemann erklärt die politische Motivation für seine Entscheidung Jazzmusiker zu werden.
Nikolaus Neuser diskutiert Jazz als gesellschaftliches Rollenmodell. Michael Rüsenberg hinterfragt die Vorstellung, dass Jazz immer politisch sei. Thomas Krüger beschreibt das Potenzial des Jazz für die politische Bildung. Angelika Niescier, Korhan Erel, Tim Isfort und Victoriah Szirmai blicken aus den Perspektiven von Musiker:innen, Veranstalter:innen, Journalist:innen und Publikum auf die Möglichkeiten politischer Aussagen durch Musik. Ulrich Stock sieht Atef Ben Bouzids Film “Cairo Jazzman”.
Das Buch ist auf Deutsch erschienen und ist im Buchhandel erhältlich oder direkt vom Verlag (Wolke Verlag; dort findet sich auch das Vorwort als PDF-Vorschau).
Sittin’ In. Jazz Clubs of the 1940s and 1950s
von Jeff Gold
New York 2020 (Harper Design)
260 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-06-291470-5
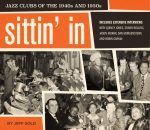 Jeff Gold betrachtet die US-amerikanische Jazzgeschichte der 1940er und 1950er Jahre einmal von der anderen Seite. Und das buchstäblich. Der Journalist, frühere Plattenmanager und Sammler nämlich entdeckte in einem Nachlass mehr als 200 Fotos aus Jazzclubs des Mitt-20sten Jahrhunderts. Die Fotos waren Souvenir-Fotos, die von club-eigenen Fotografen gemacht wurden und am Ende des Abends in Klappkarten mit dem Emblem der jeweiligen Clubs für einen Dollar verkauft wurden. Sie zeigen meist afro-amerikanische Fans, Familien, Freunde, ab und an auch Musikerinnen und Musiker.
Jeff Gold betrachtet die US-amerikanische Jazzgeschichte der 1940er und 1950er Jahre einmal von der anderen Seite. Und das buchstäblich. Der Journalist, frühere Plattenmanager und Sammler nämlich entdeckte in einem Nachlass mehr als 200 Fotos aus Jazzclubs des Mitt-20sten Jahrhunderts. Die Fotos waren Souvenir-Fotos, die von club-eigenen Fotografen gemacht wurden und am Ende des Abends in Klappkarten mit dem Emblem der jeweiligen Clubs für einen Dollar verkauft wurden. Sie zeigen meist afro-amerikanische Fans, Familien, Freunde, ab und an auch Musikerinnen und Musiker.
Die Bilder, schreibt Gold im Vorwort seines Buchs, “drehen die Kamera herum”: Statt der Bühnenkünstler sehen wir das Publikum, die Fans. Warum ist das so besonders? Sonny Rollins, den Gold für sein Buch interviewte, erklärt: In solchen kleinen Clubs wurde das Publikum schnell zum Teil der Band. Jason Moran bekräftigt: Diese Bilder sind powerful, weil wir doch sonst das Publikum nie dokumentieren. Gold spricht mit Quincy Jones, der in einigen dieser Clubs spielte, mit Dan Morgenstern, der die seit den späten 1940er Jahren regelmäßig frequentierte, außerdem mit der Mode- und Kulturhistorikern Robin Givhan. Er erzählt kurz die Geschichte der jeweiligen Clubs, lässt aber ansonsten die Bilder für sich sprechen.
Und diese Bilder sind dann tatsächlich powerful: eine Silvesterparty im Cotton Club aus Sicht der (Cab Calloway) Band, Dizzy Gillespie’s Bigband in den späten 1940er Jahren, die Sängerin Gladys Bentley im weißen Frack im Ubangi Club. Wenig bekannte Spielstätten wie der Club Baron und das Palm Cafe in Harlem, bekanntere wie das Onyx, Famous Door, Three Deuces oder Birdland in Midtown-Manhattan, das legendäre und noch heute existierende Village Vanguard, Nick’s und das Café Society in Greewich Village.
Ein kurzes Kapitel über Atlantic City schließt sich an (Paradise Cafe, Club Harlem, 500 Club), eins über Washington, D.C. (Bohemian Caverns, Club Kavakos, Club Bali), Boston (Symphony Hall, Hi-Hat), Clevaland (Chatterbox, Club 77), Detroit, Chicago, Kansas City, St. Louis, Los Angeles und San Francisco.
Es ist nicht nur die geänderte Sichtweise, die an den Fotos fasziniert, sondern auch das Private, das in ihnen durchscheint: Pärchen und Freundeskreise um einen Tisch mit reichlich Alkohol, fröhlich feiernde Menschen, für die der Clubbesuch mehr ist als nur die Musik, nämlich ein Abend mit Freunden. Es ist ein Ausflug in eine andere Zeit, und man kann sich, sofern man schon mal selbst einen amerikanischen Jazzclub besucht hat, durchaus vorstellen, wie die Atmosphäre in diesen Clubs tatsächlich war.
Golds Buch ist damit zwar keine Sozialstudie über das Jazzpublikum, aber es bietet genügend Quellenmaterial für künftige Studien. Der Fund jener Kisten mit Souvenirfotos jedenfalls ist ein grandioser Blick nicht etwa hinter die Kulissen, sondern in den Zuschaueraum der Orte, an denen die Musik enstand. Ungemein blätterfreundlich. Und inspirierend ob all der nicht-erzählten Geschichten, die sich hinter den Bildern verbergen.
Wolfram Knauer (August 2022)
Life in E Flat. The Autobiography of Phil Woods
von Phil Woods (mit Ted Panken)
Torrance 2020 (Cymbal Press)
ISBN: 978-0-9994776-4-9
21,95 US-Dollar
 Phil Woods habe Bird verehrt, heißt es, so sehr, dass er nach Charlie Parkers Tod dessen Witwe geheiratet und seine Kinder adoptiert habe. Die Leute hätten das immer falsch verstanden, betont Woods. Selbst Art Pepper habe über ihn gelästert, habe behauptet, man wisse nicht genau, ob Woods Birds Witwe geheiratet habe, weil er sie liebte oder weil er dessen Instrument haben wollte. Und Art sei ein Freund gewesen, betont Woods. Nein, es sei Liebe gewesen, die Ehe habe schließlich fünfzehn Jahre gehalten.
Phil Woods habe Bird verehrt, heißt es, so sehr, dass er nach Charlie Parkers Tod dessen Witwe geheiratet und seine Kinder adoptiert habe. Die Leute hätten das immer falsch verstanden, betont Woods. Selbst Art Pepper habe über ihn gelästert, habe behauptet, man wisse nicht genau, ob Woods Birds Witwe geheiratet habe, weil er sie liebte oder weil er dessen Instrument haben wollte. Und Art sei ein Freund gewesen, betont Woods. Nein, es sei Liebe gewesen, die Ehe habe schließlich fünfzehn Jahre gehalten.
Phil Woods hat seine Memoiren in den Mitt-2000er Jahren begonnen und den Journalisten Ted Panken eines Tages gefragt, ob er ihm nicht helfen könne, das alles in Form zu bringen. 2008 sei das gewesen, Woods habe noch ein paar Jahre gespielt, bis zum 4. September 2015, um genau zu sein, als er bei einem Konzert in Pittsburgh bekanntgab, sich zur Ruhe zu setzen. Seine Lungen machten nicht mehr mit, Emphysem. 24 Tage nach dem Konzert war er tot. Das Erscheinen dieses Buchs hat er also nicht mehr erlebt, konnte darin dennoch die gesamte aktive Zeit als Musiker erzählen.
Woods wurde 1931 in Springfield, Massachusetts, geboren und kam zum Saxophon, als sein Onkel starb und ihm sein Instrument vermachte. Er nahm Unterricht und spielte in einer ersten Band mit Freunden, unter denen sich auch der Schlagzeuger Joe Morello befand. Der Pianist der Band, Hal Serra, machte ihn mit dem Bebop vertraut; gemeinsam hörten sie Charlie Parkers Platten, daneben aber auch Arnold Schönberg und vieles andere. Ende der 1940er Jahre fuhren sie regelmäßig nach New York, nahmen Unterricht bei Lennie Tristano und hörten danach dessen Trio auf der 52nd Street, als Vorband für Charlie Parkers Quintett.
1949 zog Woods ganz nach New York, schrieb sich erst an der Manhattan School of Music, dann an der Juilliard School für Klarinette ein, spielte in den Sommerferien für Striptease-Shows, machte sich aber zugleich einen Namen als Reed-Player, der sicher genug war, alles lesen zu können und zugleich die Fähigkeit zur Improvisation “im modernen Stil” besaß. Woods erzählt von Gigs mit Charlie Barnet und Friedrich Gulda, von ersten Begegnungen mit Alkohol und Drogen und von seiner ersten, gescheiterten Ehe. 1956 lud ihn Dizzy Gillespie in seine Bigband ein, mit der er fürs State Department durch den Nahen Osten reiste. Er spickt seine Erinnerungen an die Reise mit Briefausschnitten an seine Eltern und einem ausführlichen Bericht Marshall Stearns’ fürs Down Beat Magazin. Eine weitere Reise mit Gillespie führte kurz danach nach Südamerika.
Nach seiner Rückkehr lernte er Chan Parker kennen und lieben, und heiratete sie am 19. Mai 1957. Er erzählt vom Quintett, das er in den 1950er Jahren mit dem Tenoristen Gene Quill leitete, und vom Musical “Saint Louis Woman”, das Quincy Jones 1959 für eine Europa-Tournee wiederaufleben lassen wollte. Die Show, zu dessen Besetzung unter anderem Clark Terry, Benny Bailey, Åke Persson, Melba Liston gehörten, sollte in Paris ihre Premiere haben, war allerdings ein totaler Reinfall. Die Quincy Jones Bigband blieb in Folge eine Weile in Europa, tourte und festigte Jones Namen nicht nur als Arrangeur, sondern auch als Orchesterleiter.
1960 war Woods bei einer weiteren legendären Reise dabei, die die Benny Goodman Bigband hinter den Eisernen Vorhang führte, 32 Konzerte in Moskau, Sotschi, Tiflis, Tashkent, Leningrad und Kiew. Von dieser Reise gibt es zahlreiche erheiternde Anekdoten, von denen Woods einige zitiert, um dann noch eigene hinzuzufügen. Zurück in New York, spielte er eine Platte mit seinem Idol Benny Carter ein und begann zu unterrichten. Sowohl Woods wie auch Chan waren von Europa so fasziniert, dass sie entschieden 1968 nach Frankreich zu ziehen, wo Woods bald seine European Rhythm Machine gründete, ein Quartett mit jungen europäischen Musikern (Daniel Humair, Henri Texier, George Gruntz), das kreuz und quer durch den Kontinent reiste und auf Festivals große Erfolge feierte. Hier begann Woods auch elektronische Hilfsmittel einzusetzen, das Varitone beispielsweise, mithilfe dessen er den Sound seines Instruments verändern konnte.
Nach vier Jahren zog die Familie zurück in die USA, nach Los Angeles, wo sich Chan allerdings nicht sonderlich wohl fühlte und entschied mit den Kindern zurück nach Frankreich zu gehen. “Als sie ging, wusste ich, dass es vorbei war, und ich glaube, sie wusste das auch.” Woods erzählt von anderen Beziehungen und davon, wie er eines Tages erkannte, dass Jill Goodwin, die er in Kalifornien kennengelernt hatte, die Richtige sei, seine dritte und letzte Ehefrau. Er beschreibt die Genese seines amerikanischen Quartetts mit Hal Galper, Bill Goodwin und Steve Gilmore, zum Quintett ergänzt durch Tom Harrell, Hal Crook oder Brian Lynch. Er erzählt eindringlich vom Tod seiner Tochter Aimee durch Alkoholabusus, der ihm seine eigenen Suchterfahrungen vor Augen führte, und davon, dass er trotz aller Rückschläge ein gutes Leben hatte und stolz auf seine Musik und seine Familie sei.
Phil Woods’ Biographie ist eine schnelle und größtenteils kurzweilige Lektüre, gespickt mit Anekdoten, die den Humor des Saxophonisten auf fast jeder Seite durchscheinen lassen. Ted Panken ist es gelungen, das alles sinnvoll und lesenswert zusammenzubinden, wenn auch die letzten Kapitel etwas mühsam wirken, ein wenig, als sei alles auserzählt, aber die und die Namen müsse man nun auch noch nennen. Woods hält nicht zurück mit selbstkritischer Betrachtung insbesondere seines Privatlebens und seines Suchtverhaltens. Er weiß um seine “eigene” Stimme im Jazz, die so viele seiner Mitmusiker faszinierte, er weiß aber auch um das Glück als weißer Amerikaner von den Ausübenden einer afro-amerikanischen Kunstform als einer der Ihren angenommen worden zu sein. “Life in E Flat” lautet der passende Titel des Buchs, in dem man immer wieder den Respekt, die Offenheit und den Humor verspürt, die auch seine Musik ausmachen. Und es bleibt nicht aus, dass man seine Platten während der Lektüre dann auch immer wieder gerne auflegt.
Wolfram Knauer (Mai 2022)
Better Days Will Come Again. The Life of Arthur Briggs, Jazz Genius of Harlem, Paris, and a Nazi Prison Camp
von Travis Atria
Chicago 2020 (Chicago Review Press)
336 Seiten, 27,99 US-Dollar
ISBN: 9780914090106
 In den großen Geschichtsbüchern zum Jazz ist Arthur Briggs vor allem als Randnotiz verzeichnet. Er gehört mit zu jenen afro-amerikanischen Musikern, die in den 1920er Jahren durch Europa tourten und sich hier so wohl fühlten, dass sie blieben. Briggs war in der zweiten Hälfte der 1920er und in den 1930er Jahren in ganz Europa zu hören und galt als “Louis Armstrong von Paris”. Travis Atria, der bislang vor allem im Bereich populärer Musik in Erscheinung getreten ist, etwa einer Biographie von Curtis Mayfield, hat dem oft vergessenen Briggs jetzt ein Buch gewidmet, mit Genehmigung und Hilfe der Tochter des Trompeters, die ihm unter anderem die Memoiren ihres Vaters zur Verfügung stellte.
In den großen Geschichtsbüchern zum Jazz ist Arthur Briggs vor allem als Randnotiz verzeichnet. Er gehört mit zu jenen afro-amerikanischen Musikern, die in den 1920er Jahren durch Europa tourten und sich hier so wohl fühlten, dass sie blieben. Briggs war in der zweiten Hälfte der 1920er und in den 1930er Jahren in ganz Europa zu hören und galt als “Louis Armstrong von Paris”. Travis Atria, der bislang vor allem im Bereich populärer Musik in Erscheinung getreten ist, etwa einer Biographie von Curtis Mayfield, hat dem oft vergessenen Briggs jetzt ein Buch gewidmet, mit Genehmigung und Hilfe der Tochter des Trompeters, die ihm unter anderem die Memoiren ihres Vaters zur Verfügung stellte.
Die meisten Lexika schreiben, Briggs sei 1899 in Charleston, South Carolina, zur Welt gekommen. Tatsächlich, klärt Atria auf, kam der Trompeter wohl zwei Jahre später in St. Georges auf der britischen Karibikinsel Grenada zur Welt. Er erhielt klassischen Unterricht, sehr viel mehr aber ist nicht bekannt über die ersten 16 Jahre seines Lebens. Im November 1917 verließ Briggs seine Heimatinsel. Als er in New York durch die Passkontrolle ging, gab er seinen Beruf selbstbewusst als “Musiker” an. Er kam bei seiner Schwester in Harlem unter und freundete sich mit Gleichaltrigen an, und er begann sowohl seinen Akzent zu verlieren als auch seine Herkunft zu verschleiern. Die Kirche in der Nachbarschaft hatte eine Brassband, und deren Leiter war genauso überrascht wie begeistert, einen gut ausgebildeten, dazu noch notenfesten Trompeter mit klarem Ton zu bekommen. Briggs kannte sich im klassischen und semiklassischen Repertoire ein wenig aus, und er spielte für die benachbarte Tanzschule genauso wie für Begräbnisse. Durch die Musik kam er zum ersten Mal heraus aus Harlem und erlebte den Rassismus und die Segregation in anderen Teilen der USA. Amerika befand sich im Krieg, und James Reese Europe rekrutierte Musiker für eine Militärkapelle, mit der er den Kampf der Truppen in Europa unterstützen wollte, Briggs meldete sich und machte sich zwei Jahre älter. Travis Atria verortet Briggs im Harlem seiner Zeit, beschreibt die gesellschaftlichen Diskurse, Marcus Garvey, W.E.B. DuBois, das neue Selbstbewusstsein, das in Harlem für die afro-amerikanische Community und Kultur entstand. Neben Europe war auch der afro-amerikanische Komponist Will Marion Cook von Einfluss auf den jungen Briggs, in dessen Orchester Briggs auf erste große Tournee ging. Die führte ihn (und 50 weitere Künstler:innen) die gesamte Ostküste entlang und bis nach Chicago, das seinerzeit (noch vor 1920) das eigentliche Zentrum des noch jungen Jazz war. Hier hörte Briggs King Oliver und Freddie Keppard, hier traf er auch auf Sidney Bechet, mit dem er sich schnell anfreundete. Der Jazz hatte es ihm angetan, und Atria schildert, wie Briggs nach Akzent und Geburtsdatum nun auch noch den Rest seiner Biographie umschrieb, um besser ins Bild des afro-amerikanischen Jazzmusikers zu passen. Ein befreundeter Musiker hatte ihm von den Jenkins Orphanage Bands erzählt, die damals jährlich durch die USA tourten, um Geld für ihr Waisenhaus in Charleston zu sammeln. Das, fand Briggs, war doch eine passende Geschichte, und es sollte eine werden, die er bis zum Ende seines Lebens erzählte.
1919 reiste Briggs nach London, trat mit dem von Cook geleiteten Southern Syncopated Orchestra auf, dem auch Sidney Bechet angehörte und mit dem er sogar in den Buckingham Palace eingeladen wurde. Die Band tourte in wechselnden Besetzungen bis zum Herbst 1921, als neun Mitglieder bei einem Schiffsunglück in der Irischen See ums Leben kamen. Briggs hatte das Orchester zu dem Zeitpunkt bereits wieder verlassen und in London eine eigene Band gegründet. Er spielte mit den Five Jazzing Devils und den Five Musical Dragons; das Repertoire für die Dinnermusik im Murray’s Club enthielt internationale Folksongs, erst danach packte sie den heißen Jazz aus. Für eine Weile tourte er die belgischen Nordseebäder, kehrte dann im Sommer 1922 wieder zurück nach New York. Als er dort aber keinen Job fand und auch sonst vom alltäglichen Rassismus abgestoßen fühlte, schiffte er sich schnurstracks wieder ein, lebte einer Weile in Paris, dann in Brüssel, wo er die Savoy Syncops Band gründete, mit denen er auch in Paris und anderswo auftrat. Die Kunstwelt hatte damals eine Faszination für Afrika für sich entdeckt, und der schwarze Jazz schien wie ein Soundtrack dafür zu sein. Atria weiß über Geschichten der Halbwelt, in der sich der Jazz im Paris jener Jahre abspielte, und er beschreibt, dass es ja auch in Frankreich Rassismus gab, der sich aber von dem in den USA erheblich unterschied, eher von oben herab war als gewalttätig.
Der Jazz wandelte sich damals immer mehr zu einer Solistenkunst, und Briggs verstand sich als Botschafter dieser Musik in Europa. Er trat vor Pablo Casals in der Wiener Weihburg auf, war im Stummfilm “Das Spielzeug von Paris” zu sehen, und er reiste nach Istanbul und Ankara, wo seine Band u.a. für eine Party nach der Erhängung von zwölf politischen Dissidenten gebucht war. Im November 1926 reiste Briggs nach Berlin, und Atria teilt seine Erinnerungen an Auftritte im Club Barberina und im neueröffneten Valencia. In Berlin auch machte Briggs seine ersten Schallplattenaufnahmen, mit eigener Band genauso wie als Gast deutscher Besetzungen.
Zurück in Paris war Briggs nun bereits einer der Veteranen der Expatriates, jender amerikanischer Musiker also, die in Europa einen so großen Markt sahen, dass sie zumindest für eine Weile ihren Lebensmittelpunkt hierher verlegten. Briggs war gefragt, und als Noble Sissle, den er aus seinen Tagen mit James Reese Europe kannte, ihn bat, seine Tourneekapelle zu leiten, sagte er gern zu. Anfang der 1930er Jahre kaufte er sich ein Haus in einem noblen Vorort von Paris. Er begegnete Bricktop, der amerikanischen Sängerin und Pariser Nightclub-Besitzerin, Marlene Dietrich und Duke Ellington, der ihm einen Platz in seinem Orchester anbot, er erinnert sich an Louis Armstrong und seine Lippenprobleme Briggs, an Stéphane Grappelli, Django Reinhardt und den Hot Club de France, zu dessen Mitgründern er gehörte, an Coleman Hawkins und Josephine Baker. Von Paris aus reiste er kreuz und quer durch Europa, trat in Den Haag auf, dann in Cannes, dann sechs Monate lang in Kairo, wo er neben seinen Gigs auch zwei Monate lang ein Militärorchester im richtigen Swing-Feel coachte.
Die dunklen Wolken über Europa ziehen sich immer weiter zusammen, und zunehmend fügt Atria die politischen Ereignisse ein in sein Narrativ. Reichskristallnacht, Besetzung der Tschechoslowakei, Invasion Polens, Kriegserklärung. Das US-Konsulat kontaktierte alle Amerikaner in Paris und riet ihnen die Stadt zu verlassen. Briggs blieb, wohl auch, weil er mittlerweile eine Belgierin geheiratet hatte und sich ein gemeinsames (gemischtes) Leben mit ihr in den USA nicht vorstellen konnte. Als die Deutschen im Juni 1940 Paris eroberten, versteckte sich Briggs. Am 17. Oktober wurde er von den Nazis verhaftet, als er gerade mit seinem Hund draußen war. Zusammen mit anderen Amerikanern landete er erst im berüchtigten Camp vom Compiègne, dann im Stalag 220 in St. Denis, vor den Toren von Paris. Dorthin hatte ein Freund ihn beordert, der eine Lagerkapelle zusammengestellt hatte und wollte, dass Briggs die Blechbläser anführt.
Atria zitiert ausführlich aus Briggs’ Memoiren und kann dabei wenigstens bruchstückweise ein Repertoire der Band zusammenklauben. Für einen der Nazi-Komandeure spielte er “Alte Kameraden” und den “Radetsky-Marsch” und erhielt von diesem das Lob, er habe es nie für möglich gehalten, dass ein Schwarzer ein so guter Musiker sein könne, worauf Briggs ihm in die Augen geschaut und auf Deutsch geantwortet habe: “Es gibt viel Sachen, die man nicht kennen.” [Sic!] Die Winter waren hart, und etliche Gefangene starben an Lungenentzündung. Briggs Kapelle spielte Szenen aus Mozarts “Don Giovanni” und Beethovens “Egmont Ouvertüre”. Und am Ende eines jeden Konzerts spielte er den Negro Workshong “Better Days Will Come Again”. Die Nazis hatten keine Ahnung vom Text und konnten sich die Kraft, die von dem Song ausging nicht einmal im Entferntesten vorstellen. Winter 1943, Stalingrad, die Wärter in St. Denis werden brutaler. Nur die Musik, gemalte Bilder, Gedichte ließen die Gefangenen sich aus dem Stalag wegträumen. Das Rote Kreuz besuchte das Camp, das im Bericht fast human wirkt, insbesondere, wenn man es mit den Todeslagern Hitlers vergleicht. Aber auch in St. Denis wurde gestorben, gehungert, gefroren. Briggs erinnert sich, dass am Tag des Besuchs alle Insassen in ihre Kammern geschlossen wurden und das Rote Kreuz höchstens die Wärter gesehen haben könne.
Im August 1944 endete die deutsche Besatzung von Paris. Die Wachen verließen ihre Stellung, und die Gefangenen waren frei. Briggs kehrte in ein verändertes Paris zurück. In seinem Apartment wohnte jemand anders, niemand wusste, wo seine Frau war, seine eingelagerten Koffer waren verschwunden. Er suchte seine Freunde auf, begann wieder zu spielen. Er war jetzt 50, aber er fand kaum Musiker, mit denen er wirklich spielen wollte. Und so suchte er nach neuen spirituellen Ankern und wurde 1955 Freimaurer. Als er kurz darauf in einem Freimaurer-Magazin von 307.000 weißen, aber keinem einzigen schwarzen Freimaurern in den USA las, reichte es ihm, und er hielt einen Vortrag vor seiner Loge über den Rassismus in Amerika. Musikalisch hielt er sich mit Calypso und anderer vom Jazz der Zeit eher entfernten Musik über Wasser. Django Reinhardt war 1953 gestorben und Briggs war auf der Beerdigung; Sidney Bechet starb 1959 und Briggs war auf der Beerdigung. Mittlerweile hatte er zum zweiten Mal geheiratet, jetzt eine Französin, hatte eine Tochter, unterrichtete Saxophon, Trompete und Schlagzeug an einer Schule in Saint-Gratien. 1974 kehrte er noch einmal in die USA zurück, um beim 80sten Geburtstag seiner Schwester dabei zu sein. Zuhause aber war er in Paris; hier unterrichtete er noch bis 1984, dann ließ seine Gesundheit langsam nach. Er erblindete weitgehend und starb am 15. Juli 1991 an den Folgen einer Lungenkrebs-Erkrankung.
Travis Atria erzählt in seiner Biographien Arthur Briggs eine spannende Geschichte und kann dank der Memoiren des Trompeters etliche Lücken in seinem Leben füllen. Es gelingt ihm, die musikalische Karriere in die Weltläufte der Zeit einzupassen, und wenn er auch wenig über die Musik selbst schreibt, so erahnt man, insbesondere wenn man Briggs’ erhaltene Aufnahmen hört, wie wichtig seine Präsenz, auch über die dunkelsten Zeiten, für die französische Jazzszene gewesen war. “Better Days Will Come Again” ist ein absolut lesenswertes Buch, mit dem Atria Briggs Memoiren sorgfältig recherchierten Kontext gibt.
Wolfram Knauer (April 2021)
Heart Full of Rhythm. The Big Band Years of Louis Armstrong
by Ricky Riccardi
New York 2020 (Oxford University Press)
414 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-091411-0
 Ricky Riccardi ist “director of jazz collections”, also der Kurator der Sammlung des Louis Armstrong House Museum; darüber hinaus ist er öffentlich bekennender und überaus enthusiastischer Fan von Armstrongs Musik. Sein Blog (https://dippermouth.blogspot.com/) beleuchtet punktuell Aspekte in Satchmos Leben und Wirken. Seine Plattentexte etwa zu den hochwertigen Mosaic-Wiederveröffentlichungen aus diversen Phasen von Armstrongs Karriere werden zu Recht hoch gelobt. Sein erstes Buch befasste sich 2011 mit den “späten Jahren” des Trompeters, also mit den All-Stars der 1950er und 1960er und Pops’ Aufstieg (oder Abstieg, je nach Sichtweise) in die Welt der Pop- und Schlagermusik der Zeit. Tatsächlich war Armstrong allerdings immer schon ein Teil der populären Musik gewesen, wie Riccardi in seinem neuen Buch zeigt, das eine Periode im Schaffen des Trompeters dokumentiert, die in vielen Darstellungen seiner Kunst weitgehend ausgespart wird: die nämlich seiner Bigbandarbeit in den 1930er und 1940er Jahren. Es ist, wie der Klappentext betont, die Geschichte, die aus Armstrong den ersten “King of Pop” machte.
Ricky Riccardi ist “director of jazz collections”, also der Kurator der Sammlung des Louis Armstrong House Museum; darüber hinaus ist er öffentlich bekennender und überaus enthusiastischer Fan von Armstrongs Musik. Sein Blog (https://dippermouth.blogspot.com/) beleuchtet punktuell Aspekte in Satchmos Leben und Wirken. Seine Plattentexte etwa zu den hochwertigen Mosaic-Wiederveröffentlichungen aus diversen Phasen von Armstrongs Karriere werden zu Recht hoch gelobt. Sein erstes Buch befasste sich 2011 mit den “späten Jahren” des Trompeters, also mit den All-Stars der 1950er und 1960er und Pops’ Aufstieg (oder Abstieg, je nach Sichtweise) in die Welt der Pop- und Schlagermusik der Zeit. Tatsächlich war Armstrong allerdings immer schon ein Teil der populären Musik gewesen, wie Riccardi in seinem neuen Buch zeigt, das eine Periode im Schaffen des Trompeters dokumentiert, die in vielen Darstellungen seiner Kunst weitgehend ausgespart wird: die nämlich seiner Bigbandarbeit in den 1930er und 1940er Jahren. Es ist, wie der Klappentext betont, die Geschichte, die aus Armstrong den ersten “King of Pop” machte.
Mit solchen Metaphern sollte man vielleicht vorsichtig sein, doch können sie durchaus bei der Positionsbestimmung helfen. Die Position des King of Pop habe Armstrong ja bereits innegehabt, bevor Michael Jackson geboren wurde, zitiert Riccardi den Trompeter Nicolas Payton, der die Genreeingrenzungen des Begriffs Jazz eh in Frage stellt und Satchmo stattdessen auch im Kontext der Popmusik des 20sten Jahrhunderts sieht, “einflussreicher als die Beatles oder Michael Jackson zusammen”. Es ist also diese Dichotomie zwischen Jazzkünstler und Popstar, die Riccardi in seinem neuen Buch interessiert. Daneben will er aber auch mit dem jahrzehntelangen Urteil aufräumen, Armstrongs Bigbandaufnahmen seien ein Verrat am Jazz gewesen. Satchmo habe sich ja nie einem klar umschriebenen und damit eingrenzenden “wahren Jazz” verpflichtet gefühlt, sondern eher einer Spielhaltung, die es ihm seit jungen Jahren ermöglichte, seinen eigenen Stil beizubehalten, unter welchen Labels seine Musik auch immer gerade verkauft wurde.
Riccardis Buch beginnt mit den letzten Aufnahmen der Hot Five-Phase des Trompeters, jener nämlich in der Armstrong sich bewusst auf das Feld der populären Musik begab, und folgt ihm auf seinem Weg zu einem internationalen Superstar, der beim weißen Publikum genauso beliebt war wie er eine Identifikationsfigur in der schwarzen Community blieb. Er stützt sich auf Aufnahmen, Notizbücher, Tonbänder und andere Hinterlassenschaften Satchmos, die sich im Archiv des Armstrong House finden. Zugleich stützt er sich aber auch auf seine immense Kenntnis, zusammengetragen durch seine tägliche Arbeit, seinen Enthusiasmus und durch Gespräche mit Zeitzeugen.
Armstrong wurde bereits in den 1920er Jahren als herausragender Musiker gefeiert, tatsächlich aber waren die meisten seiner Aufnahmen von reinen Studiobands getätigt worden. Live spielte er mit verschiedenen Ensembles, im März 1929 beispielsweise im Savoy Ballroom in New York mit dem Orchester des Pianisten Luis Russell. In New York hatte man ihn, der die letzten Jahre vor allem in Chicago tätig war, nicht ganz so auf dem Schirm, aber nach diesem Konzert wurde er als “neuer König” des Jazz gefeiert. Es gab jede Menge anderer Trompeter, die hoch und virtuos spielen konnten, aber während deren Töne im höchsten Register eher wie eine Flöte klangen, spielte Satchmo dort “richtige Töne. Da quietschte nichts” – erinnert sich Altsaxophonist Charlie Holmes.
Armstrongs Wirkung aufs Publikum fiel aber nicht nur seinen Mitmusikern auf, sondern auch Tommy Rockwell, der seit 1927 den Popmusik-Katalog von OKeh Records betreute und entschied, Satchmo könne über den schwarzen Markt hinaus die Menschen ansprechen. Rockwell ließ den Trompeter von einem größeren Ensemble begleiten, mit Arrangements von Don Redman oder Alex Hill, und er initiierte jene Session im März 1929, bei der mit “I Can’t Give you Anything But Love” Armstrongs Popmusikkarriere begann. “Armstrong behielt das Gefühl des ursprünglichen Textes bei, gab dem Ganzen aber außerdem eine Leidenschaft, wie man sie in den Pop-Vocals der späten 1920er Jahre nicht fand”, beschreibt Riccardi den Effekt.
Er habe sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Musikercommunity eine enorme Glaubwürdigkeit besessen. Schnell wurde aus dem Plattenstar ein Bühnenstar, der nicht mehr stationär vor allem in Chicago oder New York zu erleben war, sondern anfing zu touren und die Säle zu füllen. Riccardi blickt hinter die Aktivitäten, erzählt von John Collins, dem oft als zwielichtig beschriebenen Manager, der Satchmo in der ersten Hälfte der 1930er Jahre vertrat. Riccardi zeichnet das Geschäftsverhältnis der beiden (oder drei, denn Tommy Rockwell war immer noch für die Aufnahmen zuständig) eindrücklich nach, und beleuchtet einige lang überlieferte Legenden, etwa zur Verhaftung Armstrongs wegen Drogenbesitzes oder zu einem Erpressungsversuch, den Collins mit seinen Verbindungen klärte. Er folgt Satchmo auf seiner ersten Tournee durch die amerikanischen Südstaaten, die von Schwierigkeiten mit der amerikanischen Musikkergewerkschaft überschattet war, ihn aber auch erstmals zurück in seine Heimatstadt New Orleans brachte. Er zitiert Musikerkollegen, sieht sich einige der kurzen Musikfilme an, die Satchmo in jenen Jahren machte und stellt den begeisterten auch die kritischen Reaktionen dazu gegenüber. Riccardi selbst hält sich bei der ästhetischen Einordnung größtenteils zurück; sein Maßstab ist Armstrong selbst, sind die Notizen und Erinnerungen, die sich im Armstrong Archive finden.
Im Juli 1932 nahm Satchmo eine Einladung nach London an, und Riccardi weiß von der Überraschung des britischen Publikums ob des Unterschieds zwischen Platte und Live-Erlebnis genauso wie von den Schwierigkeiten, etwa eine angemessene Begleitband zusammenzustellen. Im November ging es zurück nach New York, aber der Empfang, den er in Europa erlebt hatte, hatte Satchmo so beeindruckt, dass er schon im nächsten Jahr zurückkehrte. Jetzt blieb er fast zwei Jahre, und Riccardi berichtet von den Hochs und Tiefs dieses Besuchs, von grandiosen Konzerten und fehl-gemanagten Tourneen, von Lippen- und Ansatzproblemen. Später erzählte Satchmo, dass er sein Instrument ein halbes Jahr nicht angefasst habe und dann wie ein Anfänger ganz neu beginnen musste.
Zurück in den USA war dieser Neubeginn auch mit einem neuen Manager verbunden, Joe Glaser, einem früheren Autoverkäufer und Hundezüchter, der während der Prohibition in Chicago eine Reihe an Bordellen besaß, in denen er seine ersten Erfahrungen mit dem Showbusiness machte. Glaser sorgte dafür, dass Armstrong für das nächste Jahrzehnt vom Orchester von Luis Russell begleitet wurde, und Riccardi führt uns durch die Aufnahmesessions, weiß Details zu Bühnenshows, Filmclips oder zur Fleischmann’s Yeast Radioshow. Er diskutiert das damals bereits empfindliche Minenfeld einer angemessenen Repräsentation von Afro-Amerikanern in den Medien, lässt uns an den Diskursen der Zeit teilhaben, die er insbesondere auf Armstrongs Position fokussiert. Show für Show, Aufnahmesession für Aufnahmesession erklärt Riccardi das Repertoire, die Gründe für stilistische Entscheidungen, die Diskussionen über kommerziellen und künstlerischen Erfolg der resultierenden Platten.
In den 1940er Jahren hatte Armstrong wie andere auch mit der sich wandelnden Musikindustrie zu kämpfen, die nicht nur durch den Aufnahmebann der American Federation of Musicians ins Schlingern gekommen war. Für einige wirkte er wie ein Zeugnis einer früheren Zeit, doch blieb seine Popularität ungeschmälert: Satchmo erreichte nach wie vor ein großes Publikum. In seiner medialen Omnipräsenz gelang es ihm anfangs noch, seinen Respekt zu den Ursprüngen des Jazz genauso zu betonen wie seine Neugier auf jüngste musikalische Entwicklungen. Als dann allerdings insbesondere die Presse eine vermeintliche Konkurrenz zwischen den ästhetischen Idealen Armstrongs und des Bebops aufzubauen, Armstrong also beispielsweise gegen Dizzy Gillespie auszuspielen, konnte Satchmo nicht länger an sich halten. Er äußerte sich öffentlich; vor allem aber wurden seine All Stars zu einem ästhetischen Statement, das ihm die Popularität rettete, allerdings auf einem ganz anderen stilistischen Feld, als er es die letzten 20 Jahre bedient hatte.
Ricky Riccardis gelingt es in seinem Buch die vielen Nebenkriegsschauplätze, die er beschreibt, für seine Leser:innen richtig einzuordnen. Den Laien mag die Informationsfülle stellenweise vielleicht verwirren; die Fans und Experten aber erinnert Riccardi daran, dass alle Legenden um den Trompeter und Sänger in seiner Musik ihren Ursprung haben, dass andererseits zum Verständnis seiner musikalischen Ästhetik das Wissen um den Kontext unerlässlich ist. “Heart Full of Rhythm” ist damit ein Standardwerk über Louis Armstrong’s Wirken der Jahre 1929 bis 1947.
Wolfram Knauer (März 2021)
A Rediscovered Trio. Down Memory Lane with the Green Book Cellist and an Apprentice
von Evelin Täht & Atro Mikkola
Estland 2020 (Pappus)
127 Seiten, 9,99 Euro
ISBN: 9789916400982
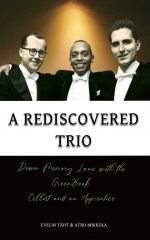 Der 2018 erschienene Film “Green Book” wurde einerseits gefeiert und mit drei Oscars ausgezeichnet, andererseits kritisiert, weil er sowohl die Autobiographie des darin dargestellten Konzertpianisten Donald Shirley verfälscht und überhaupt die Realität des Rassismus in den USA der frühen 1960er Jahre vereinfacht dargestellt habe. Der Film jedenfalls, schreibt die Autorin Evelin Täht, habe sie ermuntert, einen Teil ihrer eigenen Familiengeschichte zu erzählen, die Geschichte nämlich ihres Schwiegervaters, des 1926 in Estland geborenen Cellisten Jüri Täht, der Anfang 1951 fürs Studium in die USA ging. 1957 wurde Juri Taht, wie er amerikanisiert hieß, von Donald Shirley für sein neues Trio verpflichtet, dem er bis 1983 angehörte und mit dem er auch danach noch einige Jahre regelmäßig in der Carnegie Hall auftrat. Der zweite Autor des Buchs, der Kontrabassist Arto Mikkola, stammt aus Finnland, lebte ab 1985 in den Vereinigten Staaten, und lernte Donald Shirley in dn 1990er Jahren kennen, als dieser ihn zu sich einlud und ihm in einer Art Privatunterricht seine musikalischen und ästhetischen Ansichten nahebrachte.
Der 2018 erschienene Film “Green Book” wurde einerseits gefeiert und mit drei Oscars ausgezeichnet, andererseits kritisiert, weil er sowohl die Autobiographie des darin dargestellten Konzertpianisten Donald Shirley verfälscht und überhaupt die Realität des Rassismus in den USA der frühen 1960er Jahre vereinfacht dargestellt habe. Der Film jedenfalls, schreibt die Autorin Evelin Täht, habe sie ermuntert, einen Teil ihrer eigenen Familiengeschichte zu erzählen, die Geschichte nämlich ihres Schwiegervaters, des 1926 in Estland geborenen Cellisten Jüri Täht, der Anfang 1951 fürs Studium in die USA ging. 1957 wurde Juri Taht, wie er amerikanisiert hieß, von Donald Shirley für sein neues Trio verpflichtet, dem er bis 1983 angehörte und mit dem er auch danach noch einige Jahre regelmäßig in der Carnegie Hall auftrat. Der zweite Autor des Buchs, der Kontrabassist Arto Mikkola, stammt aus Finnland, lebte ab 1985 in den Vereinigten Staaten, und lernte Donald Shirley in dn 1990er Jahren kennen, als dieser ihn zu sich einlud und ihm in einer Art Privatunterricht seine musikalischen und ästhetischen Ansichten nahebrachte.
Alles in allem also eine Ausgangslage, die ein spannendes Buch verspricht, das Shirley als Mittler zwischen den Welten populärer und klassischer Musik sowohl biographisch wie auch musikalisch näherbringen könnte. Diese Erwartung erfüllt “A Rediscovered Trio” allerdings nicht einmal ansatzweise, und Autorin Evelin Täht weiß selbst, warum das so ist, wenn sie gleich zu Beginn warnt: “Da ich weder Schriftstellerin noch Musikerin bin, mag es sein, dass mein Text ein bisschen roh und unkonventionell ausfällt.” Man hat diese Entschuldigung also von der ersten Seite an im Hinterkopf, erinnert sich an sie, wenn biographische Stationen wiederholt erwähnt werden, wenn Sprünge das Verfolgen des chronologischen Verlaufs kaum nachvollziehbar machen, wenn “Green Book” mal als Referenz zur biographischen Erzählung herangezogen, dann wieder auf dessen nicht-biographischen Ansatz verwiesen wird, wenn ganze Themenbündel (Homosecualität, Alltagsrassismus in den USA der 1960er Jahre) entweder gänzlich ausgeklammert oder aber nur am Rande behandelt werden. Die Autorin verlässt sich auf die ihr zugänglichen Quellen, auf die Erinnerungen ihres Schwiegervaters also, auf Zeitungsausrisse, auf einen seinerzeit nicht veröffentlichten Nachruf Shirleys von Michiel C. Kappeyne van de Coppelo. Sie stellt keine weiteren Recherchen an, spricht nicht mit anderen Zeitzeugen, und versäumt es fast gänzlich die biographische Erzählung zu kontextualisieren. Damit wird sie am Ende weder Donald Shirley noch ihrem Schwiegervater gerecht, dessen Unmut darüber, in den USA oft als “Russe” identifiziert worden zu sein, sie ja sogar dazu motiviert hatte, ihrem Buch einen zusammenhanglosen Einschub des Historikers Mairo Rääsk über die Geschichte der esthnischen Opfer im Zweiten Weltkrieg und unter Stalin voranzustellen.
Im zweiten Teil des Buchs erzählt Arto Mikkola von seiner Begegnung und seinen Gesprächen mit dem Pianisten. Im Unterkapitel “The Musical Concept – Transcription” will er Shirleys musikalischen Ansatz analytisch erklären, bleibt seinem Lehrer dabei aber gedanklich viel zu nah. Eine objektive Sichtweise ist ihm nicht möglich, auch gelingt es ihm nicht, Shirley in die ästhetischen Welten von Jazz einerseits, der klassischen Musik andererseits einzuordnen und daraus seine Besonderheit zu erklären, wie sich nämlich in seiner Kunst Repertoire, Interpretation, Performance und gesellschaftliche Funktion von Musik gegenseitig befruchten.
“A Rediscovered Trio” war ursprünglich als Ehrung für den Schwiegervater gedacht, den Cellisten Juri Taht, und vielleicht hätte Evelin Täht es dabei bewenden lassen sollen. Eine breitere Veröffentlichung benötigt einfach die sorgfältige Recherche und vielleicht auch den Lektor, der auf Schlüssigkeit, Lesbarkeit und Kontext pocht. Ein wenig, das lesen Sie vielleicht zwischen den Zeilen durch, verärgert solch ein Mangel an Weitsicht, weil nämlich Geschichten nicht unendlich oft erzählt werden können. Ihre Chance haben die Autoren jedenfalls gründlich vertan; nach der Lektüre bleibt man mit mehr Fragen zurück als man zu Beginn des Buchs hatte.
Wolfram Knauer (März 2021)
Fallen from the Moon. Robert Edward Juice Wilson. His Life on Earth. A Dossier
von Anthony Barnett
Lewes/East Sussex 2020 (Allardyce Book ABP)
92 Seiten, 25 Euro
ISBN: 978-0-097954-68-2
http: www.abar.net/moon.pdf
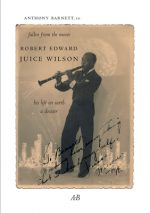 Es gibt nur zwei Soli von Juice Wilson auf Platte, beide aufgenommen 1929 mit Noble Sissles Orchester in England: “Kansas City Kitty” und “Miranda”. Es gibt Aussagen von Kollegen, die ihn als den größten Jazzgeiger bezeichnen, der je gelebt habe. Es gibt wenige biographische Details – geboren 1904 in St. Louis, gestorben 1972 in Chicago, zwischen 1929 und 1963 vor allem in Europa aktiv. Erinnerungen. Es gibt Pressenotizen, die ihn oft nur am Rande erwähnen, Gerüchte und Spekulationen. Anthony Barnett hat sich wahrlich kein einfaches Sujet gewählt für sein neuestes Buch. Barnett ist, wenn man so will, ein Jazzviolin-Historiker. Er gab das Magazin Fable heraus, das sich bekannten sowie oft vergessenen Vertretern dieses Instruments widmete, und hat Bücher über Eddie South, Stuff Smith und andere insbesondere afro-amerikanische Jazzgeiger geschrieben. Für das Buch zu Juice Wilson aber bezeichnet er sich selbst nur als “Editor”, als Herausgeber. Zu disparat sind die Quellen, die er präsentiert und die er nebeneinander stehen lässt, wie die Teile eines Puzzles, das ein ganzes Bild erahnen lässt. Also verzichtet er auf verbindende Worte und lässt stattdessen die Vergangenheit sprechen.
Es gibt nur zwei Soli von Juice Wilson auf Platte, beide aufgenommen 1929 mit Noble Sissles Orchester in England: “Kansas City Kitty” und “Miranda”. Es gibt Aussagen von Kollegen, die ihn als den größten Jazzgeiger bezeichnen, der je gelebt habe. Es gibt wenige biographische Details – geboren 1904 in St. Louis, gestorben 1972 in Chicago, zwischen 1929 und 1963 vor allem in Europa aktiv. Erinnerungen. Es gibt Pressenotizen, die ihn oft nur am Rande erwähnen, Gerüchte und Spekulationen. Anthony Barnett hat sich wahrlich kein einfaches Sujet gewählt für sein neuestes Buch. Barnett ist, wenn man so will, ein Jazzviolin-Historiker. Er gab das Magazin Fable heraus, das sich bekannten sowie oft vergessenen Vertretern dieses Instruments widmete, und hat Bücher über Eddie South, Stuff Smith und andere insbesondere afro-amerikanische Jazzgeiger geschrieben. Für das Buch zu Juice Wilson aber bezeichnet er sich selbst nur als “Editor”, als Herausgeber. Zu disparat sind die Quellen, die er präsentiert und die er nebeneinander stehen lässt, wie die Teile eines Puzzles, das ein ganzes Bild erahnen lässt. Also verzichtet er auf verbindende Worte und lässt stattdessen die Vergangenheit sprechen.
In Barcelona macht man sich Mitte der 1940er Jahre Gedanken darüber, was wohl mit Juice Wilson geschehen sei. Man habe von diesem hochmusikalischen Künstler mit Poesie und Charme, mit der Gabe der Überraschung, seit acht Jahren nichts mehr gehört. Angeblich sei er 1938 nach Malta gezogen, habe davor mit verschiedenen, wenig bekannten Ensembles in ganz Europa gespielt und eine Weile in Barcelona gewohnt. Der Kritiker Antonio Tendes habe ihn in Spanien gehört, 1932 oder ein wenig später, und eigentlich habe er damals wenig Eindruck auf ihn gemacht. Er habe die ganze Zeit über Altsaxophon gespielt, das er bei weitem nicht so gut beherrschte wie die Geige. Auf der aber sei er ein Meister gewesen, voller Wärme und Gefühl. Auch am Klavier habe er seine spanischen Mitmusiker beeindruckt, nicht so sehr durch seine Technik als durch den harmonischen Ansatz. Sein Repertoire habe vor allem aus den Klassikern des Jazz bestanden. Er sei nicht gerade gesellig gewesen und habe unter Heimweh gelitten, das er oft genug in Alkohol ertränkte. Sie hätten gern in einem Plattenladen auf der Rambla abgehangen, wo ihm die Aufnahmen Fletcher Hendersons besser gefielen als die Ellingtons oder Luncefords. Und dann sei er einfach verschwunden, und niemand wusste, wo er abgeblieben war.
Ein ausführlicheres biographisches Portrait aus der Feder Alec Boswells erschien 1946 in der britischen Zeitschrift Jazz Music, außerdem erinnert sich der Gitarrist Nevil Skrimshire an seine Begegnung mit Wilson in Malta, wo Wilson gut 20 Jahre lang gelebt hat, und Barnett druckt Auszüge aus der Korrespondenz zwischen Boswell und Charles Denaunay sowie zwischen Boswell, Nevil Skrimshire und ihm, Anthony Barnett, ab, die weitere Details zutage fördern. Auch andere Zeitzeugen erinnern sich an Wilsons Zeit in Malta, und Fotos zeigen ihn in Jimmy Dowlings Orchester, der Ende der 1940er Jahre auch für Prinzessin Elisabeth und Prinz Philipp zum Tanz aufspielte. In den USA erinnerte man sich 1942 kurz an ihn, als die New York Amsterdam News berichten, Lionel Hampton sei ein Bewunderer des Geigers und habe lange nach ihm gesucht. Schließlich kommt Juice Wilson aber auch selbst zu Wort, in einem Interview für das Bulletin du Hot Club de France von 1962. Darin erzählt er von seinem Kindheitsfreund Eddie South, von seiner Bewunderung für den Klarinettisten Darnell Howard und von seinem Ideal eines beidhändigen Klavierspiels. Um 1960 arbeitete Wilson im Safari Club in Tanger, danach zog es ihn nach Paris, und um 1962 spielte er als Altsaxophonist in Jean Marie Masses Hot Club de Limoges. Ein Jahr später ging er schließlich zurück nach Chicago.
Barnetts kleines Büchlein öffnet ein Fenster ins Leben und Wirken dieses afro-amerikanischen Musikers, der den Krieg über in Europa blieb und sich insbesondere in Malta einen Namen machte. Zusammen mit den beiden einzigen auf Platte veröffentlichten Geigensoli macht seine Geschichte neugierig auf die Entwicklung seines Stils sowie darauf, welchen Einfluss wohl Europa auf ihn als Künstler gehabt haben mag. All das aber wäre Spekulation, was erklärt, warum Barnett sich lieber auf größtenteils unkommentiert präsentierte Fakten und Dokumente beschränkt. Diese wiederum lassen den Musiker Juice Wilson wie auf einem stark vergilbten Foto erstehen, auf dem man einiges deutlich erkennt, anderes zu erkennen vermeint, während man an anderen Stellen nur noch Fragen hat. Auch so etwas also kann Jazzforschung produzieren, eine Studie, der es weniger um die Antworten geht als um das Eingrenzen von Fragen, die selbst dann deutlich werden, wenn der Autor sie gar nicht selbst stellt.
Wolfram Knauer (März 2021)
Stratusphunk. The Life and Works of George Russell
von Duncan Heining
Framlingham, Suffolk 2020 (Jazz Internationale)
345 Seiten, 14,99 Britische Pfund
ISBN: 9798697792612
 Mit “Stratusphunk” legt Duncan Heining die zweite Ausgabe seiner Biographie des Komponisten und Theoretikers George Russell vor, die ursprünglich vor zehn Jahre beim amerikanischen Verlag Scarecrow Press erschienen war. Die Neuauflage enthält Änderungen, darunter eine etwas ausführlichere Diskussion des von Russell entwickelten Lydian Chromatic Concept. In der ersten Ausgabe, erklärt Heining, habe er noch verschwiegen, dass der 2009 verstorbene Russell zum Zeitpunkt seiner Recherchen und Interviews bereits an Folgen einer fortschreitenden Demenz litt. Russell habe damals mit Hilfe seiner Partnerin weiter gearbeitet; durch eine Offenlegung seiner Erkrankung seien seine Einnahmen gefährdet gewesen. Beim Verfassen seines Buchs hätten insbesondere die zahlreichen Mythen im Weg gestanden, schreibt Heining, die Russell über die Jahre zum Teil selbst über seine Biographie pflanzte und die er als Biograph so weit wie möglich klären wollte.
Mit “Stratusphunk” legt Duncan Heining die zweite Ausgabe seiner Biographie des Komponisten und Theoretikers George Russell vor, die ursprünglich vor zehn Jahre beim amerikanischen Verlag Scarecrow Press erschienen war. Die Neuauflage enthält Änderungen, darunter eine etwas ausführlichere Diskussion des von Russell entwickelten Lydian Chromatic Concept. In der ersten Ausgabe, erklärt Heining, habe er noch verschwiegen, dass der 2009 verstorbene Russell zum Zeitpunkt seiner Recherchen und Interviews bereits an Folgen einer fortschreitenden Demenz litt. Russell habe damals mit Hilfe seiner Partnerin weiter gearbeitet; durch eine Offenlegung seiner Erkrankung seien seine Einnahmen gefährdet gewesen. Beim Verfassen seines Buchs hätten insbesondere die zahlreichen Mythen im Weg gestanden, schreibt Heining, die Russell über die Jahre zum Teil selbst über seine Biographie pflanzte und die er als Biograph so weit wie möglich klären wollte.
Kurz vor der Veröffentlichung der ersten Ausgabe zeigte sich Russell besorgt. Es gäbe da eine Geschichte aus seiner Jugend, die er nicht im Buch haben wolle: Ein weißer Bassist, Freund der Familie, war damals von zwei ebenfalls weißen Männern geschlagen worden, offenbar Polizeibeamten, weil er mit Schwarzen verkehrte. Jetzt also wollte Russell diese Geschichte aus dem Manuskript streichen, aus Furcht, wie Bürger und Offizielle in Cincinnati, wo das alles geschehen war, auf sie reagieren würden. Für Russell, schreibt Heining, habe die Entdeckung des Lydian Chromatic Concept im Mittelpunkt der Arbeit an dem Buch gestanden; und so haber er nicht verstanden, warum die Leser an irgendwelchen halbgaren Geschichten aus seiner Jugend interessiert sein sollten. Für Heining, den Biographen, allerdings waren eben auch die Umstände wichtig, die den Menschen und Künstler Russell prägten. Die Geschichte jedenfalls erklärt viel über Heinings Herangehensweise an das Buch: reflektiert, mit Respekt vor dem Subjekt und seiner Haltung gegenüber der Musik, zugleich mit einem kritischen Bewusstsein gegenüber all den Informationen, die er bei seinen Recherchen sammelte, in Archiven, von Zeitzeugen oder gar von Russell selbst.
Bereits die Umstände seiner Geburt im Juni 1923 seien nicht gänzlich klar, weiß Heining. Seine Mutter gebar George unter einem Pseudonym und gab ihn danach zur Adoption frei. So wuchs Russell bei Adoptiveltern auf, einer Krankenschwester und einem Koch für die Eisenbahngesellschaft. Er erinnert sich an Rassismus-Erfahrungen seiner Jugend, und an Strategien, die er entwickelte, um diesen zu begegnen, und Heining ergänzt all dies mit seinen Recherchen über Alltagsrassismus in Cincinnati. Erst im Alter von 12 Jahren erfuhr Russell von der Adoption; seine Adoptivmutter identifizierte seinen leiblichen Vater als einen weißen Musikprofessor am Oberlin College und seine Mutter eine hellhäutige schwarze Studentin aus reichem Hause. Diese Geschichte sei nirgends zu verifizieren, erklärt Heining, es sei aber interessant zu verfolgen, wie Russell sie über die Jahre immer wieder erzählte und dabei quasi sein musikalisches Talent den Genen seines weißen Vaters zuschrieb.
Heining beschreibt Russells Weg zur Musik, Einflüsse auf ihn und frühe musikalische Begegnungen, seine Tuberkulose-Erkrankung, die Musikszene von Cincinnati, in der Russell seine ersten professionellen Erfahrungen sammelte, sein Studium an der Wilberforce University. In den Anfangstagen spielte Russell Schlagzeug, und als Schlagzeuger wurde er 1943 von Benny Carter angeheuert, mit dessen Orchester er zum ersten Mal nach New York und ebenfalls zum ersten Mal mit dem Bebop in Kontakt kam. Carter war von seinen Instrumentalkünsten nicht ganz so überzeugt, und als Russell nach kurzer Zeit gefeuert wurde, nahm er dies als Chance sich lieber dem musikalischen Metier zu widmen, das er um einiges spannender fand: der Komposition. Er schrieb “New World”, ein Arrangement, das er nacheinander an Benny Carter, Cab Calloway, Earl Hines und Dizzy Gillespie verkaufte. Er beschäftigte sich mit dem Werk klassischer Komponisten wie Claude Debussy und Maurice Ravel, deren Einflüsse sich etwa in einigen seiner Arrangements niederschlugen, die er bald für Earl Hines’ Orchester in Chicago verfasste.
Zurück in New York freundete er sich mit den jungen Beboppern an und entwickelte, als er erneut 15 Monate mit Tuberkulose im Krankenhaus zubringen musste, die Grundidee seines Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, dessen Bedeutung Heining folgendermaßen zusammenfasst: “It increases the range of musical choices for improviser and composer and, perhaps more importantly, it was based on observation of the actual practice of jazz musicians” (64). Auslöser zur Entwicklung seiner Theorie sei eine Bemerkung Miles Davis’ gewesen, der ichm gesagt habe: “Wo willst Du musikalisch eigentlich hin? Ich jedenfalls will alle Changes lernen.” Weihnachten 1946 wurde Russell aus dem Krankenhaus entlassen und lebte eine Weile bei der Familie Max Roachs. Er nahm Kompositionsunterricht bei Stefan Wolpe, und er schrieb mit “Cuban-Be, Cubano-Bop” für Dizzy Gillespies Bigband und den Perkussionisten Chano Pozo seine erste modale Komposition.
Heining folgt Russells Karriere und seine kompositorische Entwicklung, von “A Bird in Igor’s Yard”, das er für die Band des Klarinettisten Buddy DeFranco schrieb, über die Gruppe an Musikern, die mit Miles Davis an dessen “Birth of the Cool”-Konzept arbeitete, seine Zusammenarbeit mit Lee Konitz, für dessen Sextett (mit Miles Davis) er “Ezz-thetic” und “Odjenar” schrieb, über Nicht-Musiker-Jobs im Warenhaus Macy’s oder als Koch in verschiedenen Diners der Stadt bis hin zur Veröffentlichung seines “Lydian Chromatic Concept” 1953 im Selbstverlag. Das Buch verkaufte sich nicht besonders gut, die Idee dahinter allerdings, dass man sein Tonmaterial nämlich aus Skalen beziehen könne statt sich auf die Akkordstrukturen der Improvisationsgrundlage zu fokussieren, sprach sich in Musikerkreisen schnell herum.
Russell war nicht der einzige Musiker der Avantgarde-Jazzszene, der sich mit Musiktheorie befasste oder der versuchte Erkenntnisse der klassischen Musikwelt mit den improvisierten Traditionen des Jazz zu verbinden. 1956 stellte Teddy Charles für Atlantic Records ein Album zusammen, das Auftragskompositionen verschiedener avancierter Komponisten enthielt und für das Russell “Lydian M-1” schrieb. Kurz darauf gründete er “The Jazz Workshop”, eine Band mit dem Saxophonisten Hal McKusick und dem Pianisten Bill Evans, die eine Reihe seiner Stücke einspielte, teils unter seinem, teils unter McKusicks Namen. Er schrieb Arrangements für Sängerinnen wie Marilyn Moore und Lucy Reed, und er war einer von sechs Komponisten, die 1957 von der Brandeis University um eine Auftragskomposition im damals noch nicht so genannten Third Stream-Genre gebeten wurden. Heining zeichnet die Szene der im Third Stream aktiven Musiker nach, allen voran Gunther Schuller und John Lewis, und er berichtet von der Überraschung, die Russell verspürte, als er beim Besuch der Lenox School of Jazz zum ersten Mal Ornette Coleman hörte. “Ich dachte, ich kannte mich ziemlich gut aus mit den verschiedenen Kategorien, aber da wurde mir klar, dass ich eine Kategorie ausgelassen hatte. Ich nannte sie Supra-Vertical Tonal Gravity” (112).
Heining erzählt, wie es 1958 zur Aufnahme von “New York, N.Y.” kam, “einer der am ehesten zugänglichen Platten Russells”, wie er schreibt (117), und er widmet “Jazz in the Space Age” ein eigenes Kapitel, jener Platte, die Russell 1959 mit Bill Evans und Paul Bley aufnahm und in dessen dreiteiligem “Chromatic Universe” er sein Lydian Concept in der Praxis beweisen wollte. Anfang der 1960er Jahre entschloss Russell sich eine eigene Band zu gründen, in der er selbst Klavier spielte. Ihr gehörten über die Jahre David Baker an und Don Ellis, Eric Dolphy und Steve Swallow, später auch Thad Jones und Barre Phillips. Heining beschreibt, wie Russell, der von 1964 bis 1969 in Europa lebte, sich in diesen Jahren zusehends von der schwarzen Avantgarde in den USA und insbesondere der politischen Haltung einzelner ihrer Vertreter entfremdete, zum Beispiel in einer Debatte insbesondere zwischen ihm und Archie Shepp, die offen in den Seiten des Down Beat ausgetragen wurde.
Heining betrachtet Russells Arbeit in den 1960er Jahren vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Bereich der Neuen Musik genauso wie in Bezug auf den Einfluss, den sie auf europäische, insbesondere aber skandinavische Musiker wie Jan Garbarek oder Palle Mikkelborg hatte. Als Gunther Schuller Ende der 1960er Jahre das Third Stream Department am New England Conservatory gründete, holte er Russell als Lehrer für Komposition und Theorie nach Boston, und Heining spricht mit einigen seiner Schüler wie Ricky Ford, Fred Hersch, Don Byron, Satoko Fujii, Marty Ehrlich, John Medeski über ihre Erinnerungen an seinen Unterricht. Russell komponierte weiter, unter anderem “Living Time” for Bill Evans, Auftragskompositionen und Wiederaufnahmen früherer Werke, vor allem aber konzentrierte er sich ab Mitte der 1970er Jahre aufs Unterrichten. 2004 setzte er sich von seiner Lehrtätigkeit zur Ruhe, wurde auf Tourneen oder im Kennedy Center weiterhin als Elder Statesman des Jazz gefeiert. Am 27. Juli 2009 starb er im Alter von 86 Jahren in Boston.
Heinings Quellen sind eigene Interviews mit Russell und anderen Zeitzeugen sowie ausführliche Interviews mit seinem Sujet, die etwa die Musikethnologin Vivian Perlis oder der Trompeter und Jazzhistoriker Ian Carr geführt hatten. Heining benutzt all das wie Oral-History-Quellen, wobei er vergleichbare Stellen gern nebeneinander setzt, um Konsistenzen genauso wie Inkonsistenzen aufzuzeigen. Er erklärt Kontexte und füllt die Lücken der Interviews mit anderweitig recherchierten Fakten auf. Und er bewertet, insbesondere wenn es um Rassismus-Erfahrungen des jungen Russells geht, die er gern mit moralisch klingenden Sätzen begleitet. Dass etwa rassistische Stereotype Schwarzen nicht nur von außen zugesprochen, sondern auch innerhalb ihrer eigenen Community bestärkt werden, kommentiert Heining folgendermaßen: “Sadly, this is a story all too common and is documented and examined extensively in the academic literature of sociology and psychology” (23).
Duncan Heining betrachtet sowohl Leben wie auch Werk George Russells, gibt dem Komponisten, Theoretiker und Pädagogen Raum und weiß auch etliches zur Persönlichkeit seines Sujets beizutragen. Er wühlte in Archiven und sprach mit Zeitzeugen, zu denen neben Kollegen und Schülern auch Russell selbst gehörte. Und er stellt all seine Quellen recht offen, und durchaus auch in ihrer etwaigen Widersprüchlichkeit nebeneinander. Das ist für die weitere Forschung sicher löblich, macht die Lektüre allerdings eher beschwerlich, insbesondere, wenn Heining laufend seinen Ansatz wechselt – mal vergleichende Oral-History-Recherche, dann historische Kontextbeschreibung, oft sehr persönlich wirkende moralische Bewertung, immer wieder unverhohlene Kritik an bisherigen Darstellungen von Russells Biographie. Eine Einordnung des theoretischen Ansatzes Russells, eine ausführliche Bibliographie, eine Auflistung der etwa 70 Interviews, die er bei seiner Recherche geführt hat, eine Diskographie sowie eine Auflistung von Tourneedaten und -besetzungen beschließen das Buch. Stil und kritischen Ansatz mag man bemängeln, und doch wird “Stratusphunk” ohne Zweifel die erste Quelle sein, wann immer es um das Werk und die Bedeutung George Russells geht.
Wolfram Knauer (März 2021)
Jazz Dialogues
von Jon Gordon
Torrance 2020(Cymbal Press)
273 Seiten, 18,95 US-Dollar
ISBN: 978-0999477663
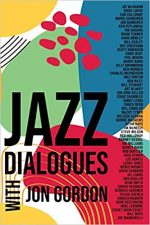 Der Saxophonist Jon Gordon hatte das Glück, als junger Musiker in den 1980er Jahren an den richtigen Orten in New York und anderswo zu sein. Er spielte mit zahlreichen Legenden der Jazzgeschichte genauso wie der Jazzgegenwart, und er erinnert sich gern an deren Ratschläge. “Jazz Dialogues” ist ein kunterbuntes Sammelsurium von Interviews, Gesprächen, Anekdoten, bei denen die Gesprächspartner einen mindestens so großen Platz einnehmen wie Jon Gordons Erinnerungen an die Begegnung, an den Erkenntnisgewinn, den er aus ihnen zog. Art Blakey etwa sprach ihn 1985 oder 1986 im Sweet Basil Club an und fragte, ob er einen Job habe. “Sei dir immer bewusst”, meinte Blakey, “dass wir wirklich Glück haben zu tun, was wir tun. Andere müssen vierzig Stunden die Woche hinter einem Schreibtisch sitzen. Vergiss das nie!” Der damals 18jährige Gordon war verunsichert: Woher wusste Blakey, dass er Musiker war? 20 Jahre später erzählte er die Geschichte Don Sickler, der ein Studio in Manhattan betrieb, in dem auch eine der Bands Gordons geprobt hatte. Und Sickler lachte nur: Blakey habe sich während einer diese Proben im Büro des Studios befunden, aber sie hätten die Jalousien runtergezogen, so dass man nur in eine Richtung schauen konnte.
Der Saxophonist Jon Gordon hatte das Glück, als junger Musiker in den 1980er Jahren an den richtigen Orten in New York und anderswo zu sein. Er spielte mit zahlreichen Legenden der Jazzgeschichte genauso wie der Jazzgegenwart, und er erinnert sich gern an deren Ratschläge. “Jazz Dialogues” ist ein kunterbuntes Sammelsurium von Interviews, Gesprächen, Anekdoten, bei denen die Gesprächspartner einen mindestens so großen Platz einnehmen wie Jon Gordons Erinnerungen an die Begegnung, an den Erkenntnisgewinn, den er aus ihnen zog. Art Blakey etwa sprach ihn 1985 oder 1986 im Sweet Basil Club an und fragte, ob er einen Job habe. “Sei dir immer bewusst”, meinte Blakey, “dass wir wirklich Glück haben zu tun, was wir tun. Andere müssen vierzig Stunden die Woche hinter einem Schreibtisch sitzen. Vergiss das nie!” Der damals 18jährige Gordon war verunsichert: Woher wusste Blakey, dass er Musiker war? 20 Jahre später erzählte er die Geschichte Don Sickler, der ein Studio in Manhattan betrieb, in dem auch eine der Bands Gordons geprobt hatte. Und Sickler lachte nur: Blakey habe sich während einer diese Proben im Büro des Studios befunden, aber sie hätten die Jalousien runtergezogen, so dass man nur in eine Richtung schauen konnte.
Solche Anekdoten sind die eine Seite dieses sehr persönlichen Buchs. Daneben gibt es ausführliche Interviews etwa mit Bill Charlap, Renee Rosnes, Scott Robinson, Melissa Aldana, Kevin Hays, Mark Turner, Jim McNeely, Bob Mintzer, Mike LeDonne, Joe Magnarelli oder Ken Peplowski, die Gordon ziemlich exakt transkribiert und nicht groß stilistisch glättet. Es gibt kleine Gesprächsfetzen, die er erinnert, etwa von McCoy Tyner als dieser ihm backstage beim Jazz Baltica-Festival erklärt, sich nicht wie einer der Großen zu fühlen, sondern wie jemand, der doch selbst auf den Schultern anderer stünde. Es gibt bewegende Anekdoten, etwa wie Gordon bei einem Clubkonzert 1986 auf Sarah Vaughan im Publikum traf, und es gibt Kollegengespräche aus gleicher Augenhöhe, bei denen Gordons Interesse dem Lebenslauf genauso wie den Karriereentscheidungen seiner Gesprächspartner gilt.
So spannt “Jazz Dialogues” einen Bogen zwischen 1983 (David Sanborn & Gil Evans) und 2020 (Bob Mintzer, Leroy Jones und andere), wobei einige der Gespräche so frisch sind, dass sie sogar die beginnende Pandemie erwähnen. “Jazz Dialogues” ist ein fließend zu lesendes Buch, mit denen Gordon seine Freundschaft zu so vielen Musikern genauso feiert wie er seinen Lesern einen Einblick hinter die Kulissen des (insbesondere New Yorker) Musikgeschäfts erlaubt.
Wolfram Knauer (Januar 2021)
Charlie Parker. The Complete Scores. Full Transcriptions from the Original Recordings
Transkribiert von Chris Romero
Milwaukee/WI 2020 Hal Leonard)
415 Seiten, 60 US-Dollar
ISBN 978-1-5400-6720-3
 Charlie Parkers hundertster Geburtstag hat den einflussreichen Saxophonisten im vergangenen Jahr einmal mehr in die Schlagzeilen gebracht. Der Verlag Hal Leonard feierte das Jubiläum mit einer Prachtausgabe der Transkriptionen von 40 Klassikern aus seinem Repertoire, bei der, anders als im “Omnibook”, nicht nur die Saxophonstimme notiert ist, sondern auch Trompete, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.
Charlie Parkers hundertster Geburtstag hat den einflussreichen Saxophonisten im vergangenen Jahr einmal mehr in die Schlagzeilen gebracht. Der Verlag Hal Leonard feierte das Jubiläum mit einer Prachtausgabe der Transkriptionen von 40 Klassikern aus seinem Repertoire, bei der, anders als im “Omnibook”, nicht nur die Saxophonstimme notiert ist, sondern auch Trompete, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.
Chris Romero, der sich dafür lange in einer stillen Kammer eingeschlossen haben muss, bleibt in seiner Partitur allerdings der Jazzhaltung treu: Nicht jede Note ist notiert; insbesondere das Comping des Klaviers wird nur dort in Notenform angegeben, wo es Lücken füllt oder zum Solo wird, ansonsten reicht ihm hier die Angabe der gespielten Changes. Dasselbe gilt fürs Schlagzeug; vor allem die Melodieinstrumente sowie der Kontrabass dagegen sind durchgängig ausnotiert. Es gibt kein ausgiebiges Vorwort, keine editorischen Vorbemerkungen, keine analytischen Begleittexte. Niemand erklärt us, wie die Auswahl zustande kam und was ausgerechnet diese Titel zu “classic performances” werden ließ.
Für Musiker ist das alles sicher interessant, allerdings wohl nicht so sehr zum Nachspielen als vielmehr zum bewussten Studieren der Aufnahmen. Und so ist das schön gebundene und in einem Pappschuber gelieferte Buch wohl eher eine Studienpartitur, die dann aber auch dem notenfesten Fan die eine oder andere Stelle des Zusammenspiels der Band vergegenwärtigen kann. Mit “Charlie Parker. The Complete Scores” hat man vielleicht nicht die Musik selbst vor sich, aber durchaus eine gute Hörhilfe, die es erlaubt, noch tiefer in Birds Musik einzudringen.
Die transkribierten Titel sind: “Ah-Leu-Cha”; “Anthropology”; “Au Privave”; “Barbados”; “Billie’s Bounce”; “Bird’s Feathers”; “Bird’s Nest”; “Bloomdido”; “Blues for Alice”; “Bongo Bop”; “Chasing the Bird”; “Chi Chi”; “Confirmation”; “Dewey Square”; “Dexterity”; “Donna Lee”; “Drifting On a Red”; “K.C. Blues”; “Kim”; “Klactoveededstene”; “Ko Ko”; “Laird Baird”; “Leap Frog”; “Marmaduke”; “Mohawk”; “Moose the Mooche”; “My Little Suede Shoes”; “Now’s the Time”; “Ornithology”; “Passport”; “Quasimodo”; “Red Cross”; “Relaxin’ at Camarillo”; “Relaxin’ with Lee”; “Scrapple from the Apple”; “Shawnuff”; “Steeplechase”; “Thriving from a Riff”; “Visa”; “Yardbird Suite”.
Wolfram Knauer (Januar 2021)
The Essential W. Royal Stokes Jazz, Blues, and Beyond Reader
von W. Royal Stokes
Elkins/WV 2020 (Hannah Books)
562 Seiten, 30 US-Dollar
ISBN: 979-8611405475
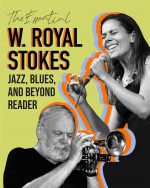 W. Royal Stokes hat in seiner Karriere für die unterschiedlichsten Publikationen geschrieben, die Tageszeitung Washington Post genauso wie für Fachmagazine wie Down Beat oder Jazz Times. Jetzt hat der 1930 geborene Journalist eine Sammlung zahlreicher seiner seit den frühen 1980er Jahren erschienenen kürzeren und längeren Artikel und Interviews zusammengestellt. Sein Interesse gilt dem alten genauso wie dem modernen Jazz, Musiker:innen seiner Wahlheimat Washington D.C., einigen ausgesuchten nicht-amerikanischen Künstler:innen sowie solchen, die eher in der Blues- und Popmusikszene zuhause sind, dem “support network”, also Aktiven des Musikgeschäfts, die sich dafür einsetzen, dass die Szene lebendig bleibt, und schließt mit ausgesuchten Konzert-, Platten- und Buchrezensionen. Konkret geht es also von Ruby Braff bis Andrew Cyrille, von Artie Shaw bis Willem Breuker, von Willis Conover bis zur Jazz Journalists Association, und selbst der Verfasser dieser Rezension kommt in einem Interview zu Wort, das Stokes 2008 mit ihm führte.
W. Royal Stokes hat in seiner Karriere für die unterschiedlichsten Publikationen geschrieben, die Tageszeitung Washington Post genauso wie für Fachmagazine wie Down Beat oder Jazz Times. Jetzt hat der 1930 geborene Journalist eine Sammlung zahlreicher seiner seit den frühen 1980er Jahren erschienenen kürzeren und längeren Artikel und Interviews zusammengestellt. Sein Interesse gilt dem alten genauso wie dem modernen Jazz, Musiker:innen seiner Wahlheimat Washington D.C., einigen ausgesuchten nicht-amerikanischen Künstler:innen sowie solchen, die eher in der Blues- und Popmusikszene zuhause sind, dem “support network”, also Aktiven des Musikgeschäfts, die sich dafür einsetzen, dass die Szene lebendig bleibt, und schließt mit ausgesuchten Konzert-, Platten- und Buchrezensionen. Konkret geht es also von Ruby Braff bis Andrew Cyrille, von Artie Shaw bis Willem Breuker, von Willis Conover bis zur Jazz Journalists Association, und selbst der Verfasser dieser Rezension kommt in einem Interview zu Wort, das Stokes 2008 mit ihm führte.
Insbesondere die Artikel für die Washington Post sind meist kurz und befassen sich oft mit speziellen Themen oder haben mit anstehenden Auftritten in DC und Umgebung zu tun. In den längeren Interviews ist Stokes ein informierter Fragesteller, der zielgerichtet durchs Gespräch führt, seinen Gesprächspartnern dabei aber durchaus Leine lässt. Dieses Procedere lässt sich beispielsweise gut in den Transkripten zweier Interviews verfolgen, die Stokes 2003 mit dem Trompeter Dave Douglas führte: Das Gespräch führt vom Persönlichen zum Künstlerischen, von ästhetischen hin zu praktischen Fragen des Musikplanens und -machens.
Neben Größen der Jazzgeschichte – unter ihnen ein Telefonat mit Red Norvo oder Interviews mit Earl Hines, Art Hodes, Harry James und Artie Shaw – finden sich zahlreiche unbekanntere Namen, der Schlagzeuger Eddie Phyfe etwa oder der Sänger Jimmy McPhail, der mit der letzten Ellington-Band sang. Stokes’ Gespräch mit Omar Sosa wirkt eher wie ein Oral History Interview, während Monika Herzig seine weitaus formaler gestellten Fragen etwas steifer, weil per e-mail beantwortete. In seinen Konzertbesprechungen für die Post ist Stokes sich immer bewusst, dass er stellvertretend für das Publikum schreibt, das bei den Veranstaltungen dabei war, lässt also immer wieder Gesprächsfetzen mit anderen Besuchern in seine Beschreibung der Veranstaltung einfließen.
Ob die für das Buch ausgewählten Artikel nun wirklich “The Essential” sind oder ob es dem Autor nur schwerfiel eine Auswahl zu treffen, sei dahingestellt. Insbesondere in den Kapiteln mit Rezensionen finden sich einige, die außer historischer Dokumentation (“ach, der hat damals also mit dem dort und dort gespielt”) wenig vermitteln. Auf den Genuss der Lektüre hat das aber keinen negativen Einfluss, da Stokes’ Buch eh als eine Art Lesebuch angelegt ist, bei dem man gern springt und sich von der Abwechslung der Perspektiven überraschen lässt. The Essential W. Royal Stokes Jazz, Blues & Beyond Reader wurde vom Autor im Eigenverlag publiziert; ein Bestelllink findet sich auf seiner Website.
Wolfram Knauer (Januar 2021)
Adrian Rollini. The Life and Music of a Jazz Rambler
von Ate van Delden
Jackson/MS 2020 (University Press of Mississippi)
507 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-1-4968-2516-2
 Adrian Rollini scheint eher ein Nebenthema der Jazzgeschichte zu sein, und doch ist er über seine knapp dreißigjährige Aufnahmegeschichte zu einer Art Legende geworden. Viele kennen ihn als den scheinbar einzigen Bass-Saxophonisten (vor Scott Robinson), andere verbinden Instrumente wie das Goofus oder den Hot Fountain Pen mit seinem Namen. Egal welches Instrument er bediente – neben der Saxophonfamilie waren dies etwa Posaune¹, Klavier, Harpaphone, Xylophon und Vibraphon –, er entwickelte eine bewundernswerte Meisterschaft auf ihnen. Sein Bass-Sax-Spiel beeinflusste Harry Carney und Gerry Mulligan, sein Xylophon-Spiel Red Norvo, und Louis Armstrong gefiel, wie deutlich in Aufnahmen mit Rollini immer der Bass-Part zu hören war.
Adrian Rollini scheint eher ein Nebenthema der Jazzgeschichte zu sein, und doch ist er über seine knapp dreißigjährige Aufnahmegeschichte zu einer Art Legende geworden. Viele kennen ihn als den scheinbar einzigen Bass-Saxophonisten (vor Scott Robinson), andere verbinden Instrumente wie das Goofus oder den Hot Fountain Pen mit seinem Namen. Egal welches Instrument er bediente – neben der Saxophonfamilie waren dies etwa Posaune¹, Klavier, Harpaphone, Xylophon und Vibraphon –, er entwickelte eine bewundernswerte Meisterschaft auf ihnen. Sein Bass-Sax-Spiel beeinflusste Harry Carney und Gerry Mulligan, sein Xylophon-Spiel Red Norvo, und Louis Armstrong gefiel, wie deutlich in Aufnahmen mit Rollini immer der Bass-Part zu hören war.
Nun hat der niederländische Sammler und Jazzforscher Ate van Delden Adrian Rollini eine Biographie gewidmet, die alle Seiten seines musikalischen Schaffens beleuchtet. Er beginnt im Piemont des 19. Jahrhundert, wo sein Vater aufwuchs, der sich in den 1890er Jahren entschied in die Vereinigten Staaten auszuwandern und bald in New York als Kupferstecher arbeitete, nebenbei aber auch Gesangsunterricht gab. Er fand eine ebenfalls italienischstämmige Frau, und am 28. Juni 1903 kam Adrian, ihr erstes Kind, zur Welt. Der besaß das absolute Gehör, erhielt ab dem 3. Lebensjahr Klavierunterricht, und ein erster Artikel über das fünfjährige Wunderkind erschien bereits im Juli 1908 im Musical Observer. Seinen ersten professionellen Erfolge in populäreren Genres feierte Rollini dann 1919 mit dem Einspielen von Klavierwalzen, auf denen er synkopierte Walzer, Broadwayschlager und Novelty-Nummern interpretierte, die mal als Blues, Foxtrot oder als “oriental fox trot” gehandelt wurden.
1922 wurde Rollini Mitglied der California Ramblers, eines vom Geschäftsmann Ed Kirkeby geleiteten Tanzorchesters, in dem Rollini anfangs als zweiter Pianist und Xylophonspieler mitwirkte. Am 7 April 1922 machte er mit dieser Band seine erste Plattenaufnahme, “Little Grey Sweetheart of Mine”, in der sein Xylophonspiel mehr improvisiert als ausgeschrieben hinter der Band zu hören ist. Das Repertoire der Band bestand aus populärer Tanzmusik und sogenannten Novelty-Nummern, etwa Zez Confreys “Stumbling” mit einem Duett der beiden Pianisten im zweiten Teil der Aufnahme. Wenig später wechselte Rollini zum Bass-Saxophon, einem Instrument, das bis dahin kaum im Jazz vorkam, und im September 1922 ist sein erster Solobreak in “I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate” zu hören. Rollini beherrschte das Instrument immer besser und machte sich bald einen Namen als jemand, der nicht nur die Basslinie betonen konnte, sondern daneben auch zu eigenständigen Soli in der Lage war. Optisch war das Bass-Sax ein Hingucker, und in kleineren Ensembles, einer Art Auskopplung aus den California Ramblers, spielte Rollini quasi als Gegenstück den Goofus, ein in Frankreich gefertigtes Spielzeuginstrument (etwa in “San” vom Mai 1924) oder den Hot Fountain Pen, eine Art Miniaturklarinette, nicht größer als ein Füllfederhalter (etwa im “Dixie Stomp” vom Oktober 1925). Inzwischen hatte Rollini die Leitung der California Ramblers übernommen, deren Arrangements immer präziser und swingender wurden.
Van Delden verfolgt das Auf und Ab der California Ramblers, Rollinis Zeit mit Red Nichols, mit dem er ab 1927 Aufnahmen machte, die noch jazziger waren als die Tanzmusikarrangements der Ramblers, und er hört sich die Platten an, die Rollini etwa mit Joe Venuti und Eddie Lang, mit Frankie Trumbauer oder Bix Beiderbecke machte. 1928 reiste Rollini nach England, um zusammen mit dem Trompeter Chelsea Quealey und dem Saxophonisten und Klarinettisten Bobby Davis Mitglied in der Band Fred Elizaldes zu werden, der einen Gig im Londoner Tophotel Savoy innehatte. Die Musik des Ensembles war in den Schlagzeilen, mit Elizalde trat Rollini bald auch auf dem Kontinent, in Paris oder Ostende, auf und war regelmäßig im BBC zu hören. Der amerikanische Tieftöner war einer der Stars der Band und wurde vielfach in der Fachzeitschrift Melody Maker erwähnt. Ende 1929 allerdings waren die Auswirkungen des Börsencrashs auf der Wall Street bis nach London zu spüren, und so entschied sich Rollini zusammen mit seiner Frau Dixie und seinem Bruder, dem Saxophonisten Art, der inzwischen ebenfalls der Elizalde-Band angehörte, nach New York zurückzukehren.
Die Wirtschaftskrise hatte die USA voll im Griff und war auch im Musikgeschäft zu spüren. Eine Weile kam Rollini im Tanzorchester von Bert Lown unter, spielte aber auch mit den New California Ramblers, die an den Ruhm der früheren Band anzuknüpfen versuchten. 1934 wechselte er die Seiten und eröffnete Adrian’s Tap Room, einen Club im Keller des President Hotel in Midtown-Manhattan, bei dessen Eröffnung u.a. Fats Waller spielte. Zwei Jahre später kam en Musikaliengeschäft dazu, außerdem gründete Rollini ein Trio, in dem er in Begleitung von Gitarre und Kontrabass Vibraphon spielte, und wirkte in einer Reihe von Filmen mit. Im Krieg war Rollini in der Truppenbetreuung aktiv, nach Kriegsende allerdings waren andere Stilrichtungen gefragter als sein gefällig-swingende Jazz. Er zog sich mehr und mehr zurück, auch aus Gesundheitsgründen, lebte die Hälfte des Jahres in Florida, die andere in New York, wo er allerdings höchstens noch kleine Engagements wahrnahm. 1956 verunglückte er bei einem lange Zeit nicht ganz geklärten Unfall und verstarb kurz darauf im Alter von 53 Jahren². Er hinterließ ein Aufnahmeschaffen, das 35 Klavierwalzen umfasste, etwa 1.500 Titel auf Schallplatte, darunter 130 unter eigenem Namen, ca. 300 für Rundfunkshows vor-aufgezeichnete Titel, sowie bei 25 Lang- und Kurzfilme.
Ate Van Deldens Buch zeichnet das Leben und die Karriere Adrian Rollinis sorgfältig nach. Seine Endnoten verraten die Akribie, mit der der Autor die verschiedenen Stationen dieser Karriere dokumentieren konnte. Seine Darstellung ist überall an der Sache interessiert und ordnet Rollinis professionellen Lebensweg in den Kontext der Unterhaltungsindustrie der 1920er und 1930er Jahre ein. Van Deldens Interesse gilt allerdings vor allem der Biographie, Auftritts- und Aufnahmedaten seines Protagonisten, nicht dem kulturgeschichtlichen oder gar gesellschaftlichen Kontext. In diesem Ansatz unterscheidet sich Van Delden nicht von anderen Jazzautoren, und doch vergibt er sich ein wenig die Chance, mit der Lupe, die er auf den Basssaxophonisten hält, der ja ganz unterschiedliche Facetten der Musikindustrie insbesondere der 1920er Jahre kennengelernt hatte, vielleicht auch die Veränderung dieser Branche etwas genauer beleuchten zu können. Seine Einlassungen zu den Aufnahmen Rollinis bleiben im Oberflächlichen, ordnen nicht ein und vergleichen auch selten zu dem, was sonst in der Zeit zu hören war. Er beschreibt weder Stil noch stilistische Entwicklung, begründet im nüchternen Ton seiner Darstellung weder, wie sich Rollinis Vibraphon-Trio beispielsweise vom Spiel Lionel Hamptons unterschied (bzw. wie es vielleicht auch von dessen Erfolg beeinflusst war), noch, was genau dazu beigetragen haben mag, dass er nach dem Krieg nicht mehr in der vordersten Reihe mitspielen konnte. Er erwähnt die seichteren und die eher auf den Jazz fokussierten Aufnahmen aus den 1920er Jahren, seine einordnenden Wertungen beschränken sich allerdings zumeist auf Adjektive wie “excellent”, “memorable”, “amazing” oder “nice”. Wie gesagt: Dieses Manko teilt Ate van Deldes Buch mit vielen von Sammlern und Privathistorikern verfassten, die ein enormes Faktenwissen ausbreiten, sich aber an eine Einschätzung der Musik selbst nicht heran trauen. Dabei braucht es gar keines musikwissenschaftlichen Vokabulars, um zu erklären, wo Neuerungen passieren, wieso eine Aufnahme mehr oder auch weniger gelungen ist, wie sich die Musik einer bestimmten Periode zu jener anderer Künstler derselben Zeit verhält.
Davon abgesehen aber ist Ate van Delden hoch zu loben für die Akribie, mit der er, auch in der Herangehensweise und dem Verweis auf seine Quellen immer nachvollziehbar, alle ihm zugänglichen Fakten über Adrian Rollini zusammengetragen und damit eine jahrzehntelange Arbeit abgeschlossen hat. Bruce Raeburn nennt das Buch in seinem Klappentext die “definitive Biographie des Multiinstrumentalisten, Bandleaders und Komponisten Adrian Rollini” – und dem kann man sich nur anschließen, mit der Einschränkung: nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Wolfram Knauer (Oktober 2020)
¹In einer Nachricht von Leser Uwe Ladwig weist dieser darauf hin, dass Rollini niemals Posaune, sondern “mit dem Bass-Saxofon Posaunenstimmen im Baßschlüssel gespielt [habe]. Ladwig weiter: “Da Rollini vom Klavier her kam, war ihm der C-Bass-Schlüssel geläufig. 1929 erschien im Melody Maker eine neunteilige Serie, in der Rollini das Bass-Saxofon bespricht: „The When, Why and How of the Bass Saxophone“. Dort plädiert er im Teil 6 “The Problem of Transposition” für den Bass-Schlüssel in C.”
²Rollini starb nicht mit 53, sondern mit 52. Er hat seinen Geburtstag nicht mehr erlebt (* 28.6.1903 – ∞ 15.5.1956); Hinweis Uwe Ladwig.
Straighten Up and Fly Right. The Life & Music of Nat King Cole
von Will Friedwald
New York 2020 (Oxford University Press)
633 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-088204-4
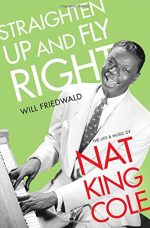 Will Friedwald ist ein ausgewiesener Kenner insbesondere des vokalen Jazz. Nach seinem viel-gelobten Buch über Frank Sinatra (1995) und diversen Büchern über amerikanische Jazz- und Popsänger:innen hat er jetzt eine Biographie Nat King Coles vorgelegt, jenes Musikers, der mehr als vielleicht jeder andere, die Welten zwischen Jazz und Pop überschreiten konnte, weil er einerseits die technische Meisterschaft auf seinem Instrument, dem Klavier, besaß, andererseits eine begeisternde Bühnenpräsenz, und darüber hinaus eine einschmeichelnde Stimme, die ihn schnell zum gefeierten Star aufsteigen ließ. Sein internationaler Ruhm lässt Jazzfans oft vergessen, welch virtuoser Pianist Nat Cole war, der aus Einflüssen durch das Stride Piano und insbesondere Earl Hines einen ganz eigenständigen Personalstil entwickelte und dabei neben den Größten seines Instruments, also Art Tatum oder Oscar Peterson, bestehen konnte.
Will Friedwald ist ein ausgewiesener Kenner insbesondere des vokalen Jazz. Nach seinem viel-gelobten Buch über Frank Sinatra (1995) und diversen Büchern über amerikanische Jazz- und Popsänger:innen hat er jetzt eine Biographie Nat King Coles vorgelegt, jenes Musikers, der mehr als vielleicht jeder andere, die Welten zwischen Jazz und Pop überschreiten konnte, weil er einerseits die technische Meisterschaft auf seinem Instrument, dem Klavier, besaß, andererseits eine begeisternde Bühnenpräsenz, und darüber hinaus eine einschmeichelnde Stimme, die ihn schnell zum gefeierten Star aufsteigen ließ. Sein internationaler Ruhm lässt Jazzfans oft vergessen, welch virtuoser Pianist Nat Cole war, der aus Einflüssen durch das Stride Piano und insbesondere Earl Hines einen ganz eigenständigen Personalstil entwickelte und dabei neben den Größten seines Instruments, also Art Tatum oder Oscar Peterson, bestehen konnte.
Für sein Buch hat Friedwald Archive durchforstet, mit Forscher:innen und Zeitzeugen – einschließlich Nat Coles Bruder Freddy Cole – gesprochen, und er hat viel Musik gehört. Er erzählt Coles Lebensgeschichte biographisch, berichtet von seiner Geburt und Kindheit in Montgomery, Alabama, dem Umzug der Familie nach Chicago, vom Vater, der vor einer Baptistengemeinde predigte, sowie von den wichtigsten musikalischen Einflüssen: der Kirche des Vaters, dem Klavierunterricht durch die Mutter und seinem Idol, dem Pianisten Earl Hines. Mit 14 Jahren, noch in der Schule, stellte Cole seine erste, zehnköpfige Band zusammen, die 1935 von der Lokalpresse als neue Sensation gefeiert wurde. Ein Jahr später machte er seine ersten Aufnahmen, unter dem Namen seines Bruders Eddie, in denen der Einfluss Hines in den Klavierpartien deutlich zu hören ist, tourte mit einer Neuauflage der 1920er-Jahre-Revue “Shuffle Along”.
1937 gründete Cole sein Trio, “aus Zufall”, wie er sagt. “Shuffle Along” war in Los Angeles gestrandet, und Cole war von der Musikszene um die Central Avenue in Los Angeles fasziniert. Er jammte mit Lionel Hampton und Lee Young, dem Bruder des Saxophonisten Lester Young. Der hatte eigentlich auch bei einem Gig dabei sein sollen, den Cole im Swanee Inn in L.A. ergattert hatte, aber er tauchte nicht auf, und so spielten Cole, Gitarrist Oscar Moore und Bassist Wesley Prince eben im Trio. Dass er zu singen begann, sei der Tatsache zu verdanken, dass er das Trio klanglich für zu eintönig hielt. Prince versorgte ihn mit dem Spitznamen “King”, und seine Karriere hob ab.
Warum ein Trio? Nun, ein Quartett mit Schlagzeug hätte zu sehr nach Rhythmusgruppe ausgesehen, und die Leute hätten dann auf den Rest der Band gewartet, argumentiert Cole später. Die ersten eigenen Aufnahmen erfolgten für sogenannte Transcription Services, also Produktionsfirmen für fertige Radiosendungen, die lokale Sender abonnieren und senden konnten. Allein von 1938 stammen 20 Aufnahmen des Trios, zwischen Standards, Pophits der Zeit und an folkige Kinderlieder angelehnte Jump-Versionen wie “Mutiny in the Nursery” oder “Three Blind Mice”. Erst Lionel Hampton brachte ihn im Mai 1940 zu einer Session ins Studio eines Major-Labels, bei der acht Titel entstanden, mit Schlagzeugbegleitung, Lionel Hampton und der Sängerin Helen Forrest. Im Dezember desselben Jahres ging Cole dann mit dem Trio ins Decca-Studio und nahm vier Titel auf, von denen insbesondere “Sweet Lorraine” ein Dauerbrenner seines Repertoires werden sollte. Die Rundfunkpräsenz Anfang der 1940er Jahre und diese Decca-Aufnahmen jedenfalls machten die nationale Presse auf ihn aufmerksam, und bald trat das Trio in den angesagten Clubs von New York und Chicago auf.
Friedwald verfolgt die Aufnahmegeschichte der Band, die im November 1943 richtig abhob, als das Trio bei seiner ersten Plattensitzung fürs kalifornische Label Capitol “Straighten Up and Fly Right” einspielte. Er erzählt die Geschichte des Labels, aber auch jene des Stücks und blättert dabei immer wieder neue Seiten amerikanischer Entertainmenthistorie auf… Er beschreibt, was Coles Interpretationen so besonders macht, erklärt, wie das Repertoire zustande kam, das Cole für Capitol aufnahm, und erzählt über die Zusammenarbeit des Sängers und Pianisten mit seinem neuen Manager Carlos Gastel. Etwa zur selben Zeit begann Norman Granz in Los Angeles mit der Organisation von öffentlichen Konzert-Jam-Sessions, aus denen schließlich Jazz at the Philharmonic-Konzertreihe hervorging, und Cole und Granz kamen für verschiedene Projekte zusammen. Wenn man den Jazzmusiker Nat Cole verstehen will, schreibt Friedwald, müsse man sich nur seine Aufnahmen mit Lester Young von 1942 und 1946 anhören.
Die Säle jedenfalls wurden größer, und Coles Name wurde nun in All-Star-Programmen oft genug in derselben Größe wie jene der Swingstars geschrieben, die in derselben Show zu hören waren. Er nahm neue Hits auf, etwa “Nature Boy” oder Billy Strayhorns “Lush Life”, und war ab 1948 regelmäßig im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand zu sehen. Zwischen den Beschreibungen musikalischer Stationen weiß Friedwald von Coles Privatleben zu berichten, der Ehe mit Maria etwa, der Geburt seiner Tochter Natalie, dem Kauf eines Hauses in einem weißen Viertel von Los Angeles, der zu rassistischen Anwürfen führte.
1950 reiste Cole zum ersten Mal nach Europa, und von nun an begann er endgültig vor allem als Pop- statt als Jazzkünstler wahrgenommen zu werden. “Mona Lisa”, schreibt Friedwald, war vielleicht der Umschwung. Wo Cole zuvor erfolgreich mit dem Arrangeur Pat Rugolo zusammengearbeitet hatte, begann jetzt seine Kooperation mit Nelson Riddle, und immer mehr wurde das Klavier zu einer nebensächlichen Staffage, weil das Publikum vor allem auf Nat King Cole, den Sänger, fokussiert war. Friedwald listet alle Erfolgsstationen auf: einen biographischen Film, Gastauftritte bei populären Fernsehshows, Auftritte in den gefeiertsten Night Clubs der Nation und schließlich seine eigene TV-Show. Immer wieder vergleicht er Coles Erfolg mit dem seiner direkten Konkurrenten, etwa Frank Sinatra oder Bing Crosby. 1961 sang Cole noch bei der Amtseinführung Präsident John F. Kennedy, doch bald darauf wurde erst ein Magengeschwür, dann Lungenkrebs diagnostiziert, eine Folge der vielen Zigaretten, die er zeitlebens geraucht hatte. Im Februar 1965 erlag er der Krankheit im Alter von nur 45 Jahren.
Will Friedwalds Buch ist ein dicker Wälzer und gewiss ein Standardwerk über Nat King Cole. Das Buch ist gut erschlossen durch einen ausführlichen Index und zahlreiche Fußnoten, und jede Phase der Karriere des Pianisten und Sängers ist ausreichend beleuchtet. Dem Autor gelingt es, die Besonderheiten des Stils zu beschreiben, ohne in eine musikalische Fachsprache zu verfallen, und er ist sich an jeder Stelle des Kontextes bewusst, in dem Cole aktiv ist: der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse also genauso wie des Status’ von Jazz und Entertainmentbranche. Und doch ist sein Buch nicht nur vom Umfang her stellenweise etwas schwer geraten. In seinem Hang zur Vollständigkeit macht es Friedwald seinen Leser:innen nämlich teilweise schwer, dabei zu bleiben. Man ist stellenweise geneigt, ihm den Titel seines eigenen Buchs zuzurufen: “Straighten Up and Fly Right!”, denn die Geschichten, die Nat King Cole so mühelos ans Publikum bringen konnten, hätten auch einen stilistisch etwas müheloseren Erzähler verdient.
Wolfram Knauer (Oktober 2020)
Kleine Songs zwischen Freunden
von Arno Fischer
Wiesbaden 2020 (Edition 6065)
110 Seiten, 12 Euro
ISBN: 978-3-941072-23-7
 Arno Fischer ist ein Buch über einen Jazzmusiker gelungen, in dem dessen Musik weitestgehend ausgespart bleibt, das aber dennoch jede Menge über seine künstlerische Haltung verrät. 1996 lernte Fischer seinen Namensvetter kennen, den amerikanischen Pianisten und Künstler John Fischer, und was als berufliche Beziehung begann – Arno Fischer war im Marburger Kulturamt für die Organisation der jährlichen Sommerakademie verantwortlich, bei der John Fischer seit einigen Jahren eine Klasse für freies Malen unterrichtete – wurde bald zu einer Freundschaft. Hinzu kam die Namensgleichheit und die Tatsache, dass die Eltern John Fischers Arno und Sabine geheißen, also die Vornamen des Autors Arno Fischer und seiner Frau getragen hatten. All das trug dazu bei, dass sich der Pianist und Künstler dem Verwaltungsangestellten und (gar nicht mal so heimlichen) Autor weit öffnete.
Arno Fischer ist ein Buch über einen Jazzmusiker gelungen, in dem dessen Musik weitestgehend ausgespart bleibt, das aber dennoch jede Menge über seine künstlerische Haltung verrät. 1996 lernte Fischer seinen Namensvetter kennen, den amerikanischen Pianisten und Künstler John Fischer, und was als berufliche Beziehung begann – Arno Fischer war im Marburger Kulturamt für die Organisation der jährlichen Sommerakademie verantwortlich, bei der John Fischer seit einigen Jahren eine Klasse für freies Malen unterrichtete – wurde bald zu einer Freundschaft. Hinzu kam die Namensgleichheit und die Tatsache, dass die Eltern John Fischers Arno und Sabine geheißen, also die Vornamen des Autors Arno Fischer und seiner Frau getragen hatten. All das trug dazu bei, dass sich der Pianist und Künstler dem Verwaltungsangestellten und (gar nicht mal so heimlichen) Autor weit öffnete.
Im Verlauf der Gespräche, die Arno Fischer in seinem Buch wiederaufleben lässt, erzählt Jean Jacques Fischer, wie John hieß, als 1930 als Sohn eines Goldschmieds in Antwerpen geboren wurde, davon, wie er zwei Tage nach Einmarsch der deutschen Truppen in die Niederlande mit seinen Eltern und Geschwistern zur Flucht Richtung Süden aufbrach. In Le Teil, einem unscheinbaren Ort in Südfrankreich, kamen sie auf einem Bauernhof unter. Er erzählt von den Umständen, den Sorgen und den Unwägbarkeiten der Flucht, über Cannes und Marseille erst nach Casablanca, dann mit einem Schiff Richtung Vereinigte Staaten, das die geflüchteten Passagiere aber in Havanna aussetzte, weil die USA die Einfahrt verweigert hatte. Zwei Jahre lebten sie auf Kuba, dann gelang ihnen die Überfahrt nach Miami, von wo aus sie per Zug nach New York reisten, und… “Eines Morgens fand ich mich wieder, sitzend in einer U-Bahn. Als wenn ich unter einer Käseglocke gelebt hätte, die nun plötzlich weggezogen worden wäre und ich war wieder in die Welt entlassen. Es war die Zeit von Hammerstein und Rodgers and Hart und George and Ira Gershwin, die ganze Welt war swinging, das war für mich die Melodie der Freiheit – und ich wusste, ich war gerettet.”
Soweit der Rahmen. Arno Fischers Buch handelt also von Flucht und den Ängsten des jungen Jean Jacques. Diese verfolgten ihn bis weit in die 1970er Jahre hinein, als er zu einem Auftritt bei den Berliner Jazztagen erstmals zu einem bejubelten Konzert nach Deutschland reiste, nach dem er sich hinter der Bühne dem Antisemitismus der Deutschen wieder ausgesetzt fühlte, ausgerechnet vom Festivalmacher George Gruntz und dem großen Albert Mangelsdorff, aber auch all den anderen anwesenden Deutschen, die sich etwas zuriefen, das er auf sich bezog: “Jetzt, nachdem man die Kunst des Juden genossen hatte”, fasst Arno Fischer die Erinnerung des Pianisten zusammen, “wurde zum Pogrom aufgerufen: ‘Jews!’ Jetzt würden die Deutschen ihr wahres Gesicht zeigen.” Als Hans Kumpf, mit dem Fischer sich angefreundet hatte, ihn aufklärte, dass die Musiker sich tatsächlich nur mit einem freundlichen “Tschüs” verabschiedet hatten, fiel Fischer ein Stein vom Herzen: “So konnte er nach zwei Analysen und dreißig Jahren New York zum ersten Mal einen winzigen Teil seiner Fluchtangst loslassen”.
Flucht und die durch sie verursachten seelischen Narben also sind das eine Thema des Buchs, das zugleich von einer Freundschaft zwischen den beiden Namensvettern handelt, vom Vertrauen-Fassen zwischen einem Nachfahren der Täter- und einem Zeitzeugen der Opfergeneration, und schließlich davon, wie John Fischers durch seine Lebenserfahrungen erlangte Gelassenheit und … vielleicht Weisheit … den jüngeren Fischer, den Autor also, dazu brachte, über sein eigenes Leben zu reflektieren.
Arno Fischers Würdigung ist dabei nur eine teilweise Biographie John Fischers, eine Erzählung über Fluchterfahrung und Erinnerung. Daneben erinnert er sich an die Gespräche, die er mit seinem väterlichen Freund hatte, an die Cafés und Restaurants, in denen diese stattfanden, an Autofahrten und Begegnungen während der Marburger Sommerakademie. John Fischer hatte bereits in den 1970er Jahren die Stätten seiner Kindheit wiederbesucht, war dabei 36 Jahre nach der Flucht auf Menschen getroffen, die er noch von damals kannte, oder auf Fremde, die ihm zeigen wollen, was sich seither alles verändert hatte. Auch davon lässt ihn Arno Fischer erzählen, wie man von fernen, leicht verklärten Erinnerungen: mal klar aufs Detail bedacht, dann dieselbe Begebenheit, aber in unterschiedlichem Kontext. Er zeichnet dabei auch die widersprüchliche Persönlichkeit John Fischers nach, dessen Mürrigkeit man genauso erahnen kann wie seine Liebenswürdigkeit, alles geerdet in einer großen Neugier und gleichzeitigen Ängsten.
Von Jazz ist bei alledem kaum die Rede, eigentlich nur im Anhang, einem Interview, das Hans Kumpf 1977 mit dem Pianisten geführt hatte. Und doch meint man den Jazz dauernd durchzuhören. Arno Fischers Buch nämlich macht uns darauf aufmerksam, dass die Kunst improvisierender Musiker immer aus ihrer eigenen Biographie schöpft, dass es sich lohnt, ihre Perspektive aufs Leben kennenzulernen, um ihrer Musik näherzukommen, dass andererseits die Kenntnis ihrer Lebenserinnerungen durchaus auch die eigene Hörerfahrung komplett umkrempeln kann – so geschehen beim Autor dieser Rezension, der John Fischers Aufnahmen jetzt mit anderen Ohren hören wird.
Wolfram Knauer (Oktober 2020)
MilesStyle. The Fashion of Miles Davis
von Michael Stradford
Los Angeles 2020(self-published)
204 Seiten, 17,99 US-Dollar
ISBN: 978-1647865573
 Michael Stradford ist Medienmanager mit umfangreichen Erfahrungen in Rundfunk, Fernsehen und Film. Jetzt hat er ein Buch über Miles Davis vorgelegt, das sich allerdings nur Rande mit Davis’ Musik zu beschäftigen scheint und stattdessen seine Bühnenpersönlichkeit, oder noch genauer: seine Bühnengarderobe und seinen Sinn für Mode in den Mittelpunkt stellt. Dass und wie Stradford dabei dann doch der Musik ziemlich nahe kommt, ist eine ziemlich erstaunliche und für seiner Leser:innen ungemein befriedigende Erfahrung.
Michael Stradford ist Medienmanager mit umfangreichen Erfahrungen in Rundfunk, Fernsehen und Film. Jetzt hat er ein Buch über Miles Davis vorgelegt, das sich allerdings nur Rande mit Davis’ Musik zu beschäftigen scheint und stattdessen seine Bühnenpersönlichkeit, oder noch genauer: seine Bühnengarderobe und seinen Sinn für Mode in den Mittelpunkt stellt. Dass und wie Stradford dabei dann doch der Musik ziemlich nahe kommt, ist eine ziemlich erstaunliche und für seiner Leser:innen ungemein befriedigende Erfahrung.
In seiner Jugend habe er fast aus Versehen Miles’ “In a Silent Way” gehört und es habe ihm überhaupt nicht gefallen, beginnt Stradford sein Buch. In den frühen 1980ern habe er den Trompeter dann auf seiner Promo-Tour für das Album “The Man with the Horn” in Cincinnati erlebt. Dieser sei in einem weiten rosa Overall aufgetreten, habe eine weiße Strickmütze getragen, auf die das Wort “Pepe” aufgestickt war, und an den Füßen habe er eine Art Pantoffeln getragen. Er habe nicht viel gespielt, doch das Publikum habe ihm begeostert zugejubelt, als er am Ende des Abends kurz winkte. Stradford verstand nicht so recht, was da vor sich ging. Ein paar Tage später sei ihm das Album “My Funny Valentine. Miles Davis in Concert” in die Hände gefallen, und der Ton, den er aus Miles Davis’ Trompete hörte, hielt ihn gefangen. Danach habe er sich nach und nach die anderen Schaffensperioden des Meisters angeeignet. Er habe alles gelesen, was er über den Trompeter finden konnte einschließlich Büchern über seine Malerei. Und er habe davon geträumt, ein großes, reich bebildertes Buch über Miles’ Mode zu schreiben. Dieses Coffertable-Book-Projekt habe sich dann leider aus Kostengründen zerschlagen, doch Stradford fand, die Recherchen rechtfertigten eine Veröffentlichung zumindest seiner Beobachtungen und der Gespräche, die er mit Vertrauten und Experten geführt hatte.
Stradfords erstes Kapitel umfasst die Jahre bis 1949, erzählt von Miles’ Jugend in St. Louis und identifiziert seine Mutter als einen modischen Einfluss, aber auch Fred Astaire (von dem Miles sagte, er habe in etwa seine Größe) und Cary Grant. Auch Clark Terry, der wie er aus St. Louis stammte, habe ihm modisch imponiert, und als Miles einen ersten Gig in Eddie Randles Band hatte, nutzte er die Gage, um “hippe Brooks Brothers”-Anzüge zu kaufen. 1944 ging Miles nach New York, um an der Juilliard School Unterricht zu nehmen, und hier achtete er besonders darauf, dass sein Äußeres nicht seine Kleinstadtherkunft verriet. Stradford blickt auf andere modebewusste Musiker der Zeit, Coleman Hawkins etwa, der Miles schon mal Anzüge besorgte, den Schlagzeuger Charlie Rice, der ihm seinen ersten Maßanzug anfertigte, oder Dexter Gordon, der Miles’ Sinn für Mode kritisierte. Und dann spricht er mit Clark Terry selbst, der erklärt, wie wichtig die Garderobe in den 1940er und 1950er Jahren war, weiß, dass Miles ihn als Jugendlicher nachgeahmt hatte, aber betont, dass er dann doch schnell seinen eigenen Stil gefunden habe (musikalisch wie modisch). Stradford spricht mit dem Modeexperten Lloyd Boston über die Bedeutung von Mode für schwarze Männer und über den Wandel in Miles Davis’ Stil, der über die Jahre immer schriller und auffälliger wurde. Miles Davis sei eine Modeikone gerade, weil er keine sein wollte, erklärt Boston und definiert den “klassischen Miles-Look”: dezente Eleganz, eine Schlichtheit, bei der weniger mehr ist. Schließlich spricht Stradford noch mit dem Filmproduzenten Reggie Hudlin darüber, wie er Miles zum ersten Mal traf, als sein erster Film “House Party” herauskam, und wie er von ihm den Auftrag erhielt, ein Bühnenbild für eine große Show in Paris zu entwerfen, ein Projekt, das dann allerdings nie realisiert wurde.
In den 1950er Jahren hatten Miles’ Pariser Ausflüge, seine Freundschaft zu Juliette Greco Einfluss auch auf den Modesinn des Trompeters. Stradford diskutiert aber auch Miles’ Suchtverhalten und die daraus resultierenden Probleme. Es ging ihm zeitweise richtig dreckig, schreibt Stradford, aber er trat nach wie vor wie aus dem Ei gepellt in der Öffentlichkeit auf. Er betrachtet Fotos von Miles aus jenen Jahren, analysiert die Stoffe, Schnitte, Designer, und er setzt all das ins Verhältnis zur allgemein vorherrschenden Mode der Zeit. Miles, fasst er am Schluss des Kapitels zusammen, habe für sich ein Profil geschaffen wie kein anderer Musiker in der populären Musik, ein Profil, zu dem die Klänge seiner Platten genauso gehörten wie sein visuelles Image. Für dieses Kapitel unterhält Stradford sich mit dem Modeexperten Charlie Davidson über Miles als Kunden in seinem Modegeschäft in Cambridge, Massachusetts, mit Bryan Ferry, der ja selbst als Modeikone gehandelt wird, sowie mit der Modeforscherin Monica Miller über die Tradition der “Black Dandies”.
In den 1960er Jahren übernahm Miles Modetrends aus Italien; selbst Down Beat fand, Miles sei so gut angezogen, dass man mit einem Blick auf ihn erkennen könne, was der Mann nächstes Jahr tragen müsse. Seine Konzerte wurden von den Stars des Showbusiness besucht, sein Erfolg ermöglichte ihm den Kauf eines fünfstöckigen Hauses auf der Upper West Side Manhattans und eines vielbeachteten Ferraris. Zugleich sprach Miles sich offen gegen den Rassismus in den USA aus, und er spielte mit einem Quintett, dessen Musiker größtenteils zumindest zehn Jahre jünger als er waren. Für dieses Kapitel spricht Stradford mit Miles’ Frau Frances Davis über ihre erste Begegnung und seinen Modegeschmack, mit Quincy Jones über Miles’ Talent als Schauspieler und sein Image als harter Bursche, sowie mit Ron Carter über seine erste Begegnung mit dem Trompeter und darüber, dass dieser seinen Musikern freie Hand bei der Entscheidung ließ, was sie auf der Bühne trugen.
Mit “Filles de Kilimanjaro” und “Bitches Brew” begann eine auch modisch völlig andere Zeit. Betty Mabris machte Miles mit der Popmusik der Zeit vertraut und beeinflusste auch seinen modischen Wandel von europäischem Chique hin zu stärker funky wirkenden Klamotten, Lederhemden, Schlangen- und Wildlederhosen, wild-bunten Hemden, die er nie öfter als einmal trug. Für dieses Kapitel spricht Stradford mit der Designerin Andrea Aranow über ihre Entwürfe für Jimi Hendrix und Miles Davis, mit dem Fotografen Anthony Barbosa über ihre Fotosessions Anfang der 1970er Jahre und jene für das Album “You’re Under Arrest”, und mit Betty Mabris/Davis über ihre Modeling-Karriere und den modischen Einfluss, den sie auf ihren Mann hatte.
Ende der 1970er Jahre hörte man eigentlich nur über Miles’ Gesundheitsprobleme; er trat nicht mehr auf, und in Interviews äußerte er oft, wie gelangweilt er sei. Für diese Zeit sammelt Stradford Interviews mit Lenny Kravitz, dessen Eltern mit Miles befreundet waren, mit der Kostümbildnerin Gersha Phillips über die Garderobe, die sie für Don Cheadles Film “Miles Ahead” entwarf, mit dem Perkussionisten James Mtume darüber, dass Miles jedes Mal, wenn sich seine Musik änderte, auch seinen Look änderte, und mit dem Bassisten Michael Henderson über seine erste Begegnung mit Miles und Einkaufstipps vom Chef.
In den 1980er Jahren feierte Miles sein Comeback mit einer Musik, die purer Miles genauso war wie sie auf Popmusik von Cyndi Lauper oder Michael Jackson zurückgriff. Er erhielt Gagen wie ein Rockstar und hatte Gastauftritte bei “Miami Vice” und “Saturday Night Live”. Er versuchte gesünder zu leben und arbeitete mit Quincy Troupe zusammenan seiner Autobiographie. Obwohl dies die vielleicht gesündeste Phase seines Lebens gewesen sein mag, forderten die Krankheiten, die er schon lange mit sich herumschleppte, ihren Tribut. Am 29. September 1991 verstarb er. Für dieses letzte Kapitel spricht Stradford mit dem Modeschöpfer Issey Miyake, dessen Kreationen Miles immer wieder trug; mit dem Bassisten Darryl Jones über Miles’ Sinn für Humor und seine Lust am Kochen; mit dem Kulturwissenschaftler Todd Boyd über die Bedeutung von Miles Davis als Ikone fürs schwarze Amerika und darüber, was sein modischer Geschmack über ihn als Künstler und schwarzer Mann aussagt; mit Jo Gelbard, Miles’ Freundin zur Zeit seines Todes, über ihr Kennenlernen in einem Aufzug, darüber, dass er nach Wandel süchtig gewesen sei, darüber, wie er etliche seiner besten Klamotten ruinierte, weil er sie beim Malen trug, sowie über die Haar-Extensions, an denen er stundenlang arbeitete, damit sie richtig saßen; mit Koshin Satoh, dessen futuristische Kreationen Miles zum Ende seines Lebens gern trug; mit dem Bassisten Marcus Miller über seine erste Begegnung mit dem Trompeter und seine Erfahrungen mit Miles’ Modegeschmack; mit dem Maler Mikel Elam, der eine Weile als Miles’ Assistent arbeitete; und mit Miles Neffen, dem Schlagzeuger und Miles’ Nachlassverwalter Vince Wilburn über den Familiensinn, den der Trompeter hatte, seinen Geschäftssinn, und über die Tatsache, dass er sich schon mal fünf- oder sechsmal am Tag umzog.
Michael Stradfords gelingt es ein ungemein unterhaltsames und zugleich erleuchtendes Buch über Miles Davis zu schreiben, obwohl er sich fast nie über die Musik selbst auslässt. Sein Erkenntnisinteresse über modische Fragen sorgt dafür, dass in seinen Interviews unbekannte Details über Miles Leben und künstlerischen Ansatz zur Sprache kommen, die auch seine Musik besser verstehen lassen. Und so gelingt es ihm in dem Buch, obwohl er so wenig zur Musik schreibt, doch sehr viel Erhellendes über sie auszubreiten. Als Leser macht man eine Erfahrung, wie wenn man etwas aus dem Augenwinkel heraus betrachtet und dabei klarer Details erkennt, die einem beim direkten Blick entgangen wären. Eine großartige Ergänzung zur Literatur über Miles Davis – und von so unerwarteter Seite.
Wolfram Knauer (Juli 2020)
Tony Lakatos. Sagt nur nicht Künstler zu mir
Von Rainer Erd
Frankfurt/Main 2020 (Books on Demand)
203 Seiten, viele Fotos
ISBN: 9783751971287
 Tony Lakatos: Der virtuose, immer verlässliche, stilistisch vielfältige, dabei ungemein bescheidene Saxophonist ist scheinbar auf jeder Bühne des Landes zuhause. In Frankfurt lebt er seit 1993 und ist seither einer der Anker der hr-Bigband. Rainer Erd hatte sich mit Lakatos’ Biographie erstmals bei einer Gesprächsveranstaltung auseinandergesetzt, bei der der gebürtige Ungar von seinem Lebensweg “vom Budapester Gypsy-Kindergeiger zum weltbekannten Jazz-Saxophonisten” erzählte. In der Folge befragte Erd den Saxophonisten ausgiebig, sprach mit Kolleg:innen aus Bigband und Szene und reiste sogar selbst nach Budapest, um die Herkunft Lakatos’ besser zu verstehen. “Sag nur nicht Künstler zu mir”, habe Lakatos ihm einmal gesagt und darauf bestanden, sein Beruf sei Musiker. Sein Talent war ihm in die Wiege gelegt war, wenn er auch erst einmal den Wunsch des Vaters abwehren musste, Geigenprimas zu werden. Zum Saxophon kam Lakatos dabei erst spät, hatte aber bereits jede Menge musikalischer Erfahrung. Und mit dem Jazz kam der junge Tony dann im 8. Bezirk Budapests in Berührung, in dem viele arme Roma lebten, in dem Lakatos aber vor allem bei Jam Sessions bei Freunden in den Jazz eintauchte.
Tony Lakatos: Der virtuose, immer verlässliche, stilistisch vielfältige, dabei ungemein bescheidene Saxophonist ist scheinbar auf jeder Bühne des Landes zuhause. In Frankfurt lebt er seit 1993 und ist seither einer der Anker der hr-Bigband. Rainer Erd hatte sich mit Lakatos’ Biographie erstmals bei einer Gesprächsveranstaltung auseinandergesetzt, bei der der gebürtige Ungar von seinem Lebensweg “vom Budapester Gypsy-Kindergeiger zum weltbekannten Jazz-Saxophonisten” erzählte. In der Folge befragte Erd den Saxophonisten ausgiebig, sprach mit Kolleg:innen aus Bigband und Szene und reiste sogar selbst nach Budapest, um die Herkunft Lakatos’ besser zu verstehen. “Sag nur nicht Künstler zu mir”, habe Lakatos ihm einmal gesagt und darauf bestanden, sein Beruf sei Musiker. Sein Talent war ihm in die Wiege gelegt war, wenn er auch erst einmal den Wunsch des Vaters abwehren musste, Geigenprimas zu werden. Zum Saxophon kam Lakatos dabei erst spät, hatte aber bereits jede Menge musikalischer Erfahrung. Und mit dem Jazz kam der junge Tony dann im 8. Bezirk Budapests in Berührung, in dem viele arme Roma lebten, in dem Lakatos aber vor allem bei Jam Sessions bei Freunden in den Jazz eintauchte.
Rainer Erd bettet die Biographie Tony Lakatos’ in die politischen Entwicklungen Ungarns ein, beschreibt die Situation der Roma im Land, ihre Kultur, deren Widerhall in der Musik, in den Cafés und Restaurants Budapests genauso wie auf der Operettenbühne zu hören war, aber auch die lange Diskriminierung, der sie ausgesetzt waren. Die Musikerdynastie der Lakatos’ sah sich in der Tradition des im 18. und frühen 19. Jahrhundert wirkenden Geigers Janos Bihare. Erd erklärt, wie wichtig in der Musik der Roma das Erlernen von Musik durch Hören und Nachahmen sei, ein Ansatz, der Lakatos in seiner Jazzerkarriere genauso hilfreich war wie beim Unterrichten junger Saxophonist:innen.
1977 nahm Lakatos erste Platten auf, gewann den 1. Platz bei einem Musikwettbewerb des ungarischen Fernsehens, während er am Béla Bartók-Konservatorium ein Studium des Jazz-Saxophons begann, dass er allerdings bald wieder abbrach, weil er das Gefühl hatte, bei Auftritten so viel mehr zu lernen. Ab Ende der 1970er Jahre trat er regelmäßig in Griechenland auf, sieht sich selbst als einen Pionier des griechischen Jazz, der ja erst ab Mitte der 1970er Jahre überhaupt zu blühen begann. 1982 brachte er seine erste Platte unter eigenem Namen heraus, “Bacillus”, stieg daneben in der Band des deutschen Gitarristen Toto Blanke ein. Die Zusammenarbeit mit letzterem sorgte dann auch für Lakatos’ Umzug nach Deutschland, wo er erst in Paderborn lebte, dann in München und schließlich in Frankfurt. Erd streift die Zusammenarbeit mit Charly Antolini, Dusko Goykovich und Barbara Dennerlein, erwähnt Platten wie “Different Moods” und “Recycling”, und erzählt von Tonys Zeit mit dem amerikanischen Pianisten Kirk Lightsey und dem ehemaligen Miles Davis-Schlagzeuger Al Foster.
Seit 1993 dann also Festanstellung in der hr Bigband mit genügend Freiraum für eigene Projekte. Erd beschreibt die Veränderung der Bigbandarbeit von der Zeit des Orchesterleiters Kurt Bong in den 1990er Jahren bis zu der der späteren Chefdirigenten Jörg Achim Keller und Jim McNeely. Er stellt weitere CD-Produktionen Lakatos’ vor, zitiert aus Rezensionen, sammelt Würdigungen von musikalischen Weggefährten und schließt mit einem Blick auf Tony Lakatos’ Aktivitäten jetzt, also mitten in der Coronakrise. Er komponiere mehr, erzählt ihm der Saxophonist, und mittendrin habe ihn dann auch noch die Nachricht erreicht, dass er den Hessischen Jazzpreis 2020 erhalte. Von der hr Bigband wird sich Tony Lakatos im November 2021 in den Vorruhestand verabschieden. Als Saxophonist allerdings wird Tony Lakatos gewiss weitermachen, der Musiker, der kein Künstler sein will, mit seinem Instrument und seiner Erfindungsgabe aber ganz große Kunst schafft.
Rainer Erds Buch über Tony Lakatos kann direkt beim Autor unter bestellt werden: Rainer.Erd@t-online.de. Der Preis beträgt € 18,00 + € 3,00 Porto.
Wolfram Knauer (Juli 2020)
Jazzblut 2021 – Berühmte Jazz-Musiker in Aktion
Fotografien von Matthias Creutziger
2020 (DUMONT Kalenderverlag)
Format (B x L): 48.7 x 58.1 cm, 14 Seiten, Spiralbindung, 30€
ISBN 425-0-8096-4699-2

Mit dem gerade erschienenen Jazzkalender mit Bildern des Dresdner Fotografen Matthias Creutziger hat der Dumont Verlag einem Künstler eine Plattform gegeben, der sich seit Jahrzehnten auf vielen Ebenen mit der Welt des Jazz auseinandergesetzt hat. So ist es nur folgerichtig, sein neuestes Werk “Jazzblut” zu betiteln.
Es wurden berühmte Jazzmusikerinnen und-Jazzmusiker an ihren verschiedenen Instrumentengattungen für diesen Kalender ausgewählt: John Scofield an der Gitarre, Sänger Ray Charles, Cellist Mischa Maisky, Pianist Michel Petrucciani, Kontrabassist Henri Texier, Tenorsaxofonist Archie Shepp, Schlagzeuger Elvin Jones, Saxophonist Charles Loyd (Quartett mit Keith Jarrett), Trompeter Tomasz Stanko, Pianistin Mitsuko Ushida, Dirigent Sir Collin Davis und Saxophonist Pharoa (Farrell) Sanders. Hilfreiche biografische Notizen zu den Künstlerinnen und Künstlern finden sich im Anhang des Werkes.
Matthias Creutziger ist freiberuflicher Fotograf mit den Hauptakzenten Jazz, Klassische Musik, Theater und Bildende Kunst. Zudem ist er Jazzkritiker und Organisator von Konzerten, Hausfotograf der Dresdner Semper Oper und kann auf zahlreiche Bildpublikationen und Ausstellungen zurückblicken. Und er hat als Schlagzeuger früher selbst Jazz gemacht. Und dies scheint man seiner Fotografie anzumerken. Er agiert nicht als außenstehender Beobachter , sondern gehört dazu, versucht der physischen Energie des Musizierens mit anderen Mitteln zu folgen.
Matthias Creutziger gilt nicht nur als hervorragender Chronist und stiller Beobachter des Musikgeschehens, sondern als Meister des Verborgenen. Er versucht in den Gesichtern seiner Protagonisten das Zerbrechliche, Intensive und Ernsthafte festzuhalten. Es ist die meditative Energie, ihre Leidenschaft zum Jazz, die in den Fotos ihren Ausdruck findet.
Und so wirkt auch der Kalender mit den Einzelpersonen optisch eher ruhig und focussiert.
Jeder Monat ist einem Musiker und verschiedensten Instrumenten im Großformat gewidmet. Fast alle Protagonisten agieren als optische Solisten aus dem Dunkel heraus im Scheinwerferlicht. So ist bei Ray Charles genau der Moment des puren Glücksempfindens festgehalten. Auch wenn es sich um typische “On Stage” Aufnahmen handelt, sind die Bühne, die Mitmusikerinnen und-musiker oder das Publikum nur in der Imagination des Betrachters präsent.
Matthias Creutziger arbeitet die Jazzgrößen von John Scofield bis Pharao Sanders so dreidimensional heraus, dass sie fast skulptural zu ihrem eigenen Denkmal avancieren. Die Fotos brauchen kein Ornament des schönen Scheins um zu wirken. Sie wirken durch die konzentrierte Individualität des Musikers und der Musikerin. Die interessanten Künstlerzitate auf jedem Kalenderblatt unterstreichen auf einer weiteren Ebene die Annäherung an die Persönlichkeit und die expressive Emotionalität – so entsteht Authentizität pur. “Ich kann keine Trennung zwischen meiner Musik und meinem Leben sehen”-philosophiert Archie Shepp und man glaubt ihm das sofort.
Die Schwarzweiß-Fotografien spielen sehr pointiert und gekonnt mit dem Hell-Dunkel-Effekt der klassischen Jazzfotografie, während die Farbaufnahmen mit der Bewegungsunschärfe eine andere völlig andere Formensprache sprechen. Matthias Creutziger versucht hier, die Zeitdimension der Musik einzufangen, die Dynamik eines John Scofield-Gitarren-Solos in Fotografie zu übersetzen, optische Spuren des Musizierens zu hinterlassen. Alle Fotos atmen alle ein hohes Maß an Authentizität, die stark von der Persönlichkeit und der expressiven Emotionalität der Musiker geprägt ist. Matthias Creutziger führt uns mit seinen eindringlichen “Jazzblut” Fotos aus unserer Alltagswelt hinaus in einen ästhetischen Vorstellungsraum, ohne Ablenkungen in ein intensives Musikerleben, das wir in den Emotionen der Musiker gespiegelt sehen.
Es sind Fotografien, die hervorragend dazu geeignet sind, abzutauchen in eine andere Welt mit meditativen Charakter.
Doris Schröder (Juli 2020)
Das Haffner Alphabet. Wolfgang Haffner im Gespräch
herausgegeben von Rainer Placke
Bad Oeynhausen 2020 (jazzprezzo)
136 Seiten, 1 beiheftende DVD, 25 Euro
ISBN: 978-3-9819538-2-4

Nach Nils Landgren und Michael Wollny ist Wolfgang Haffner der dritte Sparringpartner für Rainer Plackes Buchreihe: Die ist weder Biographie noch reines Interviewbuch, und doch doch in der Konfrontation mit den Stichwortkärtchen, auf die Haffner reagieren kann, biographische und ästhetische Aspekte genauso durch wie solche, die seine Sicht als Musiker wiedergeben.
Da geht es etwa um Altdorf, wo er 1981 seinen ersten Auftritt hatte, oder ums ARD-Wunschkonzert, für das ihm ein Schnurrbart ins Gesicht geschminkt wurde. Es geht um Johann Sebastian Bach, Chris Beier, Dave Brubeck und Till Brönner, die als Einflüsse oder Kollegen eine wichtige Rolle für ihn spielten. Es geht um Phil Collins und den “Club” (dem 1. FC Nürnberg). Es geht um seine Erfahrungen in Klaus Doldingers Band Passport und einen Vertretungsgig in der DSDS-Bigband. Es geht um den eigenen Sound, Emotionen und Peter Erskine, der auf Weather Reports “Night Passage” trommelte, eine von Haffners ersten Fusion-Platten.
Es geht ums Fliegen, um seine Heimat Franken und eine Tournee mit der Fantastischen Vier. Es geht um Steve Gadd und das Geigenspiel seiner Schwester in seiner Jugend. Es geht um seine erste Begegnung mit Peter Herbolzheimer und die Sorgfalt, die er als Musiker auf seine Hände geben muss. Es geht um Ibiza, wo er viel Zeit verbracht hat und seine Freundschaft zu Dieter Ilg. Es geht um den Film “Jazz-Club” von Helge Schneider und darum, wie Elvin Jones seine musikalische Sichtweise auf den Kopf stellte.
Es geht um frühe Kompositionserfahrungen und zwei Jahre, die er in Chaka Khans Band verbrachte. Es geht um Projekte, die er mit seinem Freund und Kollegen Nils Landgren durchführte und darum, wie im indischen Lahore die Menschen oft an anderen Stellen klatschen als hierzulande. Es geht um die Bands Mezzoforte und Metro. Es geht um Nachhaltigkeit und Natur. Es geht um die Zeit, die er als Kind auf der Orgelbank verbrachte und die Band Old Friends, in der er trommelte. Es geht um seine Lieblingsband Pink Floyd und das Streben nach Perfektion.
Es geht um seine Zusammenarbeit mit Thomas Quasthoff und sein Lieblingsquartier auf Tour, den Nightliner. Es geht um die Faszination mit dem Rampenlicht und um die Notwendigkeit der Ruhe. Es geht um die Filmmusik zu “Schtonk”, an der er mitwirkte und das Schlagzeug als Übermittler seiner Emotionen. Es geht um eine Tatort-Folge bei der er “on-screen” mitwirkte, und darum, wie wichtig Teamgeist für die Band ist. Es geht um die USA, in die er schon mal hatte ziehen wollen, und um Unruhe, die er versucht zu vermeiden.
Es geht um Vorbilder und die Notwendigkeit, sich von ihnen zu lösen, und um Visionen, etwa die Pläne für die nächste Tour oder das nächste Album. Es geht um seine Zusammenarbeit mit Konstantin Wecker und den Einfluss der Band Weather Report. Es geht um XXXL-Konzerte vor 60.000 Menschen und ein Xylophon-Projekt, das er immer schon realisieren wollte. Es geht um Yamaha als Schlagzeughersteller und den Produzenten Ypsilon. Es geht um die Notwendigkeit eines guten Zeitmanagements und die Band Zappelbude, die er zusammen mit dem Pianisten Roberto Di Gioia hatte. Und zum Schluss geht es noch um Albert Mangelsdorff, der für ihn Mentor, Bezugsperson und väterlicher Freund zugleich war.
Zwischendrin hören wir außerdem von seinem ersten Schlagzeuglehrer Harald Pompl woei von Kollegen wie Christopher Dell, Max Mutzke und Roberto Di Gioia. Eingeleitet wird das alles mit einem biographischen Vorwort von Roland Spiegel; zum Schluss folgt eine ausführliche Diskographie seiner Aufnahmen zwischen 1983 und 2019. Und zwischendrin finden sich um die 50 Fotos, die Oliver Krato während der sechsstündigen Interview-Session von Haffner machte, die den Schlagzeuger als nachdenklichen genauso wie als humorvollen Menschen portraitieren, der immer ein wenig den Schalk im Nacken zu haben scheint, dabei aber alles, womit er sich befasst, enorm ernst nimmt.
“Das Haffner Alphabet” ist ein Buch zum Blättern und Entdecken. Und zwischen den vielen Karteikarten findet sich tatsächlich viel von der Persönlichkeit des Schlagzeugers.
Wolfram Knauer (Juni 2020)POSITIONEN! Jazz und Politik
(Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung, Band 16)
herausgegeben von Wolfram Knauer
Hofheim 2020 (Wolke Verlag)
248 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-95593-016-5
 Das Buchcover sieht wie ein Nachrichtenbild dieser Tage aus, ein Rapper vor einem Foto, das einen bewaffneten Polizeieinsatz zu zeigen scheint. Das Bild, aufgenommen vom Fotografen Wilfried Heckmann, stammt vom Konzert der Band The Anarchist Republic of Bzzz letztes Jahr in der Darmstädter Centralstation, und es bebildert den Umschlag unseres just erschienenen neuen Buchs, “POSITIONEN! Jazz und Politik”, in dem wir das 16. Darmstädter Jazzforum dokumentieren.
Das Buchcover sieht wie ein Nachrichtenbild dieser Tage aus, ein Rapper vor einem Foto, das einen bewaffneten Polizeieinsatz zu zeigen scheint. Das Bild, aufgenommen vom Fotografen Wilfried Heckmann, stammt vom Konzert der Band The Anarchist Republic of Bzzz letztes Jahr in der Darmstädter Centralstation, und es bebildert den Umschlag unseres just erschienenen neuen Buchs, “POSITIONEN! Jazz und Politik”, in dem wir das 16. Darmstädter Jazzforum dokumentieren.
Dabei fragten Wissenschaftler:innen, Journalit:innen und Musiker:innen nach dem politischen Bewusstsein in unserer eigenen Gesellschaft, im Deutschland des Jahres 2019. So blickt Stephan Braese zu Beginn des Buchs zurück auf frühere politische Diskurseim deutshen Jazz. Henning Vetter diskutiert Musik und Haltung der Band The Dorf. Nina Polaschegg fragt nach den Unterschieden zwischen zeitgenössischer improvisierter und komponierter Musik in ihrem Verhältnis zur politischen Haltung. Benjamin Weidekamp und Michael Haves sprechen darüber, wie politische Haltung ihre Kunst beeinflusst.
Wolfram Knauer diskutiert Argumente für ein politisches Bewusstsein in der deutschen Jazzszene und gleicht diese mit konkreten Beispielen ab. Mario Dunkel analysiert populistische Bewegungen in Deutschland und Österreich und ihre Verwendung afrodiasporischer Musiken. Martin Pfleiderer diskutiert musikalische Interaktion als demokratischen Akt. Nadin Deventer, Lena Jeckel, Tina Heine und Ulrich Stock sprechen über die politische Verantwortung von Jazzfestival-Veranstalter:innen. Nikolaus Neuser und Florian Juncker machen auf den intermedialen Zusammenhang zwischen Musik und gesellschaftlicher Wahrnehmung aufmerksam. Hans Lüdemann erklärt die politische Motivation für seine Entscheidung Jazzmusiker zu werden.
Nikolaus Neuser diskutiert Jazz als gesellschaftliches Rollenmodell. Michael Rüsenberg hinterfragt die Vorstellung, dass Jazz immer politisch sei. Thomas Krüger beschreibt das Potenzial des Jazz für die politische Bildung. Angelika Niescier, Korhan Erel, Tim Isfort und Victoriah Szirmai blicken aus den Perspektiven von Musiker:innen, Veranstalter:innen, Journalist:innen und Publikum auf die Möglichkeiten politischer Aussagen durch Musik. Ulrich Stock sieht Atef Ben Bouzids Film “Cairo Jazzman”.
Das Buch ist auf Deutsch erschienen und ist im Buchhandel erhältlich oder direkt vom Verlag (Wolke Verlag; dort findet sich auch das Vorwort als PDF-Vorschau).
Charlie Parker. The Complete Scores. Full Transcriptions from the Original Recordings
Transkribiert von Chris Romero
Milwaukee/WI 2020 Hal Leonard)
415 Seiten, 60 US-Dollar
ISBN 978-1-5400-6720-3
 Charlie Parkers hundertster Geburtstag hat den einflussreichen Saxophonisten im vergangenen Jahr einmal mehr in die Schlagzeilen gebracht. Der Verlag Hal Leonard feierte das Jubiläum mit einer Prachtausgabe der Transkriptionen von 40 Klassikern aus seinem Repertoire, bei der, anders als im “Omnibook”, nicht nur die Saxophonstimme notiert ist, sondern auch Trompete, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.
Charlie Parkers hundertster Geburtstag hat den einflussreichen Saxophonisten im vergangenen Jahr einmal mehr in die Schlagzeilen gebracht. Der Verlag Hal Leonard feierte das Jubiläum mit einer Prachtausgabe der Transkriptionen von 40 Klassikern aus seinem Repertoire, bei der, anders als im “Omnibook”, nicht nur die Saxophonstimme notiert ist, sondern auch Trompete, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.
Chris Romero, der sich dafür lange in einer stillen Kammer eingeschlossen haben muss, bleibt in seiner Partitur allerdings der Jazzhaltung treu: Nicht jede Note ist notiert; insbesondere das Comping des Klaviers wird nur dort in Notenform angegeben, wo es Lücken füllt oder zum Solo wird, ansonsten reicht ihm hier die Angabe der gespielten Changes. Dasselbe gilt fürs Schlagzeug; vor allem die Melodieinstrumente sowie der Kontrabass dagegen sind durchgängig ausnotiert. Es gibt kein ausgiebiges Vorwort, keine editorischen Vorbemerkungen, keine analytischen Begleittexte. Niemand erklärt us, wie die Auswahl zustande kam und was ausgerechnet diese Titel zu “classic performances” werden ließ.
Für Musiker ist das alles sicher interessant, allerdings wohl nicht so sehr zum Nachspielen als vielmehr zum bewussten Studieren der Aufnahmen. Und so ist das schön gebundene und in einem Pappschuber gelieferte Buch wohl eher eine Studienpartitur, die dann aber auch dem notenfesten Fan die eine oder andere Stelle des Zusammenspiels der Band vergegenwärtigen kann. Mit “Charlie Parker. The Complete Scores” hat man vielleicht nicht die Musik selbst vor sich, aber durchaus eine gute Hörhilfe, die es erlaubt, noch tiefer in Birds Musik einzudringen.
Die transkribierten Titel sind: “Ah-Leu-Cha”; “Anthropology”; “Au Privave”; “Barbados”; “Billie’s Bounce”; “Bird’s Feathers”; “Bird’s Nest”; “Bloomdido”; “Blues for Alice”; “Bongo Bop”; “Chasing the Bird”; “Chi Chi”; “Confirmation”; “Dewey Square”; “Dexterity”; “Donna Lee”; “Drifting On a Red”; “K.C. Blues”; “Kim”; “Klactoveededstene”; “Ko Ko”; “Laird Baird”; “Leap Frog”; “Marmaduke”; “Mohawk”; “Moose the Mooche”; “My Little Suede Shoes”; “Now’s the Time”; “Ornithology”; “Passport”; “Quasimodo”; “Red Cross”; “Relaxin’ at Camarillo”; “Relaxin’ with Lee”; “Scrapple from the Apple”; “Shawnuff”; “Steeplechase”; “Thriving from a Riff”; “Visa”; “Yardbird Suite”.
Wolfram Knauer (Januar 2021)
The Essential W. Royal Stokes Jazz, Blues, and Beyond Reader
von W. Royal Stokes
Elkins/WV 2020 (Hannah Books)
562 Seiten, 30 US-Dollar
ISBN: 979-8611405475
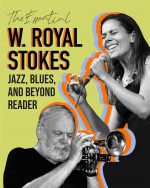 W. Royal Stokes hat in seiner Karriere für die unterschiedlichsten Publikationen geschrieben, die Tageszeitung Washington Post genauso wie für Fachmagazine wie Down Beat oder Jazz Times. Jetzt hat der 1930 geborene Journalist eine Sammlung zahlreicher seiner seit den frühen 1980er Jahren erschienenen kürzeren und längeren Artikel und Interviews zusammengestellt. Sein Interesse gilt dem alten genauso wie dem modernen Jazz, Musiker:innen seiner Wahlheimat Washington D.C., einigen ausgesuchten nicht-amerikanischen Künstler:innen sowie solchen, die eher in der Blues- und Popmusikszene zuhause sind, dem “support network”, also Aktiven des Musikgeschäfts, die sich dafür einsetzen, dass die Szene lebendig bleibt, und schließt mit ausgesuchten Konzert-, Platten- und Buchrezensionen. Konkret geht es also von Ruby Braff bis Andrew Cyrille, von Artie Shaw bis Willem Breuker, von Willis Conover bis zur Jazz Journalists Association, und selbst der Verfasser dieser Rezension kommt in einem Interview zu Wort, das Stokes 2008 mit ihm führte.
W. Royal Stokes hat in seiner Karriere für die unterschiedlichsten Publikationen geschrieben, die Tageszeitung Washington Post genauso wie für Fachmagazine wie Down Beat oder Jazz Times. Jetzt hat der 1930 geborene Journalist eine Sammlung zahlreicher seiner seit den frühen 1980er Jahren erschienenen kürzeren und längeren Artikel und Interviews zusammengestellt. Sein Interesse gilt dem alten genauso wie dem modernen Jazz, Musiker:innen seiner Wahlheimat Washington D.C., einigen ausgesuchten nicht-amerikanischen Künstler:innen sowie solchen, die eher in der Blues- und Popmusikszene zuhause sind, dem “support network”, also Aktiven des Musikgeschäfts, die sich dafür einsetzen, dass die Szene lebendig bleibt, und schließt mit ausgesuchten Konzert-, Platten- und Buchrezensionen. Konkret geht es also von Ruby Braff bis Andrew Cyrille, von Artie Shaw bis Willem Breuker, von Willis Conover bis zur Jazz Journalists Association, und selbst der Verfasser dieser Rezension kommt in einem Interview zu Wort, das Stokes 2008 mit ihm führte.
Insbesondere die Artikel für die Washington Post, die zumeist aus den späten 1970er bis Mitt-1980er Jahren stammen, sind meist kurz und befassen sich oft mit speziellen Themen oder haben mit anstehenden Auftritten in DC und Umgebung zu tun. In den längeren Interviews ist Stokes ein informierter Fragesteller, der durchaus zielgerichtet durchs Gespräch führt, seinen Gesprächspartnern dabei aber durchaus Leine lässt. Dieses Procedere lässt sich beispielsweise gut in den Transkripten zweier Interviews verfolgen, die Stokes 2003 mit dem Trompeter Dave Douglas führte: Das Gespräch führt vom Persönlichen zum Künstlerischen, von ästhetischen hin zu praktischen Fragen des Musikplanens und -machens.
Neben Größen der Jazzgeschichte – unter ihnen ein Telefonat mit Red Norvo oder Interviews mit Earl Hines, Art Hodes, Harry James und Artie Shaw – finden sich zahlreiche unbekanntere Namen, der Schlagzeuger Eddie Phyfe etwa oder der Sänger Jimmy McPhail, der mit der letzten Ellington-Band sang. Stokes’ Gespräch mit Omar Sosa wirkt eher wie ein Oral History Interview, während Monika Herzig seine weitaus formaler gestellten Fragen etwas steifer, weil per e-mail beantwortete. In seinen Konzertbesprechungen für die Post ist Stokes sich immer bewusst, dass er stellvertretend für das Publikum schreibt, das bei den Veranstaltungen dabei war, lässt also immer wieder Gesprächsfetzen mit anderen Besuchern in seine Beschreibung der Veranstaltung einfließen.
Ob die für das Buch ausgewählten Artikel nun wirklich “The Essential” sind oder ob es dem Autor nur schwerfiel eine Auswahl zu treffen, sei dahingestellt. Insbesondere in den Kapiteln mit Rezensionen finden sich einige, die außer historischer Dokumentation (“ach, der hat damals also mit dem dort und dort gespielt”) wenig vermitteln. Auf den Genuss der Lektüre hat das aber keinen negativen Einfluss, da Stokes’ Buch eh als eine Art Lesebuch angelegt ist, bei dem man gern springt und sich von der Abwechslung der Perspektiven überraschen lässt. The Essential W. Royal Stokes Jazz, Blues & Beyond Reader wurde vom Autor im Eigenverlag publiziert; ein Bestelllink findet sich auf seiner Website.
Wolfram Knauer (Januar 2021)
Adrian Rollini. The Life and Music of a Jazz Rambler
von Ate van Delden
Jackson/MS 2020 (University Press of Mississippi)
507 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-1-4968-2516-2
 Adrian Rollini scheint eher ein Nebenthema der Jazzgeschichte zu sein, und doch ist er über seine knapp dreißigjährige Aufnahmegeschichte zu einer Art Legende geworden. Viele kennen ihn als den scheinbar einzigen Bass-Saxophonisten (vor Scott Robinson), andere verbinden Instrumente wie das Goofus oder den Hot Fountain Pen mit seinem Namen. Egal welches Instrument er bediente – neben der Saxophonfamilie waren dies etwa Posaune¹, Klavier, Harpaphone, Xylophon und Vibraphon –, er entwickelte eine bewundernswerte Meisterschaft auf ihnen. Sein Bass-Sax-Spiel beeinflusste Harry Carney und Gerry Mulligan, sein Xylophon-Spiel Red Norvo, und Louis Armstrong gefiel, wie deutlich in Aufnahmen mit Rollini immer der Bass-Part zu hören war.
Adrian Rollini scheint eher ein Nebenthema der Jazzgeschichte zu sein, und doch ist er über seine knapp dreißigjährige Aufnahmegeschichte zu einer Art Legende geworden. Viele kennen ihn als den scheinbar einzigen Bass-Saxophonisten (vor Scott Robinson), andere verbinden Instrumente wie das Goofus oder den Hot Fountain Pen mit seinem Namen. Egal welches Instrument er bediente – neben der Saxophonfamilie waren dies etwa Posaune¹, Klavier, Harpaphone, Xylophon und Vibraphon –, er entwickelte eine bewundernswerte Meisterschaft auf ihnen. Sein Bass-Sax-Spiel beeinflusste Harry Carney und Gerry Mulligan, sein Xylophon-Spiel Red Norvo, und Louis Armstrong gefiel, wie deutlich in Aufnahmen mit Rollini immer der Bass-Part zu hören war.
Nun hat der niederländische Sammler und Jazzforscher Ate van Delden Adrian Rollini eine Biographie gewidmet, die alle Seiten seines musikalischen Schaffens beleuchtet. Er beginnt im Piemont des 19. Jahrhundert, wo sein Vater aufwuchs, der sich in den 1890er Jahren entschied in die Vereinigten Staaten auszuwandern und bald in New York als Kupferstecher arbeitete, nebenbei aber auch Gesangsunterricht gab. Er fand eine ebenfalls italienischstämmige Frau, und am 28. Juni 1903 kam Adrian, ihr erstes Kind, zur Welt. Der besaß das absolute Gehör, erhielt ab dem 3. Lebensjahr Klavierunterricht, und ein erster Artikel über das fünfjährige Wunderkind erschien bereits im Juli 1908 im Musical Observer. Seinen ersten professionellen Erfolge in populäreren Genres feierte Rollini dann 1919 mit dem Einspielen von Klavierwalzen, auf denen er synkopierte Walzer, Broadwayschlager und Novelty-Nummern interpretierte, die mal als Blues, Foxtrot oder als “oriental fox trot” gehandelt wurden.
1922 wurde Rollini Mitglied der California Ramblers, eines vom Geschäftsmann Ed Kirkeby geleiteten Tanzorchesters, in dem Rollini anfangs als zweiter Pianist und Xylophonspieler mitwirkte. Am 7 April 1922 machte er mit dieser Band seine erste Plattenaufnahme, “Little Grey Sweetheart of Mine”, in der sein Xylophonspiel mehr improvisiert als ausgeschrieben hinter der Band zu hören ist. Das Repertoire der Band bestand aus populärer Tanzmusik und sogenannten Novelty-Nummern, etwa Zez Confreys “Stumbling” mit einem Duett der beiden Pianisten im zweiten Teil der Aufnahme. Wenig später wechselte Rollini zum Bass-Saxophon, einem Instrument, das bis dahin kaum im Jazz vorkam, und im September 1922 ist sein erster Solobreak in “I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate” zu hören. Rollini beherrschte das Instrument immer besser und machte sich bald einen Namen als jemand, der nicht nur die Basslinie betonen konnte, sondern daneben auch zu eigenständigen Soli in der Lage war. Optisch war das Bass-Sax ein Hingucker, und in kleineren Ensembles, einer Art Auskopplung aus den California Ramblers, spielte Rollini quasi als Gegenstück den Goofus, ein in Frankreich gefertigtes Spielzeuginstrument (etwa in “San” vom Mai 1924) oder den Hot Fountain Pen, eine Art Miniaturklarinette, nicht größer als ein Füllfederhalter (etwa im “Dixie Stomp” vom Oktober 1925). Inzwischen hatte Rollini die Leitung der California Ramblers übernommen, deren Arrangements immer präziser und swingender wurden.
Van Delden verfolgt das Auf und Ab der California Ramblers, Rollinis Zeit mit Red Nichols, mit dem er ab 1927 Aufnahmen machte, die noch jazziger waren als die Tanzmusikarrangements der Ramblers, und er hört sich die Platten an, die Rollini etwa mit Joe Venuti und Eddie Lang, mit Frankie Trumbauer oder Bix Beiderbecke machte. 1928 reiste Rollini nach England, um zusammen mit dem Trompeter Chelsea Quealey und dem Saxophonisten und Klarinettisten Bobby Davis Mitglied in der Band Fred Elizaldes zu werden, der einen Gig im Londoner Tophotel Savoy innehatte. Die Musik des Ensembles war in den Schlagzeilen, mit Elizalde trat Rollini bald auch auf dem Kontinent, in Paris oder Ostende, auf und war regelmäßig im BBC zu hören. Der amerikanische Tieftöner war einer der Stars der Band und wurde vielfach in der Fachzeitschrift Melody Maker erwähnt. Ende 1929 allerdings waren die Auswirkungen des Börsencrashs auf der Wall Street bis nach London zu spüren, und so entschied sich Rollini zusammen mit seiner Frau Dixie und seinem Bruder, dem Saxophonisten Art, der inzwischen ebenfalls der Elizalde-Band angehörte, nach New York zurückzukehren.
Die Wirtschaftskrise hatte die USA voll im Griff und war auch im Musikgeschäft zu spüren. Eine Weile kam Rollini im Tanzorchester von Bert Lown unter, spielte aber auch mit den New California Ramblers, die an den Ruhm der früheren Band anzuknüpfen versuchten. 1934 wechselte er die Seiten und eröffnete Adrian’s Tap Room, einen Club im Keller des President Hotel in Midtown-Manhattan, bei dessen Eröffnung u.a. Fats Waller spielte. Zwei Jahre später kam en Musikaliengeschäft dazu, außerdem gründete Rollini ein Trio, in dem er in Begleitung von Gitarre und Kontrabass Vibraphon spielte, und wirkte in einer Reihe von Filmen mit. Im Krieg war Rollini in der Truppenbetreuung aktiv, nach Kriegsende allerdings waren andere Stilrichtungen gefragter als sein gefällig-swingende Jazz. Er zog sich mehr und mehr zurück, auch aus Gesundheitsgründen, lebte die Hälfte des Jahres in Florida, die andere in New York, wo er allerdings höchstens noch kleine Engagements wahrnahm. 1956 verunglückte er bei einem lange Zeit nicht ganz geklärten Unfall und verstarb kurz darauf im Alter von 53 Jahren². Er hinterließ ein Aufnahmeschaffen, das 35 Klavierwalzen umfasste, etwa 1.500 Titel auf Schallplatte, darunter 130 unter eigenem Namen, ca. 300 für Rundfunkshows vor-aufgezeichnete Titel, sowie bei 25 Lang- und Kurzfilme.
Ate Van Deldens Buch zeichnet das Leben und die Karriere Adrian Rollinis sorgfältig nach. Seine Endnoten verraten die Akribie, mit der der Autor die verschiedenen Stationen dieser Karriere dokumentieren konnte. Seine Darstellung ist überall an der Sache interessiert und ordnet Rollinis professionellen Lebensweg in den Kontext der Unterhaltungsindustrie der 1920er und 1930er Jahre ein. Van Deldens Interesse gilt allerdings vor allem der Biographie, Auftritts- und Aufnahmedaten seines Protagonisten, nicht dem kulturgeschichtlichen oder gar gesellschaftlichen Kontext. In diesem Ansatz unterscheidet sich Van Delden nicht von anderen Jazzautoren, und doch vergibt er sich ein wenig die Chance, mit der Lupe, die er auf den Basssaxophonisten hält, der ja ganz unterschiedliche Facetten der Musikindustrie insbesondere der 1920er Jahre kennengelernt hatte, vielleicht auch die Veränderung dieser Branche etwas genauer beleuchten zu können. Seine Einlassungen zu den Aufnahmen Rollinis bleiben im Oberflächlichen, ordnen nicht ein und vergleichen auch selten zu dem, was sonst in der Zeit zu hören war. Er beschreibt weder Stil noch stilistische Entwicklung, begründet im nüchternen Ton seiner Darstellung weder, wie sich Rollinis Vibraphon-Trio beispielsweise vom Spiel Lionel Hamptons unterschied (bzw. wie es vielleicht auch von dessen Erfolg beeinflusst war), noch, was genau dazu beigetragen haben mag, dass er nach dem Krieg nicht mehr in der vordersten Reihe mitspielen konnte. Er erwähnt die seichteren und die eher auf den Jazz fokussierten Aufnahmen aus den 1920er Jahren, seine einordnenden Wertungen beschränken sich allerdings zumeist auf Adjektive wie “excellent”, “memorable”, “amazing” oder “nice”. Wie gesagt: Dieses Manko teilt Ate van Deldes Buch mit vielen von Sammlern und Privathistorikern verfassten, die ein enormes Faktenwissen ausbreiten, sich aber an eine Einschätzung der Musik selbst nicht heran trauen. Dabei braucht es gar keines musikwissenschaftlichen Vokabulars, um zu erklären, wo Neuerungen passieren, wieso eine Aufnahme mehr oder auch weniger gelungen ist, wie sich die Musik einer bestimmten Periode zu jener anderer Künstler derselben Zeit verhält.
Davon abgesehen aber ist Ate van Delden hoch zu loben für die Akribie, mit der er, auch in der Herangehensweise und dem Verweis auf seine Quellen immer nachvollziehbar, alle ihm zugänglichen Fakten über Adrian Rollini zusammengetragen und damit eine jahrzehntelange Arbeit abgeschlossen hat. Bruce Raeburn nennt das Buch in seinem Klappentext die “definitive Biographie des Multiinstrumentalisten, Bandleaders und Komponisten Adrian Rollini” – und dem kann man sich nur anschließen, mit der Einschränkung: nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Wolfram Knauer (Oktober 2020)
¹In einer Nachricht von Leser Uwe Ladwig weist dieser darauf hin, dass Rollini niemals Posaune, sondern “mit dem Bass-Saxofon Posaunenstimmen im Baßschlüssel gespielt [habe]. Ladwig weiter: “Da Rollini vom Klavier her kam, war ihm der C-Bass-Schlüssel geläufig. 1929 erschien im Melody Maker eine neunteilige Serie, in der Rollini das Bass-Saxofon bespricht: „The When, Why and How of the Bass Saxophone“. Dort plädiert er im Teil 6 “The Problem of Transposition” für den Bass-Schlüssel in C.”
²Rollini starb nicht mit 53, sondern mit 52. Er hat seinen Geburtstag nicht mehr erlebt (* 28.6.1903 – ∞ 15.5.1956); Hinweis Uwe Ladwig.
Straighten Up and Fly Right. The Life & Music of Nat King Cole
von Will Friedwald
New York 2020 (Oxford University Press)
633 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-088204-4
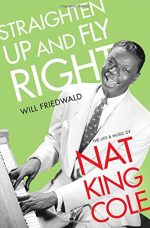 Will Friedwald ist ein ausgewiesener Kenner insbesondere des vokalen Jazz. Nach seinem viel-gelobten Buch über Frank Sinatra (1995) und diversen Büchern über amerikanische Jazz- und Popsänger:innen hat er jetzt eine Biographie Nat King Coles vorgelegt, jenes Musikers, der mehr als vielleicht jeder andere, die Welten zwischen Jazz und Pop überschreiten konnte, weil er einerseits die technische Meisterschaft auf seinem Instrument, dem Klavier, besaß, andererseits eine begeisternde Bühnenpräsenz, und darüber hinaus eine einschmeichelnde Stimme, die ihn schnell zum gefeierten Star aufsteigen ließ. Sein internationaler Ruhm lässt Jazzfans oft vergessen, welch virtuoser Pianist Nat Cole war, der aus Einflüssen durch das Stride Piano und insbesondere Earl Hines einen ganz eigenständigen Personalstil entwickelte und dabei neben den Größten seines Instruments, also Art Tatum oder Oscar Peterson, bestehen konnte.
Will Friedwald ist ein ausgewiesener Kenner insbesondere des vokalen Jazz. Nach seinem viel-gelobten Buch über Frank Sinatra (1995) und diversen Büchern über amerikanische Jazz- und Popsänger:innen hat er jetzt eine Biographie Nat King Coles vorgelegt, jenes Musikers, der mehr als vielleicht jeder andere, die Welten zwischen Jazz und Pop überschreiten konnte, weil er einerseits die technische Meisterschaft auf seinem Instrument, dem Klavier, besaß, andererseits eine begeisternde Bühnenpräsenz, und darüber hinaus eine einschmeichelnde Stimme, die ihn schnell zum gefeierten Star aufsteigen ließ. Sein internationaler Ruhm lässt Jazzfans oft vergessen, welch virtuoser Pianist Nat Cole war, der aus Einflüssen durch das Stride Piano und insbesondere Earl Hines einen ganz eigenständigen Personalstil entwickelte und dabei neben den Größten seines Instruments, also Art Tatum oder Oscar Peterson, bestehen konnte.
Für sein Buch hat Friedwald Archive durchforstet, mit Forscher:innen und Zeitzeugen – einschließlich Nat Coles Bruder Freddy Cole – gesprochen, und er hat viel Musik gehört. Er erzählt Coles Lebensgeschichte biographisch, berichtet von seiner Geburt und Kindheit in Montgomery, Alabama, dem Umzug der Familie nach Chicago, vom Vater, der vor einer Baptistengemeinde predigte, sowie von den wichtigsten musikalischen Einflüssen: der Kirche des Vaters, dem Klavierunterricht durch die Mutter und seinem Idol, dem Pianisten Earl Hines. Mit 14 Jahren, noch in der Schule, stellte Cole seine erste, zehnköpfige Band zusammen, die 1935 von der Lokalpresse als neue Sensation gefeiert wurde. Ein Jahr später machte er seine ersten Aufnahmen, unter dem Namen seines Bruders Eddie, in denen der Einfluss Hines in den Klavierpartien deutlich zu hören ist, tourte mit einer Neuauflage der 1920er-Jahre-Revue “Shuffle Along”.
1937 gründete Cole sein Trio, “aus Zufall”, wie er sagt. “Shuffle Along” war in Los Angeles gestrandet, und Cole war von der Musikszene um die Central Avenue in Los Angeles fasziniert. Er jammte mit Lionel Hampton und Lee Young, dem Bruder des Saxophonisten Lester Young. Der hatte eigentlich auch bei einem Gig dabei sein sollen, den Cole im Swanee Inn in L.A. ergattert hatte, aber er tauchte nicht auf, und so spielten Cole, Gitarrist Oscar Moore und Bassist Wesley Prince eben im Trio. Dass er zu singen begann, sei der Tatsache zu verdanken, dass er das Trio klanglich für zu eintönig hielt. Prince versorgte ihn mit dem Spitznamen “King”, und seine Karriere hob ab.
Warum ein Trio? Nun, ein Quartett mit Schlagzeug hätte zu sehr nach Rhythmusgruppe ausgesehen, und die Leute hätten dann auf den Rest der Band gewartet, argumentiert Cole später. Die ersten eigenen Aufnahmen erfolgten für sogenannte Transcription Services, also Produktionsfirmen für fertige Radiosendungen, die lokale Sender abonnieren und senden konnten. Allein von 1938 stammen 20 Aufnahmen des Trios, zwischen Standards, Pophits der Zeit und an folkige Kinderlieder angelehnte Jump-Versionen wie “Mutiny in the Nursery” oder “Three Blind Mice”. Erst Lionel Hampton brachte ihn im Mai 1940 zu einer Session ins Studio eines Major-Labels, bei der acht Titel entstanden, mit Schlagzeugbegleitung, Lionel Hampton und der Sängerin Helen Forrest. Im Dezember desselben Jahres ging Cole dann mit dem Trio ins Decca-Studio und nahm vier Titel auf, von denen insbesondere “Sweet Lorraine” ein Dauerbrenner seines Repertoires werden sollte. Die Rundfunkpräsenz Anfang der 1940er Jahre und diese Decca-Aufnahmen jedenfalls machten die nationale Presse auf ihn aufmerksam, und bald trat das Trio in den angesagten Clubs von New York und Chicago auf.
Friedwald verfolgt die Aufnahmegeschichte der Band, die im November 1943 richtig abhob, als das Trio bei seiner ersten Plattensitzung fürs kalifornische Label Capitol “Straighten Up and Fly Right” einspielte. Er erzählt die Geschichte des Labels, aber auch jene des Stücks und blättert dabei immer wieder neue Seiten amerikanischer Entertainmenthistorie auf… Er beschreibt, was Coles Interpretationen so besonders macht, erklärt, wie das Repertoire zustande kam, das Cole für Capitol aufnahm, und erzählt über die Zusammenarbeit des Sängers und Pianisten mit seinem neuen Manager Carlos Gastel. Etwa zur selben Zeit begann Norman Granz in Los Angeles mit der Organisation von öffentlichen Konzert-Jam-Sessions, aus denen schließlich Jazz at the Philharmonic-Konzertreihe hervorging, und Cole und Granz kamen für verschiedene Projekte zusammen. Wenn man den Jazzmusiker Nat Cole verstehen will, schreibt Friedwald, müsse man sich nur seine Aufnahmen mit Lester Young von 1942 und 1946 anhören.
Die Säle jedenfalls wurden größer, und Coles Name wurde nun in All-Star-Programmen oft genug in derselben Größe wie jene der Swingstars geschrieben, die in derselben Show zu hören waren. Er nahm neue Hits auf, etwa “Nature Boy” oder Billy Strayhorns “Lush Life”, und war ab 1948 regelmäßig im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand zu sehen. Zwischen den Beschreibungen musikalischer Stationen weiß Friedwald von Coles Privatleben zu berichten, der Ehe mit Maria etwa, der Geburt seiner Tochter Natalie, dem Kauf eines Hauses in einem weißen Viertel von Los Angeles, der zu rassistischen Anwürfen führte.
1950 reiste Cole zum ersten Mal nach Europa, und von nun an begann er endgültig vor allem als Pop- statt als Jazzkünstler wahrgenommen zu werden. “Mona Lisa”, schreibt Friedwald, war vielleicht der Umschwung. Wo Cole zuvor erfolgreich mit dem Arrangeur Pat Rugolo zusammengearbeitet hatte, begann jetzt seine Kooperation mit Nelson Riddle, und immer mehr wurde das Klavier zu einer nebensächlichen Staffage, weil das Publikum vor allem auf Nat King Cole, den Sänger, fokussiert war. Friedwald listet alle Erfolgsstationen auf: einen biographischen Film, Gastauftritte bei populären Fernsehshows, Auftritte in den gefeiertsten Night Clubs der Nation und schließlich seine eigene TV-Show. Immer wieder vergleicht er Coles Erfolg mit dem seiner direkten Konkurrenten, etwa Frank Sinatra oder Bing Crosby. 1961 sang Cole noch bei der Amtseinführung Präsident John F. Kennedy, doch bald darauf wurde erst ein Magengeschwür, dann Lungenkrebs diagnostiziert, eine Folge der vielen Zigaretten, die er zeitlebens geraucht hatte. Im Februar 1965 erlag er der Krankheit im Alter von nur 45 Jahren.
Will Friedwalds Buch ist ein dicker Wälzer und gewiss ein Standardwerk über Nat King Cole. Das Buch ist gut erschlossen durch einen ausführlichen Index und zahlreiche Fußnoten, und jede Phase der Karriere des Pianisten und Sängers ist ausreichend beleuchtet. Dem Autor gelingt es, die Besonderheiten des Stils zu beschreiben, ohne in eine musikalische Fachsprache zu verfallen, und er ist sich an jeder Stelle des Kontextes bewusst, in dem Cole aktiv ist: der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse also genauso wie des Status’ von Jazz und Entertainmentbranche. Und doch ist sein Buch nicht nur vom Umfang her stellenweise etwas schwer geraten. In seinem Hang zur Vollständigkeit macht es Friedwald seinen Leser:innen nämlich teilweise schwer, dabei zu bleiben. Man ist stellenweise geneigt, ihm den Titel seines eigenen Buchs zuzurufen: “Straighten Up and Fly Right!”, denn die Geschichten, die Nat King Cole so mühelos ans Publikum bringen konnten, hätten auch einen stilistisch etwas müheloseren Erzähler verdient.
Wolfram Knauer (Oktober 2020)
Kleine Songs zwischen Freunden
von Arno Fischer
Wiesbaden 2020 (Edition 6065)
110 Seiten, 12 Euro
ISBN: 978-3-941072-23-7
 Arno Fischer ist ein Buch über einen Jazzmusiker gelungen, in dem dessen Musik weitestgehend ausgespart bleibt, das aber dennoch jede Menge über seine künstlerische Haltung verrät. 1996 lernte Fischer seinen Namensvetter kennen, den amerikanischen Pianisten und Künstler John Fischer, und was als berufliche Beziehung begann – Arno Fischer war im Marburger Kulturamt für die Organisation der jährlichen Sommerakademie verantwortlich, bei der John Fischer seit einigen Jahren eine Klasse für freies Malen unterrichtete – wurde bald zu einer Freundschaft. Hinzu kam die Namensgleichheit und die Tatsache, dass die Eltern John Fischers Arno und Sabine geheißen, also die Vornamen des Autors Arno Fischer und seiner Frau getragen hatten. All das trug dazu bei, dass sich der Pianist und Künstler dem Verwaltungsangestellten und (gar nicht mal so heimlichen) Autor weit öffnete.
Arno Fischer ist ein Buch über einen Jazzmusiker gelungen, in dem dessen Musik weitestgehend ausgespart bleibt, das aber dennoch jede Menge über seine künstlerische Haltung verrät. 1996 lernte Fischer seinen Namensvetter kennen, den amerikanischen Pianisten und Künstler John Fischer, und was als berufliche Beziehung begann – Arno Fischer war im Marburger Kulturamt für die Organisation der jährlichen Sommerakademie verantwortlich, bei der John Fischer seit einigen Jahren eine Klasse für freies Malen unterrichtete – wurde bald zu einer Freundschaft. Hinzu kam die Namensgleichheit und die Tatsache, dass die Eltern John Fischers Arno und Sabine geheißen, also die Vornamen des Autors Arno Fischer und seiner Frau getragen hatten. All das trug dazu bei, dass sich der Pianist und Künstler dem Verwaltungsangestellten und (gar nicht mal so heimlichen) Autor weit öffnete.
Im Verlauf der Gespräche, die Arno Fischer in seinem Buch wiederaufleben lässt, erzählt Jean Jacques Fischer, wie John hieß, als 1930 als Sohn eines Goldschmieds in Antwerpen geboren wurde, davon, wie er zwei Tage nach Einmarsch der deutschen Truppen in die Niederlande mit seinen Eltern und Geschwistern zur Flucht Richtung Süden aufbrach. In Le Teil, einem unscheinbaren Ort in Südfrankreich, kamen sie auf einem Bauernhof unter. Er erzählt von den Umständen, den Sorgen und den Unwägbarkeiten der Flucht, über Cannes und Marseille erst nach Casablanca, dann mit einem Schiff Richtung Vereinigte Staaten, das die geflüchteten Passagiere aber in Havanna aussetzte, weil die USA die Einfahrt verweigert hatte. Zwei Jahre lebten sie auf Kuba, dann gelang ihnen die Überfahrt nach Miami, von wo aus sie per Zug nach New York reisten, und… “Eines Morgens fand ich mich wieder, sitzend in einer U-Bahn. Als wenn ich unter einer Käseglocke gelebt hätte, die nun plötzlich weggezogen worden wäre und ich war wieder in die Welt entlassen. Es war die Zeit von Hammerstein und Rodgers and Hart und George and Ira Gershwin, die ganze Welt war swinging, das war für mich die Melodie der Freiheit – und ich wusste, ich war gerettet.”
Soweit der Rahmen. Arno Fischers Buch handelt also von Flucht und den Ängsten des jungen Jean Jacques. Diese verfolgten ihn bis weit in die 1970er Jahre hinein, als er zu einem Auftritt bei den Berliner Jazztagen erstmals zu einem bejubelten Konzert nach Deutschland reiste, nach dem er sich hinter der Bühne dem Antisemitismus der Deutschen wieder ausgesetzt fühlte, ausgerechnet vom Festivalmacher George Gruntz und dem großen Albert Mangelsdorff, aber auch all den anderen anwesenden Deutschen, die sich etwas zuriefen, das er auf sich bezog: “Jetzt, nachdem man die Kunst des Juden genossen hatte”, fasst Arno Fischer die Erinnerung des Pianisten zusammen, “wurde zum Pogrom aufgerufen: ‘Jews!’ Jetzt würden die Deutschen ihr wahres Gesicht zeigen.” Als Hans Kumpf, mit dem Fischer sich angefreundet hatte, ihn aufklärte, dass die Musiker sich tatsächlich nur mit einem freundlichen “Tschüs” verabschiedet hatten, fiel Fischer ein Stein vom Herzen: “So konnte er nach zwei Analysen und dreißig Jahren New York zum ersten Mal einen winzigen Teil seiner Fluchtangst loslassen”.
Flucht und die durch sie verursachten seelischen Narben also sind das eine Thema des Buchs, das zugleich von einer Freundschaft zwischen den beiden Namensvettern handelt, vom Vertrauen-Fassen zwischen einem Nachfahren der Täter- und einem Zeitzeugen der Opfergeneration, und schließlich davon, wie John Fischers durch seine Lebenserfahrungen erlangte Gelassenheit und … vielleicht Weisheit … den jüngeren Fischer, den Autor also, dazu brachte, über sein eigenes Leben zu reflektieren.
Arno Fischers Würdigung ist dabei nur eine teilweise Biographie John Fischers, eine Erzählung über Fluchterfahrung und Erinnerung. Daneben erinnert er sich an die Gespräche, die er mit seinem väterlichen Freund hatte, an die Cafés und Restaurants, in denen diese stattfanden, an Autofahrten und Begegnungen während der Marburger Sommerakademie. John Fischer hatte bereits in den 1970er Jahren die Stätten seiner Kindheit wiederbesucht, war dabei 36 Jahre nach der Flucht auf Menschen getroffen, die er noch von damals kannte, oder auf Fremde, die ihm zeigen wollen, was sich seither alles verändert hatte. Auch davon lässt ihn Arno Fischer erzählen, wie man von fernen, leicht verklärten Erinnerungen: mal klar aufs Detail bedacht, dann dieselbe Begebenheit, aber in unterschiedlichem Kontext. Er zeichnet dabei auch die widersprüchliche Persönlichkeit John Fischers nach, dessen Mürrigkeit man genauso erahnen kann wie seine Liebenswürdigkeit, alles geerdet in einer großen Neugier und gleichzeitigen Ängsten.
Von Jazz ist bei alledem kaum die Rede, eigentlich nur im Anhang, einem Interview, das Hans Kumpf 1977 mit dem Pianisten geführt hatte. Und doch meint man den Jazz dauernd durchzuhören. Arno Fischers Buch nämlich macht uns darauf aufmerksam, dass die Kunst improvisierender Musiker immer aus ihrer eigenen Biographie schöpft, dass es sich lohnt, ihre Perspektive aufs Leben kennenzulernen, um ihrer Musik näherzukommen, dass andererseits die Kenntnis ihrer Lebenserinnerungen durchaus auch die eigene Hörerfahrung komplett umkrempeln kann – so geschehen beim Autor dieser Rezension, der John Fischers Aufnahmen jetzt mit anderen Ohren hören wird.
Wolfram Knauer (Oktober 2020)
MilesStyle. The Fashion of Miles Davis
von Michael Stradford
Los Angeles 2020(self-published)
204 Seiten, 17,99 US-Dollar
ISBN: 978-1647865573
 Michael Stradford ist Medienmanager mit umfangreichen Erfahrungen in Rundfunk, Fernsehen und Film. Jetzt hat er ein Buch über Miles Davis vorgelegt, das sich allerdings nur Rande mit Davis’ Musik zu beschäftigen scheint und stattdessen seine Bühnenpersönlichkeit, oder noch genauer: seine Bühnengarderobe und seinen Sinn für Mode in den Mittelpunkt stellt. Dass und wie Stradford dabei dann doch der Musik ziemlich nahe kommt, ist eine ziemlich erstaunliche und für seiner Leser:innen ungemein befriedigende Erfahrung.
Michael Stradford ist Medienmanager mit umfangreichen Erfahrungen in Rundfunk, Fernsehen und Film. Jetzt hat er ein Buch über Miles Davis vorgelegt, das sich allerdings nur Rande mit Davis’ Musik zu beschäftigen scheint und stattdessen seine Bühnenpersönlichkeit, oder noch genauer: seine Bühnengarderobe und seinen Sinn für Mode in den Mittelpunkt stellt. Dass und wie Stradford dabei dann doch der Musik ziemlich nahe kommt, ist eine ziemlich erstaunliche und für seiner Leser:innen ungemein befriedigende Erfahrung.
In seiner Jugend habe er fast aus Versehen Miles’ “In a Silent Way” gehört und es habe ihm überhaupt nicht gefallen, beginnt Stradford sein Buch. In den frühen 1980ern habe er den Trompeter dann auf seiner Promo-Tour für das Album “The Man with the Horn” in Cincinnati erlebt. Dieser sei in einem weiten rosa Overall aufgetreten, habe eine weiße Strickmütze getragen, auf die das Wort “Pepe” aufgestickt war, und an den Füßen habe er eine Art Pantoffeln getragen. Er habe nicht viel gespielt, doch das Publikum habe ihm begeostert zugejubelt, als er am Ende des Abends kurz winkte. Stradford verstand nicht so recht, was da vor sich ging. Ein paar Tage später sei ihm das Album “My Funny Valentine. Miles Davis in Concert” in die Hände gefallen, und der Ton, den er aus Miles Davis’ Trompete hörte, hielt ihn gefangen. Danach habe er sich nach und nach die anderen Schaffensperioden des Meisters angeeignet. Er habe alles gelesen, was er über den Trompeter finden konnte einschließlich Büchern über seine Malerei. Und er habe davon geträumt, ein großes, reich bebildertes Buch über Miles’ Mode zu schreiben. Dieses Coffertable-Book-Projekt habe sich dann leider aus Kostengründen zerschlagen, doch Stradford fand, die Recherchen rechtfertigten eine Veröffentlichung zumindest seiner Beobachtungen und der Gespräche, die er mit Vertrauten und Experten geführt hatte.
Stradfords erstes Kapitel umfasst die Jahre bis 1949, erzählt von Miles’ Jugend in St. Louis und identifiziert seine Mutter als einen modischen Einfluss, aber auch Fred Astaire (von dem Miles sagte, er habe in etwa seine Größe) und Cary Grant. Auch Clark Terry, der wie er aus St. Louis stammte, habe ihm modisch imponiert, und als Miles einen ersten Gig in Eddie Randles Band hatte, nutzte er die Gage, um “hippe Brooks Brothers”-Anzüge zu kaufen. 1944 ging Miles nach New York, um an der Juilliard School Unterricht zu nehmen, und hier achtete er besonders darauf, dass sein Äußeres nicht seine Kleinstadtherkunft verriet. Stradford blickt auf andere modebewusste Musiker der Zeit, Coleman Hawkins etwa, der Miles schon mal Anzüge besorgte, den Schlagzeuger Charlie Rice, der ihm seinen ersten Maßanzug anfertigte, oder Dexter Gordon, der Miles’ Sinn für Mode kritisierte. Und dann spricht er mit Clark Terry selbst, der erklärt, wie wichtig die Garderobe in den 1940er und 1950er Jahren war, weiß, dass Miles ihn als Jugendlicher nachgeahmt hatte, aber betont, dass er dann doch schnell seinen eigenen Stil gefunden habe (musikalisch wie modisch). Stradford spricht mit dem Modeexperten Lloyd Boston über die Bedeutung von Mode für schwarze Männer und über den Wandel in Miles Davis’ Stil, der über die Jahre immer schriller und auffälliger wurde. Miles Davis sei eine Modeikone gerade, weil er keine sein wollte, erklärt Boston und definiert den “klassischen Miles-Look”: dezente Eleganz, eine Schlichtheit, bei der weniger mehr ist. Schließlich spricht Stradford noch mit dem Filmproduzenten Reggie Hudlin darüber, wie er Miles zum ersten Mal traf, als sein erster Film “House Party” herauskam, und wie er von ihm den Auftrag erhielt, ein Bühnenbild für eine große Show in Paris zu entwerfen, ein Projekt, das dann allerdings nie realisiert wurde.
In den 1950er Jahren hatten Miles’ Pariser Ausflüge, seine Freundschaft zu Juliette Greco Einfluss auch auf den Modesinn des Trompeters. Stradford diskutiert aber auch Miles’ Suchtverhalten und die daraus resultierenden Probleme. Es ging ihm zeitweise richtig dreckig, schreibt Stradford, aber er trat nach wie vor wie aus dem Ei gepellt in der Öffentlichkeit auf. Er betrachtet Fotos von Miles aus jenen Jahren, analysiert die Stoffe, Schnitte, Designer, und er setzt all das ins Verhältnis zur allgemein vorherrschenden Mode der Zeit. Miles, fasst er am Schluss des Kapitels zusammen, habe für sich ein Profil geschaffen wie kein anderer Musiker in der populären Musik, ein Profil, zu dem die Klänge seiner Platten genauso gehörten wie sein visuelles Image. Für dieses Kapitel unterhält Stradford sich mit dem Modeexperten Charlie Davidson über Miles als Kunden in seinem Modegeschäft in Cambridge, Massachusetts, mit Bryan Ferry, der ja selbst als Modeikone gehandelt wird, sowie mit der Modeforscherin Monica Miller über die Tradition der “Black Dandies”.
In den 1960er Jahren übernahm Miles Modetrends aus Italien; selbst Down Beat fand, Miles sei so gut angezogen, dass man mit einem Blick auf ihn erkennen könne, was der Mann nächstes Jahr tragen müsse. Seine Konzerte wurden von den Stars des Showbusiness besucht, sein Erfolg ermöglichte ihm den Kauf eines fünfstöckigen Hauses auf der Upper West Side Manhattans und eines vielbeachteten Ferraris. Zugleich sprach Miles sich offen gegen den Rassismus in den USA aus, und er spielte mit einem Quintett, dessen Musiker größtenteils zumindest zehn Jahre jünger als er waren. Für dieses Kapitel spricht Stradford mit Miles’ Frau Frances Davis über ihre erste Begegnung und seinen Modegeschmack, mit Quincy Jones über Miles’ Talent als Schauspieler und sein Image als harter Bursche, sowie mit Ron Carter über seine erste Begegnung mit dem Trompeter und darüber, dass dieser seinen Musikern freie Hand bei der Entscheidung ließ, was sie auf der Bühne trugen.
Mit “Filles de Kilimanjaro” und “Bitches Brew” begann eine auch modisch völlig andere Zeit. Betty Mabris machte Miles mit der Popmusik der Zeit vertraut und beeinflusste auch seinen modischen Wandel von europäischem Chique hin zu stärker funky wirkenden Klamotten, Lederhemden, Schlangen- und Wildlederhosen, wild-bunten Hemden, die er nie öfter als einmal trug. Für dieses Kapitel spricht Stradford mit der Designerin Andrea Aranow über ihre Entwürfe für Jimi Hendrix und Miles Davis, mit dem Fotografen Anthony Barbosa über ihre Fotosessions Anfang der 1970er Jahre und jene für das Album “You’re Under Arrest”, und mit Betty Mabris/Davis über ihre Modeling-Karriere und den modischen Einfluss, den sie auf ihren Mann hatte.
Ende der 1970er Jahre hörte man eigentlich nur über Miles’ Gesundheitsprobleme; er trat nicht mehr auf, und in Interviews äußerte er oft, wie gelangweilt er sei. Für diese Zeit sammelt Stradford Interviews mit Lenny Kravitz, dessen Eltern mit Miles befreundet waren, mit der Kostümbildnerin Gersha Phillips über die Garderobe, die sie für Don Cheadles Film “Miles Ahead” entwarf, mit dem Perkussionisten James Mtume darüber, dass Miles jedes Mal, wenn sich seine Musik änderte, auch seinen Look änderte, und mit dem Bassisten Michael Henderson über seine erste Begegnung mit Miles und Einkaufstipps vom Chef.
In den 1980er Jahren feierte Miles sein Comeback mit einer Musik, die purer Miles genauso war wie sie auf Popmusik von Cyndi Lauper oder Michael Jackson zurückgriff. Er erhielt Gagen wie ein Rockstar und hatte Gastauftritte bei “Miami Vice” und “Saturday Night Live”. Er versuchte gesünder zu leben und arbeitete mit Quincy Troupe zusammenan seiner Autobiographie. Obwohl dies die vielleicht gesündeste Phase seines Lebens gewesen sein mag, forderten die Krankheiten, die er schon lange mit sich herumschleppte, ihren Tribut. Am 29. September 1991 verstarb er. Für dieses letzte Kapitel spricht Stradford mit dem Modeschöpfer Issey Miyake, dessen Kreationen Miles immer wieder trug; mit dem Bassisten Darryl Jones über Miles’ Sinn für Humor und seine Lust am Kochen; mit dem Kulturwissenschaftler Todd Boyd über die Bedeutung von Miles Davis als Ikone fürs schwarze Amerika und darüber, was sein modischer Geschmack über ihn als Künstler und schwarzer Mann aussagt; mit Jo Gelbard, Miles’ Freundin zur Zeit seines Todes, über ihr Kennenlernen in einem Aufzug, darüber, dass er nach Wandel süchtig gewesen sei, darüber, wie er etliche seiner besten Klamotten ruinierte, weil er sie beim Malen trug, sowie über die Haar-Extensions, an denen er stundenlang arbeitete, damit sie richtig saßen; mit Koshin Satoh, dessen futuristische Kreationen Miles zum Ende seines Lebens gern trug; mit dem Bassisten Marcus Miller über seine erste Begegnung mit dem Trompeter und seine Erfahrungen mit Miles’ Modegeschmack; mit dem Maler Mikel Elam, der eine Weile als Miles’ Assistent arbeitete; und mit Miles Neffen, dem Schlagzeuger und Miles’ Nachlassverwalter Vince Wilburn über den Familiensinn, den der Trompeter hatte, seinen Geschäftssinn, und über die Tatsache, dass er sich schon mal fünf- oder sechsmal am Tag umzog.
Michael Stradfords gelingt es ein ungemein unterhaltsames und zugleich erleuchtendes Buch über Miles Davis zu schreiben, obwohl er sich fast nie über die Musik selbst auslässt. Sein Erkenntnisinteresse über modische Fragen sorgt dafür, dass in seinen Interviews unbekannte Details über Miles Leben und künstlerischen Ansatz zur Sprache kommen, die auch seine Musik besser verstehen lassen. Und so gelingt es ihm in dem Buch, obwohl er so wenig zur Musik schreibt, doch sehr viel Erhellendes über sie auszubreiten. Als Leser macht man eine Erfahrung, wie wenn man etwas aus dem Augenwinkel heraus betrachtet und dabei klarer Details erkennt, die einem beim direkten Blick entgangen wären. Eine großartige Ergänzung zur Literatur über Miles Davis – und von so unerwarteter Seite.
Wolfram Knauer (Juli 2020)
Tony Lakatos. Sagt nur nicht Künstler zu mir
Von Rainer Erd
Frankfurt/Main 2020 (Books on Demand)
203 Seiten, viele Fotos
ISBN: 9783751971287
 Tony Lakatos: Der virtuose, immer verlässliche, stilistisch vielfältige, dabei ungemein bescheidene Saxophonist ist scheinbar auf jeder Bühne des Landes zuhause. In Frankfurt lebt er seit 1993 und ist seither einer der Anker der hr-Bigband. Rainer Erd hatte sich mit Lakatos’ Biographie erstmals bei einer Gesprächsveranstaltung auseinandergesetzt, bei der der gebürtige Ungar von seinem Lebensweg “vom Budapester Gypsy-Kindergeiger zum weltbekannten Jazz-Saxophonisten” erzählte. In der Folge befragte Erd den Saxophonisten ausgiebig, sprach mit Kolleg:innen aus Bigband und Szene und reiste sogar selbst nach Budapest, um die Herkunft Lakatos’ besser zu verstehen. “Sag nur nicht Künstler zu mir”, habe Lakatos ihm einmal gesagt und darauf bestanden, sein Beruf sei Musiker. Sein Talent war ihm in die Wiege gelegt war, wenn er auch erst einmal den Wunsch des Vaters abwehren musste, Geigenprimas zu werden. Zum Saxophon kam Lakatos dabei erst spät, hatte aber bereits jede Menge musikalischer Erfahrung. Und mit dem Jazz kam der junge Tony dann im 8. Bezirk Budapests in Berührung, in dem viele arme Roma lebten, in dem Lakatos aber vor allem bei Jam Sessions bei Freunden in den Jazz eintauchte.
Tony Lakatos: Der virtuose, immer verlässliche, stilistisch vielfältige, dabei ungemein bescheidene Saxophonist ist scheinbar auf jeder Bühne des Landes zuhause. In Frankfurt lebt er seit 1993 und ist seither einer der Anker der hr-Bigband. Rainer Erd hatte sich mit Lakatos’ Biographie erstmals bei einer Gesprächsveranstaltung auseinandergesetzt, bei der der gebürtige Ungar von seinem Lebensweg “vom Budapester Gypsy-Kindergeiger zum weltbekannten Jazz-Saxophonisten” erzählte. In der Folge befragte Erd den Saxophonisten ausgiebig, sprach mit Kolleg:innen aus Bigband und Szene und reiste sogar selbst nach Budapest, um die Herkunft Lakatos’ besser zu verstehen. “Sag nur nicht Künstler zu mir”, habe Lakatos ihm einmal gesagt und darauf bestanden, sein Beruf sei Musiker. Sein Talent war ihm in die Wiege gelegt war, wenn er auch erst einmal den Wunsch des Vaters abwehren musste, Geigenprimas zu werden. Zum Saxophon kam Lakatos dabei erst spät, hatte aber bereits jede Menge musikalischer Erfahrung. Und mit dem Jazz kam der junge Tony dann im 8. Bezirk Budapests in Berührung, in dem viele arme Roma lebten, in dem Lakatos aber vor allem bei Jam Sessions bei Freunden in den Jazz eintauchte.
Rainer Erd bettet die Biographie Tony Lakatos’ in die politischen Entwicklungen Ungarns ein, beschreibt die Situation der Roma im Land, ihre Kultur, deren Widerhall in der Musik, in den Cafés und Restaurants Budapests genauso wie auf der Operettenbühne zu hören war, aber auch die lange Diskriminierung, der sie ausgesetzt waren. Die Musikerdynastie der Lakatos’ sah sich in der Tradition des im 18. und frühen 19. Jahrhundert wirkenden Geigers Janos Bihare. Erd erklärt, wie wichtig in der Musik der Roma das Erlernen von Musik durch Hören und Nachahmen sei, ein Ansatz, der Lakatos in seiner Jazzerkarriere genauso hilfreich war wie beim Unterrichten junger Saxophonist:innen.
1977 nahm Lakatos erste Platten auf, gewann den 1. Platz bei einem Musikwettbewerb des ungarischen Fernsehens, während er am Béla Bartók-Konservatorium ein Studium des Jazz-Saxophons begann, dass er allerdings bald wieder abbrach, weil er das Gefühl hatte, bei Auftritten so viel mehr zu lernen. Ab Ende der 1970er Jahre trat er regelmäßig in Griechenland auf, sieht sich selbst als einen Pionier des griechischen Jazz, der ja erst ab Mitte der 1970er Jahre überhaupt zu blühen begann. 1982 brachte er seine erste Platte unter eigenem Namen heraus, “Bacillus”, stieg daneben in der Band des deutschen Gitarristen Toto Blanke ein. Die Zusammenarbeit mit letzterem sorgte dann auch für Lakatos’ Umzug nach Deutschland, wo er erst in Paderborn lebte, dann in München und schließlich in Frankfurt. Erd streift die Zusammenarbeit mit Charly Antolini, Dusko Goykovich und Barbara Dennerlein, erwähnt Platten wie “Different Moods” und “Recycling”, und erzählt von Tonys Zeit mit dem amerikanischen Pianisten Kirk Lightsey und dem ehemaligen Miles Davis-Schlagzeuger Al Foster.
Seit 1993 dann also Festanstellung in der hr Bigband mit genügend Freiraum für eigene Projekte. Erd beschreibt die Veränderung der Bigbandarbeit von der Zeit des Orchesterleiters Kurt Bong in den 1990er Jahren bis zu der der späteren Chefdirigenten Jörg Achim Keller und Jim McNeely. Er stellt weitere CD-Produktionen Lakatos’ vor, zitiert aus Rezensionen, sammelt Würdigungen von musikalischen Weggefährten und schließt mit einem Blick auf Tony Lakatos’ Aktivitäten jetzt, also mitten in der Coronakrise. Er komponiere mehr, erzählt ihm der Saxophonist, und mittendrin habe ihn dann auch noch die Nachricht erreicht, dass er den Hessischen Jazzpreis 2020 erhalte. Von der hr Bigband wird sich Tony Lakatos im November 2021 in den Vorruhestand verabschieden. Als Saxophonist allerdings wird Tony Lakatos gewiss weitermachen, der Musiker, der kein Künstler sein will, mit seinem Instrument und seiner Erfindungsgabe aber ganz große Kunst schafft.
Rainer Erds Buch über Tony Lakatos kann direkt beim Autor unter bestellt werden: Rainer.Erd@t-online.de. Der Preis beträgt € 18,00 + € 3,00 Porto.
Wolfram Knauer (Juli 2020)
Jazzblut 2021 – Berühmte Jazz-Musiker in Aktion
Fotografien von Matthias Creutziger
2020 (DUMONT Kalenderverlag)
Format (B x L): 48.7 x 58.1 cm, 14 Seiten, Spiralbindung, 30€
ISBN 425-0-8096-4699-2

Mit dem gerade erschienenen Jazzkalender mit Bildern des Dresdner Fotografen Matthias Creutziger hat der Dumont Verlag einem Künstler eine Plattform gegeben, der sich seit Jahrzehnten auf vielen Ebenen mit der Welt des Jazz auseinandergesetzt hat. So ist es nur folgerichtig, sein neuestes Werk “Jazzblut” zu betiteln.
Es wurden berühmte Jazzmusikerinnen und-Jazzmusiker an ihren verschiedenen Instrumentengattungen für diesen Kalender ausgewählt: John Scofield an der Gitarre, Sänger Ray Charles, Cellist Mischa Maisky, Pianist Michel Petrucciani, Kontrabassist Henri Texier, Tenorsaxofonist Archie Shepp, Schlagzeuger Elvin Jones, Saxophonist Charles Loyd (Quartett mit Keith Jarrett), Trompeter Tomasz Stanko, Pianistin Mitsuko Ushida, Dirigent Sir Collin Davis und Saxophonist Pharoa (Farrell) Sanders. Hilfreiche biografische Notizen zu den Künstlerinnen und Künstlern finden sich im Anhang des Werkes.
Matthias Creutziger ist freiberuflicher Fotograf mit den Hauptakzenten Jazz, Klassische Musik, Theater und Bildende Kunst. Zudem ist er Jazzkritiker und Organisator von Konzerten, Hausfotograf der Dresdner Semper Oper und kann auf zahlreiche Bildpublikationen und Ausstellungen zurückblicken. Und er hat als Schlagzeuger früher selbst Jazz gemacht. Und dies scheint man seiner Fotografie anzumerken. Er agiert nicht als außenstehender Beobachter , sondern gehört dazu, versucht der physischen Energie des Musizierens mit anderen Mitteln zu folgen.
Matthias Creutziger gilt nicht nur als hervorragender Chronist und stiller Beobachter des Musikgeschehens, sondern als Meister des Verborgenen. Er versucht in den Gesichtern seiner Protagonisten das Zerbrechliche, Intensive und Ernsthafte festzuhalten. Es ist die meditative Energie, ihre Leidenschaft zum Jazz, die in den Fotos ihren Ausdruck findet.
Und so wirkt auch der Kalender mit den Einzelpersonen optisch eher ruhig und focussiert.
Jeder Monat ist einem Musiker und verschiedensten Instrumenten im Großformat gewidmet. Fast alle Protagonisten agieren als optische Solisten aus dem Dunkel heraus im Scheinwerferlicht. So ist bei Ray Charles genau der Moment des puren Glücksempfindens festgehalten. Auch wenn es sich um typische “On Stage” Aufnahmen handelt, sind die Bühne, die Mitmusikerinnen und-musiker oder das Publikum nur in der Imagination des Betrachters präsent.
Matthias Creutziger arbeitet die Jazzgrößen von John Scofield bis Pharao Sanders so dreidimensional heraus, dass sie fast skulptural zu ihrem eigenen Denkmal avancieren. Die Fotos brauchen kein Ornament des schönen Scheins um zu wirken. Sie wirken durch die konzentrierte Individualität des Musikers und der Musikerin. Die interessanten Künstlerzitate auf jedem Kalenderblatt unterstreichen auf einer weiteren Ebene die Annäherung an die Persönlichkeit und die expressive Emotionalität – so entsteht Authentizität pur. “Ich kann keine Trennung zwischen meiner Musik und meinem Leben sehen”-philosophiert Archie Shepp und man glaubt ihm das sofort.
Die Schwarzweiß-Fotografien spielen sehr pointiert und gekonnt mit dem Hell-Dunkel-Effekt der klassischen Jazzfotografie, während die Farbaufnahmen mit der Bewegungsunschärfe eine andere völlig andere Formensprache sprechen. Matthias Creutziger versucht hier, die Zeitdimension der Musik einzufangen, die Dynamik eines John Scofield-Gitarren-Solos in Fotografie zu übersetzen, optische Spuren des Musizierens zu hinterlassen. Alle Fotos atmen alle ein hohes Maß an Authentizität, die stark von der Persönlichkeit und der expressiven Emotionalität der Musiker geprägt ist. Matthias Creutziger führt uns mit seinen eindringlichen “Jazzblut” Fotos aus unserer Alltagswelt hinaus in einen ästhetischen Vorstellungsraum, ohne Ablenkungen in ein intensives Musikerleben, das wir in den Emotionen der Musiker gespiegelt sehen.
Es sind Fotografien, die hervorragend dazu geeignet sind, abzutauchen in eine andere Welt mit meditativen Charakter.
Doris Schröder (Juli 2020)
Das Haffner Alphabet. Wolfgang Haffner im Gespräch
herausgegeben von Rainer Placke
Bad Oeynhausen 2020 (jazzprezzo)
136 Seiten, 1 beiheftende DVD, 25 Euro
ISBN: 978-3-9819538-2-4

Nach Nils Landgren und Michael Wollny ist Wolfgang Haffner der dritte Sparringpartner für Rainer Plackes Buchreihe: Die ist weder Biographie noch reines Interviewbuch, und doch doch in der Konfrontation mit den Stichwortkärtchen, auf die Haffner reagieren kann, biographische und ästhetische Aspekte genauso durch wie solche, die seine Sicht als Musiker wiedergeben.
Da geht es etwa um Altdorf, wo er 1981 seinen ersten Auftritt hatte, oder ums ARD-Wunschkonzert, für das ihm ein Schnurrbart ins Gesicht geschminkt wurde. Es geht um Johann Sebastian Bach, Chris Beier, Dave Brubeck und Till Brönner, die als Einflüsse oder Kollegen eine wichtige Rolle für ihn spielten. Es geht um Phil Collins und den “Club” (dem 1. FC Nürnberg). Es geht um seine Erfahrungen in Klaus Doldingers Band Passport und einen Vertretungsgig in der DSDS-Bigband. Es geht um den eigenen Sound, Emotionen und Peter Erskine, der auf Weather Reports “Night Passage” trommelte, eine von Haffners ersten Fusion-Platten.
Es geht ums Fliegen, um seine Heimat Franken und eine Tournee mit der Fantastischen Vier. Es geht um Steve Gadd und das Geigenspiel seiner Schwester in seiner Jugend. Es geht um seine erste Begegnung mit Peter Herbolzheimer und die Sorgfalt, die er als Musiker auf seine Hände geben muss. Es geht um Ibiza, wo er viel Zeit verbracht hat und seine Freundschaft zu Dieter Ilg. Es geht um den Film “Jazz-Club” von Helge Schneider und darum, wie Elvin Jones seine musikalische Sichtweise auf den Kopf stellte.
Es geht um frühe Kompositionserfahrungen und zwei Jahre, die er in Chaka Khans Band verbrachte. Es geht um Projekte, die er mit seinem Freund und Kollegen Nils Landgren durchführte und darum, wie im indischen Lahore die Menschen oft an anderen Stellen klatschen als hierzulande. Es geht um die Bands Mezzoforte und Metro. Es geht um Nachhaltigkeit und Natur. Es geht um die Zeit, die er als Kind auf der Orgelbank verbrachte und die Band Old Friends, in der er trommelte. Es geht um seine Lieblingsband Pink Floyd und das Streben nach Perfektion.
Es geht um seine Zusammenarbeit mit Thomas Quasthoff und sein Lieblingsquartier auf Tour, den Nightliner. Es geht um die Faszination mit dem Rampenlicht und um die Notwendigkeit der Ruhe. Es geht um die Filmmusik zu “Schtonk”, an der er mitwirkte und das Schlagzeug als Übermittler seiner Emotionen. Es geht um eine Tatort-Folge bei der er “on-screen” mitwirkte, und darum, wie wichtig Teamgeist für die Band ist. Es geht um die USA, in die er schon mal hatte ziehen wollen, und um Unruhe, die er versucht zu vermeiden.
Es geht um Vorbilder und die Notwendigkeit, sich von ihnen zu lösen, und um Visionen, etwa die Pläne für die nächste Tour oder das nächste Album. Es geht um seine Zusammenarbeit mit Konstantin Wecker und den Einfluss der Band Weather Report. Es geht um XXXL-Konzerte vor 60.000 Menschen und ein Xylophon-Projekt, das er immer schon realisieren wollte. Es geht um Yamaha als Schlagzeughersteller und den Produzenten Ypsilon. Es geht um die Notwendigkeit eines guten Zeitmanagements und die Band Zappelbude, die er zusammen mit dem Pianisten Roberto Di Gioia hatte. Und zum Schluss geht es noch um Albert Mangelsdorff, der für ihn Mentor, Bezugsperson und väterlicher Freund zugleich war.
Zwischendrin hören wir außerdem von seinem ersten Schlagzeuglehrer Harald Pompl woei von Kollegen wie Christopher Dell, Max Mutzke und Roberto Di Gioia. Eingeleitet wird das alles mit einem biographischen Vorwort von Roland Spiegel; zum Schluss folgt eine ausführliche Diskographie seiner Aufnahmen zwischen 1983 und 2019. Und zwischendrin finden sich um die 50 Fotos, die Oliver Krato während der sechsstündigen Interview-Session von Haffner machte, die den Schlagzeuger als nachdenklichen genauso wie als humorvollen Menschen portraitieren, der immer ein wenig den Schalk im Nacken zu haben scheint, dabei aber alles, womit er sich befasst, enorm ernst nimmt.
“Das Haffner Alphabet” ist ein Buch zum Blättern und Entdecken. Und zwischen den vielen Karteikarten findet sich tatsächlich viel von der Persönlichkeit des Schlagzeugers.
Wolfram Knauer (Juni 2020)POSITIONEN! Jazz und Politik
(Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung, Band 16)
herausgegeben von Wolfram Knauer
Hofheim 2020 (Wolke Verlag)
248 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-95593-016-5
 Das Buchcover sieht wie ein Nachrichtenbild dieser Tage aus, ein Rapper vor einem Foto, das einen bewaffneten Polizeieinsatz zu zeigen scheint. Das Bild, aufgenommen vom Fotografen Wilfried Heckmann, stammt vom Konzert der Band The Anarchist Republic of Bzzz letztes Jahr in der Darmstädter Centralstation, und es bebildert den Umschlag unseres just erschienenen neuen Buchs, “POSITIONEN! Jazz und Politik”, in dem wir das 16. Darmstädter Jazzforum dokumentieren.
Das Buchcover sieht wie ein Nachrichtenbild dieser Tage aus, ein Rapper vor einem Foto, das einen bewaffneten Polizeieinsatz zu zeigen scheint. Das Bild, aufgenommen vom Fotografen Wilfried Heckmann, stammt vom Konzert der Band The Anarchist Republic of Bzzz letztes Jahr in der Darmstädter Centralstation, und es bebildert den Umschlag unseres just erschienenen neuen Buchs, “POSITIONEN! Jazz und Politik”, in dem wir das 16. Darmstädter Jazzforum dokumentieren.
Dabei fragten Wissenschaftler:innen, Journalit:innen und Musiker:innen nach dem politischen Bewusstsein in unserer eigenen Gesellschaft, im Deutschland des Jahres 2019. So blickt Stephan Braese zu Beginn des Buchs zurück auf frühere politische Diskurseim deutshen Jazz. Henning Vetter diskutiert Musik und Haltung der Band The Dorf. Nina Polaschegg fragt nach den Unterschieden zwischen zeitgenössischer improvisierter und komponierter Musik in ihrem Verhältnis zur politischen Haltung. Benjamin Weidekamp und Michael Haves sprechen darüber, wie politische Haltung ihre Kunst beeinflusst.
Wolfram Knauer diskutiert Argumente für ein politisches Bewusstsein in der deutschen Jazzszene und gleicht diese mit konkreten Beispielen ab. Mario Dunkel analysiert populistische Bewegungen in Deutschland und Österreich und ihre Verwendung afrodiasporischer Musiken. Martin Pfleiderer diskutiert musikalische Interaktion als demokratischen Akt. Nadin Deventer, Lena Jeckel, Tina Heine und Ulrich Stock sprechen über die politische Verantwortung von Jazzfestival-Veranstalter:innen. Nikolaus Neuser und Florian Juncker machen auf den intermedialen Zusammenhang zwischen Musik und gesellschaftlicher Wahrnehmung aufmerksam. Hans Lüdemann erklärt die politische Motivation für seine Entscheidung Jazzmusiker zu werden.
Nikolaus Neuser diskutiert Jazz als gesellschaftliches Rollenmodell. Michael Rüsenberg hinterfragt die Vorstellung, dass Jazz immer politisch sei. Thomas Krüger beschreibt das Potenzial des Jazz für die politische Bildung. Angelika Niescier, Korhan Erel, Tim Isfort und Victoriah Szirmai blicken aus den Perspektiven von Musiker:innen, Veranstalter:innen, Journalist:innen und Publikum auf die Möglichkeiten politischer Aussagen durch Musik. Ulrich Stock sieht Atef Ben Bouzids Film “Cairo Jazzman”.
Das Buch ist auf Deutsch erschienen und ist im Buchhandel erhältlich oder direkt vom Verlag (Wolke Verlag; dort findet sich auch das Vorwort als PDF-Vorschau).
Stratusphunk. The Life and Works of George Russell
von Duncan Heining
Framlingham, Suffolk 2020 (Jazz Internationale)
345 Seiten, 14,99 Britische Pfund
ISBN: 9798697792612
 Mit “Stratusphunk” legt Duncan Heining die zweite Ausgabe seiner Biographie des Komponisten und Theoretikers George Russell vor, die ursprünglich vor zehn Jahre beim amerikanischen Verlag Scarecrow Press erschienen war. Die Neuauflage enthält Änderungen, darunter eine etwas ausführlichere Diskussion des von Russell entwickelten Lydian Chromatic Concept. In der ersten Ausgabe, erklärt Heining, habe er noch verschwiegen, dass der 2009 verstorbene Russell zum Zeitpunkt seiner Recherchen und Interviews bereits an Folgen einer fortschreitenden Demenz litt. Russell habe damals mit Hilfe seiner Partnerin weiter gearbeitet; durch eine Offenlegung seiner Erkrankung seien seine Einnahmen gefährdet gewesen. Beim Verfassen seines Buchs hätten insbesondere die zahlreichen Mythen im Weg gestanden, schreibt Heining, die Russell über die Jahre zum Teil selbst über seine Biographie pflanzte und die er als Biograph so weit wie möglich klären wollte.
Mit “Stratusphunk” legt Duncan Heining die zweite Ausgabe seiner Biographie des Komponisten und Theoretikers George Russell vor, die ursprünglich vor zehn Jahre beim amerikanischen Verlag Scarecrow Press erschienen war. Die Neuauflage enthält Änderungen, darunter eine etwas ausführlichere Diskussion des von Russell entwickelten Lydian Chromatic Concept. In der ersten Ausgabe, erklärt Heining, habe er noch verschwiegen, dass der 2009 verstorbene Russell zum Zeitpunkt seiner Recherchen und Interviews bereits an Folgen einer fortschreitenden Demenz litt. Russell habe damals mit Hilfe seiner Partnerin weiter gearbeitet; durch eine Offenlegung seiner Erkrankung seien seine Einnahmen gefährdet gewesen. Beim Verfassen seines Buchs hätten insbesondere die zahlreichen Mythen im Weg gestanden, schreibt Heining, die Russell über die Jahre zum Teil selbst über seine Biographie pflanzte und die er als Biograph so weit wie möglich klären wollte.
Kurz vor der Veröffentlichung der ersten Ausgabe zeigte sich Russell besorgt. Es gäbe da eine Geschichte aus seiner Jugend, die er nicht im Buch haben wolle: Ein weißer Bassist, Freund der Familie, war damals von zwei ebenfalls weißen Männern geschlagen worden, offenbar Polizeibeamten, weil er mit Schwarzen verkehrte. Jetzt also wollte Russell diese Geschichte aus dem Manuskript streichen, aus Furcht, wie Bürger und Offizielle in Cincinnati, wo das alles geschehen war, auf sie reagieren würden. Für Russell, schreibt Heining, habe die Entdeckung des Lydian Chromatic Concept im Mittelpunkt der Arbeit an dem Buch gestanden; und so haber er nicht verstanden, warum die Leser an irgendwelchen halbgaren Geschichten aus seiner Jugend interessiert sein sollten. Für Heining, den Biographen, allerdings waren eben auch die Umstände wichtig, die den Menschen und Künstler Russell prägten. Die Geschichte jedenfalls erklärt viel über Heinings Herangehensweise an das Buch: reflektiert, mit Respekt vor dem Subjekt und seiner Haltung gegenüber der Musik, zugleich mit einem kritischen Bewusstsein gegenüber all den Informationen, die er bei seinen Recherchen sammelte, in Archiven, von Zeitzeugen oder gar von Russell selbst.
Bereits die Umstände seiner Geburt im Juni 1923 seien nicht gänzlich klar, weiß Heining. Seine Mutter gebar George unter einem Pseudonym und gab ihn danach zur Adoption frei. So wuchs Russell bei Adoptiveltern auf, einer Krankenschwester und einem Koch für die Eisenbahngesellschaft. Er erinnert sich an Rassismus-Erfahrungen seiner Jugend, und an Strategien, die er entwickelte, um diesen zu begegnen, und Heining ergänzt all dies mit seinen Recherchen über Alltagsrassismus in Cincinnati. Erst im Alter von 12 Jahren erfuhr Russell von der Adoption; seine Adoptivmutter identifizierte seinen leiblichen Vater als einen weißen Musikprofessor am Oberlin College und seine Mutter eine hellhäutige schwarze Studentin aus reichem Hause. Diese Geschichte sei nirgends zu verifizieren, erklärt Heining, es sei aber interessant zu verfolgen, wie Russell sie über die Jahre immer wieder erzählte und dabei quasi sein musikalisches Talent den Genen seines weißen Vaters zuschrieb.
Heining beschreibt Russells Weg zur Musik, Einflüsse auf ihn und frühe musikalische Begegnungen, seine Tuberkulose-Erkrankung, die Musikszene von Cincinnati, in der Russell seine ersten professionellen Erfahrungen sammelte, sein Studium an der Wilberforce University. In den Anfangstagen spielte Russell Schlagzeug, und als Schlagzeuger wurde er 1943 von Benny Carter angeheuert, mit dessen Orchester er zum ersten Mal nach New York und ebenfalls zum ersten Mal mit dem Bebop in Kontakt kam. Carter war von seinen Instrumentalkünsten nicht ganz so überzeugt, und als Russell nach kurzer Zeit gefeuert wurde, nahm er dies als Chance sich lieber dem musikalischen Metier zu widmen, das er um einiges spannender fand: der Komposition. Er schrieb “New World”, ein Arrangement, das er nacheinander an Benny Carter, Cab Calloway, Earl Hines und Dizzy Gillespie verkaufte. Er beschäftigte sich mit dem Werk klassischer Komponisten wie Claude Debussy und Maurice Ravel, deren Einflüsse sich etwa in einigen seiner Arrangements niederschlugen, die er bald für Earl Hines’ Orchester in Chicago verfasste.
Zurück in New York freundete er sich mit den jungen Beboppern an und entwickelte, als er erneut 15 Monate mit Tuberkulose im Krankenhaus zubringen musste, die Grundidee seines Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, dessen Bedeutung Heining folgendermaßen zusammenfasst: “It increases the range of musical choices for improviser and composer and, perhaps more importantly, it was based on observation of the actual practice of jazz musicians” (64). Auslöser zur Entwicklung seiner Theorie sei eine Bemerkung Miles Davis’ gewesen, der ichm gesagt habe: “Wo willst Du musikalisch eigentlich hin? Ich jedenfalls will alle Changes lernen.” Weihnachten 1946 wurde Russell aus dem Krankenhaus entlassen und lebte eine Weile bei der Familie Max Roachs. Er nahm Kompositionsunterricht bei Stefan Wolpe, und er schrieb mit “Cuban-Be, Cubano-Bop” für Dizzy Gillespies Bigband und den Perkussionisten Chano Pozo seine erste modale Komposition.
Heining folgt Russells Karriere und seine kompositorische Entwicklung, von “A Bird in Igor’s Yard”, das er für die Band des Klarinettisten Buddy DeFranco schrieb, über die Gruppe an Musikern, die mit Miles Davis an dessen “Birth of the Cool”-Konzept arbeitete, seine Zusammenarbeit mit Lee Konitz, für dessen Sextett (mit Miles Davis) er “Ezz-thetic” und “Odjenar” schrieb, über Nicht-Musiker-Jobs im Warenhaus Macy’s oder als Koch in verschiedenen Diners der Stadt bis hin zur Veröffentlichung seines “Lydian Chromatic Concept” 1953 im Selbstverlag. Das Buch verkaufte sich nicht besonders gut, die Idee dahinter allerdings, dass man sein Tonmaterial nämlich aus Skalen beziehen könne statt sich auf die Akkordstrukturen der Improvisationsgrundlage zu fokussieren, sprach sich in Musikerkreisen schnell herum.
Russell war nicht der einzige Musiker der Avantgarde-Jazzszene, der sich mit Musiktheorie befasste oder der versuchte Erkenntnisse der klassischen Musikwelt mit den improvisierten Traditionen des Jazz zu verbinden. 1956 stellte Teddy Charles für Atlantic Records ein Album zusammen, das Auftragskompositionen verschiedener avancierter Komponisten enthielt und für das Russell “Lydian M-1” schrieb. Kurz darauf gründete er “The Jazz Workshop”, eine Band mit dem Saxophonisten Hal McKusick und dem Pianisten Bill Evans, die eine Reihe seiner Stücke einspielte, teils unter seinem, teils unter McKusicks Namen. Er schrieb Arrangements für Sängerinnen wie Marilyn Moore und Lucy Reed, und er war einer von sechs Komponisten, die 1957 von der Brandeis University um eine Auftragskomposition im damals noch nicht so genannten Third Stream-Genre gebeten wurden. Heining zeichnet die Szene der im Third Stream aktiven Musiker nach, allen voran Gunther Schuller und John Lewis, und er berichtet von der Überraschung, die Russell verspürte, als er beim Besuch der Lenox School of Jazz zum ersten Mal Ornette Coleman hörte. “Ich dachte, ich kannte mich ziemlich gut aus mit den verschiedenen Kategorien, aber da wurde mir klar, dass ich eine Kategorie ausgelassen hatte. Ich nannte sie Supra-Vertical Tonal Gravity” (112).
Heining erzählt, wie es 1958 zur Aufnahme von “New York, N.Y.” kam, “einer der am ehesten zugänglichen Platten Russells”, wie er schreibt (117), und er widmet “Jazz in the Space Age” ein eigenes Kapitel, jener Platte, die Russell 1959 mit Bill Evans und Paul Bley aufnahm und in dessen dreiteiligem “Chromatic Universe” er sein Lydian Concept in der Praxis beweisen wollte. Anfang der 1960er Jahre entschloss Russell sich eine eigene Band zu gründen, in der er selbst Klavier spielte. Ihr gehörten über die Jahre David Baker an und Don Ellis, Eric Dolphy und Steve Swallow, später auch Thad Jones und Barre Phillips. Heining beschreibt, wie Russell, der von 1964 bis 1969 in Europa lebte, sich in diesen Jahren zusehends von der schwarzen Avantgarde in den USA und insbesondere der politischen Haltung einzelner ihrer Vertreter entfremdete, zum Beispiel in einer Debatte insbesondere zwischen ihm und Archie Shepp, die offen in den Seiten des Down Beat ausgetragen wurde.
Heining betrachtet Russells Arbeit in den 1960er Jahren vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Bereich der Neuen Musik genauso wie in Bezug auf den Einfluss, den sie auf europäische, insbesondere aber skandinavische Musiker wie Jan Garbarek oder Palle Mikkelborg hatte. Als Gunther Schuller Ende der 1960er Jahre das Third Stream Department am New England Conservatory gründete, holte er Russell als Lehrer für Komposition und Theorie nach Boston, und Heining spricht mit einigen seiner Schüler wie Ricky Ford, Fred Hersch, Don Byron, Satoko Fujii, Marty Ehrlich, John Medeski über ihre Erinnerungen an seinen Unterricht. Russell komponierte weiter, unter anderem “Living Time” for Bill Evans, Auftragskompositionen und Wiederaufnahmen früherer Werke, vor allem aber konzentrierte er sich ab Mitte der 1970er Jahre aufs Unterrichten. 2004 setzte er sich von seiner Lehrtätigkeit zur Ruhe, wurde auf Tourneen oder im Kennedy Center weiterhin als Elder Statesman des Jazz gefeiert. Am 27. Juli 2009 starb er im Alter von 86 Jahren in Boston.
Heinings Quellen sind eigene Interviews mit Russell und anderen Zeitzeugen sowie ausführliche Interviews mit seinem Sujet, die etwa die Musikethnologin Vivian Perlis oder der Trompeter und Jazzhistoriker Ian Carr geführt hatten. Heining benutzt all das wie Oral-History-Quellen, wobei er vergleichbare Stellen gern nebeneinander setzt, um Konsistenzen genauso wie Inkonsistenzen aufzuzeigen. Er erklärt Kontexte und füllt die Lücken der Interviews mit anderweitig recherchierten Fakten auf. Und er bewertet, insbesondere wenn es um Rassismus-Erfahrungen des jungen Russells geht, die er gern mit moralisch klingenden Sätzen begleitet. Dass etwa rassistische Stereotype Schwarzen nicht nur von außen zugesprochen, sondern auch innerhalb ihrer eigenen Community bestärkt werden, kommentiert Heining folgendermaßen: “Sadly, this is a story all too common and is documented and examined extensively in the academic literature of sociology and psychology” (23).
Duncan Heining betrachtet sowohl Leben wie auch Werk George Russells, gibt dem Komponisten, Theoretiker und Pädagogen Raum und weiß auch etliches zur Persönlichkeit seines Sujets beizutragen. Er wühlte in Archiven und sprach mit Zeitzeugen, zu denen neben Kollegen und Schülern auch Russell selbst gehörte. Und er stellt all seine Quellen recht offen, und durchaus auch in ihrer etwaigen Widersprüchlichkeit nebeneinander. Das ist für die weitere Forschung sicher löblich, macht die Lektüre allerdings eher beschwerlich, insbesondere, wenn Heining mitten laufend seinen Ansatz wechselt – mal vergleichende Oral-History-Recherche, dann historische Kontextbeschreibung, oft sehr persönlich wirkende moralische Bewertung, immer wieder unverhohlene Kritik an bisherigen Darstellungen von Russells Biographie. Eine Einordnung des theoretischen Ansatzes Russells, eine ausführliche Bibliographie, eine Auflistung der etwa 70 Interviews, die er bei seiner Recherche geführt hat, eine Diskographie sowie eine Auflistung von Tourneedaten und -besetzungen beschließen das Buch. Stil und kritischen Ansatz mag man bemängeln, und doch wird “Stratusphunk” ohne Zweifel die erste Quelle sein, wann immer es um das Werk und die Bedeutung George Russells geht.
Wolfram Knauer (März 2021)
Jazz Dialogues
von Jon Gordon
Torrance 2020(Cymbal Press)
273 Seiten, 18,95 US-Dollar
ISBN: 978-0999477663
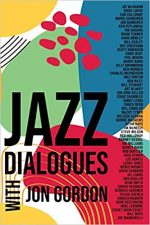 Der Saxophonist Jon Gordon hatte das Glück, als junger Musiker in den 1980er Jahren an den richtigen Orten in New York und anderswo zu sein. Er spielte mit zahlreichen Legenden der Jazzgeschichte genauso wie der Jazzgegenwart, und er erinnert sich gern an deren Ratschläge. “Jazz Dialogues” ist ein kunterbuntes Sammelsurium von Interviews, Gesprächen, Anekdoten, bei denen die Gesprächspartner einen mindestens so großen Platz einnehmen wie Jon Gordons Erinnerungen an die Begegnung, an den Erkenntnisgewinn, den er aus ihnen zog. Art Blakey etwa sprach ihn 1985 oder 1986 im Sweet Basil Club an und fragte, ob er einen Job habe. “Sei dir immer bewusst”, meinte Blakey, “dass wir wirklich Glück haben zu tun, was wir tun. Andere müssen vierzig Stunden die Woche hinter einem Schreibtisch sitzen. Vergiss das nie!” Der damals 18jährige Gordon war verunsichert: Woher wusste Blakey, dass er Musiker war? 20 Jahre später erzählte er die Geschichte Don Sickler, der ein Studio in Manhattan betrieb, in dem auch eine der Bands Gordons geprobt hatte. Und Sickler lachte nur: Blakey habe sich während einer diese Proben im Büro des Studios befunden, aber sie hätten die Jalousien runtergezogen, so dass man nur in eine Richtung schauen konnte.
Der Saxophonist Jon Gordon hatte das Glück, als junger Musiker in den 1980er Jahren an den richtigen Orten in New York und anderswo zu sein. Er spielte mit zahlreichen Legenden der Jazzgeschichte genauso wie der Jazzgegenwart, und er erinnert sich gern an deren Ratschläge. “Jazz Dialogues” ist ein kunterbuntes Sammelsurium von Interviews, Gesprächen, Anekdoten, bei denen die Gesprächspartner einen mindestens so großen Platz einnehmen wie Jon Gordons Erinnerungen an die Begegnung, an den Erkenntnisgewinn, den er aus ihnen zog. Art Blakey etwa sprach ihn 1985 oder 1986 im Sweet Basil Club an und fragte, ob er einen Job habe. “Sei dir immer bewusst”, meinte Blakey, “dass wir wirklich Glück haben zu tun, was wir tun. Andere müssen vierzig Stunden die Woche hinter einem Schreibtisch sitzen. Vergiss das nie!” Der damals 18jährige Gordon war verunsichert: Woher wusste Blakey, dass er Musiker war? 20 Jahre später erzählte er die Geschichte Don Sickler, der ein Studio in Manhattan betrieb, in dem auch eine der Bands Gordons geprobt hatte. Und Sickler lachte nur: Blakey habe sich während einer diese Proben im Büro des Studios befunden, aber sie hätten die Jalousien runtergezogen, so dass man nur in eine Richtung schauen konnte.
Solche Anekdoten sind die eine Seite dieses sehr persönlichen Buchs. Daneben gibt es ausführliche Interviews etwa mit Bill Charlap, Renee Rosnes, Scott Robinson, Melissa Aldana, Kevin Hays, Mark Turner, Jim McNeely, Bob Mintzer, Mike LeDonne, Joe Magnarelli oder Ken Peplowski, die Gordon ziemlich exakt transkribiert und nicht groß stilistisch glättet. Es gibt kleine Gesprächsfetzen, die er erinnert, etwa von McCoy Tyner als dieser ihm backstage beim Jazz Baltica-Festival erklärt, sich nicht wie einer der Großen zu fühlen, sondern wie jemand, der doch selbst auf den Schultern anderer stünde. Es gibt bewegende Anekdoten, etwa wie Gordon bei einem Clubkonzert 1986 auf Sarah Vaughan im Publikum traf, und es gibt Kollegengespräche aus gleicher Augenhöhe, bei denen Gordons Interesse dem Lebenslauf genauso wie den Karriereentscheidungen seiner Gesprächspartner gilt.
So spannt “Jazz Dialogues” einen Bogen zwischen 1983 (David Sanborn & Gil Evans) und 2020 (Bob Mintzer, Leroy Jones und andere), wobei einige der Gespräche so frisch sind, dass sie sogar die beginnende Pandemie erwähnen. “Jazz Dialogues” ist ein fließend zu lesendes Buch, mit denen Gordon seine Freundschaft zu so vielen Musikern genauso feiert wie er seinen Lesern einen Einblick hinter die Kulissen des (insbesondere New Yorker) Musikgeschäfts erlaubt.
Wolfram Knauer (Januar 2021)
Charlie Parker. The Complete Scores. Full Transcriptions from the Original Recordings
Transkribiert von Chris Romero
Milwaukee/WI 2020 Hal Leonard)
415 Seiten, 60 US-Dollar
ISBN 978-1-5400-6720-3
 Charlie Parkers hundertster Geburtstag hat den einflussreichen Saxophonisten im vergangenen Jahr einmal mehr in die Schlagzeilen gebracht. Der Verlag Hal Leonard feierte das Jubiläum mit einer Prachtausgabe der Transkriptionen von 40 Klassikern aus seinem Repertoire, bei der, anders als im “Omnibook”, nicht nur die Saxophonstimme notiert ist, sondern auch Trompete, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.
Charlie Parkers hundertster Geburtstag hat den einflussreichen Saxophonisten im vergangenen Jahr einmal mehr in die Schlagzeilen gebracht. Der Verlag Hal Leonard feierte das Jubiläum mit einer Prachtausgabe der Transkriptionen von 40 Klassikern aus seinem Repertoire, bei der, anders als im “Omnibook”, nicht nur die Saxophonstimme notiert ist, sondern auch Trompete, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.
Chris Romero, der sich dafür lange in einer stillen Kammer eingeschlossen haben muss, bleibt in seiner Partitur allerdings der Jazzhaltung treu: Nicht jede Note ist notiert; insbesondere das Comping des Klaviers wird nur dort in Notenform angegeben, wo es Lücken füllt oder zum Solo wird, ansonsten reicht ihm hier die Angabe der gespielten Changes. Dasselbe gilt fürs Schlagzeug; vor allem die Melodieinstrumente sowie der Kontrabass dagegen sind durchgängig ausnotiert. Es gibt kein ausgiebiges Vorwort, keine editorischen Vorbemerkungen, keine analytischen Begleittexte. Niemand erklärt us, wie die Auswahl zustande kam und was ausgerechnet diese Titel zu “classic performances” werden ließ.
Für Musiker ist das alles sicher interessant, allerdings wohl nicht so sehr zum Nachspielen als vielmehr zum bewussten Studieren der Aufnahmen. Und so ist das schön gebundene und in einem Pappschuber gelieferte Buch wohl eher eine Studienpartitur, die dann aber auch dem notenfesten Fan die eine oder andere Stelle des Zusammenspiels der Band vergegenwärtigen kann. Mit “Charlie Parker. The Complete Scores” hat man vielleicht nicht die Musik selbst vor sich, aber durchaus eine gute Hörhilfe, die es erlaubt, noch tiefer in Birds Musik einzudringen.
Die transkribierten Titel sind: “Ah-Leu-Cha”; “Anthropology”; “Au Privave”; “Barbados”; “Billie’s Bounce”; “Bird’s Feathers”; “Bird’s Nest”; “Bloomdido”; “Blues for Alice”; “Bongo Bop”; “Chasing the Bird”; “Chi Chi”; “Confirmation”; “Dewey Square”; “Dexterity”; “Donna Lee”; “Drifting On a Red”; “K.C. Blues”; “Kim”; “Klactoveededstene”; “Ko Ko”; “Laird Baird”; “Leap Frog”; “Marmaduke”; “Mohawk”; “Moose the Mooche”; “My Little Suede Shoes”; “Now’s the Time”; “Ornithology”; “Passport”; “Quasimodo”; “Red Cross”; “Relaxin’ at Camarillo”; “Relaxin’ with Lee”; “Scrapple from the Apple”; “Shawnuff”; “Steeplechase”; “Thriving from a Riff”; “Visa”; “Yardbird Suite”.
Wolfram Knauer (Januar 2021)
The Essential W. Royal Stokes Jazz, Blues, and Beyond Reader
von W. Royal Stokes
Elkins/WV 2020 (Hannah Books)
562 Seiten, 30 US-Dollar
ISBN: 979-8611405475
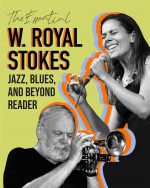 W. Royal Stokes hat in seiner Karriere für die unterschiedlichsten Publikationen geschrieben, die Tageszeitung Washington Post genauso wie für Fachmagazine wie Down Beat oder Jazz Times. Jetzt hat der 1930 geborene Journalist eine Sammlung zahlreicher seiner seit den frühen 1980er Jahren erschienenen kürzeren und längeren Artikel und Interviews zusammengestellt. Sein Interesse gilt dem alten genauso wie dem modernen Jazz, Musiker:innen seiner Wahlheimat Washington D.C., einigen ausgesuchten nicht-amerikanischen Künstler:innen sowie solchen, die eher in der Blues- und Popmusikszene zuhause sind, dem “support network”, also Aktiven des Musikgeschäfts, die sich dafür einsetzen, dass die Szene lebendig bleibt, und schließt mit ausgesuchten Konzert-, Platten- und Buchrezensionen. Konkret geht es also von Ruby Braff bis Andrew Cyrille, von Artie Shaw bis Willem Breuker, von Willis Conover bis zur Jazz Journalists Association, und selbst der Verfasser dieser Rezension kommt in einem Interview zu Wort, das Stokes 2008 mit ihm führte.
W. Royal Stokes hat in seiner Karriere für die unterschiedlichsten Publikationen geschrieben, die Tageszeitung Washington Post genauso wie für Fachmagazine wie Down Beat oder Jazz Times. Jetzt hat der 1930 geborene Journalist eine Sammlung zahlreicher seiner seit den frühen 1980er Jahren erschienenen kürzeren und längeren Artikel und Interviews zusammengestellt. Sein Interesse gilt dem alten genauso wie dem modernen Jazz, Musiker:innen seiner Wahlheimat Washington D.C., einigen ausgesuchten nicht-amerikanischen Künstler:innen sowie solchen, die eher in der Blues- und Popmusikszene zuhause sind, dem “support network”, also Aktiven des Musikgeschäfts, die sich dafür einsetzen, dass die Szene lebendig bleibt, und schließt mit ausgesuchten Konzert-, Platten- und Buchrezensionen. Konkret geht es also von Ruby Braff bis Andrew Cyrille, von Artie Shaw bis Willem Breuker, von Willis Conover bis zur Jazz Journalists Association, und selbst der Verfasser dieser Rezension kommt in einem Interview zu Wort, das Stokes 2008 mit ihm führte.
Insbesondere die Artikel für die Washington Post sind meist kurz und befassen sich oft mit speziellen Themen oder haben mit anstehenden Auftritten in DC und Umgebung zu tun. In den längeren Interviews ist Stokes ein informierter Fragesteller, der zielgerichtet durchs Gespräch führt, seinen Gesprächspartnern dabei aber durchaus Leine lässt. Dieses Procedere lässt sich beispielsweise gut in den Transkripten zweier Interviews verfolgen, die Stokes 2003 mit dem Trompeter Dave Douglas führte: Das Gespräch führt vom Persönlichen zum Künstlerischen, von ästhetischen hin zu praktischen Fragen des Musikplanens und -machens.
Neben Größen der Jazzgeschichte – unter ihnen ein Telefonat mit Red Norvo oder Interviews mit Earl Hines, Art Hodes, Harry James und Artie Shaw – finden sich zahlreiche unbekanntere Namen, der Schlagzeuger Eddie Phyfe etwa oder der Sänger Jimmy McPhail, der mit der letzten Ellington-Band sang. Stokes’ Gespräch mit Omar Sosa wirkt eher wie ein Oral History Interview, während Monika Herzig seine weitaus formaler gestellten Fragen etwas steifer, weil per e-mail beantwortete. In seinen Konzertbesprechungen für die Post ist Stokes sich immer bewusst, dass er stellvertretend für das Publikum schreibt, das bei den Veranstaltungen dabei war, lässt also immer wieder Gesprächsfetzen mit anderen Besuchern in seine Beschreibung der Veranstaltung einfließen.
Ob die für das Buch ausgewählten Artikel nun wirklich “The Essential” sind oder ob es dem Autor nur schwerfiel eine Auswahl zu treffen, sei dahingestellt. Insbesondere in den Kapiteln mit Rezensionen finden sich einige, die außer historischer Dokumentation (“ach, der hat damals also mit dem dort und dort gespielt”) wenig vermitteln. Auf den Genuss der Lektüre hat das aber keinen negativen Einfluss, da Stokes’ Buch eh als eine Art Lesebuch angelegt ist, bei dem man gern springt und sich von der Abwechslung der Perspektiven überraschen lässt. The Essential W. Royal Stokes Jazz, Blues & Beyond Reader wurde vom Autor im Eigenverlag publiziert; ein Bestelllink findet sich auf seiner Website.
Wolfram Knauer (Januar 2021)
Adrian Rollini. The Life and Music of a Jazz Rambler
von Ate van Delden
Jackson/MS 2020 (University Press of Mississippi)
507 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-1-4968-2516-2
 Adrian Rollini scheint eher ein Nebenthema der Jazzgeschichte zu sein, und doch ist er über seine knapp dreißigjährige Aufnahmegeschichte zu einer Art Legende geworden. Viele kennen ihn als den scheinbar einzigen Bass-Saxophonisten (vor Scott Robinson), andere verbinden Instrumente wie das Goofus oder den Hot Fountain Pen mit seinem Namen. Egal welches Instrument er bediente – neben der Saxophonfamilie waren dies etwa Posaune¹, Klavier, Harpaphone, Xylophon und Vibraphon –, er entwickelte eine bewundernswerte Meisterschaft auf ihnen. Sein Bass-Sax-Spiel beeinflusste Harry Carney und Gerry Mulligan, sein Xylophon-Spiel Red Norvo, und Louis Armstrong gefiel, wie deutlich in Aufnahmen mit Rollini immer der Bass-Part zu hören war.
Adrian Rollini scheint eher ein Nebenthema der Jazzgeschichte zu sein, und doch ist er über seine knapp dreißigjährige Aufnahmegeschichte zu einer Art Legende geworden. Viele kennen ihn als den scheinbar einzigen Bass-Saxophonisten (vor Scott Robinson), andere verbinden Instrumente wie das Goofus oder den Hot Fountain Pen mit seinem Namen. Egal welches Instrument er bediente – neben der Saxophonfamilie waren dies etwa Posaune¹, Klavier, Harpaphone, Xylophon und Vibraphon –, er entwickelte eine bewundernswerte Meisterschaft auf ihnen. Sein Bass-Sax-Spiel beeinflusste Harry Carney und Gerry Mulligan, sein Xylophon-Spiel Red Norvo, und Louis Armstrong gefiel, wie deutlich in Aufnahmen mit Rollini immer der Bass-Part zu hören war.
Nun hat der niederländische Sammler und Jazzforscher Ate van Delden Adrian Rollini eine Biographie gewidmet, die alle Seiten seines musikalischen Schaffens beleuchtet. Er beginnt im Piemont des 19. Jahrhundert, wo sein Vater aufwuchs, der sich in den 1890er Jahren entschied in die Vereinigten Staaten auszuwandern und bald in New York als Kupferstecher arbeitete, nebenbei aber auch Gesangsunterricht gab. Er fand eine ebenfalls italienischstämmige Frau, und am 28. Juni 1903 kam Adrian, ihr erstes Kind, zur Welt. Der besaß das absolute Gehör, erhielt ab dem 3. Lebensjahr Klavierunterricht, und ein erster Artikel über das fünfjährige Wunderkind erschien bereits im Juli 1908 im Musical Observer. Seinen ersten professionellen Erfolge in populäreren Genres feierte Rollini dann 1919 mit dem Einspielen von Klavierwalzen, auf denen er synkopierte Walzer, Broadwayschlager und Novelty-Nummern interpretierte, die mal als Blues, Foxtrot oder als “oriental fox trot” gehandelt wurden.
1922 wurde Rollini Mitglied der California Ramblers, eines vom Geschäftsmann Ed Kirkeby geleiteten Tanzorchesters, in dem Rollini anfangs als zweiter Pianist und Xylophonspieler mitwirkte. Am 7 April 1922 machte er mit dieser Band seine erste Plattenaufnahme, “Little Grey Sweetheart of Mine”, in der sein Xylophonspiel mehr improvisiert als ausgeschrieben hinter der Band zu hören ist. Das Repertoire der Band bestand aus populärer Tanzmusik und sogenannten Novelty-Nummern, etwa Zez Confreys “Stumbling” mit einem Duett der beiden Pianisten im zweiten Teil der Aufnahme. Wenig später wechselte Rollini zum Bass-Saxophon, einem Instrument, das bis dahin kaum im Jazz vorkam, und im September 1922 ist sein erster Solobreak in “I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate” zu hören. Rollini beherrschte das Instrument immer besser und machte sich bald einen Namen als jemand, der nicht nur die Basslinie betonen konnte, sondern daneben auch zu eigenständigen Soli in der Lage war. Optisch war das Bass-Sax ein Hingucker, und in kleineren Ensembles, einer Art Auskopplung aus den California Ramblers, spielte Rollini quasi als Gegenstück den Goofus, ein in Frankreich gefertigtes Spielzeuginstrument (etwa in “San” vom Mai 1924) oder den Hot Fountain Pen, eine Art Miniaturklarinette, nicht größer als ein Füllfederhalter (etwa im “Dixie Stomp” vom Oktober 1925). Inzwischen hatte Rollini die Leitung der California Ramblers übernommen, deren Arrangements immer präziser und swingender wurden.
Van Delden verfolgt das Auf und Ab der California Ramblers, Rollinis Zeit mit Red Nichols, mit dem er ab 1927 Aufnahmen machte, die noch jazziger waren als die Tanzmusikarrangements der Ramblers, und er hört sich die Platten an, die Rollini etwa mit Joe Venuti und Eddie Lang, mit Frankie Trumbauer oder Bix Beiderbecke machte. 1928 reiste Rollini nach England, um zusammen mit dem Trompeter Chelsea Quealey und dem Saxophonisten und Klarinettisten Bobby Davis Mitglied in der Band Fred Elizaldes zu werden, der einen Gig im Londoner Tophotel Savoy innehatte. Die Musik des Ensembles war in den Schlagzeilen, mit Elizalde trat Rollini bald auch auf dem Kontinent, in Paris oder Ostende, auf und war regelmäßig im BBC zu hören. Der amerikanische Tieftöner war einer der Stars der Band und wurde vielfach in der Fachzeitschrift Melody Maker erwähnt. Ende 1929 allerdings waren die Auswirkungen des Börsencrashs auf der Wall Street bis nach London zu spüren, und so entschied sich Rollini zusammen mit seiner Frau Dixie und seinem Bruder, dem Saxophonisten Art, der inzwischen ebenfalls der Elizalde-Band angehörte, nach New York zurückzukehren.
Die Wirtschaftskrise hatte die USA voll im Griff und war auch im Musikgeschäft zu spüren. Eine Weile kam Rollini im Tanzorchester von Bert Lown unter, spielte aber auch mit den New California Ramblers, die an den Ruhm der früheren Band anzuknüpfen versuchten. 1934 wechselte er die Seiten und eröffnete Adrian’s Tap Room, einen Club im Keller des President Hotel in Midtown-Manhattan, bei dessen Eröffnung u.a. Fats Waller spielte. Zwei Jahre später kam en Musikaliengeschäft dazu, außerdem gründete Rollini ein Trio, in dem er in Begleitung von Gitarre und Kontrabass Vibraphon spielte, und wirkte in einer Reihe von Filmen mit. Im Krieg war Rollini in der Truppenbetreuung aktiv, nach Kriegsende allerdings waren andere Stilrichtungen gefragter als sein gefällig-swingende Jazz. Er zog sich mehr und mehr zurück, auch aus Gesundheitsgründen, lebte die Hälfte des Jahres in Florida, die andere in New York, wo er allerdings höchstens noch kleine Engagements wahrnahm. 1956 verunglückte er bei einem lange Zeit nicht ganz geklärten Unfall und verstarb kurz darauf im Alter von 53 Jahren². Er hinterließ ein Aufnahmeschaffen, das 35 Klavierwalzen umfasste, etwa 1.500 Titel auf Schallplatte, darunter 130 unter eigenem Namen, ca. 300 für Rundfunkshows vor-aufgezeichnete Titel, sowie bei 25 Lang- und Kurzfilme.
Ate Van Deldens Buch zeichnet das Leben und die Karriere Adrian Rollinis sorgfältig nach. Seine Endnoten verraten die Akribie, mit der der Autor die verschiedenen Stationen dieser Karriere dokumentieren konnte. Seine Darstellung ist überall an der Sache interessiert und ordnet Rollinis professionellen Lebensweg in den Kontext der Unterhaltungsindustrie der 1920er und 1930er Jahre ein. Van Deldens Interesse gilt allerdings vor allem der Biographie, Auftritts- und Aufnahmedaten seines Protagonisten, nicht dem kulturgeschichtlichen oder gar gesellschaftlichen Kontext. In diesem Ansatz unterscheidet sich Van Delden nicht von anderen Jazzautoren, und doch vergibt er sich ein wenig die Chance, mit der Lupe, die er auf den Basssaxophonisten hält, der ja ganz unterschiedliche Facetten der Musikindustrie insbesondere der 1920er Jahre kennengelernt hatte, vielleicht auch die Veränderung dieser Branche etwas genauer beleuchten zu können. Seine Einlassungen zu den Aufnahmen Rollinis bleiben im Oberflächlichen, ordnen nicht ein und vergleichen auch selten zu dem, was sonst in der Zeit zu hören war. Er beschreibt weder Stil noch stilistische Entwicklung, begründet im nüchternen Ton seiner Darstellung weder, wie sich Rollinis Vibraphon-Trio beispielsweise vom Spiel Lionel Hamptons unterschied (bzw. wie es vielleicht auch von dessen Erfolg beeinflusst war), noch, was genau dazu beigetragen haben mag, dass er nach dem Krieg nicht mehr in der vordersten Reihe mitspielen konnte. Er erwähnt die seichteren und die eher auf den Jazz fokussierten Aufnahmen aus den 1920er Jahren, seine einordnenden Wertungen beschränken sich allerdings zumeist auf Adjektive wie “excellent”, “memorable”, “amazing” oder “nice”. Wie gesagt: Dieses Manko teilt Ate van Deldes Buch mit vielen von Sammlern und Privathistorikern verfassten, die ein enormes Faktenwissen ausbreiten, sich aber an eine Einschätzung der Musik selbst nicht heran trauen. Dabei braucht es gar keines musikwissenschaftlichen Vokabulars, um zu erklären, wo Neuerungen passieren, wieso eine Aufnahme mehr oder auch weniger gelungen ist, wie sich die Musik einer bestimmten Periode zu jener anderer Künstler derselben Zeit verhält.
Davon abgesehen aber ist Ate van Delden hoch zu loben für die Akribie, mit der er, auch in der Herangehensweise und dem Verweis auf seine Quellen immer nachvollziehbar, alle ihm zugänglichen Fakten über Adrian Rollini zusammengetragen und damit eine jahrzehntelange Arbeit abgeschlossen hat. Bruce Raeburn nennt das Buch in seinem Klappentext die “definitive Biographie des Multiinstrumentalisten, Bandleaders und Komponisten Adrian Rollini” – und dem kann man sich nur anschließen, mit der Einschränkung: nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Wolfram Knauer (Oktober 2020)
¹In einer Nachricht von Leser Uwe Ladwig weist dieser darauf hin, dass Rollini niemals Posaune, sondern “mit dem Bass-Saxofon Posaunenstimmen im Baßschlüssel gespielt [habe]. Ladwig weiter: “Da Rollini vom Klavier her kam, war ihm der C-Bass-Schlüssel geläufig. 1929 erschien im Melody Maker eine neunteilige Serie, in der Rollini das Bass-Saxofon bespricht: „The When, Why and How of the Bass Saxophone“. Dort plädiert er im Teil 6 “The Problem of Transposition” für den Bass-Schlüssel in C.”
²Rollini starb nicht mit 53, sondern mit 52. Er hat seinen Geburtstag nicht mehr erlebt (* 28.6.1903 – ∞ 15.5.1956); Hinweis Uwe Ladwig.
Straighten Up and Fly Right. The Life & Music of Nat King Cole
von Will Friedwald
New York 2020 (Oxford University Press)
633 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-088204-4
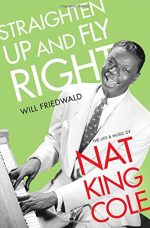 Will Friedwald ist ein ausgewiesener Kenner insbesondere des vokalen Jazz. Nach seinem viel-gelobten Buch über Frank Sinatra (1995) und diversen Büchern über amerikanische Jazz- und Popsänger:innen hat er jetzt eine Biographie Nat King Coles vorgelegt, jenes Musikers, der mehr als vielleicht jeder andere, die Welten zwischen Jazz und Pop überschreiten konnte, weil er einerseits die technische Meisterschaft auf seinem Instrument, dem Klavier, besaß, andererseits eine begeisternde Bühnenpräsenz, und darüber hinaus eine einschmeichelnde Stimme, die ihn schnell zum gefeierten Star aufsteigen ließ. Sein internationaler Ruhm lässt Jazzfans oft vergessen, welch virtuoser Pianist Nat Cole war, der aus Einflüssen durch das Stride Piano und insbesondere Earl Hines einen ganz eigenständigen Personalstil entwickelte und dabei neben den Größten seines Instruments, also Art Tatum oder Oscar Peterson, bestehen konnte.
Will Friedwald ist ein ausgewiesener Kenner insbesondere des vokalen Jazz. Nach seinem viel-gelobten Buch über Frank Sinatra (1995) und diversen Büchern über amerikanische Jazz- und Popsänger:innen hat er jetzt eine Biographie Nat King Coles vorgelegt, jenes Musikers, der mehr als vielleicht jeder andere, die Welten zwischen Jazz und Pop überschreiten konnte, weil er einerseits die technische Meisterschaft auf seinem Instrument, dem Klavier, besaß, andererseits eine begeisternde Bühnenpräsenz, und darüber hinaus eine einschmeichelnde Stimme, die ihn schnell zum gefeierten Star aufsteigen ließ. Sein internationaler Ruhm lässt Jazzfans oft vergessen, welch virtuoser Pianist Nat Cole war, der aus Einflüssen durch das Stride Piano und insbesondere Earl Hines einen ganz eigenständigen Personalstil entwickelte und dabei neben den Größten seines Instruments, also Art Tatum oder Oscar Peterson, bestehen konnte.
Für sein Buch hat Friedwald Archive durchforstet, mit Forscher:innen und Zeitzeugen – einschließlich Nat Coles Bruder Freddy Cole – gesprochen, und er hat viel Musik gehört. Er erzählt Coles Lebensgeschichte biographisch, berichtet von seiner Geburt und Kindheit in Montgomery, Alabama, dem Umzug der Familie nach Chicago, vom Vater, der vor einer Baptistengemeinde predigte, sowie von den wichtigsten musikalischen Einflüssen: der Kirche des Vaters, dem Klavierunterricht durch die Mutter und seinem Idol, dem Pianisten Earl Hines. Mit 14 Jahren, noch in der Schule, stellte Cole seine erste, zehnköpfige Band zusammen, die 1935 von der Lokalpresse als neue Sensation gefeiert wurde. Ein Jahr später machte er seine ersten Aufnahmen, unter dem Namen seines Bruders Eddie, in denen der Einfluss Hines in den Klavierpartien deutlich zu hören ist, tourte mit einer Neuauflage der 1920er-Jahre-Revue “Shuffle Along”.
1937 gründete Cole sein Trio, “aus Zufall”, wie er sagt. “Shuffle Along” war in Los Angeles gestrandet, und Cole war von der Musikszene um die Central Avenue in Los Angeles fasziniert. Er jammte mit Lionel Hampton und Lee Young, dem Bruder des Saxophonisten Lester Young. Der hatte eigentlich auch bei einem Gig dabei sein sollen, den Cole im Swanee Inn in L.A. ergattert hatte, aber er tauchte nicht auf, und so spielten Cole, Gitarrist Oscar Moore und Bassist Wesley Prince eben im Trio. Dass er zu singen begann, sei der Tatsache zu verdanken, dass er das Trio klanglich für zu eintönig hielt. Prince versorgte ihn mit dem Spitznamen “King”, und seine Karriere hob ab.
Warum ein Trio? Nun, ein Quartett mit Schlagzeug hätte zu sehr nach Rhythmusgruppe ausgesehen, und die Leute hätten dann auf den Rest der Band gewartet, argumentiert Cole später. Die ersten eigenen Aufnahmen erfolgten für sogenannte Transcription Services, also Produktionsfirmen für fertige Radiosendungen, die lokale Sender abonnieren und senden konnten. Allein von 1938 stammen 20 Aufnahmen des Trios, zwischen Standards, Pophits der Zeit und an folkige Kinderlieder angelehnte Jump-Versionen wie “Mutiny in the Nursery” oder “Three Blind Mice”. Erst Lionel Hampton brachte ihn im Mai 1940 zu einer Session ins Studio eines Major-Labels, bei der acht Titel entstanden, mit Schlagzeugbegleitung, Lionel Hampton und der Sängerin Helen Forrest. Im Dezember desselben Jahres ging Cole dann mit dem Trio ins Decca-Studio und nahm vier Titel auf, von denen insbesondere “Sweet Lorraine” ein Dauerbrenner seines Repertoires werden sollte. Die Rundfunkpräsenz Anfang der 1940er Jahre und diese Decca-Aufnahmen jedenfalls machten die nationale Presse auf ihn aufmerksam, und bald trat das Trio in den angesagten Clubs von New York und Chicago auf.
Friedwald verfolgt die Aufnahmegeschichte der Band, die im November 1943 richtig abhob, als das Trio bei seiner ersten Plattensitzung fürs kalifornische Label Capitol “Straighten Up and Fly Right” einspielte. Er erzählt die Geschichte des Labels, aber auch jene des Stücks und blättert dabei immer wieder neue Seiten amerikanischer Entertainmenthistorie auf… Er beschreibt, was Coles Interpretationen so besonders macht, erklärt, wie das Repertoire zustande kam, das Cole für Capitol aufnahm, und erzählt über die Zusammenarbeit des Sängers und Pianisten mit seinem neuen Manager Carlos Gastel. Etwa zur selben Zeit begann Norman Granz in Los Angeles mit der Organisation von öffentlichen Konzert-Jam-Sessions, aus denen schließlich Jazz at the Philharmonic-Konzertreihe hervorging, und Cole und Granz kamen für verschiedene Projekte zusammen. Wenn man den Jazzmusiker Nat Cole verstehen will, schreibt Friedwald, müsse man sich nur seine Aufnahmen mit Lester Young von 1942 und 1946 anhören.
Die Säle jedenfalls wurden größer, und Coles Name wurde nun in All-Star-Programmen oft genug in derselben Größe wie jene der Swingstars geschrieben, die in derselben Show zu hören waren. Er nahm neue Hits auf, etwa “Nature Boy” oder Billy Strayhorns “Lush Life”, und war ab 1948 regelmäßig im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand zu sehen. Zwischen den Beschreibungen musikalischer Stationen weiß Friedwald von Coles Privatleben zu berichten, der Ehe mit Maria etwa, der Geburt seiner Tochter Natalie, dem Kauf eines Hauses in einem weißen Viertel von Los Angeles, der zu rassistischen Anwürfen führte.
1950 reiste Cole zum ersten Mal nach Europa, und von nun an begann er endgültig vor allem als Pop- statt als Jazzkünstler wahrgenommen zu werden. “Mona Lisa”, schreibt Friedwald, war vielleicht der Umschwung. Wo Cole zuvor erfolgreich mit dem Arrangeur Pat Rugolo zusammengearbeitet hatte, begann jetzt seine Kooperation mit Nelson Riddle, und immer mehr wurde das Klavier zu einer nebensächlichen Staffage, weil das Publikum vor allem auf Nat King Cole, den Sänger, fokussiert war. Friedwald listet alle Erfolgsstationen auf: einen biographischen Film, Gastauftritte bei populären Fernsehshows, Auftritte in den gefeiertsten Night Clubs der Nation und schließlich seine eigene TV-Show. Immer wieder vergleicht er Coles Erfolg mit dem seiner direkten Konkurrenten, etwa Frank Sinatra oder Bing Crosby. 1961 sang Cole noch bei der Amtseinführung Präsident John F. Kennedy, doch bald darauf wurde erst ein Magengeschwür, dann Lungenkrebs diagnostiziert, eine Folge der vielen Zigaretten, die er zeitlebens geraucht hatte. Im Februar 1965 erlag er der Krankheit im Alter von nur 45 Jahren.
Will Friedwalds Buch ist ein dicker Wälzer und gewiss ein Standardwerk über Nat King Cole. Das Buch ist gut erschlossen durch einen ausführlichen Index und zahlreiche Fußnoten, und jede Phase der Karriere des Pianisten und Sängers ist ausreichend beleuchtet. Dem Autor gelingt es, die Besonderheiten des Stils zu beschreiben, ohne in eine musikalische Fachsprache zu verfallen, und er ist sich an jeder Stelle des Kontextes bewusst, in dem Cole aktiv ist: der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse also genauso wie des Status’ von Jazz und Entertainmentbranche. Und doch ist sein Buch nicht nur vom Umfang her stellenweise etwas schwer geraten. In seinem Hang zur Vollständigkeit macht es Friedwald seinen Leser:innen nämlich teilweise schwer, dabei zu bleiben. Man ist stellenweise geneigt, ihm den Titel seines eigenen Buchs zuzurufen: “Straighten Up and Fly Right!”, denn die Geschichten, die Nat King Cole so mühelos ans Publikum bringen konnten, hätten auch einen stilistisch etwas müheloseren Erzähler verdient.
Wolfram Knauer (Oktober 2020)
Kleine Songs zwischen Freunden
von Arno Fischer
Wiesbaden 2020 (Edition 6065)
110 Seiten, 12 Euro
ISBN: 978-3-941072-23-7
 Arno Fischer ist ein Buch über einen Jazzmusiker gelungen, in dem dessen Musik weitestgehend ausgespart bleibt, das aber dennoch jede Menge über seine künstlerische Haltung verrät. 1996 lernte Fischer seinen Namensvetter kennen, den amerikanischen Pianisten und Künstler John Fischer, und was als berufliche Beziehung begann – Arno Fischer war im Marburger Kulturamt für die Organisation der jährlichen Sommerakademie verantwortlich, bei der John Fischer seit einigen Jahren eine Klasse für freies Malen unterrichtete – wurde bald zu einer Freundschaft. Hinzu kam die Namensgleichheit und die Tatsache, dass die Eltern John Fischers Arno und Sabine geheißen, also die Vornamen des Autors Arno Fischer und seiner Frau getragen hatten. All das trug dazu bei, dass sich der Pianist und Künstler dem Verwaltungsangestellten und (gar nicht mal so heimlichen) Autor weit öffnete.
Arno Fischer ist ein Buch über einen Jazzmusiker gelungen, in dem dessen Musik weitestgehend ausgespart bleibt, das aber dennoch jede Menge über seine künstlerische Haltung verrät. 1996 lernte Fischer seinen Namensvetter kennen, den amerikanischen Pianisten und Künstler John Fischer, und was als berufliche Beziehung begann – Arno Fischer war im Marburger Kulturamt für die Organisation der jährlichen Sommerakademie verantwortlich, bei der John Fischer seit einigen Jahren eine Klasse für freies Malen unterrichtete – wurde bald zu einer Freundschaft. Hinzu kam die Namensgleichheit und die Tatsache, dass die Eltern John Fischers Arno und Sabine geheißen, also die Vornamen des Autors Arno Fischer und seiner Frau getragen hatten. All das trug dazu bei, dass sich der Pianist und Künstler dem Verwaltungsangestellten und (gar nicht mal so heimlichen) Autor weit öffnete.
Im Verlauf der Gespräche, die Arno Fischer in seinem Buch wiederaufleben lässt, erzählt Jean Jacques Fischer, wie John hieß, als 1930 als Sohn eines Goldschmieds in Antwerpen geboren wurde, davon, wie er zwei Tage nach Einmarsch der deutschen Truppen in die Niederlande mit seinen Eltern und Geschwistern zur Flucht Richtung Süden aufbrach. In Le Teil, einem unscheinbaren Ort in Südfrankreich, kamen sie auf einem Bauernhof unter. Er erzählt von den Umständen, den Sorgen und den Unwägbarkeiten der Flucht, über Cannes und Marseille erst nach Casablanca, dann mit einem Schiff Richtung Vereinigte Staaten, das die geflüchteten Passagiere aber in Havanna aussetzte, weil die USA die Einfahrt verweigert hatte. Zwei Jahre lebten sie auf Kuba, dann gelang ihnen die Überfahrt nach Miami, von wo aus sie per Zug nach New York reisten, und… “Eines Morgens fand ich mich wieder, sitzend in einer U-Bahn. Als wenn ich unter einer Käseglocke gelebt hätte, die nun plötzlich weggezogen worden wäre und ich war wieder in die Welt entlassen. Es war die Zeit von Hammerstein und Rodgers and Hart und George and Ira Gershwin, die ganze Welt war swinging, das war für mich die Melodie der Freiheit – und ich wusste, ich war gerettet.”
Soweit der Rahmen. Arno Fischers Buch handelt also von Flucht und den Ängsten des jungen Jean Jacques. Diese verfolgten ihn bis weit in die 1970er Jahre hinein, als er zu einem Auftritt bei den Berliner Jazztagen erstmals zu einem bejubelten Konzert nach Deutschland reiste, nach dem er sich hinter der Bühne dem Antisemitismus der Deutschen wieder ausgesetzt fühlte, ausgerechnet vom Festivalmacher George Gruntz und dem großen Albert Mangelsdorff, aber auch all den anderen anwesenden Deutschen, die sich etwas zuriefen, das er auf sich bezog: “Jetzt, nachdem man die Kunst des Juden genossen hatte”, fasst Arno Fischer die Erinnerung des Pianisten zusammen, “wurde zum Pogrom aufgerufen: ‘Jews!’ Jetzt würden die Deutschen ihr wahres Gesicht zeigen.” Als Hans Kumpf, mit dem Fischer sich angefreundet hatte, ihn aufklärte, dass die Musiker sich tatsächlich nur mit einem freundlichen “Tschüs” verabschiedet hatten, fiel Fischer ein Stein vom Herzen: “So konnte er nach zwei Analysen und dreißig Jahren New York zum ersten Mal einen winzigen Teil seiner Fluchtangst loslassen”.
Flucht und die durch sie verursachten seelischen Narben also sind das eine Thema des Buchs, das zugleich von einer Freundschaft zwischen den beiden Namensvettern handelt, vom Vertrauen-Fassen zwischen einem Nachfahren der Täter- und einem Zeitzeugen der Opfergeneration, und schließlich davon, wie John Fischers durch seine Lebenserfahrungen erlangte Gelassenheit und … vielleicht Weisheit … den jüngeren Fischer, den Autor also, dazu brachte, über sein eigenes Leben zu reflektieren.
Arno Fischers Würdigung ist dabei nur eine teilweise Biographie John Fischers, eine Erzählung über Fluchterfahrung und Erinnerung. Daneben erinnert er sich an die Gespräche, die er mit seinem väterlichen Freund hatte, an die Cafés und Restaurants, in denen diese stattfanden, an Autofahrten und Begegnungen während der Marburger Sommerakademie. John Fischer hatte bereits in den 1970er Jahren die Stätten seiner Kindheit wiederbesucht, war dabei 36 Jahre nach der Flucht auf Menschen getroffen, die er noch von damals kannte, oder auf Fremde, die ihm zeigen wollen, was sich seither alles verändert hatte. Auch davon lässt ihn Arno Fischer erzählen, wie man von fernen, leicht verklärten Erinnerungen: mal klar aufs Detail bedacht, dann dieselbe Begebenheit, aber in unterschiedlichem Kontext. Er zeichnet dabei auch die widersprüchliche Persönlichkeit John Fischers nach, dessen Mürrigkeit man genauso erahnen kann wie seine Liebenswürdigkeit, alles geerdet in einer großen Neugier und gleichzeitigen Ängsten.
Von Jazz ist bei alledem kaum die Rede, eigentlich nur im Anhang, einem Interview, das Hans Kumpf 1977 mit dem Pianisten geführt hatte. Und doch meint man den Jazz dauernd durchzuhören. Arno Fischers Buch nämlich macht uns darauf aufmerksam, dass die Kunst improvisierender Musiker immer aus ihrer eigenen Biographie schöpft, dass es sich lohnt, ihre Perspektive aufs Leben kennenzulernen, um ihrer Musik näherzukommen, dass andererseits die Kenntnis ihrer Lebenserinnerungen durchaus auch die eigene Hörerfahrung komplett umkrempeln kann – so geschehen beim Autor dieser Rezension, der John Fischers Aufnahmen jetzt mit anderen Ohren hören wird.
Wolfram Knauer (Oktober 2020)
MilesStyle. The Fashion of Miles Davis
von Michael Stradford
Los Angeles 2020(self-published)
204 Seiten, 17,99 US-Dollar
ISBN: 978-1647865573
 Michael Stradford ist Medienmanager mit umfangreichen Erfahrungen in Rundfunk, Fernsehen und Film. Jetzt hat er ein Buch über Miles Davis vorgelegt, das sich allerdings nur Rande mit Davis’ Musik zu beschäftigen scheint und stattdessen seine Bühnenpersönlichkeit, oder noch genauer: seine Bühnengarderobe und seinen Sinn für Mode in den Mittelpunkt stellt. Dass und wie Stradford dabei dann doch der Musik ziemlich nahe kommt, ist eine ziemlich erstaunliche und für seiner Leser:innen ungemein befriedigende Erfahrung.
Michael Stradford ist Medienmanager mit umfangreichen Erfahrungen in Rundfunk, Fernsehen und Film. Jetzt hat er ein Buch über Miles Davis vorgelegt, das sich allerdings nur Rande mit Davis’ Musik zu beschäftigen scheint und stattdessen seine Bühnenpersönlichkeit, oder noch genauer: seine Bühnengarderobe und seinen Sinn für Mode in den Mittelpunkt stellt. Dass und wie Stradford dabei dann doch der Musik ziemlich nahe kommt, ist eine ziemlich erstaunliche und für seiner Leser:innen ungemein befriedigende Erfahrung.
In seiner Jugend habe er fast aus Versehen Miles’ “In a Silent Way” gehört und es habe ihm überhaupt nicht gefallen, beginnt Stradford sein Buch. In den frühen 1980ern habe er den Trompeter dann auf seiner Promo-Tour für das Album “The Man with the Horn” in Cincinnati erlebt. Dieser sei in einem weiten rosa Overall aufgetreten, habe eine weiße Strickmütze getragen, auf die das Wort “Pepe” aufgestickt war, und an den Füßen habe er eine Art Pantoffeln getragen. Er habe nicht viel gespielt, doch das Publikum habe ihm begeostert zugejubelt, als er am Ende des Abends kurz winkte. Stradford verstand nicht so recht, was da vor sich ging. Ein paar Tage später sei ihm das Album “My Funny Valentine. Miles Davis in Concert” in die Hände gefallen, und der Ton, den er aus Miles Davis’ Trompete hörte, hielt ihn gefangen. Danach habe er sich nach und nach die anderen Schaffensperioden des Meisters angeeignet. Er habe alles gelesen, was er über den Trompeter finden konnte einschließlich Büchern über seine Malerei. Und er habe davon geträumt, ein großes, reich bebildertes Buch über Miles’ Mode zu schreiben. Dieses Coffertable-Book-Projekt habe sich dann leider aus Kostengründen zerschlagen, doch Stradford fand, die Recherchen rechtfertigten eine Veröffentlichung zumindest seiner Beobachtungen und der Gespräche, die er mit Vertrauten und Experten geführt hatte.
Stradfords erstes Kapitel umfasst die Jahre bis 1949, erzählt von Miles’ Jugend in St. Louis und identifiziert seine Mutter als einen modischen Einfluss, aber auch Fred Astaire (von dem Miles sagte, er habe in etwa seine Größe) und Cary Grant. Auch Clark Terry, der wie er aus St. Louis stammte, habe ihm modisch imponiert, und als Miles einen ersten Gig in Eddie Randles Band hatte, nutzte er die Gage, um “hippe Brooks Brothers”-Anzüge zu kaufen. 1944 ging Miles nach New York, um an der Juilliard School Unterricht zu nehmen, und hier achtete er besonders darauf, dass sein Äußeres nicht seine Kleinstadtherkunft verriet. Stradford blickt auf andere modebewusste Musiker der Zeit, Coleman Hawkins etwa, der Miles schon mal Anzüge besorgte, den Schlagzeuger Charlie Rice, der ihm seinen ersten Maßanzug anfertigte, oder Dexter Gordon, der Miles’ Sinn für Mode kritisierte. Und dann spricht er mit Clark Terry selbst, der erklärt, wie wichtig die Garderobe in den 1940er und 1950er Jahren war, weiß, dass Miles ihn als Jugendlicher nachgeahmt hatte, aber betont, dass er dann doch schnell seinen eigenen Stil gefunden habe (musikalisch wie modisch). Stradford spricht mit dem Modeexperten Lloyd Boston über die Bedeutung von Mode für schwarze Männer und über den Wandel in Miles Davis’ Stil, der über die Jahre immer schriller und auffälliger wurde. Miles Davis sei eine Modeikone gerade, weil er keine sein wollte, erklärt Boston und definiert den “klassischen Miles-Look”: dezente Eleganz, eine Schlichtheit, bei der weniger mehr ist. Schließlich spricht Stradford noch mit dem Filmproduzenten Reggie Hudlin darüber, wie er Miles zum ersten Mal traf, als sein erster Film “House Party” herauskam, und wie er von ihm den Auftrag erhielt, ein Bühnenbild für eine große Show in Paris zu entwerfen, ein Projekt, das dann allerdings nie realisiert wurde.
In den 1950er Jahren hatten Miles’ Pariser Ausflüge, seine Freundschaft zu Juliette Greco Einfluss auch auf den Modesinn des Trompeters. Stradford diskutiert aber auch Miles’ Suchtverhalten und die daraus resultierenden Probleme. Es ging ihm zeitweise richtig dreckig, schreibt Stradford, aber er trat nach wie vor wie aus dem Ei gepellt in der Öffentlichkeit auf. Er betrachtet Fotos von Miles aus jenen Jahren, analysiert die Stoffe, Schnitte, Designer, und er setzt all das ins Verhältnis zur allgemein vorherrschenden Mode der Zeit. Miles, fasst er am Schluss des Kapitels zusammen, habe für sich ein Profil geschaffen wie kein anderer Musiker in der populären Musik, ein Profil, zu dem die Klänge seiner Platten genauso gehörten wie sein visuelles Image. Für dieses Kapitel unterhält Stradford sich mit dem Modeexperten Charlie Davidson über Miles als Kunden in seinem Modegeschäft in Cambridge, Massachusetts, mit Bryan Ferry, der ja selbst als Modeikone gehandelt wird, sowie mit der Modeforscherin Monica Miller über die Tradition der “Black Dandies”.
In den 1960er Jahren übernahm Miles Modetrends aus Italien; selbst Down Beat fand, Miles sei so gut angezogen, dass man mit einem Blick auf ihn erkennen könne, was der Mann nächstes Jahr tragen müsse. Seine Konzerte wurden von den Stars des Showbusiness besucht, sein Erfolg ermöglichte ihm den Kauf eines fünfstöckigen Hauses auf der Upper West Side Manhattans und eines vielbeachteten Ferraris. Zugleich sprach Miles sich offen gegen den Rassismus in den USA aus, und er spielte mit einem Quintett, dessen Musiker größtenteils zumindest zehn Jahre jünger als er waren. Für dieses Kapitel spricht Stradford mit Miles’ Frau Frances Davis über ihre erste Begegnung und seinen Modegeschmack, mit Quincy Jones über Miles’ Talent als Schauspieler und sein Image als harter Bursche, sowie mit Ron Carter über seine erste Begegnung mit dem Trompeter und darüber, dass dieser seinen Musikern freie Hand bei der Entscheidung ließ, was sie auf der Bühne trugen.
Mit “Filles de Kilimanjaro” und “Bitches Brew” begann eine auch modisch völlig andere Zeit. Betty Mabris machte Miles mit der Popmusik der Zeit vertraut und beeinflusste auch seinen modischen Wandel von europäischem Chique hin zu stärker funky wirkenden Klamotten, Lederhemden, Schlangen- und Wildlederhosen, wild-bunten Hemden, die er nie öfter als einmal trug. Für dieses Kapitel spricht Stradford mit der Designerin Andrea Aranow über ihre Entwürfe für Jimi Hendrix und Miles Davis, mit dem Fotografen Anthony Barbosa über ihre Fotosessions Anfang der 1970er Jahre und jene für das Album “You’re Under Arrest”, und mit Betty Mabris/Davis über ihre Modeling-Karriere und den modischen Einfluss, den sie auf ihren Mann hatte.
Ende der 1970er Jahre hörte man eigentlich nur über Miles’ Gesundheitsprobleme; er trat nicht mehr auf, und in Interviews äußerte er oft, wie gelangweilt er sei. Für diese Zeit sammelt Stradford Interviews mit Lenny Kravitz, dessen Eltern mit Miles befreundet waren, mit der Kostümbildnerin Gersha Phillips über die Garderobe, die sie für Don Cheadles Film “Miles Ahead” entwarf, mit dem Perkussionisten James Mtume darüber, dass Miles jedes Mal, wenn sich seine Musik änderte, auch seinen Look änderte, und mit dem Bassisten Michael Henderson über seine erste Begegnung mit Miles und Einkaufstipps vom Chef.
In den 1980er Jahren feierte Miles sein Comeback mit einer Musik, die purer Miles genauso war wie sie auf Popmusik von Cyndi Lauper oder Michael Jackson zurückgriff. Er erhielt Gagen wie ein Rockstar und hatte Gastauftritte bei “Miami Vice” und “Saturday Night Live”. Er versuchte gesünder zu leben und arbeitete mit Quincy Troupe zusammenan seiner Autobiographie. Obwohl dies die vielleicht gesündeste Phase seines Lebens gewesen sein mag, forderten die Krankheiten, die er schon lange mit sich herumschleppte, ihren Tribut. Am 29. September 1991 verstarb er. Für dieses letzte Kapitel spricht Stradford mit dem Modeschöpfer Issey Miyake, dessen Kreationen Miles immer wieder trug; mit dem Bassisten Darryl Jones über Miles’ Sinn für Humor und seine Lust am Kochen; mit dem Kulturwissenschaftler Todd Boyd über die Bedeutung von Miles Davis als Ikone fürs schwarze Amerika und darüber, was sein modischer Geschmack über ihn als Künstler und schwarzer Mann aussagt; mit Jo Gelbard, Miles’ Freundin zur Zeit seines Todes, über ihr Kennenlernen in einem Aufzug, darüber, dass er nach Wandel süchtig gewesen sei, darüber, wie er etliche seiner besten Klamotten ruinierte, weil er sie beim Malen trug, sowie über die Haar-Extensions, an denen er stundenlang arbeitete, damit sie richtig saßen; mit Koshin Satoh, dessen futuristische Kreationen Miles zum Ende seines Lebens gern trug; mit dem Bassisten Marcus Miller über seine erste Begegnung mit dem Trompeter und seine Erfahrungen mit Miles’ Modegeschmack; mit dem Maler Mikel Elam, der eine Weile als Miles’ Assistent arbeitete; und mit Miles Neffen, dem Schlagzeuger und Miles’ Nachlassverwalter Vince Wilburn über den Familiensinn, den der Trompeter hatte, seinen Geschäftssinn, und über die Tatsache, dass er sich schon mal fünf- oder sechsmal am Tag umzog.
Michael Stradfords gelingt es ein ungemein unterhaltsames und zugleich erleuchtendes Buch über Miles Davis zu schreiben, obwohl er sich fast nie über die Musik selbst auslässt. Sein Erkenntnisinteresse über modische Fragen sorgt dafür, dass in seinen Interviews unbekannte Details über Miles Leben und künstlerischen Ansatz zur Sprache kommen, die auch seine Musik besser verstehen lassen. Und so gelingt es ihm in dem Buch, obwohl er so wenig zur Musik schreibt, doch sehr viel Erhellendes über sie auszubreiten. Als Leser macht man eine Erfahrung, wie wenn man etwas aus dem Augenwinkel heraus betrachtet und dabei klarer Details erkennt, die einem beim direkten Blick entgangen wären. Eine großartige Ergänzung zur Literatur über Miles Davis – und von so unerwarteter Seite.
Wolfram Knauer (Juli 2020)
Tony Lakatos. Sagt nur nicht Künstler zu mir
Von Rainer Erd
Frankfurt/Main 2020 (Books on Demand)
203 Seiten, viele Fotos
ISBN: 9783751971287
 Tony Lakatos: Der virtuose, immer verlässliche, stilistisch vielfältige, dabei ungemein bescheidene Saxophonist ist scheinbar auf jeder Bühne des Landes zuhause. In Frankfurt lebt er seit 1993 und ist seither einer der Anker der hr-Bigband. Rainer Erd hatte sich mit Lakatos’ Biographie erstmals bei einer Gesprächsveranstaltung auseinandergesetzt, bei der der gebürtige Ungar von seinem Lebensweg “vom Budapester Gypsy-Kindergeiger zum weltbekannten Jazz-Saxophonisten” erzählte. In der Folge befragte Erd den Saxophonisten ausgiebig, sprach mit Kolleg:innen aus Bigband und Szene und reiste sogar selbst nach Budapest, um die Herkunft Lakatos’ besser zu verstehen. “Sag nur nicht Künstler zu mir”, habe Lakatos ihm einmal gesagt und darauf bestanden, sein Beruf sei Musiker. Sein Talent war ihm in die Wiege gelegt war, wenn er auch erst einmal den Wunsch des Vaters abwehren musste, Geigenprimas zu werden. Zum Saxophon kam Lakatos dabei erst spät, hatte aber bereits jede Menge musikalischer Erfahrung. Und mit dem Jazz kam der junge Tony dann im 8. Bezirk Budapests in Berührung, in dem viele arme Roma lebten, in dem Lakatos aber vor allem bei Jam Sessions bei Freunden in den Jazz eintauchte.
Tony Lakatos: Der virtuose, immer verlässliche, stilistisch vielfältige, dabei ungemein bescheidene Saxophonist ist scheinbar auf jeder Bühne des Landes zuhause. In Frankfurt lebt er seit 1993 und ist seither einer der Anker der hr-Bigband. Rainer Erd hatte sich mit Lakatos’ Biographie erstmals bei einer Gesprächsveranstaltung auseinandergesetzt, bei der der gebürtige Ungar von seinem Lebensweg “vom Budapester Gypsy-Kindergeiger zum weltbekannten Jazz-Saxophonisten” erzählte. In der Folge befragte Erd den Saxophonisten ausgiebig, sprach mit Kolleg:innen aus Bigband und Szene und reiste sogar selbst nach Budapest, um die Herkunft Lakatos’ besser zu verstehen. “Sag nur nicht Künstler zu mir”, habe Lakatos ihm einmal gesagt und darauf bestanden, sein Beruf sei Musiker. Sein Talent war ihm in die Wiege gelegt war, wenn er auch erst einmal den Wunsch des Vaters abwehren musste, Geigenprimas zu werden. Zum Saxophon kam Lakatos dabei erst spät, hatte aber bereits jede Menge musikalischer Erfahrung. Und mit dem Jazz kam der junge Tony dann im 8. Bezirk Budapests in Berührung, in dem viele arme Roma lebten, in dem Lakatos aber vor allem bei Jam Sessions bei Freunden in den Jazz eintauchte.
Rainer Erd bettet die Biographie Tony Lakatos’ in die politischen Entwicklungen Ungarns ein, beschreibt die Situation der Roma im Land, ihre Kultur, deren Widerhall in der Musik, in den Cafés und Restaurants Budapests genauso wie auf der Operettenbühne zu hören war, aber auch die lange Diskriminierung, der sie ausgesetzt waren. Die Musikerdynastie der Lakatos’ sah sich in der Tradition des im 18. und frühen 19. Jahrhundert wirkenden Geigers Janos Bihare. Erd erklärt, wie wichtig in der Musik der Roma das Erlernen von Musik durch Hören und Nachahmen sei, ein Ansatz, der Lakatos in seiner Jazzerkarriere genauso hilfreich war wie beim Unterrichten junger Saxophonist:innen.
1977 nahm Lakatos erste Platten auf, gewann den 1. Platz bei einem Musikwettbewerb des ungarischen Fernsehens, während er am Béla Bartók-Konservatorium ein Studium des Jazz-Saxophons begann, dass er allerdings bald wieder abbrach, weil er das Gefühl hatte, bei Auftritten so viel mehr zu lernen. Ab Ende der 1970er Jahre trat er regelmäßig in Griechenland auf, sieht sich selbst als einen Pionier des griechischen Jazz, der ja erst ab Mitte der 1970er Jahre überhaupt zu blühen begann. 1982 brachte er seine erste Platte unter eigenem Namen heraus, “Bacillus”, stieg daneben in der Band des deutschen Gitarristen Toto Blanke ein. Die Zusammenarbeit mit letzterem sorgte dann auch für Lakatos’ Umzug nach Deutschland, wo er erst in Paderborn lebte, dann in München und schließlich in Frankfurt. Erd streift die Zusammenarbeit mit Charly Antolini, Dusko Goykovich und Barbara Dennerlein, erwähnt Platten wie “Different Moods” und “Recycling”, und erzählt von Tonys Zeit mit dem amerikanischen Pianisten Kirk Lightsey und dem ehemaligen Miles Davis-Schlagzeuger Al Foster.
Seit 1993 dann also Festanstellung in der hr Bigband mit genügend Freiraum für eigene Projekte. Erd beschreibt die Veränderung der Bigbandarbeit von der Zeit des Orchesterleiters Kurt Bong in den 1990er Jahren bis zu der der späteren Chefdirigenten Jörg Achim Keller und Jim McNeely. Er stellt weitere CD-Produktionen Lakatos’ vor, zitiert aus Rezensionen, sammelt Würdigungen von musikalischen Weggefährten und schließt mit einem Blick auf Tony Lakatos’ Aktivitäten jetzt, also mitten in der Coronakrise. Er komponiere mehr, erzählt ihm der Saxophonist, und mittendrin habe ihn dann auch noch die Nachricht erreicht, dass er den Hessischen Jazzpreis 2020 erhalte. Von der hr Bigband wird sich Tony Lakatos im November 2021 in den Vorruhestand verabschieden. Als Saxophonist allerdings wird Tony Lakatos gewiss weitermachen, der Musiker, der kein Künstler sein will, mit seinem Instrument und seiner Erfindungsgabe aber ganz große Kunst schafft.
Rainer Erds Buch über Tony Lakatos kann direkt beim Autor unter bestellt werden: Rainer.Erd@t-online.de. Der Preis beträgt € 18,00 + € 3,00 Porto.
Wolfram Knauer (Juli 2020)
Jazzblut 2021 – Berühmte Jazz-Musiker in Aktion
Fotografien von Matthias Creutziger
2020 (DUMONT Kalenderverlag)
Format (B x L): 48.7 x 58.1 cm, 14 Seiten, Spiralbindung, 30€
ISBN 425-0-8096-4699-2

Mit dem gerade erschienenen Jazzkalender mit Bildern des Dresdner Fotografen Matthias Creutziger hat der Dumont Verlag einem Künstler eine Plattform gegeben, der sich seit Jahrzehnten auf vielen Ebenen mit der Welt des Jazz auseinandergesetzt hat. So ist es nur folgerichtig, sein neuestes Werk “Jazzblut” zu betiteln.
Es wurden berühmte Jazzmusikerinnen und-Jazzmusiker an ihren verschiedenen Instrumentengattungen für diesen Kalender ausgewählt: John Scofield an der Gitarre, Sänger Ray Charles, Cellist Mischa Maisky, Pianist Michel Petrucciani, Kontrabassist Henri Texier, Tenorsaxofonist Archie Shepp, Schlagzeuger Elvin Jones, Saxophonist Charles Loyd (Quartett mit Keith Jarrett), Trompeter Tomasz Stanko, Pianistin Mitsuko Ushida, Dirigent Sir Collin Davis und Saxophonist Pharoa (Farrell) Sanders. Hilfreiche biografische Notizen zu den Künstlerinnen und Künstlern finden sich im Anhang des Werkes.
Matthias Creutziger ist freiberuflicher Fotograf mit den Hauptakzenten Jazz, Klassische Musik, Theater und Bildende Kunst. Zudem ist er Jazzkritiker und Organisator von Konzerten, Hausfotograf der Dresdner Semper Oper und kann auf zahlreiche Bildpublikationen und Ausstellungen zurückblicken. Und er hat als Schlagzeuger früher selbst Jazz gemacht. Und dies scheint man seiner Fotografie anzumerken. Er agiert nicht als außenstehender Beobachter , sondern gehört dazu, versucht der physischen Energie des Musizierens mit anderen Mitteln zu folgen.
Matthias Creutziger gilt nicht nur als hervorragender Chronist und stiller Beobachter des Musikgeschehens, sondern als Meister des Verborgenen. Er versucht in den Gesichtern seiner Protagonisten das Zerbrechliche, Intensive und Ernsthafte festzuhalten. Es ist die meditative Energie, ihre Leidenschaft zum Jazz, die in den Fotos ihren Ausdruck findet.
Und so wirkt auch der Kalender mit den Einzelpersonen optisch eher ruhig und focussiert.
Jeder Monat ist einem Musiker und verschiedensten Instrumenten im Großformat gewidmet. Fast alle Protagonisten agieren als optische Solisten aus dem Dunkel heraus im Scheinwerferlicht. So ist bei Ray Charles genau der Moment des puren Glücksempfindens festgehalten. Auch wenn es sich um typische “On Stage” Aufnahmen handelt, sind die Bühne, die Mitmusikerinnen und-musiker oder das Publikum nur in der Imagination des Betrachters präsent.
Matthias Creutziger arbeitet die Jazzgrößen von John Scofield bis Pharao Sanders so dreidimensional heraus, dass sie fast skulptural zu ihrem eigenen Denkmal avancieren. Die Fotos brauchen kein Ornament des schönen Scheins um zu wirken. Sie wirken durch die konzentrierte Individualität des Musikers und der Musikerin. Die interessanten Künstlerzitate auf jedem Kalenderblatt unterstreichen auf einer weiteren Ebene die Annäherung an die Persönlichkeit und die expressive Emotionalität – so entsteht Authentizität pur. “Ich kann keine Trennung zwischen meiner Musik und meinem Leben sehen”-philosophiert Archie Shepp und man glaubt ihm das sofort.
Die Schwarzweiß-Fotografien spielen sehr pointiert und gekonnt mit dem Hell-Dunkel-Effekt der klassischen Jazzfotografie, während die Farbaufnahmen mit der Bewegungsunschärfe eine andere völlig andere Formensprache sprechen. Matthias Creutziger versucht hier, die Zeitdimension der Musik einzufangen, die Dynamik eines John Scofield-Gitarren-Solos in Fotografie zu übersetzen, optische Spuren des Musizierens zu hinterlassen. Alle Fotos atmen alle ein hohes Maß an Authentizität, die stark von der Persönlichkeit und der expressiven Emotionalität der Musiker geprägt ist. Matthias Creutziger führt uns mit seinen eindringlichen “Jazzblut” Fotos aus unserer Alltagswelt hinaus in einen ästhetischen Vorstellungsraum, ohne Ablenkungen in ein intensives Musikerleben, das wir in den Emotionen der Musiker gespiegelt sehen.
Es sind Fotografien, die hervorragend dazu geeignet sind, abzutauchen in eine andere Welt mit meditativen Charakter.
Doris Schröder (Juli 2020)
Das Haffner Alphabet. Wolfgang Haffner im Gespräch
herausgegeben von Rainer Placke
Bad Oeynhausen 2020 (jazzprezzo)
136 Seiten, 1 beiheftende DVD, 25 Euro
ISBN: 978-3-9819538-2-4

Nach Nils Landgren und Michael Wollny ist Wolfgang Haffner der dritte Sparringpartner für Rainer Plackes Buchreihe: Die ist weder Biographie noch reines Interviewbuch, und doch doch in der Konfrontation mit den Stichwortkärtchen, auf die Haffner reagieren kann, biographische und ästhetische Aspekte genauso durch wie solche, die seine Sicht als Musiker wiedergeben.
Da geht es etwa um Altdorf, wo er 1981 seinen ersten Auftritt hatte, oder ums ARD-Wunschkonzert, für das ihm ein Schnurrbart ins Gesicht geschminkt wurde. Es geht um Johann Sebastian Bach, Chris Beier, Dave Brubeck und Till Brönner, die als Einflüsse oder Kollegen eine wichtige Rolle für ihn spielten. Es geht um Phil Collins und den “Club” (dem 1. FC Nürnberg). Es geht um seine Erfahrungen in Klaus Doldingers Band Passport und einen Vertretungsgig in der DSDS-Bigband. Es geht um den eigenen Sound, Emotionen und Peter Erskine, der auf Weather Reports “Night Passage” trommelte, eine von Haffners ersten Fusion-Platten.
Es geht ums Fliegen, um seine Heimat Franken und eine Tournee mit der Fantastischen Vier. Es geht um Steve Gadd und das Geigenspiel seiner Schwester in seiner Jugend. Es geht um seine erste Begegnung mit Peter Herbolzheimer und die Sorgfalt, die er als Musiker auf seine Hände geben muss. Es geht um Ibiza, wo er viel Zeit verbracht hat und seine Freundschaft zu Dieter Ilg. Es geht um den Film “Jazz-Club” von Helge Schneider und darum, wie Elvin Jones seine musikalische Sichtweise auf den Kopf stellte.
Es geht um frühe Kompositionserfahrungen und zwei Jahre, die er in Chaka Khans Band verbrachte. Es geht um Projekte, die er mit seinem Freund und Kollegen Nils Landgren durchführte und darum, wie im indischen Lahore die Menschen oft an anderen Stellen klatschen als hierzulande. Es geht um die Bands Mezzoforte und Metro. Es geht um Nachhaltigkeit und Natur. Es geht um die Zeit, die er als Kind auf der Orgelbank verbrachte und die Band Old Friends, in der er trommelte. Es geht um seine Lieblingsband Pink Floyd und das Streben nach Perfektion.
Es geht um seine Zusammenarbeit mit Thomas Quasthoff und sein Lieblingsquartier auf Tour, den Nightliner. Es geht um die Faszination mit dem Rampenlicht und um die Notwendigkeit der Ruhe. Es geht um die Filmmusik zu “Schtonk”, an der er mitwirkte und das Schlagzeug als Übermittler seiner Emotionen. Es geht um eine Tatort-Folge bei der er “on-screen” mitwirkte, und darum, wie wichtig Teamgeist für die Band ist. Es geht um die USA, in die er schon mal hatte ziehen wollen, und um Unruhe, die er versucht zu vermeiden.
Es geht um Vorbilder und die Notwendigkeit, sich von ihnen zu lösen, und um Visionen, etwa die Pläne für die nächste Tour oder das nächste Album. Es geht um seine Zusammenarbeit mit Konstantin Wecker und den Einfluss der Band Weather Report. Es geht um XXXL-Konzerte vor 60.000 Menschen und ein Xylophon-Projekt, das er immer schon realisieren wollte. Es geht um Yamaha als Schlagzeughersteller und den Produzenten Ypsilon. Es geht um die Notwendigkeit eines guten Zeitmanagements und die Band Zappelbude, die er zusammen mit dem Pianisten Roberto Di Gioia hatte. Und zum Schluss geht es noch um Albert Mangelsdorff, der für ihn Mentor, Bezugsperson und väterlicher Freund zugleich war.
Zwischendrin hören wir außerdem von seinem ersten Schlagzeuglehrer Harald Pompl woei von Kollegen wie Christopher Dell, Max Mutzke und Roberto Di Gioia. Eingeleitet wird das alles mit einem biographischen Vorwort von Roland Spiegel; zum Schluss folgt eine ausführliche Diskographie seiner Aufnahmen zwischen 1983 und 2019. Und zwischendrin finden sich um die 50 Fotos, die Oliver Krato während der sechsstündigen Interview-Session von Haffner machte, die den Schlagzeuger als nachdenklichen genauso wie als humorvollen Menschen portraitieren, der immer ein wenig den Schalk im Nacken zu haben scheint, dabei aber alles, womit er sich befasst, enorm ernst nimmt.
“Das Haffner Alphabet” ist ein Buch zum Blättern und Entdecken. Und zwischen den vielen Karteikarten findet sich tatsächlich viel von der Persönlichkeit des Schlagzeugers.
Wolfram Knauer (Juni 2020)POSITIONEN! Jazz und Politik
(Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung, Band 16)
herausgegeben von Wolfram Knauer
Hofheim 2020 (Wolke Verlag)
248 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-95593-016-5
 Das Buchcover sieht wie ein Nachrichtenbild dieser Tage aus, ein Rapper vor einem Foto, das einen bewaffneten Polizeieinsatz zu zeigen scheint. Das Bild, aufgenommen vom Fotografen Wilfried Heckmann, stammt vom Konzert der Band The Anarchist Republic of Bzzz letztes Jahr in der Darmstädter Centralstation, und es bebildert den Umschlag unseres just erschienenen neuen Buchs, “POSITIONEN! Jazz und Politik”, in dem wir das 16. Darmstädter Jazzforum dokumentieren.
Das Buchcover sieht wie ein Nachrichtenbild dieser Tage aus, ein Rapper vor einem Foto, das einen bewaffneten Polizeieinsatz zu zeigen scheint. Das Bild, aufgenommen vom Fotografen Wilfried Heckmann, stammt vom Konzert der Band The Anarchist Republic of Bzzz letztes Jahr in der Darmstädter Centralstation, und es bebildert den Umschlag unseres just erschienenen neuen Buchs, “POSITIONEN! Jazz und Politik”, in dem wir das 16. Darmstädter Jazzforum dokumentieren.
Dabei fragten Wissenschaftler:innen, Journalit:innen und Musiker:innen nach dem politischen Bewusstsein in unserer eigenen Gesellschaft, im Deutschland des Jahres 2019. So blickt Stephan Braese zu Beginn des Buchs zurück auf frühere politische Diskurseim deutshen Jazz. Henning Vetter diskutiert Musik und Haltung der Band The Dorf. Nina Polaschegg fragt nach den Unterschieden zwischen zeitgenössischer improvisierter und komponierter Musik in ihrem Verhältnis zur politischen Haltung. Benjamin Weidekamp und Michael Haves sprechen darüber, wie politische Haltung ihre Kunst beeinflusst.
Wolfram Knauer diskutiert Argumente für ein politisches Bewusstsein in der deutschen Jazzszene und gleicht diese mit konkreten Beispielen ab. Mario Dunkel analysiert populistische Bewegungen in Deutschland und Österreich und ihre Verwendung afrodiasporischer Musiken. Martin Pfleiderer diskutiert musikalische Interaktion als demokratischen Akt. Nadin Deventer, Lena Jeckel, Tina Heine und Ulrich Stock sprechen über die politische Verantwortung von Jazzfestival-Veranstalter:innen. Nikolaus Neuser und Florian Juncker machen auf den intermedialen Zusammenhang zwischen Musik und gesellschaftlicher Wahrnehmung aufmerksam. Hans Lüdemann erklärt die politische Motivation für seine Entscheidung Jazzmusiker zu werden.
Nikolaus Neuser diskutiert Jazz als gesellschaftliches Rollenmodell. Michael Rüsenberg hinterfragt die Vorstellung, dass Jazz immer politisch sei. Thomas Krüger beschreibt das Potenzial des Jazz für die politische Bildung. Angelika Niescier, Korhan Erel, Tim Isfort und Victoriah Szirmai blicken aus den Perspektiven von Musiker:innen, Veranstalter:innen, Journalist:innen und Publikum auf die Möglichkeiten politischer Aussagen durch Musik. Ulrich Stock sieht Atef Ben Bouzids Film “Cairo Jazzman”.
Das Buch ist auf Deutsch erschienen und ist im Buchhandel erhältlich oder direkt vom Verlag (Wolke Verlag; dort findet sich auch das Vorwort als PDF-Vorschau).
Charlie Parker. The Complete Scores. Full Transcriptions from the Original Recordings
Transkribiert von Chris Romero
Milwaukee/WI 2020 Hal Leonard)
415 Seiten, 60 US-Dollar
ISBN 978-1-5400-6720-3
 Charlie Parkers hundertster Geburtstag hat den einflussreichen Saxophonisten im vergangenen Jahr einmal mehr in die Schlagzeilen gebracht. Der Verlag Hal Leonard feierte das Jubiläum mit einer Prachtausgabe der Transkriptionen von 40 Klassikern aus seinem Repertoire, bei der, anders als im “Omnibook”, nicht nur die Saxophonstimme notiert ist, sondern auch Trompete, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.
Charlie Parkers hundertster Geburtstag hat den einflussreichen Saxophonisten im vergangenen Jahr einmal mehr in die Schlagzeilen gebracht. Der Verlag Hal Leonard feierte das Jubiläum mit einer Prachtausgabe der Transkriptionen von 40 Klassikern aus seinem Repertoire, bei der, anders als im “Omnibook”, nicht nur die Saxophonstimme notiert ist, sondern auch Trompete, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.
Chris Romero, der sich dafür lange in einer stillen Kammer eingeschlossen haben muss, bleibt in seiner Partitur allerdings der Jazzhaltung treu: Nicht jede Note ist notiert; insbesondere das Comping des Klaviers wird nur dort in Notenform angegeben, wo es Lücken füllt oder zum Solo wird, ansonsten reicht ihm hier die Angabe der gespielten Changes. Dasselbe gilt fürs Schlagzeug; vor allem die Melodieinstrumente sowie der Kontrabass dagegen sind durchgängig ausnotiert. Es gibt kein ausgiebiges Vorwort, keine editorischen Vorbemerkungen, keine analytischen Begleittexte. Niemand erklärt us, wie die Auswahl zustande kam und was ausgerechnet diese Titel zu “classic performances” werden ließ.
Für Musiker ist das alles sicher interessant, allerdings wohl nicht so sehr zum Nachspielen als vielmehr zum bewussten Studieren der Aufnahmen. Und so ist das schön gebundene und in einem Pappschuber gelieferte Buch wohl eher eine Studienpartitur, die dann aber auch dem notenfesten Fan die eine oder andere Stelle des Zusammenspiels der Band vergegenwärtigen kann. Mit “Charlie Parker. The Complete Scores” hat man vielleicht nicht die Musik selbst vor sich, aber durchaus eine gute Hörhilfe, die es erlaubt, noch tiefer in Birds Musik einzudringen.
Die transkribierten Titel sind: “Ah-Leu-Cha”; “Anthropology”; “Au Privave”; “Barbados”; “Billie’s Bounce”; “Bird’s Feathers”; “Bird’s Nest”; “Bloomdido”; “Blues for Alice”; “Bongo Bop”; “Chasing the Bird”; “Chi Chi”; “Confirmation”; “Dewey Square”; “Dexterity”; “Donna Lee”; “Drifting On a Red”; “K.C. Blues”; “Kim”; “Klactoveededstene”; “Ko Ko”; “Laird Baird”; “Leap Frog”; “Marmaduke”; “Mohawk”; “Moose the Mooche”; “My Little Suede Shoes”; “Now’s the Time”; “Ornithology”; “Passport”; “Quasimodo”; “Red Cross”; “Relaxin’ at Camarillo”; “Relaxin’ with Lee”; “Scrapple from the Apple”; “Shawnuff”; “Steeplechase”; “Thriving from a Riff”; “Visa”; “Yardbird Suite”.
Wolfram Knauer (Januar 2021)
The Essential W. Royal Stokes Jazz, Blues, and Beyond Reader
von W. Royal Stokes
Elkins/WV 2020 (Hannah Books)
562 Seiten, 30 US-Dollar
ISBN: 979-8611405475
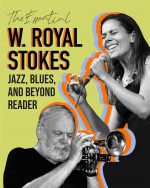 W. Royal Stokes hat in seiner Karriere für die unterschiedlichsten Publikationen geschrieben, die Tageszeitung Washington Post genauso wie für Fachmagazine wie Down Beat oder Jazz Times. Jetzt hat der 1930 geborene Journalist eine Sammlung zahlreicher seiner seit den frühen 1980er Jahren erschienenen kürzeren und längeren Artikel und Interviews zusammengestellt. Sein Interesse gilt dem alten genauso wie dem modernen Jazz, Musiker:innen seiner Wahlheimat Washington D.C., einigen ausgesuchten nicht-amerikanischen Künstler:innen sowie solchen, die eher in der Blues- und Popmusikszene zuhause sind, dem “support network”, also Aktiven des Musikgeschäfts, die sich dafür einsetzen, dass die Szene lebendig bleibt, und schließt mit ausgesuchten Konzert-, Platten- und Buchrezensionen. Konkret geht es also von Ruby Braff bis Andrew Cyrille, von Artie Shaw bis Willem Breuker, von Willis Conover bis zur Jazz Journalists Association, und selbst der Verfasser dieser Rezension kommt in einem Interview zu Wort, das Stokes 2008 mit ihm führte.
W. Royal Stokes hat in seiner Karriere für die unterschiedlichsten Publikationen geschrieben, die Tageszeitung Washington Post genauso wie für Fachmagazine wie Down Beat oder Jazz Times. Jetzt hat der 1930 geborene Journalist eine Sammlung zahlreicher seiner seit den frühen 1980er Jahren erschienenen kürzeren und längeren Artikel und Interviews zusammengestellt. Sein Interesse gilt dem alten genauso wie dem modernen Jazz, Musiker:innen seiner Wahlheimat Washington D.C., einigen ausgesuchten nicht-amerikanischen Künstler:innen sowie solchen, die eher in der Blues- und Popmusikszene zuhause sind, dem “support network”, also Aktiven des Musikgeschäfts, die sich dafür einsetzen, dass die Szene lebendig bleibt, und schließt mit ausgesuchten Konzert-, Platten- und Buchrezensionen. Konkret geht es also von Ruby Braff bis Andrew Cyrille, von Artie Shaw bis Willem Breuker, von Willis Conover bis zur Jazz Journalists Association, und selbst der Verfasser dieser Rezension kommt in einem Interview zu Wort, das Stokes 2008 mit ihm führte.
Insbesondere die Artikel für die Washington Post, die zumeist aus den späten 1970er bis Mitt-1980er Jahren stammen, sind meist kurz und befassen sich oft mit speziellen Themen oder haben mit anstehenden Auftritten in DC und Umgebung zu tun. In den längeren Interviews ist Stokes ein informierter Fragesteller, der durchaus zielgerichtet durchs Gespräch führt, seinen Gesprächspartnern dabei aber durchaus Leine lässt. Dieses Procedere lässt sich beispielsweise gut in den Transkripten zweier Interviews verfolgen, die Stokes 2003 mit dem Trompeter Dave Douglas führte: Das Gespräch führt vom Persönlichen zum Künstlerischen, von ästhetischen hin zu praktischen Fragen des Musikplanens und -machens.
Neben Größen der Jazzgeschichte – unter ihnen ein Telefonat mit Red Norvo oder Interviews mit Earl Hines, Art Hodes, Harry James und Artie Shaw – finden sich zahlreiche unbekanntere Namen, der Schlagzeuger Eddie Phyfe etwa oder der Sänger Jimmy McPhail, der mit der letzten Ellington-Band sang. Stokes’ Gespräch mit Omar Sosa wirkt eher wie ein Oral History Interview, während Monika Herzig seine weitaus formaler gestellten Fragen etwas steifer, weil per e-mail beantwortete. In seinen Konzertbesprechungen für die Post ist Stokes sich immer bewusst, dass er stellvertretend für das Publikum schreibt, das bei den Veranstaltungen dabei war, lässt also immer wieder Gesprächsfetzen mit anderen Besuchern in seine Beschreibung der Veranstaltung einfließen.
Ob die für das Buch ausgewählten Artikel nun wirklich “The Essential” sind oder ob es dem Autor nur schwerfiel eine Auswahl zu treffen, sei dahingestellt. Insbesondere in den Kapiteln mit Rezensionen finden sich einige, die außer historischer Dokumentation (“ach, der hat damals also mit dem dort und dort gespielt”) wenig vermitteln. Auf den Genuss der Lektüre hat das aber keinen negativen Einfluss, da Stokes’ Buch eh als eine Art Lesebuch angelegt ist, bei dem man gern springt und sich von der Abwechslung der Perspektiven überraschen lässt. The Essential W. Royal Stokes Jazz, Blues & Beyond Reader wurde vom Autor im Eigenverlag publiziert; ein Bestelllink findet sich auf seiner Website.
Wolfram Knauer (Januar 2021)
Adrian Rollini. The Life and Music of a Jazz Rambler
von Ate van Delden
Jackson/MS 2020 (University Press of Mississippi)
507 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-1-4968-2516-2
 Adrian Rollini scheint eher ein Nebenthema der Jazzgeschichte zu sein, und doch ist er über seine knapp dreißigjährige Aufnahmegeschichte zu einer Art Legende geworden. Viele kennen ihn als den scheinbar einzigen Bass-Saxophonisten (vor Scott Robinson), andere verbinden Instrumente wie das Goofus oder den Hot Fountain Pen mit seinem Namen. Egal welches Instrument er bediente – neben der Saxophonfamilie waren dies etwa Posaune¹, Klavier, Harpaphone, Xylophon und Vibraphon –, er entwickelte eine bewundernswerte Meisterschaft auf ihnen. Sein Bass-Sax-Spiel beeinflusste Harry Carney und Gerry Mulligan, sein Xylophon-Spiel Red Norvo, und Louis Armstrong gefiel, wie deutlich in Aufnahmen mit Rollini immer der Bass-Part zu hören war.
Adrian Rollini scheint eher ein Nebenthema der Jazzgeschichte zu sein, und doch ist er über seine knapp dreißigjährige Aufnahmegeschichte zu einer Art Legende geworden. Viele kennen ihn als den scheinbar einzigen Bass-Saxophonisten (vor Scott Robinson), andere verbinden Instrumente wie das Goofus oder den Hot Fountain Pen mit seinem Namen. Egal welches Instrument er bediente – neben der Saxophonfamilie waren dies etwa Posaune¹, Klavier, Harpaphone, Xylophon und Vibraphon –, er entwickelte eine bewundernswerte Meisterschaft auf ihnen. Sein Bass-Sax-Spiel beeinflusste Harry Carney und Gerry Mulligan, sein Xylophon-Spiel Red Norvo, und Louis Armstrong gefiel, wie deutlich in Aufnahmen mit Rollini immer der Bass-Part zu hören war.
Nun hat der niederländische Sammler und Jazzforscher Ate van Delden Adrian Rollini eine Biographie gewidmet, die alle Seiten seines musikalischen Schaffens beleuchtet. Er beginnt im Piemont des 19. Jahrhundert, wo sein Vater aufwuchs, der sich in den 1890er Jahren entschied in die Vereinigten Staaten auszuwandern und bald in New York als Kupferstecher arbeitete, nebenbei aber auch Gesangsunterricht gab. Er fand eine ebenfalls italienischstämmige Frau, und am 28. Juni 1903 kam Adrian, ihr erstes Kind, zur Welt. Der besaß das absolute Gehör, erhielt ab dem 3. Lebensjahr Klavierunterricht, und ein erster Artikel über das fünfjährige Wunderkind erschien bereits im Juli 1908 im Musical Observer. Seinen ersten professionellen Erfolge in populäreren Genres feierte Rollini dann 1919 mit dem Einspielen von Klavierwalzen, auf denen er synkopierte Walzer, Broadwayschlager und Novelty-Nummern interpretierte, die mal als Blues, Foxtrot oder als “oriental fox trot” gehandelt wurden.
1922 wurde Rollini Mitglied der California Ramblers, eines vom Geschäftsmann Ed Kirkeby geleiteten Tanzorchesters, in dem Rollini anfangs als zweiter Pianist und Xylophonspieler mitwirkte. Am 7 April 1922 machte er mit dieser Band seine erste Plattenaufnahme, “Little Grey Sweetheart of Mine”, in der sein Xylophonspiel mehr improvisiert als ausgeschrieben hinter der Band zu hören ist. Das Repertoire der Band bestand aus populärer Tanzmusik und sogenannten Novelty-Nummern, etwa Zez Confreys “Stumbling” mit einem Duett der beiden Pianisten im zweiten Teil der Aufnahme. Wenig später wechselte Rollini zum Bass-Saxophon, einem Instrument, das bis dahin kaum im Jazz vorkam, und im September 1922 ist sein erster Solobreak in “I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate” zu hören. Rollini beherrschte das Instrument immer besser und machte sich bald einen Namen als jemand, der nicht nur die Basslinie betonen konnte, sondern daneben auch zu eigenständigen Soli in der Lage war. Optisch war das Bass-Sax ein Hingucker, und in kleineren Ensembles, einer Art Auskopplung aus den California Ramblers, spielte Rollini quasi als Gegenstück den Goofus, ein in Frankreich gefertigtes Spielzeuginstrument (etwa in “San” vom Mai 1924) oder den Hot Fountain Pen, eine Art Miniaturklarinette, nicht größer als ein Füllfederhalter (etwa im “Dixie Stomp” vom Oktober 1925). Inzwischen hatte Rollini die Leitung der California Ramblers übernommen, deren Arrangements immer präziser und swingender wurden.
Van Delden verfolgt das Auf und Ab der California Ramblers, Rollinis Zeit mit Red Nichols, mit dem er ab 1927 Aufnahmen machte, die noch jazziger waren als die Tanzmusikarrangements der Ramblers, und er hört sich die Platten an, die Rollini etwa mit Joe Venuti und Eddie Lang, mit Frankie Trumbauer oder Bix Beiderbecke machte. 1928 reiste Rollini nach England, um zusammen mit dem Trompeter Chelsea Quealey und dem Saxophonisten und Klarinettisten Bobby Davis Mitglied in der Band Fred Elizaldes zu werden, der einen Gig im Londoner Tophotel Savoy innehatte. Die Musik des Ensembles war in den Schlagzeilen, mit Elizalde trat Rollini bald auch auf dem Kontinent, in Paris oder Ostende, auf und war regelmäßig im BBC zu hören. Der amerikanische Tieftöner war einer der Stars der Band und wurde vielfach in der Fachzeitschrift Melody Maker erwähnt. Ende 1929 allerdings waren die Auswirkungen des Börsencrashs auf der Wall Street bis nach London zu spüren, und so entschied sich Rollini zusammen mit seiner Frau Dixie und seinem Bruder, dem Saxophonisten Art, der inzwischen ebenfalls der Elizalde-Band angehörte, nach New York zurückzukehren.
Die Wirtschaftskrise hatte die USA voll im Griff und war auch im Musikgeschäft zu spüren. Eine Weile kam Rollini im Tanzorchester von Bert Lown unter, spielte aber auch mit den New California Ramblers, die an den Ruhm der früheren Band anzuknüpfen versuchten. 1934 wechselte er die Seiten und eröffnete Adrian’s Tap Room, einen Club im Keller des President Hotel in Midtown-Manhattan, bei dessen Eröffnung u.a. Fats Waller spielte. Zwei Jahre später kam en Musikaliengeschäft dazu, außerdem gründete Rollini ein Trio, in dem er in Begleitung von Gitarre und Kontrabass Vibraphon spielte, und wirkte in einer Reihe von Filmen mit. Im Krieg war Rollini in der Truppenbetreuung aktiv, nach Kriegsende allerdings waren andere Stilrichtungen gefragter als sein gefällig-swingende Jazz. Er zog sich mehr und mehr zurück, auch aus Gesundheitsgründen, lebte die Hälfte des Jahres in Florida, die andere in New York, wo er allerdings höchstens noch kleine Engagements wahrnahm. 1956 verunglückte er bei einem lange Zeit nicht ganz geklärten Unfall und verstarb kurz darauf im Alter von 53 Jahren². Er hinterließ ein Aufnahmeschaffen, das 35 Klavierwalzen umfasste, etwa 1.500 Titel auf Schallplatte, darunter 130 unter eigenem Namen, ca. 300 für Rundfunkshows vor-aufgezeichnete Titel, sowie bei 25 Lang- und Kurzfilme.
Ate Van Deldens Buch zeichnet das Leben und die Karriere Adrian Rollinis sorgfältig nach. Seine Endnoten verraten die Akribie, mit der der Autor die verschiedenen Stationen dieser Karriere dokumentieren konnte. Seine Darstellung ist überall an der Sache interessiert und ordnet Rollinis professionellen Lebensweg in den Kontext der Unterhaltungsindustrie der 1920er und 1930er Jahre ein. Van Deldens Interesse gilt allerdings vor allem der Biographie, Auftritts- und Aufnahmedaten seines Protagonisten, nicht dem kulturgeschichtlichen oder gar gesellschaftlichen Kontext. In diesem Ansatz unterscheidet sich Van Delden nicht von anderen Jazzautoren, und doch vergibt er sich ein wenig die Chance, mit der Lupe, die er auf den Basssaxophonisten hält, der ja ganz unterschiedliche Facetten der Musikindustrie insbesondere der 1920er Jahre kennengelernt hatte, vielleicht auch die Veränderung dieser Branche etwas genauer beleuchten zu können. Seine Einlassungen zu den Aufnahmen Rollinis bleiben im Oberflächlichen, ordnen nicht ein und vergleichen auch selten zu dem, was sonst in der Zeit zu hören war. Er beschreibt weder Stil noch stilistische Entwicklung, begründet im nüchternen Ton seiner Darstellung weder, wie sich Rollinis Vibraphon-Trio beispielsweise vom Spiel Lionel Hamptons unterschied (bzw. wie es vielleicht auch von dessen Erfolg beeinflusst war), noch, was genau dazu beigetragen haben mag, dass er nach dem Krieg nicht mehr in der vordersten Reihe mitspielen konnte. Er erwähnt die seichteren und die eher auf den Jazz fokussierten Aufnahmen aus den 1920er Jahren, seine einordnenden Wertungen beschränken sich allerdings zumeist auf Adjektive wie “excellent”, “memorable”, “amazing” oder “nice”. Wie gesagt: Dieses Manko teilt Ate van Deldes Buch mit vielen von Sammlern und Privathistorikern verfassten, die ein enormes Faktenwissen ausbreiten, sich aber an eine Einschätzung der Musik selbst nicht heran trauen. Dabei braucht es gar keines musikwissenschaftlichen Vokabulars, um zu erklären, wo Neuerungen passieren, wieso eine Aufnahme mehr oder auch weniger gelungen ist, wie sich die Musik einer bestimmten Periode zu jener anderer Künstler derselben Zeit verhält.
Davon abgesehen aber ist Ate van Delden hoch zu loben für die Akribie, mit der er, auch in der Herangehensweise und dem Verweis auf seine Quellen immer nachvollziehbar, alle ihm zugänglichen Fakten über Adrian Rollini zusammengetragen und damit eine jahrzehntelange Arbeit abgeschlossen hat. Bruce Raeburn nennt das Buch in seinem Klappentext die “definitive Biographie des Multiinstrumentalisten, Bandleaders und Komponisten Adrian Rollini” – und dem kann man sich nur anschließen, mit der Einschränkung: nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Wolfram Knauer (Oktober 2020)
¹In einer Nachricht von Leser Uwe Ladwig weist dieser darauf hin, dass Rollini niemals Posaune, sondern “mit dem Bass-Saxofon Posaunenstimmen im Baßschlüssel gespielt [habe]. Ladwig weiter: “Da Rollini vom Klavier her kam, war ihm der C-Bass-Schlüssel geläufig. 1929 erschien im Melody Maker eine neunteilige Serie, in der Rollini das Bass-Saxofon bespricht: „The When, Why and How of the Bass Saxophone“. Dort plädiert er im Teil 6 “The Problem of Transposition” für den Bass-Schlüssel in C.”
²Rollini starb nicht mit 53, sondern mit 52. Er hat seinen Geburtstag nicht mehr erlebt (* 28.6.1903 – ∞ 15.5.1956); Hinweis Uwe Ladwig.
Straighten Up and Fly Right. The Life & Music of Nat King Cole
von Will Friedwald
New York 2020 (Oxford University Press)
633 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-088204-4
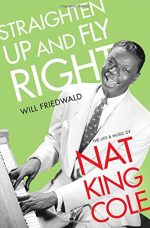 Will Friedwald ist ein ausgewiesener Kenner insbesondere des vokalen Jazz. Nach seinem viel-gelobten Buch über Frank Sinatra (1995) und diversen Büchern über amerikanische Jazz- und Popsänger:innen hat er jetzt eine Biographie Nat King Coles vorgelegt, jenes Musikers, der mehr als vielleicht jeder andere, die Welten zwischen Jazz und Pop überschreiten konnte, weil er einerseits die technische Meisterschaft auf seinem Instrument, dem Klavier, besaß, andererseits eine begeisternde Bühnenpräsenz, und darüber hinaus eine einschmeichelnde Stimme, die ihn schnell zum gefeierten Star aufsteigen ließ. Sein internationaler Ruhm lässt Jazzfans oft vergessen, welch virtuoser Pianist Nat Cole war, der aus Einflüssen durch das Stride Piano und insbesondere Earl Hines einen ganz eigenständigen Personalstil entwickelte und dabei neben den Größten seines Instruments, also Art Tatum oder Oscar Peterson, bestehen konnte.
Will Friedwald ist ein ausgewiesener Kenner insbesondere des vokalen Jazz. Nach seinem viel-gelobten Buch über Frank Sinatra (1995) und diversen Büchern über amerikanische Jazz- und Popsänger:innen hat er jetzt eine Biographie Nat King Coles vorgelegt, jenes Musikers, der mehr als vielleicht jeder andere, die Welten zwischen Jazz und Pop überschreiten konnte, weil er einerseits die technische Meisterschaft auf seinem Instrument, dem Klavier, besaß, andererseits eine begeisternde Bühnenpräsenz, und darüber hinaus eine einschmeichelnde Stimme, die ihn schnell zum gefeierten Star aufsteigen ließ. Sein internationaler Ruhm lässt Jazzfans oft vergessen, welch virtuoser Pianist Nat Cole war, der aus Einflüssen durch das Stride Piano und insbesondere Earl Hines einen ganz eigenständigen Personalstil entwickelte und dabei neben den Größten seines Instruments, also Art Tatum oder Oscar Peterson, bestehen konnte.
Für sein Buch hat Friedwald Archive durchforstet, mit Forscher:innen und Zeitzeugen – einschließlich Nat Coles Bruder Freddy Cole – gesprochen, und er hat viel Musik gehört. Er erzählt Coles Lebensgeschichte biographisch, berichtet von seiner Geburt und Kindheit in Montgomery, Alabama, dem Umzug der Familie nach Chicago, vom Vater, der vor einer Baptistengemeinde predigte, sowie von den wichtigsten musikalischen Einflüssen: der Kirche des Vaters, dem Klavierunterricht durch die Mutter und seinem Idol, dem Pianisten Earl Hines. Mit 14 Jahren, noch in der Schule, stellte Cole seine erste, zehnköpfige Band zusammen, die 1935 von der Lokalpresse als neue Sensation gefeiert wurde. Ein Jahr später machte er seine ersten Aufnahmen, unter dem Namen seines Bruders Eddie, in denen der Einfluss Hines in den Klavierpartien deutlich zu hören ist, tourte mit einer Neuauflage der 1920er-Jahre-Revue “Shuffle Along”.
1937 gründete Cole sein Trio, “aus Zufall”, wie er sagt. “Shuffle Along” war in Los Angeles gestrandet, und Cole war von der Musikszene um die Central Avenue in Los Angeles fasziniert. Er jammte mit Lionel Hampton und Lee Young, dem Bruder des Saxophonisten Lester Young. Der hatte eigentlich auch bei einem Gig dabei sein sollen, den Cole im Swanee Inn in L.A. ergattert hatte, aber er tauchte nicht auf, und so spielten Cole, Gitarrist Oscar Moore und Bassist Wesley Prince eben im Trio. Dass er zu singen begann, sei der Tatsache zu verdanken, dass er das Trio klanglich für zu eintönig hielt. Prince versorgte ihn mit dem Spitznamen “King”, und seine Karriere hob ab.
Warum ein Trio? Nun, ein Quartett mit Schlagzeug hätte zu sehr nach Rhythmusgruppe ausgesehen, und die Leute hätten dann auf den Rest der Band gewartet, argumentiert Cole später. Die ersten eigenen Aufnahmen erfolgten für sogenannte Transcription Services, also Produktionsfirmen für fertige Radiosendungen, die lokale Sender abonnieren und senden konnten. Allein von 1938 stammen 20 Aufnahmen des Trios, zwischen Standards, Pophits der Zeit und an folkige Kinderlieder angelehnte Jump-Versionen wie “Mutiny in the Nursery” oder “Three Blind Mice”. Erst Lionel Hampton brachte ihn im Mai 1940 zu einer Session ins Studio eines Major-Labels, bei der acht Titel entstanden, mit Schlagzeugbegleitung, Lionel Hampton und der Sängerin Helen Forrest. Im Dezember desselben Jahres ging Cole dann mit dem Trio ins Decca-Studio und nahm vier Titel auf, von denen insbesondere “Sweet Lorraine” ein Dauerbrenner seines Repertoires werden sollte. Die Rundfunkpräsenz Anfang der 1940er Jahre und diese Decca-Aufnahmen jedenfalls machten die nationale Presse auf ihn aufmerksam, und bald trat das Trio in den angesagten Clubs von New York und Chicago auf.
Friedwald verfolgt die Aufnahmegeschichte der Band, die im November 1943 richtig abhob, als das Trio bei seiner ersten Plattensitzung fürs kalifornische Label Capitol “Straighten Up and Fly Right” einspielte. Er erzählt die Geschichte des Labels, aber auch jene des Stücks und blättert dabei immer wieder neue Seiten amerikanischer Entertainmenthistorie auf… Er beschreibt, was Coles Interpretationen so besonders macht, erklärt, wie das Repertoire zustande kam, das Cole für Capitol aufnahm, und erzählt über die Zusammenarbeit des Sängers und Pianisten mit seinem neuen Manager Carlos Gastel. Etwa zur selben Zeit begann Norman Granz in Los Angeles mit der Organisation von öffentlichen Konzert-Jam-Sessions, aus denen schließlich Jazz at the Philharmonic-Konzertreihe hervorging, und Cole und Granz kamen für verschiedene Projekte zusammen. Wenn man den Jazzmusiker Nat Cole verstehen will, schreibt Friedwald, müsse man sich nur seine Aufnahmen mit Lester Young von 1942 und 1946 anhören.
Die Säle jedenfalls wurden größer, und Coles Name wurde nun in All-Star-Programmen oft genug in derselben Größe wie jene der Swingstars geschrieben, die in derselben Show zu hören waren. Er nahm neue Hits auf, etwa “Nature Boy” oder Billy Strayhorns “Lush Life”, und war ab 1948 regelmäßig im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand zu sehen. Zwischen den Beschreibungen musikalischer Stationen weiß Friedwald von Coles Privatleben zu berichten, der Ehe mit Maria etwa, der Geburt seiner Tochter Natalie, dem Kauf eines Hauses in einem weißen Viertel von Los Angeles, der zu rassistischen Anwürfen führte.
1950 reiste Cole zum ersten Mal nach Europa, und von nun an begann er endgültig vor allem als Pop- statt als Jazzkünstler wahrgenommen zu werden. “Mona Lisa”, schreibt Friedwald, war vielleicht der Umschwung. Wo Cole zuvor erfolgreich mit dem Arrangeur Pat Rugolo zusammengearbeitet hatte, begann jetzt seine Kooperation mit Nelson Riddle, und immer mehr wurde das Klavier zu einer nebensächlichen Staffage, weil das Publikum vor allem auf Nat King Cole, den Sänger, fokussiert war. Friedwald listet alle Erfolgsstationen auf: einen biographischen Film, Gastauftritte bei populären Fernsehshows, Auftritte in den gefeiertsten Night Clubs der Nation und schließlich seine eigene TV-Show. Immer wieder vergleicht er Coles Erfolg mit dem seiner direkten Konkurrenten, etwa Frank Sinatra oder Bing Crosby. 1961 sang Cole noch bei der Amtseinführung Präsident John F. Kennedy, doch bald darauf wurde erst ein Magengeschwür, dann Lungenkrebs diagnostiziert, eine Folge der vielen Zigaretten, die er zeitlebens geraucht hatte. Im Februar 1965 erlag er der Krankheit im Alter von nur 45 Jahren.
Will Friedwalds Buch ist ein dicker Wälzer und gewiss ein Standardwerk über Nat King Cole. Das Buch ist gut erschlossen durch einen ausführlichen Index und zahlreiche Fußnoten, und jede Phase der Karriere des Pianisten und Sängers ist ausreichend beleuchtet. Dem Autor gelingt es, die Besonderheiten des Stils zu beschreiben, ohne in eine musikalische Fachsprache zu verfallen, und er ist sich an jeder Stelle des Kontextes bewusst, in dem Cole aktiv ist: der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse also genauso wie des Status’ von Jazz und Entertainmentbranche. Und doch ist sein Buch nicht nur vom Umfang her stellenweise etwas schwer geraten. In seinem Hang zur Vollständigkeit macht es Friedwald seinen Leser:innen nämlich teilweise schwer, dabei zu bleiben. Man ist stellenweise geneigt, ihm den Titel seines eigenen Buchs zuzurufen: “Straighten Up and Fly Right!”, denn die Geschichten, die Nat King Cole so mühelos ans Publikum bringen konnten, hätten auch einen stilistisch etwas müheloseren Erzähler verdient.
Wolfram Knauer (Oktober 2020)
Kleine Songs zwischen Freunden
von Arno Fischer
Wiesbaden 2020 (Edition 6065)
110 Seiten, 12 Euro
ISBN: 978-3-941072-23-7
 Arno Fischer ist ein Buch über einen Jazzmusiker gelungen, in dem dessen Musik weitestgehend ausgespart bleibt, das aber dennoch jede Menge über seine künstlerische Haltung verrät. 1996 lernte Fischer seinen Namensvetter kennen, den amerikanischen Pianisten und Künstler John Fischer, und was als berufliche Beziehung begann – Arno Fischer war im Marburger Kulturamt für die Organisation der jährlichen Sommerakademie verantwortlich, bei der John Fischer seit einigen Jahren eine Klasse für freies Malen unterrichtete – wurde bald zu einer Freundschaft. Hinzu kam die Namensgleichheit und die Tatsache, dass die Eltern John Fischers Arno und Sabine geheißen, also die Vornamen des Autors Arno Fischer und seiner Frau getragen hatten. All das trug dazu bei, dass sich der Pianist und Künstler dem Verwaltungsangestellten und (gar nicht mal so heimlichen) Autor weit öffnete.
Arno Fischer ist ein Buch über einen Jazzmusiker gelungen, in dem dessen Musik weitestgehend ausgespart bleibt, das aber dennoch jede Menge über seine künstlerische Haltung verrät. 1996 lernte Fischer seinen Namensvetter kennen, den amerikanischen Pianisten und Künstler John Fischer, und was als berufliche Beziehung begann – Arno Fischer war im Marburger Kulturamt für die Organisation der jährlichen Sommerakademie verantwortlich, bei der John Fischer seit einigen Jahren eine Klasse für freies Malen unterrichtete – wurde bald zu einer Freundschaft. Hinzu kam die Namensgleichheit und die Tatsache, dass die Eltern John Fischers Arno und Sabine geheißen, also die Vornamen des Autors Arno Fischer und seiner Frau getragen hatten. All das trug dazu bei, dass sich der Pianist und Künstler dem Verwaltungsangestellten und (gar nicht mal so heimlichen) Autor weit öffnete.
Im Verlauf der Gespräche, die Arno Fischer in seinem Buch wiederaufleben lässt, erzählt Jean Jacques Fischer, wie John hieß, als 1930 als Sohn eines Goldschmieds in Antwerpen geboren wurde, davon, wie er zwei Tage nach Einmarsch der deutschen Truppen in die Niederlande mit seinen Eltern und Geschwistern zur Flucht Richtung Süden aufbrach. In Le Teil, einem unscheinbaren Ort in Südfrankreich, kamen sie auf einem Bauernhof unter. Er erzählt von den Umständen, den Sorgen und den Unwägbarkeiten der Flucht, über Cannes und Marseille erst nach Casablanca, dann mit einem Schiff Richtung Vereinigte Staaten, das die geflüchteten Passagiere aber in Havanna aussetzte, weil die USA die Einfahrt verweigert hatte. Zwei Jahre lebten sie auf Kuba, dann gelang ihnen die Überfahrt nach Miami, von wo aus sie per Zug nach New York reisten, und… “Eines Morgens fand ich mich wieder, sitzend in einer U-Bahn. Als wenn ich unter einer Käseglocke gelebt hätte, die nun plötzlich weggezogen worden wäre und ich war wieder in die Welt entlassen. Es war die Zeit von Hammerstein und Rodgers and Hart und George and Ira Gershwin, die ganze Welt war swinging, das war für mich die Melodie der Freiheit – und ich wusste, ich war gerettet.”
Soweit der Rahmen. Arno Fischers Buch handelt also von Flucht und den Ängsten des jungen Jean Jacques. Diese verfolgten ihn bis weit in die 1970er Jahre hinein, als er zu einem Auftritt bei den Berliner Jazztagen erstmals zu einem bejubelten Konzert nach Deutschland reiste, nach dem er sich hinter der Bühne dem Antisemitismus der Deutschen wieder ausgesetzt fühlte, ausgerechnet vom Festivalmacher George Gruntz und dem großen Albert Mangelsdorff, aber auch all den anderen anwesenden Deutschen, die sich etwas zuriefen, das er auf sich bezog: “Jetzt, nachdem man die Kunst des Juden genossen hatte”, fasst Arno Fischer die Erinnerung des Pianisten zusammen, “wurde zum Pogrom aufgerufen: ‘Jews!’ Jetzt würden die Deutschen ihr wahres Gesicht zeigen.” Als Hans Kumpf, mit dem Fischer sich angefreundet hatte, ihn aufklärte, dass die Musiker sich tatsächlich nur mit einem freundlichen “Tschüs” verabschiedet hatten, fiel Fischer ein Stein vom Herzen: “So konnte er nach zwei Analysen und dreißig Jahren New York zum ersten Mal einen winzigen Teil seiner Fluchtangst loslassen”.
Flucht und die durch sie verursachten seelischen Narben also sind das eine Thema des Buchs, das zugleich von einer Freundschaft zwischen den beiden Namensvettern handelt, vom Vertrauen-Fassen zwischen einem Nachfahren der Täter- und einem Zeitzeugen der Opfergeneration, und schließlich davon, wie John Fischers durch seine Lebenserfahrungen erlangte Gelassenheit und … vielleicht Weisheit … den jüngeren Fischer, den Autor also, dazu brachte, über sein eigenes Leben zu reflektieren.
Arno Fischers Würdigung ist dabei nur eine teilweise Biographie John Fischers, eine Erzählung über Fluchterfahrung und Erinnerung. Daneben erinnert er sich an die Gespräche, die er mit seinem väterlichen Freund hatte, an die Cafés und Restaurants, in denen diese stattfanden, an Autofahrten und Begegnungen während der Marburger Sommerakademie. John Fischer hatte bereits in den 1970er Jahren die Stätten seiner Kindheit wiederbesucht, war dabei 36 Jahre nach der Flucht auf Menschen getroffen, die er noch von damals kannte, oder auf Fremde, die ihm zeigen wollen, was sich seither alles verändert hatte. Auch davon lässt ihn Arno Fischer erzählen, wie man von fernen, leicht verklärten Erinnerungen: mal klar aufs Detail bedacht, dann dieselbe Begebenheit, aber in unterschiedlichem Kontext. Er zeichnet dabei auch die widersprüchliche Persönlichkeit John Fischers nach, dessen Mürrigkeit man genauso erahnen kann wie seine Liebenswürdigkeit, alles geerdet in einer großen Neugier und gleichzeitigen Ängsten.
Von Jazz ist bei alledem kaum die Rede, eigentlich nur im Anhang, einem Interview, das Hans Kumpf 1977 mit dem Pianisten geführt hatte. Und doch meint man den Jazz dauernd durchzuhören. Arno Fischers Buch nämlich macht uns darauf aufmerksam, dass die Kunst improvisierender Musiker immer aus ihrer eigenen Biographie schöpft, dass es sich lohnt, ihre Perspektive aufs Leben kennenzulernen, um ihrer Musik näherzukommen, dass andererseits die Kenntnis ihrer Lebenserinnerungen durchaus auch die eigene Hörerfahrung komplett umkrempeln kann – so geschehen beim Autor dieser Rezension, der John Fischers Aufnahmen jetzt mit anderen Ohren hören wird.
Wolfram Knauer (Oktober 2020)
MilesStyle. The Fashion of Miles Davis
von Michael Stradford
Los Angeles 2020(self-published)
204 Seiten, 17,99 US-Dollar
ISBN: 978-1647865573
 Michael Stradford ist Medienmanager mit umfangreichen Erfahrungen in Rundfunk, Fernsehen und Film. Jetzt hat er ein Buch über Miles Davis vorgelegt, das sich allerdings nur Rande mit Davis’ Musik zu beschäftigen scheint und stattdessen seine Bühnenpersönlichkeit, oder noch genauer: seine Bühnengarderobe und seinen Sinn für Mode in den Mittelpunkt stellt. Dass und wie Stradford dabei dann doch der Musik ziemlich nahe kommt, ist eine ziemlich erstaunliche und für seiner Leser:innen ungemein befriedigende Erfahrung.
Michael Stradford ist Medienmanager mit umfangreichen Erfahrungen in Rundfunk, Fernsehen und Film. Jetzt hat er ein Buch über Miles Davis vorgelegt, das sich allerdings nur Rande mit Davis’ Musik zu beschäftigen scheint und stattdessen seine Bühnenpersönlichkeit, oder noch genauer: seine Bühnengarderobe und seinen Sinn für Mode in den Mittelpunkt stellt. Dass und wie Stradford dabei dann doch der Musik ziemlich nahe kommt, ist eine ziemlich erstaunliche und für seiner Leser:innen ungemein befriedigende Erfahrung.
In seiner Jugend habe er fast aus Versehen Miles’ “In a Silent Way” gehört und es habe ihm überhaupt nicht gefallen, beginnt Stradford sein Buch. In den frühen 1980ern habe er den Trompeter dann auf seiner Promo-Tour für das Album “The Man with the Horn” in Cincinnati erlebt. Dieser sei in einem weiten rosa Overall aufgetreten, habe eine weiße Strickmütze getragen, auf die das Wort “Pepe” aufgestickt war, und an den Füßen habe er eine Art Pantoffeln getragen. Er habe nicht viel gespielt, doch das Publikum habe ihm begeostert zugejubelt, als er am Ende des Abends kurz winkte. Stradford verstand nicht so recht, was da vor sich ging. Ein paar Tage später sei ihm das Album “My Funny Valentine. Miles Davis in Concert” in die Hände gefallen, und der Ton, den er aus Miles Davis’ Trompete hörte, hielt ihn gefangen. Danach habe er sich nach und nach die anderen Schaffensperioden des Meisters angeeignet. Er habe alles gelesen, was er über den Trompeter finden konnte einschließlich Büchern über seine Malerei. Und er habe davon geträumt, ein großes, reich bebildertes Buch über Miles’ Mode zu schreiben. Dieses Coffertable-Book-Projekt habe sich dann leider aus Kostengründen zerschlagen, doch Stradford fand, die Recherchen rechtfertigten eine Veröffentlichung zumindest seiner Beobachtungen und der Gespräche, die er mit Vertrauten und Experten geführt hatte.
Stradfords erstes Kapitel umfasst die Jahre bis 1949, erzählt von Miles’ Jugend in St. Louis und identifiziert seine Mutter als einen modischen Einfluss, aber auch Fred Astaire (von dem Miles sagte, er habe in etwa seine Größe) und Cary Grant. Auch Clark Terry, der wie er aus St. Louis stammte, habe ihm modisch imponiert, und als Miles einen ersten Gig in Eddie Randles Band hatte, nutzte er die Gage, um “hippe Brooks Brothers”-Anzüge zu kaufen. 1944 ging Miles nach New York, um an der Juilliard School Unterricht zu nehmen, und hier achtete er besonders darauf, dass sein Äußeres nicht seine Kleinstadtherkunft verriet. Stradford blickt auf andere modebewusste Musiker der Zeit, Coleman Hawkins etwa, der Miles schon mal Anzüge besorgte, den Schlagzeuger Charlie Rice, der ihm seinen ersten Maßanzug anfertigte, oder Dexter Gordon, der Miles’ Sinn für Mode kritisierte. Und dann spricht er mit Clark Terry selbst, der erklärt, wie wichtig die Garderobe in den 1940er und 1950er Jahren war, weiß, dass Miles ihn als Jugendlicher nachgeahmt hatte, aber betont, dass er dann doch schnell seinen eigenen Stil gefunden habe (musikalisch wie modisch). Stradford spricht mit dem Modeexperten Lloyd Boston über die Bedeutung von Mode für schwarze Männer und über den Wandel in Miles Davis’ Stil, der über die Jahre immer schriller und auffälliger wurde. Miles Davis sei eine Modeikone gerade, weil er keine sein wollte, erklärt Boston und definiert den “klassischen Miles-Look”: dezente Eleganz, eine Schlichtheit, bei der weniger mehr ist. Schließlich spricht Stradford noch mit dem Filmproduzenten Reggie Hudlin darüber, wie er Miles zum ersten Mal traf, als sein erster Film “House Party” herauskam, und wie er von ihm den Auftrag erhielt, ein Bühnenbild für eine große Show in Paris zu entwerfen, ein Projekt, das dann allerdings nie realisiert wurde.
In den 1950er Jahren hatten Miles’ Pariser Ausflüge, seine Freundschaft zu Juliette Greco Einfluss auch auf den Modesinn des Trompeters. Stradford diskutiert aber auch Miles’ Suchtverhalten und die daraus resultierenden Probleme. Es ging ihm zeitweise richtig dreckig, schreibt Stradford, aber er trat nach wie vor wie aus dem Ei gepellt in der Öffentlichkeit auf. Er betrachtet Fotos von Miles aus jenen Jahren, analysiert die Stoffe, Schnitte, Designer, und er setzt all das ins Verhältnis zur allgemein vorherrschenden Mode der Zeit. Miles, fasst er am Schluss des Kapitels zusammen, habe für sich ein Profil geschaffen wie kein anderer Musiker in der populären Musik, ein Profil, zu dem die Klänge seiner Platten genauso gehörten wie sein visuelles Image. Für dieses Kapitel unterhält Stradford sich mit dem Modeexperten Charlie Davidson über Miles als Kunden in seinem Modegeschäft in Cambridge, Massachusetts, mit Bryan Ferry, der ja selbst als Modeikone gehandelt wird, sowie mit der Modeforscherin Monica Miller über die Tradition der “Black Dandies”.
In den 1960er Jahren übernahm Miles Modetrends aus Italien; selbst Down Beat fand, Miles sei so gut angezogen, dass man mit einem Blick auf ihn erkennen könne, was der Mann nächstes Jahr tragen müsse. Seine Konzerte wurden von den Stars des Showbusiness besucht, sein Erfolg ermöglichte ihm den Kauf eines fünfstöckigen Hauses auf der Upper West Side Manhattans und eines vielbeachteten Ferraris. Zugleich sprach Miles sich offen gegen den Rassismus in den USA aus, und er spielte mit einem Quintett, dessen Musiker größtenteils zumindest zehn Jahre jünger als er waren. Für dieses Kapitel spricht Stradford mit Miles’ Frau Frances Davis über ihre erste Begegnung und seinen Modegeschmack, mit Quincy Jones über Miles’ Talent als Schauspieler und sein Image als harter Bursche, sowie mit Ron Carter über seine erste Begegnung mit dem Trompeter und darüber, dass dieser seinen Musikern freie Hand bei der Entscheidung ließ, was sie auf der Bühne trugen.
Mit “Filles de Kilimanjaro” und “Bitches Brew” begann eine auch modisch völlig andere Zeit. Betty Mabris machte Miles mit der Popmusik der Zeit vertraut und beeinflusste auch seinen modischen Wandel von europäischem Chique hin zu stärker funky wirkenden Klamotten, Lederhemden, Schlangen- und Wildlederhosen, wild-bunten Hemden, die er nie öfter als einmal trug. Für dieses Kapitel spricht Stradford mit der Designerin Andrea Aranow über ihre Entwürfe für Jimi Hendrix und Miles Davis, mit dem Fotografen Anthony Barbosa über ihre Fotosessions Anfang der 1970er Jahre und jene für das Album “You’re Under Arrest”, und mit Betty Mabris/Davis über ihre Modeling-Karriere und den modischen Einfluss, den sie auf ihren Mann hatte.
Ende der 1970er Jahre hörte man eigentlich nur über Miles’ Gesundheitsprobleme; er trat nicht mehr auf, und in Interviews äußerte er oft, wie gelangweilt er sei. Für diese Zeit sammelt Stradford Interviews mit Lenny Kravitz, dessen Eltern mit Miles befreundet waren, mit der Kostümbildnerin Gersha Phillips über die Garderobe, die sie für Don Cheadles Film “Miles Ahead” entwarf, mit dem Perkussionisten James Mtume darüber, dass Miles jedes Mal, wenn sich seine Musik änderte, auch seinen Look änderte, und mit dem Bassisten Michael Henderson über seine erste Begegnung mit Miles und Einkaufstipps vom Chef.
In den 1980er Jahren feierte Miles sein Comeback mit einer Musik, die purer Miles genauso war wie sie auf Popmusik von Cyndi Lauper oder Michael Jackson zurückgriff. Er erhielt Gagen wie ein Rockstar und hatte Gastauftritte bei “Miami Vice” und “Saturday Night Live”. Er versuchte gesünder zu leben und arbeitete mit Quincy Troupe zusammenan seiner Autobiographie. Obwohl dies die vielleicht gesündeste Phase seines Lebens gewesen sein mag, forderten die Krankheiten, die er schon lange mit sich herumschleppte, ihren Tribut. Am 29. September 1991 verstarb er. Für dieses letzte Kapitel spricht Stradford mit dem Modeschöpfer Issey Miyake, dessen Kreationen Miles immer wieder trug; mit dem Bassisten Darryl Jones über Miles’ Sinn für Humor und seine Lust am Kochen; mit dem Kulturwissenschaftler Todd Boyd über die Bedeutung von Miles Davis als Ikone fürs schwarze Amerika und darüber, was sein modischer Geschmack über ihn als Künstler und schwarzer Mann aussagt; mit Jo Gelbard, Miles’ Freundin zur Zeit seines Todes, über ihr Kennenlernen in einem Aufzug, darüber, dass er nach Wandel süchtig gewesen sei, darüber, wie er etliche seiner besten Klamotten ruinierte, weil er sie beim Malen trug, sowie über die Haar-Extensions, an denen er stundenlang arbeitete, damit sie richtig saßen; mit Koshin Satoh, dessen futuristische Kreationen Miles zum Ende seines Lebens gern trug; mit dem Bassisten Marcus Miller über seine erste Begegnung mit dem Trompeter und seine Erfahrungen mit Miles’ Modegeschmack; mit dem Maler Mikel Elam, der eine Weile als Miles’ Assistent arbeitete; und mit Miles Neffen, dem Schlagzeuger und Miles’ Nachlassverwalter Vince Wilburn über den Familiensinn, den der Trompeter hatte, seinen Geschäftssinn, und über die Tatsache, dass er sich schon mal fünf- oder sechsmal am Tag umzog.
Michael Stradfords gelingt es ein ungemein unterhaltsames und zugleich erleuchtendes Buch über Miles Davis zu schreiben, obwohl er sich fast nie über die Musik selbst auslässt. Sein Erkenntnisinteresse über modische Fragen sorgt dafür, dass in seinen Interviews unbekannte Details über Miles Leben und künstlerischen Ansatz zur Sprache kommen, die auch seine Musik besser verstehen lassen. Und so gelingt es ihm in dem Buch, obwohl er so wenig zur Musik schreibt, doch sehr viel Erhellendes über sie auszubreiten. Als Leser macht man eine Erfahrung, wie wenn man etwas aus dem Augenwinkel heraus betrachtet und dabei klarer Details erkennt, die einem beim direkten Blick entgangen wären. Eine großartige Ergänzung zur Literatur über Miles Davis – und von so unerwarteter Seite.
Wolfram Knauer (Juli 2020)
Tony Lakatos. Sagt nur nicht Künstler zu mir
Von Rainer Erd
Frankfurt/Main 2020 (Books on Demand)
203 Seiten, viele Fotos
ISBN: 9783751971287
 Tony Lakatos: Der virtuose, immer verlässliche, stilistisch vielfältige, dabei ungemein bescheidene Saxophonist ist scheinbar auf jeder Bühne des Landes zuhause. In Frankfurt lebt er seit 1993 und ist seither einer der Anker der hr-Bigband. Rainer Erd hatte sich mit Lakatos’ Biographie erstmals bei einer Gesprächsveranstaltung auseinandergesetzt, bei der der gebürtige Ungar von seinem Lebensweg “vom Budapester Gypsy-Kindergeiger zum weltbekannten Jazz-Saxophonisten” erzählte. In der Folge befragte Erd den Saxophonisten ausgiebig, sprach mit Kolleg:innen aus Bigband und Szene und reiste sogar selbst nach Budapest, um die Herkunft Lakatos’ besser zu verstehen. “Sag nur nicht Künstler zu mir”, habe Lakatos ihm einmal gesagt und darauf bestanden, sein Beruf sei Musiker. Sein Talent war ihm in die Wiege gelegt war, wenn er auch erst einmal den Wunsch des Vaters abwehren musste, Geigenprimas zu werden. Zum Saxophon kam Lakatos dabei erst spät, hatte aber bereits jede Menge musikalischer Erfahrung. Und mit dem Jazz kam der junge Tony dann im 8. Bezirk Budapests in Berührung, in dem viele arme Roma lebten, in dem Lakatos aber vor allem bei Jam Sessions bei Freunden in den Jazz eintauchte.
Tony Lakatos: Der virtuose, immer verlässliche, stilistisch vielfältige, dabei ungemein bescheidene Saxophonist ist scheinbar auf jeder Bühne des Landes zuhause. In Frankfurt lebt er seit 1993 und ist seither einer der Anker der hr-Bigband. Rainer Erd hatte sich mit Lakatos’ Biographie erstmals bei einer Gesprächsveranstaltung auseinandergesetzt, bei der der gebürtige Ungar von seinem Lebensweg “vom Budapester Gypsy-Kindergeiger zum weltbekannten Jazz-Saxophonisten” erzählte. In der Folge befragte Erd den Saxophonisten ausgiebig, sprach mit Kolleg:innen aus Bigband und Szene und reiste sogar selbst nach Budapest, um die Herkunft Lakatos’ besser zu verstehen. “Sag nur nicht Künstler zu mir”, habe Lakatos ihm einmal gesagt und darauf bestanden, sein Beruf sei Musiker. Sein Talent war ihm in die Wiege gelegt war, wenn er auch erst einmal den Wunsch des Vaters abwehren musste, Geigenprimas zu werden. Zum Saxophon kam Lakatos dabei erst spät, hatte aber bereits jede Menge musikalischer Erfahrung. Und mit dem Jazz kam der junge Tony dann im 8. Bezirk Budapests in Berührung, in dem viele arme Roma lebten, in dem Lakatos aber vor allem bei Jam Sessions bei Freunden in den Jazz eintauchte.
Rainer Erd bettet die Biographie Tony Lakatos’ in die politischen Entwicklungen Ungarns ein, beschreibt die Situation der Roma im Land, ihre Kultur, deren Widerhall in der Musik, in den Cafés und Restaurants Budapests genauso wie auf der Operettenbühne zu hören war, aber auch die lange Diskriminierung, der sie ausgesetzt waren. Die Musikerdynastie der Lakatos’ sah sich in der Tradition des im 18. und frühen 19. Jahrhundert wirkenden Geigers Janos Bihare. Erd erklärt, wie wichtig in der Musik der Roma das Erlernen von Musik durch Hören und Nachahmen sei, ein Ansatz, der Lakatos in seiner Jazzerkarriere genauso hilfreich war wie beim Unterrichten junger Saxophonist:innen.
1977 nahm Lakatos erste Platten auf, gewann den 1. Platz bei einem Musikwettbewerb des ungarischen Fernsehens, während er am Béla Bartók-Konservatorium ein Studium des Jazz-Saxophons begann, dass er allerdings bald wieder abbrach, weil er das Gefühl hatte, bei Auftritten so viel mehr zu lernen. Ab Ende der 1970er Jahre trat er regelmäßig in Griechenland auf, sieht sich selbst als einen Pionier des griechischen Jazz, der ja erst ab Mitte der 1970er Jahre überhaupt zu blühen begann. 1982 brachte er seine erste Platte unter eigenem Namen heraus, “Bacillus”, stieg daneben in der Band des deutschen Gitarristen Toto Blanke ein. Die Zusammenarbeit mit letzterem sorgte dann auch für Lakatos’ Umzug nach Deutschland, wo er erst in Paderborn lebte, dann in München und schließlich in Frankfurt. Erd streift die Zusammenarbeit mit Charly Antolini, Dusko Goykovich und Barbara Dennerlein, erwähnt Platten wie “Different Moods” und “Recycling”, und erzählt von Tonys Zeit mit dem amerikanischen Pianisten Kirk Lightsey und dem ehemaligen Miles Davis-Schlagzeuger Al Foster.
Seit 1993 dann also Festanstellung in der hr Bigband mit genügend Freiraum für eigene Projekte. Erd beschreibt die Veränderung der Bigbandarbeit von der Zeit des Orchesterleiters Kurt Bong in den 1990er Jahren bis zu der der späteren Chefdirigenten Jörg Achim Keller und Jim McNeely. Er stellt weitere CD-Produktionen Lakatos’ vor, zitiert aus Rezensionen, sammelt Würdigungen von musikalischen Weggefährten und schließt mit einem Blick auf Tony Lakatos’ Aktivitäten jetzt, also mitten in der Coronakrise. Er komponiere mehr, erzählt ihm der Saxophonist, und mittendrin habe ihn dann auch noch die Nachricht erreicht, dass er den Hessischen Jazzpreis 2020 erhalte. Von der hr Bigband wird sich Tony Lakatos im November 2021 in den Vorruhestand verabschieden. Als Saxophonist allerdings wird Tony Lakatos gewiss weitermachen, der Musiker, der kein Künstler sein will, mit seinem Instrument und seiner Erfindungsgabe aber ganz große Kunst schafft.
Rainer Erds Buch über Tony Lakatos kann direkt beim Autor unter bestellt werden: Rainer.Erd@t-online.de. Der Preis beträgt € 18,00 + € 3,00 Porto.
Wolfram Knauer (Juli 2020)
Jazzblut 2021 – Berühmte Jazz-Musiker in Aktion
Fotografien von Matthias Creutziger
2020 (DUMONT Kalenderverlag)
Format (B x L): 48.7 x 58.1 cm, 14 Seiten, Spiralbindung, 30€
ISBN 425-0-8096-4699-2

Mit dem gerade erschienenen Jazzkalender mit Bildern des Dresdner Fotografen Matthias Creutziger hat der Dumont Verlag einem Künstler eine Plattform gegeben, der sich seit Jahrzehnten auf vielen Ebenen mit der Welt des Jazz auseinandergesetzt hat. So ist es nur folgerichtig, sein neuestes Werk “Jazzblut” zu betiteln.
Es wurden berühmte Jazzmusikerinnen und-Jazzmusiker an ihren verschiedenen Instrumentengattungen für diesen Kalender ausgewählt: John Scofield an der Gitarre, Sänger Ray Charles, Cellist Mischa Maisky, Pianist Michel Petrucciani, Kontrabassist Henri Texier, Tenorsaxofonist Archie Shepp, Schlagzeuger Elvin Jones, Saxophonist Charles Loyd (Quartett mit Keith Jarrett), Trompeter Tomasz Stanko, Pianistin Mitsuko Ushida, Dirigent Sir Collin Davis und Saxophonist Pharoa (Farrell) Sanders. Hilfreiche biografische Notizen zu den Künstlerinnen und Künstlern finden sich im Anhang des Werkes.
Matthias Creutziger ist freiberuflicher Fotograf mit den Hauptakzenten Jazz, Klassische Musik, Theater und Bildende Kunst. Zudem ist er Jazzkritiker und Organisator von Konzerten, Hausfotograf der Dresdner Semper Oper und kann auf zahlreiche Bildpublikationen und Ausstellungen zurückblicken. Und er hat als Schlagzeuger früher selbst Jazz gemacht. Und dies scheint man seiner Fotografie anzumerken. Er agiert nicht als außenstehender Beobachter , sondern gehört dazu, versucht der physischen Energie des Musizierens mit anderen Mitteln zu folgen.
Matthias Creutziger gilt nicht nur als hervorragender Chronist und stiller Beobachter des Musikgeschehens, sondern als Meister des Verborgenen. Er versucht in den Gesichtern seiner Protagonisten das Zerbrechliche, Intensive und Ernsthafte festzuhalten. Es ist die meditative Energie, ihre Leidenschaft zum Jazz, die in den Fotos ihren Ausdruck findet.
Und so wirkt auch der Kalender mit den Einzelpersonen optisch eher ruhig und focussiert.
Jeder Monat ist einem Musiker und verschiedensten Instrumenten im Großformat gewidmet. Fast alle Protagonisten agieren als optische Solisten aus dem Dunkel heraus im Scheinwerferlicht. So ist bei Ray Charles genau der Moment des puren Glücksempfindens festgehalten. Auch wenn es sich um typische “On Stage” Aufnahmen handelt, sind die Bühne, die Mitmusikerinnen und-musiker oder das Publikum nur in der Imagination des Betrachters präsent.
Matthias Creutziger arbeitet die Jazzgrößen von John Scofield bis Pharao Sanders so dreidimensional heraus, dass sie fast skulptural zu ihrem eigenen Denkmal avancieren. Die Fotos brauchen kein Ornament des schönen Scheins um zu wirken. Sie wirken durch die konzentrierte Individualität des Musikers und der Musikerin. Die interessanten Künstlerzitate auf jedem Kalenderblatt unterstreichen auf einer weiteren Ebene die Annäherung an die Persönlichkeit und die expressive Emotionalität – so entsteht Authentizität pur. “Ich kann keine Trennung zwischen meiner Musik und meinem Leben sehen”-philosophiert Archie Shepp und man glaubt ihm das sofort.
Die Schwarzweiß-Fotografien spielen sehr pointiert und gekonnt mit dem Hell-Dunkel-Effekt der klassischen Jazzfotografie, während die Farbaufnahmen mit der Bewegungsunschärfe eine andere völlig andere Formensprache sprechen. Matthias Creutziger versucht hier, die Zeitdimension der Musik einzufangen, die Dynamik eines John Scofield-Gitarren-Solos in Fotografie zu übersetzen, optische Spuren des Musizierens zu hinterlassen. Alle Fotos atmen alle ein hohes Maß an Authentizität, die stark von der Persönlichkeit und der expressiven Emotionalität der Musiker geprägt ist. Matthias Creutziger führt uns mit seinen eindringlichen “Jazzblut” Fotos aus unserer Alltagswelt hinaus in einen ästhetischen Vorstellungsraum, ohne Ablenkungen in ein intensives Musikerleben, das wir in den Emotionen der Musiker gespiegelt sehen.
Es sind Fotografien, die hervorragend dazu geeignet sind, abzutauchen in eine andere Welt mit meditativen Charakter.
Doris Schröder (Juli 2020)
Das Haffner Alphabet. Wolfgang Haffner im Gespräch
herausgegeben von Rainer Placke
Bad Oeynhausen 2020 (jazzprezzo)
136 Seiten, 1 beiheftende DVD, 25 Euro
ISBN: 978-3-9819538-2-4

Nach Nils Landgren und Michael Wollny ist Wolfgang Haffner der dritte Sparringpartner für Rainer Plackes Buchreihe: Die ist weder Biographie noch reines Interviewbuch, und doch doch in der Konfrontation mit den Stichwortkärtchen, auf die Haffner reagieren kann, biographische und ästhetische Aspekte genauso durch wie solche, die seine Sicht als Musiker wiedergeben.
Da geht es etwa um Altdorf, wo er 1981 seinen ersten Auftritt hatte, oder ums ARD-Wunschkonzert, für das ihm ein Schnurrbart ins Gesicht geschminkt wurde. Es geht um Johann Sebastian Bach, Chris Beier, Dave Brubeck und Till Brönner, die als Einflüsse oder Kollegen eine wichtige Rolle für ihn spielten. Es geht um Phil Collins und den “Club” (dem 1. FC Nürnberg). Es geht um seine Erfahrungen in Klaus Doldingers Band Passport und einen Vertretungsgig in der DSDS-Bigband. Es geht um den eigenen Sound, Emotionen und Peter Erskine, der auf Weather Reports “Night Passage” trommelte, eine von Haffners ersten Fusion-Platten.
Es geht ums Fliegen, um seine Heimat Franken und eine Tournee mit der Fantastischen Vier. Es geht um Steve Gadd und das Geigenspiel seiner Schwester in seiner Jugend. Es geht um seine erste Begegnung mit Peter Herbolzheimer und die Sorgfalt, die er als Musiker auf seine Hände geben muss. Es geht um Ibiza, wo er viel Zeit verbracht hat und seine Freundschaft zu Dieter Ilg. Es geht um den Film “Jazz-Club” von Helge Schneider und darum, wie Elvin Jones seine musikalische Sichtweise auf den Kopf stellte.
Es geht um frühe Kompositionserfahrungen und zwei Jahre, die er in Chaka Khans Band verbrachte. Es geht um Projekte, die er mit seinem Freund und Kollegen Nils Landgren durchführte und darum, wie im indischen Lahore die Menschen oft an anderen Stellen klatschen als hierzulande. Es geht um die Bands Mezzoforte und Metro. Es geht um Nachhaltigkeit und Natur. Es geht um die Zeit, die er als Kind auf der Orgelbank verbrachte und die Band Old Friends, in der er trommelte. Es geht um seine Lieblingsband Pink Floyd und das Streben nach Perfektion.
Es geht um seine Zusammenarbeit mit Thomas Quasthoff und sein Lieblingsquartier auf Tour, den Nightliner. Es geht um die Faszination mit dem Rampenlicht und um die Notwendigkeit der Ruhe. Es geht um die Filmmusik zu “Schtonk”, an der er mitwirkte und das Schlagzeug als Übermittler seiner Emotionen. Es geht um eine Tatort-Folge bei der er “on-screen” mitwirkte, und darum, wie wichtig Teamgeist für die Band ist. Es geht um die USA, in die er schon mal hatte ziehen wollen, und um Unruhe, die er versucht zu vermeiden.
Es geht um Vorbilder und die Notwendigkeit, sich von ihnen zu lösen, und um Visionen, etwa die Pläne für die nächste Tour oder das nächste Album. Es geht um seine Zusammenarbeit mit Konstantin Wecker und den Einfluss der Band Weather Report. Es geht um XXXL-Konzerte vor 60.000 Menschen und ein Xylophon-Projekt, das er immer schon realisieren wollte. Es geht um Yamaha als Schlagzeughersteller und den Produzenten Ypsilon. Es geht um die Notwendigkeit eines guten Zeitmanagements und die Band Zappelbude, die er zusammen mit dem Pianisten Roberto Di Gioia hatte. Und zum Schluss geht es noch um Albert Mangelsdorff, der für ihn Mentor, Bezugsperson und väterlicher Freund zugleich war.
Zwischendrin hören wir außerdem von seinem ersten Schlagzeuglehrer Harald Pompl woei von Kollegen wie Christopher Dell, Max Mutzke und Roberto Di Gioia. Eingeleitet wird das alles mit einem biographischen Vorwort von Roland Spiegel; zum Schluss folgt eine ausführliche Diskographie seiner Aufnahmen zwischen 1983 und 2019. Und zwischendrin finden sich um die 50 Fotos, die Oliver Krato während der sechsstündigen Interview-Session von Haffner machte, die den Schlagzeuger als nachdenklichen genauso wie als humorvollen Menschen portraitieren, der immer ein wenig den Schalk im Nacken zu haben scheint, dabei aber alles, womit er sich befasst, enorm ernst nimmt.
“Das Haffner Alphabet” ist ein Buch zum Blättern und Entdecken. Und zwischen den vielen Karteikarten findet sich tatsächlich viel von der Persönlichkeit des Schlagzeugers.
Wolfram Knauer (Juni 2020)
 Die Kulturhistorikerin Rachel Anne Gillett nimmt sich in ihrem Buch ein oft behandeltes Thema vor: den die populäre schwarze Musik im Paris zwischen den beiden Weltkriegen. Doch wer dabei eine weitere Abhandlung über amerikanische Jazzmusiker in Paris erwartet, über die Faszination der Stadt an der Seine für amerikanische Künstler im allgemeinen, über die afro-amerikanische Exilszene in der französischen Hauptstadt, die davon schwärmte, hier freier und mit weniger Rassismus leben zu können als in den USA, wird enttäuscht… dafür aber belohnt mit einer Studie, die daran erinnert, dass schwarze Musik in Paris – und hier kann man ergänzen: schwarze Musik in Europa – in jenen Jahren eben nicht nur von US-amerikanischen Musiker:innen gespielt wurde, sondern dass es daneben jede Menge anderer schwarzer Musiker gab, die aus Französisch-Westafrika oder den französischen Antillen stammten, die sich wegen der Jazzmode hierzulande aber oft genug amerikanisierte Namen gaben. Tatsächlich ließen sich zahlreiche US-Musiker – das bekannteste Beispiel ist Louis Armstrong – bei ihren Tourneen auf dem Alten Kontinent von Bands begleiten, deren Mitglieder aufs Publikum wie Amerikaner wirkten, tatsächlich aber Briten oder Franzosen schwarzer Hautfarbe waren.
Die Kulturhistorikerin Rachel Anne Gillett nimmt sich in ihrem Buch ein oft behandeltes Thema vor: den die populäre schwarze Musik im Paris zwischen den beiden Weltkriegen. Doch wer dabei eine weitere Abhandlung über amerikanische Jazzmusiker in Paris erwartet, über die Faszination der Stadt an der Seine für amerikanische Künstler im allgemeinen, über die afro-amerikanische Exilszene in der französischen Hauptstadt, die davon schwärmte, hier freier und mit weniger Rassismus leben zu können als in den USA, wird enttäuscht… dafür aber belohnt mit einer Studie, die daran erinnert, dass schwarze Musik in Paris – und hier kann man ergänzen: schwarze Musik in Europa – in jenen Jahren eben nicht nur von US-amerikanischen Musiker:innen gespielt wurde, sondern dass es daneben jede Menge anderer schwarzer Musiker gab, die aus Französisch-Westafrika oder den französischen Antillen stammten, die sich wegen der Jazzmode hierzulande aber oft genug amerikanisierte Namen gaben. Tatsächlich ließen sich zahlreiche US-Musiker – das bekannteste Beispiel ist Louis Armstrong – bei ihren Tourneen auf dem Alten Kontinent von Bands begleiten, deren Mitglieder aufs Publikum wie Amerikaner wirkten, tatsächlich aber Briten oder Franzosen schwarzer Hautfarbe waren. Steve Lacy war eine faszinierende Persönlichkeit. Ein Musiker, der mit 16 Jahren anfing traditionellen Jazz zu spielen und mit 22 auf Cecil Taylors Debutalbum “Jazz Advance” mitwirkte, der kurzzeitig Mitglied in Thelonious Mons Band war, dessen Stücke zeitlebens in seinem Repertoire blieben, dann Teil der europäischen Avantgarde/Free-Jazz-Szene wurde, erst in Italien, dann in Paris, von wo aus er mit seinem Sextett tourte, ab den 1970er Jahren aber immer wieder auch als Solist auf dem Sopransaxophon auftrat. Auf einem Instrument, das nach dem großen Sidney Bechet kaum ein Saxophonist mehr angerührt hatte, weil sein Beispiel einfach zu einflussreich war. Eigentlich war John Coltrane der einzige neben Lacy, der auf dem Instrument neue Wege beschritt (und Coltrane, erinnert sich Urs Leimgruber, hatte das Instrument aufgenommen, weil Lacy gezeigt hatte, dass man sich von Bechet lösen konnte). Lacy jedenfalls entwickelte einen ganz eigenen Ton, und aus dem Ton eine eigene Handschrift, die man sowohl in seinen Kompositionen wie auch seinen Improvisationen erkennen konnte. Diese Geradlinigkeit in seinem Spiel beeinflusste Musiker:innen weit über seine eigene Instrumentenfamilie hinaus, insbesondere in Europa, wo er den Ruf hatte, die Freiheit des Free Jazz mit einem Groove zu vermählen, der mal boppig klang, mal wie ein französisches Chanson, mal nach Monk, dann nach europäischer Avantgarde.
Steve Lacy war eine faszinierende Persönlichkeit. Ein Musiker, der mit 16 Jahren anfing traditionellen Jazz zu spielen und mit 22 auf Cecil Taylors Debutalbum “Jazz Advance” mitwirkte, der kurzzeitig Mitglied in Thelonious Mons Band war, dessen Stücke zeitlebens in seinem Repertoire blieben, dann Teil der europäischen Avantgarde/Free-Jazz-Szene wurde, erst in Italien, dann in Paris, von wo aus er mit seinem Sextett tourte, ab den 1970er Jahren aber immer wieder auch als Solist auf dem Sopransaxophon auftrat. Auf einem Instrument, das nach dem großen Sidney Bechet kaum ein Saxophonist mehr angerührt hatte, weil sein Beispiel einfach zu einflussreich war. Eigentlich war John Coltrane der einzige neben Lacy, der auf dem Instrument neue Wege beschritt (und Coltrane, erinnert sich Urs Leimgruber, hatte das Instrument aufgenommen, weil Lacy gezeigt hatte, dass man sich von Bechet lösen konnte). Lacy jedenfalls entwickelte einen ganz eigenen Ton, und aus dem Ton eine eigene Handschrift, die man sowohl in seinen Kompositionen wie auch seinen Improvisationen erkennen konnte. Diese Geradlinigkeit in seinem Spiel beeinflusste Musiker:innen weit über seine eigene Instrumentenfamilie hinaus, insbesondere in Europa, wo er den Ruf hatte, die Freiheit des Free Jazz mit einem Groove zu vermählen, der mal boppig klang, mal wie ein französisches Chanson, mal nach Monk, dann nach europäischer Avantgarde.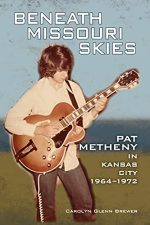 “Genies kommen nicht einfach aus dem Nichts”, lobt Peter Erskine das Buch, das Carolyn Glenn Brewer der Jugend des Gitarristen gewidmet hat, der Zeit zwischen seinem 10. und 18. Lebensjahr, um genau zu sein. Sie beginnt 1964, als Pat die Beatles bei ihrem ersten Auftritt in einer US-amerikanischen Fernsehshow sieht, und sie endet 1972, also zwei Jahre bevor er Mitglied der Gary Burton Band wird.
“Genies kommen nicht einfach aus dem Nichts”, lobt Peter Erskine das Buch, das Carolyn Glenn Brewer der Jugend des Gitarristen gewidmet hat, der Zeit zwischen seinem 10. und 18. Lebensjahr, um genau zu sein. Sie beginnt 1964, als Pat die Beatles bei ihrem ersten Auftritt in einer US-amerikanischen Fernsehshow sieht, und sie endet 1972, also zwei Jahre bevor er Mitglied der Gary Burton Band wird.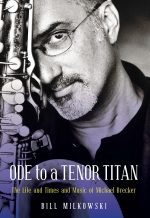 Bill Milkowski ist ein erfahrener Journalist und Mitarbeiter vieler internationaler Fachzeitschriften. Sein jüngstes Buch widmet sich dem Leben und der Musik des Saxophonisten Michael Brecker, einem der vielleicht einflussreichsten Musiker des ausgehenden 20sten Jahrhunderts. Von seinem Einfluss zeugen zahlreiche Statements von Kollegen, die Milkowski im Vorwort sammelt. Er habe nur einmal den Fehler gemacht ein Solo nach Brecker zu spielen, erinnert sich etwa David Sanborn. Andere schwärmen von seiner Virtuosität, seiner bewundernswerten Technik. Sein Einfluss sei so dominant gewesen, erklärt Joshua Redman, dass man einfach eine Meinung zu ihm haben musste, schon aus dem einfachen Grund, weil sein Sound, sein musikalisches Konzept so überzeugend gewesen seien, dass diese die Fähigkeit nahezu aller jüngerer Saxophonisten gefährdet hätten, einen eigenen Weg zu finden.
Bill Milkowski ist ein erfahrener Journalist und Mitarbeiter vieler internationaler Fachzeitschriften. Sein jüngstes Buch widmet sich dem Leben und der Musik des Saxophonisten Michael Brecker, einem der vielleicht einflussreichsten Musiker des ausgehenden 20sten Jahrhunderts. Von seinem Einfluss zeugen zahlreiche Statements von Kollegen, die Milkowski im Vorwort sammelt. Er habe nur einmal den Fehler gemacht ein Solo nach Brecker zu spielen, erinnert sich etwa David Sanborn. Andere schwärmen von seiner Virtuosität, seiner bewundernswerten Technik. Sein Einfluss sei so dominant gewesen, erklärt Joshua Redman, dass man einfach eine Meinung zu ihm haben musste, schon aus dem einfachen Grund, weil sein Sound, sein musikalisches Konzept so überzeugend gewesen seien, dass diese die Fähigkeit nahezu aller jüngerer Saxophonisten gefährdet hätten, einen eigenen Weg zu finden. Heinz von Hermann: ein Name, der aus der bundesdeutschen Bigbandlandschaft der 1960er bis 1980er Jahre nicht wegzudenken ist: Max Greger, SFB (Paul Kuhn), RIAS, Peter Herbolzheimers Rhythm Combination & Brass, Zusammenarbeit mit den Bigbands des NDR und des Hessischen Rundfunks, Tausende Aufnahmen als Studiomusiker mit Stars aus den unterschiedlichsten Welten der Unterhaltung, Arrangements für eine Vielzahl an Bands, Solist, der sich in modernen Zusammenhängen genauso wohlfühlt wie im Swing. Aber: “Ein bissl Bebop bevor ich geh'”: Der Titel seiner Biographie erklärt dann doch recht deutlich, an welcher Musik sein Herz hängt.
Heinz von Hermann: ein Name, der aus der bundesdeutschen Bigbandlandschaft der 1960er bis 1980er Jahre nicht wegzudenken ist: Max Greger, SFB (Paul Kuhn), RIAS, Peter Herbolzheimers Rhythm Combination & Brass, Zusammenarbeit mit den Bigbands des NDR und des Hessischen Rundfunks, Tausende Aufnahmen als Studiomusiker mit Stars aus den unterschiedlichsten Welten der Unterhaltung, Arrangements für eine Vielzahl an Bands, Solist, der sich in modernen Zusammenhängen genauso wohlfühlt wie im Swing. Aber: “Ein bissl Bebop bevor ich geh'”: Der Titel seiner Biographie erklärt dann doch recht deutlich, an welcher Musik sein Herz hängt. Es ist schon ein dicker Wälzer: über 700 Seiten stark, Hardcover mit Lesebändchen, und wer denkt, die Hälfte davon wird wahrscheinlich die Diskographie ausmachen, täuscht sich.
Es ist schon ein dicker Wälzer: über 700 Seiten stark, Hardcover mit Lesebändchen, und wer denkt, die Hälfte davon wird wahrscheinlich die Diskographie ausmachen, täuscht sich.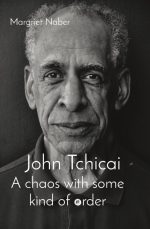 Als sie John Tchicai 1989 das erste Mal bei einem Workshop in Rotterdam traf, habe sie sich in seine Musik verliebt, schreibt Margriet Naber, beim zweiten Mal dann in ihn. Dann seien sie zusammengezogen. Ihr Leben mit ihm habe sie gelehrt, wie hilfreich Improvisation gerade in unvorhersehbaren Situationen sein kann, auch diese Erkenntnis wolle sie in ihrem Buch weitergeben.
Als sie John Tchicai 1989 das erste Mal bei einem Workshop in Rotterdam traf, habe sie sich in seine Musik verliebt, schreibt Margriet Naber, beim zweiten Mal dann in ihn. Dann seien sie zusammengezogen. Ihr Leben mit ihm habe sie gelehrt, wie hilfreich Improvisation gerade in unvorhersehbaren Situationen sein kann, auch diese Erkenntnis wolle sie in ihrem Buch weitergeben. William Parker ist seit Jahrzehnten eine Integrationsfigur der New Yorker Jazz- und Improvisationsszene, ein Kontrabassist mit großem Ton, ein Bandleader unterschiedlichster Besetzungen, Sideman in diversesten Gruppen, Organisator von Community-Events, ein politisch bewusster und bewegter Vertreter aktueller Musik, ein Künstler und Aktivist. Als Cisco Bradley Parker im November 2015 mit dem Anliegen anmailte, einen längeren Text über sein Leben und seine Arbeit verfassen zu wollen, meldete der sich sofort zurück und ermutigte ihn zu mehr als einem längeren Text. Es folgten 21 Interviews, die Durchsicht von Kisten voller Familienerinnerungen, Fotos, Clippings und sonstiger Erinnerungsstücke, sowie Gespräche mit Parkers Frau, der Tänzerin Patricia Nicholson Parker, seiner Tochter, mit Mitmusikern wie Matthew Shipp und Cooper-Moore und vielen anderen.
William Parker ist seit Jahrzehnten eine Integrationsfigur der New Yorker Jazz- und Improvisationsszene, ein Kontrabassist mit großem Ton, ein Bandleader unterschiedlichster Besetzungen, Sideman in diversesten Gruppen, Organisator von Community-Events, ein politisch bewusster und bewegter Vertreter aktueller Musik, ein Künstler und Aktivist. Als Cisco Bradley Parker im November 2015 mit dem Anliegen anmailte, einen längeren Text über sein Leben und seine Arbeit verfassen zu wollen, meldete der sich sofort zurück und ermutigte ihn zu mehr als einem längeren Text. Es folgten 21 Interviews, die Durchsicht von Kisten voller Familienerinnerungen, Fotos, Clippings und sonstiger Erinnerungsstücke, sowie Gespräche mit Parkers Frau, der Tänzerin Patricia Nicholson Parker, seiner Tochter, mit Mitmusikern wie Matthew Shipp und Cooper-Moore und vielen anderen. Gérard Régniers Buch basiert auf einem Vortrag, den er 2010 über Django Reinhardts Leben und Wirken zur Zeit der deutschen Besatzung von Paris hielt. Darin betont Régnier, dass Reinhardt als Sinti einerseits zu den von den Nationalsozialisten verfolgten Volksgruppen gehörte, er andererseits ausgerechnet in den Jahren der Besatzung zu einer französischen Legende wurde, vergleichbar höchstens mit Entertaintern wie Maurice Chevalier oder Charles Trenet.
Gérard Régniers Buch basiert auf einem Vortrag, den er 2010 über Django Reinhardts Leben und Wirken zur Zeit der deutschen Besatzung von Paris hielt. Darin betont Régnier, dass Reinhardt als Sinti einerseits zu den von den Nationalsozialisten verfolgten Volksgruppen gehörte, er andererseits ausgerechnet in den Jahren der Besatzung zu einer französischen Legende wurde, vergleichbar höchstens mit Entertaintern wie Maurice Chevalier oder Charles Trenet.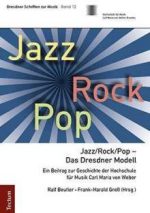 Als Frank-Harald Greß 1959 nach dem Studium der Musikwissenschaft begann an der Dresdner Musikhochschule zu unterrichten, “schmuggelte er”, wie er sich erinnert, den Jazz in seine Vorlesungen über Musikgeschichte, Akustik und Instrumentenkunde, obwohl es von staatlicher Seite noch erhebliche Vorbehalte gegen die “Musik des Klassenfeindes” gab. Als Greß im Jahr darauf eine Jazzcombo bei einer offiziellen Veranstaltung auftreten ließ, war der Rektor zwar ästhetisch entsetzt, meinte aber – die Großwetterlage in Bezug auf den Jazz hatte sich in der DDR gerade gewandelt –: “die Entwicklung der sozialistischen Musikkultur verlange, auch für ein höheres Niveau der ‘leichten Musik zu sorgen”. Gebeten, weitere Dozenten aus Jazz- und Tanzmusikkreisen zu verpflichten, wandte sich Greß an den Pianisten Günter Hörig. Der spielte mit seinem Trio vor, und einige argumentatorischen Tricks später (Jazz als Musik des “anderen” Amerika) wurde in Dresden der erste Studiengang für “Tanz- und Unterhaltungsmusik” begründet. Greß erinnert sich an einige der Schwierigkeiten des jungen Studiengangs – zum Vorspiel des ersten Schlagzeugbewerbers Baby Sommer gab es etwa kein hochschuleigenes Instrument, so dass der auf hölzernen Stuhlsitzen trommelte –, und er beschreibt, wie es ihm gelang, statt eines Aufbau- oder Zusatzstudiengangs eine selbständige Vollausbildung durchzusetzen, “mit Diplomabschluss für den Studiengang Kapellenleiter”. Er erinnert sich an die Probleme bei der Materialbeschaffung, sprich: dem Verbot der Einfuhr “westlicher” Noten, das aber letzten Endes dazu führte, dass die Lehrenden nach und nach eigene Unterrichtsliteratur verfassten. Das Dresdner Modell jedenfalls wurde bald von den anderen Musikhochschulen der DDR übernommen.
Als Frank-Harald Greß 1959 nach dem Studium der Musikwissenschaft begann an der Dresdner Musikhochschule zu unterrichten, “schmuggelte er”, wie er sich erinnert, den Jazz in seine Vorlesungen über Musikgeschichte, Akustik und Instrumentenkunde, obwohl es von staatlicher Seite noch erhebliche Vorbehalte gegen die “Musik des Klassenfeindes” gab. Als Greß im Jahr darauf eine Jazzcombo bei einer offiziellen Veranstaltung auftreten ließ, war der Rektor zwar ästhetisch entsetzt, meinte aber – die Großwetterlage in Bezug auf den Jazz hatte sich in der DDR gerade gewandelt –: “die Entwicklung der sozialistischen Musikkultur verlange, auch für ein höheres Niveau der ‘leichten Musik zu sorgen”. Gebeten, weitere Dozenten aus Jazz- und Tanzmusikkreisen zu verpflichten, wandte sich Greß an den Pianisten Günter Hörig. Der spielte mit seinem Trio vor, und einige argumentatorischen Tricks später (Jazz als Musik des “anderen” Amerika) wurde in Dresden der erste Studiengang für “Tanz- und Unterhaltungsmusik” begründet. Greß erinnert sich an einige der Schwierigkeiten des jungen Studiengangs – zum Vorspiel des ersten Schlagzeugbewerbers Baby Sommer gab es etwa kein hochschuleigenes Instrument, so dass der auf hölzernen Stuhlsitzen trommelte –, und er beschreibt, wie es ihm gelang, statt eines Aufbau- oder Zusatzstudiengangs eine selbständige Vollausbildung durchzusetzen, “mit Diplomabschluss für den Studiengang Kapellenleiter”. Er erinnert sich an die Probleme bei der Materialbeschaffung, sprich: dem Verbot der Einfuhr “westlicher” Noten, das aber letzten Endes dazu führte, dass die Lehrenden nach und nach eigene Unterrichtsliteratur verfassten. Das Dresdner Modell jedenfalls wurde bald von den anderen Musikhochschulen der DDR übernommen. Charles Freeman Lee – wahrscheinlich wirklich nur eingefleischten Jazzfans ist der Name ein Begriff: Zwischen 1952 und 1955 war er als Freeman Lee an verschiedenen Aufnahmesitzungen des legendären Pianisten Elmo Hope beteiligt gewesen. Der Klappentext von Annette Johnsons literarisch-biographischem Drehbuch fasst seine Karriere zusammen: Geboren in New York studierte Lee an der Wilberforce University, einem der sogenannten “Historically Black Colleges and Universities” der Vereinigten Staaten, in deren Schulband er unter anderem mit Frank Foster, George Russell, Snooky Young und anderen saß. Er tourte mit Snooky Youngs Band, kehrte dann zurück nach New York, wo er mit Musikern wie Eddie Cleanhead Vinson, James Moody, Lou Donaldson und Thelonious Monk auftrat und die bereits erwähnten Aufnahmen mit Elmo Hope machte. In New York verliebte er sich in Jenny, die damalige Frau Milt Jacksons, die sich daraufhin vom Vibraphonisten des Modern Jazz Quartet scheiden ließ, um Lee zu heiraten. Seine Heroinsucht brachte ihn wenig später ins New Yorker Gefängnis von Riker’s Island, wo er mit Jackie McLean, Hank Mobley und Elvin Jones auf alte Bekannte aus der Jazzszene trifft. In den 1970er und 1980er Jahren hatte Lee das Musikgeschäft verlassen und unterrichtete Biologie im Mittleren Westen, begann dann in den 1990ern wieder aufzutreten, jetzt vor allem mit europäischen und südafrikanischen Musikern und in Europa.
Charles Freeman Lee – wahrscheinlich wirklich nur eingefleischten Jazzfans ist der Name ein Begriff: Zwischen 1952 und 1955 war er als Freeman Lee an verschiedenen Aufnahmesitzungen des legendären Pianisten Elmo Hope beteiligt gewesen. Der Klappentext von Annette Johnsons literarisch-biographischem Drehbuch fasst seine Karriere zusammen: Geboren in New York studierte Lee an der Wilberforce University, einem der sogenannten “Historically Black Colleges and Universities” der Vereinigten Staaten, in deren Schulband er unter anderem mit Frank Foster, George Russell, Snooky Young und anderen saß. Er tourte mit Snooky Youngs Band, kehrte dann zurück nach New York, wo er mit Musikern wie Eddie Cleanhead Vinson, James Moody, Lou Donaldson und Thelonious Monk auftrat und die bereits erwähnten Aufnahmen mit Elmo Hope machte. In New York verliebte er sich in Jenny, die damalige Frau Milt Jacksons, die sich daraufhin vom Vibraphonisten des Modern Jazz Quartet scheiden ließ, um Lee zu heiraten. Seine Heroinsucht brachte ihn wenig später ins New Yorker Gefängnis von Riker’s Island, wo er mit Jackie McLean, Hank Mobley und Elvin Jones auf alte Bekannte aus der Jazzszene trifft. In den 1970er und 1980er Jahren hatte Lee das Musikgeschäft verlassen und unterrichtete Biologie im Mittleren Westen, begann dann in den 1990ern wieder aufzutreten, jetzt vor allem mit europäischen und südafrikanischen Musikern und in Europa.











 Das Buchcover sieht wie ein Nachrichtenbild dieser Tage aus, ein Rapper vor einem Foto, das einen bewaffneten Polizeieinsatz zu zeigen scheint. Das Bild, aufgenommen vom Fotografen Wilfried Heckmann, stammt vom Konzert der Band The Anarchist Republic of Bzzz letztes Jahr in der Darmstädter Centralstation, und es bebildert den Umschlag unseres just erschienenen neuen Buchs, “POSITIONEN! Jazz und Politik”, in dem wir das 16. Darmstädter Jazzforum dokumentieren.
Das Buchcover sieht wie ein Nachrichtenbild dieser Tage aus, ein Rapper vor einem Foto, das einen bewaffneten Polizeieinsatz zu zeigen scheint. Das Bild, aufgenommen vom Fotografen Wilfried Heckmann, stammt vom Konzert der Band The Anarchist Republic of Bzzz letztes Jahr in der Darmstädter Centralstation, und es bebildert den Umschlag unseres just erschienenen neuen Buchs, “POSITIONEN! Jazz und Politik”, in dem wir das 16. Darmstädter Jazzforum dokumentieren.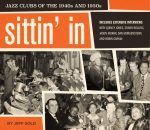 Jeff Gold betrachtet die US-amerikanische Jazzgeschichte der 1940er und 1950er Jahre einmal von der anderen Seite. Und das buchstäblich. Der Journalist, frühere Plattenmanager und Sammler nämlich entdeckte in einem Nachlass mehr als 200 Fotos aus Jazzclubs des Mitt-20sten Jahrhunderts. Die Fotos waren Souvenir-Fotos, die von club-eigenen Fotografen gemacht wurden und am Ende des Abends in Klappkarten mit dem Emblem der jeweiligen Clubs für einen Dollar verkauft wurden. Sie zeigen meist afro-amerikanische Fans, Familien, Freunde, ab und an auch Musikerinnen und Musiker.
Jeff Gold betrachtet die US-amerikanische Jazzgeschichte der 1940er und 1950er Jahre einmal von der anderen Seite. Und das buchstäblich. Der Journalist, frühere Plattenmanager und Sammler nämlich entdeckte in einem Nachlass mehr als 200 Fotos aus Jazzclubs des Mitt-20sten Jahrhunderts. Die Fotos waren Souvenir-Fotos, die von club-eigenen Fotografen gemacht wurden und am Ende des Abends in Klappkarten mit dem Emblem der jeweiligen Clubs für einen Dollar verkauft wurden. Sie zeigen meist afro-amerikanische Fans, Familien, Freunde, ab und an auch Musikerinnen und Musiker. Phil Woods habe Bird verehrt, heißt es, so sehr, dass er nach Charlie Parkers Tod dessen Witwe geheiratet und seine Kinder adoptiert habe. Die Leute hätten das immer falsch verstanden, betont Woods. Selbst Art Pepper habe über ihn gelästert, habe behauptet, man wisse nicht genau, ob Woods Birds Witwe geheiratet habe, weil er sie liebte oder weil er dessen Instrument haben wollte. Und Art sei ein Freund gewesen, betont Woods. Nein, es sei Liebe gewesen, die Ehe habe schließlich fünfzehn Jahre gehalten.
Phil Woods habe Bird verehrt, heißt es, so sehr, dass er nach Charlie Parkers Tod dessen Witwe geheiratet und seine Kinder adoptiert habe. Die Leute hätten das immer falsch verstanden, betont Woods. Selbst Art Pepper habe über ihn gelästert, habe behauptet, man wisse nicht genau, ob Woods Birds Witwe geheiratet habe, weil er sie liebte oder weil er dessen Instrument haben wollte. Und Art sei ein Freund gewesen, betont Woods. Nein, es sei Liebe gewesen, die Ehe habe schließlich fünfzehn Jahre gehalten. In den großen Geschichtsbüchern zum Jazz ist Arthur Briggs vor allem als Randnotiz verzeichnet. Er gehört mit zu jenen afro-amerikanischen Musikern, die in den 1920er Jahren durch Europa tourten und sich hier so wohl fühlten, dass sie blieben. Briggs war in der zweiten Hälfte der 1920er und in den 1930er Jahren in ganz Europa zu hören und galt als “Louis Armstrong von Paris”. Travis Atria, der bislang vor allem im Bereich populärer Musik in Erscheinung getreten ist, etwa einer Biographie von Curtis Mayfield, hat dem oft vergessenen Briggs jetzt ein Buch gewidmet, mit Genehmigung und Hilfe der Tochter des Trompeters, die ihm unter anderem die Memoiren ihres Vaters zur Verfügung stellte.
In den großen Geschichtsbüchern zum Jazz ist Arthur Briggs vor allem als Randnotiz verzeichnet. Er gehört mit zu jenen afro-amerikanischen Musikern, die in den 1920er Jahren durch Europa tourten und sich hier so wohl fühlten, dass sie blieben. Briggs war in der zweiten Hälfte der 1920er und in den 1930er Jahren in ganz Europa zu hören und galt als “Louis Armstrong von Paris”. Travis Atria, der bislang vor allem im Bereich populärer Musik in Erscheinung getreten ist, etwa einer Biographie von Curtis Mayfield, hat dem oft vergessenen Briggs jetzt ein Buch gewidmet, mit Genehmigung und Hilfe der Tochter des Trompeters, die ihm unter anderem die Memoiren ihres Vaters zur Verfügung stellte. Ricky Riccardi ist “director of jazz collections”, also der Kurator der Sammlung des Louis Armstrong House Museum; darüber hinaus ist er öffentlich bekennender und überaus enthusiastischer Fan von Armstrongs Musik. Sein Blog (
Ricky Riccardi ist “director of jazz collections”, also der Kurator der Sammlung des Louis Armstrong House Museum; darüber hinaus ist er öffentlich bekennender und überaus enthusiastischer Fan von Armstrongs Musik. Sein Blog (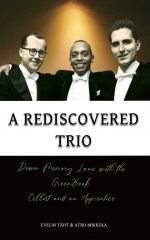 Der 2018 erschienene Film “Green Book” wurde einerseits gefeiert und mit drei Oscars ausgezeichnet, andererseits kritisiert, weil er sowohl die Autobiographie des darin dargestellten Konzertpianisten Donald Shirley verfälscht und überhaupt die Realität des Rassismus in den USA der frühen 1960er Jahre vereinfacht dargestellt habe. Der Film jedenfalls, schreibt die Autorin Evelin Täht, habe sie ermuntert, einen Teil ihrer eigenen Familiengeschichte zu erzählen, die Geschichte nämlich ihres Schwiegervaters, des 1926 in Estland geborenen Cellisten Jüri Täht, der Anfang 1951 fürs Studium in die USA ging. 1957 wurde Juri Taht, wie er amerikanisiert hieß, von Donald Shirley für sein neues Trio verpflichtet, dem er bis 1983 angehörte und mit dem er auch danach noch einige Jahre regelmäßig in der Carnegie Hall auftrat. Der zweite Autor des Buchs, der Kontrabassist Arto Mikkola, stammt aus Finnland, lebte ab 1985 in den Vereinigten Staaten, und lernte Donald Shirley in dn 1990er Jahren kennen, als dieser ihn zu sich einlud und ihm in einer Art Privatunterricht seine musikalischen und ästhetischen Ansichten nahebrachte.
Der 2018 erschienene Film “Green Book” wurde einerseits gefeiert und mit drei Oscars ausgezeichnet, andererseits kritisiert, weil er sowohl die Autobiographie des darin dargestellten Konzertpianisten Donald Shirley verfälscht und überhaupt die Realität des Rassismus in den USA der frühen 1960er Jahre vereinfacht dargestellt habe. Der Film jedenfalls, schreibt die Autorin Evelin Täht, habe sie ermuntert, einen Teil ihrer eigenen Familiengeschichte zu erzählen, die Geschichte nämlich ihres Schwiegervaters, des 1926 in Estland geborenen Cellisten Jüri Täht, der Anfang 1951 fürs Studium in die USA ging. 1957 wurde Juri Taht, wie er amerikanisiert hieß, von Donald Shirley für sein neues Trio verpflichtet, dem er bis 1983 angehörte und mit dem er auch danach noch einige Jahre regelmäßig in der Carnegie Hall auftrat. Der zweite Autor des Buchs, der Kontrabassist Arto Mikkola, stammt aus Finnland, lebte ab 1985 in den Vereinigten Staaten, und lernte Donald Shirley in dn 1990er Jahren kennen, als dieser ihn zu sich einlud und ihm in einer Art Privatunterricht seine musikalischen und ästhetischen Ansichten nahebrachte.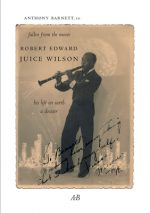 Es gibt nur zwei Soli von Juice Wilson auf Platte, beide aufgenommen 1929 mit Noble Sissles Orchester in England: “Kansas City Kitty” und “Miranda”. Es gibt Aussagen von Kollegen, die ihn als den größten Jazzgeiger bezeichnen, der je gelebt habe. Es gibt wenige biographische Details – geboren 1904 in St. Louis, gestorben 1972 in Chicago, zwischen 1929 und 1963 vor allem in Europa aktiv. Erinnerungen. Es gibt Pressenotizen, die ihn oft nur am Rande erwähnen, Gerüchte und Spekulationen. Anthony Barnett hat sich wahrlich kein einfaches Sujet gewählt für sein neuestes Buch. Barnett ist, wenn man so will, ein Jazzviolin-Historiker. Er gab das Magazin Fable heraus, das sich bekannten sowie oft vergessenen Vertretern dieses Instruments widmete, und hat Bücher über Eddie South, Stuff Smith und andere insbesondere afro-amerikanische Jazzgeiger geschrieben. Für das Buch zu Juice Wilson aber bezeichnet er sich selbst nur als “Editor”, als Herausgeber. Zu disparat sind die Quellen, die er präsentiert und die er nebeneinander stehen lässt, wie die Teile eines Puzzles, das ein ganzes Bild erahnen lässt. Also verzichtet er auf verbindende Worte und lässt stattdessen die Vergangenheit sprechen.
Es gibt nur zwei Soli von Juice Wilson auf Platte, beide aufgenommen 1929 mit Noble Sissles Orchester in England: “Kansas City Kitty” und “Miranda”. Es gibt Aussagen von Kollegen, die ihn als den größten Jazzgeiger bezeichnen, der je gelebt habe. Es gibt wenige biographische Details – geboren 1904 in St. Louis, gestorben 1972 in Chicago, zwischen 1929 und 1963 vor allem in Europa aktiv. Erinnerungen. Es gibt Pressenotizen, die ihn oft nur am Rande erwähnen, Gerüchte und Spekulationen. Anthony Barnett hat sich wahrlich kein einfaches Sujet gewählt für sein neuestes Buch. Barnett ist, wenn man so will, ein Jazzviolin-Historiker. Er gab das Magazin Fable heraus, das sich bekannten sowie oft vergessenen Vertretern dieses Instruments widmete, und hat Bücher über Eddie South, Stuff Smith und andere insbesondere afro-amerikanische Jazzgeiger geschrieben. Für das Buch zu Juice Wilson aber bezeichnet er sich selbst nur als “Editor”, als Herausgeber. Zu disparat sind die Quellen, die er präsentiert und die er nebeneinander stehen lässt, wie die Teile eines Puzzles, das ein ganzes Bild erahnen lässt. Also verzichtet er auf verbindende Worte und lässt stattdessen die Vergangenheit sprechen. Mit “Stratusphunk” legt Duncan Heining die zweite Ausgabe seiner Biographie des Komponisten und Theoretikers George Russell vor, die ursprünglich vor zehn Jahre beim amerikanischen Verlag Scarecrow Press erschienen war. Die Neuauflage enthält Änderungen, darunter eine etwas ausführlichere Diskussion des von Russell entwickelten Lydian Chromatic Concept. In der ersten Ausgabe, erklärt Heining, habe er noch verschwiegen, dass der 2009 verstorbene Russell zum Zeitpunkt seiner Recherchen und Interviews bereits an Folgen einer fortschreitenden Demenz litt. Russell habe damals mit Hilfe seiner Partnerin weiter gearbeitet; durch eine Offenlegung seiner Erkrankung seien seine Einnahmen gefährdet gewesen. Beim Verfassen seines Buchs hätten insbesondere die zahlreichen Mythen im Weg gestanden, schreibt Heining, die Russell über die Jahre zum Teil selbst über seine Biographie pflanzte und die er als Biograph so weit wie möglich klären wollte.
Mit “Stratusphunk” legt Duncan Heining die zweite Ausgabe seiner Biographie des Komponisten und Theoretikers George Russell vor, die ursprünglich vor zehn Jahre beim amerikanischen Verlag Scarecrow Press erschienen war. Die Neuauflage enthält Änderungen, darunter eine etwas ausführlichere Diskussion des von Russell entwickelten Lydian Chromatic Concept. In der ersten Ausgabe, erklärt Heining, habe er noch verschwiegen, dass der 2009 verstorbene Russell zum Zeitpunkt seiner Recherchen und Interviews bereits an Folgen einer fortschreitenden Demenz litt. Russell habe damals mit Hilfe seiner Partnerin weiter gearbeitet; durch eine Offenlegung seiner Erkrankung seien seine Einnahmen gefährdet gewesen. Beim Verfassen seines Buchs hätten insbesondere die zahlreichen Mythen im Weg gestanden, schreibt Heining, die Russell über die Jahre zum Teil selbst über seine Biographie pflanzte und die er als Biograph so weit wie möglich klären wollte.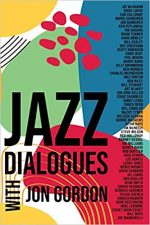 Der Saxophonist Jon Gordon hatte das Glück, als junger Musiker in den 1980er Jahren an den richtigen Orten in New York und anderswo zu sein. Er spielte mit zahlreichen Legenden der Jazzgeschichte genauso wie der Jazzgegenwart, und er erinnert sich gern an deren Ratschläge. “Jazz Dialogues” ist ein kunterbuntes Sammelsurium von Interviews, Gesprächen, Anekdoten, bei denen die Gesprächspartner einen mindestens so großen Platz einnehmen wie Jon Gordons Erinnerungen an die Begegnung, an den Erkenntnisgewinn, den er aus ihnen zog. Art Blakey etwa sprach ihn 1985 oder 1986 im Sweet Basil Club an und fragte, ob er einen Job habe. “Sei dir immer bewusst”, meinte Blakey, “dass wir wirklich Glück haben zu tun, was wir tun. Andere müssen vierzig Stunden die Woche hinter einem Schreibtisch sitzen. Vergiss das nie!” Der damals 18jährige Gordon war verunsichert: Woher wusste Blakey, dass er Musiker war? 20 Jahre später erzählte er die Geschichte Don Sickler, der ein Studio in Manhattan betrieb, in dem auch eine der Bands Gordons geprobt hatte. Und Sickler lachte nur: Blakey habe sich während einer diese Proben im Büro des Studios befunden, aber sie hätten die Jalousien runtergezogen, so dass man nur in eine Richtung schauen konnte.
Der Saxophonist Jon Gordon hatte das Glück, als junger Musiker in den 1980er Jahren an den richtigen Orten in New York und anderswo zu sein. Er spielte mit zahlreichen Legenden der Jazzgeschichte genauso wie der Jazzgegenwart, und er erinnert sich gern an deren Ratschläge. “Jazz Dialogues” ist ein kunterbuntes Sammelsurium von Interviews, Gesprächen, Anekdoten, bei denen die Gesprächspartner einen mindestens so großen Platz einnehmen wie Jon Gordons Erinnerungen an die Begegnung, an den Erkenntnisgewinn, den er aus ihnen zog. Art Blakey etwa sprach ihn 1985 oder 1986 im Sweet Basil Club an und fragte, ob er einen Job habe. “Sei dir immer bewusst”, meinte Blakey, “dass wir wirklich Glück haben zu tun, was wir tun. Andere müssen vierzig Stunden die Woche hinter einem Schreibtisch sitzen. Vergiss das nie!” Der damals 18jährige Gordon war verunsichert: Woher wusste Blakey, dass er Musiker war? 20 Jahre später erzählte er die Geschichte Don Sickler, der ein Studio in Manhattan betrieb, in dem auch eine der Bands Gordons geprobt hatte. Und Sickler lachte nur: Blakey habe sich während einer diese Proben im Büro des Studios befunden, aber sie hätten die Jalousien runtergezogen, so dass man nur in eine Richtung schauen konnte. Charlie Parkers hundertster Geburtstag hat den einflussreichen Saxophonisten im vergangenen Jahr einmal mehr in die Schlagzeilen gebracht. Der Verlag Hal Leonard feierte das Jubiläum mit einer Prachtausgabe der Transkriptionen von 40 Klassikern aus seinem Repertoire, bei der, anders als im “Omnibook”, nicht nur die Saxophonstimme notiert ist, sondern auch Trompete, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.
Charlie Parkers hundertster Geburtstag hat den einflussreichen Saxophonisten im vergangenen Jahr einmal mehr in die Schlagzeilen gebracht. Der Verlag Hal Leonard feierte das Jubiläum mit einer Prachtausgabe der Transkriptionen von 40 Klassikern aus seinem Repertoire, bei der, anders als im “Omnibook”, nicht nur die Saxophonstimme notiert ist, sondern auch Trompete, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.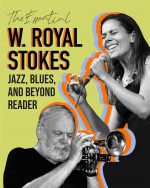 W. Royal Stokes hat in seiner Karriere für die unterschiedlichsten Publikationen geschrieben, die Tageszeitung Washington Post genauso wie für Fachmagazine wie Down Beat oder Jazz Times. Jetzt hat der 1930 geborene Journalist eine Sammlung zahlreicher seiner seit den frühen 1980er Jahren erschienenen kürzeren und längeren Artikel und Interviews zusammengestellt. Sein Interesse gilt dem alten genauso wie dem modernen Jazz, Musiker:innen seiner Wahlheimat Washington D.C., einigen ausgesuchten nicht-amerikanischen Künstler:innen sowie solchen, die eher in der Blues- und Popmusikszene zuhause sind, dem “support network”, also Aktiven des Musikgeschäfts, die sich dafür einsetzen, dass die Szene lebendig bleibt, und schließt mit ausgesuchten Konzert-, Platten- und Buchrezensionen. Konkret geht es also von Ruby Braff bis Andrew Cyrille, von Artie Shaw bis Willem Breuker, von Willis Conover bis zur Jazz Journalists Association, und selbst der Verfasser dieser Rezension kommt in einem Interview zu Wort, das Stokes 2008 mit ihm führte.
W. Royal Stokes hat in seiner Karriere für die unterschiedlichsten Publikationen geschrieben, die Tageszeitung Washington Post genauso wie für Fachmagazine wie Down Beat oder Jazz Times. Jetzt hat der 1930 geborene Journalist eine Sammlung zahlreicher seiner seit den frühen 1980er Jahren erschienenen kürzeren und längeren Artikel und Interviews zusammengestellt. Sein Interesse gilt dem alten genauso wie dem modernen Jazz, Musiker:innen seiner Wahlheimat Washington D.C., einigen ausgesuchten nicht-amerikanischen Künstler:innen sowie solchen, die eher in der Blues- und Popmusikszene zuhause sind, dem “support network”, also Aktiven des Musikgeschäfts, die sich dafür einsetzen, dass die Szene lebendig bleibt, und schließt mit ausgesuchten Konzert-, Platten- und Buchrezensionen. Konkret geht es also von Ruby Braff bis Andrew Cyrille, von Artie Shaw bis Willem Breuker, von Willis Conover bis zur Jazz Journalists Association, und selbst der Verfasser dieser Rezension kommt in einem Interview zu Wort, das Stokes 2008 mit ihm führte. Adrian Rollini scheint eher ein Nebenthema der Jazzgeschichte zu sein, und doch ist er über seine knapp dreißigjährige Aufnahmegeschichte zu einer Art Legende geworden. Viele kennen ihn als den scheinbar einzigen Bass-Saxophonisten (vor Scott Robinson), andere verbinden Instrumente wie das Goofus oder den Hot Fountain Pen mit seinem Namen. Egal welches Instrument er bediente – neben der Saxophonfamilie waren dies etwa Posaune¹, Klavier, Harpaphone, Xylophon und Vibraphon –, er entwickelte eine bewundernswerte Meisterschaft auf ihnen. Sein Bass-Sax-Spiel beeinflusste Harry Carney und Gerry Mulligan, sein Xylophon-Spiel Red Norvo, und Louis Armstrong gefiel, wie deutlich in Aufnahmen mit Rollini immer der Bass-Part zu hören war.
Adrian Rollini scheint eher ein Nebenthema der Jazzgeschichte zu sein, und doch ist er über seine knapp dreißigjährige Aufnahmegeschichte zu einer Art Legende geworden. Viele kennen ihn als den scheinbar einzigen Bass-Saxophonisten (vor Scott Robinson), andere verbinden Instrumente wie das Goofus oder den Hot Fountain Pen mit seinem Namen. Egal welches Instrument er bediente – neben der Saxophonfamilie waren dies etwa Posaune¹, Klavier, Harpaphone, Xylophon und Vibraphon –, er entwickelte eine bewundernswerte Meisterschaft auf ihnen. Sein Bass-Sax-Spiel beeinflusste Harry Carney und Gerry Mulligan, sein Xylophon-Spiel Red Norvo, und Louis Armstrong gefiel, wie deutlich in Aufnahmen mit Rollini immer der Bass-Part zu hören war.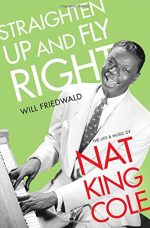 Will Friedwald ist ein ausgewiesener Kenner insbesondere des vokalen Jazz. Nach seinem viel-gelobten Buch über Frank Sinatra (1995) und diversen Büchern über amerikanische Jazz- und Popsänger:innen hat er jetzt eine Biographie Nat King Coles vorgelegt, jenes Musikers, der mehr als vielleicht jeder andere, die Welten zwischen Jazz und Pop überschreiten konnte, weil er einerseits die technische Meisterschaft auf seinem Instrument, dem Klavier, besaß, andererseits eine begeisternde Bühnenpräsenz, und darüber hinaus eine einschmeichelnde Stimme, die ihn schnell zum gefeierten Star aufsteigen ließ. Sein internationaler Ruhm lässt Jazzfans oft vergessen, welch virtuoser Pianist Nat Cole war, der aus Einflüssen durch das Stride Piano und insbesondere Earl Hines einen ganz eigenständigen Personalstil entwickelte und dabei neben den Größten seines Instruments, also Art Tatum oder Oscar Peterson, bestehen konnte.
Will Friedwald ist ein ausgewiesener Kenner insbesondere des vokalen Jazz. Nach seinem viel-gelobten Buch über Frank Sinatra (1995) und diversen Büchern über amerikanische Jazz- und Popsänger:innen hat er jetzt eine Biographie Nat King Coles vorgelegt, jenes Musikers, der mehr als vielleicht jeder andere, die Welten zwischen Jazz und Pop überschreiten konnte, weil er einerseits die technische Meisterschaft auf seinem Instrument, dem Klavier, besaß, andererseits eine begeisternde Bühnenpräsenz, und darüber hinaus eine einschmeichelnde Stimme, die ihn schnell zum gefeierten Star aufsteigen ließ. Sein internationaler Ruhm lässt Jazzfans oft vergessen, welch virtuoser Pianist Nat Cole war, der aus Einflüssen durch das Stride Piano und insbesondere Earl Hines einen ganz eigenständigen Personalstil entwickelte und dabei neben den Größten seines Instruments, also Art Tatum oder Oscar Peterson, bestehen konnte. Arno Fischer ist ein Buch über einen Jazzmusiker gelungen, in dem dessen Musik weitestgehend ausgespart bleibt, das aber dennoch jede Menge über seine künstlerische Haltung verrät. 1996 lernte Fischer seinen Namensvetter kennen, den amerikanischen Pianisten und Künstler John Fischer, und was als berufliche Beziehung begann – Arno Fischer war im Marburger Kulturamt für die Organisation der jährlichen Sommerakademie verantwortlich, bei der John Fischer seit einigen Jahren eine Klasse für freies Malen unterrichtete – wurde bald zu einer Freundschaft. Hinzu kam die Namensgleichheit und die Tatsache, dass die Eltern John Fischers Arno und Sabine geheißen, also die Vornamen des Autors Arno Fischer und seiner Frau getragen hatten. All das trug dazu bei, dass sich der Pianist und Künstler dem Verwaltungsangestellten und (gar nicht mal so heimlichen) Autor weit öffnete.
Arno Fischer ist ein Buch über einen Jazzmusiker gelungen, in dem dessen Musik weitestgehend ausgespart bleibt, das aber dennoch jede Menge über seine künstlerische Haltung verrät. 1996 lernte Fischer seinen Namensvetter kennen, den amerikanischen Pianisten und Künstler John Fischer, und was als berufliche Beziehung begann – Arno Fischer war im Marburger Kulturamt für die Organisation der jährlichen Sommerakademie verantwortlich, bei der John Fischer seit einigen Jahren eine Klasse für freies Malen unterrichtete – wurde bald zu einer Freundschaft. Hinzu kam die Namensgleichheit und die Tatsache, dass die Eltern John Fischers Arno und Sabine geheißen, also die Vornamen des Autors Arno Fischer und seiner Frau getragen hatten. All das trug dazu bei, dass sich der Pianist und Künstler dem Verwaltungsangestellten und (gar nicht mal so heimlichen) Autor weit öffnete. Michael Stradford ist Medienmanager mit umfangreichen Erfahrungen in Rundfunk, Fernsehen und Film. Jetzt hat er ein Buch über Miles Davis vorgelegt, das sich allerdings nur Rande mit Davis’ Musik zu beschäftigen scheint und stattdessen seine Bühnenpersönlichkeit, oder noch genauer: seine Bühnengarderobe und seinen Sinn für Mode in den Mittelpunkt stellt. Dass und wie Stradford dabei dann doch der Musik ziemlich nahe kommt, ist eine ziemlich erstaunliche und für seiner Leser:innen ungemein befriedigende Erfahrung.
Michael Stradford ist Medienmanager mit umfangreichen Erfahrungen in Rundfunk, Fernsehen und Film. Jetzt hat er ein Buch über Miles Davis vorgelegt, das sich allerdings nur Rande mit Davis’ Musik zu beschäftigen scheint und stattdessen seine Bühnenpersönlichkeit, oder noch genauer: seine Bühnengarderobe und seinen Sinn für Mode in den Mittelpunkt stellt. Dass und wie Stradford dabei dann doch der Musik ziemlich nahe kommt, ist eine ziemlich erstaunliche und für seiner Leser:innen ungemein befriedigende Erfahrung. Tony Lakatos: Der virtuose, immer verlässliche, stilistisch vielfältige, dabei ungemein bescheidene Saxophonist ist scheinbar auf jeder Bühne des Landes zuhause. In Frankfurt lebt er seit 1993 und ist seither einer der Anker der hr-Bigband. Rainer Erd hatte sich mit Lakatos’ Biographie erstmals bei einer Gesprächsveranstaltung auseinandergesetzt, bei der der gebürtige Ungar von seinem Lebensweg “vom Budapester Gypsy-Kindergeiger zum weltbekannten Jazz-Saxophonisten” erzählte. In der Folge befragte Erd den Saxophonisten ausgiebig, sprach mit Kolleg:innen aus Bigband und Szene und reiste sogar selbst nach Budapest, um die Herkunft Lakatos’ besser zu verstehen. “Sag nur nicht Künstler zu mir”, habe Lakatos ihm einmal gesagt und darauf bestanden, sein Beruf sei Musiker. Sein Talent war ihm in die Wiege gelegt war, wenn er auch erst einmal den Wunsch des Vaters abwehren musste, Geigenprimas zu werden. Zum Saxophon kam Lakatos dabei erst spät, hatte aber bereits jede Menge musikalischer Erfahrung. Und mit dem Jazz kam der junge Tony dann im 8. Bezirk Budapests in Berührung, in dem viele arme Roma lebten, in dem Lakatos aber vor allem bei Jam Sessions bei Freunden in den Jazz eintauchte.
Tony Lakatos: Der virtuose, immer verlässliche, stilistisch vielfältige, dabei ungemein bescheidene Saxophonist ist scheinbar auf jeder Bühne des Landes zuhause. In Frankfurt lebt er seit 1993 und ist seither einer der Anker der hr-Bigband. Rainer Erd hatte sich mit Lakatos’ Biographie erstmals bei einer Gesprächsveranstaltung auseinandergesetzt, bei der der gebürtige Ungar von seinem Lebensweg “vom Budapester Gypsy-Kindergeiger zum weltbekannten Jazz-Saxophonisten” erzählte. In der Folge befragte Erd den Saxophonisten ausgiebig, sprach mit Kolleg:innen aus Bigband und Szene und reiste sogar selbst nach Budapest, um die Herkunft Lakatos’ besser zu verstehen. “Sag nur nicht Künstler zu mir”, habe Lakatos ihm einmal gesagt und darauf bestanden, sein Beruf sei Musiker. Sein Talent war ihm in die Wiege gelegt war, wenn er auch erst einmal den Wunsch des Vaters abwehren musste, Geigenprimas zu werden. Zum Saxophon kam Lakatos dabei erst spät, hatte aber bereits jede Menge musikalischer Erfahrung. Und mit dem Jazz kam der junge Tony dann im 8. Bezirk Budapests in Berührung, in dem viele arme Roma lebten, in dem Lakatos aber vor allem bei Jam Sessions bei Freunden in den Jazz eintauchte.



 Yaeko Asano ist Klangkünstlerin und Musikpädagogin. Zwischen 1996 und 2002 studierte sie Komposition bei Atsuhiko Gondai und Klavier bei Kazuoki Fujii an der “Toho Gakuen School of Music” in Tokio. Nach ihrem Umzug nach Deutschland studierte sie Komposition bei Johannes Schöllhorn an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, wo sie im Jahr 2006 ihr Diplom erwarb. Sie lebt seit 2011 in Frankfurt am Main und arbeitet inzwischen als Musiklehrerin an einer Grundschule.
Yaeko Asano ist Klangkünstlerin und Musikpädagogin. Zwischen 1996 und 2002 studierte sie Komposition bei Atsuhiko Gondai und Klavier bei Kazuoki Fujii an der “Toho Gakuen School of Music” in Tokio. Nach ihrem Umzug nach Deutschland studierte sie Komposition bei Johannes Schöllhorn an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, wo sie im Jahr 2006 ihr Diplom erwarb. Sie lebt seit 2011 in Frankfurt am Main und arbeitet inzwischen als Musiklehrerin an einer Grundschule. NEDE ist ein Konsumkünstler. Nach 20 Jahren in der Musikbranche als Musikverleger, wechselte er 2013 die Seiten, vom Schreibtisch zum Künstler. Er arbeitet u.a. mit den Abfällen der Konsumgesellschaft und recycelt diese zu Kunstwerken, die ein Abbild unserer Obsessionen darstellen und ein Fenster unserer Möglichkeiten. Konsum wird bei ihm zur provokativen Macht. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Objekte, Installationen und die Fotografie.
NEDE ist ein Konsumkünstler. Nach 20 Jahren in der Musikbranche als Musikverleger, wechselte er 2013 die Seiten, vom Schreibtisch zum Künstler. Er arbeitet u.a. mit den Abfällen der Konsumgesellschaft und recycelt diese zu Kunstwerken, die ein Abbild unserer Obsessionen darstellen und ein Fenster unserer Möglichkeiten. Konsum wird bei ihm zur provokativen Macht. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Objekte, Installationen und die Fotografie. Paulina Stulin ist eine Comic-Künstlerin. Von 2007-2012 hat sie in Darmstadt und Krakau Kommunikationsdesign studiert. 2015 erhielt sie für ihre Graphic Novel »The Right Here Right Now Thing« den ICOM Independent Comic Preis in der Kategorie »Herausragendes Szenario«. 2020 erschien ihr 600 Seiten starkes Buch »Bei mir zuhause«, das für den Max und Moritz-Preis in der Kategorie »Bester deutschsprachiger Comic« nominiert wurde. Im Juni 2022 erschien der Comic »FREIBAD«, den sie begleitend zum gleichnamigen Kinofilm von Doris Dörrie gezeichnet hat. Neben dem Comicmachen zettelt sie gerne wilde Diskussionen über Gott und die Welt an, arbeitet als pädagogische Betreuung für Jugendliche und produziert den Podcast »In Echtzeit«.
Paulina Stulin ist eine Comic-Künstlerin. Von 2007-2012 hat sie in Darmstadt und Krakau Kommunikationsdesign studiert. 2015 erhielt sie für ihre Graphic Novel »The Right Here Right Now Thing« den ICOM Independent Comic Preis in der Kategorie »Herausragendes Szenario«. 2020 erschien ihr 600 Seiten starkes Buch »Bei mir zuhause«, das für den Max und Moritz-Preis in der Kategorie »Bester deutschsprachiger Comic« nominiert wurde. Im Juni 2022 erschien der Comic »FREIBAD«, den sie begleitend zum gleichnamigen Kinofilm von Doris Dörrie gezeichnet hat. Neben dem Comicmachen zettelt sie gerne wilde Diskussionen über Gott und die Welt an, arbeitet als pädagogische Betreuung für Jugendliche und produziert den Podcast »In Echtzeit«. Johanna Krimmel ist eine freischaffende bildende Künstlerin und Szenografin aus Darmstadt. Mit Stift und Skizzenbuch die Umwelt genau zu beobachten und zu analysieren, bildet die Grundlage für ihre Arbeiten, die auch im Raum und in Verbindung mit medialen, interaktiven Inszenierungen weitergedacht werden. Stetig auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen und Herausforderungen lässt sie sich nicht auf ein Sujet und einen Stil festlegen, vielmehr versteht sie ihren Arbeitsprozess als situativen Flow, als eine Entdeckungsreise mit ungewissem Ziel. Mit ihren Arbeiten ist sie bei Ausstellungen und Performances im In- und Ausland vertreten. Als aktives Mitglied der weltweiten Urban Sketcher Community leitet sie Workshops, u.a. bei internationalen Symposien.
Johanna Krimmel ist eine freischaffende bildende Künstlerin und Szenografin aus Darmstadt. Mit Stift und Skizzenbuch die Umwelt genau zu beobachten und zu analysieren, bildet die Grundlage für ihre Arbeiten, die auch im Raum und in Verbindung mit medialen, interaktiven Inszenierungen weitergedacht werden. Stetig auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen und Herausforderungen lässt sie sich nicht auf ein Sujet und einen Stil festlegen, vielmehr versteht sie ihren Arbeitsprozess als situativen Flow, als eine Entdeckungsreise mit ungewissem Ziel. Mit ihren Arbeiten ist sie bei Ausstellungen und Performances im In- und Ausland vertreten. Als aktives Mitglied der weltweiten Urban Sketcher Community leitet sie Workshops, u.a. bei internationalen Symposien. Fabian Rücker ist ein Strategieberater für die Themen Metaverse, Virtual & Augmented Reality und Künstliche Intelligenz. Während seines Mathematikstudiums gründete er 2015 die mittlerweile zweitgrößte deutsche VR & AR Community VRANKFURT und fing nach seinem Studium an am Fraunhofer IGD in diesem Bereich zu promovieren. Durch die industrienahe Forschung am IGD ist er mit den gängigen professionellen XR-Anwendungen bestens vertraut. Im Rahmen seiner Beratung unterstützt er Unternehmen dabei eine auf ihre Situation angepasste Strategie zu entwickeln, relevante Anwendungsfälle zu identifizieren und durch Explorationsworkshops auch erste Praxis-Erfahrungen zu sammeln.
Fabian Rücker ist ein Strategieberater für die Themen Metaverse, Virtual & Augmented Reality und Künstliche Intelligenz. Während seines Mathematikstudiums gründete er 2015 die mittlerweile zweitgrößte deutsche VR & AR Community VRANKFURT und fing nach seinem Studium an am Fraunhofer IGD in diesem Bereich zu promovieren. Durch die industrienahe Forschung am IGD ist er mit den gängigen professionellen XR-Anwendungen bestens vertraut. Im Rahmen seiner Beratung unterstützt er Unternehmen dabei eine auf ihre Situation angepasste Strategie zu entwickeln, relevante Anwendungsfälle zu identifizieren und durch Explorationsworkshops auch erste Praxis-Erfahrungen zu sammeln. MOLUSK ist ein medienverarbeitender Künstler. Er findet kreative Inspiration und Zugehörigkeit sowohl im Studium der klassischen Bildungsstätten wie Museen, Galerien und Ausstellungen als auch in der täglichen Konfrontation mit Medien; ideengebend sind allgegenwärtige Werbung, Kult- und Trash-Comics, die Kunst des Tätowierens, Street und Urban Art und natürlich das Internet in all seinen Fassetten. Diese Fülle an Input führt zu einer Melange an Motiven und Geschichten, die nicht immer sofort zu durchschauen ist. Die Auseinandersetzung mit KI hebt die Motiv-Erschaffung auf ein neues Level. Das Ausloten der Grenzen, deren Überschreitung und das Ringen um die kreative Hoheit sowie die inhaltliche Deutung lassen einzigartige Bilder, Ideen und Interpretationsmöglichkeiten entstehen.
MOLUSK ist ein medienverarbeitender Künstler. Er findet kreative Inspiration und Zugehörigkeit sowohl im Studium der klassischen Bildungsstätten wie Museen, Galerien und Ausstellungen als auch in der täglichen Konfrontation mit Medien; ideengebend sind allgegenwärtige Werbung, Kult- und Trash-Comics, die Kunst des Tätowierens, Street und Urban Art und natürlich das Internet in all seinen Fassetten. Diese Fülle an Input führt zu einer Melange an Motiven und Geschichten, die nicht immer sofort zu durchschauen ist. Die Auseinandersetzung mit KI hebt die Motiv-Erschaffung auf ein neues Level. Das Ausloten der Grenzen, deren Überschreitung und das Ringen um die kreative Hoheit sowie die inhaltliche Deutung lassen einzigartige Bilder, Ideen und Interpretationsmöglichkeiten entstehen. Bianca Dührssen studiert seit 2021 Sound and Music Production an der Hochschule Darmstadt. Von 2013 bis 2017 lebte sie in Berlin, wo sie ihre Ausbildung zur Mediengestalterin absolvierte. Anschließend arbeitete sie zunächst in verschiedenen Agenturen und beim hessischen Rundfunk, seit 2020 ist sie selbstständig. Zeitweise unterstützte sie non-profit Organisationen wie Ocean Sounds, wo sie ihr Interesse für Field Recording entdeckte. Privat schreibt und produziert sie eigene Musik.
Bianca Dührssen studiert seit 2021 Sound and Music Production an der Hochschule Darmstadt. Von 2013 bis 2017 lebte sie in Berlin, wo sie ihre Ausbildung zur Mediengestalterin absolvierte. Anschließend arbeitete sie zunächst in verschiedenen Agenturen und beim hessischen Rundfunk, seit 2020 ist sie selbstständig. Zeitweise unterstützte sie non-profit Organisationen wie Ocean Sounds, wo sie ihr Interesse für Field Recording entdeckte. Privat schreibt und produziert sie eigene Musik. Jan Niklas Diwisch ist ein Nachwuchskünstler. Er beschäftigt sich vornehmlich mit bildender Kunst und Fotografie. Beeinflusst wird seine Kunst häufig von Horror- und Endzeitszenarien. Diwisch verwendet gerne psychedelische Elemente und arbeitet mit surrealistischen Effekten. Seine Ausbildung am Fachbereich Gestaltung einer Fachoberschule bietet ihm die Möglichkeit, sich vielseitig weiterzuentwickeln. In seiner Freizeit musiziert Jan Niklas außerdem solistisch und in einem Bandprojekt.
Jan Niklas Diwisch ist ein Nachwuchskünstler. Er beschäftigt sich vornehmlich mit bildender Kunst und Fotografie. Beeinflusst wird seine Kunst häufig von Horror- und Endzeitszenarien. Diwisch verwendet gerne psychedelische Elemente und arbeitet mit surrealistischen Effekten. Seine Ausbildung am Fachbereich Gestaltung einer Fachoberschule bietet ihm die Möglichkeit, sich vielseitig weiterzuentwickeln. In seiner Freizeit musiziert Jan Niklas außerdem solistisch und in einem Bandprojekt. Kerstin (Kiki) Rau ist eine Biologin in der Krebsforschung. Sie kam zum Studieren nach Darmstadt und hat sich direkt in die Stadt verliebt. Nach ihrem Biologiestudium an der TU Darmstadt promovierte sie zum Thema der neurophysiologischen Nebenwirkungen von Strahlentherapien bei Hirntumoren. Seit 2019 arbeitet sie in der klinischen Krebsforschung und versucht so jeden Tag die Möglichkeiten zukünftiger Krebstherapien zu verbessern. Wenn sie nicht arbeitet, verbringt sie gerne Zeit in der Natur oder in ihrem Garten, am liebsten mit Partner und Katze. Außerdem zeichnet und malt Kiki seit ihrer Kindheit und hat sich dieses Hobby bis heute als Ausgleich bewahrt.
Kerstin (Kiki) Rau ist eine Biologin in der Krebsforschung. Sie kam zum Studieren nach Darmstadt und hat sich direkt in die Stadt verliebt. Nach ihrem Biologiestudium an der TU Darmstadt promovierte sie zum Thema der neurophysiologischen Nebenwirkungen von Strahlentherapien bei Hirntumoren. Seit 2019 arbeitet sie in der klinischen Krebsforschung und versucht so jeden Tag die Möglichkeiten zukünftiger Krebstherapien zu verbessern. Wenn sie nicht arbeitet, verbringt sie gerne Zeit in der Natur oder in ihrem Garten, am liebsten mit Partner und Katze. Außerdem zeichnet und malt Kiki seit ihrer Kindheit und hat sich dieses Hobby bis heute als Ausgleich bewahrt. dink ist ein multidisziplinärer Künstler. Er bewegt sich meist im figurativen Expressionismus. Seine Techniken reichen von Linoldrucken, Gemälden und Zeichnungen bis hin zu Murals und Grafiken aller Formate und Couleur. Er thematisiert gesellschaftliche und soziale Themen und beleuchtet diese mit einer kritischen und teils provokativen Haltung. Seine künstlerischen Positionen werden seit 2022 von BAODT Art in München und der Context Art Gallery in Venedig vertreten. Der gelernte Drucker und Diplomdesigner studiert derzeit Kunst-Medien-Kulturelle Bildung in Frankfurt am Main.
dink ist ein multidisziplinärer Künstler. Er bewegt sich meist im figurativen Expressionismus. Seine Techniken reichen von Linoldrucken, Gemälden und Zeichnungen bis hin zu Murals und Grafiken aller Formate und Couleur. Er thematisiert gesellschaftliche und soziale Themen und beleuchtet diese mit einer kritischen und teils provokativen Haltung. Seine künstlerischen Positionen werden seit 2022 von BAODT Art in München und der Context Art Gallery in Venedig vertreten. Der gelernte Drucker und Diplomdesigner studiert derzeit Kunst-Medien-Kulturelle Bildung in Frankfurt am Main.


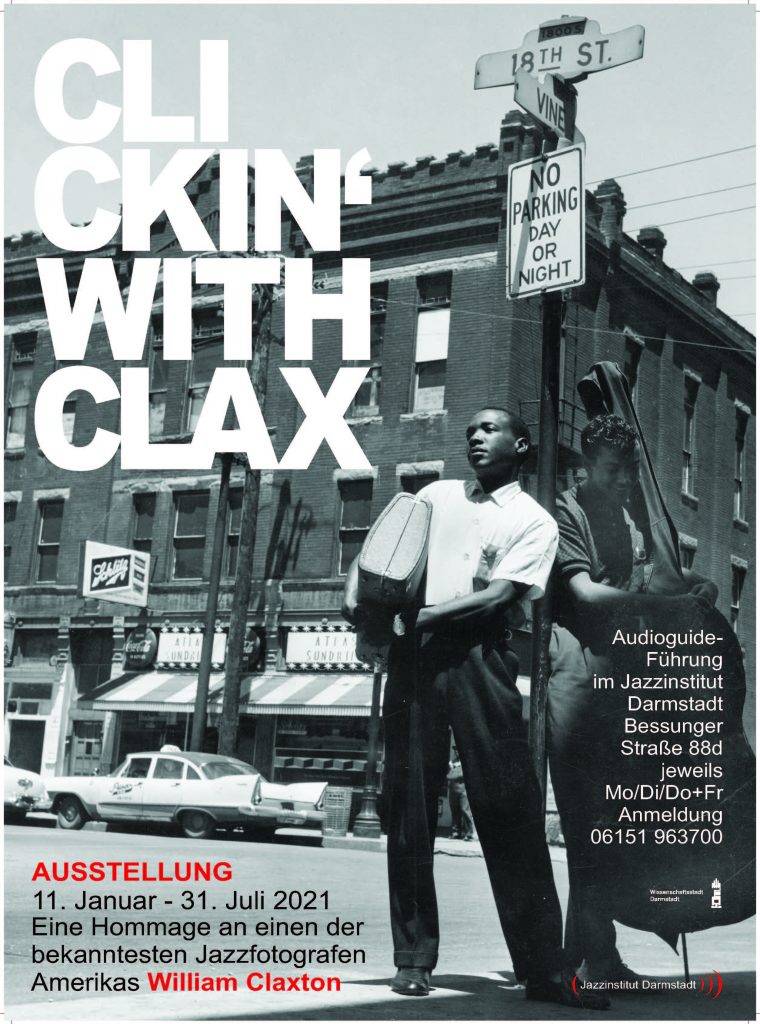























 Die dynamischen, raschen Tusche-Pinsel-Zeichnungen kombiniert mit Aquarelltechnik setzen hohes künstlerisches Können voraus, da Korrekturen kaum noch möglich sind.
Die dynamischen, raschen Tusche-Pinsel-Zeichnungen kombiniert mit Aquarelltechnik setzen hohes künstlerisches Können voraus, da Korrekturen kaum noch möglich sind. Gut, über eigene Bücher zu schreiben, ist ein wenig schwierig. Die Presse lobt mein neues Buch als als eine “rundum überzeugende Geschichte des Jazz in Deutschland” (FAZ), als “umfassendste Bestandsaufnahme des Jazz in Deutschland, schlagend aktuell und absolut empfehlenswert” (NDR), als eine “exemplarischen Kulturgeschichte” (Frankfurter Rundschau), als “kenntnisreiches und flüssig geschriebenes Buch, das das Zeug zum Standardwerk hat” (NZZ) und als ein “Standardwerk, das als Lesebuch und zum Nachschlagen gleichermaßen taugt” (Die Zeit). Die Rückmeldungen von Fans, Journalisten, Musikerinnen und Musikern sind so überaus positiv, dass der Autor sich ob des Lobs leicht “norddeutsch” eigentlich lieber verschämt hinter dem dicken Buch verstecken möchte.
Gut, über eigene Bücher zu schreiben, ist ein wenig schwierig. Die Presse lobt mein neues Buch als als eine “rundum überzeugende Geschichte des Jazz in Deutschland” (FAZ), als “umfassendste Bestandsaufnahme des Jazz in Deutschland, schlagend aktuell und absolut empfehlenswert” (NDR), als eine “exemplarischen Kulturgeschichte” (Frankfurter Rundschau), als “kenntnisreiches und flüssig geschriebenes Buch, das das Zeug zum Standardwerk hat” (NZZ) und als ein “Standardwerk, das als Lesebuch und zum Nachschlagen gleichermaßen taugt” (Die Zeit). Die Rückmeldungen von Fans, Journalisten, Musikerinnen und Musikern sind so überaus positiv, dass der Autor sich ob des Lobs leicht “norddeutsch” eigentlich lieber verschämt hinter dem dicken Buch verstecken möchte.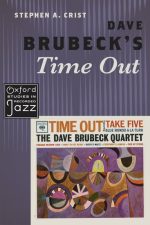 In der Reihe “Oxford Studies in Recorded Jazz” hat der Verlag Oxford University Press jetzt eine Monographie über Dave Brubecks Album “Time Out” vorgelegt, das 1959 auf den Markt kam und schnell zu einem der meistverkauften Alben der Jazzgeschichte wurde. Stephen A. Crist verweist im Vorwort seines Buchs auf das andere Album aus dem Jahr 1959, das bis heute gefeiert wird, Miles Davis’ “Kind of Blue”, über das es mittlerweile jede Menge Literatur gebe, in der die Musik von allen Seiten betrachtet und analysiert werde. Brubecks Albums sei eine solche Wertschätzung leider nie zuteil geworden, klagt er und macht sich dann für seine Recherchen auf in die Brubeck Collection in Stockton, Kalifornien, spricht daneben mit Brubeck selbst (vor seinem Tod natürlich), mit seiner Frau Iola sowie anderen Zeitzeugen, die mit dem Album zu tun hatten.
In der Reihe “Oxford Studies in Recorded Jazz” hat der Verlag Oxford University Press jetzt eine Monographie über Dave Brubecks Album “Time Out” vorgelegt, das 1959 auf den Markt kam und schnell zu einem der meistverkauften Alben der Jazzgeschichte wurde. Stephen A. Crist verweist im Vorwort seines Buchs auf das andere Album aus dem Jahr 1959, das bis heute gefeiert wird, Miles Davis’ “Kind of Blue”, über das es mittlerweile jede Menge Literatur gebe, in der die Musik von allen Seiten betrachtet und analysiert werde. Brubecks Albums sei eine solche Wertschätzung leider nie zuteil geworden, klagt er und macht sich dann für seine Recherchen auf in die Brubeck Collection in Stockton, Kalifornien, spricht daneben mit Brubeck selbst (vor seinem Tod natürlich), mit seiner Frau Iola sowie anderen Zeitzeugen, die mit dem Album zu tun hatten. Als der Trompeter Harry Beckett im Juli 2010 verstarb, dachten selbst seine Nachruf-Schreiber, er sei 75 Jahre alt gewesen. Nur der Independent fragte genauer nach bei seiner Witwe und erfuhr, dass Beckett bei seinem Tod tatsächlich 87 Jahre alt gewesen war, dass er sich immer ein wenig jünger gemacht hatte, aus Sorge, sonst würden die Veranstalter ihn nicht mehr buchen. Beckett gehört seit den 1960er Jahren zu den wichtigsten Musikern des modernen britischen Jazz, zugleich war er einer der vielleicht vielseitigsten Künstler der Szene, der sich in afrikanische Highlife-Musik genauso einfinden konnte wie in karibische Bands, in den Jazzrock der 1970er genauso wie in die Avantgardeszene der Insel, und der sich bis ins hohe Alter auch nicht zu schade war, bei Dub- und Dance Music-Sessions etwa mit Jah Wobble mitzuwirken.
Als der Trompeter Harry Beckett im Juli 2010 verstarb, dachten selbst seine Nachruf-Schreiber, er sei 75 Jahre alt gewesen. Nur der Independent fragte genauer nach bei seiner Witwe und erfuhr, dass Beckett bei seinem Tod tatsächlich 87 Jahre alt gewesen war, dass er sich immer ein wenig jünger gemacht hatte, aus Sorge, sonst würden die Veranstalter ihn nicht mehr buchen. Beckett gehört seit den 1960er Jahren zu den wichtigsten Musikern des modernen britischen Jazz, zugleich war er einer der vielleicht vielseitigsten Künstler der Szene, der sich in afrikanische Highlife-Musik genauso einfinden konnte wie in karibische Bands, in den Jazzrock der 1970er genauso wie in die Avantgardeszene der Insel, und der sich bis ins hohe Alter auch nicht zu schade war, bei Dub- und Dance Music-Sessions etwa mit Jah Wobble mitzuwirken. Jedes Jahr nach Himmelfahrt kommt der Jazz nach E., also ins brandenburgische Eberswalde. Das Festival für zeitgenössische Jazz- und Improvisationsmusik entstand nach anfänglichen Konzerten in der Garage des ehemaligen preußischen Zollamts. Erste Konzerte gab es ab 1992, 1993 und 1994 dann den Garagen-Sommer, und ab 1995 das Festival Jazz in Eberswalde, bald nur noch als “Jazz in E.” abgekürzt. Thomas Melzer dokumentiert in seinem liebevoll gestalteten Buch mehr als 20 Jahre aktiver Veranstaltungsarbeit, die den aktuellen Jazz der immer zentraler werdenden Berliner Jazzszene nach der Wiedervereinigung dokumentiert. Fürs Festival waren die Konzerte schnell in größere Orte umgezogen, der Geist des “Festivals aktueller Musik”, wie es sich im Untertitel nannte, hielt bis in die Gegenwart. Melzers Buch dokumentiert die Reihe bis 2018; 2019 fand die 25. Ausgabe statt, aus deren Anlass dieses Buch entstand; dann war und ist Pause. Sein Buch enthält viele Fotos, die die Atmosphäre gut einfangen, die gesammelten Festivalplakate sowie vereinzelte Rezensionen. Nach Eberswalde, erzählt Ulf Drechsel im Vorwort, sei das Publikum geströmt, ohne zu wissen, was es erwartete. Die Basis war Vertrauen. Das spürt man, auch in der Dokumentation, die wie eine Art Familienalbum einer Szene dient, die froh ist, dass diese Musik nicht nur in der Großstadt passiert, sondern – vielleicht ja gerade – auch auf dem Land Freiräume findet und Kreativität unterstützt.
Jedes Jahr nach Himmelfahrt kommt der Jazz nach E., also ins brandenburgische Eberswalde. Das Festival für zeitgenössische Jazz- und Improvisationsmusik entstand nach anfänglichen Konzerten in der Garage des ehemaligen preußischen Zollamts. Erste Konzerte gab es ab 1992, 1993 und 1994 dann den Garagen-Sommer, und ab 1995 das Festival Jazz in Eberswalde, bald nur noch als “Jazz in E.” abgekürzt. Thomas Melzer dokumentiert in seinem liebevoll gestalteten Buch mehr als 20 Jahre aktiver Veranstaltungsarbeit, die den aktuellen Jazz der immer zentraler werdenden Berliner Jazzszene nach der Wiedervereinigung dokumentiert. Fürs Festival waren die Konzerte schnell in größere Orte umgezogen, der Geist des “Festivals aktueller Musik”, wie es sich im Untertitel nannte, hielt bis in die Gegenwart. Melzers Buch dokumentiert die Reihe bis 2018; 2019 fand die 25. Ausgabe statt, aus deren Anlass dieses Buch entstand; dann war und ist Pause. Sein Buch enthält viele Fotos, die die Atmosphäre gut einfangen, die gesammelten Festivalplakate sowie vereinzelte Rezensionen. Nach Eberswalde, erzählt Ulf Drechsel im Vorwort, sei das Publikum geströmt, ohne zu wissen, was es erwartete. Die Basis war Vertrauen. Das spürt man, auch in der Dokumentation, die wie eine Art Familienalbum einer Szene dient, die froh ist, dass diese Musik nicht nur in der Großstadt passiert, sondern – vielleicht ja gerade – auch auf dem Land Freiräume findet und Kreativität unterstützt. Der Journalist Con Chapman hat sich eine scheinbar unmögliche Aufgabe gestellt, nämlich die Biographie über einen der wortkargsten Musiker der Jazzgeschichte zu verfassen, den Altsaxophonisten Johnny Hodges, über den zumal so viele irreführenden Informationen kursierten, dass einem fast schwindlig wird. Also klärt er auf: Das Rätsel um den Nachnamen, der auch mal ohne des “s” am Ende erscheint; das Rätsel um den Vornamen, der ursprünglich “Cornelius”, spätestens ab dem dritten Geburtstag aber “John” lautete; das Rätsel um und die verschiedenen Erklärungen seines Spitznamens “Rabbit” (sowie die Geschichte hinter anderen Spitznamen, die Hodges über seine Karriere tragen sollte); das Rätsel um die Angabe in der Volkszählung von 1910, dass alle Mitglieder der Familie “weiß” gewesen seien.
Der Journalist Con Chapman hat sich eine scheinbar unmögliche Aufgabe gestellt, nämlich die Biographie über einen der wortkargsten Musiker der Jazzgeschichte zu verfassen, den Altsaxophonisten Johnny Hodges, über den zumal so viele irreführenden Informationen kursierten, dass einem fast schwindlig wird. Also klärt er auf: Das Rätsel um den Nachnamen, der auch mal ohne des “s” am Ende erscheint; das Rätsel um den Vornamen, der ursprünglich “Cornelius”, spätestens ab dem dritten Geburtstag aber “John” lautete; das Rätsel um und die verschiedenen Erklärungen seines Spitznamens “Rabbit” (sowie die Geschichte hinter anderen Spitznamen, die Hodges über seine Karriere tragen sollte); das Rätsel um die Angabe in der Volkszählung von 1910, dass alle Mitglieder der Familie “weiß” gewesen seien. Im Sommer 1962 trat das Archie Shepp-Bill Dixon Quartet bei den 8. Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Helsinki auf, einer vom Weltbund der Demokratischen Jugend ausgerichteten Veranstaltungsreihe, die seit 1947 meist in Staaten des Ostblocks und einzig 1959 mit Wien und 1962 mit Helsinki in nicht Ostblockländern stattfand. Die Weltjugendspiele waren eine politische Veranstaltung – insbesondere 1962, also mitten im Kalten Krieg, und insbesondere in Finnland, das damals eine Art Land zwischen den Systemen war. Sezgin Boynik und Taneli Viitahuhta beleuchten den Auftritt Shepps und Dixons im Quartett mit Don Moore, Bass, und Howard McRae, Schlagzeug, von unterschiedlichen Seiten, wollen dabei die Bedeutung des Konzerts im Rahmen des Festivals, aber auch die Auswirkungen der politischen Bedeutung der Veranstaltung auf den weiteren Lebensweg insbesondere Archie Shepps analysieren.
Im Sommer 1962 trat das Archie Shepp-Bill Dixon Quartet bei den 8. Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Helsinki auf, einer vom Weltbund der Demokratischen Jugend ausgerichteten Veranstaltungsreihe, die seit 1947 meist in Staaten des Ostblocks und einzig 1959 mit Wien und 1962 mit Helsinki in nicht Ostblockländern stattfand. Die Weltjugendspiele waren eine politische Veranstaltung – insbesondere 1962, also mitten im Kalten Krieg, und insbesondere in Finnland, das damals eine Art Land zwischen den Systemen war. Sezgin Boynik und Taneli Viitahuhta beleuchten den Auftritt Shepps und Dixons im Quartett mit Don Moore, Bass, und Howard McRae, Schlagzeug, von unterschiedlichen Seiten, wollen dabei die Bedeutung des Konzerts im Rahmen des Festivals, aber auch die Auswirkungen der politischen Bedeutung der Veranstaltung auf den weiteren Lebensweg insbesondere Archie Shepps analysieren. Stéphane Grappelli gehört zu den großen und einflussreichen Musikern seines Instruments im Jazz – in Europa, aber tatsächlich auch über Europa hinaus. Der australische Musikwissenschaftler Frank Murphy versucht jetzt in einer analytischen Studie seinem Personalstil näher zu kommen und dabei insbesondere seinen Beitrag zum Quintette du Hot Club de France zu beschreiben. Er hat dafür alle ihm zugängliche Literatur gesichtet und diese insbesondere auf Grappellis Zeit im QdHCF ausgewertet, sich sämtliche Aufnahmen des Ensembles zwischen 1934 und 1948 angehört, an denen der Geiger beteiligt war, Grappellis Improvisationen transkribiert, und seine Soli wo immer möglich mit Notenveröffentlichungen der betreffenden Songs verglichen.
Stéphane Grappelli gehört zu den großen und einflussreichen Musikern seines Instruments im Jazz – in Europa, aber tatsächlich auch über Europa hinaus. Der australische Musikwissenschaftler Frank Murphy versucht jetzt in einer analytischen Studie seinem Personalstil näher zu kommen und dabei insbesondere seinen Beitrag zum Quintette du Hot Club de France zu beschreiben. Er hat dafür alle ihm zugängliche Literatur gesichtet und diese insbesondere auf Grappellis Zeit im QdHCF ausgewertet, sich sämtliche Aufnahmen des Ensembles zwischen 1934 und 1948 angehört, an denen der Geiger beteiligt war, Grappellis Improvisationen transkribiert, und seine Soli wo immer möglich mit Notenveröffentlichungen der betreffenden Songs verglichen.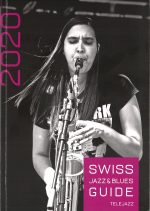 Alle paar Jahre legt der Verlag JazzTime, der monatlich einen Veranstaltungsüberblick über das Jazz- und Bluesgeschehen in der Schweiz herausgibt, einen Wegweiser durch die gesamte Schweizer Jazz- und Blueslandschaft vor. Der “Swiss Jazz & Blues Guide” enthält die Kontaktdaten zu weit etwa 1.200 Musikerinnen und Musikern, etwa 400 Bands, 33 Clubs und Vereine, etwa 80 Vereinen sowie ca. 50 Festivals. Es ist damit eine Art Branchenbuch der Schweizer Szene, ähnlich wie es der Wegweiser Jazz als Buch bis 2009 war und als Internetdatenbank bis heute ist. Die Musiker sind mit Postanschrift, Telefon, Mailadresse und Website gelistet, außerdem in einer eigenen Rubrik nach Instrument sortiert; für die Vereine und Festivals sind die Kontaktpersonen genannt, für die Spielorte oft nur Adresse und URL; die Festivals sind zusätzlich in einer eigenen Rubrik chronologisch geordnet. Ein kurzes Vorwort, ein Porträt der Saxophonistin uns Komponistin Sarah Chaksad sowie ein einseitiges Feature für das Winterhurer Institut für aktuelle Musik runden das Buch ab, das daneben noch eine Anzeige der Hochschule der Künste Bern enthält, aber ansonsten auf keine weiteren Fortbildungsangebote in der Schweiz verweist. Auch in Zeiten des Internet ist ein solches gedrucktes Verzeichnis wertvoll, wenn man sich auch wünschen würde, dass es über kurz oder lang (mit all den Problemen, die der Datenschutz mit sich bringt) in eine gepflegte Online-Datenbank überführt würde.
Alle paar Jahre legt der Verlag JazzTime, der monatlich einen Veranstaltungsüberblick über das Jazz- und Bluesgeschehen in der Schweiz herausgibt, einen Wegweiser durch die gesamte Schweizer Jazz- und Blueslandschaft vor. Der “Swiss Jazz & Blues Guide” enthält die Kontaktdaten zu weit etwa 1.200 Musikerinnen und Musikern, etwa 400 Bands, 33 Clubs und Vereine, etwa 80 Vereinen sowie ca. 50 Festivals. Es ist damit eine Art Branchenbuch der Schweizer Szene, ähnlich wie es der Wegweiser Jazz als Buch bis 2009 war und als Internetdatenbank bis heute ist. Die Musiker sind mit Postanschrift, Telefon, Mailadresse und Website gelistet, außerdem in einer eigenen Rubrik nach Instrument sortiert; für die Vereine und Festivals sind die Kontaktpersonen genannt, für die Spielorte oft nur Adresse und URL; die Festivals sind zusätzlich in einer eigenen Rubrik chronologisch geordnet. Ein kurzes Vorwort, ein Porträt der Saxophonistin uns Komponistin Sarah Chaksad sowie ein einseitiges Feature für das Winterhurer Institut für aktuelle Musik runden das Buch ab, das daneben noch eine Anzeige der Hochschule der Künste Bern enthält, aber ansonsten auf keine weiteren Fortbildungsangebote in der Schweiz verweist. Auch in Zeiten des Internet ist ein solches gedrucktes Verzeichnis wertvoll, wenn man sich auch wünschen würde, dass es über kurz oder lang (mit all den Problemen, die der Datenschutz mit sich bringt) in eine gepflegte Online-Datenbank überführt würde. Gerhard Evertz hat bereits 2004 und 2007 zwei Bücher mit zahlreichen Dokumenten zur Jazzgeschichte seiner Heimatstadt vorgelegt. Jetzt konnte er diese in einem weiteren Band um Dokumente aus den 1940er bis 1960er Jahren ergänzen, insbesondere Faksimiles oder Abschriften der diversen Hot-Club-Zeitschriften “Rhythm Echo”, “Rhythm on Record”, “Die Synkope” und “Yardbird”.
Gerhard Evertz hat bereits 2004 und 2007 zwei Bücher mit zahlreichen Dokumenten zur Jazzgeschichte seiner Heimatstadt vorgelegt. Jetzt konnte er diese in einem weiteren Band um Dokumente aus den 1940er bis 1960er Jahren ergänzen, insbesondere Faksimiles oder Abschriften der diversen Hot-Club-Zeitschriften “Rhythm Echo”, “Rhythm on Record”, “Die Synkope” und “Yardbird”. “Sagen Sie niemals: ‘In seiner Autobiographie schrieb Miles Davis…’ Miles Davis hat nichts davon geschrieben.” So beginnt Masaya Yamaguchi sein Buch, das …. hmmmm…. nunja, das schwer beschreibbar ist. Es ist nur bedingt ein Buch über Miles Davis; es ist keine Biographie, es ist keine Stilstudie, es ist kein analytisches Werk. Als Ausgangspunkt dient die vom Dichter und Schriftsteller Quincy Troupe verfasste Autobiographie des Trompeters, in der Yamaguchi über zahlreiche Fehler, Missverständnisse, falsche Mythen und ähnliches stolpert und das zum Anlass nimmt weiter zu graben. Er recherchiert in Archiven, vergleicht das Buch mit den Interviews, die Troupe entweder selbst mit Miles führte (und die heute im Archiv des Schomburg Center in New York liegen), oder die anderweitig mit ihm verfügbar sind, studiert die verschiedenen Fassungen von Anekdoten und Erklärungen des Trompeters über die Jahre, und vergleicht behauptete Fakten mit offiziellen Unterlagen, etwa Zensuslisten, Familienregistern oder in Archiven entdeckter Korrespondenz. Sein Buch ist quasi eine recherchekritische Begleitstudie zur Autobiographie, die zugleich das Problem historischer Forschung im Jazzbereich beleuchtet, die oft verschwommene Quellenlage, den Umgang mit apokryphen Geschichten oder unklaren Daten. Es ist eine Studie über Legendenbildung im Jazz.
“Sagen Sie niemals: ‘In seiner Autobiographie schrieb Miles Davis…’ Miles Davis hat nichts davon geschrieben.” So beginnt Masaya Yamaguchi sein Buch, das …. hmmmm…. nunja, das schwer beschreibbar ist. Es ist nur bedingt ein Buch über Miles Davis; es ist keine Biographie, es ist keine Stilstudie, es ist kein analytisches Werk. Als Ausgangspunkt dient die vom Dichter und Schriftsteller Quincy Troupe verfasste Autobiographie des Trompeters, in der Yamaguchi über zahlreiche Fehler, Missverständnisse, falsche Mythen und ähnliches stolpert und das zum Anlass nimmt weiter zu graben. Er recherchiert in Archiven, vergleicht das Buch mit den Interviews, die Troupe entweder selbst mit Miles führte (und die heute im Archiv des Schomburg Center in New York liegen), oder die anderweitig mit ihm verfügbar sind, studiert die verschiedenen Fassungen von Anekdoten und Erklärungen des Trompeters über die Jahre, und vergleicht behauptete Fakten mit offiziellen Unterlagen, etwa Zensuslisten, Familienregistern oder in Archiven entdeckter Korrespondenz. Sein Buch ist quasi eine recherchekritische Begleitstudie zur Autobiographie, die zugleich das Problem historischer Forschung im Jazzbereich beleuchtet, die oft verschwommene Quellenlage, den Umgang mit apokryphen Geschichten oder unklaren Daten. Es ist eine Studie über Legendenbildung im Jazz. Warum ausgerechnet Jazz? Wer kennt sie nicht, diese Frage, die uns Jazzaffinen immer mal wieder von Außenseitern gestellt wird, ein wenig ungläubig, dass wir in den virtuosen Soli der Jazzgrößen so viel Spannendes zu entdecken scheinen, dass uns die Komplexität freier Improvisation nicht abschreckt, dass wir keine Texte benötigen, aber offenbar Instrumentalisten bereits nach einem Ton erkennen…
Warum ausgerechnet Jazz? Wer kennt sie nicht, diese Frage, die uns Jazzaffinen immer mal wieder von Außenseitern gestellt wird, ein wenig ungläubig, dass wir in den virtuosen Soli der Jazzgrößen so viel Spannendes zu entdecken scheinen, dass uns die Komplexität freier Improvisation nicht abschreckt, dass wir keine Texte benötigen, aber offenbar Instrumentalisten bereits nach einem Ton erkennen… Also gleich mal vorneweg: Und wo ist Earl Hines? Oder Mary Lou Williams? Warum keine Jutta Hipp? Wie kann man Derek Bailey vergessen? Jan Garbarek kommt nicht vor, echt? Ella sings Cole Porter…? wo ihr Album mit Ellis Larkins doch viel besser ist! Klaus Doldinger fehlt! Ein Michael Wollny-Album außerhalb seines Duos mit Heinz Sauer hätte aber schon dabei sein können!
Also gleich mal vorneweg: Und wo ist Earl Hines? Oder Mary Lou Williams? Warum keine Jutta Hipp? Wie kann man Derek Bailey vergessen? Jan Garbarek kommt nicht vor, echt? Ella sings Cole Porter…? wo ihr Album mit Ellis Larkins doch viel besser ist! Klaus Doldinger fehlt! Ein Michael Wollny-Album außerhalb seines Duos mit Heinz Sauer hätte aber schon dabei sein können! Der zweite Band in Rainer Plackes neuer Buchreihe heißt “Das Wollny Alphabet”. Das Procedere gleicht dem ersten Band über den Posaunisten Nils Landgren: Placke bringt 26 Karten mit, auf denen für jeden Buchstaben des Alphabets fünf Begriffe stehen, und bittet den Pianisten Michael Wollny zu mindestens zwei davon etwas zu sagen. Wollny durfte Stichworte streichen, eigene hinzufügen, ansonsten freie Hand. Das Spiel der Assoziationen ist also wie eine Art gelenkte Improvisation mit jeweils – dem Umfang des Ganzen geschuldet – kurzen Reflexionen, die dem Leser ganz unterschiedliche Facetten im Denken des Pianisten vermitteln.
Der zweite Band in Rainer Plackes neuer Buchreihe heißt “Das Wollny Alphabet”. Das Procedere gleicht dem ersten Band über den Posaunisten Nils Landgren: Placke bringt 26 Karten mit, auf denen für jeden Buchstaben des Alphabets fünf Begriffe stehen, und bittet den Pianisten Michael Wollny zu mindestens zwei davon etwas zu sagen. Wollny durfte Stichworte streichen, eigene hinzufügen, ansonsten freie Hand. Das Spiel der Assoziationen ist also wie eine Art gelenkte Improvisation mit jeweils – dem Umfang des Ganzen geschuldet – kurzen Reflexionen, die dem Leser ganz unterschiedliche Facetten im Denken des Pianisten vermitteln. Fast 10 Kilo Gewicht, insgesamt 2.288 Seiten, das sind 17cm Regalfläche, 5 schwere Hardcover-gebundene Bände mit Lesebändchen, über 13.000 farbigen Abbildungen, vor allem aber allumfassendste Information über einen abgeschlossenen Teil deutscher Mediengeschichte. Im “Bilderlexikon der deutschen Schellack-Schallplatten” hat Rainer Lotz zusammen mit seinen beiden Mitstreitern Michael Gunrem und Stephan Puille ein Kompendium vorgelegt, das bereits jetzt als Standardwerk gelten muss.
Fast 10 Kilo Gewicht, insgesamt 2.288 Seiten, das sind 17cm Regalfläche, 5 schwere Hardcover-gebundene Bände mit Lesebändchen, über 13.000 farbigen Abbildungen, vor allem aber allumfassendste Information über einen abgeschlossenen Teil deutscher Mediengeschichte. Im “Bilderlexikon der deutschen Schellack-Schallplatten” hat Rainer Lotz zusammen mit seinen beiden Mitstreitern Michael Gunrem und Stephan Puille ein Kompendium vorgelegt, das bereits jetzt als Standardwerk gelten muss. Bob Gluck ist Pianist und Autor zweier Bücher über Herbie Hancocks Mwandishi Band und Miles Davis’ “lost quartets”. Jetzt hat er ein weiteres vorgelegt, das mit vielen O-Tönen beteiligter Musiker und Kollegen das Leben des Saxophonisten Paul Winter dokumentiert.
Bob Gluck ist Pianist und Autor zweier Bücher über Herbie Hancocks Mwandishi Band und Miles Davis’ “lost quartets”. Jetzt hat er ein weiteres vorgelegt, das mit vielen O-Tönen beteiligter Musiker und Kollegen das Leben des Saxophonisten Paul Winter dokumentiert. Der Musikwissenschaftler Nico Thom ist seit 2012 im Netzwerk der Musikhochschulen für Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung tätig und hat aus dieser Arbeit sowie aus zwei Masterarbeiten über Lehrpläne von künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Studiengängen zu Jazz und Popmusik eine empirische Studie vorgelegt. Darin analysiert er 49 künstlerische sowie 24 künstlerisch-pädagogische Studiengänge nach ihrem Angebot, dem Bewusstsein der Ersteller für die Bedarfe der Studierenden und bietet Empfehlungen für eine Weiterentwicklung der betreffenden Curricula an.
Der Musikwissenschaftler Nico Thom ist seit 2012 im Netzwerk der Musikhochschulen für Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung tätig und hat aus dieser Arbeit sowie aus zwei Masterarbeiten über Lehrpläne von künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Studiengängen zu Jazz und Popmusik eine empirische Studie vorgelegt. Darin analysiert er 49 künstlerische sowie 24 künstlerisch-pädagogische Studiengänge nach ihrem Angebot, dem Bewusstsein der Ersteller für die Bedarfe der Studierenden und bietet Empfehlungen für eine Weiterentwicklung der betreffenden Curricula an.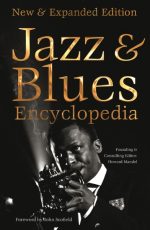
 Nach “Fantasieren nach Beethoven” (2017) legt Anke Steinbeck jetzt ein zweites Buch vor, das in Reflexionen und Interviews dem Geheimnis der musikalischen Improvisation auf die Spur kommen will. Improvisation, merkt sie im Vorwort an, gehörte ja bis vor rund 150 Jahren wie selbstverständlich zur europäischen Musikgeschichte, sei allerdings in der klassischen Musik heute vor allem noch im Spiel freier Kadenzen oder in Improvisation fordernden Beispielen aus dem Bereich der Neuen Musik vorhanden. Tatsächlich aber hat natürlich selbst die Interpretation eines festen Notentextes improvisatorischen Gehalt und ist Improvisation schon lange nicht mehr Alleinstellungsmerkmal des Jazz. Also ist der Jazz zwar Ausgangspunkt all ihrer Betrachtungen, beschränkt sich Steinbeck allerdings bei ihren Gesprächspartnern keineswegs auf Jazzmusiker oder -musikerinnen.
Nach “Fantasieren nach Beethoven” (2017) legt Anke Steinbeck jetzt ein zweites Buch vor, das in Reflexionen und Interviews dem Geheimnis der musikalischen Improvisation auf die Spur kommen will. Improvisation, merkt sie im Vorwort an, gehörte ja bis vor rund 150 Jahren wie selbstverständlich zur europäischen Musikgeschichte, sei allerdings in der klassischen Musik heute vor allem noch im Spiel freier Kadenzen oder in Improvisation fordernden Beispielen aus dem Bereich der Neuen Musik vorhanden. Tatsächlich aber hat natürlich selbst die Interpretation eines festen Notentextes improvisatorischen Gehalt und ist Improvisation schon lange nicht mehr Alleinstellungsmerkmal des Jazz. Also ist der Jazz zwar Ausgangspunkt all ihrer Betrachtungen, beschränkt sich Steinbeck allerdings bei ihren Gesprächspartnern keineswegs auf Jazzmusiker oder -musikerinnen. “In den Jahren um 1970”, beginnt Ekkehard Jost sein Buch Europas Jazz, 1960-80, “innerhalb einer relativ kurzen Phase des historischen Prozesses, fand Europas Jazz zu sich selbst.” Ähnlich könnte auch Eric Fillion sein Buch beginnen, das ein spezielles Kapitel freier Musik in Quebec in den Jahren 1967 bis 1975 behandelt. “1968” gab es ja überall zumindest in der westlichen Welt: die mal friedlichen, zunehmend militanten Aktivitäten der Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Studentenunruhen in ganz Europa, die Freiheitsbestrebungen in den offeneren Staaten des damaligen Ostblocks, all das schien sich in den utopistischen Klängen des Free Jazz jener Jahre zu spiegeln. Eric Fillion, seines Zeichens Historiker und Musiker, widmet jetzt eine Studio genau diesen Verbindungen zwischen Jazz und Politik in Kanada am Beispiel der Gruppe Jazz Libre, die sich selbst im Quebec jener Jahre innerhalb der Autonomiebewegung verortete. Anhand der politisch-musikalischen Aktionen ihrer Mitglieder verdeutlicht er die verschiedenen Ausprägungen der Autonomiediskussionen in jenen Jahren zwischen der sogenannten “Stillen Revolution” und den militanteren Aktivitäten der Front de Libération du Québec.
“In den Jahren um 1970”, beginnt Ekkehard Jost sein Buch Europas Jazz, 1960-80, “innerhalb einer relativ kurzen Phase des historischen Prozesses, fand Europas Jazz zu sich selbst.” Ähnlich könnte auch Eric Fillion sein Buch beginnen, das ein spezielles Kapitel freier Musik in Quebec in den Jahren 1967 bis 1975 behandelt. “1968” gab es ja überall zumindest in der westlichen Welt: die mal friedlichen, zunehmend militanten Aktivitäten der Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Studentenunruhen in ganz Europa, die Freiheitsbestrebungen in den offeneren Staaten des damaligen Ostblocks, all das schien sich in den utopistischen Klängen des Free Jazz jener Jahre zu spiegeln. Eric Fillion, seines Zeichens Historiker und Musiker, widmet jetzt eine Studio genau diesen Verbindungen zwischen Jazz und Politik in Kanada am Beispiel der Gruppe Jazz Libre, die sich selbst im Quebec jener Jahre innerhalb der Autonomiebewegung verortete. Anhand der politisch-musikalischen Aktionen ihrer Mitglieder verdeutlicht er die verschiedenen Ausprägungen der Autonomiediskussionen in jenen Jahren zwischen der sogenannten “Stillen Revolution” und den militanteren Aktivitäten der Front de Libération du Québec. Knapp vorneweg: Dies ist sicher nicht das am leichtesten lesbare Buch über den Jazz. Laurent Cugny, Jazzfreunden bekannt als Pianist, der u.a. mit Gil Evans zusammengearbeitet hat. Zugleich ist er Musikwissenschaftler; seine vorliegendes Buch basiert auf seiner Dissertation zum selben Thema von 2001 und einem Buch in französischer Sprache von 2009. Da diese Veröffentlichung eine Übersetzung des 2009 bei Outre Mesure erschienenen Buchs ist, verweisen wir auf unsere Rezension vom Februar 2010, die auch für die englische Fassung gilt:
Knapp vorneweg: Dies ist sicher nicht das am leichtesten lesbare Buch über den Jazz. Laurent Cugny, Jazzfreunden bekannt als Pianist, der u.a. mit Gil Evans zusammengearbeitet hat. Zugleich ist er Musikwissenschaftler; seine vorliegendes Buch basiert auf seiner Dissertation zum selben Thema von 2001 und einem Buch in französischer Sprache von 2009. Da diese Veröffentlichung eine Übersetzung des 2009 bei Outre Mesure erschienenen Buchs ist, verweisen wir auf unsere Rezension vom Februar 2010, die auch für die englische Fassung gilt:













