[:de]Louis Armstrong
von Wolfram Knauer
Stuttgart 2010 (Reclam Verlag / Universal Bibliothek)
216 Seiten, 5,80 Euro
ISBN: 978-3-15-018717-3
 Hier mal keine Kritik sondern einfach ein Hinweis auf eine neue Reihe der legendären Reclam-Universal-Bibliothek, die sich einigen der großen Jazzmusiker widmet. Der erste Band dieser Reihe beschäftigt sich mit Leben und Werk Louis Armstrongs und versucht, seiner Biographie anhand seiner Musik näherzukommen. Der Autor ist “Yours Truly”, daher sei mit pseudo-kritischem Lob gespart und stattdessen einfach ein Statement desselben abgedruckt:
Hier mal keine Kritik sondern einfach ein Hinweis auf eine neue Reihe der legendären Reclam-Universal-Bibliothek, die sich einigen der großen Jazzmusiker widmet. Der erste Band dieser Reihe beschäftigt sich mit Leben und Werk Louis Armstrongs und versucht, seiner Biographie anhand seiner Musik näherzukommen. Der Autor ist “Yours Truly”, daher sei mit pseudo-kritischem Lob gespart und stattdessen einfach ein Statement desselben abgedruckt:
“Vor einigen Jahren veröffentlichte der Reclam-Verlag seine Reihe ‘Jazz-Klassiker’, herausgegeben von Peter Niklas Wilson, der die dafür verpflichteten Autoren bat, die Biographien der ihnen zugewiesenen Musiker entlang ihrer Musik zu beschreiben, allgemein verständlich und doch immer wieder mit den offenen Ohren des kritisch Zuhörenden. Ich durfte für die ‘Jazz-Klassiker’ einige Kapitel schreiben, vor allem über Musiker aus der frühen Zeitspanne der Jazzgeschichte. Vor zweieinhalb Jahren dann fragte der Reclam-Verlag an, ob ich nicht aus meinem Armstrong-Kapitel ein Buch für die neue Jazz-Biographien-Reihe des Verlags machen könnte. Die Anfrage kam etwa zeitgleich zu meiner Berufung auf die Louis Armstrong-Professur an der Columbia University in New York, eine Gastprofessorenstelle, die ich im Frühjahr 2008 innehatte und die aus dem Nachlass des Trompeters finanziert wurde. Wenn auch meine Professur außer dem Titel nichts mit Armstrong zu tun hatte (ich unterrichtete über ‘Jazz in Europe / European Jazz’), so sah ich in der Anfrage des Reclam-Verlags doch auch eine Chance, mich ganz persönlich zu bedanken für die große Ehre, und mich einmal mehr und noch intensiver in die Musik des Trompeters und Sängers einzuhören.
Das resultierende Buch soll damit nicht einfach nur ‘eine weitere Biographie’ Armstrongs sein, sondern sein Leben entlang seiner Musik nachzeichnen, denn wie in aller Kunst ist auch im Jazz das eine ohne das andere nicht vorstellbar: Die Lebensumstände bestimmen, wo es langgeht in der Musik, und die Musik erlaubt oft genug einen tiefen Einvlick in die Persönlichkeit des Musikers. In meiner Biographie Armstrongs versuche ich solche Bezugslinien aufzuzeigen, höre genau hin und versuche durch die erklingenden Töne hinter all das zu kommen, was man über den Trompeter weiß. Ich zeichne dabei das Bild eines bescheidenen Virtuosen, eines politik-bewussten Entertainers, eines volksnahen Stars, dem es selbst in den kitschigsten seiner Aufnahmen gelang, die Würde der musikalischen Eigenständigkeit zu bewahren. Ich erzähle sein Leben entlang der Geschichte des 20sten Jahrhunderts genauso wie entlang der Jazzgeschichte, beschreibe den Mythos, der ihn umgab, und vor allem seine improvisatorische Meisterschaft, die vor allem anderen stand und ihm und seiner Musik überall auf der Welt Freunde einbrachte.
Louis Armstrong ist so alt wie der Jazz. Geboren am 4. August irgendwann um 1900, war und blieb er bis heute das Markenzeichen der großen klassischen afroamerikanischen Musik, ein Mythos, den auch Uneingeweihte kennen und respektieren (‘What a Wonderful World’…). Ein Mensch, dessen Lebensgeschichte die Emanzipation der schwarzen Amerikaner verkörperte, dessen trompetenspiel die improvisierende Phantasie in die Musik zurückbrachte, dessen Ton und Swing im kulturellen Gedächtnis der Welt aufbewahrtliegt.”
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Unternehmerisches Kulturengagement am Beispiel der Musikförderung der Škoda Auto Deutschland GmbH
von Uwe Wagner
Leipzig 2013 (Leipziger Universitätsverlag)
138 Seiten, 28,00 Euro
ISBN: 978-3-86583-407-2
 Sponsoring wird zu einem immer wichtigeren Standbein kultureller Aktivitäten. Der Jazz hat es dabei scheinbar schwer, ist seine Hörerschaft doch weit individualistischer, weniger gruppenkonform zu klassifizieren als die anderer Genres. Er konkurriert zudem mit breiter verankerten Musikrichtungen und nicht zuletzt mit dem Sport um die Gunst der Sponsoren. Uwe Wagner will in seiner Studie die Grundlagen kulturellen Sponsorings genauso wie die Motivation für Unternehmen ergründen, sich im Kultursektor zu engagieren. In einem Fallbeispiel fragt dabei insbesondere nach der Attraktivität des Jazz für unternehmerische Kulturförderung.
Sponsoring wird zu einem immer wichtigeren Standbein kultureller Aktivitäten. Der Jazz hat es dabei scheinbar schwer, ist seine Hörerschaft doch weit individualistischer, weniger gruppenkonform zu klassifizieren als die anderer Genres. Er konkurriert zudem mit breiter verankerten Musikrichtungen und nicht zuletzt mit dem Sport um die Gunst der Sponsoren. Uwe Wagner will in seiner Studie die Grundlagen kulturellen Sponsorings genauso wie die Motivation für Unternehmen ergründen, sich im Kultursektor zu engagieren. In einem Fallbeispiel fragt dabei insbesondere nach der Attraktivität des Jazz für unternehmerische Kulturförderung.
In seinem begriffsklärenden Eingangskapitel unterscheidet Wagner zwischen Kultursponsoring, Mäzenatentum und Spendenwesen und stellt das Konzept der Corporate Cultural Responsibility vor. Er fragt nach Gründen, die Unternehmen haben könnten, sich in Kulturprojekte einzubringen, Gründe, die genauso markt- und markenbezogen sein können wie gesellschaftsbezogen oder auch ganz persönlich. Er nennt Beispiele für gelungene Sponsoringaktivitäten, bei denen sich eine Affinität zwischen Sponsor und unterstütztem Projekt findet.
Für die Musik gliedert er die Förderbereiche vor allem nach Kategorien der Professionalität, also Spitzenstars, “Leistungsebene” der Professionals sowie breite Basis der Laienmusik. Er nennt Beispiele musikalischen Sponsorings aus den Bereichen Klassik, Jazz und Pop und fragt bei all diesen Beispielen nach den möglichen Beweggründen. Er stellt verschiedene Modelle vor, die von der Förderung von Nachwuchskünstlern über Sachmittel bis hin zu eigener Veranstaltungstätigkeit reichen. Wichtig für eine beide Seite zufrieden stellende Kooperation sei die Einigkeit über die angezielte und die tatsächliche Zielgruppe. In einem Unterkapitel beschreibt Wagner dabei auch die Risiken unternehmerischer Förderung, die sowohl im Glaubwürdigkeitsverlust stecken, wenn nämlich Förderer und gefördertes Projekt nicht zusammenpassen, als auch in der ungewollten Substitution öffentlicher Mittel.
Den praktischen Teil seiner Arbeit widmet Wagner dann der Kulturförderung der Škoda Auto Deutschland GmbH. Er beschreibt die Förderkriterien des Konzerns, die bisherigen Förderbereiche und die unternehmerischen Erwartungen an eine Förderung im Kultursektor. Er beschreibt Škodas Aktivitäten im Jazzbereich und den Versuch einer internen Verankerung des kulturellen Engagements, also einer Identifikation auch der Mitarbeiter mit den geförderten Jazzprojekten. Einen Fokus legt er auf den Škoda-Jazzpreis als ein Best-Practice-Beispiel.
Recht nüchtern liest sich der Abgleich möglicher unternehmenspolitischer Ziele, wie er sie anfangs in seinem Buch diskutierte, mit der konkreten Jazzförderung durch Škoda. Insgesamt, stellt Wagner fest, nähme das Kultursponsoring in den letzten Jahren im Vergleich zur Förderung anderer Bereiche eher ab. Grundlage jeder kulturellen Partnerschaft in diesem Bereich, resümiert er, sei ein hohes Maß an Engagement von beiden Partnern.
Wagners Buch ist kein Leitfaden für Kultursponsoring, aber in seiner allgemeinen Analyse und anhand des von ihm gewählten Fallbeispiels ein wichtiges Buch, anhand dessen sich die Chancen genauso wie die Probleme einer Kulturpartnerschaft ablesen lassen. Die wissenschaftliche Herangehensweise erlaubt eine nüchterne Analyse der gegenseitigen Erwartungen und damit vielleicht tatsächlich eine Partnerschaft, die mehr ist als “Geldgeber hier, Künstler dort”.
Wolfram Knauer (Oktober 2013)
Stan Kenton. This Is an Orchestra!
von Michael Sparke
Denton/TX 2010 (University of North Texas Press)
345 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-57441-284-0
 Stan Kenton war sicher einer der umstritteneren Pianisten und Bandleadern der Jazzgeschichte. Sein Orchester gehörte zu den erfolgreichsten Bands der 1940er und 1950er Jahre; Kenton selbst ermutigte Arrangeure, avancierte Kompositionen zu realisieren, und half dadurch dabei mit, dem Jazz den Weg vom Ball- in den Konzertsaal zu ebnen. Nicht zuletzt beschäftigte er einige der einflussreichsten jungen Musiker, die aus der Arbeit in seiner Band heraus ihren Weg gingen.
Stan Kenton war sicher einer der umstritteneren Pianisten und Bandleadern der Jazzgeschichte. Sein Orchester gehörte zu den erfolgreichsten Bands der 1940er und 1950er Jahre; Kenton selbst ermutigte Arrangeure, avancierte Kompositionen zu realisieren, und half dadurch dabei mit, dem Jazz den Weg vom Ball- in den Konzertsaal zu ebnen. Nicht zuletzt beschäftigte er einige der einflussreichsten jungen Musiker, die aus der Arbeit in seiner Band heraus ihren Weg gingen.
Michael Sparke erzählt in diesem Buch die Geschichte Kentons von seiner Geburt wahrscheinlich im Februar 1912 (die Geburt wurde von der Familie vordatiert, um sie ehelich zu machen) bis zu seinem Tod im Jahre 1979. Der private Kenton bleibt dabei eher außen vor; denn Sparke geht es um den Bandleader. Sparke lässt die musikalische Karriere Kentons chronologisch Revue passieren. Sein erstes Kapitel beginnt gleich mit dem Engagement der Band im Renaissance Ballroom im kalifornischen Balboa im Jahr 1941. Weiter geht’s von Hollywood nach New York und durch die Jahre als Swing- und Tanzorchester. Wir lesen über die Arrangements von Pete Rugolo, über das Artistry of Rhythm-Orchestra, über die Vermarktung des “progressive jazz” und über Kentons riesige Erfolge im Europa der 1950er Jahre. Wir erfahren von Experimenten mit klassischem Repertoire oder lateinamerikanischer Musik, vom Neophonic Orchestra, dem eigene Plattenlabel, und Kentons Rock-Experimenten in den 1970ern. Sparke beleuchtet die verschiedenen Phasen seiner Entwicklung durch Erinnerungen der beteiligten Musiker und hinterfragt die veröffentlichten Alben in Hinblick auf kommerziellen Erfolg und musikalischen Gehalt.
Das liest sich fließend, gerade weil Sparke etliche Anekdoten einfließen lässt, doch auch etwas langatmig, weil das Buch sich zu stark von Album zu Album, von Tournee zu Tournee hangelt. Eine kritische Einordnung Kentons Musik in die Jazzgeschichte fehlt gänzlich, und so ist dies Buch vor allem ein Werk für Kenton-Liebhaber und -Sammler, die gewiss die eine oder andere anderswo nicht erwähnte Geschichte finden und sich freuen werden, Kentons Biographie so konzis und umfassend dargestellt zu sehen.
Wolfram Knauer (Juli 2013)
Jazz Icons. Heroes, Myths and the Jazz Tradition
von Tony Whyton
Cambridge 2010 (Cambridge University Press)
219 Seiten, 95 US-Dollar
ISBN: 978-0-52189-645-0
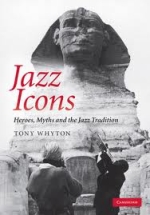 In der Jazzforschung spricht man seit einiger Zeit von “New Jazz Studies”, von analytischen, ästhetischen und soziologischen Herangehensweisen an den Jazz, die sowohl die Musik als auch ihren sozialen und gesellschaftlichen Kontext, die wirtschaftliche und politische Situation, die kritische Rezeption und alle möglichen anderen Facetten in Betracht zieht, statt sich auf singuläre Narrative zu beschränken.
In der Jazzforschung spricht man seit einiger Zeit von “New Jazz Studies”, von analytischen, ästhetischen und soziologischen Herangehensweisen an den Jazz, die sowohl die Musik als auch ihren sozialen und gesellschaftlichen Kontext, die wirtschaftliche und politische Situation, die kritische Rezeption und alle möglichen anderen Facetten in Betracht zieht, statt sich auf singuläre Narrative zu beschränken.
In seinem Buch “Jazz Icons” führt der britische Musikwissenschaftler Tony Whyton einige Beispiele solcher Ansätze vor, in Kapiteln, die vordergründig von den Großen des Jazz handeln, tatsächlich aber die konkreten Fragestellungen multidimensional angehen.
Er fragt nach der Wahrheit hinter der Genieästhetik, die im Jazz fast noch mehr zu gelten scheint als in der klassischen Musik des 19. Jahrhunderts. Er schaut auf die Musik John Coltranes und überlegt, welchen Einfluss diese auf Musiker bis in die Gegenwart hatte – nicht nur direkt, sondern auch indirekt, auf dem Umweg über seine ikonische Stellung in der Jazzgeschichte etwa oder über Jamey Aebersolds Play-A-Long-Platten.
Er hört sich Kenny Gs Version von Louis Armstrongs “What a Wonderful World” an, fragt nach Verehrung oder Sakrileg, aber auch nach Eigentum, Authentizität und dem gespaltenen Verhältnis des Jazz zur populären Musik. Er untersucht Impulse-Veröffentlichungen im Hinblick auf die Vermarktungsstrategien des Labels und ihren Einfluss auf den gegenwärtigen Jazz-Mainstream.
Er diskutiert, welche Bedeutung Musikeranekdoten für die Wahrnehmung, aber durchaus auch für die kritische Einordnung von Jazzgeschichte haben. Er blickt auf Duke Ellington als Beispiel einer besonders mythen-umrangten Ikone des Jazz und vergleicht unterschiedliche Sichtweisen auf den Meister, etwa durch die Brillen von Ken Burns, James Lincoln Collier oder David Hajdu.
Und schließlich betrachtet er die Folgen der Verschulung des Jazz, die nicht zuletzt einen besonderen Einfluss auf die Kanonisierung von Musikern und Aufnahmen hatte und diskutiert dabei Möglichkeiten, aus der Sackgasse festgefahrener Jazzpädagogik herauszugelangen.
“Jazz Icons” zeigt, wie sich Jazzgeschichte von Generation zu Generation mit den jeweils aktuellen analytischen Instrumenten neu aneignen, interpretieren und lesen lässt. Tony Whyton versucht, woran sich Jazzautoren allgemein ein Beispiel nehmen sollten: die sachlich-differenzierte Diskussion von Musik, ihren Ursachen und ihrer Wahrnehmung.
Wolfram Knauer (Juli 2013)
The Record. Contemporary Art and Vinyl
herausgegeben von Trevor Schoonmaker
Durham/NC 2010 (Nasher Museum of Art at Duke University)
216 Seiten, 29,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-938989-33-2
 Das Nasher Museum of Art zeigte 2011 eine Ausstellung über die Kulturgeschichte der Vinylschallplatte, bei der nicht nur Plattendesign im Vordergrund stand, sondern die gesamte Beziehung zwischen Bildender Kunst und Tonträgern. Der aus Anlass der Ausstellung veröffentlichte Katalog zeigt Künstler vor allem auf den letzten 50 Seiten die ausgestellten Werke und nennt ihre Künstler, nähert sich dem Thema selbst im Hauptteil außerdem in lesenswerten Aufsätzen und reich bebildert an.
Das Nasher Museum of Art zeigte 2011 eine Ausstellung über die Kulturgeschichte der Vinylschallplatte, bei der nicht nur Plattendesign im Vordergrund stand, sondern die gesamte Beziehung zwischen Bildender Kunst und Tonträgern. Der aus Anlass der Ausstellung veröffentlichte Katalog zeigt Künstler vor allem auf den letzten 50 Seiten die ausgestellten Werke und nennt ihre Künstler, nähert sich dem Thema selbst im Hauptteil außerdem in lesenswerten Aufsätzen und reich bebildert an.
Da geht es in einem einleitenden Kapitel um das augenfälligste, nämlich die Covergestaltung. Eine Timeline verfolgt die Geschichte der Schallplatte von 1857 bis in die Gegenwart. Pitr Orlov fragt, wie Schallplatten die Musik selbst veränderten; Mark Katz setzt sich mit der Leidenschaft von Plattensammlern auseinander; und Charles McGovern schaut auf den Plattenladen als “Home of the Blues, House of Sounds”. Carlo McCormick stellt fest, dass kaum ein Künstler in Stille arbeite und reflektiert über die Beziehungen zwischen Bildenden Künstlern und Musikkonserven. Mark Anthony Neal berichtet über die völlig neue und andere Sammelleidenschaft von Hip-Hop–DJs. Josh Kun betrachtet die Bedeutung der Schallplatte für die Kulturgeschichte Mexikos; Vivien Goldman tut dasselbe mit Bezug auf Jamaica. Jeff Chang beleuchtet die durch DJing und Soundmix veränderte Ästhetik seit den 1980er Jahren und Barbara London Do-It-Yourself-Produktionen in Musik und Bildender Kunst seit Fluxus.
In all diesen und weiteren Kapiteln des Buchs wird man von immer neuer Seite auf die kulturelle Selbstverständlichkeit der Schallplatte gestoßen, die man im Zeitalter von mp3 fast vergessen hat, die aber ein halbes Jahrhundert in seinem Kunstverständnis und -streben enorm prägte. Die im Buch abgedruckten Bilder, Fotos und Kunstwerke tun ein übriges, der Vinylplatte zum einen hinterherzutrauern, einen zum anderen aber auch dazu zu animieren sich umzusehen, welche Medien denn heute diese Funktion übernommen haben.
Wolfram Knauer (April 2013)
Ain’t Nothing Like the Real Thing. How the Apollo Theater Shaped American Entertainment
herausgegeben von Richard Carlin & Kinshasha Holman Conwill
Washington/DC 2010 (Smithsonian Books)
264 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-1-58834-269-0
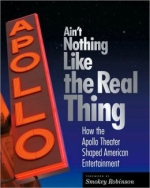 Das Apollo-Theater in Harlem ist immer noch lebendige Musikgeschichte. Es prägte die populäre Musik des 20sten Jahrhunderts wie wenige andere Spielstätten. Swinggrößen spielten hier genauso wie die Bebopper, der Rhythm ‘n’ Blues feierte Erfolge genauso wie etliche Rockstars, Soul und Funk erklangen auf der Bühne, Disco, Rap, HipHop und vieles mehr. Und natürlich begannen etliche spätere Stars bei den Amateur Hours, die jeden Mittwoch stattfanden, ihre Karriere.
Das Apollo-Theater in Harlem ist immer noch lebendige Musikgeschichte. Es prägte die populäre Musik des 20sten Jahrhunderts wie wenige andere Spielstätten. Swinggrößen spielten hier genauso wie die Bebopper, der Rhythm ‘n’ Blues feierte Erfolge genauso wie etliche Rockstars, Soul und Funk erklangen auf der Bühne, Disco, Rap, HipHop und vieles mehr. Und natürlich begannen etliche spätere Stars bei den Amateur Hours, die jeden Mittwoch stattfanden, ihre Karriere.
2010 stellte die Smithsonian Institution eine Wanderausstellung zusammen, in der Kostüme, Fotos, Erinnerungsstücke und vieles mehr zu sehen war, Dokumente einer 80jährigen Theatergeschichte. Die Ausstellung wurde begleitet vom vorliegenden Buch, dem es gelingt, die Bedeutung des Hauses noch weit eingehender zu beleuchten.
Da gibt es historische Einordnungen, etwa von David Levering Lewis über das frühe Harlem oder von Amiri Baraka über die Bedeutung des Stadtteils für die Black Consciousness der 1960er Jahre; da gibt es musik- und bühnenbezogene Kapitel, etwa von John Edward Hasse über die Hochzeit der Bigbands, von Willard Jenkins über Bebop und modernen Jazz, von Chris Washburne über die Latin-Szene, die hier eine Spielmöglichkeit fand, von Kandia Crazy Horse über Soul und Funk oder von David Hinckley über Rap und HipHop. Es gibt Erinnerungen an die Programmverantwortlichen, insbesondere Frank und Bobby Schiffman, Artikel über kultur- und gesellschaftsgeschichtliche Entwicklungen, die im Apollo ihren Widerhall fanden, seien es diverse Tanzarten, sei es die Bürgerrechtsbewegung. Es findet sich ein Kapitel über Afro-Amerikaner im II. Weltkrieg und eines über die Chorus-Girls auf der Bühne. Greg Tate beleuchtet James Browns Auftritte in Harlem, Karen Chilton erinnert an Bessie Smith, Willard Jenkins an Ella Fitzgerald, Herb Boyd an Aretha Franklin und Chris Washburne an Celia Cruz.
Das alles ist hinterlegt mit vielen, zum Teil seltenen Fotos, die das Apollo als Teil einer Stadtteilkultur genauso wie als Teil einer global ausstrahlenden Kulturszene zeigen. Besonders eindrucksvoll – in der Ausstellung genau wie im Buch –: die Karteikarten, auf denen Frank Schiffman seine recht offenen Einschätzungen über die engagierten Künstler notierte sowie die Gagen, die er ihnen zahlte oder zu zahlen bereit war.
“Ain’t Nothing Like the Real Thing” dokumentiert anschaulich ein wichtiges Kapitel afro-amerikanischer Kulturgeschichte. Bunt und swingend, funky und auf jeder Seite mitreißend, ein fokussierter und doch recht breiter Einblick in die schwarze Musik des 20sten Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (April 2013)
Jazz Matters. Sound, Place, and Time Since Bebop
von David Ake
Berkeley 2010 (University of California Press)
200 Seiten, 16,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-520-26689-6
 Jazzgeschichte genauso wie die meiste Kulturgeschichte ist in der Regel eine Geschichte der Meister. Misserfolge oder Mittelmäßigkeit schafften es selten in die Jazzgeschichtsbücher, obwohl sie und mit ihnen eben auch der Alltag recht viel über die Eingebundenheit des Jazz in die Gesellschaft aussagen. David Ake widmet sich in seinem Buch in Schlaglichtern Aspekten des Jazz, die von allgemeiner Jazzgeschichtsschreibung höchstens am Rande erwähnt werden, hält also die Lupe an konkrete Phänomene, die er dann von verschiedenen Seiten beleuchtet.
Jazzgeschichte genauso wie die meiste Kulturgeschichte ist in der Regel eine Geschichte der Meister. Misserfolge oder Mittelmäßigkeit schafften es selten in die Jazzgeschichtsbücher, obwohl sie und mit ihnen eben auch der Alltag recht viel über die Eingebundenheit des Jazz in die Gesellschaft aussagen. David Ake widmet sich in seinem Buch in Schlaglichtern Aspekten des Jazz, die von allgemeiner Jazzgeschichtsschreibung höchstens am Rande erwähnt werden, hält also die Lupe an konkrete Phänomene, die er dann von verschiedenen Seiten beleuchtet.
Im ersten Kapitel, überschrieben “Being (and Becoming) John Coltrane” etwa fragt er, was eigentlich Coltrane zu Coltrane macht, verfolgt die Aufnahmen des Saxophonisten über die Jahre und versucht zu beschreiben, was darin die subjektive Persönlichkeit Coltranes widerspiegelt.
Im zweiten Kapitel hört er sich Miles Davis’ “Old Folks” von 1961 genauer an und stolpert über ein Knarren bei 1:15, der Dielenboden des Studios, der Stuhl eines der Musikers? Warum dieses Knarren in der Studioaufnahme belassen wurde, ist kaum erkenntlich, hätte man doch auch 1961 keine Probleme gehabt, ein solches Geräusch herauszufiltern. Ake fragt den Wirkungen des Knarrens, das man, wenn überhaupt, wirklich nur im Hintergrund wahrnimmt, reflektiert über Live-Stimmung, Spontaneität, Authentizität. Bei einer früheren Aufnahmesitzung im selben Studio, klärt er später auf, machte Miles den Toningenieur auf die knarrenden Dielenbretter aufmerksam, worauf John Coltrane nur erwiderte: Mann, das ist halt ein Nebengeräusch. Das ist alles Teil des Stücks.”
Kapitel 3 betrachtet die Band Sex Mob des Trompeters Steven Bernstein und ihren Umgang mit Humor – oder, wie Ake dies nennt, dem Element des “Karnevalesken”. Kapitel 4 fragt nach Romantizismen, dem Image von Country im Jazz und konzentriert sich dabei auf ECM-Aufnahmen Keith Jarretts und Pat Methenys. In Kapitel 5 reflektiert Ake über die Veränderungen in der Jazzpädagogik und die Auswirkungen solcher Änderungen auf die Musik und den Markt. Im letzten Kapitel schließlich betrachtet er amerikanische Jazzmusiker in Paris und ihre Probleme damit, dort ihre nationale Identität beizubehalten. Mit ähnlichem Ansatz könnte man wahrscheinlich auch die Berliner Szene unserer Tage untersuchen.
Alles in allem, ein Buch ungewöhnlicher Ansätze, das – und ein größeres Lob ist kaum denkbar – Lust darauf macht, dem Jazz mit neuem Blick zu begegnen, auch deshalb, weil die ungewöhnliche Sicht unerwartete Facetten zum Vorschein bringt, solche der Musik genauso wie der eigenen Hörgewohnheit.
Wolfram Knauer (April 2013)
A Breath of Freedom. The Civil Rights Struggle, African American GIs, and Germany
von Maria Höhn & Martin Klimke
New York 2010 (Palgrave Macmillan)
254 Seiten, 2u US-Dollar
ISBN: 978-0-230-10474-0
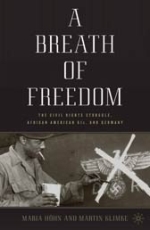 “A Breath of Freedom” handelt nicht einmal am Rande vom Jazz. “A Breath of Freedom” handelt, wie der Untertitel erklärt, vom “Bürgerrechtskampf, afro-amerikanischen GIs und Deutschland”, von der verqueren Situation also, das afro-amerikanische Soldaten im II. Weltkrieg (tatsächlich ja schon im I. Weltkrieg) für Freiheit und Demokratie kämpften, in ihrem eigenen Land aber nach wie vor die Rassentrennung herrschte.
“A Breath of Freedom” handelt nicht einmal am Rande vom Jazz. “A Breath of Freedom” handelt, wie der Untertitel erklärt, vom “Bürgerrechtskampf, afro-amerikanischen GIs und Deutschland”, von der verqueren Situation also, das afro-amerikanische Soldaten im II. Weltkrieg (tatsächlich ja schon im I. Weltkrieg) für Freiheit und Demokratie kämpften, in ihrem eigenen Land aber nach wie vor die Rassentrennung herrschte.
Maria Höhn und Martin Klimke untersuchen dabei die Zusammenhänge zwischen der langjährigen militärischen Präsenz der US-Streitkräfte in Deutschland und der Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten. Sie beschreiben die Vorurteile und das Bewusstwerden auf beiden Seiten, dass Bürgerrechte etwas Universelles seien und damit selbstverständlich auch schwarzen Amerikanern zustünden. Sie nennen politische und militärische Entscheidungen der 1940er bis 1970er Jahre und erklären die Realität der alltäglichen Lebenserfahrung innerhalb wie außerhalb der Kasernen in Deutschland. Sie fragen nach den gegenseitigen Einflüssen von Studentenbewegung in Europa und der Freiheitsbewegung in den USA, aber auch nach einer Art Verbrüderung antikapitalistischer Strömungen in Amerika mit dem System in der DDR.
Ihre faktenreiche Sammlung erklärt dabei viel über den Alltag afro-amerikanischer Soldaten in Deutschland. Über die Faszination des Jazz, jener für viele Amerikaner wie Nichtamerikaner wichtigsten afro-amerikanischen kulturellen Äußerung des 20sten Jahrhunderts, erzählen sie dabei nur wenig, was schade ist. Auf der anderen Seite verweisen sie im Vorwort darauf, dass dieses Buch nur die ersten Ergebnisse eines größeren Forschungsprojekts präsentiert.
Wer immer sich mit dem Einfluss der Präsenz afro-amerikanischer Soldaten und Musiker auf den deutschen Jazz befasst, wird in diesem Buch auf jeden Fall eine Menge Hintergrundinformation finden.
Wolfram Knauer (April 2013)
At the Jazz Band Ball. Sixty Years on the Jazz Scene
von Nat Hentoff
Berkeley 2010 (University of California Press)
246 Seiten, 40 US-Dollar (Hardcover), 21,95 US-Dollar (Paperback)
ISBN: 978-0-520-26113-6 (Hardcover), 978-0-520-26981-1 (Paperback)
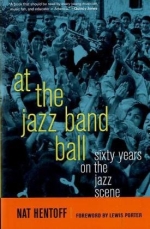 Es gibt Bücher, die liest man, weil man etwas lernen will, es gibt andere, die liest man, weil die Lektüre Spaß macht. Nat Hentoff gehört zu den seltenen Autoren, denen immer beides gelang: viel und wertvolle Information in einem Stil zu verpacken, der flüssig und lustvoll zu lesen ist.
Es gibt Bücher, die liest man, weil man etwas lernen will, es gibt andere, die liest man, weil die Lektüre Spaß macht. Nat Hentoff gehört zu den seltenen Autoren, denen immer beides gelang: viel und wertvolle Information in einem Stil zu verpacken, der flüssig und lustvoll zu lesen ist.
Sein neuestes Buch ist eine Sammlung bereits veröffentlichter – seinerzeit in der Jazz Times oder im Wall Street Journal erschienener – wie bislang noch nicht veröffentlichter Aufsätze zu allen möglichen Themen, die ihm am Herzen liegen: spezifische Musiker und ihr ästhetischer Gestaltungwille, die soziale Schieflage, in der Musiker, die alt sind oder in Not, keine Sicherheit haben, das Engagement einer Jazzszene, die sich glücklicherweise immer noch als Familie versteht, die Gleichberechtigung der Frau auch im Jazz, das Ende rassistisch bedingter Ausgrenzung und und und.
All diese Kapitel sind äußerst persönlich, mehr noch: Hentoff kennt nicht nur viele Menschen, er ist genuin an ihnen interessiert. Seine Gespräche mit Clark Terry oder Phil Woods, seine Erinnerungen an Duke Ellington oder Louis Armstrong, seine Meinung zur politischen Dimension dieser Musik, in Zeiten der Bürgerrechtsbewegung genauso wie heutzutage, seine Begeisterung nicht nur für die Heroen der Vergangenheit, sondern auch für junge Musiker, all das überträgt sich auf den Leser, der gern weiterblättert von einem zum nächsten Kapitel springt und dabei immer wieder mit neuen Facetten angestachelt wird nachdenklich zu bleiben.
64 solche Kapitel enthält das Buch und noch weit mehr Denkanstöße, sprachlich wunderbar umgesetzt, nirgends schulmeisterlich, überall voll von Erinnerung und Erzählwille. Höchst empfehlenswert!
Wolfram Knauer (März 2013)
Il libro della voce. Gli stile, le tecniche, I protagonisti della vovalità contemporanea internazionale
herausgegeben von Claudio Chianura & Leilha Tartari
Milano 2010 (Auditorium)
218 Seiten, 1 beigelegte CD, 38 Euro
ISBN: 978-88-86784-55-9
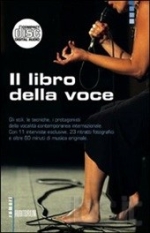 Die Stimme als Instrument – nicht erst im 20sten Jahrhundert wurde die scheinbar menschlichste musikalische Äußerung instrumental eingesetzt, aber insbesondere im 20sten Jahrhundert entwickelten Künstler und Komponisten die verschiedenen Techniken weiter, mit denen Verfremdung und Annäherung an den ureigenen Klang des Menschen und die ureigentliche Funktion der Stimme – die nämlich der Kommunikation – beeinflusst werden konnten.
Die Stimme als Instrument – nicht erst im 20sten Jahrhundert wurde die scheinbar menschlichste musikalische Äußerung instrumental eingesetzt, aber insbesondere im 20sten Jahrhundert entwickelten Künstler und Komponisten die verschiedenen Techniken weiter, mit denen Verfremdung und Annäherung an den ureigenen Klang des Menschen und die ureigentliche Funktion der Stimme – die nämlich der Kommunikation – beeinflusst werden konnten.
Das von Claudio Chianura und Leiha Tartari herausgegebene Buch nähert sich den Möglichkeiten stimmlicher Improvisation und stimmlichen Ausdrucks von verschiedenen Seiten: in einem ersten Teil theoretisch, nämlich in der Betrachtung unterschiedlicher vokaler Techniken und der dadurch verursachten allgemeinen Veränderung in der Wahrnehmung von Stimme; in einem zweiten Teil sehr individuell, nämlich in Interviews mit herausragenden Sängerinnen und Sängern, sowie in einem dritten Teil analytisch in der Betrachtung von speziellen Ansätzen einzelner Künstlerinnen und Künstler. Das alles ist insbesondere in der stilistischen Breite interessant, in der die Autoren das Thema angehen und dabei Greetje Bijma und Sidsel Endresen neben Benat Achiary oder Diamanda Galas stellen, Meredith Monk und David Moss neben Pamela Z und Demetrio Stratos.
Wem all diese Namen wenig sagen, der wird dankbar zur beiheftenden CD greifen, die 13 Beispiele bringt, von Kurt Schwitters’ “Sonate in Urlauten” und Tiziana Scanalettis “Stripsody” bis zu Beispielen der bereits genannten oder von Sainkho Namchylak, von Cristina Zavalloni oder Lorenzo Pierobon. Ein Lust machender Ausflug in die Welt der zeitgenössischen Vokalmusik.
Wolfram Knauer (März 2013)
Sardinia Jazz. Il jazz in Sardegna negli anni Zero. Musica, musicisti, eventi, discografia di base
von Claudio Loi
Cagliari 2010 (aipsa edizioni / percezioni musiche)
472 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-88 95692-26-5

Claudio Loi schreibt das “Who’s Who” des Jazz in Sardinien. Paolo Fresu, Antonello Salis, Paolo Angeli sind die Hauptfiguren; daneben aber kommen jede Menge Musiker und Band vor, von denen man hierzulande wahrscheinlich noch nie etwas gehört hat. Einleitungskapitel beschreiben die Jazzszene der zweitgrößten Insel Italiens, informieren aber auch regelmäßige Jazzevents und weiterführende Literatur. Sicher vor allem ein Buch für Eingeweihte, oder für regelmäßige Sardinien-Besucher.
Wolfram Knauer (Oktober 2012)
Vienna Blues. Die Fatty-George-Biographie
von Klaus Schulz
Wien 2010 (Album Verlag)
114 Seiten, 35 Euro
ISBN: 978-3-86184-182-0
 Der Klarinettist Fatty George spielte gern den Blues, und wenn er den Titel dann bei der österreichischen Urheberrechtsgesellschaft anmeldete, nannte er ihn “Vienna Blues” und trug den eigenen Namen als Urheber ein.
Der Klarinettist Fatty George spielte gern den Blues, und wenn er den Titel dann bei der österreichischen Urheberrechtsgesellschaft anmeldete, nannte er ihn “Vienna Blues” und trug den eigenen Namen als Urheber ein.
Clever, meint Klaus Schulz in seiner Biographie, die Leben und Werk des Klarinettisten in vier Teilen verfolgt.
Ein erster Teil gibt Franz Georg Presslers (so der volle Name) Lebensgeschichte in klassischem Gewand wieder: Kindheit, Ausbildung, erste Erfolge auf der österreichischen, dann der europäischen Jazzszene, diverse Bands und Aufnahmen über die Jahre, Gründung eines eigenen Spielorts.
Der zweite Teil geht das alles chronologisch genau und mit Interviewpassagen Georges sowie Zeitzeugenbeiträgen an. Hier bringt Schulz alle Daten und Details zusammen, Engagements, Reisen, Festivals, Platten- und Fernsehaufnahmen, Presseberichte, Korrespondenz, Fotos und Plakatabbildungen, persönliche Ereignisse und vieles mehr.
Teil drei enthält Biographien der Musiker, mit denen Fatty George über die Jahre zusammenarbeitete, Teil vier schließlich eine kurze Diskographie.
Akribisch zusammengetragen bietet sich dabei ein umfassendes Bild eines Ausnahmemusikers, der allzu oft als Dixielandklarinettist abgestempelt wird, obwohl er sich auch im Swing und modernen Jazz behaupten konnte, wie die beigeheftete CD mit seltenen und großteils unveröffentlichten Aufnahmen belegt, auf denen Fatty George neben seinen eigenen Besetzungen, der Ende der 1950er Jahre auch der junge Joe Zawinul angehörte, etwa auch mit dem Friedrich Gulda Workshop Ensemble zu hören ist, mit den ORF All-Stars, mit Lionel Hampton oder Sammy Price sowie mit seiner eigenen Besetzung, die eine Cool-Jazz-Version über “Alexander’s Ragtime Band” spielt.
Auch posthum noch einmal: Hut ab vor einem großen europäischen Jazzmusiker!
Wolfram Knauer (August 2012)
Fortællinger om jazzen. Dens vej gennem Statsradiofonien, Danmarks Radio og DR
von Tore Mortensen
Aalborn 2010 (Aalborg Universitetsforlag)
2010 Seiten, 295 Dänische Kronen
ISBN: 978-87-7307-983-6
 Unsere Nachbarn im Norden machen uns vor, was in hierzulande bislang noch nicht geleistet wurde, aber dringend notwendig wäre: eine Dokumentation der Jazzgeschichte im nationalen Rundfunk. Nun ist die deutsche Rundfunkgeschichte vielleicht etwas wechselvoller, in der Gegenwart auch vielgestaltiger als die in Dänemark, in dem es mit Danmarks Radio im Prinzip “nur” einen Staatsrundfunk gab, während im Nachkriegsdeutschland jede einzelne ARD-Anstalt ihre eigene Jazzredaktion aufbaute. Dennoch schauen wir ein wenig neidisch auf dieses Buch, dem es gelingt, den großen dänischen Bogen zu schlagen von 1925 bis ins Jahr 2009.
Unsere Nachbarn im Norden machen uns vor, was in hierzulande bislang noch nicht geleistet wurde, aber dringend notwendig wäre: eine Dokumentation der Jazzgeschichte im nationalen Rundfunk. Nun ist die deutsche Rundfunkgeschichte vielleicht etwas wechselvoller, in der Gegenwart auch vielgestaltiger als die in Dänemark, in dem es mit Danmarks Radio im Prinzip “nur” einen Staatsrundfunk gab, während im Nachkriegsdeutschland jede einzelne ARD-Anstalt ihre eigene Jazzredaktion aufbaute. Dennoch schauen wir ein wenig neidisch auf dieses Buch, dem es gelingt, den großen dänischen Bogen zu schlagen von 1925 bis ins Jahr 2009.
Tore Mortensen, seiens Zeichens Leiter des Center for Dansk Jazzhistorie in Aalborg, beginnt am 1. April 1925, als der staatliche Rundfunk in Dänemark sein erstes Radiosignal ausstrahlte. Als “Staatsradifonien” bezeichnete sich der Sender bis 1959, dann wurde er erst in “Danmarks Radio”, schließlich 1996 in “DR” umgetauft. Mortensens Buch dokumentiert die Jazzaktivitäten etwa des Radio-Tanzorchesters unter Leitung des Geigers Louis Preil, die Sendeverbote “negroider Tanz- und Unterhaltungsmusik” unter der deutschen Besatzung sowie die rasche und recht intensive Zurückeroberung der Ätherwellen durch den Jazz in der Nachkriegszeit. Mortensen listet die konkreten Sendungen, die zwischen September 1947 und Januar 1953 ausgestrahlt wurden, und die ihrerseits das Interesse am Swing, an modernen Stilarten oder an Aktivitäten sonstwo in Europa widerspiegeln. Er dokumentiert die Konzertaktivitäten des Senders in den 1950er Jahren, untermauert von Zeitzeugen wie dem Bassisten Erik Moseholm oder dem Moderator Børge Roger. Die 60er Jahre seien die goldenen Jahre des Jazz im dänischen Rundfunk gewesen, titelt Mortensen, skizziert nebenbei die Arbeit des dänischen Jazzhistorikers Erik Wiedemann und spricht mit Torben Ulrich, Peter Rasmussen und anderen, die dabei gewesen waren. Seit 1963 schnitt Danmarks Radio regelmäßig im Kopenhagener Jazzclub Montmartre mit, seit 1966 gab es regelmäßige Sonderproduktionen unter dem Titel “Radiojazzgrupppe”, später mit der Radioens Big Band.
In diesen Jahren ist Jazz in Dänemark auch im Fernsehen zu erleben. Etliche amerikanische Musiker hatten sich in den 1960er Jahren in Kopenhagen niedergelassen, unter ihnen etwa Dexter Gordon oder Duke Jordan. Jazz spielte auch nach 1975 eine wichtige Rolle im dänischen Rundfunk, dem Mercer Ellington 1984 seine private Tonbandsammlung vermachte. Thad Jones übernahm 1977 die Leitung der Radioens Big Band. Ein Unterkapitel des Buchs behandelt das Verhältnis des Senders zum Kopenhagener Jazzfestival, ein weiteres den Wandel in seinen Aufgaben im neuen Jahrtausend von denen einer Kulturinstitution zu jenen eines Multimedienanbieters. Als Anhang gibt es schließlich eine tabellarische Übersicht über die verschiedenen Aktivitäten des Senders, über wichtige Sendeformate, Produktionen und Mitarbeiter.
Eine Bibliographie sowie ein ausführlicher Index beschießen das Buch, das, es sei noch einmal gesagt, einen ein wenig neidisch in den Norden blicken lässt. Vielleicht findet sich ja hierzulande irgendwann mal jemand, der mit Berendts SWR anfängt; vielleicht gibt es einmal eine ausführliche Dokumentation der Aktivitäten des NDR oder der Berliner Produktionen. Bernd Hoffmann, Jazzredakteur des WDR, hat ein ausgeprägtes historisches Bewusstsein und sammelt sicher bereits Material, um ähnliches für den Kölner Sender zu bewerkstelligen – alles Anstalten, die nicht nur rege redaktionelle Tätigkeiten aufweisen, sondern genau wie DR Eigenproduktionen machten, eine regionale, nationale wie internationale Szene dokumentierten und zumeist eigene (Groß-)Ensembles besitzen, die mit zu den besten weltweit gehören.
Wer übrigens des Dänischen nicht ganz so mächtig ist, der wird dennoch seine Freude an den wunderbaren Fotos von Jan Persson haben, die oft genug während Produktionen von Danmarks Radio aufgenommen wurden. Sein Bildarchiv gehört heute dem Jazz for Dansk Jazzhistorie, das zugleich Initiator und Herausgeber des vorliegenden Buchs ist.
Wolfram Knauer (August 2012)
Singing Out. An Oral History of America’s Folk Music Revivals
von David King Dunaway & Molly Beer
New York 2012 (Oxford University Press)
255 Seiten, 27,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-989656-1
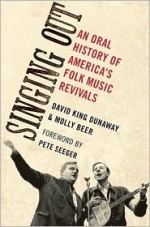 Das Folk Music Revival wird allgemein in die 1960er Jahre datiert; es beeinflusste die populäre Musik auf unterschiedlichste Art und Weise. Bob Dylan und Janis Joplin haben dieser Bewegung genauso viel zu verdanken wie auf der anderen Seite des Atlantiks die Beatles oder die Rolling Stones, wobei bei letzteren eher der Bluesteil der Folkszene von Bedeutung war. Die Anfänge des Folk-Revivals aber finden sich bereits in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren, wie das vorliegende Buch dokumentiert. David King Dunaway und Molly Beer haben dafür Zeitzeugen befragt und ihre Berichte nach Themen sortiert.
Das Folk Music Revival wird allgemein in die 1960er Jahre datiert; es beeinflusste die populäre Musik auf unterschiedlichste Art und Weise. Bob Dylan und Janis Joplin haben dieser Bewegung genauso viel zu verdanken wie auf der anderen Seite des Atlantiks die Beatles oder die Rolling Stones, wobei bei letzteren eher der Bluesteil der Folkszene von Bedeutung war. Die Anfänge des Folk-Revivals aber finden sich bereits in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren, wie das vorliegende Buch dokumentiert. David King Dunaway und Molly Beer haben dafür Zeitzeugen befragt und ihre Berichte nach Themen sortiert.
Dabei geht es etwa um die Definition von Folk Music ganz allgemein (für das “Volksmusik” ein schlechte Übersetzung ist) und um Grenzziehungen – sind also Folk Music nur englische Seemannslieder, oder gehören auch Calypso, Bluegrass, Flamenco, Cajun, Zydeco, Rap dazu? Wie unterscheidet sich die Definition von Folkmusik innerhalb und außerhalb des beschriebenen Revivals? Und wie verhält sich Folk Music zum politischen Song?
Das zweite Kapitel betrachtet frühe Sammler authentischer amerikanischer Volksmusik, fragt dabei auch danach, wem diese Musik gehört. Alan Lomax und Leadbelly erhalten ein eigenes Teilkapitel. Die Einbindung des Folk Music Revival in politische Agenden spielt eine Rolle im dritten Kapitel, das überschrieben ist mit “Music for the Masses” und in dem es auch um die Linke im Amerika der 1930er und 1940er Jahre geht.
In den 1940er Jahren fand das Revival vor allem in Greenwich Village, New York statt, dem das vierte Kapitel gewidmet ist. Zugleich, berichten die Zeitzeugen, hatte New York und seine Weltläufigkeit aber auch Einfluss auf ihre eigene musikalische Ästhetik. Ende der 1940er Jahre fielen viele der linken Folk-Revivalisten ins Raster der “Rotenjagd” McCarthys, und das Kapitel über die Verhöre, Verdächtigungen und Arbeitssperren ist vielleicht eines der bedrückendsten des Buchs. Mitte der 1950er Jahre dann folgte ein breites Folk-Revival, ein Boom, der sowohl die romantische wie auch die politischen Varianten der Folk Music einschloss und im Newport Folk Festival sowie den Karrieren von Bob Dylan und Janis Joplin mündete. Folk Music wurde Teil der Bürgerrechtsbewegung, die “We Shall Overcome” zu ihrer Hymne erkor.
Ein eigenes Kapitel ist dem Folk-Rock der späten 1960er Jahre gewidmet, ein weiteres dem “Nu-Folk” der jüngsten Vergangenheit. Wie wird die Folk Music der Vereinigten Staaten in Zukunft aussehen?, fragen die Autoren zum Schluss, sind dabei aber keinesfalls pessimistisch, sondern glauben daran, dass es weiter gehen wird. Und wie zum Beweis fügen sie noch ein letztes Kapitel an, “The Power of Music”, in dem sie Beispiele nennen, wie Musik die Welt verändern kann.
Alles in allem: ein gut lesbares Erinnerungsbuch an eine Bewegung, die durchaus auch für den Jazz von Bedeutung war, auch wenn Jazzer im Personenindex kaum Eingang gefunden haben. Billie Holidays “Strange Fruit” jedenfalls verband die Ideale der Folk- und der Jazzszene genauso wie einige der Bluesmusiker, die in Barney Josephsons “Café Society” in New York auftraten. Die Zeitzeugenberichte dieses Buchs geben einen guten Einblick in die Hintergründe des Interesses an einer ureigenen authentischen Folk Music in Amerika.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
The Penguin Jazz Guide. The History of the Music in the 1001 Best Albums
von Brian Morton & Richard Cook
London 2010 (Penguin Books)
730 Seiten, 20 Britische Pfund
ISBN: 978-0-141-04831-4
 Der Jazz ist eine schier unübersichtliche Musik – so viele Stile, so viele Entwicklungen, so lange Geschichte, so viele Aufnahmen. Für den Novizen wird es schwer, da noch durchzublicken. Und so bietet es sich an, dass immer wieder Bücher erscheinen, die dem werdenden Jazzfan Tipps geben, was er vielleicht auch noch hören könnte. Der Penguin Jazz Guide ist ein bisschen wie die Urmutter umfangreicher Plattenempfehlungen. Er erschien erstmals 1990, als niemand wusste, ob die CD die Zukunft oder der Tod der Schallplattenindustrie sein würde, und seine neueste Ausgabe erscheint in einer Zeit, in der es ungewiss ist, ob das Konzept des Jazzalbums in Zeiten des Internet-Downloads überhaupt noch eine Zukunft hat.
Der Jazz ist eine schier unübersichtliche Musik – so viele Stile, so viele Entwicklungen, so lange Geschichte, so viele Aufnahmen. Für den Novizen wird es schwer, da noch durchzublicken. Und so bietet es sich an, dass immer wieder Bücher erscheinen, die dem werdenden Jazzfan Tipps geben, was er vielleicht auch noch hören könnte. Der Penguin Jazz Guide ist ein bisschen wie die Urmutter umfangreicher Plattenempfehlungen. Er erschien erstmals 1990, als niemand wusste, ob die CD die Zukunft oder der Tod der Schallplattenindustrie sein würde, und seine neueste Ausgabe erscheint in einer Zeit, in der es ungewiss ist, ob das Konzept des Jazzalbums in Zeiten des Internet-Downloads überhaupt noch eine Zukunft hat.
Nichtsdestotrotz haben sich Brian Morton und Richard Cook, zwei der ausgewiesendsten britischen Jazzkenner, hingesetzt und eine Empfehlungsliste zusammengestellt. Im Jahr 2010 sind das oft keine Besprechungen einzelner Titel oder Alben mehr, da historische Meilensteile wie King Olivers Creole Jazz Band oder Louis Armstrongs Hot Five und Hot Seven längst in alle Aufnahmen versammelnden Box-Sets erschienen sind, die von den beiden genauso empfohlen werden wie ähnliche “complete recordings” späterer Musiker. Wie meist bei solchen Werken ist die Suche nach den fehlenden Aufnahmen nicht sehr sinnvoll weil eine nur subjektive Einschätzung. Anders als bei reinen Plattenrezensionen geben die Autoren jeder empfohlenen Platte eine kurze Beschreibung der vorgestellten Musiker vorweg, um dann auf Besonderheiten des spezifischen Albums einzugehen, die erklären, warum es den Platz unter den 1001 Alben gefunden hat.
Der Löwenanteil der Alben stammt aus den USA, erst ab den 1960er Jahren sind mehr und mehr europäische Musiker unter den Empfohlenen zu finden. Und die jüngsten Entscheidungen, also für die Jahre 2000 bis 2010, scheinen von den Autoren weit willkürlicher gefällt worden zu sein als zuvor – aber das ist verständlich, denn erst die Zeit wird zeigen, wie wegweisend, wie wichtig und bedeutend diese Alben denn nun wirklich waren.
“The Penguin Jazz Guide” wendet sich in seinen knappen Albumsrezensionen aber nicht nur an den Jazzneuling, sondern ausdrücklich auch an den Jazzkenner, der seine eigene Einschätzung am Lob der beiden Autoren messen mag und sicher die eine oder andere Aufnahme entdecken wird, die ihm bislang entgangen war, die es aber wert ist zu besitzen (und mehr noch: zu hören).
Wolfram Knauer (April 2012)
Fra Odd Fellow til East Park. Jazz i Aalborg, 1920-1970
von Knud Knudsen & Ole Izard Høyer & Tore Mortensen
Aalborg 2010 (Aalborg Universitetsforlag)
143 Seiten, 299 Kronen
ISBN: 978-87-7307-994-2
 Lokalgeschichten des Jazz in Europa handeln meist von ähnlichen Aktivitäten: der Faszination am Jazz als einer fast schon exotischen Musik in den 1920er Jahren, einer städtischen Musikszene zur Unterhaltung des bürgerlichen Publikums, dem steigenden Interesse der Musiker an der improvisatorischen Ausdrucksform des Jazz, dem Ankommen des Jazz in der Mitte der Gesellschaft und dem Neuerfinden dieser Musik nach dem II. Weltkrieg als zeitweiser Ausdrucksform der Jugend.
Lokalgeschichten des Jazz in Europa handeln meist von ähnlichen Aktivitäten: der Faszination am Jazz als einer fast schon exotischen Musik in den 1920er Jahren, einer städtischen Musikszene zur Unterhaltung des bürgerlichen Publikums, dem steigenden Interesse der Musiker an der improvisatorischen Ausdrucksform des Jazz, dem Ankommen des Jazz in der Mitte der Gesellschaft und dem Neuerfinden dieser Musik nach dem II. Weltkrieg als zeitweiser Ausdrucksform der Jugend.
Die dänische Hafenstadt Aalborg also hat eine durchaus ähnliche Jazzgeschichte aufzuweisen, wie die drei Autoren des aufwendig gestalteten Bandes dokumentieren. Erste Erwähnung jazzmusikalischer Aktivitäten finden sie im November 1922, als im Odd Fellow Palæet ein Jazzkonzert angekündigt wird. Die Autoren durchwühlen alte Tageszeitungen, Programmankündigungen, Konzertbesprechungen. Anfang der 1930er Jahre machten die ersten amerikanischen Stars in Dänemark Station, im Kopenhagener Tivoli konnte man Louis Armstrong hören, und Joe Venuti beeinflusste 1934 den blutjungen Svend Asmussen. Auch dänische Jazzgrößen, Kai Ewans etwa, Leo Mathisen oder Peter Rasmussen und andere waren regelmäßig zu Gast.
Nach dem Krieg wurde Jazz auch in Dänemark von der Tanzmusik immer mehr zur Hörmusik. 1951 gründete sich ein Jazzclub, der mit regelmäßigen Veranstaltungen und Sessions an die Öffentlichkeit ging. Die britischen Trad-Bands tourten Dänemark und beeinflussten den dänischen Dixieland. Im Januar 1959 kam Louis Armstrong in die Stadt, und auch andere Jazzgrößen waren zu hören. 1955 schließlich gründete sich der East Park Jazzclub, dessen Konzerte ein jugendliches Publikum erreichten.
“Frau Odd Fellow til East Park” erzählt die Geschichte dieser Aalborger Jazzszene zwischen den frühen 1920er und späten 1960er Jahren. Das Buch enthält viele seltene Fotos von Musikern und Veranstaltungsorten, außerdem einige Ausrisse aus zeitgenössischen Berichten. Sicher wendet sich das Buch an eine auch regional begrenzte Leserschaft (dänische Sprachkenntnisse sind Voraussetzung), ist damit aber ein willkommenes weiteres Puzzleteilchen zu einer europäischen Jazzgeschichte.
Wolfram Knauer (April 2012)
Blue Note Records. A Guide for Identifying Original Pressings
von Frederick Cohen
New York 2010 (Jazz Record Center)
112 Seiten, 45 US-Dollar
ISBN: 978-0-692-00322-0
 Der Jazzplattensammler ist ein Phänomen für sich – in seiner Ernsthaftigkeit, seinem Vollständigkeitswahn genauso wie in der Expertise, die ihn im besten Fall zum Diskographen macht, ein Fachgebiet, das ihm in anderen Musikbereichen wahrscheinlich zu einem akademischen Grad verhelfen würde. Der sympathische Jazzplattensammler ist der, der durch die Welt reist, in Plattenläden geht und dann mit offenen Augen sowohl nach Neuentdeckungen sucht als auch nach Platten, die seine eigene Sammlung, seine eigenen Sammlungsinteressen vervollständigen. Die Musik steht für ihn im Mittelpunkt, daneben aber auch die Authentizität des Tonträgers selbst, der möglichst ein Original sein sollte, gar nicht unbedingt aus Wertgründen, sondern einfach, weil es ihn mehr reizt, eine Erstausgabe in den Händen zu halten. Der skurrile Jazzplattensammler ist jener, der sämtliche Plattennummern im Kopf hat, durchaus auch Besetzungen und Aufnahmedaten, der über dem Sammlungswahn aber vergessen hat, dass Platten eigentlich Musik transportieren, so dass er seine Platten im Extremfall gar nicht auflegt, weil bereits einmaliges Abspielen den Wert der Platten mindern könnte.
Der Jazzplattensammler ist ein Phänomen für sich – in seiner Ernsthaftigkeit, seinem Vollständigkeitswahn genauso wie in der Expertise, die ihn im besten Fall zum Diskographen macht, ein Fachgebiet, das ihm in anderen Musikbereichen wahrscheinlich zu einem akademischen Grad verhelfen würde. Der sympathische Jazzplattensammler ist der, der durch die Welt reist, in Plattenläden geht und dann mit offenen Augen sowohl nach Neuentdeckungen sucht als auch nach Platten, die seine eigene Sammlung, seine eigenen Sammlungsinteressen vervollständigen. Die Musik steht für ihn im Mittelpunkt, daneben aber auch die Authentizität des Tonträgers selbst, der möglichst ein Original sein sollte, gar nicht unbedingt aus Wertgründen, sondern einfach, weil es ihn mehr reizt, eine Erstausgabe in den Händen zu halten. Der skurrile Jazzplattensammler ist jener, der sämtliche Plattennummern im Kopf hat, durchaus auch Besetzungen und Aufnahmedaten, der über dem Sammlungswahn aber vergessen hat, dass Platten eigentlich Musik transportieren, so dass er seine Platten im Extremfall gar nicht auflegt, weil bereits einmaliges Abspielen den Wert der Platten mindern könnte.
Der Sonderfall der Jazzplattensammler ist der “Blue-Note-Sammler”, und an diesen richtet sich dieses Buch. Frederick Cohen besitzt den größten Jazzplattenladen in New York, ein Mekka für Sammler aus aller Welt. In seiner täglichen Arbeit kam es ihm immer wieder unter, dass Kunden den Wert der Schallplatten in seinen Regalen anzweifelten, also in Frage stellten, ob es sich bei einer Platte auch wirklich um ein Original handelt? Das Label auf der einen Seite der Platte sah beispielsweise anders aus als das auf der anderen Plattenseite, die Firmenadresse auf dem Cover war eine andere als die auf den Labels. Über die Jahre sammelte Cohen die unterschiedlichen Merkmale der Blue-Note-Scheiben und erstellte einen Katalog untrüglicher Charakteristika, den er jetzt im eigenen Verlag vorlegt.
Das Buch beginnt mit einer Erklärung der Fachbegriffe, die für die Beschreibung von Schallplatten nötig sind. Cohen zeigt anhand von Fotos die verschiedenen Vorkommnisse des “Plastylite”-Symbols “P” auf der Vinylscheibe, das eines der wichtigsten Merkmale eines Originals ist. Er zeigt die unterschiedlichen Varianten der Adressdarstellung auf dem Label wie auf dem Cover, Varianten des Mono- und des Stereo-Logos (bzw. Stickers). Dann dekliniert er im umfangreichsten kapitel die unterschiedlichen Serien durch und beschreibt dabei ihre Besonderheiten.
Ein eigenes Kapitel widmet sich Rudy Van Gelders Kommentaren über seine Mono- und Stereoaufnahmen. In weiteren Kapiteln fasst Cohen die Veröffentlichungen nach Jahren zusammen, beschreibt die originalen inneren Schüutzhüllen und führt schließlich einige der seltesten Raritäten des Blue-Note-Labels vor.
Cohens Buch ist zu allererst ein Must-Have für Blue-Note-Sammler (von denen es nicht gerade wenige gibt). Es ist zugleich ein Musterbeispiel für diskographische Grundlagenforschung ganz anderer Art – bei ihm geht es ja nicht um Besetzungen, Titel oder Aufnahmedaten, sondern um den Tonträger und seine Verpackung, die er einer genauen Analyse unterzieht. Und zu allerletzt ist es ein unverzichtbares Referenzwerk für diejenigen, die Schallplatten als Wertanlage sammeln.
Wolfram Knauer (April 2012)
40 Jahre Internationales Dixieland Festival Dresden. Die Elbestadt swingt und brilliert, ist bluesvoll und populär
von Wolfgang Grösel & Joachim Schlese & Klaus Wilk
Dresden 2010 (Edition Sächsische Zeitung)
205 Seiten, 9,90 Euro
ISBN: 978-3-938325-73-5
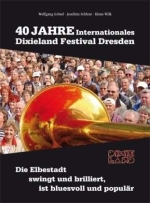 Am Pfingstwochenende 1971 begann in Dresden die Geschichte eines Festivals, das mittlerweile europaweit Kultstatus erlangt hat. Die Organisatoren wagten eine stilistische Beschränkung ihres Programms auf eine eng umgrenzte historische Jazzrichtung, den Dixieland zwischen New-Orleans-, Chicago-, Eddie-Condon- und europäischem Trad-Jazz. 1979 kamen bereits 30.000 Besucher, 1981 waren 200 Jazzmusiker aus Europa und (erstmals) den USA mit von der Partie.
Am Pfingstwochenende 1971 begann in Dresden die Geschichte eines Festivals, das mittlerweile europaweit Kultstatus erlangt hat. Die Organisatoren wagten eine stilistische Beschränkung ihres Programms auf eine eng umgrenzte historische Jazzrichtung, den Dixieland zwischen New-Orleans-, Chicago-, Eddie-Condon- und europäischem Trad-Jazz. 1979 kamen bereits 30.000 Besucher, 1981 waren 200 Jazzmusiker aus Europa und (erstmals) den USA mit von der Partie.
Das vorliegende Buch dokumentiert zum 40jährigen Jubiläum die Geschichte des Festivals, das damit quasi auf eine gleichlange DDR- wie BRD-Zeit zurückblicken kann. Neben den Publikumserfolgen werden auch die Krisenjahre kurz gestreift, das Jahr 1990 etwa, als zum 20. Jubiläum kein einziges Konzert ausverkauft war, weil die Menschen lieber in den nun offen stehenden Westen reisten als nach Dresden. Politik bleibt ansonsten eher außen vor in dieser Festschrift, in der man vielleicht gern etwas über die offizielle Haltung der DDR-Staatsführung zum Festival erfahren hätte, darüber, welche politische Agenda das Festival ermöglichte, welche Probleme oder auch welche Unterstützung es bei Einladungen an Bands aus dem Ausland gab, welche außermusikalischen Konnotationen sich bei den Besuchern mit der Veranstaltung verband.
Aber das ist vielleicht zu viel verlangt oder auch am Ziel des Buchprojekts vorbei erwartet: “40 Jahre IDF” ist vor allem ein Geschenk der Dixieland-Festival-Freunde an sich selbst, und da mag eine tiefere Beschäftigung mit eigener Geschichte vielleicht nicht so angesagt sein. Ein wenig schade ist das schon, aber dem Ziel des Buchs nach verständlich: Mit vielen bunten Fotos und einer freien Doppelseite für Autogramme ist es in erster Linie eine Art Erinnerungsalbum für die Fans.
Wolfram Knauer (April 2012)
Sun Ra. Interviews & Essays
herausgegeben von John Sinclair
London 2010 (Headpress)
201 Seiten, 13,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-900486-72-9
www.headpress.com
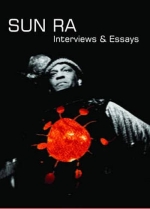 Sun Ra besaß bekanntlich Kultstatus. Und so ist es nicht verwunderlich, das in sich Veröffentlichungen dem Pianisten, Komponisten und Bandleader ganz ähnlich nähern, wie der sein Publikum zu begeistern pflegte: von allen Seiten, mit allen Sinnen, mit unerwarteten Klängen.
Sun Ra besaß bekanntlich Kultstatus. Und so ist es nicht verwunderlich, das in sich Veröffentlichungen dem Pianisten, Komponisten und Bandleader ganz ähnlich nähern, wie der sein Publikum zu begeistern pflegte: von allen Seiten, mit allen Sinnen, mit unerwarteten Klängen.
John Sinclairs Buch enthält vor allem Erinnerungen von Zeitzeugen, die Sun Ra im Konzert erlebten, ihn persönlich kannten oder gar mit ihm spielten. Ausgangspunkt ist ein Interview, das der “White Panther” und “poet-provocateur” Sinclair selbst 1966 mit Ra führte, und in dem dieser seine Philosophie… nun, vielleicht nicht gerade erklärt, aber umschreibt, und dabei im Verklären dann doch wieder etliches erklärt.
David Henderson erinnert sich an die Zeit in den 1960ern, als Ra auf der Lower East Side Manhattans lebte und eigentlich die afro-amerikanische Revolution vorlebte, die andere auf den Straßen erkämpfen wollten. Wir lesen Amiri Barakas Gedicht “Word from Sun Ra”, und Lazaro Vega spricht mit dem Dichter über Ras Bedeutung für die schwarze amerikanische Musik.
Ben Edmonds betitelt seine Erinnerungen an ein Sun-Ra-Konzert sehr treffend mit “Their Space Was My Place”. Der Trompeter Michael Ray berichtet über seine Zeit im Arkestra, und der Baritonsaxophonist Rick Steiger erinnert sich an eine Residenz des Arkestra in Detroit im Dezember 1980.
Peter Gershon reflektiert darüber, wie Marshall Allen die Ästhetik Sun Ras ins 21ste Jahrhundert transportiert. Darüber hinaus finden sich Interviews mit Musikern, deren Ästhetik durch Ras Musik stark beeinflusst wurde, Wayne Kramer etwa, Jerry Dammers und Sadiq Bey. Haf-fa Rool schließlich berichtet davon, wie er das Arkestra (als Nicht-Musiker) auf verschiedenen Europatourneen begleitet hatte.
Der zusammenhängende Faden aller Beiträge und Interviews ist die Kunst und der Einfluss Sun Ras, der schon manchmal etwas stark als der “Creator” persönlich rüberkommt – aber so war es eben, das Mysterium des Sun Ra. Sinclairs Buch endet mit einem Nachruf, den der Autor nach dem Tod des Bandleaders in der New Orleans Times-Picayune veröffentlicht hatte. Hier konzentriert er sich noch einmal auf die Erden-Seite des Pianisten, der daneben aber eben doch so viel mehr war… und dessen ästhetische Wirkung in vielen Bereichen von Musik und Kunst bis heute zu spüren ist.
Wolfram Knauer (März 2012)
Portrait Saxofon. Kultur, Praxis, Repertoire, Interpreten
Von Ralf Dombrowski
Kassel 2010 (Bärenreiter Verlag)
166 Seiten, 27,50 Euro
ISBN: 978-3-7618-1840-4
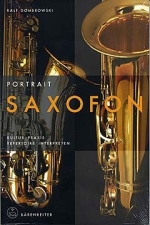 Adolphe Sax erfand das Saxophon 1841 als eine Art Klangzwitter zwischen den üblichen Holzblas- und den Streichinstrumenten. Hector Berlioz war der erste klassische Komponist, der für das neue Instrument schriebt; bald darauf übernahmen französische Militärkapellen das Instrument in ihre Instrumentierung, doch diese französische Vorliebe dauerte nur eine kurze Weile. Sax und seinem Schüler Eduard Lefèbvre gelang es allerdings, das Instrument in den USA populär zu machen. Der Rest ist Jazzgeschichte, möchte man meinen, und so ist es auch im Buch, das Ralf Dombrowski diesem neben der E-Gitarre vielleicht klang-bestimmendsten Instrument des 20. Jahrhunderts widmet.
Adolphe Sax erfand das Saxophon 1841 als eine Art Klangzwitter zwischen den üblichen Holzblas- und den Streichinstrumenten. Hector Berlioz war der erste klassische Komponist, der für das neue Instrument schriebt; bald darauf übernahmen französische Militärkapellen das Instrument in ihre Instrumentierung, doch diese französische Vorliebe dauerte nur eine kurze Weile. Sax und seinem Schüler Eduard Lefèbvre gelang es allerdings, das Instrument in den USA populär zu machen. Der Rest ist Jazzgeschichte, möchte man meinen, und so ist es auch im Buch, das Ralf Dombrowski diesem neben der E-Gitarre vielleicht klang-bestimmendsten Instrument des 20. Jahrhunderts widmet.
In kurzen Kapiteln erklärt er klangliche Besonderheiten im Spiel von Sidney Bechet, Johnny Hodges, Benny Carter, Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie Parker, Lee Konitz, Sonny Rollins, John Coltrane, Ornette Coleman, Albert Ayler, Wayne Shorter, Branford Marsalis, Peter Brötzmann, Jan Garbarek und etlichen anderen Heroen des Saxophons. Auch Marcel Mule und Sigurd Rascher erhalten eigene Kapitel, die beiden einflussreichsten klassischen Saxophonisten des letzten Jahrhunderts. Etwas eingehender betrachtet er zehn Aufnahmen und Künstler, Hawkins’ “Body and Soul” etwa, Parkers “Ornithology”, Rollins’ “Saxophone Colossus”, Coltranes “A Love Supreme” und andere, geht dann auf Konstruktion und diverse Bauformen des Instruments ein, aber auch auf Spielbesonderheiten wie etwa die Zirkularatmung und verwandte Instrumente wie das elektronische Lyricon. Er betrachtet wichtige Standards der Jazzgeschichte, in deren Erfolg auch das Saxophon eine große Rolle spielten, und er wirft einen Blick auf Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland und auf die beim Saxophon-Lernen zu beachtenden ästhetischen Dinge, insbesondere Intonation und eigener Sound.
Dombrowskis Buch ist ein gut lesbarer kurzer, dennoch intensiver Leitfaden zum Instrument, der jedem, der Saxophon spielt, ein paar Tipps zum Weiterhören, zum Sich-Selbst-Hinterfragen gibt, dabei technische Details genauso wie historische Entwicklungen erklärt.
Wolfram Knauer (März 2012)
Benny Goodman. A Supplemental Discography
von David Jessup
Lanham/MD 2010 (Scarecrow Press)
353 Seiten, 44,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-7685-9
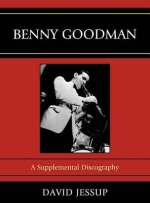 1988 erschien D. Russell Connors “Benny Goodman. Listen to His Legacy”, 1996 sein “Benny Goodman. Wrappin’ It Up”, zwei Diskographien, die Goodmans Aufnahmen von den ersten Studiosessions 1926 bis zu seinem Tod dokumentierten.
1988 erschien D. Russell Connors “Benny Goodman. Listen to His Legacy”, 1996 sein “Benny Goodman. Wrappin’ It Up”, zwei Diskographien, die Goodmans Aufnahmen von den ersten Studiosessions 1926 bis zu seinem Tod dokumentierten.
David Jessup knüpft an diese beiden diskographischen Werke an mit seinem großformatigen Opus, das die Vorgänger ergänzt um neu aufgetauchte Sessions, Livemitschnitte, Filmdokumente und zugleich in den diskographischen Details in einen Dialog mit den Titeln tritt, beschreibt, hinterfragt, offene Fragen herausstreicht, auf Diskrepanzen früherer diskographischer Erkenntnisse etwa mit dem Plattentext hinweist und vieles mehr.
Zwischendurch fasst er diskographische Diskurse zusammen, die er mit anderen Sammlern und Goodman-Experten über die Jahre geführt hatte. In einem kurzen Kapitel befasst sich Jessup außerdem mit dem Internet als einem neuen Sammelmedium.
Und schließlich füllt den zweiten Teil des Buchs eine vorläufige Diskographie der “Small Label Goodman Releases”. Das alles ist etwas für hartgesottene Goodman-Sammler – für die aber ist es ein Muss, genauso wie die Vorgängerbände von Connors.
Für alle anderen ist auch dieses Buch ein Beleg für die Bedeutung der durchaus wissenschaftlichen Arbeit, die im Jazz von Fans geleistet wird und die in der klassischen Musikwissenschaft als “Werkverzeichnis” leicht zu akademischen Ehren führen könnte.
Wolfram Knauer (Februar 2012)
The History of Jazz
Von Ted Gioia
New York 2011 (Oxford University Press)
444 Seiten, 19,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-539970-7
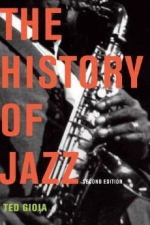 Ted Gioias “Geschichte des Jazz” ist ein umfassendes Werk, dass die Entwicklung dieser Musik von den Anfängen (er nennt es die “Africanization of American Music”) bis ins 21ste Jahrhundert verfolgt, die wichtigsten Protagonisten nennt und in kurzen Absätzen diskutiert, ästhetische Entwicklungen erklärt und in Zusammenhang mit dem allgemeinen Musikbusiness genauso wie mit sozialen Entwicklungen in den USA bringt und zwischendrin noch versucht, die Musik zumindest zu beschreiben, um die es eigentlich geht. Die erste Ausgabe dieses Buchs wurde zu einem Bestseller der Jazzliteratur in den USA und an Schulen wie Hochschulen als Text Book benutzt – obwohl sich dort vielleicht ein analytischer in die Materie sich versenkendes Buch noch mehr lohnen würde.
Ted Gioias “Geschichte des Jazz” ist ein umfassendes Werk, dass die Entwicklung dieser Musik von den Anfängen (er nennt es die “Africanization of American Music”) bis ins 21ste Jahrhundert verfolgt, die wichtigsten Protagonisten nennt und in kurzen Absätzen diskutiert, ästhetische Entwicklungen erklärt und in Zusammenhang mit dem allgemeinen Musikbusiness genauso wie mit sozialen Entwicklungen in den USA bringt und zwischendrin noch versucht, die Musik zumindest zu beschreiben, um die es eigentlich geht. Die erste Ausgabe dieses Buchs wurde zu einem Bestseller der Jazzliteratur in den USA und an Schulen wie Hochschulen als Text Book benutzt – obwohl sich dort vielleicht ein analytischer in die Materie sich versenkendes Buch noch mehr lohnen würde.
Die Kapitelübersicht macht Gioias Ansatz deutlich: “The Prehistory of Jazz”, “New Orleans Jazz”, “The Jazz Age”, “Harlem”, “The Swing Era”, “Modern Jazz”, “The Fragmentation of Jazz Styles”, “Free and Fusion”, “Traditionalists and Postmodernists” sowie “Jazz in the New Millennium”. Als Anhang finden sich Hör- genauso wie Leseempfehlungen.
Gioia präsentiert Fakten, hinterfragt Mythen, erklärt Beweggründe für den Wandel der Musik, ordnet die musikalische Entwicklung des Jazz in die soziale, wirtschaftliche politische Entwicklung der Vereinigten Staaten ein. Musikalische Details beschränken sich auf kurze Ablauf- oder Klangbeschreibungen, die er allerdings geschickt genug einsetzt, um auch dem nicht musikbewanderten Leser Besonderheiten verschiedener Zeit- und Personalstile erklären zu können.
Wie in jedem Geschichtsbuch wird man auch bei Gioia anfangen können zu kritisieren: Warum diesen, warum nicht jenen Musiker? Die Fakten sind ja alle bekannt, hier kann Gioia vor allem seine Sicht der Zusammenhänge präsentieren. Am interessantesten ist bei solchen Büchern erfahrungsgemäß der Umgang mit den jüngsten Entwicklungen. “Traditionalists and Postmodernists” ist das Kapitel überschrieben, in dem Gioia aus irgendeinem Grunde die Szene um Wynton Marsalis dem sehr viel früher begründeten AACM-Lager gegenüberstellt; die New Yorker Downtownszene zwar erwähnt, aber ihre tatsächliche Bezogenheit auf die Neotraditionalisten nicht ausreichend erklärt. “Jazz in the New Millenium” schließlich nennt einige der erfolgreichen Musikernamen der letzten zehn Jahre, um dann in einem Unterkapitel die “Globalization” of Jazz” festzustellen und hier (außer einem früheren Bezug auf Django Reinhardt) zum ersten Mal auch die europäischen Entwicklungen zu thematisieren. Solch eine amerikano-zentrische Sichtweise kann man Gioia wohl kaum vorwerfen – die Tatsache, dass diese Parallelentwicklungen der Jazzgeschichte noch nicht ausreichend – also zusammenfassend und in englischer Sprache – verschriftlicht wurden, erklärt leider immer noch die weitgehende amerikanische Negierung dessen, was nunmehr seit über vierzig Jahren in Europa an ganz eigenständigen Entwicklungen geschieht.
Ted Gioias “History of Jazz” ist auf jeden Fall eine sehr brauchbare Zusammenfassung der amerikanischen Jazzgeschichte. Andere (etwa Berendt) mögen in ihrem Ansatz gliedernder und damit insbesondere für den Jazzneuling hilfreicher sein, aber Gioia überzeugt vor allem in der dauernden Überlagerung biographischer, musikalischer, sozialgeschichtlicher Erklärstränge.
Wolfram Knauer (Januar 2012)
Lightnin’ Hopkins. His Life and Blues
von Alan Govenar
Chicago 2010 (Chicago Review Press)
334 Seiten, 28,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-55652-962-7
 Der Blues ist vordergründig eine der persönlichsten Musikstile, die man sich vorstellen kann, handelt er doch von vermeintlich Selbst-Erlebtem, vom offen gelegten emotionalen Grenzsituationen. Tatsächlich ist der Bluessänger aber ein Griot seiner Tage; seine Texte stehen nicht nur für ihn, sondern für so viele, die sich mit ihnen identifizieren und aus dem Aussprechen des täglichen Leids Kraft ziehen können. Alan Govenar hat die Biographie eines der am meisten aufgenommenen Blueskünstler des 20sten Jahrhunderts geschrieben und bietet dem Leser damit Einblick in die persönlichen Erfahrungen, die Hopkins mit in seine Musik einbringen konnte.
Der Blues ist vordergründig eine der persönlichsten Musikstile, die man sich vorstellen kann, handelt er doch von vermeintlich Selbst-Erlebtem, vom offen gelegten emotionalen Grenzsituationen. Tatsächlich ist der Bluessänger aber ein Griot seiner Tage; seine Texte stehen nicht nur für ihn, sondern für so viele, die sich mit ihnen identifizieren und aus dem Aussprechen des täglichen Leids Kraft ziehen können. Alan Govenar hat die Biographie eines der am meisten aufgenommenen Blueskünstler des 20sten Jahrhunderts geschrieben und bietet dem Leser damit Einblick in die persönlichen Erfahrungen, die Hopkins mit in seine Musik einbringen konnte.
1929 in eine arme Farmpächterfamilie in Texas geboren, verließ Hopkins bereits mit acht Jahren sein Zuhause, verdiente sich sein Geld als Straßenmusikant oder Gelegenheitsarbeiter. Seine ersten Aufnahmen machte er erst 1946, als er auch seinen Spitznamen “Lightnin'” erhielt. Seine Platten führten die R&B Charts an, aber dann wurde er wieder vergessen, bis er 1959 “wiederentdeckt” wurde und die Bürgerrechtsbewegung mit seinen emotionalen Liedern begleitete.
Govenar macht sich auf die Spurensuche, nachdem er selbst Hopkins 1974 ein einziges Mal in einem Konzert gehört und nachdem Chris Strachwitz, der Gründer des Arhoolie-Labels, ihn auf die Bedeutung dieses Musikers aufmerksam gemacht hatte. Anfangs verzweifelte er mit seinen Recherchen fast, als ihm Hopkins Manager und seine langjährige Lebensgefährtin jegliches Interview verweigerten; dann machte er sich auf nach Texas und traf im Geburtsort des Gitarristen und Sängers tatsächlich auf entfernte Verwandte und Kindheitsfreunde. Ihm gelingt es im Verlauf seines Buchs, die Mythen und Erinnerungen auseinanderzudröseln, die Hopkins selbst in Interviews oder auch in seiner Musik zu erzählen pflegte, und die über ihn kursierten.
Man weiß wenig über Sam “Lightnin'” Hopkins’ Kindheit, und Govenar muss sich hier vor allem auf andere Quellen verlassen, um die Geschichten zu verifizieren oder wenigstens in die Realität der Zeit einzupassen, etwa die von Hopkins selbst erzählte von seinem Großvater, der sich als Sklave erhängt hätte, weil er es nicht mehr aushielt, laufend bestraft zu werden. Hopkins Vater starb, als der Sohn 3 Jahre alt war. Sam schaute sich die Technik des Gitarrespielens von seinen älteren Brüdern und anderen Musikern des Dorfes ab. Govenar beschreibt die Bildungsmöglichkeiten und die Zwänge der Feldarbeit in jener Zeit, aber auch die Square Dances, die Hopkins in seinem Dorf erlebte. Mit acht Jahren traf er auf Blind Lemon Jefferson, der ihn in seinem Spiel ermutigte. Der Junge erahnte, dass die Musik eine Chance sein könnte, sich aus dem Leben eines Sharecroppers zu befreien.
Man weiß nicht genau, aus welchem Grunde Hopkins in den 1930er Jahren ins Gefängnis kam, aber später berichtete er in Wort und Blueslyrics von den Chain Gangs, wenn auch Govenar feststellt, dass seine Texte für einen Mann, der so oft im Gefängnis war, etwas reichlich unoriginell seien. Etwa gegen Mitte der 1930er Jahre traf Hopkins in Dallas auf den Bluessänger Texas Alexander, der bereits etliche Aufnahmen gemacht hatte und ihm zeigte, dass man durchaus auch von der Musik allein leben konnte. Govenar zeichnet daneben auch Einflüsse von Alexanders Stil in Hopkins’ späteren Aufnahmen nach.
Mitte der 1940er Jahre zog Hopkins nach Houston, und auch hier beschreibt Govenar eingehend die soziale und wirtschaftliche Lage, in der sich insbesondere die schwarze Bevölkerung in der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts befand. Er baut eine neuen Karriere auf und wird erstmals öffentlich wahrgenommen, vor allem natürlich, weil nun, 1946, erste Plattenaufnahmen von ihm erscheinen. Hier hat Govenar nun richtige Quellen, die er unter die Lupe nehmen kann: Bluestexte, die es gilt mit der Realität zu vergleichen, Kontorbücher, die Gagen für die Plattenaufnahmen auflisten, und Zeitzeugenberichte, die er immer mehr einführt – auch weil für die aktive Aufnahmezeit des Gitarristen einfach mehr Zeitzeugen zu finden waren als für seinen frühen Jahre. Er fragt nach den Medien, denen sich der Blues in jener Zeit bediente, und wie die Musik an ihre (vor allem schwarzen) Hörer kam.
1959 wurde Hopkins von Samuel Charters wiederentdeckt, der in einem Hinterzimmer u nd mit einem portablen Aufnahmegerät Aufnahmen vor allem alter Bluessongs machte. Auch Mack McCormick und Chris Strachwitz gehörten zu den Produzenten-Unterstützern Hopkins’, die seiner Karriere letztendlich zu einem neuen Schub verhalfen. McCormick ermutigte ihn bei seinen Aufnahmesitzungen zu singen, was immer ihm in den Sinn kam, nicht also marktorientierte, sondern möglichst persönliche Statements abzuliefern. Hopkins war ein Improvisator durch und durch, der viele seiner Stücke aus dem Stegreif dichtete.
Die 1960er Jahren brachten sowohl in den USA wie auch in Europa ein Blues-Revival, und Govenar beleuchtet die Menschen hinter dieser Bewegung, ihre Beweggründe und ihre Strategien. Hopkins tourte in den Vereinigten Staaten genauso wie in Europa und in den 1970er Jahren sogar in Japan, wenn er auch im Third Ward in Houston wohnen blieb. Gesundheitliche Probleme nahmen zu, und am 30. Januar 1982 verstarb Hopkins im Alter von 70 Jahren.
Eine von Andrew Brown und Alan Balfour zusammengestellte ausführliche Diskographie ergänzt das Buch. Govenars Biographie gelingt es überaus lesenswert, das Leben und das Werk des Gitarristen und Sängers zu beleuchten, Mythen und Realität zu analysieren und aus der Lichtgestalt des Bluesheroen den Menschen Sam Hopkins herauszuschälen.
Wolfram Knauer (Januar 2012)
Improvisieren. Paradoxien des Unvorhersehbaren. Kunst – Medien – Praxis
herausgegeben von Hans-Friedrich Bormann & Gabriele Brandstetter & Annemarie Matzke
Bielefeld 2010 (transcript)
238 Seiten, 26,80 Euro
ISBN: 978-3-8376-1274-5
 Wir Jazzer sehen die Improvisation natürlich als unser ureigenes Feld an; der Jazz schließlich ist diejenige westliche Kunst, in der Improvisation am stärksten zum Prinzip erhoben und am meisten gefeiert wurde. Das vorliegende Buch streift das große Feld der jazzmusikalischen Improvisation eher am Rande, etwa im Beitrag von Christopher Dell, der in seinem Vortrag bei der Tagung an der Freien Universität in Berlin, die Anlass für die hier abgedruckten Texte war, auch gleich selbst improvisierte – im Gegensatz zu den dort “komponierten” (spricht vorgefertigten und abgelesenen) Referate der übrigen Autoren.
Wir Jazzer sehen die Improvisation natürlich als unser ureigenes Feld an; der Jazz schließlich ist diejenige westliche Kunst, in der Improvisation am stärksten zum Prinzip erhoben und am meisten gefeiert wurde. Das vorliegende Buch streift das große Feld der jazzmusikalischen Improvisation eher am Rande, etwa im Beitrag von Christopher Dell, der in seinem Vortrag bei der Tagung an der Freien Universität in Berlin, die Anlass für die hier abgedruckten Texte war, auch gleich selbst improvisierte – im Gegensatz zu den dort “komponierten” (spricht vorgefertigten und abgelesenen) Referate der übrigen Autoren.
Es geht, kurz gesagt, um das Improvisieren in diversen künstlerischen und kulturellen Zusammenhängen, die man mit dem Phänomen der Improvisation mal mehr, mal weniger verbindet. Georg W. Bertram beginnt mit einem allgemeinen Blick auf Improvisation im Alltag und in der Sprache. Roland Borgards untersucht Texte von Thomas Mann und Hugo Ball, die die Improvisation zum Thema haben, und zwar nicht nur der eigentlichen Texte, sondern auch der Textkreation.
Edgar Landgraf schaut historisch auf die Improvisation auf der Theaterbühne zwischen Commedia dell’arte und dem frühromantischen Konzept des Universallustspiels. Sandro Zanetti holt noch weiter aus und betrachtet Improvisation vor dem Hintergrund der antiken Rhetorik und der romantischen Literatur. Markus Krajewski schaut genauer auf den Butler in “Dinner for One” und fragt nach dem Verhältnis von Routine und Improvisation in dessen Handeln.
Annemarie Matzke betrachtet die Funktion der Improvisation im Schauspiel, und Gabriele Brandstetter sowie Friedrike Lampert schauen auf die Bedeutung von Improvisation in der künstlerischen Tanzpraxis. Schließlich beleuchtet Kai van Eikels die beliebten Übersetzungen der Improvisation, wie sie etwa im Jazz stattfindet, auf Organisationstheorien.
Improvisation, das lernt mal schnell in diesem Buch, ist weitaus mehr als das, was wir uns gemeinhin darunter vorstellen, egal ob wir aus dem Jazz kommen oder meinen, jeder improvisiere doch eigentlich immer. Weder unfertig noch vollkommen ungeplant, ist das Prinzip der Improvisation letztlich ein Zurückgreifen auf Erlerntes und Erfahrenes, die Fähigkeit schnellstens Entscheidungen zu treffen, die alles ändern können, das Ziel also sowohl im Blick zu behalten wie auch nicht als ultimatives Ziel zu sehen.
Wolfram Knauer (Januar 2012)
Unfinished Blues. Memories of a New Orleans Music Man
Von Harold Battiste Jr. (& Karen Celestan)
New Orleans 2010 (Historic New Orleans Collecion)
197 Seiten, 28,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-917860-55-3
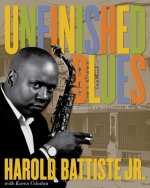 Harold Batiste war zusammen mit Alvin Batiste, Ellis Marsalis, Ed Blackwell und einigen anderen Musikern die moderne Jazzstimme im New Orleans der frühen 1950er Jahre. Mit Marsalis zusammen etablierte er weit später das Jazz Studies Program an der University of New Orleans. In seiner Autobiographie erzählt er seine Geschichte, die von New Orleans nach Los Angeles führt, vom Jazz zum Geschäft mit der Popmusik und zurück.
Harold Batiste war zusammen mit Alvin Batiste, Ellis Marsalis, Ed Blackwell und einigen anderen Musikern die moderne Jazzstimme im New Orleans der frühen 1950er Jahre. Mit Marsalis zusammen etablierte er weit später das Jazz Studies Program an der University of New Orleans. In seiner Autobiographie erzählt er seine Geschichte, die von New Orleans nach Los Angeles führt, vom Jazz zum Geschäft mit der Popmusik und zurück.
Battiste wurde im Herbst 1931 in New Orleans geboren. Das Buch berichtet über die Stadt seiner Kindheit, das Leben in verschiedenen Vierteln und in einem sozialen Wohnungsbauprojekt, über seine erste Metallklarinette, die ihm sein Vater in einem Leihhaus kaufte. Mit elf oder zwölf arbeitete er als Hilfskraft im Dew Drop Inn, wo er jede Menge schwarzer Popkultur hautnah erlebte. Er ging auf die Gilbert Academy, eine High School, in der er seinen ersten richtigen Musikunterricht erhielt und in der Schulband spielte. Später besuchte er die Dillard University und spielte auch dort in der Hochschul-Tanzkapelle. Sein Studienziel war es, staatlich geprüfter Musiklehrer zu werden.
Mit 18 hatte Battiste seinen ersten richtigen Gig im Orchester des Pianisten Joe Jones, das vor allem Kaufarrangements populärer Bigbandnummern etwa von Stan Kenton spielte. Er heiratete, unterrichtete eine Weile, war aber vom Schulsystem so frustriert, dass er seinen Job kündigte und zusammen mit seinen Kumpanen Ed Blackwell, Richard Payne und Ellis Marsalis an die amerikanische Westküste zog, wohin er wenig später auch seine Familie nachkommen ließ. Einige der Musiker (insbesondere Blackwell) spielten mit Ornette Coleman; Battiste aber begann bald seine zweite Karriere, als er nämlich die erste Hitsingle von Sam Cooke arrangierte und produzierte. Bald darauf kam er auch mit Salvatore Bono zusammen, der wenig später mit der Sängerin Cher als Sonny & Cher Karriere machen sollte.
Die folgenden Kapitel behandeln das Music Business der späten 1950er, frühen 1960er Jahre, R&B-Gruppen, mit denen Battiste zusammenarbeitete, aber auch das Label A.F.O. Records, das er in New Orleans gründete und auf dem er etliche seiner Entdeckungen herausbrachte, unter ihnen etwa Barbara George, die mit “I Know (You Don’t Love Me No More)” einen großen Hit hatte. Mit Sonny & Cher arbeitete er von den 1960er bis in die 1980er Jahre; und neben der Beschreibung seiner Arbeit erzählt er dabei durchaus auch von Copyright-Knebelverträgen, die Battistes Namen aus den Kompositionen und Arrangements strichen, die er gefertigt hatte.
1967 produzierte er ein Album mit Mac Rebennack, der bald darauf als Dr. John bekannt werden sollte. Battiste ist mittlerweile ein gemachter Mann, besitzt ein großes Haus, ein großes Auto, hat Erfolg auf der ganzen Linie. Er pendelt zwischen New Orleans und Los Angeles, produziert unzählige Projekte. Er wird musikalischer Leiter der populären Sonny & Cher TV-Show, für die er alle Arrangements fertigt. 1976 gründete er ein neues Label, Opus 43, tut sich mit Ellis Marsalis zusammen und nimmt das erste Album auf, das Ellis mit seinen Söhnen Wynton und Branford einspielte (das aber nie veröffentlicht wurde).
Die letzten Kapitel des Buchs widmen sich den Aktivitäten, mit denen Battiste seiner Heimatstadt etwas von dem zurückgeben will, was er musikalisch von ihr erhalten hatte: Wir lesen etwa von der Gründung der National Association of New Orleans Musicians und von Konzepten für eine bessere Einbindung des Jazz in den Schulunterricht. Nebenbei erfahren wir aber auch über seine Scheidung, die zum Verlust seines Hauses und seines Vermögens führte und auch dazu, dass er mit 58 Jahren eine neue Karriere als Dozent an der University of New Orleans begann / beginnen musste.
Alles in allem ist “Unfinished Blues” eine umfangreiche Autobiographie, die sich manchmal in zu viel Details verliert und der man insbesondere in der Geschichte des Privatlebens deutlich die Verletztheit des Autors anmerkt. Nichtsdestotrotz gibt das Buch einen ungemein interessanten Einblick ins Leben und Überleben eines schwarzen Musikers zwischen Jazz und Kommerz und seine musikalischen wie ästhetischen und spirituellen Werte. Es zeigt zudem unzählige Fotos, die die Stories quasi erlebbar machen, jene Geschichte vom Aufstieg eines Musikers zum Popproduzenten, von seinem Fall, von Neubesinnung und Neufindung.
Wolfram Knauer (Januar 2012)
Speak Jazzmen. 55 interviews with jazz musicians
von Guido Michelone
Milano 2010 (EDUCatt)
212 Seiten, 11 Euro
ISBN: 978-88-8311-753-4
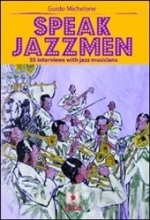 Guido Michelone ist ein fleißiger italienischer Jazzkritiker, der regelmäßig für die diversen Fachzeitschriften seines Landes schreibt, außerdem Jazzgeschichtskurse an der Universität von Mailand gibt. Aus den Schubladen seines Schreibtischs hat er für das vorliegende Buch fünfundfünfzig Interviews ausgesucht, die er in den letzten Jahren mit amerikanischen und europäischen (allerdings nicht mit italienischen) Musikern führte. Anlass der auf Englisch abgedruckten Interviews war meist entweder das Erscheinen eines neuen Albums des betreffenden Künstlers oder eine bevorstehende Italientournee.
Guido Michelone ist ein fleißiger italienischer Jazzkritiker, der regelmäßig für die diversen Fachzeitschriften seines Landes schreibt, außerdem Jazzgeschichtskurse an der Universität von Mailand gibt. Aus den Schubladen seines Schreibtischs hat er für das vorliegende Buch fünfundfünfzig Interviews ausgesucht, die er in den letzten Jahren mit amerikanischen und europäischen (allerdings nicht mit italienischen) Musikern führte. Anlass der auf Englisch abgedruckten Interviews war meist entweder das Erscheinen eines neuen Albums des betreffenden Künstlers oder eine bevorstehende Italientournee.
Unter den Gesprächspartnern sind bekannte Namen wie Don Byron, Billy Cobham, Steve Lacy, Hugh Masekela, Greg Osby, Joshua Redman, Trevor Watts, Lenny White genauso wie der breiten Öffentlichkeit nicht ganz so bekannte Namen, etwa Theo Bleckmann, Antonio Ciacca, Khari B., Tony lakatos, Martin Mayes, Brett Sroka, Torben Walldorf (aber auch Daniel Schnyder, nicht “Scheyder” und Jeremy Pelt, nicht “Pelz”, um gleich mal zwei der falsch geschriebenen Namen zu korrigieren).
Die meisten der Gespräche sind dabei eher kurz; etliche nur ein oder zwei Seiten lang. Immer wieder liest man Standardfragen wie “Was bedeutet der Jazz für Sie?” oder “Wer waren Ihre wichtigsten Einflüsse?”. Ab und an spricht Michelone auch den Unterschied zwischen europäischem und amerikanischem Jazz an, fragt aber selten nach.
Wie sollte er allerdings auch nachfragen? Viele der Interviews nämlich wurden per e-mail geführt. Im Vorwort lobt Michelone die Gedankentiefe der Antworten, vergibt sich bei der gewählten Technik des Mailinterviews allerdings die Möglichkeit der tatsächlichen Vertiefung. So werden viele Themen oft nur angeschnitten. Einige der Fragen wirken zudem hilflos, etwa wenn Michelone Vijay Iyer fragt, wie viele indische Sprachen er denn spräche (Antwort: nur Englisch und ein wenig Französisch).
Alles in allem finden sich durchaus interessante Aussagen in diesem Buch — die Beliebigkeit der Interviews, und die unterschiedliche Tiefe der Gespräche macht es allerdings zu einer wechselvollen Lektüre, der ein wenig editorisches Geschick gut getan hätte, wenn beispielsweise die Gespräche jeweils mit einleitenden oder beschließenden Worten kommentiert und eingeordnet worden wären.
Wolfram Knauer (Januar 2012)
The Comedian Harmonists. The Last Great Jewish Performers in Nazi Germany
von Douglas A. Friedman
West Long Branch/NJ 2010 (HarmonySongs Publications)
306 Seiten, 22,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-9713979-1-0
 Die Comedian Harmonists sind bis heute bekannt als eine der populärsten Vokalgruppen des frühen 20sten Jahrhunderts. Sie sind ins deutsche Kulturgut eingegraben wie sonst kaum ein populäres Ensemble, durch Loriot-Cartoons, Nachahm-Bands oder den Ende der 1990er Jahren in die Kinos gekommenen Spielfilm “The Harmonists”, der auf ihrer Geschichte basiert. Douglas Friedman hat sich nach seiner Pensionierung als Vizepräsident einer erfolgreichen amerikanischen Energiefirma an die Arbeit gemacht, die Geschichte des Vokalensembles zu recherchieren. Ihn interessierte der musikalische Kontext des Vokalquintetts dabei genauso wie der soziale, die Verfolgung der jüdischen Sänger und Musiker durch die Nazis.
Die Comedian Harmonists sind bis heute bekannt als eine der populärsten Vokalgruppen des frühen 20sten Jahrhunderts. Sie sind ins deutsche Kulturgut eingegraben wie sonst kaum ein populäres Ensemble, durch Loriot-Cartoons, Nachahm-Bands oder den Ende der 1990er Jahren in die Kinos gekommenen Spielfilm “The Harmonists”, der auf ihrer Geschichte basiert. Douglas Friedman hat sich nach seiner Pensionierung als Vizepräsident einer erfolgreichen amerikanischen Energiefirma an die Arbeit gemacht, die Geschichte des Vokalensembles zu recherchieren. Ihn interessierte der musikalische Kontext des Vokalquintetts dabei genauso wie der soziale, die Verfolgung der jüdischen Sänger und Musiker durch die Nazis.
Sein Buch beginnt mit der Faszination des jungen Harry Frommermann durch Aufnahmen des amerikanischen Vokalquintetts Revelers. Frommermann schrieb eigene Arrangements und schaltete eine Kleinanzeige im Berliner Lokal-Anzeiger, in der er nach “schönklingenden Stimmen” suchte. Im Januar 1928 hatte er die Band zusammen, die er Melody Makers nannte. Friedman rekapituliert die Biographien der Mitglieder: Harry Frommermann, Robert Biberti, Ari Leschnikoff, Roman Cycowski, Erich Collin sowie anderer, kurzfristig mit der Band arbeitender Musiker. Er beschreibt die Probenphase durchs Jahr 1928, das Vorsingen im Scala Club und den Vorschlag des Musikmanagers Eric Charrell, die Band in Comedian Harmonists umzutaufen. Im August nahm das Quintet mit Pianisten seine ersten Schallplatten auf und war sofort ein Riesenerfolg sowohl in Charrells Revue wie auch auf Platte. 1929 tourten die sechs durch Deutschland, 1930 waren sie bereits weit europaweit populär. Hits wie “Ein kleiner grüner Kaktus” oder “Veronika, der Lenz ist da” brachten dabei Optimismus in die Stimmung der Weimarer Republik, eine scheinbar perfekte Paarung des swingend intonierten amerikanischen Jazz mit deutschem Schlager der Zeit.
Friedmann verfolgt die Karriere der Band genauso wie persönliche Schicksale, Liebschaften, Hochzeiten, Erfolge, Nachahmer, Konkurrenten. 1933 kamen die Nazis an die Macht, und mit einem Mal wurde es schwierig für die jüdischen Mitglieder der Comedian Harmonists, spätestens als diesen mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 jede Arbeitsmöglichkeit genommen wurde. Das Ensemble teilte sich in eine Wiener Gruppe und ein Berliner Ensemble. Die Wiener Band ging bald auf internationale Tournee, spielte in Australien, Südamerika, Kanada und den USA. Als Hitler Polen überfiel, war diese Band gerade in Sydney, und in den Kriegswirren löste sich das Ensemble 1940 auf – zu sehr hatten die einzelnen Mitglieder mit unterschiedlichen Nachrichten aus der Heimat zu kämpfen.
In Deutschland hatte die andere Hälfte der Harmonists sich unter dem Namen Meistersextett neu gegründet, konnte aber an den Erfolg der früheren Besetzung nicht wirklich anknüpfen und musste außerdem mit Schwierigkeiten durch die Reichsmusikkammer kämpfen, die in Repertoire und Auftreten Mitspracherecht anmeldete. Die Band zerstritt sich insbesondere mit Biberti und löste sich 1941 auf. Im letzten Teil seines Textes schließlich folgt Friedman den Biographien der früheren Comedian Harmonists-Mitglieder von Kriegsende bis zu ihrem Ableben.
Friedman bezieht sich auf Quellen im Nachlass Robert Bibertis an der Staatsbibliothek Berlin sowie auf Zitate aus der 1976 gedrehten Fernsehdokumentation über die Band. Seine Recherche muss man sich dabei etwas mühsam vorstellen, denn der Autor spricht kein Deutsch und musste sich grundsätzlich auf englische Übersetzungen oder Untertitel verlassen. Letzten Endes kann er so kaum originäre Recherchen aufweisen sondern vor allem referieren, was anderswo bereits zusammengetragen wurde. Das tut dem Fleiß seiner Arbeit aber keinen Abbruch, insbesondere, wenn man den umfangreichen (mehr als 100 Seiten starken) Anhang des Buchs aufblättert, der eine genaue Timeline der Band enthält, eine komplette Diskographie sowie eine Auflistung aller bekannten Konzerte mit Anmerkungen zu Gagenhöhe oder anderen Besonderheiten. Schließlich findet sich hier auch eine Repertoireliste anhand von Programmen ausgewählter Konzerte über die Jahre, eine Filmographie, eine Liste von den Harmonists gesungener, aber nie auf Schallplatte eingespielter Titel sowie die obligatorische Literaturliste (die sich im Vergleich zu den anderen Teilen des Anhangs ein wenig dürftig ausmacht).
Alles in allem: eine hoch willkommene Zusammenfassung der biographischen und Karrieregeschichte der Comedian Harmonists, in der sich wenig über die Musik selbst findet, dafür jede Menge Information zur Lebenswirklichkeit eines Starensembles in den dunklen Jahren der Nazizeit. Insbesondere die Anhänge machen das Buch auch für Forscher zu einer hilfreichen Quelle.
Wolfram Knauer (Dezember 2011)
The Big Love. Life & Death with Bill Evans
von Laurie Verchomin
Kanada 2010 (Selbstverlag)
144 Seiten, 19,59 US-Dollar
ISBN: 978-1-456563097
 Jazzmusiker sind zuallererst – Musiker. Aber natürlich sind sie genauso Menschen wie wir alle, Menschen, die versuchen eine Balance aus Arbeit und Leben zu finden, aus Pflicht und Vergnügen, aus Ernsthaftigkeit und Liebe. Vom Privatleben eines der ganz großen Jazzmusiker handelt dieses Buch, und dabei vor allem von der Liebe. Der Autorin widmete Bill Evans seine Komposition “Laurie”, die gegen Ende seines Lebens fester Bestandteil seines Bühnenrepertoires war. “For Laurie who inspired this song with love – Bill”, schreibt Evans auf die Kompositionsnotiz, die Verchomin in ihrem Buch abdruckt und die ihn auf ewig mit ihr verbunden habe.
Jazzmusiker sind zuallererst – Musiker. Aber natürlich sind sie genauso Menschen wie wir alle, Menschen, die versuchen eine Balance aus Arbeit und Leben zu finden, aus Pflicht und Vergnügen, aus Ernsthaftigkeit und Liebe. Vom Privatleben eines der ganz großen Jazzmusiker handelt dieses Buch, und dabei vor allem von der Liebe. Der Autorin widmete Bill Evans seine Komposition “Laurie”, die gegen Ende seines Lebens fester Bestandteil seines Bühnenrepertoires war. “For Laurie who inspired this song with love – Bill”, schreibt Evans auf die Kompositionsnotiz, die Verchomin in ihrem Buch abdruckt und die ihn auf ewig mit ihr verbunden habe.
Gleich das Eingangskapitel trifft ins Mark: Laurie Verchomin erzählt, wie Evans am 15. September 1980 in seine Methadonklinik fahren will, um sich mit seinem Arzt zu beraten. Joe LaBarbera fährt sie nach Midtown-Manhattan, und mitten im Gespräch beginnt Evans Blut zu husten. Sie schaffen es noch in die Notaufnahme, doch Evans ist nicht mehr zu retten.
Rückblende: Mitte der 1970er Jahre geht die junge Laurie Verchomin aus Edmonton in Kanada nach New York, mietet ein billiges Hotelzimmer und schreibt sich für Unterricht in einer Schauspielschule ein. Zurück in Edmonton versucht sie ihr Liebesleben neu zu ordnen und jobbt nebenbei als Kellnerin. Bei einem Konzert des Bill Evans Trios, bei dem sie kellnert, lernt sie den Pianisten kennen. Sie schreiben sich, sie teilen sich das Kokain, sie besucht ihn in seiner kleinen Wohnung in Fort Lee, New Jersey. Eindringlich, überaus offen und höchst persönlich erzählt Verchomin von ihrem Eintauchen in eine Welt, die so ganz anders ist als das heimatliche Edmonton. Liebe, Sex, Kokain, Drinks, Schallplatten, Evans’ Ehefrau Nenette, die sie über seine Reihe an Liebschaften aufklärt… Verchomin erzählt über ihre Ängste, für ihn und vor seiner Sucht. Inzwischen ist sie nach Edmonton zurückgekehrt, besucht ihn bei Konzerten in Toronto, begleitet ihn nach Chicago. Zwischendurch erfahren wir von kokaingetränkten Abenden mit Dennis Hopper, vom Village Vanguard, ihrer Rückkehr nach Edmonton. In seiner Wohnung schwadroniert Evans davon, von der CIA überwacht zu werden, und Laurie akzeptiert seine Paranoia, worauf Evans sie schließlich einlädt, ganz zu ihm zu ziehen. Sie erzählt von Auseinandersetzungen mit Bills Agentin und von der Anziehungskraft eines von Drogen zerfressenen Körpers. Sie besucht ihn während eines Gigs in London; wieder zurück in den USA holt sie ihn vom Flughafen ab, beschreibt, wie ausgelaugt, offensichtlich krank und fertig er auf sie wirkte. Wir werden Teil der Szenen eines Musikerlebens: Gigs, Talk-Shows, Hotelzimmer, Flugtickets, Warten, Reisen, Spielen. Und dann… der 15. September 1980, Mount Sinai Hospital: “We couldn’t save him”.
Laurie Verchomins Buch ist vielleicht eines der persönlichsten Bücher über einen Jazzmusiker. Die Autorin ist schonungslos offen, und stellenweise weiß man nicht, mit wem man mehr mitleiden soll: dem sensiblen, schwerkranken Evans oder Laurie, die von der Liebe in eine Beziehung getragen wird, die so viel mehr an Kraft verlangt, als sie je geahnt hatte. Man legt das Buch aus der Hand mit einem beklemmenden Gefühl, aber auch ahnend, dass man das alles bereits wusste, weil Bill Evans es uns in seiner Musik offen legte, in der diese Sensibilität und Verletzlichkeit doch so deutlich durchscheint. Anderthalb Jahre begleitete Verchomin den Pianisten, auch auf seiner letzten Reise. Ihr Buch ist eine persönliche Hommage an das Vermächtnis eines genialen Musikers, der selbst im Leiden und Wissen um den bevorstehenden Tod so viel an Kraft in die Schönheit der Musik steckte. Ihr Buch schildert eine wahrhafte Tragödie, das Zugrundegehen eines Künstlers, und dennoch liest man es mit liebevollem Gesicht – weil wir alle, die wir Bill Evans hören durften, von ebendieser Kraft musikalischer Schönheit zehren konnten und bis heute zehren können.
Wolfram Knauer (Oktober 2011)
freebag…? Jazz i Norge 1960-1970
von Bjørn Stendahl
Oslo 2010 (Norsk Jazzarkiv)
613 Seiten, 450 Norwegische Kronen
ISBN: 978-82-90727-14-2
 Bjørn Stendahls Geschichte des Jazz in Norwegen in den 1960er Jahren ist der mittlerweile vierte Band einer Reihe des Norwegischen Jazzarchivs über die Jazzgeschichte des Landes. Der Umfang des Buchs, der die früheren Bände bei weitem übertrifft, macht klar, dass es sich bei diesem Jahrzehnt um ein entscheidendes handelt: das Jahrzehnt dr Bewusstwerdung, dass Jazz für norwegische Musiker nicht mehr länger ein Feld der Nachahmung amerikanischer Idole war, sondern die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken.
Bjørn Stendahls Geschichte des Jazz in Norwegen in den 1960er Jahren ist der mittlerweile vierte Band einer Reihe des Norwegischen Jazzarchivs über die Jazzgeschichte des Landes. Der Umfang des Buchs, der die früheren Bände bei weitem übertrifft, macht klar, dass es sich bei diesem Jahrzehnt um ein entscheidendes handelt: das Jahrzehnt dr Bewusstwerdung, dass Jazz für norwegische Musiker nicht mehr länger ein Feld der Nachahmung amerikanischer Idole war, sondern die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken.
Stendahl befasst sich in seinen eingehenden Recherchen mit Lokal- und Regionalszenen, mit auch in Skandinavien abgehaltenen stilistischen Grabenkämpfen zwischen Traditionalisten und Modernisten, mit den Vertriebswegen des Jazz über Radio, Fernsehen, Film, Presse und natürlich die Schallplatte, mit Clubs, Festivals und Musikerverbänden, mit der Struktur also einer sich organisierenden Szene. Das geht zum Teil schon sehr ins Detail, so dass das Buch wohl vor allem als Nachschlagewerk zu nutzen ist, in dem man blättert, um einzelne Episoden herauszugreifen, die im register leicht ansteuerbar sind. 613 Seiten im Stück zu lesen, das wird wohl kaum einer tun, auch wenn es sich lohnt, da Stendahl immer wieder spannende Fundstücke einschließt, Interviewschnipsel etwa, beispielhafte Club- und Festivalprogramme, Besetzungen und vieles mehr. Und natürlich gibt es Fotos zuhauf.
Fakten erfährt man also jede Menge, über musikalische Inhalte allerdings schweigt sich Stendahl meist aus. Zu Jan Garbareks Entwicklung etwa finden sich Auftrittsdaten nebst Besetzungen und parallel auftretenden Bands, über seine musikalische Ästhetik aber erfährt man eher nebenbei, in knappen Zitaten aus zeitgenössischen Rezensionen. Mehr aber war wohl auch nicht Stendahls Aufgabe im Rahmen der Reihe, die das Buch den Tatsachen entsprechend als “faktengefülltes Nachschlagewerk für speziell Interessierte” anpreist.
Oh ja, ein wenig norwegische Sprachkenntnisse sind von Vorteil, wobei das Norwegische Jazzarchiv auf seiner Website eine englischsprachige Zusammenfassung anbietet.
Wolfram Knauer (Oktober 2011)
in’n out. in-fusiones de jazz
herausgegeben von Julián Ruesga Bono
Sevilla 2010 (arte-facto)
277 Seiten,
ISBN: 978-84-614-5668-0
 Jazz, schreibt Julián Ruesga Bono im Vorwort zu diesem Buch, bekam die Mischung der Kulturen quasi in die Wiege gelegt. Wer vom Jazz also Stilfundamentalismus verlange, habe die Musik nicht verstanden. Entsprechend sammelt er in fünf thematischen Kapiteln Essays über einige der Fusionen, die der Jazz nach seiner Gründung einging.
Jazz, schreibt Julián Ruesga Bono im Vorwort zu diesem Buch, bekam die Mischung der Kulturen quasi in die Wiege gelegt. Wer vom Jazz also Stilfundamentalismus verlange, habe die Musik nicht verstanden. Entsprechend sammelt er in fünf thematischen Kapiteln Essays über einige der Fusionen, die der Jazz nach seiner Gründung einging.
Luc Delannoy befasst sich mit den Annäherungen zwischen lateinamerikanischen Musikrichtungen und dem Jazz zwischen den afro-kubanischen Aufnahmen Dizzy Gillespies und heutigen Projekten, in denen sich Jazz mit Traditionen Lateinamerikas mischt. Luis Clemente beschreibt die Verbindung jazzmusikalischer Improvisation mit dem andalusischen Flamenco und nennt historische sowie aktuelle Beispiele. Daniel Varela beschäftigt sich mit der Fusion von Jazz und zeitgenössischer Musik, wobei er als Fallbeispiele auf Aufnahmen aus Deutschland, den Niederlanden, England und den USA zurückgreift. Norberto Cambiasso zeichnet die politische Bedeutung des Jazz der 60er und 70er Jahre in Europa nach, bei Exilamerikanern genauso wie im erstarkenden europäischen Jazz, verweist auf konkrete politische Bezüge genauso wie auf allgemeine ästhetische Statements. Santiago Tadeo deckt den Bereich der elektronischen Experimente im Jazz insbesondere der jüngsten Zeit ab, also all das, was unter dem Terminus “Nu-Jazz” gehandelt wird, blickt dabei aber auch auf die Vorgänger, die seit den 60er Jahren elektronische Instrumente in den Jazz integrierten.
Neben diesen konkreten Kapiteln zu verschiedenen Formen von Fusionen zwischen “Jazz und…” enthält das Buch noch einen Rundumschlag von Chema Martínez über den Jazz im Jahr 2010, in dem man allerdings wirklich jüngere Namen vergeblich sucht, sowie eine Übersicht über Studien zum Jazz in Spanisch sprechenden Ländern.
Er habe das Buch auch “Notizen zu einer anderen Geschichte des Jazz” nennen können, schreibt Bono in seinem Vorwort, und tatsächlich stoßen die einzelnen Kapitel Themenstränge zu einer Musik an, die mittlerweile eben nicht allein mehr eine afro-amerikanische ist, sondern seit langem ihr eigenes Leben in vielen Ländern außerhalb der USA führt. Die Kapitel stehen dabei manchmal etwas sehr bezugslos nebeneinander, aber das macht dann auch wieder den Charme des Buchs aus, das darin deutlich macht, wie wichtig es ist, all die Fäden, die hier nur angerissen werden, aufzunehmen und in ein Gesamtbild des Jazz als eines großen globalen Projektes zu weben.
Wolfram Knauer (Oktober 2011)
Louis Armstrong. The Soundtrack of The American Experience
von David Stricklin
Chicago 2010 (Ivan R. Dee)
182 Seiten, 15,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-56663-836-4
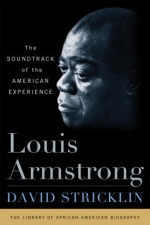 Noch eine Biographie des ersten wirklichen Stars des Jazz. David Striklin hat ein hübsches Büchlein vorgelegt, das Louis Armstrongs Leben beschreibt und daran entlang dessen afro-amerikanische Erfahrung herausstellen will. Und so gibt es in seinem Buch vor allem zwei Erzählstränge: den biographischen, der allseits bekannt ist und von ihm meist mit Verweisen auf die ebenfalls bekannten Armstrong-Biographen sowie Zitaten vom Trompeter selbst abgefeiert wird, sowie jenen, der von einer schwarzen Künstlerkarriere berichtet, die in Abhängigkeit vom weiß dominierten Markt gelebt wurde.
Noch eine Biographie des ersten wirklichen Stars des Jazz. David Striklin hat ein hübsches Büchlein vorgelegt, das Louis Armstrongs Leben beschreibt und daran entlang dessen afro-amerikanische Erfahrung herausstellen will. Und so gibt es in seinem Buch vor allem zwei Erzählstränge: den biographischen, der allseits bekannt ist und von ihm meist mit Verweisen auf die ebenfalls bekannten Armstrong-Biographen sowie Zitaten vom Trompeter selbst abgefeiert wird, sowie jenen, der von einer schwarzen Künstlerkarriere berichtet, die in Abhängigkeit vom weiß dominierten Markt gelebt wurde.
Stricklin beschreibt die Arbeitsumgebung erst in New Orleans, dann Chicago, dann New York, schließlich global. Er beschreibt die Entwicklung von einem jungen Trompeter, der froh war, mit seinen Mentoren spielen zu dürfen, hin zum eigenständigen Künstler, der sein eigener Herr war und seinerseits plötzlich überall Nachahmer fand. Er beschreibt Armstrong als freien und selbstbewussten Afro-Amerikaner, der weiße Hilfe durchaus annahm, auch immer wichtige weiße Geschäftspartner (bzw. Manager) hatte, sich selbst aber nicht die Butter vom Brot nehmen ließ.
Er beschreibt den Erfolg genauso wie die Schwierigkeiten, die Satchmo in den 1940er Jahren durchmachte, internationale Tourneen und seine Rückkehr nach New Orleans, das politische Bewusstsein des Trompeters und den populären Erfolg in den 1960ern. Das alles tut er in gut lesbaren Worten, aber nie mit allzu viel Konzentration auf das, was Armstrong eigentlich ausmachte, nämlich die Musik. Selbst im Schlusskapitel “The Recordings” kommt das Musikalische eher knapp und kaum aussagekräftig zu Wort, und so bleibt es bei vielen bekannten Fakten, neu sortiertem Atmosphärischem und einem wenig kritischen Literaturüberblick.
Für Einsteiger ist dieses Buch sicher kein Fehler; wer je ein anderes Armstrong-Buch gelesen hat, wird hier allerdings wenig Neues lernen.
Wolfram Knauer (Oktober 2011)
Blue Smoke. The Lost Dawn of New Zealand Popular Music 1918-1964
von Chris Bourke
Auckland 2010 (Auckland University Press)
382 Seiten, 59,59 New-Zealand-Dollar
ISBN: 978-1-86940-455-0
 Man verliert als Europäer ja doch manchmal die Übersicht über die Welt. Hat man doch gerade erst akzeptiert, dass sich mit der Entdeckung Amerikas der Horizont gezwungenermaßen erweitert hat und dass in der Popmusik die Amerikaner das Zepter in der Hand halten, hat man darüber hinaus gerade erst selbstbewusst die amerikanische Musik sich angeeignet und nun eigene Wege innerhalb derselben gefunden und proklamiert, da stößt man darauf, dass selbst am anderen Ende der Welt, in Gegenden, die man auf der popmusikalischen Weltkarte gar nicht auf Schirm hatte, Jazz, Bluegrass, Country, Rock und Popmusik ihren Siegeszug antraten, und das alles etwa zur selben Zeit wie bei uns.
Man verliert als Europäer ja doch manchmal die Übersicht über die Welt. Hat man doch gerade erst akzeptiert, dass sich mit der Entdeckung Amerikas der Horizont gezwungenermaßen erweitert hat und dass in der Popmusik die Amerikaner das Zepter in der Hand halten, hat man darüber hinaus gerade erst selbstbewusst die amerikanische Musik sich angeeignet und nun eigene Wege innerhalb derselben gefunden und proklamiert, da stößt man darauf, dass selbst am anderen Ende der Welt, in Gegenden, die man auf der popmusikalischen Weltkarte gar nicht auf Schirm hatte, Jazz, Bluegrass, Country, Rock und Popmusik ihren Siegeszug antraten, und das alles etwa zur selben Zeit wie bei uns.
Die Bilder ähneln sich, wenn man das opulente großformatige Buch von Chris Bourke aufschlägt: Tanzkapellen, die in ODJB-Manier posieren, größere oder kleinere Swingorchester. Doch dann hält man inne: Gleich zwei Frauen sitzen in der Band von Walter Smith, eine am Banjo, eine am Klavier. An anderer Stelle sieht man ein Banjo-, Mandolinen- und Gitarrenorchester einschließlich eines selbstgebauten Bass-Banjos. Immer wieder Musiker mit Maori oder polynesischem Hintergrund.
Neuseeland, am anderen Ende der Welt, reagierte auf die Jazzmode durchaus zur selben Zeit wie Europa. Bourke beschränkt sich in seiner Darstellung nicht auf die Geschichte des Jazz in Neuseeland, sondern betrachtet den Jazz als Teil vieler anderer populärer und vor allem aus den USA stammender Musikströmungen, die das Land eroberten, und eines der Themen, die sich wie ein roter Faden durchs Buch ziehen, ist die Verbindung all dieser amerikanischen Musikgenres mit den Südseerhythmen der Ureinwohner oder der von Neuseeland abhängigen Inselstaaten der Region.
Viele der Namen, die in seinem Buch auftauchen sind uns Westlern wahrscheinlich fremd. Er nennt etwa den Gitarren- und Banjovirtuosen Walter Smith, den Perkussionisten Bob Adams oder den Saxophonisten Abe Romain, der 1930 nach England ging und dort 1932 in der Begleitband für Louis Armstrong mitwirkte. Er betrachtet die Bedeutung des Rundfunks für die Verbreitung moderner Rhythmen in Neuseeland und wirft einen Blick auf frühe Plattenproduktionen mit Musik der Maoris.
Die Tanzkapellen der 1930er Jahre professionalisieren die Szene, und neben Swing- und Sweetbands erwähnt Bourke für diese Zeit auch erstmals einen Countrysänger, Tex Morton, der sowohl in Neuseeland als auch Australien Furore machte und zwischen 1936 und 1943 an die 100 Titel einspielte.
Der II. Weltkrieg erreichte auch unsere Antipoden. Bourke druckt Reproduktionen einzelner Songtitel ab, die den Kampf der neuseeländischen Truppen unterstützen sollten, und er begleitet die Royal New Zealand Air Force Band auf ihren erfolgreichen inländischen Tourneen. 1942 landeten die ersten US-Amerikaner in neuseeländischen Häfen an und brachten ihre eigene Musik mit. Schwarze Amerikaner allerdings, schreibt Bourke, waren in Neuseeland zwar ab und an zu sehen, ihre Musik aber sei kaum gehört worden. Eine der amerikanischen Bands immerhin, die nach einer langen Tour durch den Pazifik in Auckland anlangte, wurde vom Klarinettisten Artie Shaw geleitet.
Für die direkte Nachkriegszeit beleuchtet Bourke die Monopolkämpfe der Plattenindustrie, beschreibt Vertriebswege und Verkaufsstrategien. Einschübe beleuchten etwa die Karriere des blinden Pianisten Julian Lee, der auf Anraten Frank Sinatras in die Vereinigten Staaten ging, dort Sessions mit Chet Baker und anderen spielte und Arrangements für Stan Kenton schrieb.
Ende der 1950er Jahre veränderte sich die Popmusikszene. Sängerinnen und männliche Vokalgruppen wurden beliebt, genauso pseudo-Hawaiianische Bands und Country-and-Western-Gruppen. Bourke hebt besonders die Sängerin Mavis Rivers hervor, die Pianistin Nancy Harrie und den Pianisten Crombie Murdoch. Die Fotos fangen an etwas lächerlich zu wirken, wenn man neuseeländische Musiker in Cowboyhut und mit Westerngürtel sieht, eine Pseudo-Folklore, die durchaus auch auf das ländliche Leben des eigenen Landes Bezug nehmen wollte. Zugleich eroberte auch die Rock ‘n’ Roll-Welle das Land mit Covers der Hits von Elvis Presley, Bill Haley und anderen.
Bourke lässt seine neuseeländische Popmusikgeschichte im Jahr 1964 enden, also mit dem Erfolg des Rock ‘n’ Roll. In seinem Vorwort schreibt er, er wäre gern eingehender auf regionale Szenen eingegangen, die aber glücklicherweise in lokal begrenzten Geschichtsdokumentationen abgedeckt seien. Sein Buch jedenfalls gibt einen exzellenten Einblick in ein – aus europäischer Sicht – sehr exotisches Kapitel der globalen Popmusikentwicklung.
Wolfram Knauer (September 2011)
Horst Lippmann. Ein Leben für Jazz, Blues und Rock
von Michael Rieth
Heidelberg 2010 (Palmyra Verlag)
230 Seiten, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-930378-79-1
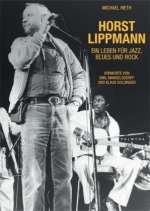 Zusammen mit seinem langjährigen Kompagnon Fritz Rau verkörperte Horst Lippmann den Siegeszug amerikanischer Musik im Nachkriegsdeutschland. Er spielte er Schlagzeug, organisierte im Restaurant seiner Eltern Jam Sessions, gab eigene Zeitschriften zum Jazz heraus, ermutigte die Gründung von Hot-Clubs und Hot-Club-Zusammenschlüssen zur Deutschen Jazzföderation, ermöglichte Konzerte und Festivalevents mit vielen deutschen Musikern und begleitete nicht zuletzt amerikanische Stars, die sich in seinen Händen so wohl fühlten, dass es sich bald herumsprach und Lippmann+Rau zur erfolgreichsten deutschen Konzertagentur zwischen Jazz, Blues, Rock und darüber hinaus wurde.
Zusammen mit seinem langjährigen Kompagnon Fritz Rau verkörperte Horst Lippmann den Siegeszug amerikanischer Musik im Nachkriegsdeutschland. Er spielte er Schlagzeug, organisierte im Restaurant seiner Eltern Jam Sessions, gab eigene Zeitschriften zum Jazz heraus, ermutigte die Gründung von Hot-Clubs und Hot-Club-Zusammenschlüssen zur Deutschen Jazzföderation, ermöglichte Konzerte und Festivalevents mit vielen deutschen Musikern und begleitete nicht zuletzt amerikanische Stars, die sich in seinen Händen so wohl fühlten, dass es sich bald herumsprach und Lippmann+Rau zur erfolgreichsten deutschen Konzertagentur zwischen Jazz, Blues, Rock und darüber hinaus wurde.
Jetzt hat Michael Rieth die Geschichte Horst Lippmanns niedergeschrieben und dabei versucht sich Lippmann als Geschäftsmann, als Jazz- und Musikfan und als Mensch zu nähern. Rieth weiß darum, wie wichtig Lippmanns oft nur im Hintergrund wahrgenommenen Aktivitäten für das deutsche Jazzleben waren, und immer wieder verweist er auf diese Bezugsstränge: Lippmanns Faszination mit der Musik, Lippmanns pragmatische Projektideen und -umsetzungen, der populären Erfolg dieser Projekte und die daraus resultierenden Veränderungen in Lippmanns Privat- und Geschäftsleben.
Gleich in seinem Vorwort erklärt Rieth, dass er, der Feuilletonist, der Literatur näher stünde als der biographischen Faktenhuberei. Und so liest sich sein Buch flüssig und spannend, weil er hinter den Lebensstationen, hinter den Begegnungen, hinter den musikalischen Begebenheiten, die Geschichten sucht, das Menschliche, das Lippmann dazu brachte dies oder jenes zu tun. So lässt Rieth die jugendliche Faszination Lippmanns durch den Jazz lebendig werden, stöbert in den “Jazz News”, die Lippmann ab Frühsommer 1945 (!) in hektographierter Form herausgab, fühlt das Entstehen einer lokalen Jazzszene nach, bei dem die Frankfurter Jazzer mindestens genauso wichtig waren wie die Möglichkeit für die Amerikaner und mit den Amerikanern zu spielen. Er zeichnet die Gründung des legendären Jazzkellers nach, aber auch die Sessions und Feiern “im Hause Lippmanns”, anfangs in Frankfurt, später im neu gebauten Eigenheim nahe des Flughafens. Olaf Hudtwalcker, Carlo Bohländer und Emil Mangelsdorff finden Erwähnung, und auch die Plattennachmittage, bei denen Lippmann und andere Vorträge über ihre liebsten Künstler oder neue Entwicklungen im Jazz vorbereiteten.
Familie Lippmann erhält noch schnell ein eigenes Kapitel, bevor Rieth vom Fan zum Geschäftsmann Lippmann schwenkt, der Sidney Bechet und Ted Heath nach Deutschland holte, Tourneen bekannter Jazzensembles für die Deutsche Jazzföderation durchführte, und, nachdem er sich während der Jazz at the Philharmonic-Tournee des Jahres 1952 als Organisationsgenie entpuppte, künftig sämtliche deutsche Tourneen für Norman Granz durchführte. Natürlich lässt Rieth Lippmanns langjährigen Geschäftspartner Fritz Rau zu Wort kommen, und er transkribiert Raus unnachahmlich dialektgefärbten Tonschlag, der so viel an Wärme und Freundschaft rüberbringt, die “nur” in Worten leicht verloren ginge. Rieth würdigt Lippmanns Einfluss sowohl auf die Gründung des Jazzensembles des Hessischen Rundfunks als auch einer eigenen Jazzredaktion beim hr oder seine Tätigkeit als Regisseur der SWR-Fernsehreihe “Jazz – gehört und gesehen”. Sein Engagement (und Kiesers Plakate!) beim Deutschen Jazz Festival ist genauso Thema wie das American Folk Blues Festival und dessen Einfluss auf die britische Rockmusik. Den Arbeitsalltag von Lippmann + Rau überlässt Rieth Lippmanns Kompagnon Rau, von dem ja erst kürzlich eine eigene Biographie voller Geschichten und Erlebnisse erschien.
Einige Stationen in Lippmanns so überaus aktivem Leben vernachlässigt Rieth in seinem Buch, etwa die Produktionen, die er in den 1960er Jahren für das Label Columbia machte und mit denen er dem deutschen modernen Jazz eine Plattform geben wollte. Solche und andere Details aber werden in anderen Bücher abgehandelt, etwa in Jürgen Schwabs opulentem “Der Frankfurt Sound”. Michael Rieth gelingt in seiner Biographie vor allem eines: den Menschen Horst Lippmann in seiner ganzen Faszination durch und Begeisterung für den Jazz darzustellen, die letzten Endes Beweggrund auch für all seine geschäftlichen Entscheidungen war. Es ist ein lesenswertes Buch geworden, schnell verschlungen, weil Rieth Anekdoten mit Reflexionen mischt, und weil seine Sprache sich nun mal “gut liest”. Es ist eine liebevolle und gelungene Verneigung vor diesem großen deutschen Impresario und mehr noch vor dem großartigen Jazzfreund Horst Lippmann.
Wolfram Knauer (September 2011)
Das Blaue Wunder. Blues aus deutschen Landen.
Herausgegeben von Winfried Siebers und Uwe Zagratzki
Eutin 2010 (Lumpeter & Lasel)
540 Seiten, 27,80 Euro
ISBN 9788-3-9812961-5-0
 Man merkt den Herausgebern den guten Willen an, eine tiefgehende, vielschichtige Analyse des Status quo des Blues in Deutschland zu liefern. Ausdrücklich wollen sie sich nicht am weit verbreiteten Abgesang auf den Blues beteiligen, sondern vielmehr seine Vielfalt in “regionalen Formen und heterogenen Nischen” dokumentieren. Allein es fehlen den beteiligten Autoren hier und da die zündenden Ideen dieses umzusetzen.
Man merkt den Herausgebern den guten Willen an, eine tiefgehende, vielschichtige Analyse des Status quo des Blues in Deutschland zu liefern. Ausdrücklich wollen sie sich nicht am weit verbreiteten Abgesang auf den Blues beteiligen, sondern vielmehr seine Vielfalt in “regionalen Formen und heterogenen Nischen” dokumentieren. Allein es fehlen den beteiligten Autoren hier und da die zündenden Ideen dieses umzusetzen.
Die Vorgaben der Herausgeber sind offensichtlich und sinnvoll, das erahnt man bereits an den Überschriften der einzelnen Buchteile: “Musiker und Zuhörer“, “Markt und Medien“, “Regionen und Orte“, “Geschichte und Geschichten“ in die das Buch gegliedert ist. Dass fast durchgehend in allen Kapiteln im Wesentlichen “Geschichtchen“ ausgebreitet werden, kann man den Autoren nicht wirklich zum Vorwurf machen. Es wimmelt im Blues ja nur so von Individualisten und Eigenbrödlern.
Heraus gekommen ist dadurch ein buntes und vielfältiges Panoptikum deutscher Bluesgeschichte von Nord nach Süd und von Ost nach West. Von den unterschiedlichen Arbeitbedingungen und Perspektiven derer, die auf der Bühne, bei den Labels, im Radio oder als Veranstalter den Blues haben, erfährt man so einiges. Vieles davon lässt Schlussfolgerungen über den Zustand des Blues in der deutschen Gegenwart zu.
So befasst sich Mit-Herausgeber Winfried Siebers analytisch in seinem Beitrag mit deutschsprachigen Blueszeitschriften. Dass er sich dabei ausschließlich mit den der siebziger und achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts beschäftigt, mag man allerdings wiederum fast als symptomatisch für das ganze Buch betrachten: Viele der beschriebenen Szenarien verharren in der Vergangenheit, meist in den für den Blues in Deutschland glorreichen 70ies und 80ies. Die Gegenwart kommt dabei mancherorts zu kurz, nicht nur in diesem Beitrag.
Wer sich gerne in unterhalsame Schilderungen der Highlights lokaler Szenen hineinlesen mag, für den ist dieses Buch eine gelungene Bett- oder Urlaubslektüre. Und die humorvoll-ironischen Anekdoten, die der Kabarettist und Schriftsteller Thomas C. Breuer in “Das Blaue Wunder“ am Ende eines jeden Buchabschnitts beisteuert, sorgen allemal dafür, dass man nach dem ein oder anderen zugegebenermaßen etwas schwerfälligen Beitrag nicht allzu schnell wegschlummert.
Arndt Weidler (Dezember 2011)
Da den moderne dansemusik kom til Danmark
von Erik Moseholm
Hellerup 2010 (Erik Moseholm Forlag)
247 Seiten, 2 CDs mit 85 Titeln
ISBN: 978-87-993793-0-9
 Der dänische Kritiker und Musikwissenschaftler Erik Wiedemann veröffentlichte 1982 die Früchte jahrzehntelange Arbeit über den Jazz in Dänemark. Jetzt legt der renommierte dänische Kontrabassist, Komponist und Jazzpädagoge Erik Moseholm ein Buch, das einmal einen ganz anderen Blick auf die europäische Jazzrezeption zu Beginn des 20sten Jahrhunderts wirft und nämlich fragt, “wie die moderne Tanzmusik nach Dänemark kam”. Ganz bewusst also spricht er im Titel nicht von Jazz, sondern von Tanzmusik. Sein Buch ist eine Kulturgeschichte der musikalischen Akkulturation, des amerikanischen Einflusses, der Skepsis, dass mit Ragtime, Cakewalk und Co die Werte dänischer Kultur zugrunde gehen könnten, aber auch der Faszination mit einer fremden Kultur und zaghaften Versuchen, sie für eigene Zwecke nutzbar zu machen, etwa indem man den tanzbaren Rhythmen dänische Texte unterlegte. Vor allem aber ist sein Buch eine Dokumentation des Verständnisses von Jazz als einer Musik, zu der man tanzen sollte, als einer Musik, bei der das Tanzen im Vordergrund steht.
Der dänische Kritiker und Musikwissenschaftler Erik Wiedemann veröffentlichte 1982 die Früchte jahrzehntelange Arbeit über den Jazz in Dänemark. Jetzt legt der renommierte dänische Kontrabassist, Komponist und Jazzpädagoge Erik Moseholm ein Buch, das einmal einen ganz anderen Blick auf die europäische Jazzrezeption zu Beginn des 20sten Jahrhunderts wirft und nämlich fragt, “wie die moderne Tanzmusik nach Dänemark kam”. Ganz bewusst also spricht er im Titel nicht von Jazz, sondern von Tanzmusik. Sein Buch ist eine Kulturgeschichte der musikalischen Akkulturation, des amerikanischen Einflusses, der Skepsis, dass mit Ragtime, Cakewalk und Co die Werte dänischer Kultur zugrunde gehen könnten, aber auch der Faszination mit einer fremden Kultur und zaghaften Versuchen, sie für eigene Zwecke nutzbar zu machen, etwa indem man den tanzbaren Rhythmen dänische Texte unterlegte. Vor allem aber ist sein Buch eine Dokumentation des Verständnisses von Jazz als einer Musik, zu der man tanzen sollte, als einer Musik, bei der das Tanzen im Vordergrund steht.
Moseholm beginnt mit einem Blick auf die europäische Tanzkultur um 1900. Er nennt afro-amerikanische Musiker und Tänzer, die noch weit vor dem Jazz auch in Dänemark auftraten, Sängerinnen und Minstrel-Acts. Er erkennt, dass der Ragtime und der Cakewalk als eine Art exotischer Modetanz nach Europa und damit auch nach Dänemark kamen und zeigt zeitgenössische Karikaturen von Festen mit “Kakedans”, wie der Cakewalk auf Dänisch hieß. Auch das Kapitel “Onestep, Vrikkedans, Twostep og Klapstep” beschäftigt sich mit afro-amerikanischer Musik als Tanzphänomen, beleuchtet diverse Modetänze der Zeit vor 1920, die meist amerikanische Namen trugen.
1919 wurde in Dänemark erstmals der Jazz als ein neues musikalisches Phänomen aus den Vereinigten Staaten thematisiert. Die Original Dixieland Jazz Band und Paul Whiteman waren die Bandbreite, in der Jazz in jenen Jahren rezipiert wurde, also kaum als schwarze Musik, auch wenn der afro-amerikanische Ursprung all der jüngsten musikalischen Entwicklungen durchaus bewusst war. Mosehol erwähnt dänische Musiker, die sich mit der neuen Tanzmusik aus Amerika beschäftigten. Henrik Clausen, Valdemar Eiberg, Emil Reesen und andere Namen fallen, und Moseholm wirft auch einen Blick auf seltsam anmutende Besetzungen wie etwa die Banjo-überladene Kapelle von Marius Hansen. Überhaupt sind Banjo und Saxophon (und vielleicht noch das Schlagzeugset) die am meisten wahrgenommenen und herausgestellten Instrumente dieser neuen Musik.
Doch die Musik an und für sich spielt in diesem Buch tatsächlich eher eine Nebenrolle, das sich vor allem mit dem Phänomen der Tanzmusik beschäftigt und dabei das Tanzen und das Musikmachen “zum Tanzen” in den Vordergrund rückt. Moseholm tut gut daran, auf dieser Tatsache ein wenig herumzureiten, wurde doch der Jazz tatsächlich bis weit in die 1920er Jahre hinein mindestens genauso sehr als Tanz denn als Musik wahrgenommen. Die ersten Bücher über Jazz beschrieben das den Tanz mindestens genauso ausführlich wie die Musik, zu der da getanzt wurde. Erst aus der Rückschau wurde aus dem jazz selbst dieser frühen Jahre eine reine Hörmusik. Doch wer die Rezeption des frühen Jazz in Europa ohne seine enge Verbindung zum Tanz betrachtet, missversteht die Umgebung, in der diese Musik hier gepflegt wurde.
Zwischendurch immerhin wirft Moseholm auch den einen oder anderen Blick auf die Orchesterleiter und Bands, die für die Tanzmusik jener Jahre in Dänemark verantwortlich waren, beleuchtet die Arbeit des Staatlichen Radiosinfonieorchesters, nennt Otto Lington, Teddy Petersen, Kaj Julian Olsen, Erik Tuxen, Kai Ewans, Louis Preil und andere. Für die 1930er Jahre reflektiert er noch kurz über die aufkommende Jitterbug-Mode und listet in einem abschließenden Kapitel Modetänze auf, sortiert nach den Jahren, in denen sie in Dänemark eingeführt wurden. In den 1950er Jahren sei das Phänomen des Jazz als Tanzmusik weitestgehend Geschichte, schreibt Moseholm; Jazz sei vor allem Konzertmusik geworden und seine Funktion als Tanzmusik sei nun von anderen Genres übernommen worden.
In einem Appendix zum Buch findet sich etwas unvermittelt zum Rest des Buchs dann noch eine ausführliche biographische Skizze des Schlagzeugers Allan Rasmussen, der in der dänischen Jazzszene der Nachkriegszeit aktiv war.
Dem Buch sind zwei CDs beigefügt, die insgesamt 85 Titel enthalten, eingespielt zwischen 1909 und 1944.
Der Jazzbassist Erik Moseholm wirft mit seinem Buch einen erfrischend “anderen Blick” auf die Rezeption afro-amerikanischer Musik in Europa, einen Blick auf die in den meisten Jazzgeschichtsbüchern oft vernachlässigte Funktion dieser Musik. Sein Buch ist damit vor allem als sinnvolle Ergänzung der zu Beginn erwähnten Jazzgeschichte von Erik Wiedemann zu lesen.
Wolfram Knauer (September 2011)
Historia Jazzu w Polsce
von Krystian Brodacki
Krakau 2010 (PWM Edition)
626 Seiten
ISBN
978-83-224-0917-6
 Unter den europäischen Jazzgeschichten ist die polnische die vielleicht konnotationsbelastete. Überall im Osten stand der Jazz für Freiheit, war ein Fenster in den Westen, ein Symbol für eine andere Art von Demokratie, für Individualität und Eigenständigkeit. In Polen aber schufen Jazzmusiker Freiräume, die weit über den Jazz hinausreichten. Kristian Brodackis Buch erzählt die Geschichte des Jazz in Polen von den 1920er Jahren bis heute, und ein Subtext seines Buches ist neben den biographischen Stationen der erwähnten Musiker immer, wie diese Musik sich in einem System durchsetzen konnte, das dem Jazz eigentlich eher suspekt gegenüberstand. Die ersten Jahre bis Kriegsende füllen die ersten 100 Seiten und handeln von Ady Rosner und von Strategien in angespanntester Lage, jene faszinierende amerikanische Musik zu machen, zu hören und dazu zu tanzen. Dann geht Brodacki chronologisch in Fünfjahresschritten vor, beleuchtet einzelne Biographien, lokale Szenen und die um die Jazzszene langsam entstehenden Netzwerke, Clubs und Zeitschriften. International bekannte Musiker wie Krzysztof Komeda oder Tomasz Stanko werden ausführlich gewürdigt, aber allein beim Durchblicken des Namensindex merkt man schnell, dass es Brodacki auf Vollständigkeit ankam. Die macht die Lektüre denn auch stellenweise etwas anstrengend, wenn sie über lange Strecken Namensketten bildet, aber weniger über die Besonderheit des betreffenden Individualstils aussagt. Solche musikalischen Chatakterisierungen überlässt Brodacki vor allem Musikerzitaten, die er immer wieder in seinen Text einfließen lässt. Brodackis Werk ist auf jeden Fall ein wichtiger Stein auf dem Weg zu einer immer noch nicht vollendeten europäischen Jazzgeschichte, die die vielen nationalen Geschichten dieser Musik zusammenfasst und miteinander verwebt.
Unter den europäischen Jazzgeschichten ist die polnische die vielleicht konnotationsbelastete. Überall im Osten stand der Jazz für Freiheit, war ein Fenster in den Westen, ein Symbol für eine andere Art von Demokratie, für Individualität und Eigenständigkeit. In Polen aber schufen Jazzmusiker Freiräume, die weit über den Jazz hinausreichten. Kristian Brodackis Buch erzählt die Geschichte des Jazz in Polen von den 1920er Jahren bis heute, und ein Subtext seines Buches ist neben den biographischen Stationen der erwähnten Musiker immer, wie diese Musik sich in einem System durchsetzen konnte, das dem Jazz eigentlich eher suspekt gegenüberstand. Die ersten Jahre bis Kriegsende füllen die ersten 100 Seiten und handeln von Ady Rosner und von Strategien in angespanntester Lage, jene faszinierende amerikanische Musik zu machen, zu hören und dazu zu tanzen. Dann geht Brodacki chronologisch in Fünfjahresschritten vor, beleuchtet einzelne Biographien, lokale Szenen und die um die Jazzszene langsam entstehenden Netzwerke, Clubs und Zeitschriften. International bekannte Musiker wie Krzysztof Komeda oder Tomasz Stanko werden ausführlich gewürdigt, aber allein beim Durchblicken des Namensindex merkt man schnell, dass es Brodacki auf Vollständigkeit ankam. Die macht die Lektüre denn auch stellenweise etwas anstrengend, wenn sie über lange Strecken Namensketten bildet, aber weniger über die Besonderheit des betreffenden Individualstils aussagt. Solche musikalischen Chatakterisierungen überlässt Brodacki vor allem Musikerzitaten, die er immer wieder in seinen Text einfließen lässt. Brodackis Werk ist auf jeden Fall ein wichtiger Stein auf dem Weg zu einer immer noch nicht vollendeten europäischen Jazzgeschichte, die die vielen nationalen Geschichten dieser Musik zusammenfasst und miteinander verwebt.
Wolfram Knauer (August 2011)
The Jazz Loft Project. Photographs and Tapes of W. Eugene Smith from 821 Sixth Avenue, 1957-1965
von Sam Stephenson
New York 2010 (Alfred A. Knopf)
268 Seiten, 40,00 US-Dollar
ISBN: 978-0-307-26709-2
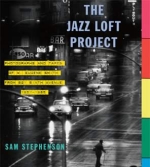 Es ist eine skurile Geschichte, die Anlass dieses Buchs ist: Der Fotograf W. Eugene Smith, der einen gut bezahlten Job bei der Illustrierten “Life” hatte, zog 1957 in ein heruntergekommenes Gebäude auf der Sixth Avenue zwischen 28ster und 29ster Straße. Er begann das Treiben auf der Straße im New Yorker Blumenviertel zu dokumentieren, aber auch das nächtliche Treiben im Haus selbst, in dem neben ihm der Fotograf David X. Young lebte, aber auch die Jazzmusiker Hall Overton und Dick Cary. Das Gebäude wurde bald zu einem der heißesten Jam-Session und Probenorte der Stadt, und Smith, der wie ein Besessener seine Umwelt mit der Kamera dokumentierte, begann auch die Klänge mitzuschneiden, indem er das ganze Gebäude mit Mikrofonen überzog und aufnahm, was immer sich im Gebäude tat. Im Nachlass des Fotografen fanden sich so etwa 40.000 Bilder, die er zwischen 1957 und 1965 im oder um das Gebäude herum aufgenommen hatte sowie 1.740 Tonbänder (also 4.000 Stunden) mit Musik, Gesprächen, Telefonaten, Rundfunksendungen und vielem mehr – eine Komplett-Dokumentation von Zeitgeschichte, vergleichbar vielleicht den Dean-Benedetti-Mitschnitten Charlie Parkers, die vor einigen Jahren auf dem Mosaic-Label veröffentlicht wurden, nur noch viel verrückter und umfassender.
Es ist eine skurile Geschichte, die Anlass dieses Buchs ist: Der Fotograf W. Eugene Smith, der einen gut bezahlten Job bei der Illustrierten “Life” hatte, zog 1957 in ein heruntergekommenes Gebäude auf der Sixth Avenue zwischen 28ster und 29ster Straße. Er begann das Treiben auf der Straße im New Yorker Blumenviertel zu dokumentieren, aber auch das nächtliche Treiben im Haus selbst, in dem neben ihm der Fotograf David X. Young lebte, aber auch die Jazzmusiker Hall Overton und Dick Cary. Das Gebäude wurde bald zu einem der heißesten Jam-Session und Probenorte der Stadt, und Smith, der wie ein Besessener seine Umwelt mit der Kamera dokumentierte, begann auch die Klänge mitzuschneiden, indem er das ganze Gebäude mit Mikrofonen überzog und aufnahm, was immer sich im Gebäude tat. Im Nachlass des Fotografen fanden sich so etwa 40.000 Bilder, die er zwischen 1957 und 1965 im oder um das Gebäude herum aufgenommen hatte sowie 1.740 Tonbänder (also 4.000 Stunden) mit Musik, Gesprächen, Telefonaten, Rundfunksendungen und vielem mehr – eine Komplett-Dokumentation von Zeitgeschichte, vergleichbar vielleicht den Dean-Benedetti-Mitschnitten Charlie Parkers, die vor einigen Jahren auf dem Mosaic-Label veröffentlicht wurden, nur noch viel verrückter und umfassender.
Das Buch “The Jazz Loft Project” erzählt die Geschichte des Hauses 821 Sixth Avenue und seiner Bewohner, festgehalten durch die Bilder und Tonbänder W. Eugene Smiths und untermauert durch Interviews mit Zeitzeugen. Die Bilder zeigen Musiker wie Thelonious Monk, der sich im Haus regelmäßig mit Hall Overton traf, um sein Town-Hall-Konzert vorzubereiten und mit der Bigband dort zu proben, Zoot Sims, Buck Clayton, Dave McKenna, Bud Freeman, Wingy Manone, Gus Johnson, Jimmy Giuffre, Bob Brookmeyer, Jim Hall, Ronnie Free und viele andere, bei Sessions oder in Gesprächen. Viele der exzellenten Fotos aber haben gar keinen Jazzgehalt, sondern zeigen einfach Szenen von der Straße, Blumenlieferungen für den Floristen gegenüber, einen Tortenbäcker, aus Autos ein- und aussteigende Menschen, Spaziergänger im Schnee, einen Unfall, Norman Mailer, Salvador Dali, einen Polizisten, eine Frau mit Kinderwagen. Dazwischengeschaltet, mit Datum versehen Transkripte aus den Bändern, Dialoge zwischen Musikern, Gesprächsfetzen, den Hörtrack zu Sonny Clark, wie er sich Heroin spritzt und langsam high wird und seine Freunde sich Sorgen machen, ob alles in Ordnung ist. Monk und Overton unterhalten sich über das bevorstehende Konzert. Roland Kirk spricht mit Jay Cameron, Alice Coltrane und Smith diskutieren darüber, ob es wohl rechtlich und ethisch in Ordnung sei, all die Musik im Loft aufzunehmen. Zwischendrin bunte Abbildungen der Tonband-Cover und ihrer Beschriftungen, der Leihhausquittungen für Kameras, die Smith kurzzeitig weggab, um Geld locker zu machen. Zoot Sims erzählt von einem Club, in dem er für Striptease-Tänzerinnen spielte. Eine Frau wühlt in ihrer Handtasche. Ein Mann fegt Blumen von der Straße auf. Zufällige Szenen und doch nicht zufällig, herausgegriffen aus acht Jahren Fotos und Tonbändern, dem Blick aus dem Haus, in das Haus auf der Sixth Avenue.
Ein Buch für Voyeure, meint man stellenweise, und doch mit so viel Gespür und sorgfältigen liebevollen Kommentaren ediert, dass die Frage, “Darf der das überhaupt?!” nicht wirklich aufkommt. Ein wunderbares Buch, das in der Unaufgeregtheit, der Dokumentation des Belanglosen die Zeit genauso zurechtrückt wie es sie verklärt. Für Fotoliebhaber, für Jazzfans, für jeden, für Historiker der Beats. Ein erstaunliches Dokument der Zeitgeschichte, begleitet von einer Website (www.jazzloftproject.org), auf der man in einige der Bänder hineinhören kann und dass außerdem eine Rundfunkdokumentation über das Jazz Loft Project verlinkt.
Wolfram Knauer (Juli 2011)
Monument Eternal. The Music of Alice Coltrane
von Franya J. Berkman
Middletown/CT 2010 (Wesleyan University Press)
132 Seiten, 27,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8195-6925-7
 Nicht nur in der klassischen Musik hat das Schicksal einige Musikerinnen um ihren Ruhm gebracht, weil sie mit Männern verheiratet waren, deren Glanz sie so stark überstrahlte, dass ihre eigene Kreativität kaum mehr wahrgenommen oder wertgeschätzt wurde. Was für Clara Schumann, Fanny Mendelssohn und andere gilt, das findet im Jazz quasi in Alice Coltrane eine Entsprechung. Die Musikwissenschaftlerin Franya J. Berkman hat sich nun daran gemacht, Alice Coltrane aus der Versenkung zu befreien, in die die Jazzgeschichte sie hat fallen lassen, würdigt in ihrer aus einer Dissertation hervorgegangenen Studie die Eigenständigkeit der Musik, die Alice Coltrane seit den frühen 1960er Jahren hervorgebracht hat und die den Jazz als klar abgegrenztes Genre weit transzendiert. Die Jahre nach dem Tod ihres Mannes verbrachte Swamimi Turiyasanitananada, wie Alice Coltrane in ihrem Vedanic Center in Kalifornien genannt wurde, mit der Erforschung einer Verbindung afro-amerikanischer Wurzeln und südasiatischer Musizierpraktiken. Dabei liegt dem lebenslangen Wirken der Pianistin, Harfenistin und Komponistin eine spirituelle Grundhaltung zugrunde, die aus familiärer Spiritualität stammt und die sie als religiöse Sucherin bis zuletzt hochhielt. Die Untersuchung von Spiritualität in der Musik der 1960er und 1970er Jahre aber, weiß Berkman, hat immer auch hoch-politische Gehalt, so dass sie neben der Geschichte der Musikerin und ihrer spirituellen Entwicklung immer auch die Einbettung dieser Entwicklung in die politische Lage der USA in jenen Jahren zu betrachten hat.
Nicht nur in der klassischen Musik hat das Schicksal einige Musikerinnen um ihren Ruhm gebracht, weil sie mit Männern verheiratet waren, deren Glanz sie so stark überstrahlte, dass ihre eigene Kreativität kaum mehr wahrgenommen oder wertgeschätzt wurde. Was für Clara Schumann, Fanny Mendelssohn und andere gilt, das findet im Jazz quasi in Alice Coltrane eine Entsprechung. Die Musikwissenschaftlerin Franya J. Berkman hat sich nun daran gemacht, Alice Coltrane aus der Versenkung zu befreien, in die die Jazzgeschichte sie hat fallen lassen, würdigt in ihrer aus einer Dissertation hervorgegangenen Studie die Eigenständigkeit der Musik, die Alice Coltrane seit den frühen 1960er Jahren hervorgebracht hat und die den Jazz als klar abgegrenztes Genre weit transzendiert. Die Jahre nach dem Tod ihres Mannes verbrachte Swamimi Turiyasanitananada, wie Alice Coltrane in ihrem Vedanic Center in Kalifornien genannt wurde, mit der Erforschung einer Verbindung afro-amerikanischer Wurzeln und südasiatischer Musizierpraktiken. Dabei liegt dem lebenslangen Wirken der Pianistin, Harfenistin und Komponistin eine spirituelle Grundhaltung zugrunde, die aus familiärer Spiritualität stammt und die sie als religiöse Sucherin bis zuletzt hochhielt. Die Untersuchung von Spiritualität in der Musik der 1960er und 1970er Jahre aber, weiß Berkman, hat immer auch hoch-politische Gehalt, so dass sie neben der Geschichte der Musikerin und ihrer spirituellen Entwicklung immer auch die Einbettung dieser Entwicklung in die politische Lage der USA in jenen Jahren zu betrachten hat.
Berkman beginnt mit biographischen Notizen: Geboren in Detroit nahm Alice McLeod mit sieben Jahren Klavierunterricht und spielte bald in der Baptistengemeinde, der ihre Familie angehörte. Berkman beschreibt die Musik- und insbesondere die lebendige Jazzszene Detroits in den 1940er und 1950er Jahren und das Modern-Jazz-Network, das sich dort bald zwischen vielen später namhaften Musikern herauskristallisierte. Alices älterer Halbbruder Ernest Farrow war ein angesehener Kontrabassist auf der Detroiter Jazzszene und der Pianist Barry Harris, der fast Alices Halbschwester geheiratet hätte, waren wichtige Lehrer für die Pianistin. In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre spielte Alice mit den Premieres, einem “Lounge Act”, der Gospel und Rhythm ‘n’ Blues jener Jahre mischte. 1960 verbrachte zusammen mit ihrem ersten Mann, dem Bebop-Sänger Kenny Hagood, ein Jahr in Paris, wo sie Bud Powell traf, der für sie ein weiterer wichtiger musikalischer Mentor werden sollte. Zurück in den USA (inzwischen geschieden und mit einem ersten Kind) trat Alice mit eigener Band in Detroit auf, der unter anderem der Saxophonist Bennie Maupin angehörte. Während ihrer Pariser Zeit hatte sie John Coltrane ein erstes Mal gehört, als dieser mit Miles Davis dort auftrat. 1962 spielte Coltrane mit eigener Band in Detroit und Alice war hingerissen davon, wie weit er die musikalische Sprache des Bebop vorangebracht hatte. Alice tourte mit der Band des Vibraphonisten Terry Gibbs, mit dem sie 1963 ihre ersten Aufnahmen machte. Berkman analysiert einige ihrer Soli und zeigt dabei die Einflüsse von Harris und Powell, zeigt zugleich, dass Alice McLeod hier schon lange keine Novizin mehr war, sondern eine gereifte Musikerin.
Terry Gibbs’ Band spielte im Sommer 1963 als Vorgruppe für John Coltranes Quartett, und bald waren die beiden erst ein Liebes-, dann ein Ehepaar. Im Februar 1966 machte Alice ihre ersten Aufnahmen mit John Coltrane, und der Einfluss, den ihr Mann auf ihre musikalische Sprache hatte, ging wohl durchaus auch in die andere Richtung: Sie beide entwickelten ihre musikalische genauso wie ihre familiäre und ihre spirituelle Seite nunmehr gemeinsam weiter. Berkman nähert sich all diesen Aspekten und verortet das Interesse der beiden an einer Art universeller Spiritualität auch in der politischen Situation der 1960er Jahre. Coltrane, konstatiert sie, habe in Alice die musikalische Suche geweckt – zuvor sei sie doch recht konventionell in ihren ästhetischen Vorstellungen gewesen. Ihr Mann habe ihr vor allem durch die Praxis des Zusammenspiels neue Wege gewiesen, sagt Alice, nicht etwa durch technische Erklärungen. Vor diesem Hintergrund analysiert Berkman “Manifestation”, einen Mitschnitt der John Coltrane Band, der erst 1995 veröffentlicht wurde.
Nach dem Tod ihres Mannes musste Alice Coltrane sein musikalisches, spirituelles und familiäres Erbe weitertragen. Berkman spielt einen Moment lang die Psychoanalytikerin und diagnostiziert eine schwere Depression, ausgelöst durch den Verlust des Saxophonisten. Ihre ersten Alben nach Coltranes Tod fanden zwar nicht den größten kritischen Zuspruch, zeigten aber, wie Berkman schreibt, eine sich entwickelnde Komponistin, die mit neuen Timbres und Instrumentierungen experimentiert, mit der Beziehung zwischen Struktur und Freiheit und dem Potential einer ruhigeren Dynamik. Berkman analysiert die ersten Alben der frühen 1970er Jahre, insbesondere “Universal Consciousness” von 1971 und beschreibt den Einfluss ihres indischen Gurus auf ihre Arbeit. 1976 hatte Alice eine Erweckungserfahrung, aufgrund derer sie die orange Kluft eines spirituellen Führers der Hindu-Tradition aufnahm und einen Ashram gründete. Berkman beschreibt die Hymnen, die jetzt Teil eines spirituellen Rituals wurden und dabei den Zirkelschluss einer Entwicklung von religiösem Erwachen bis religiöser Erweckung bilden.
Berkmans Buch ist aus einer Dissertation entstanden, dennoch über weite Strecken flüssig zu lesen, da die Autorin sich an der Biographie genauso wie den Aufnahmen von Alice Coltrane entlang hangelt. Stellenweise würde man sich eine etwas ausführlichere Diskussion spiritueller Tendenzen in der afro-amerikanischen Community ihrer Zeit wünschen, um John und Alice Coltranes Entwicklung besser einpassen zu können. Das aber war nicht die von der Autorin selbst gestellte Aufgabe, und so liefert “Monument Eternal” einen mehr als brauchbaren Einblick in Leben und Werk einer von der Jazzgeschichte zu Unrecht links liegen gelassenen Künstlerin.
Wolfram Knauer (Juli 2011)
Kurt Henkels. Eine Musiker-Biographie mit ausführlicher Diskographie
von Gerhard Conrad
Hildesheim 2010 (Olms)
252 Seiten, 19,80 Euro
ISBN: 978-3-487-08499-2
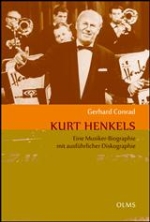 Kurt Henkels war einer der erfolgreichsten deutschen Bandleader, der in der DDR als Leiter des Rundfunk-Tanzorchesters gekonnt Swing und Schlager miteinander verband, 1959 dann die DDR verließ und in Westdeutschland erst beim, NDR, und später kurze Zeit beim ZDF ein Orchester leitete. Henkels wäre im Jahr 2010 hundert Jahre alt geworden; aus Anlass des Jubiläums widmet Gerhard Conrad ihm eine Biographie. Conrad ist einer der kenntnisreichsten Experten zum frühem Jazz und zur Tanzmusik in Deutschland, und er kann für sein Buch auf eigene Recherchen, vor allem aber auch auf Gespräche mit vielen Zeitgenossen des Bandleaders, ja sogar mit Henkels selbst zurückgreifen.
Kurt Henkels war einer der erfolgreichsten deutschen Bandleader, der in der DDR als Leiter des Rundfunk-Tanzorchesters gekonnt Swing und Schlager miteinander verband, 1959 dann die DDR verließ und in Westdeutschland erst beim, NDR, und später kurze Zeit beim ZDF ein Orchester leitete. Henkels wäre im Jahr 2010 hundert Jahre alt geworden; aus Anlass des Jubiläums widmet Gerhard Conrad ihm eine Biographie. Conrad ist einer der kenntnisreichsten Experten zum frühem Jazz und zur Tanzmusik in Deutschland, und er kann für sein Buch auf eigene Recherchen, vor allem aber auch auf Gespräche mit vielen Zeitgenossen des Bandleaders, ja sogar mit Henkels selbst zurückgreifen.
Sein Buch ist vollgefüllt mit Fakten, Details und Geschichten, vermittelt dabei über die Daten eines Lebens und musikalischen Wirkens hinaus auch viel über die Lebenswirklichkeit eines Musikers zwischen Jazz und Unterhaltungsmusik, eines Musikers, der seine Liebe, die swingende Musik, auch in einem Land hochhalten wollte, in dem der Jazz als Musik des Klassenfeind galt. Conrad unterscheidet dabei meist klar zwischen Jazz und Tanzmusik, ohne diese Unterscheidung zu einer Wertung werden zu lassen. Und immer wieder beschreibt er knapp, aber kenntnisreich einzelne Aufnahmen Henkels.
Das Buch wird abgerundet durch eine ausführliche Diskographie der Aufnahmen Kurt Henkels von 1948 bis 1965. Conrad beleuchtet mit seiner Biographie Henkels scheinbar nur ein Randkapitel deutscher Jazzgeschichte, schildert dabei aber zugleich viel von der Lebenswirklichkeit, mit der auch Jazzmusiker sich immer wieder auseinanderzusetzen hatten.
Wolfram Knauer (März 2011)
Blues In My Eyes. Jazzfotografien aus sechs Jahrzehnten
Weitra (Österreich) 2010 (Bibliothek der Provinz)
204 Seiten, 39 Euro
ISBN: 978-3-85252-603-4
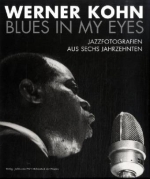 Der Bamberger Fotograf Werner Kohn ist seit den späten 1950er Jahren mit der Kamera unterwegs und dokumentiert seit 1959 regelmäßig auch Konzerte mit Jazz- oder Blueskünstlern. Nun ist ein opulenter Bildband erschienen, in dem fast 200 seiner Fotos zu sehen sind, schwarzweiß oder Farbe, meist auf der Bühne und bei der Arbeit. Das Buch heißt “Jazzfotografien”, daneben aber sind auch Blues- und Rockmusiker zu sehen, in Aufnahmen von 1959 bis 2004 (also aus eigentlich fünf statt sechs Jahrzehnten). Die Armstrong All Stars machen den Anfang, Ella, Ellington, Monk, Coltrane, Doldinger und viele andere. Es sind teils witzige, teils spannende Fotos, etwa von Bertice Reading in einem genialen Sackkleid von 1961, Jimmy Rushing schräg von oben mit Hut, Champion Jack Dupree tanzend, Prince und die Beatles, Miles Davis, Gunter Hampel, Herb Geller. Die meisten der Fotos sind Bühnenportraits, zeigen die Musiker bei der Arbeit am Instrument, vermitteln Intensität, Konzentration oder auch relaxtes Swingen. Viele der Fotos, gerade auch von unbekannteren Musikern, scheinen einen Einblick in die tatsächliche Arbeitswelt der Musiker zu geben; andere Fotos sind wohl vor allem der historischen Bedeutung wegen in die Sammlung aufgenommen worden. Auch unter den farbigen Portraits immerhin gibt es einige exzellente Bilder, das von Pharoah Sanders etwa, oder vom schweißüberströmten Maceo Parker, und auch auf den ersten Blick unscharfe Bilder können durchaus eine bewegende künstlerische Aussage besitzen, etwa das Bild vom träumerisch spielenden Woody Allen an der Klarinette.
Der Bamberger Fotograf Werner Kohn ist seit den späten 1950er Jahren mit der Kamera unterwegs und dokumentiert seit 1959 regelmäßig auch Konzerte mit Jazz- oder Blueskünstlern. Nun ist ein opulenter Bildband erschienen, in dem fast 200 seiner Fotos zu sehen sind, schwarzweiß oder Farbe, meist auf der Bühne und bei der Arbeit. Das Buch heißt “Jazzfotografien”, daneben aber sind auch Blues- und Rockmusiker zu sehen, in Aufnahmen von 1959 bis 2004 (also aus eigentlich fünf statt sechs Jahrzehnten). Die Armstrong All Stars machen den Anfang, Ella, Ellington, Monk, Coltrane, Doldinger und viele andere. Es sind teils witzige, teils spannende Fotos, etwa von Bertice Reading in einem genialen Sackkleid von 1961, Jimmy Rushing schräg von oben mit Hut, Champion Jack Dupree tanzend, Prince und die Beatles, Miles Davis, Gunter Hampel, Herb Geller. Die meisten der Fotos sind Bühnenportraits, zeigen die Musiker bei der Arbeit am Instrument, vermitteln Intensität, Konzentration oder auch relaxtes Swingen. Viele der Fotos, gerade auch von unbekannteren Musikern, scheinen einen Einblick in die tatsächliche Arbeitswelt der Musiker zu geben; andere Fotos sind wohl vor allem der historischen Bedeutung wegen in die Sammlung aufgenommen worden. Auch unter den farbigen Portraits immerhin gibt es einige exzellente Bilder, das von Pharoah Sanders etwa, oder vom schweißüberströmten Maceo Parker, und auch auf den ersten Blick unscharfe Bilder können durchaus eine bewegende künstlerische Aussage besitzen, etwa das Bild vom träumerisch spielenden Woody Allen an der Klarinette.
Gewiss zeigen einige Bilder fotografische Schwächen, sind leicht unscharf, sehr pixelig oder haben kaum Tiefenschärfe. So passiert es, dass etwa das Gesicht von Margie Evans zu einem flachen orangenen Mond zu werden scheint oder die Silhouetten von Harry Belafonte und Dianne (nicht “Diana!”!) Reeves wie platte Scherenschnitte vor einen schwarzen Hintergrund geklebt wirken. An diesen Stellen hätte man sich einen kritischeren Bildlektor gewünscht. Einige dieser Fotos haben sicher dokumentarischem Wert, doch bedarf dieser dann auch der Erklärung. Von daher man meint im Vorwort von Rolf Sachsse ein gewisses Augenzwinkern mitzulesen, wenn dieser anmerkt, dass sich Kohn “beim Jazz an William P. Gottlieb, Herman Leonard und William Claxton messen lassen” muss. Diese Messlatte ist ziemlich hoch, und Gottlieb, Claxton und Leonard hatten meistens eine editorische Begleitung, die ähnliche Ausrutscher zumindest erklärten. Nichtsdestotrozu schafft es Werner Kohn, uns mitzunehmen in die Konzerte und leiht uns für den Augenblick des Kameraklicks seine Augen, seine Sicht auf den Jazz.
Wolfram Knauer (März 2011)
Der zornige Baron. Das Prinzip Diskontinuität im Leben und konzept-kompositorischen Schaffen des Charles Mingus jr.
von Hans-Joachim Heßler
Duisburg 2010 (United Dictions of Music)
589 Seiten, 29,80 Euro
ISBN: 978-3-942677-00-4
 Der Titel des Buches sagt bereits einiges über seinen Inhalt aus: Ein etwas reißerisch wirkender Ober- und ein wissenschaftlich komplexer Untertitel. “Der zornige Baron” steht als Metapher für die Persönlichkeit von Charles Mingus, die sich in seiner Musik widerspiegelt und biographische wie gesellschaftliche Unzufriedenheit abbildet. “Das Prinzip Diskontinuität im Leben und konzept-kompositorischen Schaffen des Charles Mingus jr.” steht für die wissenschaftliche Reflektion über Persönlichkeit und Musik. Ein Spagat also zwischen dem Begreifen und Beschreiben des enorm emotionalen Ausdrucks der Musik des Kontrabassisten und Bandleaders und ihrer Verwurzelung in Lebens- und Gesellschaftserfahrungen sowie der Analyse und Einordnung nach unterschiedlichen wissenschaftlichen Kriterien.
Der Titel des Buches sagt bereits einiges über seinen Inhalt aus: Ein etwas reißerisch wirkender Ober- und ein wissenschaftlich komplexer Untertitel. “Der zornige Baron” steht als Metapher für die Persönlichkeit von Charles Mingus, die sich in seiner Musik widerspiegelt und biographische wie gesellschaftliche Unzufriedenheit abbildet. “Das Prinzip Diskontinuität im Leben und konzept-kompositorischen Schaffen des Charles Mingus jr.” steht für die wissenschaftliche Reflektion über Persönlichkeit und Musik. Ein Spagat also zwischen dem Begreifen und Beschreiben des enorm emotionalen Ausdrucks der Musik des Kontrabassisten und Bandleaders und ihrer Verwurzelung in Lebens- und Gesellschaftserfahrungen sowie der Analyse und Einordnung nach unterschiedlichen wissenschaftlichen Kriterien.
Heßlers Einleitung verweist dabei gleich auf seinen interdisziplinären Ansatz, der vor allem musiksoziologische, sozialpsychologische und musikanalytische Herangehensweisen miteinander verbinden will. Einer der roten Fäden, die sich durch seine Arbeit ziehen, ist dabei die stilistische Vielfältigkeit, der sich Mingus in seiner Arbeit bedient und die ihn Heßler “im Kontext des Idealtypus einer musikalischen Postmoderne” analysieren lässt – bereits hier ein Verweis auf die im Untertitel der Arbeit apostrophierte “Diskontinuität”. Ein zweiter roter Faden ist der Einfluss von Hautfarbe und tatsächlichem oder gefühltem Rassismus auf Mingus’ Werk und Ästhetik. Der problematischste der präsentierten Ansätze scheint auf den ersten Blick jener der sozialpsychologischen Methodik zu sein, innerhalb dessen Heßler die These aufstellt: “Im Verlauf seiner Sozialisation fühlte sich Charles Mingus jr. verschiedenen kulturellen Systemen zugehörig: dem weißen, dem mulattischen und dem schwarzen”, um dann aus den “unterschiedlichen sozialen Rollen, die er dabei einzunehmen hatte” seine “diskontinuierliche Persönlichkeitsstruktur und letztendlich [das] strukturbildende Merkmal der Diskontinuität in seiner Musik” abzuleiten (S. 64). Im folgenden dann bemüht Heßler Freud, Lacan und andere Psychoanalytiker, Philosophen und Soziologen, um Mingus’ Persönlichkeit aus seiner Familie, der sozialen Spannung seines Aufwachsens heraus zu erklären.
Das Kapitel über Mingus’ Sozialisation in Kindheit und Jugend beginnt Heßler mit einem Verweis auf die biologische Anthropologie bedient und spricht dabei – zugegeben: in Vorbereitung auf eine komplexere Betrachtungsweise – von “drei unterschiedlichen Erscheinungsformen (Rassen)” (S. 87), die Charles Mingus in sich vereinige. Im Wissen darum, worum es Heßler dabei tatsächlich geht, fühlte sich der Rezensent hier und in der folgenden Auseinandersetzung mit Mingus’ eigener Identitätskrise als Afro-Amerikaner doch etwas unwohl bei der Verwendung Hautfarbe beschreibender Termini. Es mag dies vielleicht mehr ein begriffliches als ein inhaltliches Problem sein: Im Deutschen jedenfalls sind Begriffe wie “Rasse”, “Mulatte” etc. nun mal belastet. Vielleicht wäre es hilfreicher, hier mit den englischen Originalbegriffen zu operieren, also “race”, “mulatto”, um dadurch den Unterschied der Konnotationen im Englischen und im Deutschen in den Terminus mit einzubeziehen. Überhaupt aber wäre es dem Thema angemessen (und dem Leser durchaus zuzumuten), die Quellen (etwa aus “Beneath the Underdog”) im englischen Original zu präsentieren statt in deutschen Übersetzungen oder das englische Original zumindest in Fußnoten zu zitieren.
Solche kritischen Anmerkungen beziehen sich allerdings eher auf Marginalien ins Heßlers Argumentation. Seine ausführlichen Darstellung von Mingus’ Biographie und deren Einfluss auf seine ästhetischen Haltungen macht letzten Endes sehr klar deutlich, dass Mingus vor allem ein soziales Identitätsproblem besaß, mit dem er sich in einer durch die Bedeutung von Hautfarbe dominierten Gesellschaft keiner der ihn umgebenden Gruppen richtig zugehörig fühlte. Seine Analysen von Aufnahmen des Komponisten beschreiben Klangeindrücke und Strukturabläufe, greifen charakteristische Details heraus und bieten auch schon mal interessante Vergleiche, etwa wenn er Mingus’ “The Chill of Death” Richard Strauß’ “Tod und Verklärung” gegenüberstellt. Gerade in Bezug auf diese Komposition wäre darüber hinaus eine Diskussion der Einordnung des Mingus’schen Schaffens in den Third-Stream-Diskurs der 50er Jahre interessant, an dem Mingus ja durchaus aktiv teilnahm.
Ein eigenes Kapitel widmet Heßler den musikalischen Einflüssen etwa durch Jelly Roll Morton, Art Tatum, Louis Armstrong, Lionel Hampton, Charlie Parker und Red Norvo. Er analysiert Übernahmen und Annäherungen an Mortons Stil, sowohl was den Ragtime als auch den Einfluss lateinamerikanischer Musik anbelangt. Er entdeckt den harmonischen Einfluss Tatums vor allem auf die kompositorische Sprache des Bassisten. Er benennt die klare Aussage durch improvisatorische Mittel, aber auch die New-Orleans-spezifischen Besetzungsdetails als Aspekte, die Mingus von Armstrong übernommen habe. Bei Hampton habe er sein Solotalent entdeckt (etwa in “Mingus Fingers”). Parker habe nicht nur neue musikalische Möglichkeiten aufgezeigt, sondern die Musik auch ins Politische hinein geöffnet; er habe ihm außerdem das Verständnis von Musik als Sprache vermittelt. Norvo habe kammermusikalische Klangkombinationen erforscht, die Mingus in späteren Bands auf andere Art und Weise fortführen sollte.
Eine ganz andere Herangehensweise an Mingus’ Musik versucht Heßler, indem er Studierende der Universität Dortmund einer Befragung zum Gesamteindruck über Stücke von Mingus, Frank Zappa und John Zorn unterzog – jeweils Stücken, die ähnlich wie Mingus mit strukturellen Brüchen arbeiteten. Er fragt nach Hörerwartungen und dem Erlebnis der kompositorischen und strukturellen Umbrüche im Ablauf der Stücke. Im selben Kapitel (das überschrieben ist mit “Mingus im Blickfeld von Philosophie und Soziologie”) fragt Heßler dann auch nach den ökonomischen Bedingungen, innerhalb derer Mingus’ Musik entstand. Er beschreibt wirtschaftliche Abhängigkeiten, Eigeninitiativen, etwa beim Plattenlabel Debut, beim Jazz Workshop oder der Firma Charles Mingus Enterprises.
Das Kapitel “The Angry Man” nähert sich dem zornigen Mingus – zornig gegenüber den Medien, gegenüber anderen Musikern, gegenüber dem Publikum. Das Kapitel “Mingus als homo politicus” betrachtet den Bassisten und Komponisten in seinen politischen Aussagen, die er sowohl in den Titeln seiner Kompositionen, in Ansagen oder eigenen Texten machte. Ausführlich diskutiert Heßler hier Stücke wie “Fables of Faubus”, “Freedom”, “Haitian Fight Song”, “Remember Rockefeller at Attica”, “Free Cell Block F, ‘Tis Nazi USA” und “Meditations on Integration” als politische Musik.
Im Schlusskapitel schließlich verschränkt Heßler die verschiedenen Argumentationsstränge seiner Arbeit noch einmal: Sklaverei und Rassismus, schwarze Musik und schwarze Identität, Diskontinuität als Personalstil, und wendet all diese Diskurse auf “Pithecanthropus Erectus” an.
Heßlers Arbeit ist eine ambitionierte Studie zur Persönlichkeit und Musik von Charles Mingus. Insbesondere in den theoretischen Diskursen ist das – dem thematischen Ansatz der Studie zuzuschreiben – schon mal etwas schwerfällig zu lesen; doch versäumt Heßler es nicht, diese theoretische Ebene immer wieder ins Praktische hinüberzuretten, und die von ihm benutzten Diskurse ganz konkret auf die Musik anzuwenden. Seine Studie ist dabei keine Gesamtstudie des Mingus’schen Schaffens – so fehlt etwa eine Diskussion über improvisatorische Facetten in Mingus’ Arbeit, über seinen Personalstil als Kontrabassist oder über die kommunikativen Aspekte seiner Werke –, aber das ist auch nicht das Thema des Buchs. Dem strukturellen Arbeiten in Mingus’ Musik fügt Heßler auf jeden Fall einige interessante Facetten bei und bereichert so die Literatur zu Charles Mingus um ein wichtiges Kapitel.
(Wolfram Knauer, März 2011)
Jazz Behind the Iron Curtain
herausgegeben von Gertrud Pickhan & Rüdiger Ritter
Frankfurt/Main 2010 (Peter Lang)
316 Seiten, 49,80 Euro
ISBN: 978-3-631-59172-7
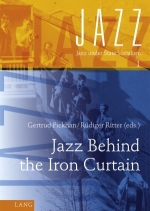 Das Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin hatte vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt unter dem Titel “Jazz im ‘Ostblock’ – Widerständigkeit durch Kulturtransfer” ins Leben gerufen, mit wissenschaftliche Arbeiten angeregt und unterstützt werden sollen, die sich mit der Geschichte des Jazz hinterm Eisernen Vorhang beschäftigen. Bei einer Tagung in Warschau im September 2008 wurden etliche dieser Projekte vorgestellt; das vorliegende Buch in englischer Sprache enthält die Referate der Warschauer Tagung und dabei in der Tat sehr vielfältige Ansätze an das vor allem als historisch begriffene Thema.
Das Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin hatte vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt unter dem Titel “Jazz im ‘Ostblock’ – Widerständigkeit durch Kulturtransfer” ins Leben gerufen, mit wissenschaftliche Arbeiten angeregt und unterstützt werden sollen, die sich mit der Geschichte des Jazz hinterm Eisernen Vorhang beschäftigen. Bei einer Tagung in Warschau im September 2008 wurden etliche dieser Projekte vorgestellt; das vorliegende Buch in englischer Sprache enthält die Referate der Warschauer Tagung und dabei in der Tat sehr vielfältige Ansätze an das vor allem als historisch begriffene Thema.
Insgesamt sind es 21 Beiträge sowie ein Tagungsbericht, aufgegliedert in fünf Schwerpunktgruppen: 1. USA – Europa, 2. Polen und die Sowjetunion als unterschiedliche Beispiele für die osteuropäische Jazzrezeption; 3. die baltischen Staaten; 4. Jazz in Zentral-Osteuropa; sowie 5. Jazz und Kunst.
Die meisten der Beiträge haben einen historischen Ansatz: Sie untersuchen Jazz als Zeichen der Widerständigkeit in totalitären Gesellschaften, als ein Symbol von Freiheit und Demokratie in Diktaturen. Als Gast der Tagung klopft der amerikanische Kulturwissenschaftler John Gennari das Verhältnis seines eigenen Landes, der USA, zum Freiheits-Topos des Jazz ab. Rüdiger Ritter schaut kritisch auf die Rolle des Radios, über das der Jazz viele aufstrebende Jazzfans im Osten erreichte, sei es über den RIAS, den AFN , Radio Free Europe oder die Voice of America.
Martin Lücke beleuchtet die Kampagne gegen den Jazz in der Sowjetunion der Jahre 1945-53; Michael Abeßer schließt an mit einer Darstellung der sowjetischen Jazz-Debatten zwischen 1953 und 1964. Marta Domurat liest die polnischen Zeitschriften “Jazz” und “Jazz Forum” und fragt nach ihrer Bedeutung für die ästhetische Akzeptanz dieser Musik. Piotr Baron nähert sich in einem der wenigen auf die Musik direkt abzielenden Beiträge des Buchs dem Phänomen “nationaler Stile” im Jazz am Beispiel des polnischen Jazz, stellt dabei letzten Endes aber vor allem Aussagen verschiedener polnischer Musiker nebeneinander, die Stimmungen, Haltungen wiedergeben, ohne diese anhand der Musik konkret näher zu beleuchten. Igor Pietraszewski schließlich nähert sich in einem eher soziologischen Ansatz der Lebenswirklichkeit polnischer Jazzmusiker.
Tiit Lauks Betrachtung des estnischen Jazz belässt es bei historischen Fakten; Heli Reimanns Annäherung an die Biographie des Lembit Saarsalu sagt weit mehr in den Interviewauszügen des Saxophonisten aus als in den Interpretationen derselben durch die Autorin. Gergö Havadi schaut für seinen Überblick über das Verhältnis des ungarischen Staats zum Jazz in die Berichte des ungarischen Geheimdienstes. Adrian Popan blickt auf ein “Jazz Revival” im Rumänien der Mitt-60er bis frühen 70er Jahre – mit Revival meint er hier ganz allgemein ein erstarkendes Interesse und vor allem ein vom System sanktioniertes Jazzleben nach einer Zeit weitgehender “Jazzlosigkeit”.
Peter Motycka widmet seinen Aufsatz der legendären Prager Jazz-Sektion, deren Aktivitäten letzten Endes mit zum Umbruch in der Tchechoslovakei beitrug. Christian Schmidt-Rost vergleicht, wie Musiker und Fans in der DDR und in Polen in den Jahren zwischen 1945 und 1961 mit dem Jazz in Berührung kamen. Marina Dmitrieva beleuchtet die “Stiliagi”, eine Art Jugendmode in der Sowjetunion, die eng mit dem Jazz assoziiert war und sich neben der Liebe zu dieser Musik auch in der Kleidung ausdrückte. Wiebke Janssen vergleicht die Jugendkultur der Halbstarken in der DDR und der BRD der 50er Jahre. Karl Brown dockt hier an und schreibt über Hooligans im kommunistischen Ungarn derselben Zeit. Michael Dörfel schließlich portraitiert die Jazz-und-Lyrik-Projekte, die in der DDR besonders populär waren.
All diese Beiträge bieten spannende und sehr unterschiedliche Ansätze an das Thema. Das Osteuropa-Projekt ist vor allem historisch orientiert, was sich auch in der Grundhaltung der Beiträge widerspiegelt. Und wenn man bedenkt, dass die Referenten hier aus ihrer laufenden Arbeit berichten, ist das gesamte Projekt nur zu beglückwünschen, schafft es doch ein Bewusstsein für eine historische Jazzforschung, die über kurz oder lang sicher über die Erfassung von Fakten und historisch-politische Zusammenhänge hinaus auch die Musik selbst betrachten wird.
Wolfram Knauer (März 2011)
Saxophone Colossus. A Portrait of Sonny Rollins
Fotos von John Abbott, Text von Bob Blumenthal
New York 2010 (Abrams)
160 Seiten, 45,00 US-$
ISBN: 978-0-8109-9615-1
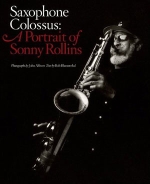 Der renommierte New Yorker Fotograf John Abbott dokumentierte Sonny Rollins seit 1993 auf und abseits der Bühne, und im vorliegenden Fotoband zeigt er, wie reich der Tenorsaxophonist ihn nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit exzellenten Motiven beschenkt hat. Wir sehen Rollins beim Newport Jazz Festival von 1993 vor jubelndem Publikum und Meer, beim Signieren von Schallplatten in seiner Berliner Garderobe, beim Soundcheck auf der Bühne der noch leeren Carnegie Hall, mit Pudelmütze beim Soundcheck in Frankfurt und Hamburg sowie in seinem Haus in Germantown, New York. Rollins ist eh fotogen, ob mit Rauschbart und wehenden Haaren, mit Hund oder mit Saxophon. Etliche von Abbotts meist farbigen Fotos zieren CDs, Plakate und Magazincover; man hat also durchaus sein Dejàvu-Erlebnis, etwa von Rollins ganz in rot oder von Rollins mit Christian McBride und Roy Haynes.
Der renommierte New Yorker Fotograf John Abbott dokumentierte Sonny Rollins seit 1993 auf und abseits der Bühne, und im vorliegenden Fotoband zeigt er, wie reich der Tenorsaxophonist ihn nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit exzellenten Motiven beschenkt hat. Wir sehen Rollins beim Newport Jazz Festival von 1993 vor jubelndem Publikum und Meer, beim Signieren von Schallplatten in seiner Berliner Garderobe, beim Soundcheck auf der Bühne der noch leeren Carnegie Hall, mit Pudelmütze beim Soundcheck in Frankfurt und Hamburg sowie in seinem Haus in Germantown, New York. Rollins ist eh fotogen, ob mit Rauschbart und wehenden Haaren, mit Hund oder mit Saxophon. Etliche von Abbotts meist farbigen Fotos zieren CDs, Plakate und Magazincover; man hat also durchaus sein Dejàvu-Erlebnis, etwa von Rollins ganz in rot oder von Rollins mit Christian McBride und Roy Haynes.
Dazwischen geschaltet sind Texte von Bob Blumenthal, der den Saxophonisten über die Jahre oft genug interviewte. Seine Kapitel strukturieren das Buch mit Überschriften wie “St. Thomas. Rollins & Rhythm” über die Liebe des Saxophonisten zu karibischen Rhythmen und sein Verhältnis zu Schlagzeugern; “You Don’t Know What Love Is. Sonny’s Sound” über ebendiesen, den kraftvollen Sound seines Instruments und den großen Einfluss Coleman Hawkins’; “Strode Rode. Rollins the Modernist” über Rollins Plattenproduktionen und den enormen Einfluss, den er selbst auf eine, ach was, gleich mehrere Generationen von Musikern hatte; sowie “Moritat. Sonny & Songs” über Sonny Rollins’ Liebe zur Melodie. Blumenthal gelingt dabei in der Konzentration eine knappe und doch sehr fundierte Charakterisierung der Rollins’schen Spielweise, so dass das Buch im ganzen – Fotos und Text zusammen – tatsächlich genau das ergeben, was der Titel des Buchs impliziert: “A Portrait of Sonny Rollins”. Liebevoll und empfehlenswert!
Wolfram Knauer (März 2011)
Unterhaltungsmusik im Dritten Reich
von Marc Brüninghaus
Hamburg 2010 (Diplomica Verlag)
106 Seiten, 39,50 Euro
ISBN: 978-3-8366-8813-0
 Jede Art der Kunst, vor allem aber die populäre Kunst war im Dritten Reich zugleich politisches Werkzeug. Der Jazz und die jazzverwandte Musik gehörten in den 1930er Jahren zur populären Musik, er verstieß allerdings zugleich gegen alle ästhetischen und rassischen “Reinheits”-Vorstellungen der Nazis. Marc Brüninghaus beschäftigt sich in seiner vorliegenden Arbeit mit der Rolle der Unterhaltungsmusik im Dritten Reich, fragt zugleich, wie es sein kann, dass “der Zeitraum von 12 Jahren, in dem von Deutschland aus größtes Leid über die Welt gebracht worden ist, gleichzeitig eine ‘Blüte’ einer unpolitisch erscheinenden Kunstform hervorbringen” konnte – insbesondere nämlich in den Schlagern von Stars wie Hans Albers, Marika Rökk, Zarah Leander oder Johannes Heesters.
Jede Art der Kunst, vor allem aber die populäre Kunst war im Dritten Reich zugleich politisches Werkzeug. Der Jazz und die jazzverwandte Musik gehörten in den 1930er Jahren zur populären Musik, er verstieß allerdings zugleich gegen alle ästhetischen und rassischen “Reinheits”-Vorstellungen der Nazis. Marc Brüninghaus beschäftigt sich in seiner vorliegenden Arbeit mit der Rolle der Unterhaltungsmusik im Dritten Reich, fragt zugleich, wie es sein kann, dass “der Zeitraum von 12 Jahren, in dem von Deutschland aus größtes Leid über die Welt gebracht worden ist, gleichzeitig eine ‘Blüte’ einer unpolitisch erscheinenden Kunstform hervorbringen” konnte – insbesondere nämlich in den Schlagern von Stars wie Hans Albers, Marika Rökk, Zarah Leander oder Johannes Heesters.
Nach seiner Einleitung beginnt Brüninghaus im zweiten Kapitel mit einer Bestandsaufnahme der Musiklandschaft im Dritten Reich, fragt nach ästhetischen und Wertevorstellungen im Bereich der “Ernsten” und der “Unterhaltungsmusik”, diskutiert die Idee einer “Deutschen Musik”, die sich als so schwer zu begründen herausstellte, dass sie spätestens 1936 aufgegeben wurde. Er diskutiert Wertmaßstäbe wie “Erhabenheit” im Bereich der Ernsten Musik und die Bevorzugung der Unterhaltungsmusik durch Propagandaminister Hoseph Goebbels, die “bei konservativen Musikern und Musikwissenschaftlern nicht nur auf Zustimmung” traf.
Im dritten Kapitel beleuchtet Brüninghaus die “Institutionalisierung der Musik im 3. Reich”, also insbesondere das “Amt Rosenberg” und die Reichsmusikkammer und ihre Aufgaben. Das vierte Kapitel widmet sich der politischen Rolle der Unterhaltungsmusik im nationalsozialistischen Deutschland, insbesondere ihrer Nutzbarkeit in Rundfunk, auf Schallplatten und im Film. Zugleich diskutiert der Autor die wechselnden Anforderungen an Unterhaltungsmusik während der zwölf Jahre der Nazi-Herrschaft sowie den Versuch einer Neudefinition von Kriterien für gute Unterhaltungsmusik – insbesondere letzteres ein klarer Vorstoß gegen den Jazz.
Dem Jazz wird das ganze fünfte Kapitel gewidmet. Brüninghaus macht klar, dass der Jazz “während des Dritten Reiches die am stärksten bekämpfte Musikrichtung im Bereich der Unterhaltungsmusik” war. Er ordnet den Jazzhass der Nazis ein in rassistisch und antisemitisch begründete Ablehnung dieser Musik bereits in den 1920er Jahren, beschreibt den Unterschied von staatlichem Anspruch und Realität (also dem Wunsch, Jazz aus dem Alltag zu verdrängen und der Popularität der Musik in der Bevölkerung). Er zitiert offizielle Stellungnahmen und die Umsetzung der Regeln in der musikalischen Wirklichkeit, und er benennt die unterschiedlichen Wege, auf denen Jazzanhänger dennoch ihre Musik hörten. Brüninghaus definiert die Jazzanhänger dabei als eine heterogene Gruppe, eher lokal verortet, “meist männliche Angehörige der Mittelschicht, Angehörige der Unterschicht wollten durch die Zugehörigkeit zu Jazzclubs oft den eigenen sozialen Status verbessern”. Längere Abschnitte widmet er in diesem Kapitel außerdem den “Jazzanhängern im Dienst des Regimes” sowie der Swingbewegung als einer Jugendbewegung der Zeit.
Alles in allem ist Brüninghaus eine knappe, aber durchaus der Sache angemessene Studie zur Situation der Unterhaltungsmusik im Dritten Reich gelungen. Er blendet biographische Details aus, schreibt weder über konkrete Musiker, Bands oder Aufnahmen, sondern konzentriert sich auf das Auseinanderdriften von öffentlicher Haltung und alltäglicher Wirklichkeit. Der Verweis auf die eine oder andere Quelle fehlt (etwa auf die samisdat-ähnlichen “Mitteilungen” zum Jazz, die in den Kriegsjahren vor allem auch an Wehrmachtsanhänger verschickt wurden und die 1993 im Buch “Jazz in Deutschland” des Jazzinstituts Darmstadt reproduziert wurden); das aber sind eher Randnotizen des Rezensenten. Auch bleibt Brüninghaus zum Schluss die Antwort auf die in der Einleitung dezidiert gestellte Frage schuldig bleibt, warum viele der Schlager, die in den 1930er Jahren geschrieben waren, noch heute populär sind. Doch hatte man diese Eingangsfrage während der Lektüre eh schon wieder vergessen, und so bleibt “Unterhaltungsmusik im Dritten Reich” eine lesenswerte Einführung ins Thema.
Wolfram Knauer (März 2011)
Hi-De-Ho. The Life of Cab Calloway
von Alyn Shipton
New York 2010 (Oxford University Press)
283 Seiten, 29,95 US-$
ISBN: 978-0-19-514153-5
 Alyn Shipton ist ein Vielschreiber, seine Biographien decken die Jazzgeschichte zwischen Swing und Modern Jazz ab, ein wenig wirkt er wie der Nachfolger John Chiltons, des phänomenalen Biographen von Sidney Bechet, Coleman Hawkins und anderen.
Alyn Shipton ist ein Vielschreiber, seine Biographien decken die Jazzgeschichte zwischen Swing und Modern Jazz ab, ein wenig wirkt er wie der Nachfolger John Chiltons, des phänomenalen Biographen von Sidney Bechet, Coleman Hawkins und anderen.
Shiptons neues Buch geht der Lebensgeschichte eines der größten Hipsters (wenn nicht gar des ersten) der Jazzgeschichte nach, Cab Calloways, dessen Einfluss auf die schwarze Musikgeschichte gar nicht groß genug eingeschätzt werden kann, weil er von in seiner Musik und seiner Bühnenpersönlichkeit schwarze Sprache und schwarze Kultur als Hipness feierte und dabei weit über die afro-amerikanische Bevölkerung hinaus populär machte.
Shipton ist ein Detektiv biographischer Forschung, wühlte in Archiven und sprach mit Zeitzeugen, Freunden, Bekannten, Kollegen und Geschäftspartnern des Sängers und Orchesterleiters. Er verfolgt Calloways Lebensweg ab seiner Geburt am Weihnachtstag 1907 in Baltimore. Calloways ältere Schwester Blanche war die erste, die eine Showbusiness-Karriere begann; sie schloss sich 1921 einer Tourband an und gehörte im Herbst 1924 bereits zu den etablierten Figuren der Chicagoer Jazzszene. 1927 kam Cab nach Chicago, sang in verschiedenen Clubs und lernte Louis Armstrong kennen, dessen Gesangsstil ihn besonders beeinflusste. Nachdem Armstrong Chicago in Richtung New York verließ, trat Calloway mit den Alabamians im Chicagoer Sunset Club auf, doch nach einem legendären Band-Wettstreit im New Yorker Savoy Ballroom wechselte er die Bands, trat mit den Missourians auf, die sich nicht viel später zum Cab Calloway Orchestra wurden. Mit ihnen und mit seinem Engagement im New Yorker Cotton Club beginnt zugleich die Zeit, in der Calloway auf Platten dokumentiert ist.
Shipton verweist auf Einflüsse aus dem afro-amerikanischen Showbusiness, von der Show “In Dahomey” bis zum Comedy-Duo Williams & Walker, noch mehr aber stellt er heraus, was Calloway aus diesen und anderen Einflüssen machte, wenn er die verschiedenen Timbres seiner Stimme einsetzte, um quasi mit sich selbst Call-and-Response-Phrasen zu erzeugen, wenn er scattete wie Armstrong, aber eben doch nicht wie der, sondern in seinem ganz eigenen Stil, der etwas sauberer wirkte und dennoch leicht verrucht, dem immer ein leichter Unterton der Ironie innezuwohnen schien.
Irving Mills, der Manager Duke Ellingtons erkannte, dass Calloway marktfähig war und übernahm schnell sein Management. Er pries ihn als “His Hi-De-Highness of Ho-De-Ho” an und machte so aus der Hipness des immer extravagant gekleideten Calloway ein Markenzeichen. Shipton beschreibt jene legendären drei Betty-Boop-Cartoons, die Calloway und seine Musik Anfang der 1930er Jahre auf die Leinwand brachten; er beschreibt aber auch die durch Calloways Popularität bedingte Schieflage im Niveau seiner Band: “Weil Cabs Band um ihn herum und seine Rolle als Sänger, Tänzer und Entertainer gebaut war statt um hoch-individuelle Solisten, auf die einzelne Kompositionen direkt zugeschneidert wurden, fiel sie im kritischen Vergleich immer etwas ab.”
Der Autor begleitet Calloway auf seiner Europatournee von 1934, die großen Einfluss hatte, da insbesondere die europäischen Fans Calloways Mode und Teile seiner Sprache übernahmen – die ZaZous, wie sich die französischen Swinganhänger in den 1930er Jahren nannten, leiteten sich direkt aus Calloways Texten ab.
Shipton beschreibt die “großen” Bands Calloways, jene mit Ben Webster Mitte der 1930er Jahre und jene mit Chu Berry Ende der 1930er Jahre und geht dabei auch auf wichtige Aufnahmen ein. Natürlich erzählt er die Geschichte Dizzy Gillespies, der von 1939 bis 1941 in der Band saß, bis ihn Calloway feuerte, weil er ihn (fälschlich) beschuldigte, mit einem Papierball nach ihm geworfen zu haben, was in einen Streit ausartete, bei dem Gillespie schließlich ein Messer zückte. Immerhin hatte Dizzy, während er in Calloways Band spielte, zusammen mit Milt Hinton harmonische Neuerungen ausprobiert, die wenig später bei der Entwicklung des Bebop von Bedeutung sein sollten.
Mit dem Krieg und dem Bebop begann der Niedergang der Bigbands, und Cab Calloway suchte nach neuen Möglichkeiten für seine Karriere. Die fand er als er 1952 die Rolle des Sportin’ Life in Gershwins Oper “Porgy and Bess” angeboten bekam, die Gershwin seinerseits nach dem Modell Calloways entworfen hatte, den er angeblich sogar für die Premiere der Oper 1935 als mögliche Besetzung im Sinn gehabt habe. “Porgy” wurde ein Riesenerfolg, sowohl in der Broadway- wie auch (zumindest kurz) in der Tournee-Version der Show. In den folgenden Jahren zog sich Calloway etwas zurück, bis ihm 1964 eine Rolle in “Hello Dolly” angeboten wurde.
In den 1970er Jahren waren Calloways Auftritte mehr Erinnerung an eine vergangene Zeit als wirklich aktuelle Musik; immerhin übernahm er 1978 eine Rolle im Broadway-Hit “Bubbling Brown Sugar”. Als er 1980 im Film “The Blues Brothers” zu sehen war, wurde allerdings eine neue, junge Generation hip über den Erfinder der Hipness. Calloway stand noch bis kurz vor seinem Tod im November 1984 auf der Bühne.
Shipton erzählt Calloways Geschichte als neutraler Beobachter, durchsetzt mit Verweisen auf Quellen aus zeitgenössischen Berichten, Interviews oder sonstige Quellen. Zwischendurch beleuchtet er auch etwa die kurze Ehe der Calloway-Tochter und Sängerin Chris Calloway mit dem Trompeter Hugh Masekela (sie hielt gerade mal drei Monate). Allerdings betrachtet er Calloway vor allem als historisches Phänomen und verpasst dabei ein wenig die Chance, ihn als Vorreiter weit späterer schwarzer Gesamtkunstwerke zu benennen – James Brown, Michael Jackson, Prince –, die dem weiß-gewandeten Calloway viel zu verdanken hatten. Nichtsdestotrotz ist diese Biographie ein solides Buch Jazzgeschichte und ergänzt damit hervorragend die 1976 erschienene Autobiographie des Sängers, Tänzers und Entertainers.
Wolfram Knauer (März 2011)
Ray Charles. Yes Indeed! Photographs by Joe Adams
Guildford, Surrey/England 2010 (Genesis Publications Limited)
152 Seiten, 235 Britische Pfund
ISBN: 978-1-905662-08-1
 Ray Charles war Star und Legende, und nur solchen wird es wohl zuteil, in enorm exklusiv aufgemachten Publikationen verewigt zu werden. “Ray Charles. Yes Indeed!” jedenfalls ist nichts geringeres, ein Coffee-Table-Buch zum Blättern und Erinnern, an eigene oder imaginierte Erlebnisse zur Musik des großen Soulkünstlers. Joe Adams arbeitete 44 Jahre lang für Ray Charles als Bühnenansager und Master of Ceremonies. Seine Kamera hatte er immer mit dabei, und so entstand eine Sammlung ungemein persönlicher Fotos von Konzerten, Proben, Aufnahmesitzungen, auf der Bühne, in der Garderobe, im Flieger oder vor Fernsehkameras. Die Dias wurden nach Charles Tod im den Büroräumen der Produktionsfirma des Künstlers gefunden. Sie zeigen vor allem einen Musiker, der allein durch seinen Starstatus offenbar immer im Mittelpunkt stand, der selbst in ruhigen Minuten, bei der Tasse Kaffee in der Garderobe, dem musikalischen Augenblick entgegenfieberte. Das Besondere des Buchs ist sicher auch die Tatsache, dass alle Fotos Farbaufnahmen sind, was dem Genre, in dem Charles tätig war, entgegenkommt: die Zeit des Soul war nun mal eine Zeit der bunten Farben.
Ray Charles war Star und Legende, und nur solchen wird es wohl zuteil, in enorm exklusiv aufgemachten Publikationen verewigt zu werden. “Ray Charles. Yes Indeed!” jedenfalls ist nichts geringeres, ein Coffee-Table-Buch zum Blättern und Erinnern, an eigene oder imaginierte Erlebnisse zur Musik des großen Soulkünstlers. Joe Adams arbeitete 44 Jahre lang für Ray Charles als Bühnenansager und Master of Ceremonies. Seine Kamera hatte er immer mit dabei, und so entstand eine Sammlung ungemein persönlicher Fotos von Konzerten, Proben, Aufnahmesitzungen, auf der Bühne, in der Garderobe, im Flieger oder vor Fernsehkameras. Die Dias wurden nach Charles Tod im den Büroräumen der Produktionsfirma des Künstlers gefunden. Sie zeigen vor allem einen Musiker, der allein durch seinen Starstatus offenbar immer im Mittelpunkt stand, der selbst in ruhigen Minuten, bei der Tasse Kaffee in der Garderobe, dem musikalischen Augenblick entgegenfieberte. Das Besondere des Buchs ist sicher auch die Tatsache, dass alle Fotos Farbaufnahmen sind, was dem Genre, in dem Charles tätig war, entgegenkommt: die Zeit des Soul war nun mal eine Zeit der bunten Farben.
Einleitend berichtet Adams selbst von seiner Arbeit für Charles, und auch Ray Charles selbst kommt zu Wort in einem Kapitel, in dem er knapp über seine Karriere bis zum Ende seines Atlantic-Vertrags erzählt. Zwischendrin finden sich kurze Zitate von Zeitgenossen, Musikerkollegen, Produzenten, Freunden, die sich an Ray Charles als Musiker, als Geschäftsmann, als Privatmensch erinnern.
“Ray Charles. Yes Indeed!” ist ein opulentes Buch, das sicher keine Biographie des Künstlers ersetzt und auch der Musik nur bedingt nahe kommt, das aber den Menschen Charles erahnen lässt in den visuellen wie verbalen Erinnerungen. Und es ist gewiss – mit Ledereinband, Silberschnitt, dickem Pappschuber udn einem hellblauen Stoffsäckchen, in dem das alles sauber aufbewahrt wird – ein exquisites (dabei leider auch entsprechend teures) Geschenk für jeden Ray-Charles-Fan.
Wolfram Knauer (Februar 2011)
Coltrane on Coltrane. The John Coltrane Interviews
herausgegeben von Chris DeVito
Chicago 2010 (Chicago Review Press)
396 Seiten, 26,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-56976-287-5
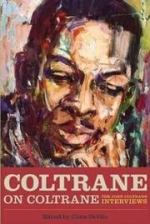 Hätte John Coltrane eine Autobiographie geschrieben, so läse diese sich gewiss völlig anders als das Buch “Coltrane on Coltrane”, das Chris DeVito aus veröffentlichten wie bislang unveröffentlichten Interviews mit dem Saxophonisten zusammenstellte. Die berühmten Interviews, etwa von August Blume, Don DeMichael, Ralph Gleason, Valerie Wilmer, François Postif oder Frank Kofsky sind genauso mit dabei – zum Teil in neuen Abschriften oder gar erstmaligen englischen Übersetzungen – wie kürzere Interview, Interviewausschnitte oder Artikel und Plattentexte, in denen Coltrane zu Worte kommt. Selbst ein wenig Fankorrespondenz ist da zu lesen, auch Interviews, in denen Coltrane sich vielleicht nicht ganz so wohl fühlte, etwa wenn er die Eingangsfrage Erik Lindgrens in Stockholm, was er zu den vielen kritischen Kommentaren über seinen Sound missversteht und denkt, Lindholm selbst hielte seinen Ton für scheußlich. Neues erfährt man dabei kaum; Coltrane war auch in beiläufigen Interviews ein seiner Worte bedächtiger Mann. Ausführliche Erinnerungen eines Jugendfreundes sowie der Leiterin der Granoff School, an der er in den 40er und frühen 50er Jahren Unterricht nahm. Eine opulente Sammlung immerhin, ein “case book” für weitere Forschung und als solches äußerst willkommen, hat man doch damit alle Quellen in einem Band vor sich. Aus Forschersicht sei allerdings auch in diesem Buch (wie auch bei anderen solchen Quellensammlungen) kritisch angemerkt, dass es wünschenswert wäre, wenn in den Texten die Seitenumbrüche angegeben würden, so dass man beim Zitieren auch entsprechend der Originalquellen zitieren kann. Aber das ist nun wirklich nur eine kleine Fußnote…
Hätte John Coltrane eine Autobiographie geschrieben, so läse diese sich gewiss völlig anders als das Buch “Coltrane on Coltrane”, das Chris DeVito aus veröffentlichten wie bislang unveröffentlichten Interviews mit dem Saxophonisten zusammenstellte. Die berühmten Interviews, etwa von August Blume, Don DeMichael, Ralph Gleason, Valerie Wilmer, François Postif oder Frank Kofsky sind genauso mit dabei – zum Teil in neuen Abschriften oder gar erstmaligen englischen Übersetzungen – wie kürzere Interview, Interviewausschnitte oder Artikel und Plattentexte, in denen Coltrane zu Worte kommt. Selbst ein wenig Fankorrespondenz ist da zu lesen, auch Interviews, in denen Coltrane sich vielleicht nicht ganz so wohl fühlte, etwa wenn er die Eingangsfrage Erik Lindgrens in Stockholm, was er zu den vielen kritischen Kommentaren über seinen Sound missversteht und denkt, Lindholm selbst hielte seinen Ton für scheußlich. Neues erfährt man dabei kaum; Coltrane war auch in beiläufigen Interviews ein seiner Worte bedächtiger Mann. Ausführliche Erinnerungen eines Jugendfreundes sowie der Leiterin der Granoff School, an der er in den 40er und frühen 50er Jahren Unterricht nahm. Eine opulente Sammlung immerhin, ein “case book” für weitere Forschung und als solches äußerst willkommen, hat man doch damit alle Quellen in einem Band vor sich. Aus Forschersicht sei allerdings auch in diesem Buch (wie auch bei anderen solchen Quellensammlungen) kritisch angemerkt, dass es wünschenswert wäre, wenn in den Texten die Seitenumbrüche angegeben würden, so dass man beim Zitieren auch entsprechend der Originalquellen zitieren kann. Aber das ist nun wirklich nur eine kleine Fußnote…
Wolfram Knauer (Februar 2011)
Klänge im Zeitalter ihrer medialen Verfügbarkeit. Popmusik auf globalen Märkten und in lokalen Kontexten
Von Susanne Binas-Preisendörfer
Bielefeld 2010 (transcript)
277 Seiten, 27,80 Euro
ISBN: 978-3-8376-1459-6
 Globalisierung, mediale Verfügbarkeit, das tagesaktuelle Wissen um Entwicklungen in anderen Kulturen und die schnelle Kommunikation sind Gegebenheiten unseres heutigen Lebens, die uns alle betreffen, und alle Bereiche unseres Lebens beeinflussen. Der Jazz, meint man, hat unter den Globalisierungstendenzen weniger zu leiden, weil er immer eine individualisierte und zumal noch eine “Minderheiten”-Musik war und die neuen Medien ihm vielleicht noch mehr nutzen als anderen Musiksparten. Doch den Jazz betrifft es natürlich auch, ist er schließlich nicht nur Genre, sondern eine Spielhaltung und hat doch gerade der Jazz immer global gehandelt, ist als musikalische Sprache durch die Welt gereist und hat Musiker immer dazu aufgefordert, “sie selbst” zu sein, “sich selbst” zu spielen. Susane Binas-Preisendöfer allerdings widmet sich der populären Musik, bei der die Gegensätze, die Frage nach Nutzen und Ausnutzen globaler Tendenzen sich weit stärker stellt als beim Jazz.
Globalisierung, mediale Verfügbarkeit, das tagesaktuelle Wissen um Entwicklungen in anderen Kulturen und die schnelle Kommunikation sind Gegebenheiten unseres heutigen Lebens, die uns alle betreffen, und alle Bereiche unseres Lebens beeinflussen. Der Jazz, meint man, hat unter den Globalisierungstendenzen weniger zu leiden, weil er immer eine individualisierte und zumal noch eine “Minderheiten”-Musik war und die neuen Medien ihm vielleicht noch mehr nutzen als anderen Musiksparten. Doch den Jazz betrifft es natürlich auch, ist er schließlich nicht nur Genre, sondern eine Spielhaltung und hat doch gerade der Jazz immer global gehandelt, ist als musikalische Sprache durch die Welt gereist und hat Musiker immer dazu aufgefordert, “sie selbst” zu sein, “sich selbst” zu spielen. Susane Binas-Preisendöfer allerdings widmet sich der populären Musik, bei der die Gegensätze, die Frage nach Nutzen und Ausnutzen globaler Tendenzen sich weit stärker stellt als beim Jazz.
Ihre Ausgangsfragen sind einfach: Wie verändert die Globalisierung die Popmusik? Wie bedingen sich die kulturell-sozialen und die technologisch-ökonomischen Aspekte von Popmusik und Globalisierung gegenseitig?
Im ersten Kapitel befasst sich die Autorin mit übergreifenden Aspekten zum Themenbereich und geht auf einzelne Beispiele ein. Sie diagnostiziert die “globale Präsenz” populärer Musik und die daraus sich ableitende Ortlosigkeit, der die Ortsgebundenheit einzelner populärer Musikerscheinungen gegenübersteht (Detroit-Techno, Berlin-Dub, Wiener Electronica). Sie fragt nach globalisierten Formen von Musik, also solchen Formen, die erst durch die Globalisierung möglich wurden. Sie überlegt, was tatsächlich an kulturellem Austausch stattfindet in dieser Globalisierung, und sie diskutiert die Beispiele der Ausnutzung lokaler traditioneller Musiken durch die aktuelle Popmusikindustrie, wenn etwa ein pazifisches Wiegenlied es auf die amerikanischen Billboard-Charts schafft und in Dance-Tracks eingebaut wird. Dieses Beispiel verfolgt sie dabei wieder aus verschiedenen Blickwinkeln, untersucht dabei die Marktmechanismen genauso wie die emotionalen Effekte, die musikethnologischen Gründe für die ursprüngliche Aufnahme des Liedes und die moralischen Aspekte seiner weltweiten Verwendung und Vermarktung ohne Rücksicht auf den Ursprung und ohne Nachdenken, was seine globale Verbreitung für Rückwirkungen haben könnte. Sie blickt dabei auf die verschiedenen Akteure im Musikprozess, betrachtet die Rechtslage, fragt nach ästhetischen Kriterien (warum ist ein pazifisches Wiegenlied für europäische Ohren angenehm?) und konstatiert die Suche nach der authentischen Fremdheit.
Im zweiten Kapitel geht es um Musiken der Welt, um World Music, um Global Pop, um die kulturelle Durchdringung musikalischer Traditionen also. Musik sei eine universale Sprache, hieße es immer wieder, zitiert die Autorin verschiedene Quellen, also werde Musik oft auch als eine universelle Problemlösung angesehen. (Tatsächlich sei europäische Kunstmusik eine veritable Weltmusik.) Dann befasst Binas-Preisendörfer sich mit Migration und kulturellem Austausch, mit der Frage um Homogenisierung oder Diversifizierung und mit der seltsamen Repertoirekategorie und Marketingstrategie “World Music” im 20sten Jahrhundert.
Das dritte Kapitel des Buchs beschäftigt sich mit der medialen Verfügbarkeit. Die Autorin beginnt mit einem Blick zurück auf die Entwicklung der Tonaufnahme und Vervielfältigungstechnologien. Sie dokumentiert die unterschiedlichen Umgänge mit Tondokumenten, die zum einen der Archivierung dienten, zum anderen eine Ware waren und damit bewusst marktgerecht verändert werden sollten. Sie nennt den Tonträger “eine Existenzform populärer Musik” und verweist auf die Entwicklung der Musikkassette in den 1960er Jahren als dezentralisierendes Format. Sie diskutiert Sampling und Copyright und schließlich die Bedeutung lokaler Märkte für die global agierende Musikwirtschaft. Zum Schluss stellt sie die Strategien der Musikgiganten gegenüber: “Think Globally, Act Locally” (SONY), “Globalize Local Repertoire” (BMG) und “One Planet – One Music” (MTV).
Susanne Binas-Preisendörfers Buch ist eine umfangreiche Analyse der globalen Aspekte populärer Musikkultur. Der Autorin gelingt es ihr komplexes Thema sachgerecht und dennoch gut lesbar zu sezieren, Denkanstöße zu geben und klarzustellen, dass sie letzten Endes über eine Entwicklung schreibt und damit nur ein Augenblicksurteil abgeben kann für Veränderungen, von denen man kaum absehen kann, wie sie weitergehen. Über den Jazz schreibt sie nicht, aber den Jazz als die erste globale populäre Musik betrifft ihre Analyse genauso wie jede Musik, die den Spagat ästhetischen Wollens und aktueller Marktgängigkeit eingehen muss.
Wolfram Knauer (Februar 2011)
Goin’ Home. The Uncompromising Life and Music of Ken Colyer
von Mark Pointon & Ray Smith
London 2010 (Ken Colyer Trust)
368 Seiten + CD, 20 Britische Pfund
ISBN: 978-0-9562940-1-2
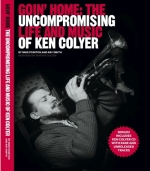 Das Wort “kompromisslos” kommt einem normalerweise wahrscheinlich eher bei Musikern avantgardistischer Stilrichtungen in den Sinn, und so mag es den oberflächlichen Kenner erstaunen, dass ausgerechnet dieses Wort den Titel der neuen umfangreichen Biographie des Trompeters Ken Colyer schmückt, der gemeinhin als die Vorzeigefigur für das Revival des New-Orleans-Jazz in England (und weit darüber hinaus in Europa) gilt, also alles andere als einem Genre der Avantgarde, weder der 40er, 50er noch 60er Jahre. Trotzdem hat es seine Berechtigung, Colyers Ästhetik als kompromisslos zu bezeichnen, und das großformatige Buch, das Mike Pointon und Ray Smith liebevoll zusammengestellt haben, erklärt warum dies so ist.
Das Wort “kompromisslos” kommt einem normalerweise wahrscheinlich eher bei Musikern avantgardistischer Stilrichtungen in den Sinn, und so mag es den oberflächlichen Kenner erstaunen, dass ausgerechnet dieses Wort den Titel der neuen umfangreichen Biographie des Trompeters Ken Colyer schmückt, der gemeinhin als die Vorzeigefigur für das Revival des New-Orleans-Jazz in England (und weit darüber hinaus in Europa) gilt, also alles andere als einem Genre der Avantgarde, weder der 40er, 50er noch 60er Jahre. Trotzdem hat es seine Berechtigung, Colyers Ästhetik als kompromisslos zu bezeichnen, und das großformatige Buch, das Mike Pointon und Ray Smith liebevoll zusammengestellt haben, erklärt warum dies so ist.
Die beiden Autoren haben Erfahrung mit dem Thema; sie schrieben zuvor eine Biographie Bill Russells, des Vaters des US-amerikanischen New-Orleans-Jazz-Revivals. Ihr Ansatz ist der einer Biographie mit vielen Zeitzeugenaussagen. Sie interviewten Musikerkollegen und mischen diese Erinnerungen – ein wenig wie in Shapiro Hentoffs legendärem “Hear Me Talkin’ To Ya” mit Auszügen aus Manuskriptfragmenten und Notizen, die Colyer für ein geplantes eigenes Buch auf Hotelbriefpapier und die Rückseiten von Flugtickets geschrieben hatte. Dazu kommen viele, zum großen Teil seltene Fotos, die Colyers Karriere dokumentieren.
Es beginnt mit dem Kapitel “Sounds in My Head”, einer Annäherung an Colyers musikalische Ästhetik. Natürlich habe er die New-Orleans-Trompeter geliebt, Percy Humphrey etwa. Louis Armstrongs In-den-Vordergrund-Spielen habe er nicht unbedingt für der Musik dienlich empfunden. Andererseits habe er immer enorm lyrisch gespielt, sei keiner dieser “Stomper” gewesen, die quasi mit der Rhythmusgruppe mitgespielt hätten. Es gäbe, sagt sein Trompeterkollege Pat Hawes an einer Stelle gar, eine direkte Verbindung zwischen Colyer und Miles Davis. Ein Jazzfan sei er gewesen, ein wenig mürrisch oft, manchmal sogar ein Bully gegenüber seinen Kollegen. Aber wenn man in seine Band kam, wusste man, was man zu erwarten hatte. Colyer spielte, was ihm gefiel; er hatte seine konkreten ästhetischen Vorstellungen, und er kannte dabei kein links und kein rechts. Das mag für moderne Ohren altbacken klingen, aber wer immer ihm rein musikalisch zuhörte, musste das anerkennen, selbst Dizzy Gillespie, wie Ron Ward erzählt; der habe bei einem Konzert, bei dem die Bands der beiden in Leicester auftraten, eine halbe Stunde aufmerksam zugehört und ihm dann ein Kompliment gemacht. Judy Garland und Frank Sinatra habe Colyer gemocht, erfahren wir, habe aber keine Lust dazu gehabt sich selbst Showbusiness-Praktiken zu unterwerfen, sondern habe einzig durch die Musik überzeugen wollen. Auch im Mittelpunkt habe er eigentlich nie stehen wollen, weil es sich in der Ästhetik des New-Orleans-Jazz nun mal um das Ensemble drehe, nicht um den Bandleader. Mitmusiker berichten darüber, was sie konkret von Colyer gelernt hätten, und immer wieder, das prägt durchaus die Ehrlichkeit des Buchs, sind die Lobeshymnen mit einem “aber” oder einem “wenn er gute Laune hatte” durchsetzt und zeigen so die offenbar allseits bekannte komplexe Persönlichkeit Colyers.
Das zweite Kapitel widmet sich dem 51 Club in der Great Newport Street in London, in dem Ken Colyer ab Mitte der 1950er Jahre so oft spielte – allein im Programmzettel für einen April in den 1950er Jahren, der im Buch reproduziert wird an acht Terminen –, dass der Club bald umbenannt wurde in “Ken Colyer Club”.
In Kapitel drei lesen wir über Colyers Kindheit, über seine Familie und darüber, wie er zum Jazz kam. Mit 12 Jahren habe er die Bluesplattens eines Bruders verschlungen und bald auf einer Mundharmonika dazu gespielt. Gleich nach dem Krieg trat er der Handelsmarine bei. In Kanada, erzählt Colyer, habe er Louis Metcalf erlebt, und dann sei plötzlich Oscar Peterson in den Club gekommen, der Pianist hätte sofort sein Instrument verlassen und hinter Peterson habe sich eine Menschentraube gebildet, alles Pianisten, die auf seine Hände starrten. In New York hörte er Wild Bill Davison, Pee Wee Russell und andere, und seine Erinnerungen gehören mit zu den lebendigsten über die New Yorker Dixieland/Swingszene der späten 1940er Jahre, die ich kenne.
Kapitel vier widmet sich der Crane River Jazz Band. Colyer war von verschiedenen Bands abgelehnt worden, bei denen er sich beworben hatte – sie wollten eher im Stile Eddie Condons oder Lu Watters’ spielen als im authentischen New-Orleans-Stil, der Colyer vorschwebte. Also gründete er mit Freunden einfach seine eigene Band, in der Besetzung von King Oliver’s Creole Jazz Band: zwei Trompeten, Klarinette, Posaune, Piano, Banjo, Kontrabass und Schlagzeug. Die Band probte in einem Pub in Cranford, und irgendwann kam einer auf die Idee, bei den eh anwesenden Gästen mit dem Hut rumzugehen, was immerhin die Kosten für die Proben-Biere reinbrachte. Dann fingen die Leute an, zur Musik der Proben zu tanzen – es störte sie nicht, wenn die Band mittendrin mal abbrach, um das Stück nochmal zu beginnen. Im Juli 1951 spielte die Band bei einem Konzert, bei dem auch die Prinzessinnen Margaret und Elisabeth anwesend waren – die Organisatoren hatten überredet werden müssen, die Band spielen zu lassen; sie fürchteten, die Band spiele zu “dirty” für die königlichen Ohren.
Kapitel fünf berichtet von den Christie Brothers Stompers, mit denen Colyer in jenen frühen Jahren ebenfalls spielte. Kapitel sechs handelt dann von Colyers erster Reise nach New Orleans, wieder dokumentiert durch Briefe und Erinnerungsfragmente des Trompeters. Hier war Colyer beides: Musiker und Fan. Er spielte und er traf auf all die Zeitzeugen des frühen Jazz, konnte seine Vorstellung von der Ästhetik des New-Orleans-Jazz am Original überprüfen. Im Februar 1953 wurde er für 38 Tage unter Arrest gestellt, weil er länger geblieben war als sein Visum es ihm erlaubt hatte. Vor den Beamten der Einwanderungsbehörde gab er zu, dass er in New Orleans bleiben wollte, um Jazz zu studieren, offenbar Grund genug für die Behörde, ihn nicht auf Kaution freizulassen, wie ein zeitgenössischer Artikel berichtet. Colyer wurde schließlich in ein Abschiebegefängnis in Ellis Island, New York, gebracht und dann des Landes verwiesen. Auch dieses Kapitel gibt einen der besten Einblicke in die New-Orleans-Szene jener Jahre, den ich kenne – vielleicht gerade, weil es ein Blick von außen ist.
In Kapitel sieben geht es um die Popularisierung des New-Orleans-Jazz in London und die anderen Musiker dieser Szene, Monty Sunshine, Chris Barber, Lonnie Donegan. Kapitel acht beschäftigt sich mit den ersten Platteneinspielungen, dem langsamen Ruhm der Band über die Grenzen Englands hinaus, ersten Tourneen, beispielsweise einem zweimonatigen Gig in der New Orleans Bier Bar in Düsseldorf, der dann auf vier Monate verlängert wurde und – Colyer zufolge – die Jazzwelt Deutschlands verwandelte und sie einer anderen Art von Musik gegenüber geöffnet habe.
Kapitel neun ist das längste Kapitel des Buchs und widmet sich der “klassischen” Band Colyers, seiner Mitwirkung bei Street Parades, zeigt auch ein Foto, auf dem Ken Colyer 1957 den legendären Dobbell’s Record Shop einweiht, indem er eine 78er-Schallplatte auf dem Tresen des Geschäftes zerbricht. Vor allem aber berichtet das Kapitel von Colyers zunehmender US-amerikanischen Gefolgschaft und davon, wie es 1957 zu dem legendären Besuch des Klarinettisten George Lewis in England und den darauf folgenden Tourneen der beiden Musiker beiderseits des Atlantiks kam.
Kapitel 10 beleuchtet den Skiffle-Craze der späten 1950er, frühen 1960er Jahre, an dem Colyer zusammen mit Lonnie Donegan besonders beteiligt waren. In Kapitel 11 geht es um den “Trad Boom” jener Jahre, aber auch um Colyers Meinung zu anderen Jazzstilen. Colyer lässt sich über Ellington aus, von dem er die frühen Aufnahmen bevorzugt; er erzählt, welche Dämpfer er für welche Zwecke verwendet; er findet, die Individualität Thelonious Monks oder Charles Mingus’ verdiene Respekt. Das Kapitel handelt aber auch von den Problemem Colyers mit Alkohol, die zunehmend seine Konzerte in Mitleidenschaft zogen. Er hatte keinen Ton mehr, zeigte seltsames Bühnenverhalten, etwa, als er bei einem Konzert in Deutschland die Blumen, die er von einem kleinen Mädchen überreicht bekam, einfach verspeiste. Es ging ihm nicht gut, aber er sprach mit niemandem darüber, was ihn plagte. War es der Alkohol oder war es Krebs? 1971 löste Colyer seine legendäre Band auf, und Max Jones schrieb im Melody Maker: “Er ist mehr als nur ein Musiker; er ist eine musikalische Haltung.” In der Folge, lernen wir in Kapitel 12, arbeitete Colyer als Freelancer mit unterschiedlichen Trad-Bands, die ihn engagierten. Zwischendurch kam es immer wieder zu Revival-Tourneen der Crane River Jazz Band, wie Kapitel 13 berichtet. 1987 dann meldete sich Colyer von der Musikerszene ab, weil seine Gesundheit nicht mehr mitspielte. Er war krank, ging nach Frejus in Südfrankreich. Ein deutscher Freund sorgte dafür, dass er im Krankenhaus in Gifhorn durchgecheckt wurde. Wenige Monate später, am 11. März 1988 starb Colyer.
Nach einem Blick auf das Erbe des Trompeters und seinen Einfluss auf die Trad-Jazz-Szene Europas widmet sich ein erster Anhang des Buchs Colyers wichtigsten Aufnahmen, wobei dies keine Diskographie im üblichen Sinne ist, sondern eine kommentierte Auflistung der Platten mit Kommentaren der Autoren, von Colyers selbst und anderen Mitmusikern. Ein zweiter Anhang versucht die Persönlichkeit des Trompeters zusammenzufassen. Ein dritter Anhang enthält seine Notizen für eine Art Lehrbuch für New-Orleans-Jazz. Ein ausführlicher Namensindex beendet das Buch, das weit mehr ist als eine simple Biographie. Einige der Kapitel aus “Goin’ Home” bieten Quellenmaterial zu Aspekten der Jazzgeschichte, die so noch nie dargestellt wurden. Vor allem aber beeindruckt die Offenheit, in der alle Interviewten sich über ihre Musik, über Colyers Musik, über Musikästhetik und anderes äußern. Wer glaubt, hier nur über eine seltsame britische Spezies des Jazz-Revivals etwas zu lernen, wird schnell eines Besseren belehrt: Man liest und lernt über die kompromisslose Welt eines Künstlers, der auf der Suche nach seiner eigenen Stimme in einem fremden Land fündig wurde. Die beiheftende CD enthält Aufnahmen von 1951 bis 1982 und dokumentiert die verschiedenen Phasen seines Schaffens zwischen klassischer Besetzung, Brass Band, Skiffle und dem Trompeter als sich selbst auf der Gitarre begleitender Sänger.
Alles in allem: Eine wunderbare Lektüre, die eigentlich gerade auch denjenigen Lesern empfohlen wird, die sich mit dem Trad Jazz Colyer’scher Prägung nie anfreunden konnten, weil es so viel erklärt über ästhetische Selbstfindung und ein Konzept, das nie wirklich den Moden folgte. Und nicht zuletzt: Ein unglaublicher Fundus an Material zu einem ganz speziellen und weithin vernachlässigten Kapitel der europäischen Jazzgeschichte.
Wolfram Knauer (Januar 2011)
Les Cahiers du Jazz, #4 (2007)
Les Cahiers du Jazz, #5 (2008)
Les Cahiers du Jazz, #6 (2009)
Les Cahiers du Jazz, #7 (2010)
jeweils erschienen beim Verlag Outre Mesure, Paris
www.outre-mesure.net
 Es gibt in der Jazzforschung mittlerweile eine Reihe an regelmäßig erscheinenden wissenschaftlich ausgerichteten Publikationen. Am längsten existiert die “Jazzforschung / jazz research” des Instituts für Jazzforschung in Graz, die jährlich bereits seit 1969 erscheint. In den USA gibt es seit fünf Jahren die Fachzeitschrift “Jazz Perspectives”; seit den 1970er Jahren außerdem das “Journal of Jazz Studies”, das in den 1980er Jahren in “Annual Review of Jazz Studies” umbenannt wurde, allerdings nach kurzem nicht wirklich mehr jährlich erscheint. In Deutschland gibt es die Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung, die seit 1989 alle zwei Jahre erscheinen. All diese Veröffentlichungen allerdings werden quasi überholt von “Les cahiers du jazz”, das in erster Auflage Anfang der 1960er erschien, dann eine lange Pause einlegte, 1994 in zweiter Auflage neu begann und 2001 wiederum eine neue Auflage erfuhr. Diese erscheint jährlich; uns liegen alle Ausgaben vor; die letzten vier kamen erst kürzlich auf unseren Schreibtisch.
Es gibt in der Jazzforschung mittlerweile eine Reihe an regelmäßig erscheinenden wissenschaftlich ausgerichteten Publikationen. Am längsten existiert die “Jazzforschung / jazz research” des Instituts für Jazzforschung in Graz, die jährlich bereits seit 1969 erscheint. In den USA gibt es seit fünf Jahren die Fachzeitschrift “Jazz Perspectives”; seit den 1970er Jahren außerdem das “Journal of Jazz Studies”, das in den 1980er Jahren in “Annual Review of Jazz Studies” umbenannt wurde, allerdings nach kurzem nicht wirklich mehr jährlich erscheint. In Deutschland gibt es die Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung, die seit 1989 alle zwei Jahre erscheinen. All diese Veröffentlichungen allerdings werden quasi überholt von “Les cahiers du jazz”, das in erster Auflage Anfang der 1960er erschien, dann eine lange Pause einlegte, 1994 in zweiter Auflage neu begann und 2001 wiederum eine neue Auflage erfuhr. Diese erscheint jährlich; uns liegen alle Ausgaben vor; die letzten vier kamen erst kürzlich auf unseren Schreibtisch.
2007 stehen vor allem Laurent Batailles Artikel über das Schlagzeug im heutigen Jazz im Vordergrund, ein Beitrag über Foto und Jazz oder eine Vorstellung französischer Rapmusik. Außerdem findet sich ein analytischer Beitrag des Trompeters Roger Guerin über den musikalischen Stil Louis Armstrongs.
Das Jahrbuch für 2008 enthält eine ausführliche Analyse von Herbie Hancocks Benutzung von Pygmäengesängen und eine Diskussion der ethischen Konsequenzen solcher Projekte mit indigener Musik aus der “dritten” Welt; einen Artikel über David Murray, einen ausführlichen Nachruf auf Michael Brecker und die Analyse eines Fotos des Kornettisten Bix Beiderbecke.
2009 ging es im Boris Vian, den Jazzfan der direkten Nachkriegszeit, um John Coltranes Spiritualität und ihre Ausprägung in seiner Musik und über Duke Ellingtons “Heaven”.
In der jüngsten Ausgabe von 2010 finden sich neun Aufsätze zu Michael Brecker, darunter ein Nachruf seines Bruders Randy Brecker, analytische Annäherungen an seine Musik von Pierre Sauvanet, Piere Genty und Bertrant Lauer und eine Diskographie. Ein Aufsatz über Albert Ayler von Frédéric Bisson, eine Untersuchung unterschiedlicher Ansätze der Jazzforschung von Laurent Cugny und ein kurzer Beitrag über Bricktop in Rom sind ebenfalls interessante Beiträge dieses Bandes, an dem uns aber vor allem eine kleine Fußnote faszinierte, die Lucien Malson kurz vor Schluss vorstellt: ein Beispiel für das Messen ästhetischer Urteilsfindung in einem Textbuch der philosophischen Fakultät der Universität von Dijon, in dem die Korrelation zwischen (weiblicher) Haarfarbe – blond oder brünett – und Musikgeschmack – Bach oder Bebop – ausgerechnet wird. Alle Bände enthalten ausführliche Buchbesprechungen jüngster Neuerscheinungen und das eine oder andere Gedicht von Alain Gerber.
Wolfram Knauer (Januar 2011)
Streiflichter. Erinnerungen und Überlegungen zum Jazz in Dresden rund um die politische Wende
herausgegeben von Matthias Bäumel & Viviane Czok-Gökkurt
Dresden 2010 (Jazzclub Neue Tonne)
56 Seiten, 5 Euro
ISBN: 978-3-941209-04-6
 Zwanzig Jahre nach der Wende ist vielleicht endlich die notwendige zeitliche Distanz geschaffen, um die Situation des Jazz in der DDR und der Wendezeit aufzuarbeiten. Das vorliegende Büchlein dokumentiert die Ereignisse und Diskussionen seit dem 18. September 1989, als in Berlin Musiker aus dem Rock- und Unterhaltungsbereich – unter ihnen beispielsweise Conny Bauer – eine Resolution unterzeichneten, mit der sie den öffentlichen Dialog im Land forderten. Diese Resolution wurde von den Tageszeitungen nicht abgedruckt, also entschlossen die Unterzeichner sich, sie vor jedem ihrer Auftritte zu verlesen. In Dresden wird am 6. Oktober der junge Schlagzeuger Harald Thiemann festgenommen und für eine Woche in Untersuchungshaft nach Bautzen gebracht, weil er, mehr zufällig, in eine der Dresdner Demonstrationen kam. Beim Tonne-Konzert mit Hannes Zerbe an diesem Abend kann er daher nicht dabeisein. In der Tonne wird derweil darüber diskutiert, ob man in dieser politisch brenzligen Situation überhaupt Kunst machen könne. Wir lesen, wie am 9. November bei einem Konzert im Berliner Babylon die Zuhörer nebenher den neuesten Meldungen aus mitgebrachten Kofferradios lauschten, wie Baby Sommer die Wende erlebte, und wie er bei einer Kundgebung seine Vision kundtat: “Täte man die Parteiabzeichen aller unfähigen Funktionäre in eine große Metallschüssel, ich könnt euch ein Perkussionskonzert spielen, dass es durchs ganze Elbtal raschelt!” Wir erfahren von der nahezu jazzlosen Zeit in der Tonne im Oktober 1989. Niemand wusste, wie die Lage sich verändern würde, ist die eine Erklärung dafür, ob nicht vielleicht auch politische Aktionen befürchtet würden, die von den Konzerten ausgingen, kann nur gemutmaßt werden. Immerhin gab es neben einer Dixielandveranstaltung zwei zeitgenössische Konzerte: das eine mit Hannes Zerbe, dem sein Schlagzeuger in Bautzen abhanden kam, das andere unter dem Titel “Klänge, Gesten und Gestalten” mit der Sängerin Roswitha Trexler, der Tänzerin Hanne Wandtke und dem Pianisten Frederic Rzewski. 20 Jahre später erinnerten zwei Konzerte an diese beiden Events aus dem Wendejahr. Das Büchlein, dass all diese Erinnerungen dokumentiert, ist eine liebevoll gestaltete Broschüre mit vielen Fotos, mit Zeichnungen des viel zu früh verstorbenen Jürgen Haufe, mit einem kurzen Essay über die (möglichen) Verbindungen zwischen Jazz und Staatssicherheit, in dem vor allem die Erkenntnisse von Viviane Czok-Gökkurt, die ihre Diplomarbeit zum Thema schrieb, zusammengefasst sind. Lesenswert, nachdenkenswert, und doch immer noch erst der Beginn einer Aufarbeitung.
Zwanzig Jahre nach der Wende ist vielleicht endlich die notwendige zeitliche Distanz geschaffen, um die Situation des Jazz in der DDR und der Wendezeit aufzuarbeiten. Das vorliegende Büchlein dokumentiert die Ereignisse und Diskussionen seit dem 18. September 1989, als in Berlin Musiker aus dem Rock- und Unterhaltungsbereich – unter ihnen beispielsweise Conny Bauer – eine Resolution unterzeichneten, mit der sie den öffentlichen Dialog im Land forderten. Diese Resolution wurde von den Tageszeitungen nicht abgedruckt, also entschlossen die Unterzeichner sich, sie vor jedem ihrer Auftritte zu verlesen. In Dresden wird am 6. Oktober der junge Schlagzeuger Harald Thiemann festgenommen und für eine Woche in Untersuchungshaft nach Bautzen gebracht, weil er, mehr zufällig, in eine der Dresdner Demonstrationen kam. Beim Tonne-Konzert mit Hannes Zerbe an diesem Abend kann er daher nicht dabeisein. In der Tonne wird derweil darüber diskutiert, ob man in dieser politisch brenzligen Situation überhaupt Kunst machen könne. Wir lesen, wie am 9. November bei einem Konzert im Berliner Babylon die Zuhörer nebenher den neuesten Meldungen aus mitgebrachten Kofferradios lauschten, wie Baby Sommer die Wende erlebte, und wie er bei einer Kundgebung seine Vision kundtat: “Täte man die Parteiabzeichen aller unfähigen Funktionäre in eine große Metallschüssel, ich könnt euch ein Perkussionskonzert spielen, dass es durchs ganze Elbtal raschelt!” Wir erfahren von der nahezu jazzlosen Zeit in der Tonne im Oktober 1989. Niemand wusste, wie die Lage sich verändern würde, ist die eine Erklärung dafür, ob nicht vielleicht auch politische Aktionen befürchtet würden, die von den Konzerten ausgingen, kann nur gemutmaßt werden. Immerhin gab es neben einer Dixielandveranstaltung zwei zeitgenössische Konzerte: das eine mit Hannes Zerbe, dem sein Schlagzeuger in Bautzen abhanden kam, das andere unter dem Titel “Klänge, Gesten und Gestalten” mit der Sängerin Roswitha Trexler, der Tänzerin Hanne Wandtke und dem Pianisten Frederic Rzewski. 20 Jahre später erinnerten zwei Konzerte an diese beiden Events aus dem Wendejahr. Das Büchlein, dass all diese Erinnerungen dokumentiert, ist eine liebevoll gestaltete Broschüre mit vielen Fotos, mit Zeichnungen des viel zu früh verstorbenen Jürgen Haufe, mit einem kurzen Essay über die (möglichen) Verbindungen zwischen Jazz und Staatssicherheit, in dem vor allem die Erkenntnisse von Viviane Czok-Gökkurt, die ihre Diplomarbeit zum Thema schrieb, zusammengefasst sind. Lesenswert, nachdenkenswert, und doch immer noch erst der Beginn einer Aufarbeitung.
Wolfram Knauer (Dezember 2010)
Plattenboss aus Leidenschaft
von Siggi Loch
Hamburg 2010 (Edel Vita)
272 Seiten, 26,95 Euro
ISBN: 978-3-941378-81-0
 Manfred Eicher, Stephan Winter, Matthias Winckelmann, Horst Weber, Jost Gebers, Siggi Loch – sie alle prägten die deutsche Jazzszene genauso wie es die Musiker taten, sorgten dafür, dass Jazz in Deutschland nicht nur einen Namen, sondern vor allem auch einen guten Klang hatte. Loch ist der Dienstälteste unter diesen Plattenmachern und Produzenten und hat jetzt ein Buch vorgelegt, in dem er ausführlich aus seinem Leben und vor allem aus seinem Geschäft berichtet.
Manfred Eicher, Stephan Winter, Matthias Winckelmann, Horst Weber, Jost Gebers, Siggi Loch – sie alle prägten die deutsche Jazzszene genauso wie es die Musiker taten, sorgten dafür, dass Jazz in Deutschland nicht nur einen Namen, sondern vor allem auch einen guten Klang hatte. Loch ist der Dienstälteste unter diesen Plattenmachern und Produzenten und hat jetzt ein Buch vorgelegt, in dem er ausführlich aus seinem Leben und vor allem aus seinem Geschäft berichtet.
Wir lesen von seiner ersten Faszination mit dem Jazz durch ein Konzert (und eine Platte) des Sopransaxophonisten Sidney Bechet, von ersten Jobs als Vertreter für die Electrola, spätere Positionen als Label-Manager und bald auch Produzent für Philips, schließlich als Chef der europäischen Dependence des US-Plattengiganten Liberty Records, zu dem neben anderen auch das legendäre Blue-Note-Label gehörte. Loch erzählt über Erfolge und Flops, über Zufälle und Strategien, über Musiker und Produkte, über Produzentenkollegen und die Unterschiede des Geschäfts in den USA und Europa, über Jazz, Pop, Schlager und vieles mehr. Das liest sich mehr als flüssig, und die Tatsache, dass Loch quasi auf jeder Seite von einem Genre ins nächste gleitet, wie es eben seine Karriere vorgegeben hat, macht die Lektüre ungemein abwechslungsreich.
Wir begegnen Klaus Doldinger (dessen erstes Album Loch produzierte), Al Jarreau, Katja Epstein, Frank Sinatra, Mick Jagger, Francis Wolff, Jürgen Drews und Franz Beckenbauer, erfahren über Beruf und Privatleben des Produzenten, Fußball-WMs und Segelregatten. Loch war 1967 als einer der jüngsten Plattenbosse mit eigener Firma gestartet gehörte spätestens seitdem er eine leitende Position bei Warner Brothers bekleidete zu den wichtigsten Tieren der internationalen Plattenbranche. Neben der Musik hatte er sich dabei vor allem ums Geschäft zu kümmern, um die Probleme mit Schwarzpressungen, um laufende Fusionen und gegenseitige Aufkäufe der Plattengiganten. Mit den Bonuszahlungen kaufte er sich schon mal ein Haus in Kiel-Schilksee, “dem Hafen meiner Segelyacht ‘Tambour'” und wurde durch seinen Freund, den französischen Pressemagnaten Daniel Filipacchi auf ein weiteres kostspieliges Hobby gebracht; das Sammeln zeitgenössischer Kunst.
Als klar wurde, dass sich mit dem Weggang Neshui Erteguns aus dem Vorstand der WEA einiges bei dem Plattengiganten ändern würde, besann sich Loch der Gründe, warum er eigentlich in dieses Berufsfeld eingestiegen war: “Hatte ich nicht immer vom eigenen Label geträumt? Inzwischen hatte ich die Erfahrung von 27 Berufsjahren und war wirtschaftlich unabhängig.” Geburtstunde: ACT, erst als ein Poplabel, das Loch zusammen mit Annette Humpe und Jim Rakete betrieb, dann, ab 1990, vor allem als Jazzlabel. Er erzählt von seinen ersten Alben für ACT, vom Entdecken neuer Künstler, wieder von Verkaufsstrategien, vom Jazz, der eine wunderbare Musik sei, aber eben auch Geschäft. Loch erzählt dabei durchaus auch aus dem Nähkästchen, etwa wenn er berichtet, wie ihm Roger Cicero abhanden kam oder wie Julia Hülsmann zu ECM gewechselt sei, und man ahnt dabei, dass es da auch eine andere Seite der Geschichte geben mag. Aber Loch ist eben ein gewiefter Geschäftsmann – einer, soviel wird schnell klar, wie ihn der Jazz dringend braucht, um aus der durchaus auch selbstgeschaffenen Nische herauszukommen.
Lochs Autobiographie enthält jede Menge Hintergrundinformation übers Musikgeschäft. Es ist ein lesenswertes Buch, gerade weil es so andere Geschichten des Business erzählt als man sie aus Musikerbiographien kennt. Und bei der Lektüre teilt sich immer wieder mit, was Loch im Titel seines Buchs andeutet, dass neben dem Geschäft eben auch die Leidenschaft vorhanden sein muss, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein.
Wolfram Knauer (Dezember 2010)
Dusk Fire. Jazz in English Hands
von Michael Garrick & Trevor Barrister
Earley, Reading 2010 (Springdale Publishing)
260 Seiten, 15 Britische Pfund
ISBN: 978-0-9564353-0-9
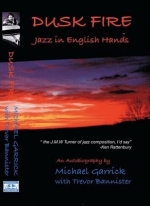 Michael Garrick gehört seit den späten 1950er Jahren zu den aktivsten Musikern der modernen britischen Jazzszene. Mit “Dusk Fire” legt er seine Autobiographie vor. 1933 in Enfield, Middlesex, geboren, erhielt er erste Klavierstunden von seiner Mutter. Sein erster großer Einfluss war das enge Zusammenspiel der vier Musiker des Modern Jazz Quartet, und so ist es kein Wunder, dass sein erstes Quartett dieselbe Besetzung hatte. Frühzeitig interessierte ihn dabei auch genuin englisches Material als Grundlage für die Improvisationen, also arrangierte er Songs wie “Barbara Allen” oder “Bobby Shaftoe” und schrieb erste eigene Stücke die ähnlichen Mustern folgten. 1961 gründete er die Konzertreihe “Poetry and Jazz in Concert”, 1967 eine weitere Reihe an Kirchenkonzerten, “Jazz Praises”. Anfangs verdiente er sich sein Geld noch als Lehrer, ab 1965 war Garrick dann “Full-time”-Musiker.
Michael Garrick gehört seit den späten 1950er Jahren zu den aktivsten Musikern der modernen britischen Jazzszene. Mit “Dusk Fire” legt er seine Autobiographie vor. 1933 in Enfield, Middlesex, geboren, erhielt er erste Klavierstunden von seiner Mutter. Sein erster großer Einfluss war das enge Zusammenspiel der vier Musiker des Modern Jazz Quartet, und so ist es kein Wunder, dass sein erstes Quartett dieselbe Besetzung hatte. Frühzeitig interessierte ihn dabei auch genuin englisches Material als Grundlage für die Improvisationen, also arrangierte er Songs wie “Barbara Allen” oder “Bobby Shaftoe” und schrieb erste eigene Stücke die ähnlichen Mustern folgten. 1961 gründete er die Konzertreihe “Poetry and Jazz in Concert”, 1967 eine weitere Reihe an Kirchenkonzerten, “Jazz Praises”. Anfangs verdiente er sich sein Geld noch als Lehrer, ab 1965 war Garrick dann “Full-time”-Musiker.
In seinem Buch berichtet er über Plattenveröffentlichungen, etwa “Moonscape” von 1964, über Kollegen wie Joe Harriott, Don Rendell und Ian Carr, über den Einfluss durch Bill Evans, den er im März 1965 in London hörte. 1976 ging Garrick in die USA, um am Berklee College in Boston zu studieren; daneben nahm er Unterricht bei der legendären Madame Chaloff, der Mutter des Saxophonisten Serge Chaloff, die ihm gezeigt habe, wie man allein durch Körperbeherrschung einen kraftvollen Sound erzeugen könne — Keith Jarrett habe bei ihr gelernt und Herbie Hancock und Chick Corea hätten Stunden bei ihr genommen. Nach seiner Rückkehr gründete Garrick eine neue Band, der die Sängerin Norma Winstone angehörte. Er spielte mit Nigel Kennedy und der großartigen Adelaide Hall, begleitete amerikanische Solisten bei Konzerten in England und spielte Duos mit Dorothy Donegan. 1985 wurde er Dozent an der Royal Academy of Music, und er schreibt ausführlich über seine Erlebnisse als Lehrer und Teil der britischen Schulbürokratie. Duke Ellingtons Musik hatte ihn immer fasziniert, und als er die Möglichkeit hatte, eine eigene Bigband zusammenzustellen, was der Duke offensichtlich eines seiner großen Vorbilder.
Garricks Buch ist eine Sammlung an Erinnerungen an eine lange Karriere, manchmal ein wenig schwerfällig lesbar angesichts der vielen Namen, bei denen man zurückblättern möchte, um den Zusammenhang zu verstehen, voller Anekdoten auch, die immerhin einen Einblick in das Wirken eines bedeutenden britischen Musikers erlauben, zwischen insularer Verwurzeltheit und Faszination mit dem Fremden des amerikanischen Jazz. Eine Sammlung eigener journalistischer Artikel, eine Diskographie und ein ausführlicher Index runden das Buch ab, das reich bebildert ist und ein Kapitel britischer Jazzgeschichte aus der Sicht der Musiker beschreibt und gibt damit einen interessanten Einblick in den Alltag eines Musikers in den 1960er bis 1990er Jahren.
Wolfram Knauer (Dezember 2010)
Miles Davis. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2010 (rowohlt Berlin)
304 Seiten, 19,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-677-4
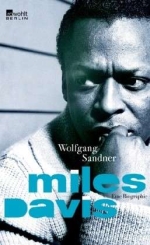 Es ist immer so eine Frage: Warum braucht es noch eine weitere Biographie der bekannten Jazzgrößen? Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis … über sie alle ist so viel geschrieben worden! Doch tatsächlich muss sich jede Zeit ihre Jazzgrößen neu entdecken. Und so ist Wolfgang Sandners Blick auf das Leben und Werk von Miles Davis eben der Blick aus dem Jahr 2010 und damit ein neues Buch, kein Wiederaufguss. Es ist ein liebevolles, sprachlich gelungenes Buch – wie nicht anders zu erwarten beim ehemaligen FAZ-Musikredakteur. Und es ist, wie Sandner in seinem Vorwort zugibt, ein Bekenntnis: für “den eigenen Geschmack, die eigene Anschauung und die eigene ästhetische Vorliebe”. Dabei hat er sich einen Satz, den Miles einst einem Interviewer mitgab, zu Herzen genommen: “Wenn du alles verstündest, was ich sage, wärst du ich.”
Es ist immer so eine Frage: Warum braucht es noch eine weitere Biographie der bekannten Jazzgrößen? Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis … über sie alle ist so viel geschrieben worden! Doch tatsächlich muss sich jede Zeit ihre Jazzgrößen neu entdecken. Und so ist Wolfgang Sandners Blick auf das Leben und Werk von Miles Davis eben der Blick aus dem Jahr 2010 und damit ein neues Buch, kein Wiederaufguss. Es ist ein liebevolles, sprachlich gelungenes Buch – wie nicht anders zu erwarten beim ehemaligen FAZ-Musikredakteur. Und es ist, wie Sandner in seinem Vorwort zugibt, ein Bekenntnis: für “den eigenen Geschmack, die eigene Anschauung und die eigene ästhetische Vorliebe”. Dabei hat er sich einen Satz, den Miles einst einem Interviewer mitgab, zu Herzen genommen: “Wenn du alles verstündest, was ich sage, wärst du ich.”
Mit diesem Caveat, dass eine Biographie immer nur eine Annäherung sein kann, beginnt Sandner also seine Reise zur Person und zur Musik des Miles Davis. Er berichtet etwa vom Vater, der ein durchaus wohlhabender Zahnarzt in St. Louis war und seine Kinder in Sinfoniekonzerte mitnahm, Miles auf seinem eigenen Pferd reiten ließ und dabei zugleich ein Anhänger von Marcus Garvey war. Diese Mischung aus dem Stolz auf die eigene Hautfarbe und mittelständischen Werten prägte Miles sein Leben lang sowohl im Positiven wie auch im Negativen, in seiner politischen Haltung wie im Versuch dem Bourgeoisen seiner eigenen Biographie zu entkommen. Erste Jobs als Musiker, erste Freundin, erstes Kind, Streit mit dem Vater, Flucht nach New York. Sandner beschreibt die Situation: “Da kam ein gut erzogener, schüchterner Schwarzer aus dem Mittleren Westen nach New York: Achtzehn Jahre alt, Nichtraucher, ohne Erfahrung mit Alkohol und keinen blassen Schimmer von Kokain, Heroin und anderen Versuchungen des Bösen. Mit einer Trompete unter dem Arm und einem einzigen Gedanken im Kopf: Wo finde ich Charlie Parker, den größten Jazzmusiker der Gegenwart, der sich anschickt, der größte Jazzmusiker der Zukunft zu werden?” Parker fand er bald, spielte mit ihm und anderen, tauchte zugleich ein in eine Welt, die von Musik und Drogen beherrscht wurde, denen letzten Endes auch er sich nicht würde entziehen können. Mit John Lewis, Gerry Mulligan und anderen jungen Musikern traf er sich in Gil Evans’ Kellerapartment und entwickelte die Idee einer Musik, in der mit möglichst wenigen Instrumenten eine Klangvielfalt und klangliche Durchorganisation erlangt wurde, wie man sie sonst beispielsweise von großen Orchestern wie dem von Claude Thornhill kannte. Die Aufnahmen seines Nonets, das diese Arrangements verwirklichte, wurden später als “The Birth of the Cool” herausgebracht und Miles damit als einer der Väter des Cool Jazz gesehen, so wie er als einer der Großen des Hard-Bop, einer der Erfinder des modalen Jazz oder noch später als der Wegbereiter der Fusion zwischen Jazz und Rock gesehen wurde. Wie immer man seine Wendungen beurteilt, es ist klar, dass es Miles darum ging, neue Sounds zu erkunden, am Puls der Zeit zu bleiben, seine eigene Stimme in die jeweils augenblickliche Sprache der Musik einzubringen.
Sandner beschreibt Miles’ liebevolle Beziehung zu Juliette Greco und seine späteren Ehen, die irgendwo zwischen Liebe, Vergötterung und Gewalttätigkeit lagen; er beschreibt die so wechselvolle Persönlichkeit des Trompeters, die aus Stolz, übersteigertem Selbstbewusstsein und Verletzlichkeit zugleich zu entstehen schien. Er beschreibt die Meisterwerke, “Kind of Blue” etwa, seine Alben mit Gil Evans, das großartige Quintett der 1960er Jahre, “Bitches Brew”, seine Fusionerfolge der 1970er Jahre, Rückschläge, Erholungen, die Rückkehr zum Blues und verflicht all das mit einer Beschreibung des Menschen, die sprachlich so gelungen ist, dass man sich gern festliest, dass man in den musikalischen Beschreibungen den Ton des Meisters zu hören glaubt und dass selbst die Beschreibung der dunklen Seiten des Klangmagiers einer gewissen Lyrik nicht entbehren, weil sie nicht entschuldigt, aber erklärt, warum Miles ist wie er ist und damit eben auch, warum er spielt wie er spielt. Ein gelungenes Buch, eine spannende Lektüre.
Wolfram Knauer (Dezember 2010)
African Rhythms. The Autobiography of Randy Weston
Von Randy Weston & Willard Jenkins
Durham/NC 2010 (Duke University Press)
326 Seiten, 32,95 US-Dollar
ISBN: 798-0-8223-4784-2
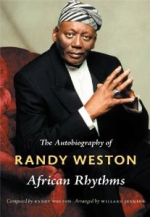 Von all den Jazzmusikern, die irgendwann in ihrem Leben nach den Wurzeln ihrer Musik suchten, ist Randy Weston einer der wenigen der sie gefunden hat: in der Musik Afrikas, die er genauso umarmte wie sie ihn, die er aber bereits zu einer Zeit “gefunden” hatte, als er den afrikanischen Kontinent physisch noch gar nicht betreten hatte. Willard Jenkins erzählt im Vorwort, wie es zu diesem Buchprojekt kam, wie sehr er erst von Westons Musik, dann von seinen Geschichten und seiner Fähigkeit zum Geschichtenerzählen begeistert war, aber auch von der Bewunderung, die Weston in seiner zweiten Heimat, Marokko, entgegenschlägt, wann immer er dort auftritt oder auch nur durch die Straßen läuft. Jenkins hatte eigentlich eine Biographie des Pianisten geplant, aber mehr und mehr wurde klar, dass das Buch eine Autobiographie werden würde, für die Weston quasi als “Komponist” diente, während Jenkins als “Arrangeur” tätig wurde.
Von all den Jazzmusikern, die irgendwann in ihrem Leben nach den Wurzeln ihrer Musik suchten, ist Randy Weston einer der wenigen der sie gefunden hat: in der Musik Afrikas, die er genauso umarmte wie sie ihn, die er aber bereits zu einer Zeit “gefunden” hatte, als er den afrikanischen Kontinent physisch noch gar nicht betreten hatte. Willard Jenkins erzählt im Vorwort, wie es zu diesem Buchprojekt kam, wie sehr er erst von Westons Musik, dann von seinen Geschichten und seiner Fähigkeit zum Geschichtenerzählen begeistert war, aber auch von der Bewunderung, die Weston in seiner zweiten Heimat, Marokko, entgegenschlägt, wann immer er dort auftritt oder auch nur durch die Straßen läuft. Jenkins hatte eigentlich eine Biographie des Pianisten geplant, aber mehr und mehr wurde klar, dass das Buch eine Autobiographie werden würde, für die Weston quasi als “Komponist” diente, während Jenkins als “Arrangeur” tätig wurde.
“Ich bin eigentlich ein Geschichtenerzähler”, beginnt Weston die Einleitung des Buchs, “kein Jazzmusiker. Ich bin ein Geschichtenerzähler durch Musik, und ich kann von erstaunlichen und einzigartigen Erlebnissen berichten. (…) Gott ist der wirkliche Musiker. Ich bin ein Instrument und das Klavier ist ein weiteres Instrument. Das habe ich in Afrika gelernt.”
Mit solchen Worten zieht Weston den Leser ein in eine tatsächlich faszinierende und einzigartige Geschichte. Er erzählt von seinem Vater, der aus einer jamaikanischen Familie stammte und ein ergebener Anhänger von Marcus Garvey war, der in den 1920er Jahren die Back-to-Africa-Bewegung mitbegründet hatte, sowie von seiner Mutter, einer zerbrechlichen kleinen Frau, die für wenig Geld die Böden anderer Leute schrubbte und nie klagte, nie bettelte, immer mit Würde lebte. Er erzählt über seine Kindheit in Brooklyn, seine ersten musikalischen Erlebnisse und wie seine Größe (Weston misst über 2 Meter) ihm immer Komplexe bereitete, für die Musik die beste Zuflucht war. Er erzählt, wie die Häuser großer Musiker wie Max Roach oder Duke Jordan interessierten Kollegen in jenen Jahren immer offenstanden. 1944 wurde Weston zur Armee eingezogen, entgegen seinen Hoffnungen, dass er wegen seiner Körpergröße untauglich geschrieben würde. Er verbrachte ein Jahr auf Okinawa und baute dort eine Kommunikationsstellung aus, kehrte dann nach Brooklyn zurück, hörte sich jeden Abend die großen Pianisten an, die in der Stadt auftraten, Art Tatum, Erroll Garner oder Hank Jones, und führte das Restaurant seines Vaters. Er erinnert sich, wie Charlie Parker ihn eines Abends abschleppte, um mit ihm eine halbe Stunde lang zu spielen, das einzige Mal, dass sie zusammen auftraten, einen Moment, den er nie vergessen werde.
Er arbeitete Anfang der 1950er Jahre als Tellerwäscher in den Berkshires, als er mehr zufällig einen Vortrag des Jazzhistorikers Marshall Stearns im Music Inn in Lenox hörte. In der Folge kam Weston die nächsten zehn Jahre jedes Jahr nach Lenox, trat dort bald mit seinem Trio auf und begleitete Stearns Vorträge mit Musikbeispielen. Was ihn an Stearns beeindruckte, war, dass dieser immer die Wurzeln des Jazz in Afrika hervorhob, die Geschichte dieser Musik also nicht in New Orleans beginnen ließ, wie dies sonst üblich war. Zusammen mit Stearns ging Westons Trio auf Tournee mit einem Programm, dass Schülern und Studenten überall im Land die Jazzgeschichte näher bringen sollte, dem ersten Jazzgeschichtskurs im amerikanischen Schulsystem.
Weston erzählt von seinen Begegnungen mit Langston Hughes, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, mit dem Ghanaischen Jazzmusiker Kofi Ghanaba oder Gnawa-Musikern in Marokko. Vor allem aber erzählt er eine Geschichte, in der seine musikalische Entwicklung eingebettet ist in ein Leben mit scheinbar glücklichen Zufällen, tatsächlich aber offenen Ohren und Augen, mit denen er angebotene Gelegenheiten aufgreifen und ausnutzen konnte. Nach wenigen Seiten ist man in “African Rhythm” versunken, mag es nicht mehr aus der Hand legen. “Diagonallesen”, wie man das oft durchaus erfolgreich macht, wenn man professionell mit dieser Musik zu tun hat, geht hier nicht mehr, weil man in jeder Geschichte, in jedem Geschichtenstrang so gefangen ist, dass man mehr wissen will, weil Weston die Begebenheiten und Begegnungen mit Menschen so plastisch schildert, dass man das Gefühl hat selbst mit dabei zu sein. Man spürt die Mischung aus Selbstbewusstsein und Schüchternheit, die auch dem Menschen Weston eigen ist, die kraftvolle linke Hand und die betörenden Melodien in der rechten, das Wissen und die Neugier.
Es hat lange kein Buch mehr gegeben, dass sich in die großen Autobiographien des Jazz einreihen könnte, wie sie von Louis Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Art Pepper und Miles Davis vorgelegt wurden. Randy Westons “African Rhythms” gehört ganz gewiss in diese Reihe. Ein großartiges Lesevergnügen!
Wolfram Knauer (Oktober 2010)
Scandinavian Wood. Niels-Henning Ørsted Pedersens musikalske løbebane i lyset af hans diskografi
Von Jørgen Mathiasen
Kopenhagen 2010 (Books on Demand)
350 Seiten, 335 Dänische Kronen
ISBN: 978-87-7114-599-1
Scandinavian Wood. The musical career of Niels-Henning Ørsted Pedersen in the light of his discography
Von Jørgen Mathiasen
Copenhagen 2010 (Books on Demand)
358 Seiten, 335 Dänische Kronen
ISBN: 978-3-8423-5157-8
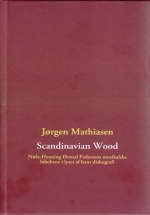 Jørgen Mathiasen ist ein in Berlin lebender dänischer Musikwissenschaftler mit speziellem Interesse sowohl an der Musik Duke Ellingtons wie auch an Musikästhetik oder dem Jazz aus seiner eigenen Heimat, Dänemark. Seit einiger Zeit beschäftigt er sich mit Niels-Henning Ørsted Pedersens “musikalischer Laufbahn im Lichte seiner Diskographie”, wie es im Untertitel seiner dicken Monographie heißt. Die Diskographie macht den größten Teil des Buchs aus, das daneben aber auch eine sechzigseitige Würdigung des musikalischen Schaffens des Kontrabassisten bietet.
Jørgen Mathiasen ist ein in Berlin lebender dänischer Musikwissenschaftler mit speziellem Interesse sowohl an der Musik Duke Ellingtons wie auch an Musikästhetik oder dem Jazz aus seiner eigenen Heimat, Dänemark. Seit einiger Zeit beschäftigt er sich mit Niels-Henning Ørsted Pedersens “musikalischer Laufbahn im Lichte seiner Diskographie”, wie es im Untertitel seiner dicken Monographie heißt. Die Diskographie macht den größten Teil des Buchs aus, das daneben aber auch eine sechzigseitige Würdigung des musikalischen Schaffens des Kontrabassisten bietet.
Im Vorwort thematisiert Mathiasen erst einmal grundsätzlich die Bedeutung von Diskographien für die Jazzforschung. Sein erstes Hauptkapitel ordnet Ørsted Pedersens Biographie in die Geschichte seines Heimatlandes ein. Mathiasen beschreibt die Situation der Jazzszene in den Jahren vor Ørsted Pedersens Geburt im Mai 1946, das Elternhaus des Bassisten, musikalische Einflüsse, seine ersten Auftritte als Bassist, als vierzehnjähriger Gymnasiast in der Band des schwedischen Saxophonisten Rolf Billberg. Eigene Kapitel widmet Mathiasen Ensembles, in denen Ørsted Pedersen sein Handwerkszeug verfeinerte oder aber sich weit über die Grenzen Dänemarks hinaus einen Namen machte, der DR Big Band etwa, also dem dänischen Rundfunkorchester, seiner Zeit als Hausbassist des Montmartre Jazz Clubs in Kopenhagen, Engagements mit Dexter Gordon, Kenny Drew, Ben Webster und natürlich Oscar Peterson. Mathiasens Anmerkungen zur Zusammenarbeit NHØPs mit Musikern wie diesen versucht vor allem, faktische und biographische Informationen zu liefern, die die folgende Diskographie in den notwendigen Kontext stellen. Auch die Aufnahmen unter eigenem Namen werden gewürdigt, und in einem kurzen Kapitel diskutiert Mathiasen Ørsted Pedersens skandinavische musikalische Identität, die Idee des “nordischen Tons”, der weit über die Benutzung von Volksmelodien hinausgehe. Schließlich stellt sich die Frage nach “Imitation und Emanzipation” bei einem Musiker wie Ørsted-Pedersen besonders, der so intensiv mit amerikanischen Kollegen zusammenspielte, ohne seine Heimat und sein Bewusstsein als dänischer Musiker aufzugeben.
 Nach einer Bibliographie über NHØP macht den Hauptteil des Buchs dann die Diskographie aus, die Aufnahmen zwischen September 1960 (Don Camillo and his Feetwarmers) und März 2005 (mit seinem eigenen Trio) listet. Dieser Teil enthält die üblichen Details jazzmusikalischer Werkverzeichnisse: Besetzungen, Ort und Datum der Aufnahme, eingespielte Titel, Erst- und Wiederveröffentlichungen, sowie, wo immer nötig, Kommentare zur Aufnahmesitzung. Neben den schon genannten Namen sind dabei Musiker wie Bud Powell, Don Byas, Albert Ayler, Roland Kirk, Archie Shepp oder Sonny Rollins zu nennen, aber auch dänische Kollegen wie Ib Glindemann, Svend Asmussen oder Palle Mikkelborg. Mathiasen zählt weit über 500 Aufnahmesitzungen, an denen Ørsted Pedersen beteiligt war – wahrlich ein klanglicher Nachlass erster Güte.
Nach einer Bibliographie über NHØP macht den Hauptteil des Buchs dann die Diskographie aus, die Aufnahmen zwischen September 1960 (Don Camillo and his Feetwarmers) und März 2005 (mit seinem eigenen Trio) listet. Dieser Teil enthält die üblichen Details jazzmusikalischer Werkverzeichnisse: Besetzungen, Ort und Datum der Aufnahme, eingespielte Titel, Erst- und Wiederveröffentlichungen, sowie, wo immer nötig, Kommentare zur Aufnahmesitzung. Neben den schon genannten Namen sind dabei Musiker wie Bud Powell, Don Byas, Albert Ayler, Roland Kirk, Archie Shepp oder Sonny Rollins zu nennen, aber auch dänische Kollegen wie Ib Glindemann, Svend Asmussen oder Palle Mikkelborg. Mathiasen zählt weit über 500 Aufnahmesitzungen, an denen Ørsted Pedersen beteiligt war – wahrlich ein klanglicher Nachlass erster Güte.
Die Entscheidung des Autors, das Buch auf Dänisch erscheinen zu lassen, ist wahrscheinlich der Hauptzielgruppe seiner Leserschaft zu schulden; dabei hätte eine englische Übersetzung zumindest des ersten Teils vielleicht keine zu großen zusätzlichen Kosten verursacht. Alles in allem: ein nüchternes Werkverzeichnis und dennoch eine labor of love, der man die Akribie und Genauigkeit anmerkt, die der Autor in seine Recherchen gesteckt hat.
Wolfram Knauer (Oktober 2010)
Zusatz: Inzwischen ist das Buch auch auf englisch erschienen und damit für eine breitere Leserschaft interessant. Die Übersetzung entspricht in Form und Inhalt der dänischen Originalausgabe.
(Wolfram Knauer (März 2012)
Die Wiener Jazzszene. Eine Musikszene zwischen Selbsthilfe und Institution
Von Stefanie Bramböck
Frankfurt/Main 2010 (Peter Lang)
194 Seiten, 39,80 Euro
ISBN: 978-3-631-59652-4
 Soziologische Studien zur Jazzszene gestalten sich erfahrungsgemäß schwierig: Es ist von vornherein nicht gerade leicht, die zu untersuchenden Gruppen genauer zu identifizieren: Musiker, Publikum, und wenn, dann welches: Konzertpublikum, traditioneller Jazz oder zeitgenössischere Spielrichtungen, Festivalbesucher oder Clubgänger, Plattenkäufer oder Downloader und so weiter und so fort. Hypothesen neigen in diesem Bereich noch mehr als in anderen dazu, zu self-fulfilling prophecies zu werden, und systematisch erhobene Daten sind oft bei Drucklegung der Studie bereits wieder hoffnungslos überholt. Trotz all solcher Schwierigkeiten ist es wichtig, soziologisch an den Jazz heranzugehen, weil empirische Untersuchungen Zahlen und Fakten bringen können, die für die politische Argumentation etwa über den Sinn einer Jazzförderung notwendig sind.
Soziologische Studien zur Jazzszene gestalten sich erfahrungsgemäß schwierig: Es ist von vornherein nicht gerade leicht, die zu untersuchenden Gruppen genauer zu identifizieren: Musiker, Publikum, und wenn, dann welches: Konzertpublikum, traditioneller Jazz oder zeitgenössischere Spielrichtungen, Festivalbesucher oder Clubgänger, Plattenkäufer oder Downloader und so weiter und so fort. Hypothesen neigen in diesem Bereich noch mehr als in anderen dazu, zu self-fulfilling prophecies zu werden, und systematisch erhobene Daten sind oft bei Drucklegung der Studie bereits wieder hoffnungslos überholt. Trotz all solcher Schwierigkeiten ist es wichtig, soziologisch an den Jazz heranzugehen, weil empirische Untersuchungen Zahlen und Fakten bringen können, die für die politische Argumentation etwa über den Sinn einer Jazzförderung notwendig sind.
In Deutschland gab es über die Jahre Studien zum Jazzpublikum, zu den Arbeitsbedingungen von Musikern und zur Lage der Clubs. Eine übergreifende Studie über “die Jazzszene” als soziologisch spannendes Geflecht unterschiedlichster Beziehungen zwischen Musikern und Musikern; Musikern und Veranstaltern; Musikern, Veranstaltern und Publikum; all dieser Bereiche und der Jazzkritik und vielem mehr lässt leider nach wie vor auf sich warten. Stefanie Bramböck hat jetzt mit ihrer als Diplomarbeit im Fach Musikwirtschaft entstandenen Diplomarbeit eine die verschiedenen Seiten dieses Beziehungsgeflechts berücksichtigende Studie vorgelegt, die die aktuelle Wiener Jazzszene als eine “Musikszene zwischen Selbsthilfe und Institution” beschreibt und analysiert.
Der Jazz sei eine Musik von Individualisten, stellt Bramböck gleich im Vorwort fest, der anders als Klassik und Popmusik nie wirklich systematisierbar bzw. strukturierbar gewesen sei. Sie geht ihre Aufgabe von unterschiedlichen Seiten an, fragt etwa zu Beginn nach den Musikern und ihrer Motivation dazu, überhaupt Jazz zu machen. Sie beleuchtet die Auftrittsorte und wirft einen besonderen Blick auf zwei Wiener Clubs, das Porgy & Bess und Jow Zawinuls Birdland, das nach großem Erfolg in die Pleite rutschte. Sie vergleicht die Clubsituation mit der größerer Konzerte, fragt nach der Aufgabe von Musikagenten und Musikmanagern, beleuchtet die Rolle der Medien – Fernsehen, Rundfunk und Printmedien – und wirft auch einen Blick aufs Publikum selbst. Die Musikindustrie erhält ein eigenes Kapitel, in dem Bramböck die Situation von Plattenlabels genauso hinterfragt wie aktuelle Produktionswege für Musiker (YouTube, MySpace, die CD als künstlerische Visitenkarte). Schließlich befasst sie sich in einem letzten Kapitel mit den unterschiedlichen Fördermöglichkeiten für Jazzmusiker in Wien – durch den Bund, die Stadt, den SKE-Fonds oder den Österreichischen Musikfonds. Während Bramböck für den größten Teil ihres Buchs vor allem auf Sekundärliteratur sowie Interviews mit Betroffenen zurückgreift, ist dieser Teil ihrer Studie der einzige, der konkrete Zahlen vorlegt.
Die fünfseitige Zusammenfassung macht noch einmal klar worum es der Autorin geht: Sie fragt danach, was es braucht, um in einer Stadt wie Wien einen Szenetreffpunkt zu etablieren, wie er für eine kreative Jazzszene unabdingbar ist. Sie stellt die Fragmentierung der Szene fest und auch das Fehlen von Lobbystrukturen. In ihrem Fazit fordert sie schließlich eine verstärkte Institutionalisierung und Internationalisierung der bereits vorhandenen funktionierenden Infrastruktur. Sie identifiziert Handlungsbedarf insbesondere in der medialen Unterstützung und Präsenz des Jazz und fordert die Geldgeber öffentlicher Subventionen auf, “bestehende und beharrende Förderstrukturen aufzubrechen, um einerseits Neues entstehen lassen zu können und andererseits auf bereits bestehende Finanzierungsbedürfnisse zu reagieren”.
Bramböcks Buch ist eine Fachstudie, also keine “Geschichte des Wiener Jazz”. Sie kann als Anleitung zur Konsolidierung einer überaus aktiven Szene gelesen werden und dabei auch Jazzaktiven in anderen Städten Hinweise darauf geben, was zu tun sei, um die so ungemein lockeren und oft wenig greifbaren Strukturen der Jazzszene zu festigen, um kreative Freiräume zu schaffen, in denen Musiker experimentieren und Neues entwickeln können. “Die Wiener Jazzszene” ist damit ein Argument in einer auch hierzulande bereits geführten Diskussion.
Wolfram Knauer (Oktober 2010)
Talking Jazz
von Till Brönner & Claudius Seidl
Köln 2010 (Kiepenheuer & Witsch)
207 Seiten, 18,95 Euro
ISBN: 978-3-462-04167-5
 Claudius Seidl ist Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Außerdem ist er Jazzfan. Liebhaber sei er, deshalb würde er selten über Jazz schreiben. Als aber ein Verleger ihn anrief, um zu fragen, ob er nicht einen guten Schreiber kenne, der zusammen mit Till Brönner ein Buch über sine Erfahrungen und ästhetischen Haltungen schreiben könne, da juckte es ihn in den Fingern. Eine Woche lang trafen sie sich jeden Morgen am Ufer der Havel, fuhren im Boot auf eine der Havelinseln und unterhielten sich, über Deutschland, die Welt und den Jazz. Das Ergebnis ist ein sehr persönliches Buch, in dem die Gespräche aufgelöst sind in kleine Kapitel mit den auf “kurz” zusammengefassten Fragen quasi als Überschriften, denen Brönners Antworten folgen, voller Liebe für die Musik, voll Unzufriedenheit darüber, dass die Musik, die er liebt, in Deutschland manchmal einen so seltsamen Ruf genießt und voll fast schon missionarischen Eifer, das zu ändern. So viele Leute liefen mit Missverständnissen darüber herum, was Jazz eigentlich sei; da täte Aufklärung dringend Not. Denn: “Jeder liebt Jazz!. Es gibt aber Menschen, die wissen schon, dass sie Jazz-Liebhaber sind. Und es gibt Menschen, die haben es noch gar nicht gemerkt.”
Claudius Seidl ist Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Außerdem ist er Jazzfan. Liebhaber sei er, deshalb würde er selten über Jazz schreiben. Als aber ein Verleger ihn anrief, um zu fragen, ob er nicht einen guten Schreiber kenne, der zusammen mit Till Brönner ein Buch über sine Erfahrungen und ästhetischen Haltungen schreiben könne, da juckte es ihn in den Fingern. Eine Woche lang trafen sie sich jeden Morgen am Ufer der Havel, fuhren im Boot auf eine der Havelinseln und unterhielten sich, über Deutschland, die Welt und den Jazz. Das Ergebnis ist ein sehr persönliches Buch, in dem die Gespräche aufgelöst sind in kleine Kapitel mit den auf “kurz” zusammengefassten Fragen quasi als Überschriften, denen Brönners Antworten folgen, voller Liebe für die Musik, voll Unzufriedenheit darüber, dass die Musik, die er liebt, in Deutschland manchmal einen so seltsamen Ruf genießt und voll fast schon missionarischen Eifer, das zu ändern. So viele Leute liefen mit Missverständnissen darüber herum, was Jazz eigentlich sei; da täte Aufklärung dringend Not. Denn: “Jeder liebt Jazz!. Es gibt aber Menschen, die wissen schon, dass sie Jazz-Liebhaber sind. Und es gibt Menschen, die haben es noch gar nicht gemerkt.”
Brönners Mission läuft ja schon länger: Er ist in Talkshows präsent wie kein anderer seiner Zunft; über ihn wird in Bild genauso wie in Frauenzeitschriften berichtet; er moderierte den Jazz Echo und er sitzt in der Jury zum “X Factor”. Brönner also hat bereits einen Fuß in der Tür derjenigen, die noch nicht gemerkt haben, dass sie Jazz-Liebhaber sind. Mit seinem Buch will er die Tür ein wenig weiter öffnen, will Überzeugungsarbeit leisten, indem er von seinem eigenen Enthusiasmus berichtet, weil er fest davon überzeugt ist, dass Enthusiasmus mitreißen kann, ja mitreißen muss.
Brönners Buch ist keine übliche Autobiographie, aber natürlich spielt seine eigene Geschichte eine wichtige Rolle, denn Musik erklärt sich aus dem Individuum heraus, das sie macht. Er berichtet von seiner musikalischen Familie, von der ersten Platte, von seiner Faszination durch Bigbands im Fernsehen, von seinen ersten Gehversuchen als musikbegeisterter Jugendlicher, und davon, dass er heute noch wisse, “an welcher Stelle des Schulhofes das Auto stand, in dem ich, staunend und sprachlos, zum ersten Mal Charlie Parker hörte”.
Der Trompete ist mindestens ein eigenes Kapitel gewidmet, aber natürlich taucht sie überall auf im Buch. Die Königin des Jazz sei sie, der Trompeter “geradezu naturgemäß der Chef”. Im Musikaliengeschäft von “Tante Doris”, der Schwester seiner Mutter, konnte er alle möglichen Instrumente ausprobieren; hier bekam er auch seine erste Trompete, ein Geschenk zur Erstkommunion. Er erzählt vom Trompetenunterricht, vom klassischen Wettbewerb “Jugend musiziert”, bei dem er mitmachte und nur den zweiten Platz belegte. Er wusste warum: Seine wahre Liebe galt dem Jazz. Er schreibt über den Klang und die Körperlichkeit des Klangs, über die Anstrengung das Instrument zu beherrschen und seine Beherrschung auch zu behalten, und über die ewige Konkurrenz zwischen Trompete und Saxophon.
Mitte der 80er Jahre kam Brönner ins Landesjugendjazzorchester, wenig später ins neu gegründete Bundesjazzorchester unter Leitung Peter Herbolzheimers. Der war Respekt einflößender Orchesterchef, zugleich aber auch Mensch, und Brönner wurde immer wieder eingeladen, in Herbolzheimers anderer Band, der Rhythm Combination & Brass mitzuwirken. Immer spielte er “A Night in Tunesia” vor, bei “Jugend jazzt” genauso wie beim BuJazzo oder beim Rias-Tanzorchester unter Horst Jankowski, in dem er als jüngster Kollege unter Vertrag genommen wurde und acht Jahre lang arbeitete. Im Rias-Orchester konnte er lernen, dass zur Professionalität eines Musikers auch gehörte, nicht immer nur Jazz zu spielen und sich selbst “nicht immer und bei jedem Stück so furchtbar wichtig zu nehmen”. Er erzählt von Playback-Konzerten, von Dieter Thomas Heck, der schon mal über diese “Negermusik” schimpfte, von Peter Alexanders Jazztalent, von Harald Juhnke, der sich seine Programmabfolge nicht merken konnte, und vom Orchesterchef Horst Jankowski, den er bewunderte und doch auch immer wieder bemitleidete.
Natürlich geht’s ums Business: Brönner erzählt, wie er seine Solokarriere 1993 begann, erstes Album, Pressekontakte, erstes Renommee, erster Verriss: Rückwärtsgewandt sei das, was er mache, oberflächlich. Von Anfang an also musste er sich mit dem Problem auseinandersetzen, dass viele seiner Kritiker den Jazz vor allem dann gelten ließen, wenn er in ihren Augen Avantgarde sei, wobei sie das “Prinzip Avantgarde” kaum hinterfragten. Die Musiker würden sich selten so äußern; die “Deuter und Hüter der Reinheitsgebote” fänden sich vor allem unter den Kritikern. “Der kann doch viel mehr”, werde ihm dann etwa vorgeworfen, “Das sei kein Jazz mehr”, oder “Der dient sich dem Publikum an”. Brönner erzählt die Kritiken nach und ist sichtbar getroffen darüber, dass diese Kritiker ihn als Musiker nicht ernst nehmen, seinen eigenen Weg nicht sehen und ihn nicht nach Kriterien beurteilen wollen, die sie aus seiner Musik ableiten.
Brönner erzählt über seine Debüt-Platte, für die er eigenhändig Ray Brown verpflichtete, über eine Produktion mit Kindheitsfreund Stefan Raab, darüber, wie er bei Universal landete, über Platten mit Carla Bruni, Sergio Mendes oder über jene Plattenproduktion, bei der Annie Lennox aus der Ferne zugespielt wurde. Er räsoniert über sein Leben, über Freunde, über das Klischee des Jazzmusikers als Drogensüchtigen, über Liebe, Romantik und Frauen. Er reflektiert über die Tatsache, dass er als deutscher Musiker eine Musik mit afro-amerikanischen Wurzeln spielt, und er mach gleich zwei Liebeserklärungen: an Berlin und an Johann Sebastian Bach. Er spricht über den Markt, den Geschmack des Publikums, über die Notwendigkeit guten Marketings und darüber, dass Deutschland immer noch ein großer Markt für die Musikwelt ist. Die Tatsache, dass Marketing offenbar manchmal wichtiger als die Musik selbst ist, sei Grund für erheblichen Frust. So sähe man das ja auch Abend für Abend bei den Casting Shows im Fernsehen, bei denen es nicht so sehr ums Talent gehe als darum, dass jeder ein Star sein könne. Brönner sei solchen Shows gegenüber sehr misstrauisch und es habe eine Weile gebraucht, bis er sich entschlossen habe, selbst in der Jury zu “X Facto” mitzumischen. Ob man als Jazzmusiker von Plattenkäufen leben könne? “Das hängt”, antwortet Brönner” nicht nur davon ab, wie viel man verkauft. Es hängt auch davon ab, wie viel man investiert.” Er nennt die Zahl der ersten Abrechnung, die er 2007 von Unversal erhalten hatte: 1.300 Euro. Zugleich seien Platten aber auch eine Investition ins eigene Repertoire, in den eigenen Namen, die Bekanntheit, das Image.
In einem der persönlichsten Kapitel berichtet Brönner dann noch ausführlich über eine Begegnung, die ihn besonders prägte. Hildegard Knef, für deren letztes Album er komponierte, es sogar produzierte, die von der Kollegin zur Vertrauten und Freundin wurde. Er spricht über die besondere Beziehung zum Publikum, dass oft besser weiß, wie gut man war als man besser, über die Freiheit des Improvisierens, für die es immer einen Rahmen braucht, über Saxophonisten, die ihn beeindruckten, Ben Webster, Johnny Griffin, Lee Konitz, über Groupies, hohe Töne, musikalische Duelle auf der Bühne, über das elitäre Getue einiger “Mitglieder des Betriebs, ob sie jetzt Musiker, Redakteure, Kritiker sind” und über das typische Till-Brönner-Publikum.
Und zum Schluss: Die Vision. Ein Plädoyer für den Erhalt der Rundfunk-Bigbands, für die Gründung einer Jazzakademie nicht passgleich, aber durchaus vergleichbar mit Jazz at Lincoln Center mit eigenen Räumen, eigener Band, eigenen Nachwuchsprojekten. Und Plattenempfehlungen – für Trompeter, für Jazz-Verächter, für die einsame Insel
Alles in allem: ein von Claudius Seidl spannend zusammengestelltes, äußerst flüssig zu lesendes Buch, auch deshalb empfehlenswert, weil Till Brönner mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält, seine eigene Position offen verteidigt und den Leser damit zum Nachdenken bringt, zum Selbst-Position-Beziehen. Man mag nicht überall einer Meinung mit ihm sein; man mag seine Kritikerschelte manchmal für etwas überzogen, seine Sicht auf “die Avantgarde” für etwas kurzsichtig halten; und man mag auch sein Verständnis vom Jazz nicht überall nachvollziehen: Auseinandersetzen aber muss man sich mit seinen Argumenten, die er wohl begründet und mit denen er einen wichtigen Diskurs über den Jazz und seine Rolle im deutschen Kulturleben anschiebt, wie er auch von Künstlerseite her geführt werden muss.
Wolfram Knauer (Oktober 2010)
William Parker. Conversazioni sul jazz
Von Marcello Lorrai
Milano 2010 (Auditorium)
140 Seiten (plus 50 Seiten Fotos), 18 Euro
ISBN: 97888-86784-52-8
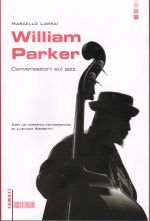 Es ist erstaunlich, dass sich daran kaum etwas geändert hat: Viele der aktuellen Entwicklungen im amerikanischen Jazz werden in Europa intensiver rezipiert und gewürdigt als im Heimatland dieser Musik. Der deutsche Verlag buddy’s knife hatte vor drei Jahren ein Buch mit Texten und Gedichten des New Yorker Kontrabassisten William Parker herausgebracht; jetzt legt Marcello Lorrai in Italien mit einem Buch nach, in dem Parker in einem langen Interview über seine Erfahrungen in der Musik berichtet, aber auch über seine musikalische Ästhetik. Es geht los mit der Kindheit in Goldsboro, North Carolina, musikalischen Einflüssen zwischen Ellington und Beethoven. Er erzählt von seinem Vater, der den ganzen Tag lang Musik gehört habe, Jack McDuff, Gene Ammons, Coleman Hawkins, Ben Webster. Er berichtet von seiner ersten Hörbegegnung mit dem New Thing, dem Free Jazz Ornette Colemans oder Cecil Taylors, von seiner Faszination durch Gedichte Kenneth Patchens. Er erzählt vom Jazzmobile, jener 1964 von Billy Taylor gegründeten Stadtteilinitiative in Harlem, die den Jazz zu den Menschen bringen sollte. Er berichtet über Weggefährten, Don Cherry etwa, Cecil Taylor vor allem, Bill Dixon, Peter Brötzmann und andere. 1978 sei er mit Jemeel Moondoc und Billy Bang zum ersten Mal nach Europa gereist, wo er seither immer wieder gespielt habe, in kleinen Clubs, auf großen Festivals. Parker reflektiert über Rassismus und die Haltung Amiri Barakas und anderer angry black men. Und zum Schluss berichtet er über drei Bassisten, die in seinem Leben eine wichtige Rolle spielten: Charles Mingus, der ihn so sehr beeinflusst habe; Henry Grimes, dem er nach dessen Wiederentdeckung 2003 ein Instrument besorgte; und den Weggefährten Peter Kowald, mit dem er zusammen das spätere Vision Festival entwickelte und der 2002 in seiner New Yorker Wohnung verstarb. Im Mittelteil des Buches finden sich außerdem 50 Seiten voller Fotos von Luciano Rossetti, der Parker beim Konzert oder backstage abgelichtet hat. William Parker bleibt eine Art Weiser im Jazzgeschäft New Yorks: ein großer Künstler, der ohne Scheuklappen genauso viel Respekt vor der Tradition besitzt wie die Kraft Neues anzugehen, der seine musikalische Weisheit aber auch mitteilen will – anderen Musikern genauso wie im Konzert seinem Publikum oder, in diesem Buch, den Lesern. Für die Lektüre sind Italienischkenntnisse vonnöten – eine Übersetzung, zumindest ins Englische, wäre mehr als wünschenswert.
Es ist erstaunlich, dass sich daran kaum etwas geändert hat: Viele der aktuellen Entwicklungen im amerikanischen Jazz werden in Europa intensiver rezipiert und gewürdigt als im Heimatland dieser Musik. Der deutsche Verlag buddy’s knife hatte vor drei Jahren ein Buch mit Texten und Gedichten des New Yorker Kontrabassisten William Parker herausgebracht; jetzt legt Marcello Lorrai in Italien mit einem Buch nach, in dem Parker in einem langen Interview über seine Erfahrungen in der Musik berichtet, aber auch über seine musikalische Ästhetik. Es geht los mit der Kindheit in Goldsboro, North Carolina, musikalischen Einflüssen zwischen Ellington und Beethoven. Er erzählt von seinem Vater, der den ganzen Tag lang Musik gehört habe, Jack McDuff, Gene Ammons, Coleman Hawkins, Ben Webster. Er berichtet von seiner ersten Hörbegegnung mit dem New Thing, dem Free Jazz Ornette Colemans oder Cecil Taylors, von seiner Faszination durch Gedichte Kenneth Patchens. Er erzählt vom Jazzmobile, jener 1964 von Billy Taylor gegründeten Stadtteilinitiative in Harlem, die den Jazz zu den Menschen bringen sollte. Er berichtet über Weggefährten, Don Cherry etwa, Cecil Taylor vor allem, Bill Dixon, Peter Brötzmann und andere. 1978 sei er mit Jemeel Moondoc und Billy Bang zum ersten Mal nach Europa gereist, wo er seither immer wieder gespielt habe, in kleinen Clubs, auf großen Festivals. Parker reflektiert über Rassismus und die Haltung Amiri Barakas und anderer angry black men. Und zum Schluss berichtet er über drei Bassisten, die in seinem Leben eine wichtige Rolle spielten: Charles Mingus, der ihn so sehr beeinflusst habe; Henry Grimes, dem er nach dessen Wiederentdeckung 2003 ein Instrument besorgte; und den Weggefährten Peter Kowald, mit dem er zusammen das spätere Vision Festival entwickelte und der 2002 in seiner New Yorker Wohnung verstarb. Im Mittelteil des Buches finden sich außerdem 50 Seiten voller Fotos von Luciano Rossetti, der Parker beim Konzert oder backstage abgelichtet hat. William Parker bleibt eine Art Weiser im Jazzgeschäft New Yorks: ein großer Künstler, der ohne Scheuklappen genauso viel Respekt vor der Tradition besitzt wie die Kraft Neues anzugehen, der seine musikalische Weisheit aber auch mitteilen will – anderen Musikern genauso wie im Konzert seinem Publikum oder, in diesem Buch, den Lesern. Für die Lektüre sind Italienischkenntnisse vonnöten – eine Übersetzung, zumindest ins Englische, wäre mehr als wünschenswert.
Wolfram Knauer (Oktober 2010)
Von Hitler vertrieben, von Stalin verfolgt. Der Jazzmusiker Eddie Rosner
von Gertrud Pickhan & Maximilian Preisler
Berlin 2010 (be.bra Wissenschaft Verlag)
168 Seiten, 19,95 Euro
 Bis 1933 hieß er Adolf Rosner, änderte dann, aus naheliegenden Gründen, seinen Vornamen, erst in Ady oder Adi, später in Eddie. Ein jüdischer Jazztrompeter, der in den 20er Jahren in Berlin Karriere machte, an den Aufnahmen der legendären Weintraub Syncopators beteiligt war, dann nach Polen, schließlich nach Russland ging, wo er anfangs als Star gefeiert, dann aber als Jazzmusiker verfolgt wurde. Der Journalist Maximilian Preisler ist schon seit einer Weile auf Rosners Spuren und fand in der Historikerin Gertrud Pickhan nun eine Forschungspartnerin bei der Aufgabe, die Lebensgeschichte des Trompeters, dessen Weg von “Erfolg” zu “verfolgt” führte, niederzuschreiben. Die beiden recherchierten auf Ämtern und in Archiven, wühlten in Büchern und Tageszeitungen, und erstellten aus all den so zusammengetragenen Informationen ein überaus lebendiges Bild des Musikers.
Bis 1933 hieß er Adolf Rosner, änderte dann, aus naheliegenden Gründen, seinen Vornamen, erst in Ady oder Adi, später in Eddie. Ein jüdischer Jazztrompeter, der in den 20er Jahren in Berlin Karriere machte, an den Aufnahmen der legendären Weintraub Syncopators beteiligt war, dann nach Polen, schließlich nach Russland ging, wo er anfangs als Star gefeiert, dann aber als Jazzmusiker verfolgt wurde. Der Journalist Maximilian Preisler ist schon seit einer Weile auf Rosners Spuren und fand in der Historikerin Gertrud Pickhan nun eine Forschungspartnerin bei der Aufgabe, die Lebensgeschichte des Trompeters, dessen Weg von “Erfolg” zu “verfolgt” führte, niederzuschreiben. Die beiden recherchierten auf Ämtern und in Archiven, wühlten in Büchern und Tageszeitungen, und erstellten aus all den so zusammengetragenen Informationen ein überaus lebendiges Bild des Musikers.
Vom Aufwachsen in einer jüdischen Familie im Berlin des frühen 20sten Jahrhunderts erfahren wir da, von der kulturellen Ader der Familie, und davon, dass Adolf bereits als Sechsjähriger als Wunderkind aufs Konservatorium geschickt wurde, um Geige zu lernen. Erstes Geld verdiente er in Tanzkapellen wie denen von Efim Schachmeister oder Marek Weber, vor allem aber bei der großen Jazzsensation im Berlin der späten 20er und frühen 30er Jahre, den Weintraub Syncopators. Da hatte er bereits zur Trompete gewechselt und wurde fortan nur noch selten als Geiger erwähnt. Rosner war nicht nur ein erstklassiger Musiker, er war auch ein Showman: Das Publikum tobte, wenn er zwei Trompeten gleichzeitig spielte. 1932 reisten die Weintraub Syncopators als Schiffskapelle nach New York – das Buch druckt ein Faksimile der Passagierliste der SS New York ab –, aber dort durften sie aufgrund des Einspruchs der amerikanischen Musikergewerkschaft ihre Instrumente nicht mit von Bord nehmen.
Nach der Machtergreifung Hitlers emigrierten etliche der Musiker der Weintraubs – darunter auch Friedrich Hollaender – in die USA und anderswohin. Rosner blieb eine Weile in den Niederlanden, trat mit dem Orchester des belgischen Bandleaders Fud Candrix auf und traf Louis Armstrong, der sich gerade auf Europatournee befand und ihm ein Foto mit den Worten widmete “To the white Louis Armstrong from the black Adi Rosner”. Als die Behörden sein Visum nicht verlängerten, ging Rosner 1935 nach Polen. In Krakau und Warschau wurde er gefeiert, zog aber 1938 wieder gen Westen, genauer: nach Paris, wo er nicht nur auf gleichgesinnte Musiker aus Jazz und Showbusiness traf, sondern auch erste Plattenaufnahmen unter eigenem Namen – für das amerikanische Columbia-Label – machte.
Wenig später aber wurde es für jüdische Musiker ernst in Europa. Pickhan und Preisler schildern anschaulich, wie etwa Rosners Schlagzeuger Maurice van Kleef im Durchgangslager Westerborg zusammen mit Kabarettisten und anderen Musikern auftrat. Van Kleef kam erst nach Auschwitz, dann nach Buchenau, und war einer der wenigen, die die KZs überlebten. Im Jahr des Kriegsausbruchs lernte Rosner in Warschau seine zukünftige Frau kennen. Im Oktober 1939 floh das junge Paar nach Bialystock; Rosner wurde kurz darauf Leiter des Belorussischen Jazzorchesters, mit dem er Erfolge in ganz Russland feiern konnte. Das Kapitel über diese Jahre ist reich an Anmerkungen zur sich laufend wandelnden sowjetischen Haltung gegenüber Amerika und dem Jazz in den Kriegs- und frühen Nachkriegsjahren. 1946 passte die Musik vom einen auf den anderen Tag nicht mehr ins ideologische Bild der Machthaber. Rosner als einer der Stars dieser Musik wurde verhaftet, als er nach Polen zurückkehren wollte, und wegen Verrats ins sowjetische Straflager gesteckt. Acht Jahre lang lebte er in verschiedenen Lagern, in denen er, der Vollblutmusiker, bald bereits Lagerorchester zusammenstellte und auch selbst komponierte.
1954 wurde Rosner entlassen, ging nach Moskau und schloss an seine Karriere als Jazzmusiker und Entertainer an, nachdem die Kulturpolitik der Sowjetunion dem Jazz wieder etwas offener gegenüberstand. Er wurde ein für sowjetische Verhältnisse wohlhabender Mann mit großer Wohnung und acht Sparbüchern. Als Benny Goodman 1962 die UdSSR bereiste, stattete er Rosner in dessen Wohnung einen Besuch ab, aß Borschtsch und andere russische Spezialitäten und jammte noch ein bisschen mit dem Trompeter. Anekdoten von Konzerten vor unzufriedenen Werktätigen in der Provinz oder im Theater der Stadt Magadan, in der Rosner lange Zeit inhaftiert gewesen war, beleuchten den Alltag eines Musikers im Russland jener Jahre. Die Zeit aber wurde immer schwieriger, und die Popularität Rosners ließ mit dem Aufkommen anderer musikalischer Moden auch in der Sowjetunion nach.
1973 wurde Rosners Gesuch auf Ausreise in die USA stattgegeben, wo er seine Schwester besuchen wollte. Sechs Tage später flog er weiter nach Berlin und wurde kurz darauf im Durchgangslager Friedland registriert, wo er und seine Frau deutsche Pässe erhielten. Im letzten Kapitel des Buchs nähern sich die Autoren Rosners Versuch in seiner Geburtsstadt wieder Fuß zu fassen. Dieses Kapitel handelt sowohl vom Streit mit Behörden um Entschädigungszahlungen und Rente als auch vom Versuch musikalisch an seine Vorkriegskarriere anzuknüpfen, als die Jugendmode nun wirklich nicht mehr Jazz hieß. Es gab Pläne für Auftritte in nostalgischen Tanzclubs und für Tourneen nach Brasilien und Israel. Doch bevor es dazu kommen konnte, starb Rosner 1976, im Alter von 66 Jahren, an einem Herzinfarkt.
Auch nach seinem Tod verklang Rosners Stimme allerdings nicht vollständig: In Russland kam es 2001 zu einer Art Rosner-Revival, als Alexey Batashev in Moskau ein Gedenkkonzert an den Trompeter organisierte, bei der eine Band Rosners Arrangements aus den 40er bis 60er Jahren nachspielte. Der Dokumentarfilm “The Jazzman from the Gulag” von 1999 erinnerte an Rosners Schicksal in der UdSSR. Der Berliner Saxophonist Dirk Engelhardt arbeitet in seinem Eddie-Rosner-Projekt Rosners verschiedene musikalische Lebensphasen auf. Rosners Tochter Irina Prokofieva-Rosner gab 2005 eine Doppel-CD mit Aufnahmen des Trompeters heraus. Und Gertrud Pickhan und Maximilian Preisler gelingt es in ihrem Buch, die so überaus wechselvolle Geschichte des Adolf / Ady / Adi / Eddie Rosner lebendig werden zu lassen und damit ein Stück pan-europäischer Jazzgeschichte als der Geschichte einer unter Diktaturen immer verfemten Musik.
Wolfram Knauer (September 2010)
Das brennende Klavier. Der Musiker Wolfgang Dauner
Von Wolfgang Schorlau
Hamburg 2010 (Nautilus)
190 Seiten, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-89401-730-9
 Die großen Jazzer des Nachkriegsdeutschlands sind dann doch mit einer Hand abzuzählen. Albert Mangelsdorff, Klaus Doldinger, Gunter Hampel … Peter Brötzmann und Alexander von Schlippenbach scheinen schon ein wenig später zu kommen. Und dann ist da Wolfgang Dauner, jener Tastenzauberer aus Stuttgart, der vom Jazz der amerikanischen Besatzer begeistert bald zum jungen Wilden der Szene wurde, der eine Geige auf der Bühne zertrümmerte oder zum “Urschrei” aufrief, der aber neben dem brennenden Piano, das auf dem Cover Titel seiner Biographie zu sehen ist, die wunderschönsten Harmonien aus dem Klavier herauszaubern kann, der freie Improvisation nicht nur im Free Jazz, sondern auch in der gebundenen Harmonik entdeckt, der Klangflächen erschließt und den Hörer einsaugt mit seinen musikalischen Ideen. Wolfgang Dauner hat viel geschaffen in seinem künstlerischen Leben: wegweisende Platten, etwa “Dream Talk” von 1964 oder “Free Action” von 1967, ein nachhaltig wirkendes paneuropäisches Orchester (das United Jazz and Rock Ensemble); er war Mitgründer des Plattenlabels Mood, schrieb Film- und Fernsehmusiken, trat mit den Größen des deutschen, europäischen, internationalen Jazz auf. Er hat aber auch viel erlebt, und von diesem Leben, von diesem Er-Leben handelt das Buch von Wolfgang Schorlau. Schorlau ist bekannt als Autor politischer Kriminalromane, und seine literarische Ader macht die Dauner-Biographie zu einem flotten Lesevergnügen. Ja, er hängt vieles an Anekdoten auf, aber das Nebeneinander der Anekdoten ist nirgends beliebig, sondern verdichtet sich mehr und mehr zur vielseitigen Persönlichkeit des Pianisten Wolfgang Dauner. Der hält nichts zurück, erzählt von seiner Jugend als Pflegekind, von Drogen und Orgien (oder, wie Schorlau schreibt: “der Begriff Party ist wohl zu lau für das, was in seiner Wohnung stattfindet”, von der Suche und dem Finden, ob in künstlerischer oder privater Hinsicht. Dauner selbst kommt ausführlich zu Wort: über ästhetische Ansichten, lange Haare, die Trauerfeier für Willy Brandt, den “Urschrei”, einen Besuch in New Orleans und und und. Seltene Fotos sind zu sehen, etwa vom splitterfasernackten Fred Braceful (bei einem Happening während des Deutschen Jazzfestivals in Frankfurt) oder auch die kuriose Korrespondenz Dauners mit einer von ihm phantasierten “Cowboy Band Texas”, an die der Zwölfjährige einen Brief schrieb, und über den der “Fort Worth Star-Telegram1948 prompt berichtete (und ihm im Anschluss eine Antwort und eine Cowboy-Banduniform schickte). Schorlaus Buch ist eine lesenswerte Biographie, weil sie sich nicht bei den Fakten aufhält, sondern immer den Menschen dahinter sucht – und findet: den Musiker Wolfgang Dauner.
Die großen Jazzer des Nachkriegsdeutschlands sind dann doch mit einer Hand abzuzählen. Albert Mangelsdorff, Klaus Doldinger, Gunter Hampel … Peter Brötzmann und Alexander von Schlippenbach scheinen schon ein wenig später zu kommen. Und dann ist da Wolfgang Dauner, jener Tastenzauberer aus Stuttgart, der vom Jazz der amerikanischen Besatzer begeistert bald zum jungen Wilden der Szene wurde, der eine Geige auf der Bühne zertrümmerte oder zum “Urschrei” aufrief, der aber neben dem brennenden Piano, das auf dem Cover Titel seiner Biographie zu sehen ist, die wunderschönsten Harmonien aus dem Klavier herauszaubern kann, der freie Improvisation nicht nur im Free Jazz, sondern auch in der gebundenen Harmonik entdeckt, der Klangflächen erschließt und den Hörer einsaugt mit seinen musikalischen Ideen. Wolfgang Dauner hat viel geschaffen in seinem künstlerischen Leben: wegweisende Platten, etwa “Dream Talk” von 1964 oder “Free Action” von 1967, ein nachhaltig wirkendes paneuropäisches Orchester (das United Jazz and Rock Ensemble); er war Mitgründer des Plattenlabels Mood, schrieb Film- und Fernsehmusiken, trat mit den Größen des deutschen, europäischen, internationalen Jazz auf. Er hat aber auch viel erlebt, und von diesem Leben, von diesem Er-Leben handelt das Buch von Wolfgang Schorlau. Schorlau ist bekannt als Autor politischer Kriminalromane, und seine literarische Ader macht die Dauner-Biographie zu einem flotten Lesevergnügen. Ja, er hängt vieles an Anekdoten auf, aber das Nebeneinander der Anekdoten ist nirgends beliebig, sondern verdichtet sich mehr und mehr zur vielseitigen Persönlichkeit des Pianisten Wolfgang Dauner. Der hält nichts zurück, erzählt von seiner Jugend als Pflegekind, von Drogen und Orgien (oder, wie Schorlau schreibt: “der Begriff Party ist wohl zu lau für das, was in seiner Wohnung stattfindet”, von der Suche und dem Finden, ob in künstlerischer oder privater Hinsicht. Dauner selbst kommt ausführlich zu Wort: über ästhetische Ansichten, lange Haare, die Trauerfeier für Willy Brandt, den “Urschrei”, einen Besuch in New Orleans und und und. Seltene Fotos sind zu sehen, etwa vom splitterfasernackten Fred Braceful (bei einem Happening während des Deutschen Jazzfestivals in Frankfurt) oder auch die kuriose Korrespondenz Dauners mit einer von ihm phantasierten “Cowboy Band Texas”, an die der Zwölfjährige einen Brief schrieb, und über den der “Fort Worth Star-Telegram1948 prompt berichtete (und ihm im Anschluss eine Antwort und eine Cowboy-Banduniform schickte). Schorlaus Buch ist eine lesenswerte Biographie, weil sie sich nicht bei den Fakten aufhält, sondern immer den Menschen dahinter sucht – und findet: den Musiker Wolfgang Dauner.
Wolfram Knauer (September 2010)
Vorort von New York? Die Amerikaner in Bremerhaven. Ergebnisse einer Studie am Museum der 50er Jahre Bremerhaven
Von Rüdiger Ritter
Bremerhaven 2010 (Wissenschaftsverlag NW)
372 Seiten, 24,80 Euro
ISBN: 978-3-86509-929-7
 Deutschland Nachkriegs-Jazzgeschichte hängt eng mit seiner Besatzungsgeschichte zusammen. Knapp gesagt: In den englisch besetzten Gebieten spielte man andere Musik als in den amerikanisch besetzten Gebieten. Unter den Briten florierte der in England beliebte Trad Jazz; bei den Amerikanern und unter dem Einfluss der Begegnung deutscher und amerikanischer Musiker der moderne Jazz, der Bebop, Cool Jazz, später der Hard Bop. Albert Mangelsdorff wäre wahrscheinlich überall ein Modernist geworden, aber die Tatsache, dass er in Frankfurt am Main lebte, half erfreulich nach. In letzter Zeit sind einige Studien zum Verhältnis der Deutschen und der Amerikaner in der Zeit der Besatzung erschienen, und die meisten befassen sich mit den “klassischen” amerikanischen Besatzungsgebieten in Süd- und Südwestdeutschland. Dabei war Bremerhaven als Hafenstadt eine ganz besondere Enklave, und die Präsenz der Amerikaner beeinflusste auch hier deutsche Musiker dahingehend, dass sie modernen Jazz spielten, experimentierten, sich die soul-vollen Grooves ihrer amerikanischen Kollegen abschauten oder aber in den Clubs der Stadt durch die Erwartungshaltung ihres amerikanischen Publikums ein anderes musikalisches Bewusstsein entwickelten.
Deutschland Nachkriegs-Jazzgeschichte hängt eng mit seiner Besatzungsgeschichte zusammen. Knapp gesagt: In den englisch besetzten Gebieten spielte man andere Musik als in den amerikanisch besetzten Gebieten. Unter den Briten florierte der in England beliebte Trad Jazz; bei den Amerikanern und unter dem Einfluss der Begegnung deutscher und amerikanischer Musiker der moderne Jazz, der Bebop, Cool Jazz, später der Hard Bop. Albert Mangelsdorff wäre wahrscheinlich überall ein Modernist geworden, aber die Tatsache, dass er in Frankfurt am Main lebte, half erfreulich nach. In letzter Zeit sind einige Studien zum Verhältnis der Deutschen und der Amerikaner in der Zeit der Besatzung erschienen, und die meisten befassen sich mit den “klassischen” amerikanischen Besatzungsgebieten in Süd- und Südwestdeutschland. Dabei war Bremerhaven als Hafenstadt eine ganz besondere Enklave, und die Präsenz der Amerikaner beeinflusste auch hier deutsche Musiker dahingehend, dass sie modernen Jazz spielten, experimentierten, sich die soul-vollen Grooves ihrer amerikanischen Kollegen abschauten oder aber in den Clubs der Stadt durch die Erwartungshaltung ihres amerikanischen Publikums ein anderes musikalisches Bewusstsein entwickelten.
Rüdiger Ritter ist ein jazz-beflissener Historiker und hat quasi nebenher in der ehemaligen Militärkirche auf dem Gelände der einstigen US-Kaserne “Carl Schurz” in Bremerhaven-Weddewarden ein Museum der 50er Jahre aufgebaut. Nun legt er eine ausführliche Studie vor, für die er akribisch in den Akten gewälzt, aber auch jede Menge Zeitzeugeninterviews geführt hat und in der er beleuchtet, wie die Präsenz der Amerikaner das Leben in Bremerhaven in allen Bereichen beeinflusste.
Die Bremerhavener nannten ihre Stadt selbst scherzhaft “Vorort New Yorks” – allerdings gar nicht mit Bezug auf die amerikanische Besatzung, sonder vielmehr mit Bezug auf die Zeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert, als von Bremerhaven aus die großen Passagierschiffe in Richtung Amerika ausliefen, als Bremerhaven für viele Auswanderer die letzte deutsche Stadt war, bevor sie in Ellis Island amerikanischen Boden betraten. Als die Amerikaner nach dem II. Weltkrieg entschieden, Bremerhaven als “Port of Embarkation” zu nutzen, bauten sie genauso wie die Bremerhavener auf dieser Vorgeschichte auf – eine Vorgeschichte, die durchaus dazu beitrug, dass die Besatzung auch durch die Bürger der Stadt von Anfang an positiver gesehen wurde als anderswo.
Ritters Buch beschreibt die Stationierung der Amerikaner, die am 7. Mai 1945 begann und am 5. Juni 1993 mit der Schließung der letzten US-Kaserne endete. Er erklärt, wie sich Briten und Amerikaner nach dem Krieg auf die Aufteilung der Besatzungsgebiete einigten. Er beschreibt die Bedeutung des Standorts Bremerhaven für die US-Streitkräfte in Europa und die US-amerikanische Infrastruktur inner- und außerhalb der Barracks. Zugleich betrachtet er die Lebensumstände der Deutschen zur selben Zeit, Nachkriegsarmut und Überlebensstrategien, den Schwarzmarkt und die Amerikaner als Arbeitgeber. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit den Re-education-Maßnahmen, ein weiteres mit der innerhalb dieses Programms zu sehenden Jugendarbeit der Amerikaner. Fraternisierung, die “German Fräuleins” und “spontane Amerikanisierung in der Kneipe” bringen uns dann langsam zum Thema Kulturtransfer, dem Jazzfreund Ritter ein ausführliches Kapitel einräumt. Er beschreibt “Chico’s Place”, jene Kneipe, in der seit den 50er Jahren Jazz erklang und in die selbst Hamburger Jazzfreunde pilgerten Er schreibt über Armeekappellen, die auch auf Bremerhavens Straßen zu hören waren und neben Marschmusik immer auch Jazziges im Gepäck hatten. Der AFN wird erwähnt und natürlich die Ankunft Elvis Presleys 1958. Vor allem aber beschreibt Ritter die Amerikaner “als Geburtshelfer der Bremerhavener Jazz-Szene” – und man könnte ergänzen: auch der Bremer Szene. Von den Namen, die er nennt, ist kaum einer über die Region hinaus bekannt geworden, doch die Legende lebt weiter. Von “Chico’s Place” erzählen sich alte Jazzer noch heute, und auch der Mythos eines fröhlichen Nebeneinanderlebens hält sich.
Ritter aber setzt auch ein wenig dagegen, indem er stichprobenhaft die verschiedenen Mythen amerikanisch-deutschen Zusammenlebens in Bremerhaven auf ihre Wirklichkeitsnähe hin überprüft, etwa wenn er auf den Umgang der Amerikaner mit Homosexualität, auf den alltäglichen Rassismus und seinen Widerspruch zu den Idealen der Umerziehung, auf “Gis als Unruhestifter” oder auf den Clash der Generationen jener Jahre hinweist, in dem der amerikanische Einfluss immer mehr als ein kulturzersetzender, jugendgefährdender gesehen wurde. Sein Buch ist eine beispielhafte Studie, die zugleich vorführt, wie vielfältig die Beziehungen zwischen eng miteinander lebenden Kulturkreisen sind und vor allem, wieviel Forschungsaufgaben noch vor uns liegen, um konkrete Entwicklungen nachzuzeichnen. Für die deutsche Jazzgeschichte, die das Phänomen der amerikanischen Präsenz in Deutschland ja fast am stärksten betrifft, ist das alles ein besonders spannendes Thema, und Ritters Buch eine gute Ausgangsbasis zur Reflektion über die vielfältigen gegenseitigen Einflüsse.
Wolfram Knauer (September 2010)
Coltrane
Von Paolo Parisi
Bologna 2010 (Blackvelvet Biopop)
128 Seiten, 13,00 Euro
ISBN: 978-88-87827-86-6
 “Am Anfang war der Ton”, beginnt das Buch des Comicautors Paolo Parisi, das die musikalische Lebensgeschichte von John Coltrane erzählt: von seiner Jugend in North Carolina, ersten musikalischen Gehversuchen in Philadelphia, der Zeit bei Dizzy Gillespie, Thelonious Monk und Miles Davis, von Alkohol- und Drogenexzessen, vom Rassismus, von Liebe, Geschäft, Erfolg, von ästhetischen Wollen und vom künstlerischen Nachlass des großen Saxophonisten. Wir begegnen all den wichtigen Personen in seinem Leben, seinem klassischen Quartett, seiner Frau Alice, vielen Kollegen, die an der New Yorker Jazz-Avantgarde der 1960er Jahre mitwirkten, Orten wie dem Birdland und dem Village Vanguard, Aufnahmesessions wie der für “My Favorite Things” oder der für “A Love Supreme”, dessen vier Sätzen der Autor die Überschriften über die vier Großkapitel entlieh. Ein schönes Buch für jeden (italienisch sprechenden) Coltraneliebhaber.
“Am Anfang war der Ton”, beginnt das Buch des Comicautors Paolo Parisi, das die musikalische Lebensgeschichte von John Coltrane erzählt: von seiner Jugend in North Carolina, ersten musikalischen Gehversuchen in Philadelphia, der Zeit bei Dizzy Gillespie, Thelonious Monk und Miles Davis, von Alkohol- und Drogenexzessen, vom Rassismus, von Liebe, Geschäft, Erfolg, von ästhetischen Wollen und vom künstlerischen Nachlass des großen Saxophonisten. Wir begegnen all den wichtigen Personen in seinem Leben, seinem klassischen Quartett, seiner Frau Alice, vielen Kollegen, die an der New Yorker Jazz-Avantgarde der 1960er Jahre mitwirkten, Orten wie dem Birdland und dem Village Vanguard, Aufnahmesessions wie der für “My Favorite Things” oder der für “A Love Supreme”, dessen vier Sätzen der Autor die Überschriften über die vier Großkapitel entlieh. Ein schönes Buch für jeden (italienisch sprechenden) Coltraneliebhaber.
Wolfram Knauer (August 2010)
In Search of Don Ellis, Forgotten Genius, Volume 1-3
von Ken Orton
England 2010 (UniBook / Ken Orton)
Vol. 1: 418 Seiten, 32,94 Euro
Vol. 2: 438 Seiten, 34,23 Euro
Vol. 3: 157 Seiten, 42,97 Euro
ISBN: 9781935038962 (Vol. 1)
ISBN: 9781935038979 (Vol. 2)
ISBN: 9781935038986 (Vol. 3)
Direkt erhältlich über www.unibook.com
Ken Orton ist wahrscheinlich der kenntnisreichste Experte, wenn es um den Trompeter Don Ellis geht, dessen Experimente mit Form und Metrum, aber auch mit außereuropäischen (bzw. außeramerikanischen) Musiktraditionen in den 1960er Jahren weit einflussreicher waren, als es sein Bekanntheitsgrad vermuten lässt. Seine Don Ellis-Biographie ist jetzt erschienen, und sie ist umfangreich geworden: ein Werk mit drei Bänden von insgesamt knapp 1.000 Seiten, auf denen Ellis’ Leben genauso dokumentiert wird wie sein musikalisches Werk. Es ist eine “labor of love”, und es ist ein akribisches Projekt, ohne Zweifel ein Standardwerk über den Trompeter, an dem niemand vorbeikommen wird.
 Der erste Band widmet sich Ellis’ Biographie bis etwa 1971. Orton verfolgt die Familiengeschichte ausführlich, weiß um Leben und Arbeit des Vaters genauso wie um die geographischen Umstände der Kindheit Don Ellis’. Er zitiert aus Interviews mit Familienangehörigen und Bekannten, vor allem aber auch aus persönlichen Papieren, Briefen, Familienbüchern und vielem mehr. Mit acht Jahren erhielt Don sein erstes Instrument, mit zehn Jahren wurde sein musikalisches Talent offiziell festgehalten; mit elf hatte er seine erste Band, für die er auch die Arrangements schrieb. 1956 wurde Ellis in die Armee eingezogen und war bald in Deutschland stationiert, wo er in der 7th Army Symphony spielte. Orton macht überall in seinem Buch ausführlichen gebrauch von persönlichen Briefen, die Don Ellis an seine Eltern und Großeltern schrieb. In solchen Briefen liest man etwa von einer Session mit Tony Scott, von seinem neuen Porsche, von Reisen mit der Band und seiner Unzufriedenheit mit einem neuen Bandleader der Armeekapelle. 1958 wurde Ellis ehrenhaft aus der Armee entlassen. Zurück in New York traf er Joe Zawinul, den er aus Wien kannte und der ihm einen Job in Maynard Fergusons Band vermittelte. Zwischendurch finden sich dabei immer wieder kurze Anmerkungen, die Orton nicht auflöst, die der jazzgeschichtlich bewanderte Leser aber mit Interesse zur Kenntnis nimmt, etwa (aus einem Brief vom Oktober 1959): “Der Gitarrist in meiner Band ist ein Typ, mit dem ich in Frankfurt immer zusammengespielt hatte. Er hat letztes Jahr in die europäischen Jazzumfragen gewonnen.” – gemeint ist wahrscheinlich Attila Zoller, der genau zu dieser Zeit in New York ankam. 1959 nahm Ellis eine Platte mit Charles Mingus auf; 1960 stellte er sein eigenes Quintett im New Yorker Club Birdland vor; später im Jahr erhielt er ein Vollstipendium zur Lenox School of Jazz, über die er einen ausführlichen Report verfasste. Im Herbst nahm er dann sein erstes Album unter eigenem Namen auf, “How Time Passes”, und wieder geben viele persönliche Briefe einen Einblick in das tägliche Leben eines Musikers in jenen Jahren. Orton verfolgt Ellis’ Biographie mehr oder weniger chronologisch, notiert akribisch jeden Termin, jedes Engagement, über das es Belege gibt, zitiert aus Briefen, zeitgenössischen Kritiken, Zeitzeugeninterviews etwa mit seiner Frau Connie. Ellis selbst äußert sich etwa auf eine Frage Leonard Feathers über seine Einstellung zur Ästhetik des Jazz (den er immer noch als “Folk Music” ansieht) und über staatliche Subventionen (“Ich bin absolut dagegen.”). 1962 besuchte Don mit seiner Frau das Jazz Jamboree in Warschau, und Orton druckt sein Tagebuch der Reise ab. 1964 arbeitete Ellis an einem Buch über Rhythmik und bezieht sich darin sowohl auf seine eigenen Experimente mit ungeraden Metren wie auch auf indische Ragas. Wenig später gründete er das Hindustani Jazz Sextet, mit dem er eine Fusion aus indischen und Jazzstilistiken versuchte. Zur selben Zeit fing er an, sich für das Spiel mit Vierteltönen zu interessieren. 1966 übernahm er die Programmplanung des Clubs Bonesville in Los Angeles; im selben Jahr lud er Karin Krog ein, auf einem seiner Alben mitzuwirken. Inzwischen leitete er eine Bigband, die vor allem seine eigenen Kompositionen umsetzte und mit der er in den nächsten Jahren auf großen Festivals zu hören war. Ellis war immer ein sehr aktiver Vertreter des Third Stream und trat etwa 1967 mit seiner Bigband und dem Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Leitung von Zubin Mehta in einem Konzert auf, dass die beiden Klangkörper gegenüberstellte. Etwa zur selben Zeit wandte er sich elektrisch verstärkten Instrumenten für seine Band zu (einschließlich seines eigenen), gehörte damit zu den Vorreitern einer Jazz-Rock-Fusion, was auch außerhalb der Jazzwelt wahrgenommen wurde. 1968 veröffentlichte er mit “Electric Bath” seine erste LP für das Label Columbia, die weltweit Furore machte. Nächste Station auf seinem Weg war die Electric Band, mit der er 1968 auch bei den Berliner Jazztagen zu hören war. Orton spürt Konzertrezensionen selbst in Provinzblättern auf und druckt sie ab, Rezensionen, die manchmal ein wenig sehr ins Einzelne zu gehen scheinen, dabei aber doch das Bild des Alltags eines reisenden Musikers widerspiegeln.
Der erste Band widmet sich Ellis’ Biographie bis etwa 1971. Orton verfolgt die Familiengeschichte ausführlich, weiß um Leben und Arbeit des Vaters genauso wie um die geographischen Umstände der Kindheit Don Ellis’. Er zitiert aus Interviews mit Familienangehörigen und Bekannten, vor allem aber auch aus persönlichen Papieren, Briefen, Familienbüchern und vielem mehr. Mit acht Jahren erhielt Don sein erstes Instrument, mit zehn Jahren wurde sein musikalisches Talent offiziell festgehalten; mit elf hatte er seine erste Band, für die er auch die Arrangements schrieb. 1956 wurde Ellis in die Armee eingezogen und war bald in Deutschland stationiert, wo er in der 7th Army Symphony spielte. Orton macht überall in seinem Buch ausführlichen gebrauch von persönlichen Briefen, die Don Ellis an seine Eltern und Großeltern schrieb. In solchen Briefen liest man etwa von einer Session mit Tony Scott, von seinem neuen Porsche, von Reisen mit der Band und seiner Unzufriedenheit mit einem neuen Bandleader der Armeekapelle. 1958 wurde Ellis ehrenhaft aus der Armee entlassen. Zurück in New York traf er Joe Zawinul, den er aus Wien kannte und der ihm einen Job in Maynard Fergusons Band vermittelte. Zwischendurch finden sich dabei immer wieder kurze Anmerkungen, die Orton nicht auflöst, die der jazzgeschichtlich bewanderte Leser aber mit Interesse zur Kenntnis nimmt, etwa (aus einem Brief vom Oktober 1959): “Der Gitarrist in meiner Band ist ein Typ, mit dem ich in Frankfurt immer zusammengespielt hatte. Er hat letztes Jahr in die europäischen Jazzumfragen gewonnen.” – gemeint ist wahrscheinlich Attila Zoller, der genau zu dieser Zeit in New York ankam. 1959 nahm Ellis eine Platte mit Charles Mingus auf; 1960 stellte er sein eigenes Quintett im New Yorker Club Birdland vor; später im Jahr erhielt er ein Vollstipendium zur Lenox School of Jazz, über die er einen ausführlichen Report verfasste. Im Herbst nahm er dann sein erstes Album unter eigenem Namen auf, “How Time Passes”, und wieder geben viele persönliche Briefe einen Einblick in das tägliche Leben eines Musikers in jenen Jahren. Orton verfolgt Ellis’ Biographie mehr oder weniger chronologisch, notiert akribisch jeden Termin, jedes Engagement, über das es Belege gibt, zitiert aus Briefen, zeitgenössischen Kritiken, Zeitzeugeninterviews etwa mit seiner Frau Connie. Ellis selbst äußert sich etwa auf eine Frage Leonard Feathers über seine Einstellung zur Ästhetik des Jazz (den er immer noch als “Folk Music” ansieht) und über staatliche Subventionen (“Ich bin absolut dagegen.”). 1962 besuchte Don mit seiner Frau das Jazz Jamboree in Warschau, und Orton druckt sein Tagebuch der Reise ab. 1964 arbeitete Ellis an einem Buch über Rhythmik und bezieht sich darin sowohl auf seine eigenen Experimente mit ungeraden Metren wie auch auf indische Ragas. Wenig später gründete er das Hindustani Jazz Sextet, mit dem er eine Fusion aus indischen und Jazzstilistiken versuchte. Zur selben Zeit fing er an, sich für das Spiel mit Vierteltönen zu interessieren. 1966 übernahm er die Programmplanung des Clubs Bonesville in Los Angeles; im selben Jahr lud er Karin Krog ein, auf einem seiner Alben mitzuwirken. Inzwischen leitete er eine Bigband, die vor allem seine eigenen Kompositionen umsetzte und mit der er in den nächsten Jahren auf großen Festivals zu hören war. Ellis war immer ein sehr aktiver Vertreter des Third Stream und trat etwa 1967 mit seiner Bigband und dem Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Leitung von Zubin Mehta in einem Konzert auf, dass die beiden Klangkörper gegenüberstellte. Etwa zur selben Zeit wandte er sich elektrisch verstärkten Instrumenten für seine Band zu (einschließlich seines eigenen), gehörte damit zu den Vorreitern einer Jazz-Rock-Fusion, was auch außerhalb der Jazzwelt wahrgenommen wurde. 1968 veröffentlichte er mit “Electric Bath” seine erste LP für das Label Columbia, die weltweit Furore machte. Nächste Station auf seinem Weg war die Electric Band, mit der er 1968 auch bei den Berliner Jazztagen zu hören war. Orton spürt Konzertrezensionen selbst in Provinzblättern auf und druckt sie ab, Rezensionen, die manchmal ein wenig sehr ins Einzelne zu gehen scheinen, dabei aber doch das Bild des Alltags eines reisenden Musikers widerspiegeln.
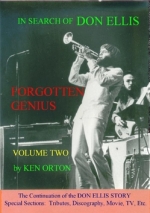 Band 2 der Reihe nimmt den Faden im Jahr 1971 auf und geht im selben Duktus weiter: Konzert auf Konzert, Platte auf Platte werden sorgfältig aufgelistet, Rezensionen gesammelt, Erinnerungen von Musikern und Auszüge aus Ellis’ Tagebuch zugeordnet. Höhepunkte hier etwa seine Filmmusik zu “The French Connection”, für die er 1972 einen Grammy erhielt. Beziehungsprobleme des Trompeters und Probleme mit den Steuerbehörden werden genauso erörtert wie der Bau seines Traumhauses, das 1974 sogar in einer Beilage der Los Angeles Times vorgestellt wurde. 1975 wurde eine Herzerkrankung bei Ellis diagnostiziert, und wenig später musste er nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden. 1976 griff er zusätzlich zu seinen bisherigen Instrumenten zur Posaune; 1977 nahm er eine Platte mit Musik auf, die durch den Film “Star Wars” inspiriert war. 1977 auch korrespondierte er mit Hans Georg Brunner-Schwer über ein Plattenprojekt für das MPS-Label, das Joachim Ernst Berendt angedacht und für das er außerdem Karin Krog vorgemerkt hatte, das aber nie realisiert werden konnte. Im Februar 1978 spielte Ellis’ Quintett beim Jazz Yatra Festival in Bombay, Indien. Der Trompeter war bereits schwer krank zu dieser Zeit, trat aber wie vor auf, wenn er auch mehr und mehr die Trompete auf die Seite legte und stattdessen auf dem Synthesizer spielte. Am 10. Mai 1978 meldete der Melody Maker, Ellis habe sich auf Anraten seiner Ärzte vom aktiven Musikmachen zurückgezogen. Am 17. Dezember 1978 besuchte Ellis eine Vorstellung des Musicals “Evolution of the Blues” von Jon Hendricks. Zurück zuhause unterhielt er sich mit seiner Mutter und brach mitten im Gespräch tot zusammen. Seine Eltern übernahmen die Aufgabe, sein Vermächtnis zu erfüllen, seine Kompositionen und Korrespondenz in einem geeigneten Archiv unterzubringen (sie entschieden sich für das Eastfield College in Texas, an dem Ellis sein letztes Konzert gegeben hatte) und die Erinnerung an ihren Sohn aufrecht zu erhalten.
Band 2 der Reihe nimmt den Faden im Jahr 1971 auf und geht im selben Duktus weiter: Konzert auf Konzert, Platte auf Platte werden sorgfältig aufgelistet, Rezensionen gesammelt, Erinnerungen von Musikern und Auszüge aus Ellis’ Tagebuch zugeordnet. Höhepunkte hier etwa seine Filmmusik zu “The French Connection”, für die er 1972 einen Grammy erhielt. Beziehungsprobleme des Trompeters und Probleme mit den Steuerbehörden werden genauso erörtert wie der Bau seines Traumhauses, das 1974 sogar in einer Beilage der Los Angeles Times vorgestellt wurde. 1975 wurde eine Herzerkrankung bei Ellis diagnostiziert, und wenig später musste er nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden. 1976 griff er zusätzlich zu seinen bisherigen Instrumenten zur Posaune; 1977 nahm er eine Platte mit Musik auf, die durch den Film “Star Wars” inspiriert war. 1977 auch korrespondierte er mit Hans Georg Brunner-Schwer über ein Plattenprojekt für das MPS-Label, das Joachim Ernst Berendt angedacht und für das er außerdem Karin Krog vorgemerkt hatte, das aber nie realisiert werden konnte. Im Februar 1978 spielte Ellis’ Quintett beim Jazz Yatra Festival in Bombay, Indien. Der Trompeter war bereits schwer krank zu dieser Zeit, trat aber wie vor auf, wenn er auch mehr und mehr die Trompete auf die Seite legte und stattdessen auf dem Synthesizer spielte. Am 10. Mai 1978 meldete der Melody Maker, Ellis habe sich auf Anraten seiner Ärzte vom aktiven Musikmachen zurückgezogen. Am 17. Dezember 1978 besuchte Ellis eine Vorstellung des Musicals “Evolution of the Blues” von Jon Hendricks. Zurück zuhause unterhielt er sich mit seiner Mutter und brach mitten im Gespräch tot zusammen. Seine Eltern übernahmen die Aufgabe, sein Vermächtnis zu erfüllen, seine Kompositionen und Korrespondenz in einem geeigneten Archiv unterzubringen (sie entschieden sich für das Eastfield College in Texas, an dem Ellis sein letztes Konzert gegeben hatte) und die Erinnerung an ihren Sohn aufrecht zu erhalten.
Ein Schlusskapitel des biographischen Teils, “Where Do We Go From Here?” stellt sich als das persönlichste des Buchs heraus: Es schildert den Weg des Autors, den Weg Ken Ortons zum Buch, einen Weg, den er Anfang der 1980er Jahre begonnen hatte, als er sich mit Ellis’ Eltern in Kalifornien traf. Orton war mitverantwortlich dafür, dass die Don Ellis Collection 2000 vom Eastfield College an die University of California in Los Angeles überführt wurde, wo sie sinnvoll erschlossen und zugänglich gemacht werden konnte. Orton ist selbst Saxophonist und leitete in den 1990er Jahren eine eigene Bigband, die er The Don Ellis Connection” nannte und mit der er mit Erlaubnis der Familie vor allem Kompositionen des Trompeters aufführte. Die zweite Hälfte des zweiten Bandes füllen Erinnerungen von Kollegen an Don Ellis, unveröffentlichte Manuskripte des Trompeters über Musik, über Jazz, über Ästhetik, sowie eine ausführliche Diskographie, die sowohl seine eigenen Projekte enthält als auch diejenigen, an denen er mitwirkte, Filmmusikern sowie Fernseh- und Videomitschnitte. Eine Liste seiner Kompositionen und Arrangements beschließt den Band.
 Band 3 des opulenten Werks schließlich enthält eine Bildergalerie einiger öffentlicher, vor allem aber privater Fotos: Kinderbilder, die ersten Bands, Fotos aus Deutschland, New York in den 1960ern, die junge Familie, Reise- und Tourneefotos, Plattensitzungen, Bilder, bei denen die Hingabe an die Musik deutlich wird (wenn auch auf den ersten Blick eher der Wandel der Frisuren auffällt). Am Schluss stehen zwei Fotos von einer Ehrung in Boston, auf denen man deutlich sieht, wie krank Ellis bereits war, drei Monate vor seinem Tod.
Band 3 des opulenten Werks schließlich enthält eine Bildergalerie einiger öffentlicher, vor allem aber privater Fotos: Kinderbilder, die ersten Bands, Fotos aus Deutschland, New York in den 1960ern, die junge Familie, Reise- und Tourneefotos, Plattensitzungen, Bilder, bei denen die Hingabe an die Musik deutlich wird (wenn auch auf den ersten Blick eher der Wandel der Frisuren auffällt). Am Schluss stehen zwei Fotos von einer Ehrung in Boston, auf denen man deutlich sieht, wie krank Ellis bereits war, drei Monate vor seinem Tod.
Ken Ortons Buch ist keine schnelle Lesereise. Er hat die letzten dreißig Jahre seinen Recherchen zu Don Ellis gewidmet, und es wirkt, als habe er alles, was er dabei gefunden hat, auch in das Buch gesteckt. Das mag ein Grund dafür sein, dass Orton Schwierigkeiten hatte, einen Verlag für dieses Mammutwerk zu finden – die akribisch festgehaltenen Details zu jedem Auftritt, jeder Platte sind wahrscheinlich tatsächlich vor allem für den Don-Ellis-Fan richtig interessant. Doch wenn man zwischendurch auch manchmal meint, das sei schon ein wenig viel des Guten, liest man sich gleich im nächsten Moment wieder fest in einer Quelle, die Orton nüchtern einführt, die für sich belanglos scheint, im Umfeld aber so ein enorm menschliches Licht auf den Künstler und Komponisten, auf den Trompeter und … ja, man mag sagen Philosophen Don Ellis wirft. Und am Ende ist man dankbar für die Akribie, auch dafür, dass Orton sich dazu entschlossen hat, dieses Material sorgfältig geordnet komplett im “books on demand”-.Verfahren zugänglich zu machen. Man wünschte sich vielleicht noch einen Personen-, Platten-, Titel- und Themenindex. Aber das war’s dann auch schon. Über Don Ellis weiß man fast alles nach der Lektüre. Nur die Musik, die muss man selbst hören.
Wolfram Knauer (August 2010)
PS: Quasi parallel zum Buch erschien eine CD mit Konzertmitschnitten vom Februar 1978, als Ellis mit seinem Quintett in Indien auftrat: Don Ellis, “Live in India. The Lost Tapes of a Musical Legend, Vol. 1” (Sleepy Night Records SNR003CD). Siehe www.sleepynightrecords.com.
Pierre Courbois > Révocation
Herausgegeben von Paul Kusters & Titus Schulz
Westervoort/Niederlande 2010 (Uitgeverij Van Gruting)
226 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 97890-75879-537
 Pierre Courbois hat in seiner musikalischen Karriere eine Menge Dinge als erster gemacht: Er war einer der ersten europäischen Musiker, die mit dem Free Jazz liebäugelten, als er 1961 das Original Dutch Free Jazz Quartet gründete; er leitete mit seiner Association PC aber auch eine der ersten Fusionbands Europas; und spielte darüber hinaus mit Musikern wie Gunter Hampel, Theo Loevendie, Mal Waldron, Rein de Graaf, Manfred Schoof, Willem Breuker, Jasper Van’t Hof und vielen anderen. Er erhielt in seinem Heimatland die höchsten Preise, so 1994 den Bird Award beim Northsea Jazz Festival und 2008 den Boy Edgar Prijs.
Pierre Courbois hat in seiner musikalischen Karriere eine Menge Dinge als erster gemacht: Er war einer der ersten europäischen Musiker, die mit dem Free Jazz liebäugelten, als er 1961 das Original Dutch Free Jazz Quartet gründete; er leitete mit seiner Association PC aber auch eine der ersten Fusionbands Europas; und spielte darüber hinaus mit Musikern wie Gunter Hampel, Theo Loevendie, Mal Waldron, Rein de Graaf, Manfred Schoof, Willem Breuker, Jasper Van’t Hof und vielen anderen. Er erhielt in seinem Heimatland die höchsten Preise, so 1994 den Bird Award beim Northsea Jazz Festival und 2008 den Boy Edgar Prijs.
Jetzt, pünktlich zu seinem 70. Geburtstag, haben Paul Kusters und Titus Schulz dem einflussreichen holländischen Musiker ein Buch gewidmet, in dem Courbois selbst genauso zu Worte kommt wie viele seiner Weggefährten über die Jahre. Es beginnt mit einer biographischen Skizze, einem kursorischen Überblick über die Kapitel seines musikalischen Werdegangs. Dann erzählt einer der Bassklarinettist und Vibraphonist Gunter Hampel über ihre gemeinsame Zeit in den 1960er Jahren, als Courbois in Hampels Band spielte und auch bei der LP “Heartplants” mit von der Partie war. Jasper Van’t Hof und Peter Crijnen erinnern sich gemeinsam mit Courbois an die Association PC und die Auseinandersetzung mit den verschiedenen rhythmischen und ästhetischen Ansätzen der beiden Genres Jazz und Rock, sind sich außerdem einig in ihrer Wertung, dass die Association PC wohl eher eine Jazzrock- als eine Rockjazz-Band gewesen sei. Die meisten der im Buch enthaltenen Interviews sind solche Doppelinterviews, wobei einer der beiden Interviewpartner oft Courbois selbst ist, was dazu führt, dass man als Leser Einblicke in Gespräche zwischen Eingeweihten erhält, dass die Diskussionen sich bald ums Eigentliche drehen, um rhythmische Absprachen (mit Rein de Graaf), Harmonik (mit Theo Loevendie), darum, wie Pierre Courbois rhythmisch Druck machen konnte (mit Leo van Oostroom und Ilja Reijngoud), wie wichtig ihm seine rhythmische Eigenständigkeit auch im Zusammenspiel war (mit Egon Kracht und Niko Langenhuijsen). Courbois selbst erzählt über seine Technik und über Einflüsse auf ihn sowie über sein Instrument, das er aus vielen verschiedenen Einzelteilen zusammengestellt hat und bei dem viele Teile von ihm selbst konstruiert wurden. Mit Jos Janssen unterhalten die Autoren sich über Pierres Gongtechnik und seine Soloaufnahmen. Manfred Schoof lobt Courbois Komposition “Révocation”, die gleich darauf von Martin Fondse ausführlich analysiert wird. Der Geiger Heribert Wagner kommt zu Wort und der Pianist Pol de Haas, mit denen Courbois in den 1980er und 1990er Jahren zusammengespielt hatte. Saxophonist Jasper Blom berichtet, dass die Band nach den Konzerten wenig über die Musik gesprochen habe, und der Schlagzeuger Colin Seidel erzählt, was er bei seinem Lehrer Pierre Courbois hat lernen können. Ein Buch voller Respekt von allen Seiten, aber auch ein Buch, das einen Einblick erlaubt ins Denken eines kreativen Musikers und ins Funktionieren improvisierter Musik zwischen den frühen 1960er Jahren und heute. Und natürlich gibt es jede Menge menschlicher Informationen über Courbois und die Musiker, mit denen er über all diese Jahre zusammengearbeitet hat. Es ist ein überaus opulentes Werk geworden, mit vielen Fotos sowohl aus Courbois’ langen Berufsjahren als auch von seinen selbstgebauten Instrumenten. Zur Lektüre allerdings sollte man schon des Holländischen mächtig sein. Das Buch erschien, wie gesagt, pünktlich zum 70. Geburtstag des Schlagzeugers im April 2010. Es ist eine Labor of Love aller Beteiligten und ein weiterer Baustein zu einer noch ausstehenden europäischen Jazzgeschichte.
Wolfram Knauer (Juli 2010)
Jazz de France. Le guide-annuaire du jazz en France
Herausgegeben von Pascal Anquetil
Paris 2010 (irma = Centre d’Information et de Resources pour les Musiques Actuelles)
608 Seiten, 36 Euro
ISBN: 978-2-916668-27-7
 Wir werden immer wieder gefragt, ob es so etwas wie den von uns alle zwei Jahre vorgelegten “Wegweiser Jazz” auch für andere Länder gibt, und für die meisten Länder müssen wir verneinen. Die eine Ausnahme ist Frankreich, das mit blendendem Beispiel vorangeht mit dem Verzeichnis “Jazz de France”, herausgegeben vom Informationszentrum für zeitgenössische Musik “irma” und betreut von Pascal Anquetil. Das Buch ist ein überaus übersichtliches Verzeichnis der französischen Jazzszene und enthält auf 600 Seiten noch erheblich mehr als wir in die Printausgabe unseres Wegweisers stecken, beispielsweise die Kontaktdaten zu Musikern (die fast 300 Seiten des Buchs ausmachen) oder Journalisten. Clubs, Festivals sind genauso verzeichnet wie Plattenlabels, Agenturen, Schulen oder Workshops. Neben Jazzclubs enthält das Buch dabei auch große Konzertsäle, die in der Vergangenheit regelmäßige Jazzkonzerte präsentierten. Ähnlich wie der “Wegweiser Jazz” verzeichnet auch “Jazz de France” die Größe der Veranstaltungsorte, Ansprechpartner, technische Ausstattung, stilistische Ausrichtung und was immer sonst an Information für die Jazzszene wichtig sein könnte. Mehr als 6.000 Einträge, mehr als 15.000 Kontakte, Adressen von 60 Verbänden, 200 Agenten und Produzenten, 30 Wettbewerben, 540 (!) Festivals, 420 Clubs und 380 größeren Sälen. Dazu die Kontaktdaten für 110 Journalisten, 150 Plattenlabels, 200 Schulen mit Jazzangebot … und vieles mehr. Unverzichtbar für jeden, der mit der französischen Jazzszene arbeitet, und ein wünschenswertes Beispiel für ganz Europa. “Jazz de France” hat übrigens auch uns zu vielen Neuerungen angeregt, die wir in die letzte Ausgabe unseres “Wegweisers Jazz” aufgenommen haben.
Wir werden immer wieder gefragt, ob es so etwas wie den von uns alle zwei Jahre vorgelegten “Wegweiser Jazz” auch für andere Länder gibt, und für die meisten Länder müssen wir verneinen. Die eine Ausnahme ist Frankreich, das mit blendendem Beispiel vorangeht mit dem Verzeichnis “Jazz de France”, herausgegeben vom Informationszentrum für zeitgenössische Musik “irma” und betreut von Pascal Anquetil. Das Buch ist ein überaus übersichtliches Verzeichnis der französischen Jazzszene und enthält auf 600 Seiten noch erheblich mehr als wir in die Printausgabe unseres Wegweisers stecken, beispielsweise die Kontaktdaten zu Musikern (die fast 300 Seiten des Buchs ausmachen) oder Journalisten. Clubs, Festivals sind genauso verzeichnet wie Plattenlabels, Agenturen, Schulen oder Workshops. Neben Jazzclubs enthält das Buch dabei auch große Konzertsäle, die in der Vergangenheit regelmäßige Jazzkonzerte präsentierten. Ähnlich wie der “Wegweiser Jazz” verzeichnet auch “Jazz de France” die Größe der Veranstaltungsorte, Ansprechpartner, technische Ausstattung, stilistische Ausrichtung und was immer sonst an Information für die Jazzszene wichtig sein könnte. Mehr als 6.000 Einträge, mehr als 15.000 Kontakte, Adressen von 60 Verbänden, 200 Agenten und Produzenten, 30 Wettbewerben, 540 (!) Festivals, 420 Clubs und 380 größeren Sälen. Dazu die Kontaktdaten für 110 Journalisten, 150 Plattenlabels, 200 Schulen mit Jazzangebot … und vieles mehr. Unverzichtbar für jeden, der mit der französischen Jazzszene arbeitet, und ein wünschenswertes Beispiel für ganz Europa. “Jazz de France” hat übrigens auch uns zu vielen Neuerungen angeregt, die wir in die letzte Ausgabe unseres “Wegweisers Jazz” aufgenommen haben.
Zu beziehen ist “Jazz de France” direkt bei irma über <http://www.irma.asso.fr/Jazz-de-France>
(Wolfram Knauer, Juli 2010)
Queere Tracks. Subversive Strategien in der Rock- und Popmusik
Von Doris Leibetseder
Bielefeld 2010 (transcript)
336 Seiten, 29,80 Euro
ISBN: 978-3-8376-1193-9
 Die queere Kulturforschung, soviel sei Uneingeweihten kurz verraten, untersucht Kulturentwicklungen auf ihre ganz unterschiedlichen Wechselwirkung mit schwul-lesbischen oder sonstigen nicht-heterosexuellen Lebens-, Denkens- und Fühlensweisen. Das können Verweise auf von heterosexueller Orientierung abweichende Lebensweisen sein, die in Texten vorkommen, die biographische Erfahrung von Musikern genauso wie ihrem Publikum, das Feststellen von Unterdrückungs- oder Sublimierungsstrukturen, also sowohl von deutlicher Ablehnung wie auch vom einfachen Ignorieren des Einflusses nicht-heterosexueller Erfahrungen auf die Musik. Studien zur Queer Theory gibt es mittlerweile zuhauf, und auch für die Musik ist dies ein spannendes Forschungsfeld. Im Bereich des Jazz (wie allgemein der afro-amerikanischen Musik) finden sich aus unterschiedlichen Gründen etliche Verdrängungsbeispiele, die entweder die Existenz schwuler, lesbischer oder gar transsexueller Aktivität in dieser Musik leugnen oder aber die Bedeutung offen gelebter queerer Sexualität für die Entwicklung der Musik abstreiten. John Gill legte 1995 sein Buch Queer Noises vor, und Sherrie Tucker beschäftigt sich seit längerem damit, inwieweit queere Theorie nicht auch die Jazzforschung in Frage stellt.
Die queere Kulturforschung, soviel sei Uneingeweihten kurz verraten, untersucht Kulturentwicklungen auf ihre ganz unterschiedlichen Wechselwirkung mit schwul-lesbischen oder sonstigen nicht-heterosexuellen Lebens-, Denkens- und Fühlensweisen. Das können Verweise auf von heterosexueller Orientierung abweichende Lebensweisen sein, die in Texten vorkommen, die biographische Erfahrung von Musikern genauso wie ihrem Publikum, das Feststellen von Unterdrückungs- oder Sublimierungsstrukturen, also sowohl von deutlicher Ablehnung wie auch vom einfachen Ignorieren des Einflusses nicht-heterosexueller Erfahrungen auf die Musik. Studien zur Queer Theory gibt es mittlerweile zuhauf, und auch für die Musik ist dies ein spannendes Forschungsfeld. Im Bereich des Jazz (wie allgemein der afro-amerikanischen Musik) finden sich aus unterschiedlichen Gründen etliche Verdrängungsbeispiele, die entweder die Existenz schwuler, lesbischer oder gar transsexueller Aktivität in dieser Musik leugnen oder aber die Bedeutung offen gelebter queerer Sexualität für die Entwicklung der Musik abstreiten. John Gill legte 1995 sein Buch Queer Noises vor, und Sherrie Tucker beschäftigt sich seit längerem damit, inwieweit queere Theorie nicht auch die Jazzforschung in Frage stellt.
Doris Leibetseder beschäftigt sich in ihrer Studie kaum mit dem Jazz, sondern vor allem mit Rock- und Popmusik, die auf den ersten Blick vielleicht auch ein dankbareres Feld für das Thema zu sein scheint. Sie beginnt mit einem historischen Kapitel, in dem sie auf female impersonators verweist, die in Vaudeville Shows des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts aufzutreten pflegten. Sie diskutiert die Bedeutung, die das Zurschaustellen von Sexualität etwa durch Josephine Baker erhielt und wie darin zugleich rassistische Klischees festgeschrieben wurden. Sie verweist auf relativ offen lebende lesbische Künstler wie Ma Rainey, auf deutlich mit queeren Klischees spielende Tanzfiguren des Rock ‘n’ Roll, auf den Glamrock, Little Richard, David Bowie, Andy Warhol und späte Auswirkungen des Glamrock bei Boy George, Annie Lennox oder Grace Jones. Selbst (oder insbesondere) offen queere Beispiele der Rock- und Popmusik, erklärt Leibetseder, spielen oft und gern mit Parodie, Täuschung, sarkastischen Gesten, Ironie, Camp, Maske und nutzen dabei sowohl queere Vorlieben wie auch jahrhundertelange Schutzmechanismen. Leibetseders Grundtheorie ist, dass es kein Geschlechteroriginal gäbe, kein richtiges oder falsches Geschlecht, so dass das Spiel mit sexuellen Rollen oder Identitäten auf der Bühne letztlich auf Bedingtheiten im realen Leben verweisen bzw. diese kommentieren.
In einem ersten Kapitel analysiert Leibetsreder die “Ironie” als Strategie, etwa im feministischen Diskurs, bei Madonna oder im Wirken der Riot Grrrls. Dabei spielt neben der Musik auch die Selbstdarstellung im Video oder der Kleidung eine Rolle. Im zweiten Kapitel beleuchtet sie das Mittel der Parodie, grenzt diese etwa von Satire, Burlesque, Persiflage, Pastiche ab, beschreibt das Subversive der Parodie und nennt als ein klassisches Beispiele aus dem Bereich der Pop- und Rockmusik Jimi Hendrix’ berühmte Interpretation der amerikanischen Nationalhymne. Für ihr Thema besonders interessant sind Geschlechterparodien, Travestie, Drag und die damit verbundene Camp-Kultur. Sie zitiert aus Anleitungen zu einem Drag-King-Workshop und bringt als musikalisches Beispiel schließlich Peaches ins Spiel, die Sängerin, die immer wieder männliche Musiker imitierte.
Leibetseder beschäftigt sich in ihrem dritten Kapitel mit “Camp”, dessen Definition und Wortherleitung allein einige Seiten in Anspruch nehmen. Sieht man Camp als sprachliche, gestische, kommunikative Methode einer Aufweichung von Geschlechterrollen und dabei eines ironischen Infragestellens einer jeden sexuellen Sicherheit, einschließlich der eigenen, so ist es eine bewusst ein-, nicht ausschließende Strategie. Camp habe einen riesigen Einfluss auf die Pop-Ästhetik gehabt, betont Leibetseder und stellt nebenbei auch einen subversiven Camp fest, der politischer ist, Stellung bezieht. Ihre Musikbeispiele sind Madonnas Spiel mit Sex- und Geschlechterrollen sowie die Androgynität bei Annie Lennox oder Grace Jones. Geschlechterrollen als Masken analysiert Leibetseder in ihrem vierten Kapitel, fragt nach Fetischisierung, dem Verständnis von Weiblichkeit oder Männlichkeit als Maskerade und geht auf Stücke von Annie Lenox und Peaches ein. Ein weiteres Kapitel ist überschrieben “Mimesis / Mimikry”, behandelt die Gründzüge beider bei Platon und Aristoteles, das Thema Mimesis und Macht sowie die feministische Mimesis, etwa im Werk Irigarays. Ihre Musikbeispiele sind diesmal Grace Jones und Bishi sowie die Band Lesbianson Ecstacy.
Ein eigenes Kapitel ist dem “Cyborg” gewidmet. Cyborg ist ein Kunstwort, gebildet aus cybernetic und organism und wurde von der Popmusik als Strategie genutzt, sexuelle Identität durch die Verbindung mit Maschinen zugleich zu ver- wie zu entkörperlichen. Als Beispiel dient Björks Musikvideo “All is Full of Love”, in dem Björks Gesicht mit einer Roboterfigur vermengt wird. Das Kapitel “Transsexualität” beginnt mit einer Erklärung, warum ein Begriff wie “Technologie” für das Verstehen von Sexualität so wichtig sein kann, bringt eine kurze Geschichte der Transsexualität von Chevalier d’Eon de Beaumont bis in die Jetztzeit. Leibetseder diskutiert die Identitätsprobleme, die sich aus Transsexualität sowohl für die Betroffenen wie für ihre Umwelt geben können (weil Transsexualität nun mal nicht nur in Frage stellt, nicht imitiert, parodiert, sondern aktiv verändert), sie weist auf Vorurteile innerhalb der lesbisch-schwulen Welt gegenüber Transsexuellen hin, und sie nennt als Beispiel aus der Musikwelt (mit vergleichendem Verweis auf Billy Tipton, den Jazzpianisten, bei dem man nach seinem Tod herausfand, dass er tatsächlich eine Frau war) den HipHop-Künstler und “Transmann” Katastrophe. Das letzte Kapitel des Buchs schließlich ist überschrieben mit “Dildo – ‘Gender Bender'” und beschäftigt sich mit sexuellen Praktiken, mit Dildos, Vibratoren und die subversive Benutzung des Motivs Dildo, etwa in Aufnahmen der Band Tribe 8 oder der Sängerin Peaches.
Eine lesenswerte Zusammenfassung der Kapitel (ohne die historischen und ästhetischen Diskurse, aber einschließlich knapper Hinweise auf die Musikbeispiele) beschließt das Buch, das sicher kaum Jazzgehalt hat, als Referenz für eine queere Theorie auch in anderen Genres aber durchaus taugt.
Wolfram Knauer (Juli 2010)
Sonny Rollins. Improvisation und Protest. Interviews
von Christian Broecking
Berlin 2010 (Christian Broecking Verlag)
136 Seiten, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-938763-29-2
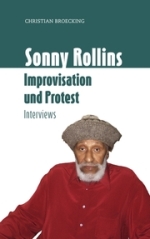 Christian Broecking versammelt in seinem Buch über Sonny Rollins fünf Interviews, die er zwischen 1996 und 2010 mit dem Tenorsaxophonisten geführt hat und schaltet dazwischen Gespräche mit Weggefährten wie Jim Hall, Max Roach oder Roy Haynes sowie mit Zeitzeugen wie David S. Ware, Gary Giddins, Roy Hargrove und Abbey Lincoln. Im Vorwort zum Gespräch von 1996 erzählt Broecking, dass Rollins sich seine Interviews sorgfältig aussuche, sich dann aber Zeit nehme. Der Saxophonist erzählt, wie wichtig es ihm sei, auf die Jazztradition Bezug zu nehmen, berichtet über das Community-Gefühl im Harlem der 1950er und 1960er Jahre, sowie darüber, wie man ihn kritisiert habe, als er 1960 den weißen Gitarristen Jim Hall in seine Band geholt habe. 1998 erzählt er über die “Freedom Suite” und die politische Aufgabe des Jazz, äußert sich vorsichtig über Wynton Marsalis und Jazz at Lincoln Center und berichtet über die Bedeutung von Spiritualität für sein Leben. Im Jahr 2000 verrät Rollins, warum er sich Anfang der 1960er Jahre einen Irokesen-Haarschnitt zugelegt habe und wie wichtig Image und Bühnenpräsenz für einen Jazzmusiker seien. Das wichtigste Element im Jazz, sagt er, sei “die spontane Kreation von Klängen” und verrät dann drei seiner Lieblingssongs: Lester Youngs “Afternoon of a Basie-ite”, Coleman Hawkins’ “The Man I Love” sowie Billie Holidays “Lover Man”. 2006 erzählt er mehr über die legendäre Aufnahmesession, bei der er 1963 mit Coleman Hawkins spielte, über Free Jazz und seinen Schüler, den Saxophonisten David S. Ware, über die Anschläge vom 11. September 2001 und welche Auswirkungen sie gehabt hätten, sowie über sein Leben auf dem Lande. Er berichtet davon, wie er einmal mit Jean-Paul Sartre zusammengetroffen sei und kommentiert die kritischen Positionen von Amiri Baraka und Stanley Crouch zu Entwicklungen im Jazz: diese mögen ja ganz interessant sein, “aber sie bewegen den Berg nicht”. 2010 schließlich äußert er sich verhalten optimistisch über die Wahl Barack Obamas zum amerikanischen Präsidenten sowie über das harte Leben eines Jazzmusikers im Allgemeinen. Mit Jim Hall unterhält sich Broecking über die Platte “The Bridge”, die der Gitarrist 1960 mit Rollins einspielte sowie über Rassismus und Gegenrassismus. Max Roach äußert sich ganz konkret zu Rassismuserfahrungen und betont wie wichtig es sei, sich der politischen Bedeutung von Musik bewusst zu bleiben. Abbey Lincoln erzählt, welche Rolle Roach für ihre Karriere gespielt habe und wie schwierig die politischen Texte, die sie immer wieder gesungen hatte, sich für ihre Karriere erwiesen hätten. Roy Haynes erzählt, wie er sich nur nach und nach bewusst wurde, dass er ja selbst Teil der großen Jazzgeschichte ist. David S. Ware klagt über die Benachteiligung durch Clubbesitzer. Gary Giddins erzählt, wie er auf die Spur des korrekten Geburtsdatums von Louis Armstrong gekommen sei und diskutiert, warum es immer noch so wenig schwarze Jazzkritiker in den USA gäbe. Roy Hargrove schließlich berichtet über all die Einflüsse auf ihn, über Wynton Marsalis sowie über Präsident George W. Bush. Sie alle legen Zeugnis dafür ab, dass der Jazz weder im luft- noch im gesellschaftsleeren Raum geschieht, sondern eine politische Äußerung eben gerade deshalb ist, weil er aus der Gegenwart heraus entsteht, weil er über die Gegenwart reflektiert und weil er zur Kommunikation über die Gegenwart animiert.
Christian Broecking versammelt in seinem Buch über Sonny Rollins fünf Interviews, die er zwischen 1996 und 2010 mit dem Tenorsaxophonisten geführt hat und schaltet dazwischen Gespräche mit Weggefährten wie Jim Hall, Max Roach oder Roy Haynes sowie mit Zeitzeugen wie David S. Ware, Gary Giddins, Roy Hargrove und Abbey Lincoln. Im Vorwort zum Gespräch von 1996 erzählt Broecking, dass Rollins sich seine Interviews sorgfältig aussuche, sich dann aber Zeit nehme. Der Saxophonist erzählt, wie wichtig es ihm sei, auf die Jazztradition Bezug zu nehmen, berichtet über das Community-Gefühl im Harlem der 1950er und 1960er Jahre, sowie darüber, wie man ihn kritisiert habe, als er 1960 den weißen Gitarristen Jim Hall in seine Band geholt habe. 1998 erzählt er über die “Freedom Suite” und die politische Aufgabe des Jazz, äußert sich vorsichtig über Wynton Marsalis und Jazz at Lincoln Center und berichtet über die Bedeutung von Spiritualität für sein Leben. Im Jahr 2000 verrät Rollins, warum er sich Anfang der 1960er Jahre einen Irokesen-Haarschnitt zugelegt habe und wie wichtig Image und Bühnenpräsenz für einen Jazzmusiker seien. Das wichtigste Element im Jazz, sagt er, sei “die spontane Kreation von Klängen” und verrät dann drei seiner Lieblingssongs: Lester Youngs “Afternoon of a Basie-ite”, Coleman Hawkins’ “The Man I Love” sowie Billie Holidays “Lover Man”. 2006 erzählt er mehr über die legendäre Aufnahmesession, bei der er 1963 mit Coleman Hawkins spielte, über Free Jazz und seinen Schüler, den Saxophonisten David S. Ware, über die Anschläge vom 11. September 2001 und welche Auswirkungen sie gehabt hätten, sowie über sein Leben auf dem Lande. Er berichtet davon, wie er einmal mit Jean-Paul Sartre zusammengetroffen sei und kommentiert die kritischen Positionen von Amiri Baraka und Stanley Crouch zu Entwicklungen im Jazz: diese mögen ja ganz interessant sein, “aber sie bewegen den Berg nicht”. 2010 schließlich äußert er sich verhalten optimistisch über die Wahl Barack Obamas zum amerikanischen Präsidenten sowie über das harte Leben eines Jazzmusikers im Allgemeinen. Mit Jim Hall unterhält sich Broecking über die Platte “The Bridge”, die der Gitarrist 1960 mit Rollins einspielte sowie über Rassismus und Gegenrassismus. Max Roach äußert sich ganz konkret zu Rassismuserfahrungen und betont wie wichtig es sei, sich der politischen Bedeutung von Musik bewusst zu bleiben. Abbey Lincoln erzählt, welche Rolle Roach für ihre Karriere gespielt habe und wie schwierig die politischen Texte, die sie immer wieder gesungen hatte, sich für ihre Karriere erwiesen hätten. Roy Haynes erzählt, wie er sich nur nach und nach bewusst wurde, dass er ja selbst Teil der großen Jazzgeschichte ist. David S. Ware klagt über die Benachteiligung durch Clubbesitzer. Gary Giddins erzählt, wie er auf die Spur des korrekten Geburtsdatums von Louis Armstrong gekommen sei und diskutiert, warum es immer noch so wenig schwarze Jazzkritiker in den USA gäbe. Roy Hargrove schließlich berichtet über all die Einflüsse auf ihn, über Wynton Marsalis sowie über Präsident George W. Bush. Sie alle legen Zeugnis dafür ab, dass der Jazz weder im luft- noch im gesellschaftsleeren Raum geschieht, sondern eine politische Äußerung eben gerade deshalb ist, weil er aus der Gegenwart heraus entsteht, weil er über die Gegenwart reflektiert und weil er zur Kommunikation über die Gegenwart animiert.
Wolfram Knauer (Juli 2010)
Herbie Hancock. Interviews
Von Christian Broecking
Berlin 2010 (Christian Broecking Verlag)
77 Seiten, 16,90 Euro
ISBN: 978-3-938763-12-4
 Christian Broecking ist sicher einer der fleißigsten deutschen Interviewer über den amerikanischen Jazz; er berichtet seit vielen Jahren über die Diskussionen innerhalb der afro-amerikanischen Jazzszene. Rechtzeitig zu Herbie Hancocks 70. Geburtstag brachte er kürzlich in seinem noch jungen, aber bereits überaus regen eigenen Verlag ein Büchlein mit Interviews heraus, die er über die Jahre mit dem Pianisten und zwei seiner engen Mitstreiter geführt hat. 1994 sprach Broecking mit Hancock über “Dis Is Da Drum”, eine Produktion, mit der dieser an seinen “Rockit!”-Hit aus den 1980er Jahren anschließen wollte. 1994 war die Marsalis/Crouch-Debatte darüber in vollem Gang, was denn noch als Jazz durchgehe und was bestimmt nicht, und Hancock nimmt kein Blatt vor den Mund: Marsalis sei bestimmt ein wunderbarer Musiker, ansonsten eher ein Historiker, und Engstirnigkeit und Begrenztheit sei seine, Hancocks Sache noch nie gewesen. Er verstehe den Kreuzzug gegen Miles Davis’ Fusion-Projekte nicht ganz und sehe auch seine eigenen Crossover-Versuche durchaus in der Tradition afro-amerikanischer Musik. Im April 2000 sprach Broecking mit Hancock anlässlich seines 60sten Geburtstags und seiner George-Gershwin-Tribut-Tournee. “Gershwin’s World” sei seine bislang ambitionierteste Platte, wirbt Hancock und habe dabei insbesondere großen Spaß an der Zusammenarbeit mit Künstlern gehabt, die nicht aus dem Jazzlager kommen, Joni Mitchell etwa, Stevie Wonder oder Kathleen Battle. Früher habe er sich vor allem als Musiker gesehen, heute sehe er sich als Menschen, der Musik macht. Er spricht über die Möglichkeiten des (damals noch recht jungen) Internets und über eventuelle Projekte im Avantgardebereich. Ein Jahr später war die CD “Future 2 Future” Grund für ein kurzes Interview, in dem Hancock sich u.a. über die Möglichkeiten moderner Technologien auslässt. Bei einem weiteren kurzen Gespräch kommentiert er 2005 die Auswirkungen von Hurrikane Katrina. 2007 schließlich traf Broecking Hancock bei der CD-Veröffentlichung von “The Joni Letters”, und sprach mit ihm über seinen Weg zum Jazz, über Visionen, Freiheit, den afro-amerikanischen Einfluss auf seine Musik, über Buddhismus, und noch einmal über die verengte Sicht von Wynton Marsalis und seiner Clique. Zwischengeschaltet ist ein Interview mit Wayne Shorter über dessen Bandkonzept, über Inspirationsquellen für seine Musik, über das Alter, Buddhismus und darüber, wie Miles Davis in seiner elektrischen Phase das Gefühl der schwarzen Kirche mit Strawinsky verbinden wollte. Ron Carter wiederum äußert sich über seine eigene Entwicklung seit den Tagen, als er im Miles Davis Quintett spielte, über Fusion, politische Meinungsäußerungen von Musikern, sowie darüber, was einen guten Produzenten und was einen guten Bandleader ausmacht. Alles in allem: ein kurzweiliges Buch, das keine Lebensgeschichte bietet, dafür Einsichten in Herbie Hancocks Gedankenwelt und die zweier enger Mitstreiter.
Christian Broecking ist sicher einer der fleißigsten deutschen Interviewer über den amerikanischen Jazz; er berichtet seit vielen Jahren über die Diskussionen innerhalb der afro-amerikanischen Jazzszene. Rechtzeitig zu Herbie Hancocks 70. Geburtstag brachte er kürzlich in seinem noch jungen, aber bereits überaus regen eigenen Verlag ein Büchlein mit Interviews heraus, die er über die Jahre mit dem Pianisten und zwei seiner engen Mitstreiter geführt hat. 1994 sprach Broecking mit Hancock über “Dis Is Da Drum”, eine Produktion, mit der dieser an seinen “Rockit!”-Hit aus den 1980er Jahren anschließen wollte. 1994 war die Marsalis/Crouch-Debatte darüber in vollem Gang, was denn noch als Jazz durchgehe und was bestimmt nicht, und Hancock nimmt kein Blatt vor den Mund: Marsalis sei bestimmt ein wunderbarer Musiker, ansonsten eher ein Historiker, und Engstirnigkeit und Begrenztheit sei seine, Hancocks Sache noch nie gewesen. Er verstehe den Kreuzzug gegen Miles Davis’ Fusion-Projekte nicht ganz und sehe auch seine eigenen Crossover-Versuche durchaus in der Tradition afro-amerikanischer Musik. Im April 2000 sprach Broecking mit Hancock anlässlich seines 60sten Geburtstags und seiner George-Gershwin-Tribut-Tournee. “Gershwin’s World” sei seine bislang ambitionierteste Platte, wirbt Hancock und habe dabei insbesondere großen Spaß an der Zusammenarbeit mit Künstlern gehabt, die nicht aus dem Jazzlager kommen, Joni Mitchell etwa, Stevie Wonder oder Kathleen Battle. Früher habe er sich vor allem als Musiker gesehen, heute sehe er sich als Menschen, der Musik macht. Er spricht über die Möglichkeiten des (damals noch recht jungen) Internets und über eventuelle Projekte im Avantgardebereich. Ein Jahr später war die CD “Future 2 Future” Grund für ein kurzes Interview, in dem Hancock sich u.a. über die Möglichkeiten moderner Technologien auslässt. Bei einem weiteren kurzen Gespräch kommentiert er 2005 die Auswirkungen von Hurrikane Katrina. 2007 schließlich traf Broecking Hancock bei der CD-Veröffentlichung von “The Joni Letters”, und sprach mit ihm über seinen Weg zum Jazz, über Visionen, Freiheit, den afro-amerikanischen Einfluss auf seine Musik, über Buddhismus, und noch einmal über die verengte Sicht von Wynton Marsalis und seiner Clique. Zwischengeschaltet ist ein Interview mit Wayne Shorter über dessen Bandkonzept, über Inspirationsquellen für seine Musik, über das Alter, Buddhismus und darüber, wie Miles Davis in seiner elektrischen Phase das Gefühl der schwarzen Kirche mit Strawinsky verbinden wollte. Ron Carter wiederum äußert sich über seine eigene Entwicklung seit den Tagen, als er im Miles Davis Quintett spielte, über Fusion, politische Meinungsäußerungen von Musikern, sowie darüber, was einen guten Produzenten und was einen guten Bandleader ausmacht. Alles in allem: ein kurzweiliges Buch, das keine Lebensgeschichte bietet, dafür Einsichten in Herbie Hancocks Gedankenwelt und die zweier enger Mitstreiter.
(Wolfram Knauer, Juli 2010)
Where the Dark and the Light Folks Meet
Race and the Mythology, Politics, and Business of Jazz
von Randall Sandke
Lanham/MD 2010 (Scarecrow Press)
275 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-6652-2
 Randy Sandke ist vor allem als swing-betonter Trompeter bekannt, der in den 1990er Jahren außerdem oft als Gastdirigent und Arrangeur fürs Carnegie Hall Jazz Orchestra einsprang. In der Buchreihe des Institute of Jazz Studies an der Rutgers University legt er mit “Where the Dark and the Light Folks Meet” eine Sammlung an interessanten und nachdenkenswerten Essays über eine alternative Sichtweise der Jazzgeschichte vor. Nicht jeder werde seinen Argumenten zustimmen, schreibt Dan Morgenstern, Direktor des Institute of Jazz Studies, im Klappentext, aber man müsse nach der Lektüre dieses Buches einfach viele Details der Jazzgeschichte neu überdenken. Worum geht es im Jazz eigentlich, fragt Sandke im Eingangskapitel und stellt fest, dass es neben der reinen Musik jede Menge an Subtexten gäbe, die da existierten und denen er sich in seinem Buch widmen wolle: Jazz als Musik der Unterdrückung und des Rassismus, Jazz als politische Waffe, und als Antwort auf die Unterdrückung … sind nur zwei dieser Subtexte, die er dabei andeutet. Er befasst sich beispielsweise mit der Jazzkritik, also der Jazzgeschichtsschreibung, fragt, ob es wahr sei, dass diese über lange Zeit weiße Musiker bevorzugt behandelt habe, und überprüft dann Bücher und Essays von namhaften Kritikern wie Marshall Stearns, John Hammond, Leonard Feather, Rudy Blesh, Nat Hentoff, Martin Williams sowie LeRoi Jones, Albert Murray und Stanley Crouch auf die mögliche Zielrichtung ihrer Ausführungen. “Good Intentions and Bad History” nimmt sich dann einige Klischees der Jazzgeschichtsschreibung vor und rückt die Tatsachen ein wenig zurück. Randke hinterfragt hier etwa die afrikanische Genese des Jazz, den Mythos des Congo Square als “missing link” zurück nach Afrika, die Auswirkungen der rassistischen Jim-Crow-Gesetze auf den Jazz, die Legenden um Buddy Bolden oder um die Geburt des Bebop, aber auch die Quellen der “Avantgarde” auf ihren tatsächliche Rückhalt in der Realität – und macht dabei klar, dass wohl nicht alles so einfach und eindimensional war, wie die Jazzgeschichtsschreibung es uns gern glauben machen will. “What Gets Left Out” lautet die Überschrift über einem weiteren Kapitel, in dem Sandke über Aspekte der Jazzgeschichte schreibt, die er in den allgemeinen Narrativen der Jazzbücher vermisst: die Minstrelsy, die nicht nur, wie sie oft abgetan wird, ein rassistisches Spektakel war, sondern durchaus auch andere Deutungsmöglichkeiten besaß; die Geschichte weißer Musiker in New Orleans, die recht früh damit begonnen hätten Jazz zu spielen und aus ähnlichen Gründen wie ihre schwarzen oder “creole” Mitbürger: weil es nämlich Bedarf nach dieser Musik gab; der Einfluss klassischer Techniken und klassischer Musik auf Musiker von Scott Joplin über Fats Waller, Jelly Roll Morton, Art Tatum, Thelonous Monk bis zu McCoy Tyner, Eric Dolphy, Charles Mingus und weit darüber hinaus. Er stellt die Frage nach Hautfarben-Identität (race identity), die im politischen Bewusstsein mancher Jazzmusiker und vieler die Jazzmusik begleitenden politischer Wortführer immer wichtiger wurde; und er beleuchtet die Retro-Bewegung der 1980er Jahre um Wynton Marsalis. Ein eigenes Kapitel widmet Sandke dem Publikum und fragt, für wen denn wohl genau die Musiker über die Jahrzehnte gespielt hätten. Es habe da immer mal wieder den Mythos gegeben, Jazzmusiker hätten vor allem für ein weißes Publikum gespielt, also befasst sich Sandke mit den verschiedenen Schauplätzen in den Clubs und Spielorten der Jazzgeschichte – insbesondere der frühen Jahre und der Bebop-Phase. “It’s Strictly Business” ist das Kapitel überschrieben, in dem Sandke sich mit dem Geschäftlichen um den Jazz beschäftigt. Waren Plattenlabels und Plattenproduzenten wirklich so korrupte Geldgeier, wie ihnen nachgesagt wird? Verdienten die weißen Musiker in den Studios von New York, Chicago oder Hollywood wirklich mehr als ihre schwarzen Kollegen (nachdem diese sich den Zutritt zu solchen Ensembles erstritten – oder erarbeitet – hatten)? Waren Agenten wirklich immer die Parasiten, als die sie gern hingestellt werden, fragt er und beleuchtet Beispiele wie den “Erfinder” des Newport Jazz Festivals George Wein, die Melrose Brothers, Irving Mills, Joe Glaser, Norman Granz, Willard Alexander, Tommy Rockwell, Billy Shaw, eddy Blume, Jack Whittemore und andere. Er befasst sich mit dem leidigen Thema Copyright und stellt dabei einige legendäre Streitfälle um die Urheberschaft vor, um den “Original Dixieland One-Step” etwa, den “Tiger Rag”, “Shimmie Like My Sister Kate”, “Muskrat Ramble” und viele andere Titel der Jazzgeschichte, Fälle, die Musiker wie Louis Armstrong, Kid Ory, Jelly Roll Morton, Duke Ellington, Sonny Rollins, Charlie Parker, Miles Davis und viele andere betrafen. “Show Me the Money” schließlich” heißt es über einem Kapitel, das die Bezahlung von Jazzmusikern zum Thema hat. Von 2 Dollar pro Abend in New Orleans bis zu 100.000 Dollar pro Konzert für Oscar Peterson geht dieser interessante Vergleich des finanziellen Erfolgs der Jazzheroen. Die durchgängig immer wieder erörterte Frage ist, “Geht es bei alledem immer nur um die Hautfarbe?”, und Sandkes Antworten sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Oft hat er gar keine abschließende Antwort auf seine Fragen, will nur ein wenig am allgemeinen scheinbaren Wissen um die Fakten rütteln, um das Bewusstsein des Lesers zu wecken, dass es vielleicht auch ein wenig anders gewesen sein könnte, dass Einzelbeispiele nicht für das Ganze genommen werden dürfen, dass man immer auch die Perspektive desjenigen, der über etwas berichtet, mitlesen müsse. Das alles gelingt ihm in einem überaus spannenden Stil, der einen quasi zum Mitdiskutieren zwingt, zum Revidieren von Meinungen, zum offenen Nachdenken auch über Dinge, die in seinem Buch gar nicht vorkommen. Ein lesenswertes und nachdenkenswertes Buch also, wärmstens gerade denjenigen empfohlen, die meinen, eigentlich alles über die Jazzgeschichte zu wissen.
Randy Sandke ist vor allem als swing-betonter Trompeter bekannt, der in den 1990er Jahren außerdem oft als Gastdirigent und Arrangeur fürs Carnegie Hall Jazz Orchestra einsprang. In der Buchreihe des Institute of Jazz Studies an der Rutgers University legt er mit “Where the Dark and the Light Folks Meet” eine Sammlung an interessanten und nachdenkenswerten Essays über eine alternative Sichtweise der Jazzgeschichte vor. Nicht jeder werde seinen Argumenten zustimmen, schreibt Dan Morgenstern, Direktor des Institute of Jazz Studies, im Klappentext, aber man müsse nach der Lektüre dieses Buches einfach viele Details der Jazzgeschichte neu überdenken. Worum geht es im Jazz eigentlich, fragt Sandke im Eingangskapitel und stellt fest, dass es neben der reinen Musik jede Menge an Subtexten gäbe, die da existierten und denen er sich in seinem Buch widmen wolle: Jazz als Musik der Unterdrückung und des Rassismus, Jazz als politische Waffe, und als Antwort auf die Unterdrückung … sind nur zwei dieser Subtexte, die er dabei andeutet. Er befasst sich beispielsweise mit der Jazzkritik, also der Jazzgeschichtsschreibung, fragt, ob es wahr sei, dass diese über lange Zeit weiße Musiker bevorzugt behandelt habe, und überprüft dann Bücher und Essays von namhaften Kritikern wie Marshall Stearns, John Hammond, Leonard Feather, Rudy Blesh, Nat Hentoff, Martin Williams sowie LeRoi Jones, Albert Murray und Stanley Crouch auf die mögliche Zielrichtung ihrer Ausführungen. “Good Intentions and Bad History” nimmt sich dann einige Klischees der Jazzgeschichtsschreibung vor und rückt die Tatsachen ein wenig zurück. Randke hinterfragt hier etwa die afrikanische Genese des Jazz, den Mythos des Congo Square als “missing link” zurück nach Afrika, die Auswirkungen der rassistischen Jim-Crow-Gesetze auf den Jazz, die Legenden um Buddy Bolden oder um die Geburt des Bebop, aber auch die Quellen der “Avantgarde” auf ihren tatsächliche Rückhalt in der Realität – und macht dabei klar, dass wohl nicht alles so einfach und eindimensional war, wie die Jazzgeschichtsschreibung es uns gern glauben machen will. “What Gets Left Out” lautet die Überschrift über einem weiteren Kapitel, in dem Sandke über Aspekte der Jazzgeschichte schreibt, die er in den allgemeinen Narrativen der Jazzbücher vermisst: die Minstrelsy, die nicht nur, wie sie oft abgetan wird, ein rassistisches Spektakel war, sondern durchaus auch andere Deutungsmöglichkeiten besaß; die Geschichte weißer Musiker in New Orleans, die recht früh damit begonnen hätten Jazz zu spielen und aus ähnlichen Gründen wie ihre schwarzen oder “creole” Mitbürger: weil es nämlich Bedarf nach dieser Musik gab; der Einfluss klassischer Techniken und klassischer Musik auf Musiker von Scott Joplin über Fats Waller, Jelly Roll Morton, Art Tatum, Thelonous Monk bis zu McCoy Tyner, Eric Dolphy, Charles Mingus und weit darüber hinaus. Er stellt die Frage nach Hautfarben-Identität (race identity), die im politischen Bewusstsein mancher Jazzmusiker und vieler die Jazzmusik begleitenden politischer Wortführer immer wichtiger wurde; und er beleuchtet die Retro-Bewegung der 1980er Jahre um Wynton Marsalis. Ein eigenes Kapitel widmet Sandke dem Publikum und fragt, für wen denn wohl genau die Musiker über die Jahrzehnte gespielt hätten. Es habe da immer mal wieder den Mythos gegeben, Jazzmusiker hätten vor allem für ein weißes Publikum gespielt, also befasst sich Sandke mit den verschiedenen Schauplätzen in den Clubs und Spielorten der Jazzgeschichte – insbesondere der frühen Jahre und der Bebop-Phase. “It’s Strictly Business” ist das Kapitel überschrieben, in dem Sandke sich mit dem Geschäftlichen um den Jazz beschäftigt. Waren Plattenlabels und Plattenproduzenten wirklich so korrupte Geldgeier, wie ihnen nachgesagt wird? Verdienten die weißen Musiker in den Studios von New York, Chicago oder Hollywood wirklich mehr als ihre schwarzen Kollegen (nachdem diese sich den Zutritt zu solchen Ensembles erstritten – oder erarbeitet – hatten)? Waren Agenten wirklich immer die Parasiten, als die sie gern hingestellt werden, fragt er und beleuchtet Beispiele wie den “Erfinder” des Newport Jazz Festivals George Wein, die Melrose Brothers, Irving Mills, Joe Glaser, Norman Granz, Willard Alexander, Tommy Rockwell, Billy Shaw, eddy Blume, Jack Whittemore und andere. Er befasst sich mit dem leidigen Thema Copyright und stellt dabei einige legendäre Streitfälle um die Urheberschaft vor, um den “Original Dixieland One-Step” etwa, den “Tiger Rag”, “Shimmie Like My Sister Kate”, “Muskrat Ramble” und viele andere Titel der Jazzgeschichte, Fälle, die Musiker wie Louis Armstrong, Kid Ory, Jelly Roll Morton, Duke Ellington, Sonny Rollins, Charlie Parker, Miles Davis und viele andere betrafen. “Show Me the Money” schließlich” heißt es über einem Kapitel, das die Bezahlung von Jazzmusikern zum Thema hat. Von 2 Dollar pro Abend in New Orleans bis zu 100.000 Dollar pro Konzert für Oscar Peterson geht dieser interessante Vergleich des finanziellen Erfolgs der Jazzheroen. Die durchgängig immer wieder erörterte Frage ist, “Geht es bei alledem immer nur um die Hautfarbe?”, und Sandkes Antworten sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Oft hat er gar keine abschließende Antwort auf seine Fragen, will nur ein wenig am allgemeinen scheinbaren Wissen um die Fakten rütteln, um das Bewusstsein des Lesers zu wecken, dass es vielleicht auch ein wenig anders gewesen sein könnte, dass Einzelbeispiele nicht für das Ganze genommen werden dürfen, dass man immer auch die Perspektive desjenigen, der über etwas berichtet, mitlesen müsse. Das alles gelingt ihm in einem überaus spannenden Stil, der einen quasi zum Mitdiskutieren zwingt, zum Revidieren von Meinungen, zum offenen Nachdenken auch über Dinge, die in seinem Buch gar nicht vorkommen. Ein lesenswertes und nachdenkenswertes Buch also, wärmstens gerade denjenigen empfohlen, die meinen, eigentlich alles über die Jazzgeschichte zu wissen.
(Wolfram Knauer, Juni 2010)
We Want Miles
herausgegeben von Vincent Bessières
Montréal 2010 (Montréal Museum of Fine Arts)
223 Seiten, 39 Euro
ISBN: 978-2-80192-343-9
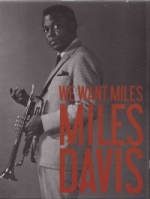 “We Want Miles” heißt die oppulente Ausstellung die Vincent Bessières für die Cité de la Musique in Paris zusammengestellt hat und die zurzeit (und noch bis August 2010) im Montréal Museum of Fine Arts zu sehen ist. Die Ausstellung in Paris umfasst zwei Stockwerke voll mit Material, das sich auf Miles bezieht: Klangkabinen, in denen man Musik aus den verschiedenen Schaffensperioden seines Lebens hören kann, seltene Filmausschnitte von Konzerten oder Interviews, in denen er über seine Musik spricht, seine Kleidung und Gemälde, vieler seiner Instrumente, originale Notenblätter etlicher Aufnahmesessions, einschließlich der legendären Capitol-Nonett-Aufnahmen von 1949, sowie handschriftliche Notizen über die Aufnahmesitzungen, die oft von seinem langjährigen Produzenten Teo Macero stammen. Dem Kurator der Ausstellung Vincent Bessières und seinen Mitarbeitern von der Cité de la Musique ist es gelungen, ein wenig vom Geist des Trompeters einzufangen, den Besucher langsam in Miles’ Welt eintauchen zu lassen. Sie zeichnen seine musikalische und persönliche Entwicklung über die Jahre in Saal nach Saal nach und geben selbst seinem Rückzug von Musik und Öffentlichkeit in den späten 1970er Jahren einen eigenen Raum: einen dunklen Durchgang mit wenigen Dokumenten an den schwarzen Wänden, die knappe Einblicke in seine Probleme der Zeit geben. Am Anfang der Ausstellung mag man noch meinen, dieses Foto sei einem doch eh bekannt, diese Platten ebenfalls oder jener Zeitungsartikel. Mehr und mehr aber wird man in den Sog der Ausstellung gezogen und erlebt bestimmte Phasen in Miles’ Entwicklung anders als man sie zuvor erlebt hat, einfach durch die Art und Weise, wie die Ausstellungsstücke einander gegenübergestellt sind, wie die Musik aus den Klangkabinen, die Videos und all die anderen Dokumente einander ergänzen und einen die Musik und das Leben von Miles Davis neu entdecken, neu sehen, neu hören lassen. Der Ausstellungskatalog zeigt viele der in der Cité de la Musique zu sehenden Exponate und enthält daneben einen ausführlichen Text von Franck Bergerot sowie kürzere Texte von George Avakian, Laurent Cugny, Ira Gitler, David Liebman, Francis Marmande, John Szwed und Mike Zwerin. Nun ist der ursprünglich nur auf Französisch erhältliche Katalog auch in englischer Übersetzung erschienen: eine wunderbare Sammlung an Dokumenten, Fotos und Erinnerungen.
“We Want Miles” heißt die oppulente Ausstellung die Vincent Bessières für die Cité de la Musique in Paris zusammengestellt hat und die zurzeit (und noch bis August 2010) im Montréal Museum of Fine Arts zu sehen ist. Die Ausstellung in Paris umfasst zwei Stockwerke voll mit Material, das sich auf Miles bezieht: Klangkabinen, in denen man Musik aus den verschiedenen Schaffensperioden seines Lebens hören kann, seltene Filmausschnitte von Konzerten oder Interviews, in denen er über seine Musik spricht, seine Kleidung und Gemälde, vieler seiner Instrumente, originale Notenblätter etlicher Aufnahmesessions, einschließlich der legendären Capitol-Nonett-Aufnahmen von 1949, sowie handschriftliche Notizen über die Aufnahmesitzungen, die oft von seinem langjährigen Produzenten Teo Macero stammen. Dem Kurator der Ausstellung Vincent Bessières und seinen Mitarbeitern von der Cité de la Musique ist es gelungen, ein wenig vom Geist des Trompeters einzufangen, den Besucher langsam in Miles’ Welt eintauchen zu lassen. Sie zeichnen seine musikalische und persönliche Entwicklung über die Jahre in Saal nach Saal nach und geben selbst seinem Rückzug von Musik und Öffentlichkeit in den späten 1970er Jahren einen eigenen Raum: einen dunklen Durchgang mit wenigen Dokumenten an den schwarzen Wänden, die knappe Einblicke in seine Probleme der Zeit geben. Am Anfang der Ausstellung mag man noch meinen, dieses Foto sei einem doch eh bekannt, diese Platten ebenfalls oder jener Zeitungsartikel. Mehr und mehr aber wird man in den Sog der Ausstellung gezogen und erlebt bestimmte Phasen in Miles’ Entwicklung anders als man sie zuvor erlebt hat, einfach durch die Art und Weise, wie die Ausstellungsstücke einander gegenübergestellt sind, wie die Musik aus den Klangkabinen, die Videos und all die anderen Dokumente einander ergänzen und einen die Musik und das Leben von Miles Davis neu entdecken, neu sehen, neu hören lassen. Der Ausstellungskatalog zeigt viele der in der Cité de la Musique zu sehenden Exponate und enthält daneben einen ausführlichen Text von Franck Bergerot sowie kürzere Texte von George Avakian, Laurent Cugny, Ira Gitler, David Liebman, Francis Marmande, John Szwed und Mike Zwerin. Nun ist der ursprünglich nur auf Französisch erhältliche Katalog auch in englischer Übersetzung erschienen: eine wunderbare Sammlung an Dokumenten, Fotos und Erinnerungen.
(Wolfram Knauer)
silent solos. improvisers speak
herausgegeben von Renata Da Rin
Köln 2010 (buddy’s knife)
176 Seiten, 22,00 Euro
ISBN: 978-3-00-030557-3
 Die Bücher aus dem Kölner Verlag Buddy’s Knife haben in nur wenigen Ausgaben bereits ein ganz eigenes Profil: schwarz eingebunden mit einem matt-bunten Foto- oder Grafik-Querstreifen in der Mitte des Covers, feines Papier, eine schöne Type, die Schrift in tiefdunklem Grau; und auch inhaltlich: meist Literarisches und Poetisches aus der Feder von Musikern der amerikanischen Avantgardeszene. Das neueste Buch ist da nicht anders: 50 Musiker vor allem der New Yorker Downtown-Szene haben Gedichte beigetragen, die mit Musik zu tun haben oder auch nicht, die abstrakt sind oder reflexiv oder sehr realitätsbezogen. Wahrscheinlich stimmt, was George Lewis in seinem Vorwort sagt, dass man zuerst geneigt sein mag, Ähnlichkeiten zwischen den Texten und der Musik ihrer Autoren zu suchen. Lewis auch stellt die provokante These auf, dass Worte schneller reisten als Musik. Auf jeden Fall käme in der Poesie eine weitere Spielebene hinzu, die der Bedeutungen nämlich, die sich aufeinander und auf die Worte zuvor und danach beziehen, eine Ebene, die sich laufend verändert und die den Leser involviert. Nun, in den Gedichten, die sich in diesem Band befinden, lassen sich allerhand Dinge entdecken, die über das poetische Genießen hinaus Bedeutung besitzen. Wirklich wahllos herausgepickt: Lee Konitzs “no easy way” über die Schwierigkeiten des Zusammenspielens; Gunther Hampels “improvisation – the celebration of the moment” über genau das, was also geschieht, wenn man improvisiert; Katie Bulls “improvisation is the jazz-mandala-voyage” ebenfalls über den Improvisationsprozess; Jayne Cortezs “what’s your take” über die ökonomische Globalisierung und die Notwendigkeit, in diesem Prozess Stellung zu beziehen; Roy Nathansons “charles’ song” über und für Charles Gayle; David Liebmans “what jazz means to me” über seine ganz persönliche Beziehung zu dieser Musik; Assif Tsahars “untitled” über die Stille der Natur; Joseph Jarmans “a vision against violence”; Charles Gayles “untitled”, ein großer Dank ans Publikum … und so viele andere Gedichte, die Geschichten erzählen oder Stimmungen schaffen, die auf reale Erlebnisse rekurrieren oder in sich (den Autor) hineinhorchen. Von David Amram bis Henry P. Warner sind es insgesamt 82 Texte, alphabetisch nach Autoren sortiert, abwechslungsreich, lyrisch, hoffnungsvoll, oft das Suchen widerspiegelnd, das die Autoren auch in ihrer Musik vorantreibt. All diese Texte und Gedichte erlauben einen anderen Blick auf die Musik, nicht beschreibend, sondern wie Soli in einem anderen Medium, “silent solos”, die nichtsdestotrotz heftigst klingen können.
Die Bücher aus dem Kölner Verlag Buddy’s Knife haben in nur wenigen Ausgaben bereits ein ganz eigenes Profil: schwarz eingebunden mit einem matt-bunten Foto- oder Grafik-Querstreifen in der Mitte des Covers, feines Papier, eine schöne Type, die Schrift in tiefdunklem Grau; und auch inhaltlich: meist Literarisches und Poetisches aus der Feder von Musikern der amerikanischen Avantgardeszene. Das neueste Buch ist da nicht anders: 50 Musiker vor allem der New Yorker Downtown-Szene haben Gedichte beigetragen, die mit Musik zu tun haben oder auch nicht, die abstrakt sind oder reflexiv oder sehr realitätsbezogen. Wahrscheinlich stimmt, was George Lewis in seinem Vorwort sagt, dass man zuerst geneigt sein mag, Ähnlichkeiten zwischen den Texten und der Musik ihrer Autoren zu suchen. Lewis auch stellt die provokante These auf, dass Worte schneller reisten als Musik. Auf jeden Fall käme in der Poesie eine weitere Spielebene hinzu, die der Bedeutungen nämlich, die sich aufeinander und auf die Worte zuvor und danach beziehen, eine Ebene, die sich laufend verändert und die den Leser involviert. Nun, in den Gedichten, die sich in diesem Band befinden, lassen sich allerhand Dinge entdecken, die über das poetische Genießen hinaus Bedeutung besitzen. Wirklich wahllos herausgepickt: Lee Konitzs “no easy way” über die Schwierigkeiten des Zusammenspielens; Gunther Hampels “improvisation – the celebration of the moment” über genau das, was also geschieht, wenn man improvisiert; Katie Bulls “improvisation is the jazz-mandala-voyage” ebenfalls über den Improvisationsprozess; Jayne Cortezs “what’s your take” über die ökonomische Globalisierung und die Notwendigkeit, in diesem Prozess Stellung zu beziehen; Roy Nathansons “charles’ song” über und für Charles Gayle; David Liebmans “what jazz means to me” über seine ganz persönliche Beziehung zu dieser Musik; Assif Tsahars “untitled” über die Stille der Natur; Joseph Jarmans “a vision against violence”; Charles Gayles “untitled”, ein großer Dank ans Publikum … und so viele andere Gedichte, die Geschichten erzählen oder Stimmungen schaffen, die auf reale Erlebnisse rekurrieren oder in sich (den Autor) hineinhorchen. Von David Amram bis Henry P. Warner sind es insgesamt 82 Texte, alphabetisch nach Autoren sortiert, abwechslungsreich, lyrisch, hoffnungsvoll, oft das Suchen widerspiegelnd, das die Autoren auch in ihrer Musik vorantreibt. All diese Texte und Gedichte erlauben einen anderen Blick auf die Musik, nicht beschreibend, sondern wie Soli in einem anderen Medium, “silent solos”, die nichtsdestotrotz heftigst klingen können.
Wolfram Knauer (Mai 2010)
Long Lost Blues. Popular Blues in America, 1850-1920
Von Peter C. Muir
Urbana/Illinois 2010 (University of Illinois Press)
254 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-07676-3
 Wie der Jazz wird auch der Blues allgemein als eine Musik des 20. Jahrhunderts wahrgenommen, eine Musik, die sich parallel zur Tonaufzeichnung entwickelt hat. Anders als der Jazz aber hat der Blues tatsächlich eine längere Geschichte, die Peter Muir in seinem Buch nachzeichnet, das sich den Jahren vor den ersten Bluesaufnahmen widmet, den Jahrzehnten vor Mamie Smith’s “Crazy Blues”. Er schreibt damit über ein Genre, das er selbst als “Popular Blues” bezeichnet und damit sowohl vom Folk Blues wie auch vom Nachkriegs-Chicago-Blues unterscheidet. Entscheidend für die Zuordnung ist ihm dabei die Zielgruppe und Marktorientierung der Musik. Zu den Künstlern dieses Popular Blues zählen also Musiker wie W.C. Handy, Spencer Williams, James P. Johnson, George W. Thomas und Perry Bradford. Muirs Definition des Blues ist dabei denkbar einfach: Wo “Blues” draufsteht, entscheidet er, da wird reingeschaut: Der Titel oder Untertitel der Musik ist ihm wichtiger als eine musikalische Einordnung, auch deshalb, weil es ihm vor allem um eine kulturelle Studie geht und ihn daher diejenige Musik interessiert, die von der Kultur, in der sie entstand, als Blues verkauft werden wollte. Wenn sein Buch im Untertitel auch bis aufs Jahr 1850 zurückgreift, so widmet er sich im Hauptteil allerdings der Musik, die zwischen 1912 und 1920 entstanden ist und für die er eine “Popular Blues Industry” feststellt. Am 12. Januar 1912 meldeten Chris Smith und Tim Brymn beim Urheberrechtsbüro in Washington eine Komposition mit dem simplen Titel “The Blues” an, eigentlich ein Ragtime-Song, der aber in der Thematik (eine Frau, die um ihren Liebsten klagt) wie auch in harmonischen Wendungen Bluesmomente evoziert. Muir untersucht die Veröffentlichungen der nächsten neun Jahre und stellt eine Zunahme der “Blues”-Notenpublikationen fest von 5 im Jahre 1912 bis 456 im Jahr 1920. Er zählt die Blues-Schellackplatten jener Jahre genauso wie die Zylinder und Klavierwalzen und stellt fest, dass die Notenveröffentlichungen damals deutlich einen wichtigeren Marktanteil besaßen als die Plattenveröffentlichungen. Er schaut auf die Verwendung des Bluesklischees im Varieté (Vaudeville) jener Jahre, in Musicals, Minstrel Shows, in Aufführungen von weißen genauso wie schwarzen Künstlern. Er diskutiert das damals kaum vorhandene Bewusstsein der Musiker zur Dualität von Roots Music und Popmusik, in der ihre Aufführungen standen. Muir analysiert einzelne Blueskompositionen, etwa den “Broadway Blues” von Arthur Swanstrom und Morgan Carey, der auch in seiner Klavier/Gesangsfassung komplett abgedruckt ist. Er klassifiziert die von ihm gefundenen Stücke nach Themen, etwa “Beziehungs-Blues”, “Nostalgie-Blues”, “Prohibitions-Blues”, “Kriegs-Blues” und “reflektive Blues”, schaut aber auch auf die rein instrumentalen Blueskompositionen, die oft einen stärkeren Folkduktus besaßen als die vokalen Stücke. Muir erwähnt die Verbindungen zwischen Blues und Ragtime, Blues und Foxtrott und auch Blues und Jazz, wobei er etwa Jelly Roll Mortons “Jelly Roll Blues” diskutiert. Natürlich befasst er sich mit der zwölftaktigen Form des klassischen Bluesmodells, mit Blue Notes, Barbershop Endings, einer der typischsten melodischen Viernotenfiguren jener frühen Blues sowie einem textlichen Klischee, der Zeile “I’ve Got the Blues”, die sich in so vielen der Titel findet. Ein eigenes Kapitel widmet Mur den Konnotationen des Begriffs “Blues”, also den nicht-musikalischen und nicht-textlichen Verständnissen von Traurigkeit, Depression, Schicksalsschlag, und fragt nach den homöopathischen oder allopathischen Qualitäten des Blues, die dabei helfen könnten, solchen Gemütszuständen entgegenzuwirken. Der erfolgreichste Blueskomponist dieser Jahre, W.C. Handy, verdient und erhält ein eigenes Großkapitel. Muir unterteilt sein Wirken in seine Zeit in Memphis (1909-1917) und seine New Yorker Jahre (nach 1917) und untersucht etliche seiner Kompositionen auf ihre Machart, darunter “Yellow Dog Blues”, “Beale Street Blues” und “Saint Louis Blues”. Einige der kreativsten Blueskompositionen, konstatiert Muir, stammten von Komponisten aus den amerikanischen Südstaaten. Als Beispiele führt er Titel an wie “Baby Seals’ Blues”, den “Dallas Blues” oder aber Kompositionen von Euday L. Bowman, George W. Thomas und Perry Bradford. Im abschließenden Kapitel wirft Muir dann noch einen Blick auf Kompositionen, die vor 1912 veröffentlicht wurden und deutliche musikalische oder textliche Beziehungen zum Blues zeigen. Hier wird er dann auch dem Untertitel seines Buchs gerecht und reicht bis 1850 zurück (ein Stück namens “I Have Got the Blues To Day”). Er verfolgt die zwölftaktige Bluesform immerhin bis zurück ins Jahr 1895 (Muir bezieht sich auch hier nur auf Notenveröffentlichungen) und streicht dabei vor allem den Komponisten Hughie Cannon heraus, einen weißen Ragtimepianisten, der heute vor allem noch wegen seines Stücks “Bill Bailey” bekannt ist, daneben aber immerhin dreizehn Stücke schrieb, die Muir zu jenen “Proto-Blues” zählt, Stücke, die vor allem in der formalen und harmonischen Struktur wichtige Einflüsse auf die spätere Bluesmode der Jahre nach 1912 haben sollten. Muir diskutiert das Phänomen der Bluesballade (insbesondere “Frankie and Johnny”) und begründet, warum der Bluesstimmenverlauf, wie wir ihn kennen, und nicht die harmonische Form von “Frankie” sich wohl letzten Endes im populären Blues durchgesetzt haben. Ein Anhang des Buchs listet Stücke, die “Blues” im Titel tragen und zwischen 1912 und 1915 zum Copyright angemeldet wurden. Muirs Buch ist durchsetzt mit musikalischen Beispielen, Auszügen aus den Notenveröffentlichungen, um die sich seine Studie hauptsächlich dreht. Er problematisiert kaum (gerade mal im Vorwort) die performativen Eigenheiten all dieser Kompositionen, die Vereinfachungen ihrer Notenveröffentlichungen, die Ver- und Überarbeitungen, die viele dieser populären Stücke in Arrangements von Bands, Minstrelkünstlern und anderen Musikern erhielten. Sein Buch deckt allerdings recht erschöpfend ein Kapitel ab, das sich manchem als Frage gestellt haben mag, der sich mit dem Repertoire vor 1920 beschäftigt hat und dabei über eine Vielzahl an mit “Blues” betitelten Stücken gestolpert ist, die aber nur bedingt dem entsprechen, was man nach 1920 als Blues versteht. “Long Lost Blues” ist damit also eine überaus spannende und umfassende Aufarbeitung eines wichtigen Teils der Vorgeschichte des Jazz.
Wie der Jazz wird auch der Blues allgemein als eine Musik des 20. Jahrhunderts wahrgenommen, eine Musik, die sich parallel zur Tonaufzeichnung entwickelt hat. Anders als der Jazz aber hat der Blues tatsächlich eine längere Geschichte, die Peter Muir in seinem Buch nachzeichnet, das sich den Jahren vor den ersten Bluesaufnahmen widmet, den Jahrzehnten vor Mamie Smith’s “Crazy Blues”. Er schreibt damit über ein Genre, das er selbst als “Popular Blues” bezeichnet und damit sowohl vom Folk Blues wie auch vom Nachkriegs-Chicago-Blues unterscheidet. Entscheidend für die Zuordnung ist ihm dabei die Zielgruppe und Marktorientierung der Musik. Zu den Künstlern dieses Popular Blues zählen also Musiker wie W.C. Handy, Spencer Williams, James P. Johnson, George W. Thomas und Perry Bradford. Muirs Definition des Blues ist dabei denkbar einfach: Wo “Blues” draufsteht, entscheidet er, da wird reingeschaut: Der Titel oder Untertitel der Musik ist ihm wichtiger als eine musikalische Einordnung, auch deshalb, weil es ihm vor allem um eine kulturelle Studie geht und ihn daher diejenige Musik interessiert, die von der Kultur, in der sie entstand, als Blues verkauft werden wollte. Wenn sein Buch im Untertitel auch bis aufs Jahr 1850 zurückgreift, so widmet er sich im Hauptteil allerdings der Musik, die zwischen 1912 und 1920 entstanden ist und für die er eine “Popular Blues Industry” feststellt. Am 12. Januar 1912 meldeten Chris Smith und Tim Brymn beim Urheberrechtsbüro in Washington eine Komposition mit dem simplen Titel “The Blues” an, eigentlich ein Ragtime-Song, der aber in der Thematik (eine Frau, die um ihren Liebsten klagt) wie auch in harmonischen Wendungen Bluesmomente evoziert. Muir untersucht die Veröffentlichungen der nächsten neun Jahre und stellt eine Zunahme der “Blues”-Notenpublikationen fest von 5 im Jahre 1912 bis 456 im Jahr 1920. Er zählt die Blues-Schellackplatten jener Jahre genauso wie die Zylinder und Klavierwalzen und stellt fest, dass die Notenveröffentlichungen damals deutlich einen wichtigeren Marktanteil besaßen als die Plattenveröffentlichungen. Er schaut auf die Verwendung des Bluesklischees im Varieté (Vaudeville) jener Jahre, in Musicals, Minstrel Shows, in Aufführungen von weißen genauso wie schwarzen Künstlern. Er diskutiert das damals kaum vorhandene Bewusstsein der Musiker zur Dualität von Roots Music und Popmusik, in der ihre Aufführungen standen. Muir analysiert einzelne Blueskompositionen, etwa den “Broadway Blues” von Arthur Swanstrom und Morgan Carey, der auch in seiner Klavier/Gesangsfassung komplett abgedruckt ist. Er klassifiziert die von ihm gefundenen Stücke nach Themen, etwa “Beziehungs-Blues”, “Nostalgie-Blues”, “Prohibitions-Blues”, “Kriegs-Blues” und “reflektive Blues”, schaut aber auch auf die rein instrumentalen Blueskompositionen, die oft einen stärkeren Folkduktus besaßen als die vokalen Stücke. Muir erwähnt die Verbindungen zwischen Blues und Ragtime, Blues und Foxtrott und auch Blues und Jazz, wobei er etwa Jelly Roll Mortons “Jelly Roll Blues” diskutiert. Natürlich befasst er sich mit der zwölftaktigen Form des klassischen Bluesmodells, mit Blue Notes, Barbershop Endings, einer der typischsten melodischen Viernotenfiguren jener frühen Blues sowie einem textlichen Klischee, der Zeile “I’ve Got the Blues”, die sich in so vielen der Titel findet. Ein eigenes Kapitel widmet Mur den Konnotationen des Begriffs “Blues”, also den nicht-musikalischen und nicht-textlichen Verständnissen von Traurigkeit, Depression, Schicksalsschlag, und fragt nach den homöopathischen oder allopathischen Qualitäten des Blues, die dabei helfen könnten, solchen Gemütszuständen entgegenzuwirken. Der erfolgreichste Blueskomponist dieser Jahre, W.C. Handy, verdient und erhält ein eigenes Großkapitel. Muir unterteilt sein Wirken in seine Zeit in Memphis (1909-1917) und seine New Yorker Jahre (nach 1917) und untersucht etliche seiner Kompositionen auf ihre Machart, darunter “Yellow Dog Blues”, “Beale Street Blues” und “Saint Louis Blues”. Einige der kreativsten Blueskompositionen, konstatiert Muir, stammten von Komponisten aus den amerikanischen Südstaaten. Als Beispiele führt er Titel an wie “Baby Seals’ Blues”, den “Dallas Blues” oder aber Kompositionen von Euday L. Bowman, George W. Thomas und Perry Bradford. Im abschließenden Kapitel wirft Muir dann noch einen Blick auf Kompositionen, die vor 1912 veröffentlicht wurden und deutliche musikalische oder textliche Beziehungen zum Blues zeigen. Hier wird er dann auch dem Untertitel seines Buchs gerecht und reicht bis 1850 zurück (ein Stück namens “I Have Got the Blues To Day”). Er verfolgt die zwölftaktige Bluesform immerhin bis zurück ins Jahr 1895 (Muir bezieht sich auch hier nur auf Notenveröffentlichungen) und streicht dabei vor allem den Komponisten Hughie Cannon heraus, einen weißen Ragtimepianisten, der heute vor allem noch wegen seines Stücks “Bill Bailey” bekannt ist, daneben aber immerhin dreizehn Stücke schrieb, die Muir zu jenen “Proto-Blues” zählt, Stücke, die vor allem in der formalen und harmonischen Struktur wichtige Einflüsse auf die spätere Bluesmode der Jahre nach 1912 haben sollten. Muir diskutiert das Phänomen der Bluesballade (insbesondere “Frankie and Johnny”) und begründet, warum der Bluesstimmenverlauf, wie wir ihn kennen, und nicht die harmonische Form von “Frankie” sich wohl letzten Endes im populären Blues durchgesetzt haben. Ein Anhang des Buchs listet Stücke, die “Blues” im Titel tragen und zwischen 1912 und 1915 zum Copyright angemeldet wurden. Muirs Buch ist durchsetzt mit musikalischen Beispielen, Auszügen aus den Notenveröffentlichungen, um die sich seine Studie hauptsächlich dreht. Er problematisiert kaum (gerade mal im Vorwort) die performativen Eigenheiten all dieser Kompositionen, die Vereinfachungen ihrer Notenveröffentlichungen, die Ver- und Überarbeitungen, die viele dieser populären Stücke in Arrangements von Bands, Minstrelkünstlern und anderen Musikern erhielten. Sein Buch deckt allerdings recht erschöpfend ein Kapitel ab, das sich manchem als Frage gestellt haben mag, der sich mit dem Repertoire vor 1920 beschäftigt hat und dabei über eine Vielzahl an mit “Blues” betitelten Stücken gestolpert ist, die aber nur bedingt dem entsprechen, was man nach 1920 als Blues versteht. “Long Lost Blues” ist damit also eine überaus spannende und umfassende Aufarbeitung eines wichtigen Teils der Vorgeschichte des Jazz.
Wolfram Knauer (Mai 2010)
Groove – Kultur – Unterricht. Studien zur pädagogischen Erschließung einer musikkulturellen Praktik
von Heinrich Klingmann
Bielefeld 2010 (transcript Verlag)
436 Seiten, 34,80 Euro
ISBN: 978-3-8376-1354-4
 Afroamerikanischer Groove, sagt Heinrich Klingmann in der Einleitung zu seinem Buch, sei ein Phänomen, das nicht nur für rhythmisch-musikalische Praktiken stehe, sondern daneben eine musikalische Gestaltungsweise beschreibe, die inzwischen weltweit rezipiert werde. Sie sei darüber hinaus unterrichtbar und müsse heute auch unterrichtet werden. Sein Buch wolle so einen “Beitrag zur wissenschaftlichen Legitimierung der pädagogischen Arbeit mit dem rhythmischen Aspekt afroamerikanischer Musik leisten”. In einem ersten Kapitel beschreibt er, wie Groove bislang im wissenschaftlichen Diskurs behandelt wurde, stellt unterschiedliche musikologische wie erlebnis- und rezeptionstheoretische Erklärungen oder Annäherungen an das Phänomen Groove vor, geht dabei auch auf musikethnologische Forschungen zur Funktion von Rhythmus bzw. Groove in verschiedenen Kulturen ein. Er erklärt kulturwissenschaftliche Perspektiven, also beispielsweise unterschiedliche Codes, die sich mit musikalischen Parametern verbinden und diskutiert in diesem Zusammenhang ausführlich die Probleme, die die westlich geprägte Hochkultur mit der scheinbaren Unmitttelbarkeit als “primitiv” angesehener Kulturen hatte, also auch mit Rhythmik und Groove (und vor allem: Körperlichkeit) afrikanischer bzw. afroamerikanischer Musik. Der zweite Teil, der etwas mehr als ein Viertel seines Buchs ausmacht, ist dem Thema “Musikpädagogik und Groovemusik” gewidmet. Hier geht es Klingmann darum, ob und wie man Groove an Schulen unterrichten könne. Er stellt kurz dar, wie sich der Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten geändert und geöffnet habe, schildert unterschiedliche musikdidaktische Positionen und die Rolle, die afroamerikanische Rhythmik in ihnen spielt, und überlegt schließlich, wie rhythmisches Bewusstsein in unterschiedliche Lehrkonzepte einzubauen sein könnte, etwa als Einführung in die Musikkulturen, als Möglichkeit persönlicher Authentifizierung und einer Authentifizierung in der Gruppe, oder als Möglichkeit der Ausbildung von Teilkompetenzen (nach dem Motto “Kunst kommt nicht ohne handwerkliches Können aus”). Afroamerikanische Rhythmik, erklärt er resümierend, könne damit erheblich zur musikalischen Bildung beitragen, gerade weil sie praktisch orientiert sei und die Schüler mit einbinde. Klingmanns Buch entstand aus seiner Dissertation (im Fach Musikpädagogik), und so ist das Buch eine entsprechend theoretische Lektüre mit viel Querverweisen und Literaturdiskussion. Dabei aber gelingt es ihm Argumente für den Einsatz rhythmischer Modelle in den Musikunterricht zu stützen und nebenbei auch einen sehr speziellen Blick auf die Bedürfnisse des Musikunterrichts im 21. Jahrhundert zu richten.
Afroamerikanischer Groove, sagt Heinrich Klingmann in der Einleitung zu seinem Buch, sei ein Phänomen, das nicht nur für rhythmisch-musikalische Praktiken stehe, sondern daneben eine musikalische Gestaltungsweise beschreibe, die inzwischen weltweit rezipiert werde. Sie sei darüber hinaus unterrichtbar und müsse heute auch unterrichtet werden. Sein Buch wolle so einen “Beitrag zur wissenschaftlichen Legitimierung der pädagogischen Arbeit mit dem rhythmischen Aspekt afroamerikanischer Musik leisten”. In einem ersten Kapitel beschreibt er, wie Groove bislang im wissenschaftlichen Diskurs behandelt wurde, stellt unterschiedliche musikologische wie erlebnis- und rezeptionstheoretische Erklärungen oder Annäherungen an das Phänomen Groove vor, geht dabei auch auf musikethnologische Forschungen zur Funktion von Rhythmus bzw. Groove in verschiedenen Kulturen ein. Er erklärt kulturwissenschaftliche Perspektiven, also beispielsweise unterschiedliche Codes, die sich mit musikalischen Parametern verbinden und diskutiert in diesem Zusammenhang ausführlich die Probleme, die die westlich geprägte Hochkultur mit der scheinbaren Unmitttelbarkeit als “primitiv” angesehener Kulturen hatte, also auch mit Rhythmik und Groove (und vor allem: Körperlichkeit) afrikanischer bzw. afroamerikanischer Musik. Der zweite Teil, der etwas mehr als ein Viertel seines Buchs ausmacht, ist dem Thema “Musikpädagogik und Groovemusik” gewidmet. Hier geht es Klingmann darum, ob und wie man Groove an Schulen unterrichten könne. Er stellt kurz dar, wie sich der Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten geändert und geöffnet habe, schildert unterschiedliche musikdidaktische Positionen und die Rolle, die afroamerikanische Rhythmik in ihnen spielt, und überlegt schließlich, wie rhythmisches Bewusstsein in unterschiedliche Lehrkonzepte einzubauen sein könnte, etwa als Einführung in die Musikkulturen, als Möglichkeit persönlicher Authentifizierung und einer Authentifizierung in der Gruppe, oder als Möglichkeit der Ausbildung von Teilkompetenzen (nach dem Motto “Kunst kommt nicht ohne handwerkliches Können aus”). Afroamerikanische Rhythmik, erklärt er resümierend, könne damit erheblich zur musikalischen Bildung beitragen, gerade weil sie praktisch orientiert sei und die Schüler mit einbinde. Klingmanns Buch entstand aus seiner Dissertation (im Fach Musikpädagogik), und so ist das Buch eine entsprechend theoretische Lektüre mit viel Querverweisen und Literaturdiskussion. Dabei aber gelingt es ihm Argumente für den Einsatz rhythmischer Modelle in den Musikunterricht zu stützen und nebenbei auch einen sehr speziellen Blick auf die Bedürfnisse des Musikunterrichts im 21. Jahrhundert zu richten.
(Wolfram Knauer)
Der Wind, das Licht. ECM und das Bild
herausgegeben von Lars Müller
Baden/Schweiz 2010 (Lars Müller Publishers)
447 Seiten, 54,90 Euro
ISBN: 978-3-03778-197-5
 Das Label ECM besteht seit 40 Jahren und seit bald 35 Jahren ist es quasi ein Mythos: der Musik wegen, des Sounds wegen und auch der Covergestaltung seiner Alben wegen. Neben Blue Note ist es wohl das einzige Plattenlabel des Jazz, das Forscher zu unterschiedlichsten wissenschaftlichen Arbeiten anregte, mit denen sie versuchten, dem Geheimnis von ECM auf die Spur zu kommen. Lars Müllers neuestes Buch tut dies relativ direkt: Er präsentiert sämtliche Cover, die seit Beginn des Labels erschienen sind, setzt auf den Plattencovern verwendete Originalfotos in Verbindung zu den erschienenen Produkten und erlaubt damit einen Überblick über die Entwicklung des grafischen Konzepts und der Veränderungen über die Jahre. Immer wieder sind es Bilder, die zwischen Fotorealismus und Abstraktion schwanken, die Atmosphärisches heraufbeschwören und bei denen man quasi auf die Musik schließen möchte, auch wenn man die Aufnahmen selbst nicht kennt. “Der Wind, das Licht” — allein der Titel ist sicher Beschreibung genug für viele der Fotos, die weite Landschaft, Natur (und Natürlichkeit) vermitteln. Fünf Essays nähern sich den Bildern auch textlich; Thomas Steinfeld schreibt einen allgemeinen Einführungstext; Katharina Epprecht macht sich Gedanken über “transmediale Sinnbilder”, also über den Eindruck, den die ECM-Coverkunst selbst bei flüchtigem Anblick hervorrufen können; Geoff Andrew reflektiert über den Einfluss des Filmregisseurs Michel Godard auf die Bildästhetik hinter den von Manfred Eicher ausgewählten Bildern; Kjetil Bjornstad beschreibt seine ganz persönliche Reaktion auf die Covergestaltung; und der Herausgeber Lars Müller schließlich macht sich Gedanken über die in den Bildern dargestellten Motive und ihre Wirkung vor und nach der genaueren Betrachtung. Auch die Buchgestaltung orientiert sich am ECM-Design: edel-zurückhaltend, im grauen Einband durchscheinend das aufgewühlte Meer, klare silbern-schwarze Schrift, auf der Vorderumschlag der geprägte Abdruck eines CD-Covers, auf der Rückseite der geprägte Abdruck einer CD. Alles in allem: ein opulentes Werk über das grafische Konzept eines Plattenlabels — und ganz gewiss ein passendes Geschenk für Kunsthistoriker oder ECM-Fans.
Das Label ECM besteht seit 40 Jahren und seit bald 35 Jahren ist es quasi ein Mythos: der Musik wegen, des Sounds wegen und auch der Covergestaltung seiner Alben wegen. Neben Blue Note ist es wohl das einzige Plattenlabel des Jazz, das Forscher zu unterschiedlichsten wissenschaftlichen Arbeiten anregte, mit denen sie versuchten, dem Geheimnis von ECM auf die Spur zu kommen. Lars Müllers neuestes Buch tut dies relativ direkt: Er präsentiert sämtliche Cover, die seit Beginn des Labels erschienen sind, setzt auf den Plattencovern verwendete Originalfotos in Verbindung zu den erschienenen Produkten und erlaubt damit einen Überblick über die Entwicklung des grafischen Konzepts und der Veränderungen über die Jahre. Immer wieder sind es Bilder, die zwischen Fotorealismus und Abstraktion schwanken, die Atmosphärisches heraufbeschwören und bei denen man quasi auf die Musik schließen möchte, auch wenn man die Aufnahmen selbst nicht kennt. “Der Wind, das Licht” — allein der Titel ist sicher Beschreibung genug für viele der Fotos, die weite Landschaft, Natur (und Natürlichkeit) vermitteln. Fünf Essays nähern sich den Bildern auch textlich; Thomas Steinfeld schreibt einen allgemeinen Einführungstext; Katharina Epprecht macht sich Gedanken über “transmediale Sinnbilder”, also über den Eindruck, den die ECM-Coverkunst selbst bei flüchtigem Anblick hervorrufen können; Geoff Andrew reflektiert über den Einfluss des Filmregisseurs Michel Godard auf die Bildästhetik hinter den von Manfred Eicher ausgewählten Bildern; Kjetil Bjornstad beschreibt seine ganz persönliche Reaktion auf die Covergestaltung; und der Herausgeber Lars Müller schließlich macht sich Gedanken über die in den Bildern dargestellten Motive und ihre Wirkung vor und nach der genaueren Betrachtung. Auch die Buchgestaltung orientiert sich am ECM-Design: edel-zurückhaltend, im grauen Einband durchscheinend das aufgewühlte Meer, klare silbern-schwarze Schrift, auf der Vorderumschlag der geprägte Abdruck eines CD-Covers, auf der Rückseite der geprägte Abdruck einer CD. Alles in allem: ein opulentes Werk über das grafische Konzept eines Plattenlabels — und ganz gewiss ein passendes Geschenk für Kunsthistoriker oder ECM-Fans.
(Wolfram Knauer, April 2010)
What a Wonderful World. Als Louis Armstrong durch den Osten tourte
von Stephan Schulz
Berlin 2010 (Neues Leben)
255 Seiten, 14,95 Euro
ISBN: 978-3-355-01772-5
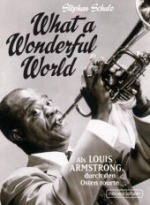 Louis Armstrong kam im März 1965 zu 17 Konzerten in der DDR, eine Sensation mitten im Kalten Krieg. Der Journalist Stephan Schulz recherchierte die Geschichte eigentlich für eine Rundfunkreportage, stieß dabei aber auf so viele interessante Dokumente und enthusiastische Zeitzeugen, dass aus seinen Recherchen ein opulentes Buch wurde, das, reich bebildert, jetzt im Verlag Neues Leben erschien. Schulz ordnet Armstrongs Tournee in die Lebenswirklichkeit in der DDR der 1960er Jahre ein, kontrastiert Begeisterung, Wünsche, Ängste, Hoffnungen, Befürchtungen, Argwohn und wieder Begeisterung — alles Emotionen, die zu spüren sind im Umgang der Behörden mit der ungewöhnlichen Tournee, im Enthusiasmus der Fans, den Überstar des Jazz persönlich erleben zu dürfen, in den augenzwinkernden Reaktionen Satchmos selbst auf die Lebenswirklichkeit im real existierenden Sozialismus. Schulz befragte viele Fans, die dabei waren bei den Konzerten in Berlin, Leipzig, Magdeburg, Erfurt und Schwerin. In Berlin gaben die All Stars sechs Konzerte, die innerhalb eines Tages ausverkauft waren – 18.000 Tickets an einem Tag! Schulz fragt, inwieweit Armstrongs Konzerte das Regime stützen sollten und inwieweit sie dazu beitrugen, den Jazz in DDR stärker hoffähig zu machen als zuvor, wo er oft noch als “Affenmusik des Imperialismus” abgetan wurde. Er recherchiert, wie es überhaupt zu der Tournee kam, spricht mit Roland Trisch, der einst in der Künstleragentur der DDR gearbeitet hatte, und mit dem Jazzexperten Karlheinz Drechsel, der Armstrong auf der Tournee begleitete und die Konzerte ansagte, geht ins Bundesarchiv, in dem die Akten der Künstleragentur lagern. Der Schweizer Zwischenagent habe als Honorar ein Observatorium der Firma Carl Zeiss Jena gefordert, hieß es, oder aber er habe alte Waffen aus dem Dreißigjährigen Krieg erhalten. Schulz spricht mit dem damaligen Kulturminister der DDR, und er tut jenen Schweizer Agenten auf, der ihm einen Rückruf zusichert, dann aber wenige Tage nach dem Telefonat verstirbt. Schulz beschreibt die Ankunft der All Stars auf dem Flughafen Berlin-Schöneberg, auf dem die Jazz-Optimisten den Trompeter musikalisch mit seiner Erkennungsmelodie begrüßten und er sofort mit einstimmt. Er schreibt über die Pressekonferenz, in der Armstrong klar macht, dass es ihm bei seiner Tournee vor allem um Musik geht, darum, sein Publikum zu erfreuen, und nicht um Politik. Schulz liest die internationalen Presseberichte über die Konzerte, beschreibt die Atmosphäre bei und nach den Konzerten, begleitet den Trompeter nach Leipzig, wo Armstrong eine Zahnkrone abhanden kam und er einen Zahnarzt aufsuchen musste. Schulz spricht mit der Ehefrau des damaligen Zahnarztes. Ein kurzes Kapitel befasst sich mit der Überwachung des Konzertpublikums durch die Stasi. Er berichtet davon, wie Satchmo bei seiner Reise seine Liebe für Eisbein entdeckt habe. Auf dem Weg von Berlin nach Magdeburg wurde der Bandbus von der sowjetischen Armee gestoppt, die Truppenübungen machte, mit denen sie auf die am nächsten Tag stattfindende Sitzung des Deutschen Bundestags in Westberlin reagierte, aus DDR-Sicht eine Provokation und ein Verstoß gegen den Status der Stadt. Bei derselben Fahrt war plötzlich der Kühler des Busses defekt, und die Musiker mussten in der Kleinstadt Genthin eine Zwangspause einlegen, wo er sofort von Menschen umringt war, die ihn um Autogramme baten. Ähnliche Geschichten gibt es auch von anderswo, und Schulzes Buch ist voll von ihnen, voll von Zeugnissen dafür, wie menschennah, wie wenig “Star” Armstrong zeitlebens war. Er erzählt die Geschichte hinter einer seltsamen Blumensamenwerbung, für die Armstrong Modell stand. Und im mecklenburgischen Barth setzte ein Reporter Armstrong den Floh ins Ohr, Bix Beiderbecke (dessen Vorfahren aus Westfalen kommen) würde angeblich von hier stammen, was Satchmo noch zuhause brav weiter ausspann. Zum Schluss entdeckt Schulz die Abrechnung der Künstleragentur und stellt fest, dass Armstrong mit 15.745,66 Mark im Jahr 1965 nach dem Bolschoi-Theater das meiste Geld in die Kassen der Künstleragentur gespielt hatte. Schulzes Buch ist voller seltener Fotos aus den Privatalben von Fans genauso wie aus dem Archiv von Pressefotografen, zeigt Ausrisse aus Zeitungen genauso wie Anzeigen oder Plakate oder auch Fotos, die vordergründig überhaupt nichts mit Armstrong zu tun haben, aber mit der Unterschrift versehen sind “In dieser Kneipe in Parchen soll Louis Armstrong um Kühlwasser für sein Wasser gebeten haben”. Ein unterhaltsames und zugleich informatives Buch, das einen sehr fokussierten Einblick in den Arbeitsalltags des Trompeters Louis Armstrong und zugleich Einblicke in das Leben in der DDR und die unterschiedlichen Möglichkeiten des Umgehens staatlicher Hindernissen vermittelt.
Louis Armstrong kam im März 1965 zu 17 Konzerten in der DDR, eine Sensation mitten im Kalten Krieg. Der Journalist Stephan Schulz recherchierte die Geschichte eigentlich für eine Rundfunkreportage, stieß dabei aber auf so viele interessante Dokumente und enthusiastische Zeitzeugen, dass aus seinen Recherchen ein opulentes Buch wurde, das, reich bebildert, jetzt im Verlag Neues Leben erschien. Schulz ordnet Armstrongs Tournee in die Lebenswirklichkeit in der DDR der 1960er Jahre ein, kontrastiert Begeisterung, Wünsche, Ängste, Hoffnungen, Befürchtungen, Argwohn und wieder Begeisterung — alles Emotionen, die zu spüren sind im Umgang der Behörden mit der ungewöhnlichen Tournee, im Enthusiasmus der Fans, den Überstar des Jazz persönlich erleben zu dürfen, in den augenzwinkernden Reaktionen Satchmos selbst auf die Lebenswirklichkeit im real existierenden Sozialismus. Schulz befragte viele Fans, die dabei waren bei den Konzerten in Berlin, Leipzig, Magdeburg, Erfurt und Schwerin. In Berlin gaben die All Stars sechs Konzerte, die innerhalb eines Tages ausverkauft waren – 18.000 Tickets an einem Tag! Schulz fragt, inwieweit Armstrongs Konzerte das Regime stützen sollten und inwieweit sie dazu beitrugen, den Jazz in DDR stärker hoffähig zu machen als zuvor, wo er oft noch als “Affenmusik des Imperialismus” abgetan wurde. Er recherchiert, wie es überhaupt zu der Tournee kam, spricht mit Roland Trisch, der einst in der Künstleragentur der DDR gearbeitet hatte, und mit dem Jazzexperten Karlheinz Drechsel, der Armstrong auf der Tournee begleitete und die Konzerte ansagte, geht ins Bundesarchiv, in dem die Akten der Künstleragentur lagern. Der Schweizer Zwischenagent habe als Honorar ein Observatorium der Firma Carl Zeiss Jena gefordert, hieß es, oder aber er habe alte Waffen aus dem Dreißigjährigen Krieg erhalten. Schulz spricht mit dem damaligen Kulturminister der DDR, und er tut jenen Schweizer Agenten auf, der ihm einen Rückruf zusichert, dann aber wenige Tage nach dem Telefonat verstirbt. Schulz beschreibt die Ankunft der All Stars auf dem Flughafen Berlin-Schöneberg, auf dem die Jazz-Optimisten den Trompeter musikalisch mit seiner Erkennungsmelodie begrüßten und er sofort mit einstimmt. Er schreibt über die Pressekonferenz, in der Armstrong klar macht, dass es ihm bei seiner Tournee vor allem um Musik geht, darum, sein Publikum zu erfreuen, und nicht um Politik. Schulz liest die internationalen Presseberichte über die Konzerte, beschreibt die Atmosphäre bei und nach den Konzerten, begleitet den Trompeter nach Leipzig, wo Armstrong eine Zahnkrone abhanden kam und er einen Zahnarzt aufsuchen musste. Schulz spricht mit der Ehefrau des damaligen Zahnarztes. Ein kurzes Kapitel befasst sich mit der Überwachung des Konzertpublikums durch die Stasi. Er berichtet davon, wie Satchmo bei seiner Reise seine Liebe für Eisbein entdeckt habe. Auf dem Weg von Berlin nach Magdeburg wurde der Bandbus von der sowjetischen Armee gestoppt, die Truppenübungen machte, mit denen sie auf die am nächsten Tag stattfindende Sitzung des Deutschen Bundestags in Westberlin reagierte, aus DDR-Sicht eine Provokation und ein Verstoß gegen den Status der Stadt. Bei derselben Fahrt war plötzlich der Kühler des Busses defekt, und die Musiker mussten in der Kleinstadt Genthin eine Zwangspause einlegen, wo er sofort von Menschen umringt war, die ihn um Autogramme baten. Ähnliche Geschichten gibt es auch von anderswo, und Schulzes Buch ist voll von ihnen, voll von Zeugnissen dafür, wie menschennah, wie wenig “Star” Armstrong zeitlebens war. Er erzählt die Geschichte hinter einer seltsamen Blumensamenwerbung, für die Armstrong Modell stand. Und im mecklenburgischen Barth setzte ein Reporter Armstrong den Floh ins Ohr, Bix Beiderbecke (dessen Vorfahren aus Westfalen kommen) würde angeblich von hier stammen, was Satchmo noch zuhause brav weiter ausspann. Zum Schluss entdeckt Schulz die Abrechnung der Künstleragentur und stellt fest, dass Armstrong mit 15.745,66 Mark im Jahr 1965 nach dem Bolschoi-Theater das meiste Geld in die Kassen der Künstleragentur gespielt hatte. Schulzes Buch ist voller seltener Fotos aus den Privatalben von Fans genauso wie aus dem Archiv von Pressefotografen, zeigt Ausrisse aus Zeitungen genauso wie Anzeigen oder Plakate oder auch Fotos, die vordergründig überhaupt nichts mit Armstrong zu tun haben, aber mit der Unterschrift versehen sind “In dieser Kneipe in Parchen soll Louis Armstrong um Kühlwasser für sein Wasser gebeten haben”. Ein unterhaltsames und zugleich informatives Buch, das einen sehr fokussierten Einblick in den Arbeitsalltags des Trompeters Louis Armstrong und zugleich Einblicke in das Leben in der DDR und die unterschiedlichen Möglichkeiten des Umgehens staatlicher Hindernissen vermittelt.
(Wolfram Knauer, März 2010)
Ornette Coleman. Klang der Freiheit. Interviews
von Christian Broecking
Berlin 2010 (Broecking Verlag)
123 Seiten, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-938763-13-1
 Christian Broecking unterhält sich in seinem neuen Buch mit Ornette Coleman über dessen ganz persönliche Sicht auf Musik und Gesellschaft. Coleman ist weit weniger Zorniger Schwarzer Mann als andere Kollegen seiner Generation. Er kommt zwar aus Armut und wuchs in einer rassistischen gesellschaft auf, doch sieht er seine Musik kaum durch dieses Spannungsfeld beeinflusst, sieht im Gegenteil in seiner Musik vor allem etwas Anti-Segregationistisches. In zwei Interviews spricht er über seinen Sohn, über Armut, Glück und Liebe, über Improvisation und darüber, wie man mit Musik die Welt verändern kann. Broecking unterhält sich außerdem mit zwei Weggefährten Colemans: Don Cherry und Charlie Haden. Cherry erzählt ihm über den Unterschied der Generationen im Jazz, über seine erste Taschentrompete, über Steve Lacy, der sein erster Lehrer war, über seine Zeit in Schweden und darüber, warum er anders als etliche seiner Kollegen nicht verbittert sei. Er berichtet von Ansatzschwierigkeiten, seitdem er ein künstliches Gebiss hat, über die Rolle der großen Schwarzen Musiker als Propheten, nicht role models, und natürlich über den Schock, den Ornette Colemans Musik anfangs bei den Leuten auslöste. Charlie Haden erzählt in vier Interviews über sein Quartet West und seine politischen Ambitionen, über das Liberation Music Orchestra, konservativen und progressiven Sound im Jazz. Er berichtet über seine Aufnahmen mit John Coltrane, über seine Reaktion auf den Hurricane Katrina in New Orleans, über die Musikindustrie, Country Music und darüber, welche Rolle Ornette Colemans Musik in seinem Leben spielte. In einem abschließenden Kapitel sammelt Broecking schließlich Äußerungen unterschiedlichster Wegbegleiter Colemans über den Saxophonisten, Trompeter, Geiger und Komponisten. Zu Worte kommen Pat Metheny, Bruce Lundvall, Jason Moran, Greg Osby, Geri Allen, Joshua Redman, Dewey Redman, Michael Cuscuna, Walter Norris, Vijay Iyer, Terence Blanchard, Dave Holland, David Sanborn, Hank Jones, Curtis Fuller, Philip Glass, Manfred Eicher, Barre Philips, Evan Parker, David Murray, Butch Morris, Anthony Braxton, George Lewis und Henry Threagill. “Klang der Freiheit” ist ein kleines Büchlein über Ornette Coleman, durchsetzt mit Fotos, die Broecking bei Konzerten oder im New Yorker Loft des Saxophonisten aufgenommen hat, und gibt in der Sammlung der Geschichten und Biographien, die sich immer wieder kreuzten, einen wunderbaren Einblick in die musikalische Ästhetik Ornette Colemans und die Umgebung, in der diese sich entwickelte.
Christian Broecking unterhält sich in seinem neuen Buch mit Ornette Coleman über dessen ganz persönliche Sicht auf Musik und Gesellschaft. Coleman ist weit weniger Zorniger Schwarzer Mann als andere Kollegen seiner Generation. Er kommt zwar aus Armut und wuchs in einer rassistischen gesellschaft auf, doch sieht er seine Musik kaum durch dieses Spannungsfeld beeinflusst, sieht im Gegenteil in seiner Musik vor allem etwas Anti-Segregationistisches. In zwei Interviews spricht er über seinen Sohn, über Armut, Glück und Liebe, über Improvisation und darüber, wie man mit Musik die Welt verändern kann. Broecking unterhält sich außerdem mit zwei Weggefährten Colemans: Don Cherry und Charlie Haden. Cherry erzählt ihm über den Unterschied der Generationen im Jazz, über seine erste Taschentrompete, über Steve Lacy, der sein erster Lehrer war, über seine Zeit in Schweden und darüber, warum er anders als etliche seiner Kollegen nicht verbittert sei. Er berichtet von Ansatzschwierigkeiten, seitdem er ein künstliches Gebiss hat, über die Rolle der großen Schwarzen Musiker als Propheten, nicht role models, und natürlich über den Schock, den Ornette Colemans Musik anfangs bei den Leuten auslöste. Charlie Haden erzählt in vier Interviews über sein Quartet West und seine politischen Ambitionen, über das Liberation Music Orchestra, konservativen und progressiven Sound im Jazz. Er berichtet über seine Aufnahmen mit John Coltrane, über seine Reaktion auf den Hurricane Katrina in New Orleans, über die Musikindustrie, Country Music und darüber, welche Rolle Ornette Colemans Musik in seinem Leben spielte. In einem abschließenden Kapitel sammelt Broecking schließlich Äußerungen unterschiedlichster Wegbegleiter Colemans über den Saxophonisten, Trompeter, Geiger und Komponisten. Zu Worte kommen Pat Metheny, Bruce Lundvall, Jason Moran, Greg Osby, Geri Allen, Joshua Redman, Dewey Redman, Michael Cuscuna, Walter Norris, Vijay Iyer, Terence Blanchard, Dave Holland, David Sanborn, Hank Jones, Curtis Fuller, Philip Glass, Manfred Eicher, Barre Philips, Evan Parker, David Murray, Butch Morris, Anthony Braxton, George Lewis und Henry Threagill. “Klang der Freiheit” ist ein kleines Büchlein über Ornette Coleman, durchsetzt mit Fotos, die Broecking bei Konzerten oder im New Yorker Loft des Saxophonisten aufgenommen hat, und gibt in der Sammlung der Geschichten und Biographien, die sich immer wieder kreuzten, einen wunderbaren Einblick in die musikalische Ästhetik Ornette Colemans und die Umgebung, in der diese sich entwickelte.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
The Music of Django Reinhardt
von Benjamin Givan
Ann Arbor 2010 (University of Michigan Press)
242 Seiten; 29,95 US-$
ISBN: 978-0-472-03408-6
 2010 wird überall in der Jazzwelt der 100. Geburtstag Django Reinhardts gefeiert, und neben unzähligen Geburtstags-Homages als Konzert oder auf CD legt die University of Michigan Press eine musikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Gitarristen vor, die auf der Dissertation basiert, die Benjamin Givan bereits 2003 an der Yale University eingereicht hatte. Givans Buch ist keine Biographie — davon gibt es inzwischen genügend –, sondern eine Auseinandersetzung mit der Technik des Gitarristen, der sich bei einem Feuer in seinem Wohnwagen 1928 die linke Hand so schwer verletzte, dass er deren Mittel- und Ringfinger nicht weiter benutzen konnte. Gleich im ersten Kapitel spekuliert Givan, welche Verletzungen das Feuer wohl konkret angerichtet haben könnten und welche Auswirkungen die Verletzungen auf Reinhardts Gitarrenspiel hatte. Givan analysiert mögliche Grifftechniken einzelner Titel und findet heraus, dass Reinhardt seinen Mittelfinger offenbar durchaus noch gezielt einsetzen konnte und dass er sein Handicap durch andere Griffmethoden wettmachte, etwa den Einsatz des Daumens für Bassnoten. Im zweiten Kapitel beschäftigt sich Givan mit der Beobachtung, dass, wo in anderen Werken auch aus dem Jazzkontext der einheitliche dynamische Bogen besonders wertgeschätzt wird, bei Reinhardt ein Moment laufender Diskontinuität eine wichtige Rolle spielt. Er untersucht dafür verschiedene Aufnahmen auf das Phänomen abrupter Brüche, die durch harmonische, rhythmische, melodische oder formale Entscheidungen des Gitarristen ausgelöst werden. Givan lässt bei aller analytischen Diskussion allerdings ein wenig die Tatsache außer Acht, dass “discontinuity” nicht wirklich der Gegensatz zu “unity” ist, dass Beschreibungen wie “Geschlossenheit”, “dramaturgischer Bogen” etc. durchaus mit der Idee musikalischer Brüche als stilistisches Werkzeug kompatibel sind. Im dritten Kapitel wendet Givan das Beispiel der Thomas Owens’schen Analyse von Improvisationsformeln im Spiel Charlie Parkers auf die Musik Reinhardts an, sucht also nach melodischen Formeln, die sich an bestimmten Stellen, etwa bei speziellen Harmoniewechseln, immer wieder finden. Im vierten Kapitel analysiert er drei “klassische” Soli Reinhardts: “I’ll See You In My Dreams”, “Love’s Melody” und “Embraceable You” — wie sonstwo im Buch einschließlich ausführlicher Solotranskriptionen. Givans fünftes Kapitel betrachtet spätere stilistische Änderungen im Gitarrenspiel Djangos, also den Einfluss des Bebop oder den Wechsel zur elektrisch verstärkten Gitarre. Biographische Notizen sind in Givans Buch auf ein Minimum beschränkt, auch Anmerkungen auf Einflüsse etwa anderer Gitarristen oder eine Diskussion der Musik der Manouche. Er schreibt eine analytische musikwissenschaftliche Studie, die für den “einfachen” Fan eher schwere Lektüre sein dürfte. Givan vermag dabei aus der Musik selbst heraus den Blick auf bestimmte Aspekte der Technik des Gitarristen zu lenken und dabei mit Hilfe der musikalischen Analyse die Kunst Django Reinhardts ein wenig näher zu erklären.
2010 wird überall in der Jazzwelt der 100. Geburtstag Django Reinhardts gefeiert, und neben unzähligen Geburtstags-Homages als Konzert oder auf CD legt die University of Michigan Press eine musikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Gitarristen vor, die auf der Dissertation basiert, die Benjamin Givan bereits 2003 an der Yale University eingereicht hatte. Givans Buch ist keine Biographie — davon gibt es inzwischen genügend –, sondern eine Auseinandersetzung mit der Technik des Gitarristen, der sich bei einem Feuer in seinem Wohnwagen 1928 die linke Hand so schwer verletzte, dass er deren Mittel- und Ringfinger nicht weiter benutzen konnte. Gleich im ersten Kapitel spekuliert Givan, welche Verletzungen das Feuer wohl konkret angerichtet haben könnten und welche Auswirkungen die Verletzungen auf Reinhardts Gitarrenspiel hatte. Givan analysiert mögliche Grifftechniken einzelner Titel und findet heraus, dass Reinhardt seinen Mittelfinger offenbar durchaus noch gezielt einsetzen konnte und dass er sein Handicap durch andere Griffmethoden wettmachte, etwa den Einsatz des Daumens für Bassnoten. Im zweiten Kapitel beschäftigt sich Givan mit der Beobachtung, dass, wo in anderen Werken auch aus dem Jazzkontext der einheitliche dynamische Bogen besonders wertgeschätzt wird, bei Reinhardt ein Moment laufender Diskontinuität eine wichtige Rolle spielt. Er untersucht dafür verschiedene Aufnahmen auf das Phänomen abrupter Brüche, die durch harmonische, rhythmische, melodische oder formale Entscheidungen des Gitarristen ausgelöst werden. Givan lässt bei aller analytischen Diskussion allerdings ein wenig die Tatsache außer Acht, dass “discontinuity” nicht wirklich der Gegensatz zu “unity” ist, dass Beschreibungen wie “Geschlossenheit”, “dramaturgischer Bogen” etc. durchaus mit der Idee musikalischer Brüche als stilistisches Werkzeug kompatibel sind. Im dritten Kapitel wendet Givan das Beispiel der Thomas Owens’schen Analyse von Improvisationsformeln im Spiel Charlie Parkers auf die Musik Reinhardts an, sucht also nach melodischen Formeln, die sich an bestimmten Stellen, etwa bei speziellen Harmoniewechseln, immer wieder finden. Im vierten Kapitel analysiert er drei “klassische” Soli Reinhardts: “I’ll See You In My Dreams”, “Love’s Melody” und “Embraceable You” — wie sonstwo im Buch einschließlich ausführlicher Solotranskriptionen. Givans fünftes Kapitel betrachtet spätere stilistische Änderungen im Gitarrenspiel Djangos, also den Einfluss des Bebop oder den Wechsel zur elektrisch verstärkten Gitarre. Biographische Notizen sind in Givans Buch auf ein Minimum beschränkt, auch Anmerkungen auf Einflüsse etwa anderer Gitarristen oder eine Diskussion der Musik der Manouche. Er schreibt eine analytische musikwissenschaftliche Studie, die für den “einfachen” Fan eher schwere Lektüre sein dürfte. Givan vermag dabei aus der Musik selbst heraus den Blick auf bestimmte Aspekte der Technik des Gitarristen zu lenken und dabei mit Hilfe der musikalischen Analyse die Kunst Django Reinhardts ein wenig näher zu erklären.
(Wolfram Knauer 2010)
[:en]Louis Armstrong
von Wolfram Knauer
Stuttgart 2010 (Reclam Verlag / Universal Bibliothek)
216 Seiten, 5,80 Euro
ISBN: 978-3-15-018717-3
 Hier mal keine Kritik sondern einfach ein Hinweis auf eine neue Reihe der legendären Reclam-Universal-Bibliothek, die sich einigen der großen Jazzmusiker widmet. Der erste Band dieser Reihe beschäftigt sich mit Leben und Werk Louis Armstrongs und versucht, seiner Biographie anhand seiner Musik näherzukommen. Der Autor ist “Yours Truly”, daher sei mit pseudo-kritischem Lob gespart und stattdessen einfach ein Statement desselben abgedruckt:
Hier mal keine Kritik sondern einfach ein Hinweis auf eine neue Reihe der legendären Reclam-Universal-Bibliothek, die sich einigen der großen Jazzmusiker widmet. Der erste Band dieser Reihe beschäftigt sich mit Leben und Werk Louis Armstrongs und versucht, seiner Biographie anhand seiner Musik näherzukommen. Der Autor ist “Yours Truly”, daher sei mit pseudo-kritischem Lob gespart und stattdessen einfach ein Statement desselben abgedruckt:
“Vor einigen Jahren veröffentlichte der Reclam-Verlag seine Reihe ‘Jazz-Klassiker’, herausgegeben von Peter Niklas Wilson, der die dafür verpflichteten Autoren bat, die Biographien der ihnen zugewiesenen Musiker entlang ihrer Musik zu beschreiben, allgemein verständlich und doch immer wieder mit den offenen Ohren des kritisch Zuhörenden. Ich durfte für die ‘Jazz-Klassiker’ einige Kapitel schreiben, vor allem über Musiker aus der frühen Zeitspanne der Jazzgeschichte. Vor zweieinhalb Jahren dann fragte der Reclam-Verlag an, ob ich nicht aus meinem Armstrong-Kapitel ein Buch für die neue Jazz-Biographien-Reihe des Verlags machen könnte. Die Anfrage kam etwa zeitgleich zu meiner Berufung auf die Louis Armstrong-Professur an der Columbia University in New York, eine Gastprofessorenstelle, die ich im Frühjahr 2008 innehatte und die aus dem Nachlass des Trompeters finanziert wurde. Wenn auch meine Professur außer dem Titel nichts mit Armstrong zu tun hatte (ich unterrichtete über ‘Jazz in Europe / European Jazz’), so sah ich in der Anfrage des Reclam-Verlags doch auch eine Chance, mich ganz persönlich zu bedanken für die große Ehre, und mich einmal mehr und noch intensiver in die Musik des Trompeters und Sängers einzuhören.
Das resultierende Buch soll damit nicht einfach nur ‘eine weitere Biographie’ Armstrongs sein, sondern sein Leben entlang seiner Musik nachzeichnen, denn wie in aller Kunst ist auch im Jazz das eine ohne das andere nicht vorstellbar: Die Lebensumstände bestimmen, wo es langgeht in der Musik, und die Musik erlaubt oft genug einen tiefen Einvlick in die Persönlichkeit des Musikers. In meiner Biographie Armstrongs versuche ich solche Bezugslinien aufzuzeigen, höre genau hin und versuche durch die erklingenden Töne hinter all das zu kommen, was man über den Trompeter weiß. Ich zeichne dabei das Bild eines bescheidenen Virtuosen, eines politik-bewussten Entertainers, eines volksnahen Stars, dem es selbst in den kitschigsten seiner Aufnahmen gelang, die Würde der musikalischen Eigenständigkeit zu bewahren. Ich erzähle sein Leben entlang der Geschichte des 20sten Jahrhunderts genauso wie entlang der Jazzgeschichte, beschreibe den Mythos, der ihn umgab, und vor allem seine improvisatorische Meisterschaft, die vor allem anderen stand und ihm und seiner Musik überall auf der Welt Freunde einbrachte.
Louis Armstrong ist so alt wie der Jazz. Geboren am 4. August irgendwann um 1900, war und blieb er bis heute das Markenzeichen der großen klassischen afroamerikanischen Musik, ein Mythos, den auch Uneingeweihte kennen und respektieren (‘What a Wonderful World’…). Ein Mensch, dessen Lebensgeschichte die Emanzipation der schwarzen Amerikaner verkörperte, dessen trompetenspiel die improvisierende Phantasie in die Musik zurückbrachte, dessen Ton und Swing im kulturellen Gedächtnis der Welt aufbewahrtliegt.”
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Unternehmerisches Kulturengagement am Beispiel der Musikförderung der Škoda Auto Deutschland GmbH
von Uwe Wagner
Leipzig 2013 (Leipziger Universitätsverlag)
138 Seiten, 28,00 Euro
ISBN: 978-3-86583-407-2
 Sponsoring wird zu einem immer wichtigeren Standbein kultureller Aktivitäten. Der Jazz hat es dabei scheinbar schwer, ist seine Hörerschaft doch weit individualistischer, weniger gruppenkonform zu klassifizieren als die anderer Genres. Er konkurriert zudem mit breiter verankerten Musikrichtungen und nicht zuletzt mit dem Sport um die Gunst der Sponsoren. Uwe Wagner will in seiner Studie die Grundlagen kulturellen Sponsorings genauso wie die Motivation für Unternehmen ergründen, sich im Kultursektor zu engagieren. In einem Fallbeispiel fragt dabei insbesondere nach der Attraktivität des Jazz für unternehmerische Kulturförderung.
Sponsoring wird zu einem immer wichtigeren Standbein kultureller Aktivitäten. Der Jazz hat es dabei scheinbar schwer, ist seine Hörerschaft doch weit individualistischer, weniger gruppenkonform zu klassifizieren als die anderer Genres. Er konkurriert zudem mit breiter verankerten Musikrichtungen und nicht zuletzt mit dem Sport um die Gunst der Sponsoren. Uwe Wagner will in seiner Studie die Grundlagen kulturellen Sponsorings genauso wie die Motivation für Unternehmen ergründen, sich im Kultursektor zu engagieren. In einem Fallbeispiel fragt dabei insbesondere nach der Attraktivität des Jazz für unternehmerische Kulturförderung.
In seinem begriffsklärenden Eingangskapitel unterscheidet Wagner zwischen Kultursponsoring, Mäzenatentum und Spendenwesen und stellt das Konzept der Corporate Cultural Responsibility vor. Er fragt nach Gründen, die Unternehmen haben könnten, sich in Kulturprojekte einzubringen, Gründe, die genauso markt- und markenbezogen sein können wie gesellschaftsbezogen oder auch ganz persönlich. Er nennt Beispiele für gelungene Sponsoringaktivitäten, bei denen sich eine Affinität zwischen Sponsor und unterstütztem Projekt findet.
Für die Musik gliedert er die Förderbereiche vor allem nach Kategorien der Professionalität, also Spitzenstars, “Leistungsebene” der Professionals sowie breite Basis der Laienmusik. Er nennt Beispiele musikalischen Sponsorings aus den Bereichen Klassik, Jazz und Pop und fragt bei all diesen Beispielen nach den möglichen Beweggründen. Er stellt verschiedene Modelle vor, die von der Förderung von Nachwuchskünstlern über Sachmittel bis hin zu eigener Veranstaltungstätigkeit reichen. Wichtig für eine beide Seite zufrieden stellende Kooperation sei die Einigkeit über die angezielte und die tatsächliche Zielgruppe. In einem Unterkapitel beschreibt Wagner dabei auch die Risiken unternehmerischer Förderung, die sowohl im Glaubwürdigkeitsverlust stecken, wenn nämlich Förderer und gefördertes Projekt nicht zusammenpassen, als auch in der ungewollten Substitution öffentlicher Mittel.
Den praktischen Teil seiner Arbeit widmet Wagner dann der Kulturförderung der Škoda Auto Deutschland GmbH. Er beschreibt die Förderkriterien des Konzerns, die bisherigen Förderbereiche und die unternehmerischen Erwartungen an eine Förderung im Kultursektor. Er beschreibt Škodas Aktivitäten im Jazzbereich und den Versuch einer internen Verankerung des kulturellen Engagements, also einer Identifikation auch der Mitarbeiter mit den geförderten Jazzprojekten. Einen Fokus legt er auf den Škoda-Jazzpreis als ein Best-Practice-Beispiel.
Recht nüchtern liest sich der Abgleich möglicher unternehmenspolitischer Ziele, wie er sie anfangs in seinem Buch diskutierte, mit der konkreten Jazzförderung durch Škoda. Insgesamt, stellt Wagner fest, nähme das Kultursponsoring in den letzten Jahren im Vergleich zur Förderung anderer Bereiche eher ab. Grundlage jeder kulturellen Partnerschaft in diesem Bereich, resümiert er, sei ein hohes Maß an Engagement von beiden Partnern.
Wagners Buch ist kein Leitfaden für Kultursponsoring, aber in seiner allgemeinen Analyse und anhand des von ihm gewählten Fallbeispiels ein wichtiges Buch, anhand dessen sich die Chancen genauso wie die Probleme einer Kulturpartnerschaft ablesen lassen. Die wissenschaftliche Herangehensweise erlaubt eine nüchterne Analyse der gegenseitigen Erwartungen und damit vielleicht tatsächlich eine Partnerschaft, die mehr ist als “Geldgeber hier, Künstler dort”.
Wolfram Knauer (Oktober 2013)
Stan Kenton. This Is an Orchestra!
von Michael Sparke
Denton/TX 2010 (University of North Texas Press)
345 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-57441-284-0
 Stan Kenton war sicher einer der umstritteneren Pianisten und Bandleadern der Jazzgeschichte. Sein Orchester gehörte zu den erfolgreichsten Bands der 1940er und 1950er Jahre; Kenton selbst ermutigte Arrangeure, avancierte Kompositionen zu realisieren, und half dadurch dabei mit, dem Jazz den Weg vom Ball- in den Konzertsaal zu ebnen. Nicht zuletzt beschäftigte er einige der einflussreichsten jungen Musiker, die aus der Arbeit in seiner Band heraus ihren Weg gingen.
Stan Kenton war sicher einer der umstritteneren Pianisten und Bandleadern der Jazzgeschichte. Sein Orchester gehörte zu den erfolgreichsten Bands der 1940er und 1950er Jahre; Kenton selbst ermutigte Arrangeure, avancierte Kompositionen zu realisieren, und half dadurch dabei mit, dem Jazz den Weg vom Ball- in den Konzertsaal zu ebnen. Nicht zuletzt beschäftigte er einige der einflussreichsten jungen Musiker, die aus der Arbeit in seiner Band heraus ihren Weg gingen.
Michael Sparke erzählt in diesem Buch die Geschichte Kentons von seiner Geburt wahrscheinlich im Februar 1912 (die Geburt wurde von der Familie vordatiert, um sie ehelich zu machen) bis zu seinem Tod im Jahre 1979. Der private Kenton bleibt dabei eher außen vor; denn Sparke geht es um den Bandleader. Sparke lässt die musikalische Karriere Kentons chronologisch Revue passieren. Sein erstes Kapitel beginnt gleich mit dem Engagement der Band im Renaissance Ballroom im kalifornischen Balboa im Jahr 1941. Weiter geht’s von Hollywood nach New York und durch die Jahre als Swing- und Tanzorchester. Wir lesen über die Arrangements von Pete Rugolo, über das Artistry of Rhythm-Orchestra, über die Vermarktung des “progressive jazz” und über Kentons riesige Erfolge im Europa der 1950er Jahre. Wir erfahren von Experimenten mit klassischem Repertoire oder lateinamerikanischer Musik, vom Neophonic Orchestra, dem eigene Plattenlabel, und Kentons Rock-Experimenten in den 1970ern. Sparke beleuchtet die verschiedenen Phasen seiner Entwicklung durch Erinnerungen der beteiligten Musiker und hinterfragt die veröffentlichten Alben in Hinblick auf kommerziellen Erfolg und musikalischen Gehalt.
Das liest sich fließend, gerade weil Sparke etliche Anekdoten einfließen lässt, doch auch etwas langatmig, weil das Buch sich zu stark von Album zu Album, von Tournee zu Tournee hangelt. Eine kritische Einordnung Kentons Musik in die Jazzgeschichte fehlt gänzlich, und so ist dies Buch vor allem ein Werk für Kenton-Liebhaber und -Sammler, die gewiss die eine oder andere anderswo nicht erwähnte Geschichte finden und sich freuen werden, Kentons Biographie so konzis und umfassend dargestellt zu sehen.
Wolfram Knauer (Juli 2013)
Jazz Icons. Heroes, Myths and the Jazz Tradition
von Tony Whyton
Cambridge 2010 (Cambridge University Press)
219 Seiten, 95 US-Dollar
ISBN: 978-0-52189-645-0
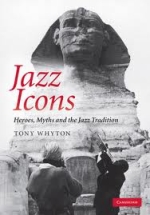 In der Jazzforschung spricht man seit einiger Zeit von “New Jazz Studies”, von analytischen, ästhetischen und soziologischen Herangehensweisen an den Jazz, die sowohl die Musik als auch ihren sozialen und gesellschaftlichen Kontext, die wirtschaftliche und politische Situation, die kritische Rezeption und alle möglichen anderen Facetten in Betracht zieht, statt sich auf singuläre Narrative zu beschränken.
In der Jazzforschung spricht man seit einiger Zeit von “New Jazz Studies”, von analytischen, ästhetischen und soziologischen Herangehensweisen an den Jazz, die sowohl die Musik als auch ihren sozialen und gesellschaftlichen Kontext, die wirtschaftliche und politische Situation, die kritische Rezeption und alle möglichen anderen Facetten in Betracht zieht, statt sich auf singuläre Narrative zu beschränken.
In seinem Buch “Jazz Icons” führt der britische Musikwissenschaftler Tony Whyton einige Beispiele solcher Ansätze vor, in Kapiteln, die vordergründig von den Großen des Jazz handeln, tatsächlich aber die konkreten Fragestellungen multidimensional angehen.
Er fragt nach der Wahrheit hinter der Genieästhetik, die im Jazz fast noch mehr zu gelten scheint als in der klassischen Musik des 19. Jahrhunderts. Er schaut auf die Musik John Coltranes und überlegt, welchen Einfluss diese auf Musiker bis in die Gegenwart hatte – nicht nur direkt, sondern auch indirekt, auf dem Umweg über seine ikonische Stellung in der Jazzgeschichte etwa oder über Jamey Aebersolds Play-A-Long-Platten.
Er hört sich Kenny Gs Version von Louis Armstrongs “What a Wonderful World” an, fragt nach Verehrung oder Sakrileg, aber auch nach Eigentum, Authentizität und dem gespaltenen Verhältnis des Jazz zur populären Musik. Er untersucht Impulse-Veröffentlichungen im Hinblick auf die Vermarktungsstrategien des Labels und ihren Einfluss auf den gegenwärtigen Jazz-Mainstream.
Er diskutiert, welche Bedeutung Musikeranekdoten für die Wahrnehmung, aber durchaus auch für die kritische Einordnung von Jazzgeschichte haben. Er blickt auf Duke Ellington als Beispiel einer besonders mythen-umrangten Ikone des Jazz und vergleicht unterschiedliche Sichtweisen auf den Meister, etwa durch die Brillen von Ken Burns, James Lincoln Collier oder David Hajdu.
Und schließlich betrachtet er die Folgen der Verschulung des Jazz, die nicht zuletzt einen besonderen Einfluss auf die Kanonisierung von Musikern und Aufnahmen hatte und diskutiert dabei Möglichkeiten, aus der Sackgasse festgefahrener Jazzpädagogik herauszugelangen.
“Jazz Icons” zeigt, wie sich Jazzgeschichte von Generation zu Generation mit den jeweils aktuellen analytischen Instrumenten neu aneignen, interpretieren und lesen lässt. Tony Whyton versucht, woran sich Jazzautoren allgemein ein Beispiel nehmen sollten: die sachlich-differenzierte Diskussion von Musik, ihren Ursachen und ihrer Wahrnehmung.
Wolfram Knauer (Juli 2013)
The Record. Contemporary Art and Vinyl
herausgegeben von Trevor Schoonmaker
Durham/NC 2010 (Nasher Museum of Art at Duke University)
216 Seiten, 29,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-938989-33-2
 Das Nasher Museum of Art zeigte 2011 eine Ausstellung über die Kulturgeschichte der Vinylschallplatte, bei der nicht nur Plattendesign im Vordergrund stand, sondern die gesamte Beziehung zwischen Bildender Kunst und Tonträgern. Der aus Anlass der Ausstellung veröffentlichte Katalog zeigt Künstler vor allem auf den letzten 50 Seiten die ausgestellten Werke und nennt ihre Künstler, nähert sich dem Thema selbst im Hauptteil außerdem in lesenswerten Aufsätzen und reich bebildert an.
Das Nasher Museum of Art zeigte 2011 eine Ausstellung über die Kulturgeschichte der Vinylschallplatte, bei der nicht nur Plattendesign im Vordergrund stand, sondern die gesamte Beziehung zwischen Bildender Kunst und Tonträgern. Der aus Anlass der Ausstellung veröffentlichte Katalog zeigt Künstler vor allem auf den letzten 50 Seiten die ausgestellten Werke und nennt ihre Künstler, nähert sich dem Thema selbst im Hauptteil außerdem in lesenswerten Aufsätzen und reich bebildert an.
Da geht es in einem einleitenden Kapitel um das augenfälligste, nämlich die Covergestaltung. Eine Timeline verfolgt die Geschichte der Schallplatte von 1857 bis in die Gegenwart. Pitr Orlov fragt, wie Schallplatten die Musik selbst veränderten; Mark Katz setzt sich mit der Leidenschaft von Plattensammlern auseinander; und Charles McGovern schaut auf den Plattenladen als “Home of the Blues, House of Sounds”. Carlo McCormick stellt fest, dass kaum ein Künstler in Stille arbeite und reflektiert über die Beziehungen zwischen Bildenden Künstlern und Musikkonserven. Mark Anthony Neal berichtet über die völlig neue und andere Sammelleidenschaft von Hip-Hop–DJs. Josh Kun betrachtet die Bedeutung der Schallplatte für die Kulturgeschichte Mexikos; Vivien Goldman tut dasselbe mit Bezug auf Jamaica. Jeff Chang beleuchtet die durch DJing und Soundmix veränderte Ästhetik seit den 1980er Jahren und Barbara London Do-It-Yourself-Produktionen in Musik und Bildender Kunst seit Fluxus.
In all diesen und weiteren Kapiteln des Buchs wird man von immer neuer Seite auf die kulturelle Selbstverständlichkeit der Schallplatte gestoßen, die man im Zeitalter von mp3 fast vergessen hat, die aber ein halbes Jahrhundert in seinem Kunstverständnis und -streben enorm prägte. Die im Buch abgedruckten Bilder, Fotos und Kunstwerke tun ein übriges, der Vinylplatte zum einen hinterherzutrauern, einen zum anderen aber auch dazu zu animieren sich umzusehen, welche Medien denn heute diese Funktion übernommen haben.
Wolfram Knauer (April 2013)
Ain’t Nothing Like the Real Thing. How the Apollo Theater Shaped American Entertainment
herausgegeben von Richard Carlin & Kinshasha Holman Conwill
Washington/DC 2010 (Smithsonian Books)
264 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-1-58834-269-0
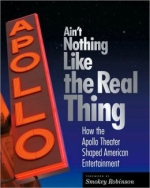 Das Apollo-Theater in Harlem ist immer noch lebendige Musikgeschichte. Es prägte die populäre Musik des 20sten Jahrhunderts wie wenige andere Spielstätten. Swinggrößen spielten hier genauso wie die Bebopper, der Rhythm ‘n’ Blues feierte Erfolge genauso wie etliche Rockstars, Soul und Funk erklangen auf der Bühne, Disco, Rap, HipHop und vieles mehr. Und natürlich begannen etliche spätere Stars bei den Amateur Hours, die jeden Mittwoch stattfanden, ihre Karriere.
Das Apollo-Theater in Harlem ist immer noch lebendige Musikgeschichte. Es prägte die populäre Musik des 20sten Jahrhunderts wie wenige andere Spielstätten. Swinggrößen spielten hier genauso wie die Bebopper, der Rhythm ‘n’ Blues feierte Erfolge genauso wie etliche Rockstars, Soul und Funk erklangen auf der Bühne, Disco, Rap, HipHop und vieles mehr. Und natürlich begannen etliche spätere Stars bei den Amateur Hours, die jeden Mittwoch stattfanden, ihre Karriere.
2010 stellte die Smithsonian Institution eine Wanderausstellung zusammen, in der Kostüme, Fotos, Erinnerungsstücke und vieles mehr zu sehen war, Dokumente einer 80jährigen Theatergeschichte. Die Ausstellung wurde begleitet vom vorliegenden Buch, dem es gelingt, die Bedeutung des Hauses noch weit eingehender zu beleuchten.
Da gibt es historische Einordnungen, etwa von David Levering Lewis über das frühe Harlem oder von Amiri Baraka über die Bedeutung des Stadtteils für die Black Consciousness der 1960er Jahre; da gibt es musik- und bühnenbezogene Kapitel, etwa von John Edward Hasse über die Hochzeit der Bigbands, von Willard Jenkins über Bebop und modernen Jazz, von Chris Washburne über die Latin-Szene, die hier eine Spielmöglichkeit fand, von Kandia Crazy Horse über Soul und Funk oder von David Hinckley über Rap und HipHop. Es gibt Erinnerungen an die Programmverantwortlichen, insbesondere Frank und Bobby Schiffman, Artikel über kultur- und gesellschaftsgeschichtliche Entwicklungen, die im Apollo ihren Widerhall fanden, seien es diverse Tanzarten, sei es die Bürgerrechtsbewegung. Es findet sich ein Kapitel über Afro-Amerikaner im II. Weltkrieg und eines über die Chorus-Girls auf der Bühne. Greg Tate beleuchtet James Browns Auftritte in Harlem, Karen Chilton erinnert an Bessie Smith, Willard Jenkins an Ella Fitzgerald, Herb Boyd an Aretha Franklin und Chris Washburne an Celia Cruz.
Das alles ist hinterlegt mit vielen, zum Teil seltenen Fotos, die das Apollo als Teil einer Stadtteilkultur genauso wie als Teil einer global ausstrahlenden Kulturszene zeigen. Besonders eindrucksvoll – in der Ausstellung genau wie im Buch –: die Karteikarten, auf denen Frank Schiffman seine recht offenen Einschätzungen über die engagierten Künstler notierte sowie die Gagen, die er ihnen zahlte oder zu zahlen bereit war.
“Ain’t Nothing Like the Real Thing” dokumentiert anschaulich ein wichtiges Kapitel afro-amerikanischer Kulturgeschichte. Bunt und swingend, funky und auf jeder Seite mitreißend, ein fokussierter und doch recht breiter Einblick in die schwarze Musik des 20sten Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (April 2013)
Jazz Matters. Sound, Place, and Time Since Bebop
von David Ake
Berkeley 2010 (University of California Press)
200 Seiten, 16,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-520-26689-6
 Jazzgeschichte genauso wie die meiste Kulturgeschichte ist in der Regel eine Geschichte der Meister. Misserfolge oder Mittelmäßigkeit schafften es selten in die Jazzgeschichtsbücher, obwohl sie und mit ihnen eben auch der Alltag recht viel über die Eingebundenheit des Jazz in die Gesellschaft aussagen. David Ake widmet sich in seinem Buch in Schlaglichtern Aspekten des Jazz, die von allgemeiner Jazzgeschichtsschreibung höchstens am Rande erwähnt werden, hält also die Lupe an konkrete Phänomene, die er dann von verschiedenen Seiten beleuchtet.
Jazzgeschichte genauso wie die meiste Kulturgeschichte ist in der Regel eine Geschichte der Meister. Misserfolge oder Mittelmäßigkeit schafften es selten in die Jazzgeschichtsbücher, obwohl sie und mit ihnen eben auch der Alltag recht viel über die Eingebundenheit des Jazz in die Gesellschaft aussagen. David Ake widmet sich in seinem Buch in Schlaglichtern Aspekten des Jazz, die von allgemeiner Jazzgeschichtsschreibung höchstens am Rande erwähnt werden, hält also die Lupe an konkrete Phänomene, die er dann von verschiedenen Seiten beleuchtet.
Im ersten Kapitel, überschrieben “Being (and Becoming) John Coltrane” etwa fragt er, was eigentlich Coltrane zu Coltrane macht, verfolgt die Aufnahmen des Saxophonisten über die Jahre und versucht zu beschreiben, was darin die subjektive Persönlichkeit Coltranes widerspiegelt.
Im zweiten Kapitel hört er sich Miles Davis’ “Old Folks” von 1961 genauer an und stolpert über ein Knarren bei 1:15, der Dielenboden des Studios, der Stuhl eines der Musikers? Warum dieses Knarren in der Studioaufnahme belassen wurde, ist kaum erkenntlich, hätte man doch auch 1961 keine Probleme gehabt, ein solches Geräusch herauszufiltern. Ake fragt den Wirkungen des Knarrens, das man, wenn überhaupt, wirklich nur im Hintergrund wahrnimmt, reflektiert über Live-Stimmung, Spontaneität, Authentizität. Bei einer früheren Aufnahmesitzung im selben Studio, klärt er später auf, machte Miles den Toningenieur auf die knarrenden Dielenbretter aufmerksam, worauf John Coltrane nur erwiderte: Mann, das ist halt ein Nebengeräusch. Das ist alles Teil des Stücks.”
Kapitel 3 betrachtet die Band Sex Mob des Trompeters Steven Bernstein und ihren Umgang mit Humor – oder, wie Ake dies nennt, dem Element des “Karnevalesken”. Kapitel 4 fragt nach Romantizismen, dem Image von Country im Jazz und konzentriert sich dabei auf ECM-Aufnahmen Keith Jarretts und Pat Methenys. In Kapitel 5 reflektiert Ake über die Veränderungen in der Jazzpädagogik und die Auswirkungen solcher Änderungen auf die Musik und den Markt. Im letzten Kapitel schließlich betrachtet er amerikanische Jazzmusiker in Paris und ihre Probleme damit, dort ihre nationale Identität beizubehalten. Mit ähnlichem Ansatz könnte man wahrscheinlich auch die Berliner Szene unserer Tage untersuchen.
Alles in allem, ein Buch ungewöhnlicher Ansätze, das – und ein größeres Lob ist kaum denkbar – Lust darauf macht, dem Jazz mit neuem Blick zu begegnen, auch deshalb, weil die ungewöhnliche Sicht unerwartete Facetten zum Vorschein bringt, solche der Musik genauso wie der eigenen Hörgewohnheit.
Wolfram Knauer (April 2013)
A Breath of Freedom. The Civil Rights Struggle, African American GIs, and Germany
von Maria Höhn & Martin Klimke
New York 2010 (Palgrave Macmillan)
254 Seiten, 2u US-Dollar
ISBN: 978-0-230-10474-0
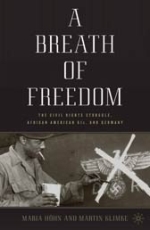 “A Breath of Freedom” handelt nicht einmal am Rande vom Jazz. “A Breath of Freedom” handelt, wie der Untertitel erklärt, vom “Bürgerrechtskampf, afro-amerikanischen GIs und Deutschland”, von der verqueren Situation also, das afro-amerikanische Soldaten im II. Weltkrieg (tatsächlich ja schon im I. Weltkrieg) für Freiheit und Demokratie kämpften, in ihrem eigenen Land aber nach wie vor die Rassentrennung herrschte.
“A Breath of Freedom” handelt nicht einmal am Rande vom Jazz. “A Breath of Freedom” handelt, wie der Untertitel erklärt, vom “Bürgerrechtskampf, afro-amerikanischen GIs und Deutschland”, von der verqueren Situation also, das afro-amerikanische Soldaten im II. Weltkrieg (tatsächlich ja schon im I. Weltkrieg) für Freiheit und Demokratie kämpften, in ihrem eigenen Land aber nach wie vor die Rassentrennung herrschte.
Maria Höhn und Martin Klimke untersuchen dabei die Zusammenhänge zwischen der langjährigen militärischen Präsenz der US-Streitkräfte in Deutschland und der Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten. Sie beschreiben die Vorurteile und das Bewusstwerden auf beiden Seiten, dass Bürgerrechte etwas Universelles seien und damit selbstverständlich auch schwarzen Amerikanern zustünden. Sie nennen politische und militärische Entscheidungen der 1940er bis 1970er Jahre und erklären die Realität der alltäglichen Lebenserfahrung innerhalb wie außerhalb der Kasernen in Deutschland. Sie fragen nach den gegenseitigen Einflüssen von Studentenbewegung in Europa und der Freiheitsbewegung in den USA, aber auch nach einer Art Verbrüderung antikapitalistischer Strömungen in Amerika mit dem System in der DDR.
Ihre faktenreiche Sammlung erklärt dabei viel über den Alltag afro-amerikanischer Soldaten in Deutschland. Über die Faszination des Jazz, jener für viele Amerikaner wie Nichtamerikaner wichtigsten afro-amerikanischen kulturellen Äußerung des 20sten Jahrhunderts, erzählen sie dabei nur wenig, was schade ist. Auf der anderen Seite verweisen sie im Vorwort darauf, dass dieses Buch nur die ersten Ergebnisse eines größeren Forschungsprojekts präsentiert.
Wer immer sich mit dem Einfluss der Präsenz afro-amerikanischer Soldaten und Musiker auf den deutschen Jazz befasst, wird in diesem Buch auf jeden Fall eine Menge Hintergrundinformation finden.
Wolfram Knauer (April 2013)
At the Jazz Band Ball. Sixty Years on the Jazz Scene
von Nat Hentoff
Berkeley 2010 (University of California Press)
246 Seiten, 40 US-Dollar (Hardcover), 21,95 US-Dollar (Paperback)
ISBN: 978-0-520-26113-6 (Hardcover), 978-0-520-26981-1 (Paperback)
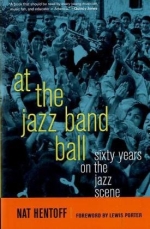 Es gibt Bücher, die liest man, weil man etwas lernen will, es gibt andere, die liest man, weil die Lektüre Spaß macht. Nat Hentoff gehört zu den seltenen Autoren, denen immer beides gelang: viel und wertvolle Information in einem Stil zu verpacken, der flüssig und lustvoll zu lesen ist.
Es gibt Bücher, die liest man, weil man etwas lernen will, es gibt andere, die liest man, weil die Lektüre Spaß macht. Nat Hentoff gehört zu den seltenen Autoren, denen immer beides gelang: viel und wertvolle Information in einem Stil zu verpacken, der flüssig und lustvoll zu lesen ist.
Sein neuestes Buch ist eine Sammlung bereits veröffentlichter – seinerzeit in der Jazz Times oder im Wall Street Journal erschienener – wie bislang noch nicht veröffentlichter Aufsätze zu allen möglichen Themen, die ihm am Herzen liegen: spezifische Musiker und ihr ästhetischer Gestaltungwille, die soziale Schieflage, in der Musiker, die alt sind oder in Not, keine Sicherheit haben, das Engagement einer Jazzszene, die sich glücklicherweise immer noch als Familie versteht, die Gleichberechtigung der Frau auch im Jazz, das Ende rassistisch bedingter Ausgrenzung und und und.
All diese Kapitel sind äußerst persönlich, mehr noch: Hentoff kennt nicht nur viele Menschen, er ist genuin an ihnen interessiert. Seine Gespräche mit Clark Terry oder Phil Woods, seine Erinnerungen an Duke Ellington oder Louis Armstrong, seine Meinung zur politischen Dimension dieser Musik, in Zeiten der Bürgerrechtsbewegung genauso wie heutzutage, seine Begeisterung nicht nur für die Heroen der Vergangenheit, sondern auch für junge Musiker, all das überträgt sich auf den Leser, der gern weiterblättert von einem zum nächsten Kapitel springt und dabei immer wieder mit neuen Facetten angestachelt wird nachdenklich zu bleiben.
64 solche Kapitel enthält das Buch und noch weit mehr Denkanstöße, sprachlich wunderbar umgesetzt, nirgends schulmeisterlich, überall voll von Erinnerung und Erzählwille. Höchst empfehlenswert!
Wolfram Knauer (März 2013)
Il libro della voce. Gli stile, le tecniche, I protagonisti della vovalità contemporanea internazionale
herausgegeben von Claudio Chianura & Leilha Tartari
Milano 2010 (Auditorium)
218 Seiten, 1 beigelegte CD, 38 Euro
ISBN: 978-88-86784-55-9
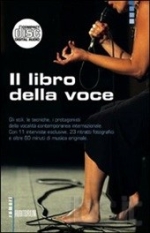 Die Stimme als Instrument – nicht erst im 20sten Jahrhundert wurde die scheinbar menschlichste musikalische Äußerung instrumental eingesetzt, aber insbesondere im 20sten Jahrhundert entwickelten Künstler und Komponisten die verschiedenen Techniken weiter, mit denen Verfremdung und Annäherung an den ureigenen Klang des Menschen und die ureigentliche Funktion der Stimme – die nämlich der Kommunikation – beeinflusst werden konnten.
Die Stimme als Instrument – nicht erst im 20sten Jahrhundert wurde die scheinbar menschlichste musikalische Äußerung instrumental eingesetzt, aber insbesondere im 20sten Jahrhundert entwickelten Künstler und Komponisten die verschiedenen Techniken weiter, mit denen Verfremdung und Annäherung an den ureigenen Klang des Menschen und die ureigentliche Funktion der Stimme – die nämlich der Kommunikation – beeinflusst werden konnten.
Das von Claudio Chianura und Leiha Tartari herausgegebene Buch nähert sich den Möglichkeiten stimmlicher Improvisation und stimmlichen Ausdrucks von verschiedenen Seiten: in einem ersten Teil theoretisch, nämlich in der Betrachtung unterschiedlicher vokaler Techniken und der dadurch verursachten allgemeinen Veränderung in der Wahrnehmung von Stimme; in einem zweiten Teil sehr individuell, nämlich in Interviews mit herausragenden Sängerinnen und Sängern, sowie in einem dritten Teil analytisch in der Betrachtung von speziellen Ansätzen einzelner Künstlerinnen und Künstler. Das alles ist insbesondere in der stilistischen Breite interessant, in der die Autoren das Thema angehen und dabei Greetje Bijma und Sidsel Endresen neben Benat Achiary oder Diamanda Galas stellen, Meredith Monk und David Moss neben Pamela Z und Demetrio Stratos.
Wem all diese Namen wenig sagen, der wird dankbar zur beiheftenden CD greifen, die 13 Beispiele bringt, von Kurt Schwitters’ “Sonate in Urlauten” und Tiziana Scanalettis “Stripsody” bis zu Beispielen der bereits genannten oder von Sainkho Namchylak, von Cristina Zavalloni oder Lorenzo Pierobon. Ein Lust machender Ausflug in die Welt der zeitgenössischen Vokalmusik.
Wolfram Knauer (März 2013)
Sardinia Jazz. Il jazz in Sardegna negli anni Zero. Musica, musicisti, eventi, discografia di base
von Claudio Loi
Cagliari 2010 (aipsa edizioni / percezioni musiche)
472 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-88 95692-26-5

Claudio Loi schreibt das “Who’s Who” des Jazz in Sardinien. Paolo Fresu, Antonello Salis, Paolo Angeli sind die Hauptfiguren; daneben aber kommen jede Menge Musiker und Band vor, von denen man hierzulande wahrscheinlich noch nie etwas gehört hat. Einleitungskapitel beschreiben die Jazzszene der zweitgrößten Insel Italiens, informieren aber auch regelmäßige Jazzevents und weiterführende Literatur. Sicher vor allem ein Buch für Eingeweihte, oder für regelmäßige Sardinien-Besucher.
Wolfram Knauer (Oktober 2012)
Vienna Blues. Die Fatty-George-Biographie
von Klaus Schulz
Wien 2010 (Album Verlag)
114 Seiten, 35 Euro
ISBN: 978-3-86184-182-0
 Der Klarinettist Fatty George spielte gern den Blues, und wenn er den Titel dann bei der österreichischen Urheberrechtsgesellschaft anmeldete, nannte er ihn “Vienna Blues” und trug den eigenen Namen als Urheber ein.
Der Klarinettist Fatty George spielte gern den Blues, und wenn er den Titel dann bei der österreichischen Urheberrechtsgesellschaft anmeldete, nannte er ihn “Vienna Blues” und trug den eigenen Namen als Urheber ein.
Clever, meint Klaus Schulz in seiner Biographie, die Leben und Werk des Klarinettisten in vier Teilen verfolgt.
Ein erster Teil gibt Franz Georg Presslers (so der volle Name) Lebensgeschichte in klassischem Gewand wieder: Kindheit, Ausbildung, erste Erfolge auf der österreichischen, dann der europäischen Jazzszene, diverse Bands und Aufnahmen über die Jahre, Gründung eines eigenen Spielorts.
Der zweite Teil geht das alles chronologisch genau und mit Interviewpassagen Georges sowie Zeitzeugenbeiträgen an. Hier bringt Schulz alle Daten und Details zusammen, Engagements, Reisen, Festivals, Platten- und Fernsehaufnahmen, Presseberichte, Korrespondenz, Fotos und Plakatabbildungen, persönliche Ereignisse und vieles mehr.
Teil drei enthält Biographien der Musiker, mit denen Fatty George über die Jahre zusammenarbeitete, Teil vier schließlich eine kurze Diskographie.
Akribisch zusammengetragen bietet sich dabei ein umfassendes Bild eines Ausnahmemusikers, der allzu oft als Dixielandklarinettist abgestempelt wird, obwohl er sich auch im Swing und modernen Jazz behaupten konnte, wie die beigeheftete CD mit seltenen und großteils unveröffentlichten Aufnahmen belegt, auf denen Fatty George neben seinen eigenen Besetzungen, der Ende der 1950er Jahre auch der junge Joe Zawinul angehörte, etwa auch mit dem Friedrich Gulda Workshop Ensemble zu hören ist, mit den ORF All-Stars, mit Lionel Hampton oder Sammy Price sowie mit seiner eigenen Besetzung, die eine Cool-Jazz-Version über “Alexander’s Ragtime Band” spielt.
Auch posthum noch einmal: Hut ab vor einem großen europäischen Jazzmusiker!
Wolfram Knauer (August 2012)
Fortællinger om jazzen. Dens vej gennem Statsradiofonien, Danmarks Radio og DR
von Tore Mortensen
Aalborn 2010 (Aalborg Universitetsforlag)
2010 Seiten, 295 Dänische Kronen
ISBN: 978-87-7307-983-6
 Unsere Nachbarn im Norden machen uns vor, was in hierzulande bislang noch nicht geleistet wurde, aber dringend notwendig wäre: eine Dokumentation der Jazzgeschichte im nationalen Rundfunk. Nun ist die deutsche Rundfunkgeschichte vielleicht etwas wechselvoller, in der Gegenwart auch vielgestaltiger als die in Dänemark, in dem es mit Danmarks Radio im Prinzip “nur” einen Staatsrundfunk gab, während im Nachkriegsdeutschland jede einzelne ARD-Anstalt ihre eigene Jazzredaktion aufbaute. Dennoch schauen wir ein wenig neidisch auf dieses Buch, dem es gelingt, den großen dänischen Bogen zu schlagen von 1925 bis ins Jahr 2009.
Unsere Nachbarn im Norden machen uns vor, was in hierzulande bislang noch nicht geleistet wurde, aber dringend notwendig wäre: eine Dokumentation der Jazzgeschichte im nationalen Rundfunk. Nun ist die deutsche Rundfunkgeschichte vielleicht etwas wechselvoller, in der Gegenwart auch vielgestaltiger als die in Dänemark, in dem es mit Danmarks Radio im Prinzip “nur” einen Staatsrundfunk gab, während im Nachkriegsdeutschland jede einzelne ARD-Anstalt ihre eigene Jazzredaktion aufbaute. Dennoch schauen wir ein wenig neidisch auf dieses Buch, dem es gelingt, den großen dänischen Bogen zu schlagen von 1925 bis ins Jahr 2009.
Tore Mortensen, seiens Zeichens Leiter des Center for Dansk Jazzhistorie in Aalborg, beginnt am 1. April 1925, als der staatliche Rundfunk in Dänemark sein erstes Radiosignal ausstrahlte. Als “Staatsradifonien” bezeichnete sich der Sender bis 1959, dann wurde er erst in “Danmarks Radio”, schließlich 1996 in “DR” umgetauft. Mortensens Buch dokumentiert die Jazzaktivitäten etwa des Radio-Tanzorchesters unter Leitung des Geigers Louis Preil, die Sendeverbote “negroider Tanz- und Unterhaltungsmusik” unter der deutschen Besatzung sowie die rasche und recht intensive Zurückeroberung der Ätherwellen durch den Jazz in der Nachkriegszeit. Mortensen listet die konkreten Sendungen, die zwischen September 1947 und Januar 1953 ausgestrahlt wurden, und die ihrerseits das Interesse am Swing, an modernen Stilarten oder an Aktivitäten sonstwo in Europa widerspiegeln. Er dokumentiert die Konzertaktivitäten des Senders in den 1950er Jahren, untermauert von Zeitzeugen wie dem Bassisten Erik Moseholm oder dem Moderator Børge Roger. Die 60er Jahre seien die goldenen Jahre des Jazz im dänischen Rundfunk gewesen, titelt Mortensen, skizziert nebenbei die Arbeit des dänischen Jazzhistorikers Erik Wiedemann und spricht mit Torben Ulrich, Peter Rasmussen und anderen, die dabei gewesen waren. Seit 1963 schnitt Danmarks Radio regelmäßig im Kopenhagener Jazzclub Montmartre mit, seit 1966 gab es regelmäßige Sonderproduktionen unter dem Titel “Radiojazzgrupppe”, später mit der Radioens Big Band.
In diesen Jahren ist Jazz in Dänemark auch im Fernsehen zu erleben. Etliche amerikanische Musiker hatten sich in den 1960er Jahren in Kopenhagen niedergelassen, unter ihnen etwa Dexter Gordon oder Duke Jordan. Jazz spielte auch nach 1975 eine wichtige Rolle im dänischen Rundfunk, dem Mercer Ellington 1984 seine private Tonbandsammlung vermachte. Thad Jones übernahm 1977 die Leitung der Radioens Big Band. Ein Unterkapitel des Buchs behandelt das Verhältnis des Senders zum Kopenhagener Jazzfestival, ein weiteres den Wandel in seinen Aufgaben im neuen Jahrtausend von denen einer Kulturinstitution zu jenen eines Multimedienanbieters. Als Anhang gibt es schließlich eine tabellarische Übersicht über die verschiedenen Aktivitäten des Senders, über wichtige Sendeformate, Produktionen und Mitarbeiter.
Eine Bibliographie sowie ein ausführlicher Index beschießen das Buch, das, es sei noch einmal gesagt, einen ein wenig neidisch in den Norden blicken lässt. Vielleicht findet sich ja hierzulande irgendwann mal jemand, der mit Berendts SWR anfängt; vielleicht gibt es einmal eine ausführliche Dokumentation der Aktivitäten des NDR oder der Berliner Produktionen. Bernd Hoffmann, Jazzredakteur des WDR, hat ein ausgeprägtes historisches Bewusstsein und sammelt sicher bereits Material, um ähnliches für den Kölner Sender zu bewerkstelligen – alles Anstalten, die nicht nur rege redaktionelle Tätigkeiten aufweisen, sondern genau wie DR Eigenproduktionen machten, eine regionale, nationale wie internationale Szene dokumentierten und zumeist eigene (Groß-)Ensembles besitzen, die mit zu den besten weltweit gehören.
Wer übrigens des Dänischen nicht ganz so mächtig ist, der wird dennoch seine Freude an den wunderbaren Fotos von Jan Persson haben, die oft genug während Produktionen von Danmarks Radio aufgenommen wurden. Sein Bildarchiv gehört heute dem Jazz for Dansk Jazzhistorie, das zugleich Initiator und Herausgeber des vorliegenden Buchs ist.
Wolfram Knauer (August 2012)
Singing Out. An Oral History of America’s Folk Music Revivals
von David King Dunaway & Molly Beer
New York 2012 (Oxford University Press)
255 Seiten, 27,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-989656-1
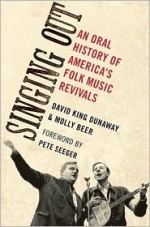 Das Folk Music Revival wird allgemein in die 1960er Jahre datiert; es beeinflusste die populäre Musik auf unterschiedlichste Art und Weise. Bob Dylan und Janis Joplin haben dieser Bewegung genauso viel zu verdanken wie auf der anderen Seite des Atlantiks die Beatles oder die Rolling Stones, wobei bei letzteren eher der Bluesteil der Folkszene von Bedeutung war. Die Anfänge des Folk-Revivals aber finden sich bereits in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren, wie das vorliegende Buch dokumentiert. David King Dunaway und Molly Beer haben dafür Zeitzeugen befragt und ihre Berichte nach Themen sortiert.
Das Folk Music Revival wird allgemein in die 1960er Jahre datiert; es beeinflusste die populäre Musik auf unterschiedlichste Art und Weise. Bob Dylan und Janis Joplin haben dieser Bewegung genauso viel zu verdanken wie auf der anderen Seite des Atlantiks die Beatles oder die Rolling Stones, wobei bei letzteren eher der Bluesteil der Folkszene von Bedeutung war. Die Anfänge des Folk-Revivals aber finden sich bereits in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren, wie das vorliegende Buch dokumentiert. David King Dunaway und Molly Beer haben dafür Zeitzeugen befragt und ihre Berichte nach Themen sortiert.
Dabei geht es etwa um die Definition von Folk Music ganz allgemein (für das “Volksmusik” ein schlechte Übersetzung ist) und um Grenzziehungen – sind also Folk Music nur englische Seemannslieder, oder gehören auch Calypso, Bluegrass, Flamenco, Cajun, Zydeco, Rap dazu? Wie unterscheidet sich die Definition von Folkmusik innerhalb und außerhalb des beschriebenen Revivals? Und wie verhält sich Folk Music zum politischen Song?
Das zweite Kapitel betrachtet frühe Sammler authentischer amerikanischer Volksmusik, fragt dabei auch danach, wem diese Musik gehört. Alan Lomax und Leadbelly erhalten ein eigenes Teilkapitel. Die Einbindung des Folk Music Revival in politische Agenden spielt eine Rolle im dritten Kapitel, das überschrieben ist mit “Music for the Masses” und in dem es auch um die Linke im Amerika der 1930er und 1940er Jahre geht.
In den 1940er Jahren fand das Revival vor allem in Greenwich Village, New York statt, dem das vierte Kapitel gewidmet ist. Zugleich, berichten die Zeitzeugen, hatte New York und seine Weltläufigkeit aber auch Einfluss auf ihre eigene musikalische Ästhetik. Ende der 1940er Jahre fielen viele der linken Folk-Revivalisten ins Raster der “Rotenjagd” McCarthys, und das Kapitel über die Verhöre, Verdächtigungen und Arbeitssperren ist vielleicht eines der bedrückendsten des Buchs. Mitte der 1950er Jahre dann folgte ein breites Folk-Revival, ein Boom, der sowohl die romantische wie auch die politischen Varianten der Folk Music einschloss und im Newport Folk Festival sowie den Karrieren von Bob Dylan und Janis Joplin mündete. Folk Music wurde Teil der Bürgerrechtsbewegung, die “We Shall Overcome” zu ihrer Hymne erkor.
Ein eigenes Kapitel ist dem Folk-Rock der späten 1960er Jahre gewidmet, ein weiteres dem “Nu-Folk” der jüngsten Vergangenheit. Wie wird die Folk Music der Vereinigten Staaten in Zukunft aussehen?, fragen die Autoren zum Schluss, sind dabei aber keinesfalls pessimistisch, sondern glauben daran, dass es weiter gehen wird. Und wie zum Beweis fügen sie noch ein letztes Kapitel an, “The Power of Music”, in dem sie Beispiele nennen, wie Musik die Welt verändern kann.
Alles in allem: ein gut lesbares Erinnerungsbuch an eine Bewegung, die durchaus auch für den Jazz von Bedeutung war, auch wenn Jazzer im Personenindex kaum Eingang gefunden haben. Billie Holidays “Strange Fruit” jedenfalls verband die Ideale der Folk- und der Jazzszene genauso wie einige der Bluesmusiker, die in Barney Josephsons “Café Society” in New York auftraten. Die Zeitzeugenberichte dieses Buchs geben einen guten Einblick in die Hintergründe des Interesses an einer ureigenen authentischen Folk Music in Amerika.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
The Penguin Jazz Guide. The History of the Music in the 1001 Best Albums
von Brian Morton & Richard Cook
London 2010 (Penguin Books)
730 Seiten, 20 Britische Pfund
ISBN: 978-0-141-04831-4
 Der Jazz ist eine schier unübersichtliche Musik – so viele Stile, so viele Entwicklungen, so lange Geschichte, so viele Aufnahmen. Für den Novizen wird es schwer, da noch durchzublicken. Und so bietet es sich an, dass immer wieder Bücher erscheinen, die dem werdenden Jazzfan Tipps geben, was er vielleicht auch noch hören könnte. Der Penguin Jazz Guide ist ein bisschen wie die Urmutter umfangreicher Plattenempfehlungen. Er erschien erstmals 1990, als niemand wusste, ob die CD die Zukunft oder der Tod der Schallplattenindustrie sein würde, und seine neueste Ausgabe erscheint in einer Zeit, in der es ungewiss ist, ob das Konzept des Jazzalbums in Zeiten des Internet-Downloads überhaupt noch eine Zukunft hat.
Der Jazz ist eine schier unübersichtliche Musik – so viele Stile, so viele Entwicklungen, so lange Geschichte, so viele Aufnahmen. Für den Novizen wird es schwer, da noch durchzublicken. Und so bietet es sich an, dass immer wieder Bücher erscheinen, die dem werdenden Jazzfan Tipps geben, was er vielleicht auch noch hören könnte. Der Penguin Jazz Guide ist ein bisschen wie die Urmutter umfangreicher Plattenempfehlungen. Er erschien erstmals 1990, als niemand wusste, ob die CD die Zukunft oder der Tod der Schallplattenindustrie sein würde, und seine neueste Ausgabe erscheint in einer Zeit, in der es ungewiss ist, ob das Konzept des Jazzalbums in Zeiten des Internet-Downloads überhaupt noch eine Zukunft hat.
Nichtsdestotrotz haben sich Brian Morton und Richard Cook, zwei der ausgewiesendsten britischen Jazzkenner, hingesetzt und eine Empfehlungsliste zusammengestellt. Im Jahr 2010 sind das oft keine Besprechungen einzelner Titel oder Alben mehr, da historische Meilensteile wie King Olivers Creole Jazz Band oder Louis Armstrongs Hot Five und Hot Seven längst in alle Aufnahmen versammelnden Box-Sets erschienen sind, die von den beiden genauso empfohlen werden wie ähnliche “complete recordings” späterer Musiker. Wie meist bei solchen Werken ist die Suche nach den fehlenden Aufnahmen nicht sehr sinnvoll weil eine nur subjektive Einschätzung. Anders als bei reinen Plattenrezensionen geben die Autoren jeder empfohlenen Platte eine kurze Beschreibung der vorgestellten Musiker vorweg, um dann auf Besonderheiten des spezifischen Albums einzugehen, die erklären, warum es den Platz unter den 1001 Alben gefunden hat.
Der Löwenanteil der Alben stammt aus den USA, erst ab den 1960er Jahren sind mehr und mehr europäische Musiker unter den Empfohlenen zu finden. Und die jüngsten Entscheidungen, also für die Jahre 2000 bis 2010, scheinen von den Autoren weit willkürlicher gefällt worden zu sein als zuvor – aber das ist verständlich, denn erst die Zeit wird zeigen, wie wegweisend, wie wichtig und bedeutend diese Alben denn nun wirklich waren.
“The Penguin Jazz Guide” wendet sich in seinen knappen Albumsrezensionen aber nicht nur an den Jazzneuling, sondern ausdrücklich auch an den Jazzkenner, der seine eigene Einschätzung am Lob der beiden Autoren messen mag und sicher die eine oder andere Aufnahme entdecken wird, die ihm bislang entgangen war, die es aber wert ist zu besitzen (und mehr noch: zu hören).
Wolfram Knauer (April 2012)
Fra Odd Fellow til East Park. Jazz i Aalborg, 1920-1970
von Knud Knudsen & Ole Izard Høyer & Tore Mortensen
Aalborg 2010 (Aalborg Universitetsforlag)
143 Seiten, 299 Kronen
ISBN: 978-87-7307-994-2
 Lokalgeschichten des Jazz in Europa handeln meist von ähnlichen Aktivitäten: der Faszination am Jazz als einer fast schon exotischen Musik in den 1920er Jahren, einer städtischen Musikszene zur Unterhaltung des bürgerlichen Publikums, dem steigenden Interesse der Musiker an der improvisatorischen Ausdrucksform des Jazz, dem Ankommen des Jazz in der Mitte der Gesellschaft und dem Neuerfinden dieser Musik nach dem II. Weltkrieg als zeitweiser Ausdrucksform der Jugend.
Lokalgeschichten des Jazz in Europa handeln meist von ähnlichen Aktivitäten: der Faszination am Jazz als einer fast schon exotischen Musik in den 1920er Jahren, einer städtischen Musikszene zur Unterhaltung des bürgerlichen Publikums, dem steigenden Interesse der Musiker an der improvisatorischen Ausdrucksform des Jazz, dem Ankommen des Jazz in der Mitte der Gesellschaft und dem Neuerfinden dieser Musik nach dem II. Weltkrieg als zeitweiser Ausdrucksform der Jugend.
Die dänische Hafenstadt Aalborg also hat eine durchaus ähnliche Jazzgeschichte aufzuweisen, wie die drei Autoren des aufwendig gestalteten Bandes dokumentieren. Erste Erwähnung jazzmusikalischer Aktivitäten finden sie im November 1922, als im Odd Fellow Palæet ein Jazzkonzert angekündigt wird. Die Autoren durchwühlen alte Tageszeitungen, Programmankündigungen, Konzertbesprechungen. Anfang der 1930er Jahre machten die ersten amerikanischen Stars in Dänemark Station, im Kopenhagener Tivoli konnte man Louis Armstrong hören, und Joe Venuti beeinflusste 1934 den blutjungen Svend Asmussen. Auch dänische Jazzgrößen, Kai Ewans etwa, Leo Mathisen oder Peter Rasmussen und andere waren regelmäßig zu Gast.
Nach dem Krieg wurde Jazz auch in Dänemark von der Tanzmusik immer mehr zur Hörmusik. 1951 gründete sich ein Jazzclub, der mit regelmäßigen Veranstaltungen und Sessions an die Öffentlichkeit ging. Die britischen Trad-Bands tourten Dänemark und beeinflussten den dänischen Dixieland. Im Januar 1959 kam Louis Armstrong in die Stadt, und auch andere Jazzgrößen waren zu hören. 1955 schließlich gründete sich der East Park Jazzclub, dessen Konzerte ein jugendliches Publikum erreichten.
“Frau Odd Fellow til East Park” erzählt die Geschichte dieser Aalborger Jazzszene zwischen den frühen 1920er und späten 1960er Jahren. Das Buch enthält viele seltene Fotos von Musikern und Veranstaltungsorten, außerdem einige Ausrisse aus zeitgenössischen Berichten. Sicher wendet sich das Buch an eine auch regional begrenzte Leserschaft (dänische Sprachkenntnisse sind Voraussetzung), ist damit aber ein willkommenes weiteres Puzzleteilchen zu einer europäischen Jazzgeschichte.
Wolfram Knauer (April 2012)
Blue Note Records. A Guide for Identifying Original Pressings
von Frederick Cohen
New York 2010 (Jazz Record Center)
112 Seiten, 45 US-Dollar
ISBN: 978-0-692-00322-0
 Der Jazzplattensammler ist ein Phänomen für sich – in seiner Ernsthaftigkeit, seinem Vollständigkeitswahn genauso wie in der Expertise, die ihn im besten Fall zum Diskographen macht, ein Fachgebiet, das ihm in anderen Musikbereichen wahrscheinlich zu einem akademischen Grad verhelfen würde. Der sympathische Jazzplattensammler ist der, der durch die Welt reist, in Plattenläden geht und dann mit offenen Augen sowohl nach Neuentdeckungen sucht als auch nach Platten, die seine eigene Sammlung, seine eigenen Sammlungsinteressen vervollständigen. Die Musik steht für ihn im Mittelpunkt, daneben aber auch die Authentizität des Tonträgers selbst, der möglichst ein Original sein sollte, gar nicht unbedingt aus Wertgründen, sondern einfach, weil es ihn mehr reizt, eine Erstausgabe in den Händen zu halten. Der skurrile Jazzplattensammler ist jener, der sämtliche Plattennummern im Kopf hat, durchaus auch Besetzungen und Aufnahmedaten, der über dem Sammlungswahn aber vergessen hat, dass Platten eigentlich Musik transportieren, so dass er seine Platten im Extremfall gar nicht auflegt, weil bereits einmaliges Abspielen den Wert der Platten mindern könnte.
Der Jazzplattensammler ist ein Phänomen für sich – in seiner Ernsthaftigkeit, seinem Vollständigkeitswahn genauso wie in der Expertise, die ihn im besten Fall zum Diskographen macht, ein Fachgebiet, das ihm in anderen Musikbereichen wahrscheinlich zu einem akademischen Grad verhelfen würde. Der sympathische Jazzplattensammler ist der, der durch die Welt reist, in Plattenläden geht und dann mit offenen Augen sowohl nach Neuentdeckungen sucht als auch nach Platten, die seine eigene Sammlung, seine eigenen Sammlungsinteressen vervollständigen. Die Musik steht für ihn im Mittelpunkt, daneben aber auch die Authentizität des Tonträgers selbst, der möglichst ein Original sein sollte, gar nicht unbedingt aus Wertgründen, sondern einfach, weil es ihn mehr reizt, eine Erstausgabe in den Händen zu halten. Der skurrile Jazzplattensammler ist jener, der sämtliche Plattennummern im Kopf hat, durchaus auch Besetzungen und Aufnahmedaten, der über dem Sammlungswahn aber vergessen hat, dass Platten eigentlich Musik transportieren, so dass er seine Platten im Extremfall gar nicht auflegt, weil bereits einmaliges Abspielen den Wert der Platten mindern könnte.
Der Sonderfall der Jazzplattensammler ist der “Blue-Note-Sammler”, und an diesen richtet sich dieses Buch. Frederick Cohen besitzt den größten Jazzplattenladen in New York, ein Mekka für Sammler aus aller Welt. In seiner täglichen Arbeit kam es ihm immer wieder unter, dass Kunden den Wert der Schallplatten in seinen Regalen anzweifelten, also in Frage stellten, ob es sich bei einer Platte auch wirklich um ein Original handelt? Das Label auf der einen Seite der Platte sah beispielsweise anders aus als das auf der anderen Plattenseite, die Firmenadresse auf dem Cover war eine andere als die auf den Labels. Über die Jahre sammelte Cohen die unterschiedlichen Merkmale der Blue-Note-Scheiben und erstellte einen Katalog untrüglicher Charakteristika, den er jetzt im eigenen Verlag vorlegt.
Das Buch beginnt mit einer Erklärung der Fachbegriffe, die für die Beschreibung von Schallplatten nötig sind. Cohen zeigt anhand von Fotos die verschiedenen Vorkommnisse des “Plastylite”-Symbols “P” auf der Vinylscheibe, das eines der wichtigsten Merkmale eines Originals ist. Er zeigt die unterschiedlichen Varianten der Adressdarstellung auf dem Label wie auf dem Cover, Varianten des Mono- und des Stereo-Logos (bzw. Stickers). Dann dekliniert er im umfangreichsten kapitel die unterschiedlichen Serien durch und beschreibt dabei ihre Besonderheiten.
Ein eigenes Kapitel widmet sich Rudy Van Gelders Kommentaren über seine Mono- und Stereoaufnahmen. In weiteren Kapiteln fasst Cohen die Veröffentlichungen nach Jahren zusammen, beschreibt die originalen inneren Schüutzhüllen und führt schließlich einige der seltesten Raritäten des Blue-Note-Labels vor.
Cohens Buch ist zu allererst ein Must-Have für Blue-Note-Sammler (von denen es nicht gerade wenige gibt). Es ist zugleich ein Musterbeispiel für diskographische Grundlagenforschung ganz anderer Art – bei ihm geht es ja nicht um Besetzungen, Titel oder Aufnahmedaten, sondern um den Tonträger und seine Verpackung, die er einer genauen Analyse unterzieht. Und zu allerletzt ist es ein unverzichtbares Referenzwerk für diejenigen, die Schallplatten als Wertanlage sammeln.
Wolfram Knauer (April 2012)
40 Jahre Internationales Dixieland Festival Dresden. Die Elbestadt swingt und brilliert, ist bluesvoll und populär
von Wolfgang Grösel & Joachim Schlese & Klaus Wilk
Dresden 2010 (Edition Sächsische Zeitung)
205 Seiten, 9,90 Euro
ISBN: 978-3-938325-73-5
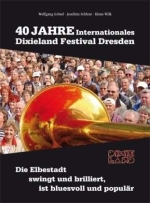 Am Pfingstwochenende 1971 begann in Dresden die Geschichte eines Festivals, das mittlerweile europaweit Kultstatus erlangt hat. Die Organisatoren wagten eine stilistische Beschränkung ihres Programms auf eine eng umgrenzte historische Jazzrichtung, den Dixieland zwischen New-Orleans-, Chicago-, Eddie-Condon- und europäischem Trad-Jazz. 1979 kamen bereits 30.000 Besucher, 1981 waren 200 Jazzmusiker aus Europa und (erstmals) den USA mit von der Partie.
Am Pfingstwochenende 1971 begann in Dresden die Geschichte eines Festivals, das mittlerweile europaweit Kultstatus erlangt hat. Die Organisatoren wagten eine stilistische Beschränkung ihres Programms auf eine eng umgrenzte historische Jazzrichtung, den Dixieland zwischen New-Orleans-, Chicago-, Eddie-Condon- und europäischem Trad-Jazz. 1979 kamen bereits 30.000 Besucher, 1981 waren 200 Jazzmusiker aus Europa und (erstmals) den USA mit von der Partie.
Das vorliegende Buch dokumentiert zum 40jährigen Jubiläum die Geschichte des Festivals, das damit quasi auf eine gleichlange DDR- wie BRD-Zeit zurückblicken kann. Neben den Publikumserfolgen werden auch die Krisenjahre kurz gestreift, das Jahr 1990 etwa, als zum 20. Jubiläum kein einziges Konzert ausverkauft war, weil die Menschen lieber in den nun offen stehenden Westen reisten als nach Dresden. Politik bleibt ansonsten eher außen vor in dieser Festschrift, in der man vielleicht gern etwas über die offizielle Haltung der DDR-Staatsführung zum Festival erfahren hätte, darüber, welche politische Agenda das Festival ermöglichte, welche Probleme oder auch welche Unterstützung es bei Einladungen an Bands aus dem Ausland gab, welche außermusikalischen Konnotationen sich bei den Besuchern mit der Veranstaltung verband.
Aber das ist vielleicht zu viel verlangt oder auch am Ziel des Buchprojekts vorbei erwartet: “40 Jahre IDF” ist vor allem ein Geschenk der Dixieland-Festival-Freunde an sich selbst, und da mag eine tiefere Beschäftigung mit eigener Geschichte vielleicht nicht so angesagt sein. Ein wenig schade ist das schon, aber dem Ziel des Buchs nach verständlich: Mit vielen bunten Fotos und einer freien Doppelseite für Autogramme ist es in erster Linie eine Art Erinnerungsalbum für die Fans.
Wolfram Knauer (April 2012)
Sun Ra. Interviews & Essays
herausgegeben von John Sinclair
London 2010 (Headpress)
201 Seiten, 13,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-900486-72-9
www.headpress.com
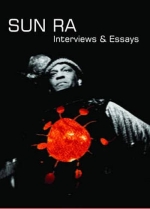 Sun Ra besaß bekanntlich Kultstatus. Und so ist es nicht verwunderlich, das in sich Veröffentlichungen dem Pianisten, Komponisten und Bandleader ganz ähnlich nähern, wie der sein Publikum zu begeistern pflegte: von allen Seiten, mit allen Sinnen, mit unerwarteten Klängen.
Sun Ra besaß bekanntlich Kultstatus. Und so ist es nicht verwunderlich, das in sich Veröffentlichungen dem Pianisten, Komponisten und Bandleader ganz ähnlich nähern, wie der sein Publikum zu begeistern pflegte: von allen Seiten, mit allen Sinnen, mit unerwarteten Klängen.
John Sinclairs Buch enthält vor allem Erinnerungen von Zeitzeugen, die Sun Ra im Konzert erlebten, ihn persönlich kannten oder gar mit ihm spielten. Ausgangspunkt ist ein Interview, das der “White Panther” und “poet-provocateur” Sinclair selbst 1966 mit Ra führte, und in dem dieser seine Philosophie… nun, vielleicht nicht gerade erklärt, aber umschreibt, und dabei im Verklären dann doch wieder etliches erklärt.
David Henderson erinnert sich an die Zeit in den 1960ern, als Ra auf der Lower East Side Manhattans lebte und eigentlich die afro-amerikanische Revolution vorlebte, die andere auf den Straßen erkämpfen wollten. Wir lesen Amiri Barakas Gedicht “Word from Sun Ra”, und Lazaro Vega spricht mit dem Dichter über Ras Bedeutung für die schwarze amerikanische Musik.
Ben Edmonds betitelt seine Erinnerungen an ein Sun-Ra-Konzert sehr treffend mit “Their Space Was My Place”. Der Trompeter Michael Ray berichtet über seine Zeit im Arkestra, und der Baritonsaxophonist Rick Steiger erinnert sich an eine Residenz des Arkestra in Detroit im Dezember 1980.
Peter Gershon reflektiert darüber, wie Marshall Allen die Ästhetik Sun Ras ins 21ste Jahrhundert transportiert. Darüber hinaus finden sich Interviews mit Musikern, deren Ästhetik durch Ras Musik stark beeinflusst wurde, Wayne Kramer etwa, Jerry Dammers und Sadiq Bey. Haf-fa Rool schließlich berichtet davon, wie er das Arkestra (als Nicht-Musiker) auf verschiedenen Europatourneen begleitet hatte.
Der zusammenhängende Faden aller Beiträge und Interviews ist die Kunst und der Einfluss Sun Ras, der schon manchmal etwas stark als der “Creator” persönlich rüberkommt – aber so war es eben, das Mysterium des Sun Ra. Sinclairs Buch endet mit einem Nachruf, den der Autor nach dem Tod des Bandleaders in der New Orleans Times-Picayune veröffentlicht hatte. Hier konzentriert er sich noch einmal auf die Erden-Seite des Pianisten, der daneben aber eben doch so viel mehr war… und dessen ästhetische Wirkung in vielen Bereichen von Musik und Kunst bis heute zu spüren ist.
Wolfram Knauer (März 2012)
Portrait Saxofon. Kultur, Praxis, Repertoire, Interpreten
Von Ralf Dombrowski
Kassel 2010 (Bärenreiter Verlag)
166 Seiten, 27,50 Euro
ISBN: 978-3-7618-1840-4
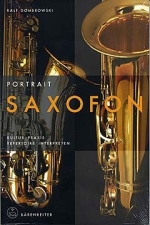 Adolphe Sax erfand das Saxophon 1841 als eine Art Klangzwitter zwischen den üblichen Holzblas- und den Streichinstrumenten. Hector Berlioz war der erste klassische Komponist, der für das neue Instrument schriebt; bald darauf übernahmen französische Militärkapellen das Instrument in ihre Instrumentierung, doch diese französische Vorliebe dauerte nur eine kurze Weile. Sax und seinem Schüler Eduard Lefèbvre gelang es allerdings, das Instrument in den USA populär zu machen. Der Rest ist Jazzgeschichte, möchte man meinen, und so ist es auch im Buch, das Ralf Dombrowski diesem neben der E-Gitarre vielleicht klang-bestimmendsten Instrument des 20. Jahrhunderts widmet.
Adolphe Sax erfand das Saxophon 1841 als eine Art Klangzwitter zwischen den üblichen Holzblas- und den Streichinstrumenten. Hector Berlioz war der erste klassische Komponist, der für das neue Instrument schriebt; bald darauf übernahmen französische Militärkapellen das Instrument in ihre Instrumentierung, doch diese französische Vorliebe dauerte nur eine kurze Weile. Sax und seinem Schüler Eduard Lefèbvre gelang es allerdings, das Instrument in den USA populär zu machen. Der Rest ist Jazzgeschichte, möchte man meinen, und so ist es auch im Buch, das Ralf Dombrowski diesem neben der E-Gitarre vielleicht klang-bestimmendsten Instrument des 20. Jahrhunderts widmet.
In kurzen Kapiteln erklärt er klangliche Besonderheiten im Spiel von Sidney Bechet, Johnny Hodges, Benny Carter, Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie Parker, Lee Konitz, Sonny Rollins, John Coltrane, Ornette Coleman, Albert Ayler, Wayne Shorter, Branford Marsalis, Peter Brötzmann, Jan Garbarek und etlichen anderen Heroen des Saxophons. Auch Marcel Mule und Sigurd Rascher erhalten eigene Kapitel, die beiden einflussreichsten klassischen Saxophonisten des letzten Jahrhunderts. Etwas eingehender betrachtet er zehn Aufnahmen und Künstler, Hawkins’ “Body and Soul” etwa, Parkers “Ornithology”, Rollins’ “Saxophone Colossus”, Coltranes “A Love Supreme” und andere, geht dann auf Konstruktion und diverse Bauformen des Instruments ein, aber auch auf Spielbesonderheiten wie etwa die Zirkularatmung und verwandte Instrumente wie das elektronische Lyricon. Er betrachtet wichtige Standards der Jazzgeschichte, in deren Erfolg auch das Saxophon eine große Rolle spielten, und er wirft einen Blick auf Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland und auf die beim Saxophon-Lernen zu beachtenden ästhetischen Dinge, insbesondere Intonation und eigener Sound.
Dombrowskis Buch ist ein gut lesbarer kurzer, dennoch intensiver Leitfaden zum Instrument, der jedem, der Saxophon spielt, ein paar Tipps zum Weiterhören, zum Sich-Selbst-Hinterfragen gibt, dabei technische Details genauso wie historische Entwicklungen erklärt.
Wolfram Knauer (März 2012)
Benny Goodman. A Supplemental Discography
von David Jessup
Lanham/MD 2010 (Scarecrow Press)
353 Seiten, 44,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-7685-9
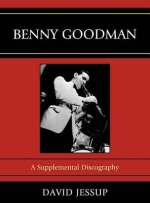 1988 erschien D. Russell Connors “Benny Goodman. Listen to His Legacy”, 1996 sein “Benny Goodman. Wrappin’ It Up”, zwei Diskographien, die Goodmans Aufnahmen von den ersten Studiosessions 1926 bis zu seinem Tod dokumentierten.
1988 erschien D. Russell Connors “Benny Goodman. Listen to His Legacy”, 1996 sein “Benny Goodman. Wrappin’ It Up”, zwei Diskographien, die Goodmans Aufnahmen von den ersten Studiosessions 1926 bis zu seinem Tod dokumentierten.
David Jessup knüpft an diese beiden diskographischen Werke an mit seinem großformatigen Opus, das die Vorgänger ergänzt um neu aufgetauchte Sessions, Livemitschnitte, Filmdokumente und zugleich in den diskographischen Details in einen Dialog mit den Titeln tritt, beschreibt, hinterfragt, offene Fragen herausstreicht, auf Diskrepanzen früherer diskographischer Erkenntnisse etwa mit dem Plattentext hinweist und vieles mehr.
Zwischendurch fasst er diskographische Diskurse zusammen, die er mit anderen Sammlern und Goodman-Experten über die Jahre geführt hatte. In einem kurzen Kapitel befasst sich Jessup außerdem mit dem Internet als einem neuen Sammelmedium.
Und schließlich füllt den zweiten Teil des Buchs eine vorläufige Diskographie der “Small Label Goodman Releases”. Das alles ist etwas für hartgesottene Goodman-Sammler – für die aber ist es ein Muss, genauso wie die Vorgängerbände von Connors.
Für alle anderen ist auch dieses Buch ein Beleg für die Bedeutung der durchaus wissenschaftlichen Arbeit, die im Jazz von Fans geleistet wird und die in der klassischen Musikwissenschaft als “Werkverzeichnis” leicht zu akademischen Ehren führen könnte.
Wolfram Knauer (Februar 2012)
The History of Jazz
Von Ted Gioia
New York 2011 (Oxford University Press)
444 Seiten, 19,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-539970-7
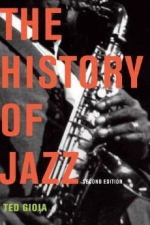 Ted Gioias “Geschichte des Jazz” ist ein umfassendes Werk, dass die Entwicklung dieser Musik von den Anfängen (er nennt es die “Africanization of American Music”) bis ins 21ste Jahrhundert verfolgt, die wichtigsten Protagonisten nennt und in kurzen Absätzen diskutiert, ästhetische Entwicklungen erklärt und in Zusammenhang mit dem allgemeinen Musikbusiness genauso wie mit sozialen Entwicklungen in den USA bringt und zwischendrin noch versucht, die Musik zumindest zu beschreiben, um die es eigentlich geht. Die erste Ausgabe dieses Buchs wurde zu einem Bestseller der Jazzliteratur in den USA und an Schulen wie Hochschulen als Text Book benutzt – obwohl sich dort vielleicht ein analytischer in die Materie sich versenkendes Buch noch mehr lohnen würde.
Ted Gioias “Geschichte des Jazz” ist ein umfassendes Werk, dass die Entwicklung dieser Musik von den Anfängen (er nennt es die “Africanization of American Music”) bis ins 21ste Jahrhundert verfolgt, die wichtigsten Protagonisten nennt und in kurzen Absätzen diskutiert, ästhetische Entwicklungen erklärt und in Zusammenhang mit dem allgemeinen Musikbusiness genauso wie mit sozialen Entwicklungen in den USA bringt und zwischendrin noch versucht, die Musik zumindest zu beschreiben, um die es eigentlich geht. Die erste Ausgabe dieses Buchs wurde zu einem Bestseller der Jazzliteratur in den USA und an Schulen wie Hochschulen als Text Book benutzt – obwohl sich dort vielleicht ein analytischer in die Materie sich versenkendes Buch noch mehr lohnen würde.
Die Kapitelübersicht macht Gioias Ansatz deutlich: “The Prehistory of Jazz”, “New Orleans Jazz”, “The Jazz Age”, “Harlem”, “The Swing Era”, “Modern Jazz”, “The Fragmentation of Jazz Styles”, “Free and Fusion”, “Traditionalists and Postmodernists” sowie “Jazz in the New Millennium”. Als Anhang finden sich Hör- genauso wie Leseempfehlungen.
Gioia präsentiert Fakten, hinterfragt Mythen, erklärt Beweggründe für den Wandel der Musik, ordnet die musikalische Entwicklung des Jazz in die soziale, wirtschaftliche politische Entwicklung der Vereinigten Staaten ein. Musikalische Details beschränken sich auf kurze Ablauf- oder Klangbeschreibungen, die er allerdings geschickt genug einsetzt, um auch dem nicht musikbewanderten Leser Besonderheiten verschiedener Zeit- und Personalstile erklären zu können.
Wie in jedem Geschichtsbuch wird man auch bei Gioia anfangen können zu kritisieren: Warum diesen, warum nicht jenen Musiker? Die Fakten sind ja alle bekannt, hier kann Gioia vor allem seine Sicht der Zusammenhänge präsentieren. Am interessantesten ist bei solchen Büchern erfahrungsgemäß der Umgang mit den jüngsten Entwicklungen. “Traditionalists and Postmodernists” ist das Kapitel überschrieben, in dem Gioia aus irgendeinem Grunde die Szene um Wynton Marsalis dem sehr viel früher begründeten AACM-Lager gegenüberstellt; die New Yorker Downtownszene zwar erwähnt, aber ihre tatsächliche Bezogenheit auf die Neotraditionalisten nicht ausreichend erklärt. “Jazz in the New Millenium” schließlich nennt einige der erfolgreichen Musikernamen der letzten zehn Jahre, um dann in einem Unterkapitel die “Globalization” of Jazz” festzustellen und hier (außer einem früheren Bezug auf Django Reinhardt) zum ersten Mal auch die europäischen Entwicklungen zu thematisieren. Solch eine amerikano-zentrische Sichtweise kann man Gioia wohl kaum vorwerfen – die Tatsache, dass diese Parallelentwicklungen der Jazzgeschichte noch nicht ausreichend – also zusammenfassend und in englischer Sprache – verschriftlicht wurden, erklärt leider immer noch die weitgehende amerikanische Negierung dessen, was nunmehr seit über vierzig Jahren in Europa an ganz eigenständigen Entwicklungen geschieht.
Ted Gioias “History of Jazz” ist auf jeden Fall eine sehr brauchbare Zusammenfassung der amerikanischen Jazzgeschichte. Andere (etwa Berendt) mögen in ihrem Ansatz gliedernder und damit insbesondere für den Jazzneuling hilfreicher sein, aber Gioia überzeugt vor allem in der dauernden Überlagerung biographischer, musikalischer, sozialgeschichtlicher Erklärstränge.
Wolfram Knauer (Januar 2012)
Lightnin’ Hopkins. His Life and Blues
von Alan Govenar
Chicago 2010 (Chicago Review Press)
334 Seiten, 28,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-55652-962-7
 Der Blues ist vordergründig eine der persönlichsten Musikstile, die man sich vorstellen kann, handelt er doch von vermeintlich Selbst-Erlebtem, vom offen gelegten emotionalen Grenzsituationen. Tatsächlich ist der Bluessänger aber ein Griot seiner Tage; seine Texte stehen nicht nur für ihn, sondern für so viele, die sich mit ihnen identifizieren und aus dem Aussprechen des täglichen Leids Kraft ziehen können. Alan Govenar hat die Biographie eines der am meisten aufgenommenen Blueskünstler des 20sten Jahrhunderts geschrieben und bietet dem Leser damit Einblick in die persönlichen Erfahrungen, die Hopkins mit in seine Musik einbringen konnte.
Der Blues ist vordergründig eine der persönlichsten Musikstile, die man sich vorstellen kann, handelt er doch von vermeintlich Selbst-Erlebtem, vom offen gelegten emotionalen Grenzsituationen. Tatsächlich ist der Bluessänger aber ein Griot seiner Tage; seine Texte stehen nicht nur für ihn, sondern für so viele, die sich mit ihnen identifizieren und aus dem Aussprechen des täglichen Leids Kraft ziehen können. Alan Govenar hat die Biographie eines der am meisten aufgenommenen Blueskünstler des 20sten Jahrhunderts geschrieben und bietet dem Leser damit Einblick in die persönlichen Erfahrungen, die Hopkins mit in seine Musik einbringen konnte.
1929 in eine arme Farmpächterfamilie in Texas geboren, verließ Hopkins bereits mit acht Jahren sein Zuhause, verdiente sich sein Geld als Straßenmusikant oder Gelegenheitsarbeiter. Seine ersten Aufnahmen machte er erst 1946, als er auch seinen Spitznamen “Lightnin'” erhielt. Seine Platten führten die R&B Charts an, aber dann wurde er wieder vergessen, bis er 1959 “wiederentdeckt” wurde und die Bürgerrechtsbewegung mit seinen emotionalen Liedern begleitete.
Govenar macht sich auf die Spurensuche, nachdem er selbst Hopkins 1974 ein einziges Mal in einem Konzert gehört und nachdem Chris Strachwitz, der Gründer des Arhoolie-Labels, ihn auf die Bedeutung dieses Musikers aufmerksam gemacht hatte. Anfangs verzweifelte er mit seinen Recherchen fast, als ihm Hopkins Manager und seine langjährige Lebensgefährtin jegliches Interview verweigerten; dann machte er sich auf nach Texas und traf im Geburtsort des Gitarristen und Sängers tatsächlich auf entfernte Verwandte und Kindheitsfreunde. Ihm gelingt es im Verlauf seines Buchs, die Mythen und Erinnerungen auseinanderzudröseln, die Hopkins selbst in Interviews oder auch in seiner Musik zu erzählen pflegte, und die über ihn kursierten.
Man weiß wenig über Sam “Lightnin'” Hopkins’ Kindheit, und Govenar muss sich hier vor allem auf andere Quellen verlassen, um die Geschichten zu verifizieren oder wenigstens in die Realität der Zeit einzupassen, etwa die von Hopkins selbst erzählte von seinem Großvater, der sich als Sklave erhängt hätte, weil er es nicht mehr aushielt, laufend bestraft zu werden. Hopkins Vater starb, als der Sohn 3 Jahre alt war. Sam schaute sich die Technik des Gitarrespielens von seinen älteren Brüdern und anderen Musikern des Dorfes ab. Govenar beschreibt die Bildungsmöglichkeiten und die Zwänge der Feldarbeit in jener Zeit, aber auch die Square Dances, die Hopkins in seinem Dorf erlebte. Mit acht Jahren traf er auf Blind Lemon Jefferson, der ihn in seinem Spiel ermutigte. Der Junge erahnte, dass die Musik eine Chance sein könnte, sich aus dem Leben eines Sharecroppers zu befreien.
Man weiß nicht genau, aus welchem Grunde Hopkins in den 1930er Jahren ins Gefängnis kam, aber später berichtete er in Wort und Blueslyrics von den Chain Gangs, wenn auch Govenar feststellt, dass seine Texte für einen Mann, der so oft im Gefängnis war, etwas reichlich unoriginell seien. Etwa gegen Mitte der 1930er Jahre traf Hopkins in Dallas auf den Bluessänger Texas Alexander, der bereits etliche Aufnahmen gemacht hatte und ihm zeigte, dass man durchaus auch von der Musik allein leben konnte. Govenar zeichnet daneben auch Einflüsse von Alexanders Stil in Hopkins’ späteren Aufnahmen nach.
Mitte der 1940er Jahre zog Hopkins nach Houston, und auch hier beschreibt Govenar eingehend die soziale und wirtschaftliche Lage, in der sich insbesondere die schwarze Bevölkerung in der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts befand. Er baut eine neuen Karriere auf und wird erstmals öffentlich wahrgenommen, vor allem natürlich, weil nun, 1946, erste Plattenaufnahmen von ihm erscheinen. Hier hat Govenar nun richtige Quellen, die er unter die Lupe nehmen kann: Bluestexte, die es gilt mit der Realität zu vergleichen, Kontorbücher, die Gagen für die Plattenaufnahmen auflisten, und Zeitzeugenberichte, die er immer mehr einführt – auch weil für die aktive Aufnahmezeit des Gitarristen einfach mehr Zeitzeugen zu finden waren als für seinen frühen Jahre. Er fragt nach den Medien, denen sich der Blues in jener Zeit bediente, und wie die Musik an ihre (vor allem schwarzen) Hörer kam.
1959 wurde Hopkins von Samuel Charters wiederentdeckt, der in einem Hinterzimmer u nd mit einem portablen Aufnahmegerät Aufnahmen vor allem alter Bluessongs machte. Auch Mack McCormick und Chris Strachwitz gehörten zu den Produzenten-Unterstützern Hopkins’, die seiner Karriere letztendlich zu einem neuen Schub verhalfen. McCormick ermutigte ihn bei seinen Aufnahmesitzungen zu singen, was immer ihm in den Sinn kam, nicht also marktorientierte, sondern möglichst persönliche Statements abzuliefern. Hopkins war ein Improvisator durch und durch, der viele seiner Stücke aus dem Stegreif dichtete.
Die 1960er Jahren brachten sowohl in den USA wie auch in Europa ein Blues-Revival, und Govenar beleuchtet die Menschen hinter dieser Bewegung, ihre Beweggründe und ihre Strategien. Hopkins tourte in den Vereinigten Staaten genauso wie in Europa und in den 1970er Jahren sogar in Japan, wenn er auch im Third Ward in Houston wohnen blieb. Gesundheitliche Probleme nahmen zu, und am 30. Januar 1982 verstarb Hopkins im Alter von 70 Jahren.
Eine von Andrew Brown und Alan Balfour zusammengestellte ausführliche Diskographie ergänzt das Buch. Govenars Biographie gelingt es überaus lesenswert, das Leben und das Werk des Gitarristen und Sängers zu beleuchten, Mythen und Realität zu analysieren und aus der Lichtgestalt des Bluesheroen den Menschen Sam Hopkins herauszuschälen.
Wolfram Knauer (Januar 2012)
Improvisieren. Paradoxien des Unvorhersehbaren. Kunst – Medien – Praxis
herausgegeben von Hans-Friedrich Bormann & Gabriele Brandstetter & Annemarie Matzke
Bielefeld 2010 (transcript)
238 Seiten, 26,80 Euro
ISBN: 978-3-8376-1274-5
 Wir Jazzer sehen die Improvisation natürlich als unser ureigenes Feld an; der Jazz schließlich ist diejenige westliche Kunst, in der Improvisation am stärksten zum Prinzip erhoben und am meisten gefeiert wurde. Das vorliegende Buch streift das große Feld der jazzmusikalischen Improvisation eher am Rande, etwa im Beitrag von Christopher Dell, der in seinem Vortrag bei der Tagung an der Freien Universität in Berlin, die Anlass für die hier abgedruckten Texte war, auch gleich selbst improvisierte – im Gegensatz zu den dort “komponierten” (spricht vorgefertigten und abgelesenen) Referate der übrigen Autoren.
Wir Jazzer sehen die Improvisation natürlich als unser ureigenes Feld an; der Jazz schließlich ist diejenige westliche Kunst, in der Improvisation am stärksten zum Prinzip erhoben und am meisten gefeiert wurde. Das vorliegende Buch streift das große Feld der jazzmusikalischen Improvisation eher am Rande, etwa im Beitrag von Christopher Dell, der in seinem Vortrag bei der Tagung an der Freien Universität in Berlin, die Anlass für die hier abgedruckten Texte war, auch gleich selbst improvisierte – im Gegensatz zu den dort “komponierten” (spricht vorgefertigten und abgelesenen) Referate der übrigen Autoren.
Es geht, kurz gesagt, um das Improvisieren in diversen künstlerischen und kulturellen Zusammenhängen, die man mit dem Phänomen der Improvisation mal mehr, mal weniger verbindet. Georg W. Bertram beginnt mit einem allgemeinen Blick auf Improvisation im Alltag und in der Sprache. Roland Borgards untersucht Texte von Thomas Mann und Hugo Ball, die die Improvisation zum Thema haben, und zwar nicht nur der eigentlichen Texte, sondern auch der Textkreation.
Edgar Landgraf schaut historisch auf die Improvisation auf der Theaterbühne zwischen Commedia dell’arte und dem frühromantischen Konzept des Universallustspiels. Sandro Zanetti holt noch weiter aus und betrachtet Improvisation vor dem Hintergrund der antiken Rhetorik und der romantischen Literatur. Markus Krajewski schaut genauer auf den Butler in “Dinner for One” und fragt nach dem Verhältnis von Routine und Improvisation in dessen Handeln.
Annemarie Matzke betrachtet die Funktion der Improvisation im Schauspiel, und Gabriele Brandstetter sowie Friedrike Lampert schauen auf die Bedeutung von Improvisation in der künstlerischen Tanzpraxis. Schließlich beleuchtet Kai van Eikels die beliebten Übersetzungen der Improvisation, wie sie etwa im Jazz stattfindet, auf Organisationstheorien.
Improvisation, das lernt mal schnell in diesem Buch, ist weitaus mehr als das, was wir uns gemeinhin darunter vorstellen, egal ob wir aus dem Jazz kommen oder meinen, jeder improvisiere doch eigentlich immer. Weder unfertig noch vollkommen ungeplant, ist das Prinzip der Improvisation letztlich ein Zurückgreifen auf Erlerntes und Erfahrenes, die Fähigkeit schnellstens Entscheidungen zu treffen, die alles ändern können, das Ziel also sowohl im Blick zu behalten wie auch nicht als ultimatives Ziel zu sehen.
Wolfram Knauer (Januar 2012)
Unfinished Blues. Memories of a New Orleans Music Man
Von Harold Battiste Jr. (& Karen Celestan)
New Orleans 2010 (Historic New Orleans Collecion)
197 Seiten, 28,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-917860-55-3
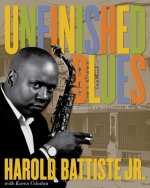 Harold Batiste war zusammen mit Alvin Batiste, Ellis Marsalis, Ed Blackwell und einigen anderen Musikern die moderne Jazzstimme im New Orleans der frühen 1950er Jahre. Mit Marsalis zusammen etablierte er weit später das Jazz Studies Program an der University of New Orleans. In seiner Autobiographie erzählt er seine Geschichte, die von New Orleans nach Los Angeles führt, vom Jazz zum Geschäft mit der Popmusik und zurück.
Harold Batiste war zusammen mit Alvin Batiste, Ellis Marsalis, Ed Blackwell und einigen anderen Musikern die moderne Jazzstimme im New Orleans der frühen 1950er Jahre. Mit Marsalis zusammen etablierte er weit später das Jazz Studies Program an der University of New Orleans. In seiner Autobiographie erzählt er seine Geschichte, die von New Orleans nach Los Angeles führt, vom Jazz zum Geschäft mit der Popmusik und zurück.
Battiste wurde im Herbst 1931 in New Orleans geboren. Das Buch berichtet über die Stadt seiner Kindheit, das Leben in verschiedenen Vierteln und in einem sozialen Wohnungsbauprojekt, über seine erste Metallklarinette, die ihm sein Vater in einem Leihhaus kaufte. Mit elf oder zwölf arbeitete er als Hilfskraft im Dew Drop Inn, wo er jede Menge schwarzer Popkultur hautnah erlebte. Er ging auf die Gilbert Academy, eine High School, in der er seinen ersten richtigen Musikunterricht erhielt und in der Schulband spielte. Später besuchte er die Dillard University und spielte auch dort in der Hochschul-Tanzkapelle. Sein Studienziel war es, staatlich geprüfter Musiklehrer zu werden.
Mit 18 hatte Battiste seinen ersten richtigen Gig im Orchester des Pianisten Joe Jones, das vor allem Kaufarrangements populärer Bigbandnummern etwa von Stan Kenton spielte. Er heiratete, unterrichtete eine Weile, war aber vom Schulsystem so frustriert, dass er seinen Job kündigte und zusammen mit seinen Kumpanen Ed Blackwell, Richard Payne und Ellis Marsalis an die amerikanische Westküste zog, wohin er wenig später auch seine Familie nachkommen ließ. Einige der Musiker (insbesondere Blackwell) spielten mit Ornette Coleman; Battiste aber begann bald seine zweite Karriere, als er nämlich die erste Hitsingle von Sam Cooke arrangierte und produzierte. Bald darauf kam er auch mit Salvatore Bono zusammen, der wenig später mit der Sängerin Cher als Sonny & Cher Karriere machen sollte.
Die folgenden Kapitel behandeln das Music Business der späten 1950er, frühen 1960er Jahre, R&B-Gruppen, mit denen Battiste zusammenarbeitete, aber auch das Label A.F.O. Records, das er in New Orleans gründete und auf dem er etliche seiner Entdeckungen herausbrachte, unter ihnen etwa Barbara George, die mit “I Know (You Don’t Love Me No More)” einen großen Hit hatte. Mit Sonny & Cher arbeitete er von den 1960er bis in die 1980er Jahre; und neben der Beschreibung seiner Arbeit erzählt er dabei durchaus auch von Copyright-Knebelverträgen, die Battistes Namen aus den Kompositionen und Arrangements strichen, die er gefertigt hatte.
1967 produzierte er ein Album mit Mac Rebennack, der bald darauf als Dr. John bekannt werden sollte. Battiste ist mittlerweile ein gemachter Mann, besitzt ein großes Haus, ein großes Auto, hat Erfolg auf der ganzen Linie. Er pendelt zwischen New Orleans und Los Angeles, produziert unzählige Projekte. Er wird musikalischer Leiter der populären Sonny & Cher TV-Show, für die er alle Arrangements fertigt. 1976 gründete er ein neues Label, Opus 43, tut sich mit Ellis Marsalis zusammen und nimmt das erste Album auf, das Ellis mit seinen Söhnen Wynton und Branford einspielte (das aber nie veröffentlicht wurde).
Die letzten Kapitel des Buchs widmen sich den Aktivitäten, mit denen Battiste seiner Heimatstadt etwas von dem zurückgeben will, was er musikalisch von ihr erhalten hatte: Wir lesen etwa von der Gründung der National Association of New Orleans Musicians und von Konzepten für eine bessere Einbindung des Jazz in den Schulunterricht. Nebenbei erfahren wir aber auch über seine Scheidung, die zum Verlust seines Hauses und seines Vermögens führte und auch dazu, dass er mit 58 Jahren eine neue Karriere als Dozent an der University of New Orleans begann / beginnen musste.
Alles in allem ist “Unfinished Blues” eine umfangreiche Autobiographie, die sich manchmal in zu viel Details verliert und der man insbesondere in der Geschichte des Privatlebens deutlich die Verletztheit des Autors anmerkt. Nichtsdestotrotz gibt das Buch einen ungemein interessanten Einblick ins Leben und Überleben eines schwarzen Musikers zwischen Jazz und Kommerz und seine musikalischen wie ästhetischen und spirituellen Werte. Es zeigt zudem unzählige Fotos, die die Stories quasi erlebbar machen, jene Geschichte vom Aufstieg eines Musikers zum Popproduzenten, von seinem Fall, von Neubesinnung und Neufindung.
Wolfram Knauer (Januar 2012)
Speak Jazzmen. 55 interviews with jazz musicians
von Guido Michelone
Milano 2010 (EDUCatt)
212 Seiten, 11 Euro
ISBN: 978-88-8311-753-4
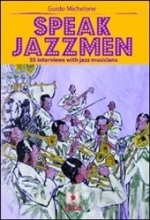 Guido Michelone ist ein fleißiger italienischer Jazzkritiker, der regelmäßig für die diversen Fachzeitschriften seines Landes schreibt, außerdem Jazzgeschichtskurse an der Universität von Mailand gibt. Aus den Schubladen seines Schreibtischs hat er für das vorliegende Buch fünfundfünfzig Interviews ausgesucht, die er in den letzten Jahren mit amerikanischen und europäischen (allerdings nicht mit italienischen) Musikern führte. Anlass der auf Englisch abgedruckten Interviews war meist entweder das Erscheinen eines neuen Albums des betreffenden Künstlers oder eine bevorstehende Italientournee.
Guido Michelone ist ein fleißiger italienischer Jazzkritiker, der regelmäßig für die diversen Fachzeitschriften seines Landes schreibt, außerdem Jazzgeschichtskurse an der Universität von Mailand gibt. Aus den Schubladen seines Schreibtischs hat er für das vorliegende Buch fünfundfünfzig Interviews ausgesucht, die er in den letzten Jahren mit amerikanischen und europäischen (allerdings nicht mit italienischen) Musikern führte. Anlass der auf Englisch abgedruckten Interviews war meist entweder das Erscheinen eines neuen Albums des betreffenden Künstlers oder eine bevorstehende Italientournee.
Unter den Gesprächspartnern sind bekannte Namen wie Don Byron, Billy Cobham, Steve Lacy, Hugh Masekela, Greg Osby, Joshua Redman, Trevor Watts, Lenny White genauso wie der breiten Öffentlichkeit nicht ganz so bekannte Namen, etwa Theo Bleckmann, Antonio Ciacca, Khari B., Tony lakatos, Martin Mayes, Brett Sroka, Torben Walldorf (aber auch Daniel Schnyder, nicht “Scheyder” und Jeremy Pelt, nicht “Pelz”, um gleich mal zwei der falsch geschriebenen Namen zu korrigieren).
Die meisten der Gespräche sind dabei eher kurz; etliche nur ein oder zwei Seiten lang. Immer wieder liest man Standardfragen wie “Was bedeutet der Jazz für Sie?” oder “Wer waren Ihre wichtigsten Einflüsse?”. Ab und an spricht Michelone auch den Unterschied zwischen europäischem und amerikanischem Jazz an, fragt aber selten nach.
Wie sollte er allerdings auch nachfragen? Viele der Interviews nämlich wurden per e-mail geführt. Im Vorwort lobt Michelone die Gedankentiefe der Antworten, vergibt sich bei der gewählten Technik des Mailinterviews allerdings die Möglichkeit der tatsächlichen Vertiefung. So werden viele Themen oft nur angeschnitten. Einige der Fragen wirken zudem hilflos, etwa wenn Michelone Vijay Iyer fragt, wie viele indische Sprachen er denn spräche (Antwort: nur Englisch und ein wenig Französisch).
Alles in allem finden sich durchaus interessante Aussagen in diesem Buch — die Beliebigkeit der Interviews, und die unterschiedliche Tiefe der Gespräche macht es allerdings zu einer wechselvollen Lektüre, der ein wenig editorisches Geschick gut getan hätte, wenn beispielsweise die Gespräche jeweils mit einleitenden oder beschließenden Worten kommentiert und eingeordnet worden wären.
Wolfram Knauer (Januar 2012)
The Comedian Harmonists. The Last Great Jewish Performers in Nazi Germany
von Douglas A. Friedman
West Long Branch/NJ 2010 (HarmonySongs Publications)
306 Seiten, 22,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-9713979-1-0
 Die Comedian Harmonists sind bis heute bekannt als eine der populärsten Vokalgruppen des frühen 20sten Jahrhunderts. Sie sind ins deutsche Kulturgut eingegraben wie sonst kaum ein populäres Ensemble, durch Loriot-Cartoons, Nachahm-Bands oder den Ende der 1990er Jahren in die Kinos gekommenen Spielfilm “The Harmonists”, der auf ihrer Geschichte basiert. Douglas Friedman hat sich nach seiner Pensionierung als Vizepräsident einer erfolgreichen amerikanischen Energiefirma an die Arbeit gemacht, die Geschichte des Vokalensembles zu recherchieren. Ihn interessierte der musikalische Kontext des Vokalquintetts dabei genauso wie der soziale, die Verfolgung der jüdischen Sänger und Musiker durch die Nazis.
Die Comedian Harmonists sind bis heute bekannt als eine der populärsten Vokalgruppen des frühen 20sten Jahrhunderts. Sie sind ins deutsche Kulturgut eingegraben wie sonst kaum ein populäres Ensemble, durch Loriot-Cartoons, Nachahm-Bands oder den Ende der 1990er Jahren in die Kinos gekommenen Spielfilm “The Harmonists”, der auf ihrer Geschichte basiert. Douglas Friedman hat sich nach seiner Pensionierung als Vizepräsident einer erfolgreichen amerikanischen Energiefirma an die Arbeit gemacht, die Geschichte des Vokalensembles zu recherchieren. Ihn interessierte der musikalische Kontext des Vokalquintetts dabei genauso wie der soziale, die Verfolgung der jüdischen Sänger und Musiker durch die Nazis.
Sein Buch beginnt mit der Faszination des jungen Harry Frommermann durch Aufnahmen des amerikanischen Vokalquintetts Revelers. Frommermann schrieb eigene Arrangements und schaltete eine Kleinanzeige im Berliner Lokal-Anzeiger, in der er nach “schönklingenden Stimmen” suchte. Im Januar 1928 hatte er die Band zusammen, die er Melody Makers nannte. Friedman rekapituliert die Biographien der Mitglieder: Harry Frommermann, Robert Biberti, Ari Leschnikoff, Roman Cycowski, Erich Collin sowie anderer, kurzfristig mit der Band arbeitender Musiker. Er beschreibt die Probenphase durchs Jahr 1928, das Vorsingen im Scala Club und den Vorschlag des Musikmanagers Eric Charrell, die Band in Comedian Harmonists umzutaufen. Im August nahm das Quintet mit Pianisten seine ersten Schallplatten auf und war sofort ein Riesenerfolg sowohl in Charrells Revue wie auch auf Platte. 1929 tourten die sechs durch Deutschland, 1930 waren sie bereits weit europaweit populär. Hits wie “Ein kleiner grüner Kaktus” oder “Veronika, der Lenz ist da” brachten dabei Optimismus in die Stimmung der Weimarer Republik, eine scheinbar perfekte Paarung des swingend intonierten amerikanischen Jazz mit deutschem Schlager der Zeit.
Friedmann verfolgt die Karriere der Band genauso wie persönliche Schicksale, Liebschaften, Hochzeiten, Erfolge, Nachahmer, Konkurrenten. 1933 kamen die Nazis an die Macht, und mit einem Mal wurde es schwierig für die jüdischen Mitglieder der Comedian Harmonists, spätestens als diesen mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 jede Arbeitsmöglichkeit genommen wurde. Das Ensemble teilte sich in eine Wiener Gruppe und ein Berliner Ensemble. Die Wiener Band ging bald auf internationale Tournee, spielte in Australien, Südamerika, Kanada und den USA. Als Hitler Polen überfiel, war diese Band gerade in Sydney, und in den Kriegswirren löste sich das Ensemble 1940 auf – zu sehr hatten die einzelnen Mitglieder mit unterschiedlichen Nachrichten aus der Heimat zu kämpfen.
In Deutschland hatte die andere Hälfte der Harmonists sich unter dem Namen Meistersextett neu gegründet, konnte aber an den Erfolg der früheren Besetzung nicht wirklich anknüpfen und musste außerdem mit Schwierigkeiten durch die Reichsmusikkammer kämpfen, die in Repertoire und Auftreten Mitspracherecht anmeldete. Die Band zerstritt sich insbesondere mit Biberti und löste sich 1941 auf. Im letzten Teil seines Textes schließlich folgt Friedman den Biographien der früheren Comedian Harmonists-Mitglieder von Kriegsende bis zu ihrem Ableben.
Friedman bezieht sich auf Quellen im Nachlass Robert Bibertis an der Staatsbibliothek Berlin sowie auf Zitate aus der 1976 gedrehten Fernsehdokumentation über die Band. Seine Recherche muss man sich dabei etwas mühsam vorstellen, denn der Autor spricht kein Deutsch und musste sich grundsätzlich auf englische Übersetzungen oder Untertitel verlassen. Letzten Endes kann er so kaum originäre Recherchen aufweisen sondern vor allem referieren, was anderswo bereits zusammengetragen wurde. Das tut dem Fleiß seiner Arbeit aber keinen Abbruch, insbesondere, wenn man den umfangreichen (mehr als 100 Seiten starken) Anhang des Buchs aufblättert, der eine genaue Timeline der Band enthält, eine komplette Diskographie sowie eine Auflistung aller bekannten Konzerte mit Anmerkungen zu Gagenhöhe oder anderen Besonderheiten. Schließlich findet sich hier auch eine Repertoireliste anhand von Programmen ausgewählter Konzerte über die Jahre, eine Filmographie, eine Liste von den Harmonists gesungener, aber nie auf Schallplatte eingespielter Titel sowie die obligatorische Literaturliste (die sich im Vergleich zu den anderen Teilen des Anhangs ein wenig dürftig ausmacht).
Alles in allem: eine hoch willkommene Zusammenfassung der biographischen und Karrieregeschichte der Comedian Harmonists, in der sich wenig über die Musik selbst findet, dafür jede Menge Information zur Lebenswirklichkeit eines Starensembles in den dunklen Jahren der Nazizeit. Insbesondere die Anhänge machen das Buch auch für Forscher zu einer hilfreichen Quelle.
Wolfram Knauer (Dezember 2011)
The Big Love. Life & Death with Bill Evans
von Laurie Verchomin
Kanada 2010 (Selbstverlag)
144 Seiten, 19,59 US-Dollar
ISBN: 978-1-456563097
 Jazzmusiker sind zuallererst – Musiker. Aber natürlich sind sie genauso Menschen wie wir alle, Menschen, die versuchen eine Balance aus Arbeit und Leben zu finden, aus Pflicht und Vergnügen, aus Ernsthaftigkeit und Liebe. Vom Privatleben eines der ganz großen Jazzmusiker handelt dieses Buch, und dabei vor allem von der Liebe. Der Autorin widmete Bill Evans seine Komposition “Laurie”, die gegen Ende seines Lebens fester Bestandteil seines Bühnenrepertoires war. “For Laurie who inspired this song with love – Bill”, schreibt Evans auf die Kompositionsnotiz, die Verchomin in ihrem Buch abdruckt und die ihn auf ewig mit ihr verbunden habe.
Jazzmusiker sind zuallererst – Musiker. Aber natürlich sind sie genauso Menschen wie wir alle, Menschen, die versuchen eine Balance aus Arbeit und Leben zu finden, aus Pflicht und Vergnügen, aus Ernsthaftigkeit und Liebe. Vom Privatleben eines der ganz großen Jazzmusiker handelt dieses Buch, und dabei vor allem von der Liebe. Der Autorin widmete Bill Evans seine Komposition “Laurie”, die gegen Ende seines Lebens fester Bestandteil seines Bühnenrepertoires war. “For Laurie who inspired this song with love – Bill”, schreibt Evans auf die Kompositionsnotiz, die Verchomin in ihrem Buch abdruckt und die ihn auf ewig mit ihr verbunden habe.
Gleich das Eingangskapitel trifft ins Mark: Laurie Verchomin erzählt, wie Evans am 15. September 1980 in seine Methadonklinik fahren will, um sich mit seinem Arzt zu beraten. Joe LaBarbera fährt sie nach Midtown-Manhattan, und mitten im Gespräch beginnt Evans Blut zu husten. Sie schaffen es noch in die Notaufnahme, doch Evans ist nicht mehr zu retten.
Rückblende: Mitte der 1970er Jahre geht die junge Laurie Verchomin aus Edmonton in Kanada nach New York, mietet ein billiges Hotelzimmer und schreibt sich für Unterricht in einer Schauspielschule ein. Zurück in Edmonton versucht sie ihr Liebesleben neu zu ordnen und jobbt nebenbei als Kellnerin. Bei einem Konzert des Bill Evans Trios, bei dem sie kellnert, lernt sie den Pianisten kennen. Sie schreiben sich, sie teilen sich das Kokain, sie besucht ihn in seiner kleinen Wohnung in Fort Lee, New Jersey. Eindringlich, überaus offen und höchst persönlich erzählt Verchomin von ihrem Eintauchen in eine Welt, die so ganz anders ist als das heimatliche Edmonton. Liebe, Sex, Kokain, Drinks, Schallplatten, Evans’ Ehefrau Nenette, die sie über seine Reihe an Liebschaften aufklärt… Verchomin erzählt über ihre Ängste, für ihn und vor seiner Sucht. Inzwischen ist sie nach Edmonton zurückgekehrt, besucht ihn bei Konzerten in Toronto, begleitet ihn nach Chicago. Zwischendurch erfahren wir von kokaingetränkten Abenden mit Dennis Hopper, vom Village Vanguard, ihrer Rückkehr nach Edmonton. In seiner Wohnung schwadroniert Evans davon, von der CIA überwacht zu werden, und Laurie akzeptiert seine Paranoia, worauf Evans sie schließlich einlädt, ganz zu ihm zu ziehen. Sie erzählt von Auseinandersetzungen mit Bills Agentin und von der Anziehungskraft eines von Drogen zerfressenen Körpers. Sie besucht ihn während eines Gigs in London; wieder zurück in den USA holt sie ihn vom Flughafen ab, beschreibt, wie ausgelaugt, offensichtlich krank und fertig er auf sie wirkte. Wir werden Teil der Szenen eines Musikerlebens: Gigs, Talk-Shows, Hotelzimmer, Flugtickets, Warten, Reisen, Spielen. Und dann… der 15. September 1980, Mount Sinai Hospital: “We couldn’t save him”.
Laurie Verchomins Buch ist vielleicht eines der persönlichsten Bücher über einen Jazzmusiker. Die Autorin ist schonungslos offen, und stellenweise weiß man nicht, mit wem man mehr mitleiden soll: dem sensiblen, schwerkranken Evans oder Laurie, die von der Liebe in eine Beziehung getragen wird, die so viel mehr an Kraft verlangt, als sie je geahnt hatte. Man legt das Buch aus der Hand mit einem beklemmenden Gefühl, aber auch ahnend, dass man das alles bereits wusste, weil Bill Evans es uns in seiner Musik offen legte, in der diese Sensibilität und Verletzlichkeit doch so deutlich durchscheint. Anderthalb Jahre begleitete Verchomin den Pianisten, auch auf seiner letzten Reise. Ihr Buch ist eine persönliche Hommage an das Vermächtnis eines genialen Musikers, der selbst im Leiden und Wissen um den bevorstehenden Tod so viel an Kraft in die Schönheit der Musik steckte. Ihr Buch schildert eine wahrhafte Tragödie, das Zugrundegehen eines Künstlers, und dennoch liest man es mit liebevollem Gesicht – weil wir alle, die wir Bill Evans hören durften, von ebendieser Kraft musikalischer Schönheit zehren konnten und bis heute zehren können.
Wolfram Knauer (Oktober 2011)
freebag…? Jazz i Norge 1960-1970
von Bjørn Stendahl
Oslo 2010 (Norsk Jazzarkiv)
613 Seiten, 450 Norwegische Kronen
ISBN: 978-82-90727-14-2
 Bjørn Stendahls Geschichte des Jazz in Norwegen in den 1960er Jahren ist der mittlerweile vierte Band einer Reihe des Norwegischen Jazzarchivs über die Jazzgeschichte des Landes. Der Umfang des Buchs, der die früheren Bände bei weitem übertrifft, macht klar, dass es sich bei diesem Jahrzehnt um ein entscheidendes handelt: das Jahrzehnt dr Bewusstwerdung, dass Jazz für norwegische Musiker nicht mehr länger ein Feld der Nachahmung amerikanischer Idole war, sondern die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken.
Bjørn Stendahls Geschichte des Jazz in Norwegen in den 1960er Jahren ist der mittlerweile vierte Band einer Reihe des Norwegischen Jazzarchivs über die Jazzgeschichte des Landes. Der Umfang des Buchs, der die früheren Bände bei weitem übertrifft, macht klar, dass es sich bei diesem Jahrzehnt um ein entscheidendes handelt: das Jahrzehnt dr Bewusstwerdung, dass Jazz für norwegische Musiker nicht mehr länger ein Feld der Nachahmung amerikanischer Idole war, sondern die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken.
Stendahl befasst sich in seinen eingehenden Recherchen mit Lokal- und Regionalszenen, mit auch in Skandinavien abgehaltenen stilistischen Grabenkämpfen zwischen Traditionalisten und Modernisten, mit den Vertriebswegen des Jazz über Radio, Fernsehen, Film, Presse und natürlich die Schallplatte, mit Clubs, Festivals und Musikerverbänden, mit der Struktur also einer sich organisierenden Szene. Das geht zum Teil schon sehr ins Detail, so dass das Buch wohl vor allem als Nachschlagewerk zu nutzen ist, in dem man blättert, um einzelne Episoden herauszugreifen, die im register leicht ansteuerbar sind. 613 Seiten im Stück zu lesen, das wird wohl kaum einer tun, auch wenn es sich lohnt, da Stendahl immer wieder spannende Fundstücke einschließt, Interviewschnipsel etwa, beispielhafte Club- und Festivalprogramme, Besetzungen und vieles mehr. Und natürlich gibt es Fotos zuhauf.
Fakten erfährt man also jede Menge, über musikalische Inhalte allerdings schweigt sich Stendahl meist aus. Zu Jan Garbareks Entwicklung etwa finden sich Auftrittsdaten nebst Besetzungen und parallel auftretenden Bands, über seine musikalische Ästhetik aber erfährt man eher nebenbei, in knappen Zitaten aus zeitgenössischen Rezensionen. Mehr aber war wohl auch nicht Stendahls Aufgabe im Rahmen der Reihe, die das Buch den Tatsachen entsprechend als “faktengefülltes Nachschlagewerk für speziell Interessierte” anpreist.
Oh ja, ein wenig norwegische Sprachkenntnisse sind von Vorteil, wobei das Norwegische Jazzarchiv auf seiner Website eine englischsprachige Zusammenfassung anbietet.
Wolfram Knauer (Oktober 2011)
in’n out. in-fusiones de jazz
herausgegeben von Julián Ruesga Bono
Sevilla 2010 (arte-facto)
277 Seiten,
ISBN: 978-84-614-5668-0
 Jazz, schreibt Julián Ruesga Bono im Vorwort zu diesem Buch, bekam die Mischung der Kulturen quasi in die Wiege gelegt. Wer vom Jazz also Stilfundamentalismus verlange, habe die Musik nicht verstanden. Entsprechend sammelt er in fünf thematischen Kapiteln Essays über einige der Fusionen, die der Jazz nach seiner Gründung einging.
Jazz, schreibt Julián Ruesga Bono im Vorwort zu diesem Buch, bekam die Mischung der Kulturen quasi in die Wiege gelegt. Wer vom Jazz also Stilfundamentalismus verlange, habe die Musik nicht verstanden. Entsprechend sammelt er in fünf thematischen Kapiteln Essays über einige der Fusionen, die der Jazz nach seiner Gründung einging.
Luc Delannoy befasst sich mit den Annäherungen zwischen lateinamerikanischen Musikrichtungen und dem Jazz zwischen den afro-kubanischen Aufnahmen Dizzy Gillespies und heutigen Projekten, in denen sich Jazz mit Traditionen Lateinamerikas mischt. Luis Clemente beschreibt die Verbindung jazzmusikalischer Improvisation mit dem andalusischen Flamenco und nennt historische sowie aktuelle Beispiele. Daniel Varela beschäftigt sich mit der Fusion von Jazz und zeitgenössischer Musik, wobei er als Fallbeispiele auf Aufnahmen aus Deutschland, den Niederlanden, England und den USA zurückgreift. Norberto Cambiasso zeichnet die politische Bedeutung des Jazz der 60er und 70er Jahre in Europa nach, bei Exilamerikanern genauso wie im erstarkenden europäischen Jazz, verweist auf konkrete politische Bezüge genauso wie auf allgemeine ästhetische Statements. Santiago Tadeo deckt den Bereich der elektronischen Experimente im Jazz insbesondere der jüngsten Zeit ab, also all das, was unter dem Terminus “Nu-Jazz” gehandelt wird, blickt dabei aber auch auf die Vorgänger, die seit den 60er Jahren elektronische Instrumente in den Jazz integrierten.
Neben diesen konkreten Kapiteln zu verschiedenen Formen von Fusionen zwischen “Jazz und…” enthält das Buch noch einen Rundumschlag von Chema Martínez über den Jazz im Jahr 2010, in dem man allerdings wirklich jüngere Namen vergeblich sucht, sowie eine Übersicht über Studien zum Jazz in Spanisch sprechenden Ländern.
Er habe das Buch auch “Notizen zu einer anderen Geschichte des Jazz” nennen können, schreibt Bono in seinem Vorwort, und tatsächlich stoßen die einzelnen Kapitel Themenstränge zu einer Musik an, die mittlerweile eben nicht allein mehr eine afro-amerikanische ist, sondern seit langem ihr eigenes Leben in vielen Ländern außerhalb der USA führt. Die Kapitel stehen dabei manchmal etwas sehr bezugslos nebeneinander, aber das macht dann auch wieder den Charme des Buchs aus, das darin deutlich macht, wie wichtig es ist, all die Fäden, die hier nur angerissen werden, aufzunehmen und in ein Gesamtbild des Jazz als eines großen globalen Projektes zu weben.
Wolfram Knauer (Oktober 2011)
Louis Armstrong. The Soundtrack of The American Experience
von David Stricklin
Chicago 2010 (Ivan R. Dee)
182 Seiten, 15,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-56663-836-4
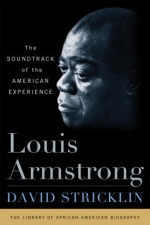 Noch eine Biographie des ersten wirklichen Stars des Jazz. David Striklin hat ein hübsches Büchlein vorgelegt, das Louis Armstrongs Leben beschreibt und daran entlang dessen afro-amerikanische Erfahrung herausstellen will. Und so gibt es in seinem Buch vor allem zwei Erzählstränge: den biographischen, der allseits bekannt ist und von ihm meist mit Verweisen auf die ebenfalls bekannten Armstrong-Biographen sowie Zitaten vom Trompeter selbst abgefeiert wird, sowie jenen, der von einer schwarzen Künstlerkarriere berichtet, die in Abhängigkeit vom weiß dominierten Markt gelebt wurde.
Noch eine Biographie des ersten wirklichen Stars des Jazz. David Striklin hat ein hübsches Büchlein vorgelegt, das Louis Armstrongs Leben beschreibt und daran entlang dessen afro-amerikanische Erfahrung herausstellen will. Und so gibt es in seinem Buch vor allem zwei Erzählstränge: den biographischen, der allseits bekannt ist und von ihm meist mit Verweisen auf die ebenfalls bekannten Armstrong-Biographen sowie Zitaten vom Trompeter selbst abgefeiert wird, sowie jenen, der von einer schwarzen Künstlerkarriere berichtet, die in Abhängigkeit vom weiß dominierten Markt gelebt wurde.
Stricklin beschreibt die Arbeitsumgebung erst in New Orleans, dann Chicago, dann New York, schließlich global. Er beschreibt die Entwicklung von einem jungen Trompeter, der froh war, mit seinen Mentoren spielen zu dürfen, hin zum eigenständigen Künstler, der sein eigener Herr war und seinerseits plötzlich überall Nachahmer fand. Er beschreibt Armstrong als freien und selbstbewussten Afro-Amerikaner, der weiße Hilfe durchaus annahm, auch immer wichtige weiße Geschäftspartner (bzw. Manager) hatte, sich selbst aber nicht die Butter vom Brot nehmen ließ.
Er beschreibt den Erfolg genauso wie die Schwierigkeiten, die Satchmo in den 1940er Jahren durchmachte, internationale Tourneen und seine Rückkehr nach New Orleans, das politische Bewusstsein des Trompeters und den populären Erfolg in den 1960ern. Das alles tut er in gut lesbaren Worten, aber nie mit allzu viel Konzentration auf das, was Armstrong eigentlich ausmachte, nämlich die Musik. Selbst im Schlusskapitel “The Recordings” kommt das Musikalische eher knapp und kaum aussagekräftig zu Wort, und so bleibt es bei vielen bekannten Fakten, neu sortiertem Atmosphärischem und einem wenig kritischen Literaturüberblick.
Für Einsteiger ist dieses Buch sicher kein Fehler; wer je ein anderes Armstrong-Buch gelesen hat, wird hier allerdings wenig Neues lernen.
Wolfram Knauer (Oktober 2011)
Blue Smoke. The Lost Dawn of New Zealand Popular Music 1918-1964
von Chris Bourke
Auckland 2010 (Auckland University Press)
382 Seiten, 59,59 New-Zealand-Dollar
ISBN: 978-1-86940-455-0
 Man verliert als Europäer ja doch manchmal die Übersicht über die Welt. Hat man doch gerade erst akzeptiert, dass sich mit der Entdeckung Amerikas der Horizont gezwungenermaßen erweitert hat und dass in der Popmusik die Amerikaner das Zepter in der Hand halten, hat man darüber hinaus gerade erst selbstbewusst die amerikanische Musik sich angeeignet und nun eigene Wege innerhalb derselben gefunden und proklamiert, da stößt man darauf, dass selbst am anderen Ende der Welt, in Gegenden, die man auf der popmusikalischen Weltkarte gar nicht auf Schirm hatte, Jazz, Bluegrass, Country, Rock und Popmusik ihren Siegeszug antraten, und das alles etwa zur selben Zeit wie bei uns.
Man verliert als Europäer ja doch manchmal die Übersicht über die Welt. Hat man doch gerade erst akzeptiert, dass sich mit der Entdeckung Amerikas der Horizont gezwungenermaßen erweitert hat und dass in der Popmusik die Amerikaner das Zepter in der Hand halten, hat man darüber hinaus gerade erst selbstbewusst die amerikanische Musik sich angeeignet und nun eigene Wege innerhalb derselben gefunden und proklamiert, da stößt man darauf, dass selbst am anderen Ende der Welt, in Gegenden, die man auf der popmusikalischen Weltkarte gar nicht auf Schirm hatte, Jazz, Bluegrass, Country, Rock und Popmusik ihren Siegeszug antraten, und das alles etwa zur selben Zeit wie bei uns.
Die Bilder ähneln sich, wenn man das opulente großformatige Buch von Chris Bourke aufschlägt: Tanzkapellen, die in ODJB-Manier posieren, größere oder kleinere Swingorchester. Doch dann hält man inne: Gleich zwei Frauen sitzen in der Band von Walter Smith, eine am Banjo, eine am Klavier. An anderer Stelle sieht man ein Banjo-, Mandolinen- und Gitarrenorchester einschließlich eines selbstgebauten Bass-Banjos. Immer wieder Musiker mit Maori oder polynesischem Hintergrund.
Neuseeland, am anderen Ende der Welt, reagierte auf die Jazzmode durchaus zur selben Zeit wie Europa. Bourke beschränkt sich in seiner Darstellung nicht auf die Geschichte des Jazz in Neuseeland, sondern betrachtet den Jazz als Teil vieler anderer populärer und vor allem aus den USA stammender Musikströmungen, die das Land eroberten, und eines der Themen, die sich wie ein roter Faden durchs Buch ziehen, ist die Verbindung all dieser amerikanischen Musikgenres mit den Südseerhythmen der Ureinwohner oder der von Neuseeland abhängigen Inselstaaten der Region.
Viele der Namen, die in seinem Buch auftauchen sind uns Westlern wahrscheinlich fremd. Er nennt etwa den Gitarren- und Banjovirtuosen Walter Smith, den Perkussionisten Bob Adams oder den Saxophonisten Abe Romain, der 1930 nach England ging und dort 1932 in der Begleitband für Louis Armstrong mitwirkte. Er betrachtet die Bedeutung des Rundfunks für die Verbreitung moderner Rhythmen in Neuseeland und wirft einen Blick auf frühe Plattenproduktionen mit Musik der Maoris.
Die Tanzkapellen der 1930er Jahre professionalisieren die Szene, und neben Swing- und Sweetbands erwähnt Bourke für diese Zeit auch erstmals einen Countrysänger, Tex Morton, der sowohl in Neuseeland als auch Australien Furore machte und zwischen 1936 und 1943 an die 100 Titel einspielte.
Der II. Weltkrieg erreichte auch unsere Antipoden. Bourke druckt Reproduktionen einzelner Songtitel ab, die den Kampf der neuseeländischen Truppen unterstützen sollten, und er begleitet die Royal New Zealand Air Force Band auf ihren erfolgreichen inländischen Tourneen. 1942 landeten die ersten US-Amerikaner in neuseeländischen Häfen an und brachten ihre eigene Musik mit. Schwarze Amerikaner allerdings, schreibt Bourke, waren in Neuseeland zwar ab und an zu sehen, ihre Musik aber sei kaum gehört worden. Eine der amerikanischen Bands immerhin, die nach einer langen Tour durch den Pazifik in Auckland anlangte, wurde vom Klarinettisten Artie Shaw geleitet.
Für die direkte Nachkriegszeit beleuchtet Bourke die Monopolkämpfe der Plattenindustrie, beschreibt Vertriebswege und Verkaufsstrategien. Einschübe beleuchten etwa die Karriere des blinden Pianisten Julian Lee, der auf Anraten Frank Sinatras in die Vereinigten Staaten ging, dort Sessions mit Chet Baker und anderen spielte und Arrangements für Stan Kenton schrieb.
Ende der 1950er Jahre veränderte sich die Popmusikszene. Sängerinnen und männliche Vokalgruppen wurden beliebt, genauso pseudo-Hawaiianische Bands und Country-and-Western-Gruppen. Bourke hebt besonders die Sängerin Mavis Rivers hervor, die Pianistin Nancy Harrie und den Pianisten Crombie Murdoch. Die Fotos fangen an etwas lächerlich zu wirken, wenn man neuseeländische Musiker in Cowboyhut und mit Westerngürtel sieht, eine Pseudo-Folklore, die durchaus auch auf das ländliche Leben des eigenen Landes Bezug nehmen wollte. Zugleich eroberte auch die Rock ‘n’ Roll-Welle das Land mit Covers der Hits von Elvis Presley, Bill Haley und anderen.
Bourke lässt seine neuseeländische Popmusikgeschichte im Jahr 1964 enden, also mit dem Erfolg des Rock ‘n’ Roll. In seinem Vorwort schreibt er, er wäre gern eingehender auf regionale Szenen eingegangen, die aber glücklicherweise in lokal begrenzten Geschichtsdokumentationen abgedeckt seien. Sein Buch jedenfalls gibt einen exzellenten Einblick in ein – aus europäischer Sicht – sehr exotisches Kapitel der globalen Popmusikentwicklung.
Wolfram Knauer (September 2011)
Horst Lippmann. Ein Leben für Jazz, Blues und Rock
von Michael Rieth
Heidelberg 2010 (Palmyra Verlag)
230 Seiten, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-930378-79-1
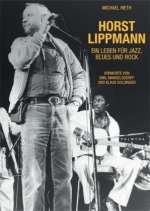 Zusammen mit seinem langjährigen Kompagnon Fritz Rau verkörperte Horst Lippmann den Siegeszug amerikanischer Musik im Nachkriegsdeutschland. Er spielte er Schlagzeug, organisierte im Restaurant seiner Eltern Jam Sessions, gab eigene Zeitschriften zum Jazz heraus, ermutigte die Gründung von Hot-Clubs und Hot-Club-Zusammenschlüssen zur Deutschen Jazzföderation, ermöglichte Konzerte und Festivalevents mit vielen deutschen Musikern und begleitete nicht zuletzt amerikanische Stars, die sich in seinen Händen so wohl fühlten, dass es sich bald herumsprach und Lippmann+Rau zur erfolgreichsten deutschen Konzertagentur zwischen Jazz, Blues, Rock und darüber hinaus wurde.
Zusammen mit seinem langjährigen Kompagnon Fritz Rau verkörperte Horst Lippmann den Siegeszug amerikanischer Musik im Nachkriegsdeutschland. Er spielte er Schlagzeug, organisierte im Restaurant seiner Eltern Jam Sessions, gab eigene Zeitschriften zum Jazz heraus, ermutigte die Gründung von Hot-Clubs und Hot-Club-Zusammenschlüssen zur Deutschen Jazzföderation, ermöglichte Konzerte und Festivalevents mit vielen deutschen Musikern und begleitete nicht zuletzt amerikanische Stars, die sich in seinen Händen so wohl fühlten, dass es sich bald herumsprach und Lippmann+Rau zur erfolgreichsten deutschen Konzertagentur zwischen Jazz, Blues, Rock und darüber hinaus wurde.
Jetzt hat Michael Rieth die Geschichte Horst Lippmanns niedergeschrieben und dabei versucht sich Lippmann als Geschäftsmann, als Jazz- und Musikfan und als Mensch zu nähern. Rieth weiß darum, wie wichtig Lippmanns oft nur im Hintergrund wahrgenommenen Aktivitäten für das deutsche Jazzleben waren, und immer wieder verweist er auf diese Bezugsstränge: Lippmanns Faszination mit der Musik, Lippmanns pragmatische Projektideen und -umsetzungen, der populären Erfolg dieser Projekte und die daraus resultierenden Veränderungen in Lippmanns Privat- und Geschäftsleben.
Gleich in seinem Vorwort erklärt Rieth, dass er, der Feuilletonist, der Literatur näher stünde als der biographischen Faktenhuberei. Und so liest sich sein Buch flüssig und spannend, weil er hinter den Lebensstationen, hinter den Begegnungen, hinter den musikalischen Begebenheiten, die Geschichten sucht, das Menschliche, das Lippmann dazu brachte dies oder jenes zu tun. So lässt Rieth die jugendliche Faszination Lippmanns durch den Jazz lebendig werden, stöbert in den “Jazz News”, die Lippmann ab Frühsommer 1945 (!) in hektographierter Form herausgab, fühlt das Entstehen einer lokalen Jazzszene nach, bei dem die Frankfurter Jazzer mindestens genauso wichtig waren wie die Möglichkeit für die Amerikaner und mit den Amerikanern zu spielen. Er zeichnet die Gründung des legendären Jazzkellers nach, aber auch die Sessions und Feiern “im Hause Lippmanns”, anfangs in Frankfurt, später im neu gebauten Eigenheim nahe des Flughafens. Olaf Hudtwalcker, Carlo Bohländer und Emil Mangelsdorff finden Erwähnung, und auch die Plattennachmittage, bei denen Lippmann und andere Vorträge über ihre liebsten Künstler oder neue Entwicklungen im Jazz vorbereiteten.
Familie Lippmann erhält noch schnell ein eigenes Kapitel, bevor Rieth vom Fan zum Geschäftsmann Lippmann schwenkt, der Sidney Bechet und Ted Heath nach Deutschland holte, Tourneen bekannter Jazzensembles für die Deutsche Jazzföderation durchführte, und, nachdem er sich während der Jazz at the Philharmonic-Tournee des Jahres 1952 als Organisationsgenie entpuppte, künftig sämtliche deutsche Tourneen für Norman Granz durchführte. Natürlich lässt Rieth Lippmanns langjährigen Geschäftspartner Fritz Rau zu Wort kommen, und er transkribiert Raus unnachahmlich dialektgefärbten Tonschlag, der so viel an Wärme und Freundschaft rüberbringt, die “nur” in Worten leicht verloren ginge. Rieth würdigt Lippmanns Einfluss sowohl auf die Gründung des Jazzensembles des Hessischen Rundfunks als auch einer eigenen Jazzredaktion beim hr oder seine Tätigkeit als Regisseur der SWR-Fernsehreihe “Jazz – gehört und gesehen”. Sein Engagement (und Kiesers Plakate!) beim Deutschen Jazz Festival ist genauso Thema wie das American Folk Blues Festival und dessen Einfluss auf die britische Rockmusik. Den Arbeitsalltag von Lippmann + Rau überlässt Rieth Lippmanns Kompagnon Rau, von dem ja erst kürzlich eine eigene Biographie voller Geschichten und Erlebnisse erschien.
Einige Stationen in Lippmanns so überaus aktivem Leben vernachlässigt Rieth in seinem Buch, etwa die Produktionen, die er in den 1960er Jahren für das Label Columbia machte und mit denen er dem deutschen modernen Jazz eine Plattform geben wollte. Solche und andere Details aber werden in anderen Bücher abgehandelt, etwa in Jürgen Schwabs opulentem “Der Frankfurt Sound”. Michael Rieth gelingt in seiner Biographie vor allem eines: den Menschen Horst Lippmann in seiner ganzen Faszination durch und Begeisterung für den Jazz darzustellen, die letzten Endes Beweggrund auch für all seine geschäftlichen Entscheidungen war. Es ist ein lesenswertes Buch geworden, schnell verschlungen, weil Rieth Anekdoten mit Reflexionen mischt, und weil seine Sprache sich nun mal “gut liest”. Es ist eine liebevolle und gelungene Verneigung vor diesem großen deutschen Impresario und mehr noch vor dem großartigen Jazzfreund Horst Lippmann.
Wolfram Knauer (September 2011)
Das Blaue Wunder. Blues aus deutschen Landen.
Herausgegeben von Winfried Siebers und Uwe Zagratzki
Eutin 2010 (Lumpeter & Lasel)
540 Seiten, 27,80 Euro
ISBN 9788-3-9812961-5-0
 Man merkt den Herausgebern den guten Willen an, eine tiefgehende, vielschichtige Analyse des Status quo des Blues in Deutschland zu liefern. Ausdrücklich wollen sie sich nicht am weit verbreiteten Abgesang auf den Blues beteiligen, sondern vielmehr seine Vielfalt in “regionalen Formen und heterogenen Nischen” dokumentieren. Allein es fehlen den beteiligten Autoren hier und da die zündenden Ideen dieses umzusetzen.
Man merkt den Herausgebern den guten Willen an, eine tiefgehende, vielschichtige Analyse des Status quo des Blues in Deutschland zu liefern. Ausdrücklich wollen sie sich nicht am weit verbreiteten Abgesang auf den Blues beteiligen, sondern vielmehr seine Vielfalt in “regionalen Formen und heterogenen Nischen” dokumentieren. Allein es fehlen den beteiligten Autoren hier und da die zündenden Ideen dieses umzusetzen.
Die Vorgaben der Herausgeber sind offensichtlich und sinnvoll, das erahnt man bereits an den Überschriften der einzelnen Buchteile: “Musiker und Zuhörer“, “Markt und Medien“, “Regionen und Orte“, “Geschichte und Geschichten“ in die das Buch gegliedert ist. Dass fast durchgehend in allen Kapiteln im Wesentlichen “Geschichtchen“ ausgebreitet werden, kann man den Autoren nicht wirklich zum Vorwurf machen. Es wimmelt im Blues ja nur so von Individualisten und Eigenbrödlern.
Heraus gekommen ist dadurch ein buntes und vielfältiges Panoptikum deutscher Bluesgeschichte von Nord nach Süd und von Ost nach West. Von den unterschiedlichen Arbeitbedingungen und Perspektiven derer, die auf der Bühne, bei den Labels, im Radio oder als Veranstalter den Blues haben, erfährt man so einiges. Vieles davon lässt Schlussfolgerungen über den Zustand des Blues in der deutschen Gegenwart zu.
So befasst sich Mit-Herausgeber Winfried Siebers analytisch in seinem Beitrag mit deutschsprachigen Blueszeitschriften. Dass er sich dabei ausschließlich mit den der siebziger und achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts beschäftigt, mag man allerdings wiederum fast als symptomatisch für das ganze Buch betrachten: Viele der beschriebenen Szenarien verharren in der Vergangenheit, meist in den für den Blues in Deutschland glorreichen 70ies und 80ies. Die Gegenwart kommt dabei mancherorts zu kurz, nicht nur in diesem Beitrag.
Wer sich gerne in unterhalsame Schilderungen der Highlights lokaler Szenen hineinlesen mag, für den ist dieses Buch eine gelungene Bett- oder Urlaubslektüre. Und die humorvoll-ironischen Anekdoten, die der Kabarettist und Schriftsteller Thomas C. Breuer in “Das Blaue Wunder“ am Ende eines jeden Buchabschnitts beisteuert, sorgen allemal dafür, dass man nach dem ein oder anderen zugegebenermaßen etwas schwerfälligen Beitrag nicht allzu schnell wegschlummert.
Arndt Weidler (Dezember 2011)
Da den moderne dansemusik kom til Danmark
von Erik Moseholm
Hellerup 2010 (Erik Moseholm Forlag)
247 Seiten, 2 CDs mit 85 Titeln
ISBN: 978-87-993793-0-9
 Der dänische Kritiker und Musikwissenschaftler Erik Wiedemann veröffentlichte 1982 die Früchte jahrzehntelange Arbeit über den Jazz in Dänemark. Jetzt legt der renommierte dänische Kontrabassist, Komponist und Jazzpädagoge Erik Moseholm ein Buch, das einmal einen ganz anderen Blick auf die europäische Jazzrezeption zu Beginn des 20sten Jahrhunderts wirft und nämlich fragt, “wie die moderne Tanzmusik nach Dänemark kam”. Ganz bewusst also spricht er im Titel nicht von Jazz, sondern von Tanzmusik. Sein Buch ist eine Kulturgeschichte der musikalischen Akkulturation, des amerikanischen Einflusses, der Skepsis, dass mit Ragtime, Cakewalk und Co die Werte dänischer Kultur zugrunde gehen könnten, aber auch der Faszination mit einer fremden Kultur und zaghaften Versuchen, sie für eigene Zwecke nutzbar zu machen, etwa indem man den tanzbaren Rhythmen dänische Texte unterlegte. Vor allem aber ist sein Buch eine Dokumentation des Verständnisses von Jazz als einer Musik, zu der man tanzen sollte, als einer Musik, bei der das Tanzen im Vordergrund steht.
Der dänische Kritiker und Musikwissenschaftler Erik Wiedemann veröffentlichte 1982 die Früchte jahrzehntelange Arbeit über den Jazz in Dänemark. Jetzt legt der renommierte dänische Kontrabassist, Komponist und Jazzpädagoge Erik Moseholm ein Buch, das einmal einen ganz anderen Blick auf die europäische Jazzrezeption zu Beginn des 20sten Jahrhunderts wirft und nämlich fragt, “wie die moderne Tanzmusik nach Dänemark kam”. Ganz bewusst also spricht er im Titel nicht von Jazz, sondern von Tanzmusik. Sein Buch ist eine Kulturgeschichte der musikalischen Akkulturation, des amerikanischen Einflusses, der Skepsis, dass mit Ragtime, Cakewalk und Co die Werte dänischer Kultur zugrunde gehen könnten, aber auch der Faszination mit einer fremden Kultur und zaghaften Versuchen, sie für eigene Zwecke nutzbar zu machen, etwa indem man den tanzbaren Rhythmen dänische Texte unterlegte. Vor allem aber ist sein Buch eine Dokumentation des Verständnisses von Jazz als einer Musik, zu der man tanzen sollte, als einer Musik, bei der das Tanzen im Vordergrund steht.
Moseholm beginnt mit einem Blick auf die europäische Tanzkultur um 1900. Er nennt afro-amerikanische Musiker und Tänzer, die noch weit vor dem Jazz auch in Dänemark auftraten, Sängerinnen und Minstrel-Acts. Er erkennt, dass der Ragtime und der Cakewalk als eine Art exotischer Modetanz nach Europa und damit auch nach Dänemark kamen und zeigt zeitgenössische Karikaturen von Festen mit “Kakedans”, wie der Cakewalk auf Dänisch hieß. Auch das Kapitel “Onestep, Vrikkedans, Twostep og Klapstep” beschäftigt sich mit afro-amerikanischer Musik als Tanzphänomen, beleuchtet diverse Modetänze der Zeit vor 1920, die meist amerikanische Namen trugen.
1919 wurde in Dänemark erstmals der Jazz als ein neues musikalisches Phänomen aus den Vereinigten Staaten thematisiert. Die Original Dixieland Jazz Band und Paul Whiteman waren die Bandbreite, in der Jazz in jenen Jahren rezipiert wurde, also kaum als schwarze Musik, auch wenn der afro-amerikanische Ursprung all der jüngsten musikalischen Entwicklungen durchaus bewusst war. Mosehol erwähnt dänische Musiker, die sich mit der neuen Tanzmusik aus Amerika beschäftigten. Henrik Clausen, Valdemar Eiberg, Emil Reesen und andere Namen fallen, und Moseholm wirft auch einen Blick auf seltsam anmutende Besetzungen wie etwa die Banjo-überladene Kapelle von Marius Hansen. Überhaupt sind Banjo und Saxophon (und vielleicht noch das Schlagzeugset) die am meisten wahrgenommenen und herausgestellten Instrumente dieser neuen Musik.
Doch die Musik an und für sich spielt in diesem Buch tatsächlich eher eine Nebenrolle, das sich vor allem mit dem Phänomen der Tanzmusik beschäftigt und dabei das Tanzen und das Musikmachen “zum Tanzen” in den Vordergrund rückt. Moseholm tut gut daran, auf dieser Tatsache ein wenig herumzureiten, wurde doch der Jazz tatsächlich bis weit in die 1920er Jahre hinein mindestens genauso sehr als Tanz denn als Musik wahrgenommen. Die ersten Bücher über Jazz beschrieben das den Tanz mindestens genauso ausführlich wie die Musik, zu der da getanzt wurde. Erst aus der Rückschau wurde aus dem jazz selbst dieser frühen Jahre eine reine Hörmusik. Doch wer die Rezeption des frühen Jazz in Europa ohne seine enge Verbindung zum Tanz betrachtet, missversteht die Umgebung, in der diese Musik hier gepflegt wurde.
Zwischendurch immerhin wirft Moseholm auch den einen oder anderen Blick auf die Orchesterleiter und Bands, die für die Tanzmusik jener Jahre in Dänemark verantwortlich waren, beleuchtet die Arbeit des Staatlichen Radiosinfonieorchesters, nennt Otto Lington, Teddy Petersen, Kaj Julian Olsen, Erik Tuxen, Kai Ewans, Louis Preil und andere. Für die 1930er Jahre reflektiert er noch kurz über die aufkommende Jitterbug-Mode und listet in einem abschließenden Kapitel Modetänze auf, sortiert nach den Jahren, in denen sie in Dänemark eingeführt wurden. In den 1950er Jahren sei das Phänomen des Jazz als Tanzmusik weitestgehend Geschichte, schreibt Moseholm; Jazz sei vor allem Konzertmusik geworden und seine Funktion als Tanzmusik sei nun von anderen Genres übernommen worden.
In einem Appendix zum Buch findet sich etwas unvermittelt zum Rest des Buchs dann noch eine ausführliche biographische Skizze des Schlagzeugers Allan Rasmussen, der in der dänischen Jazzszene der Nachkriegszeit aktiv war.
Dem Buch sind zwei CDs beigefügt, die insgesamt 85 Titel enthalten, eingespielt zwischen 1909 und 1944.
Der Jazzbassist Erik Moseholm wirft mit seinem Buch einen erfrischend “anderen Blick” auf die Rezeption afro-amerikanischer Musik in Europa, einen Blick auf die in den meisten Jazzgeschichtsbüchern oft vernachlässigte Funktion dieser Musik. Sein Buch ist damit vor allem als sinnvolle Ergänzung der zu Beginn erwähnten Jazzgeschichte von Erik Wiedemann zu lesen.
Wolfram Knauer (September 2011)
Historia Jazzu w Polsce
von Krystian Brodacki
Krakau 2010 (PWM Edition)
626 Seiten
ISBN
978-83-224-0917-6
 Unter den europäischen Jazzgeschichten ist die polnische die vielleicht konnotationsbelastete. Überall im Osten stand der Jazz für Freiheit, war ein Fenster in den Westen, ein Symbol für eine andere Art von Demokratie, für Individualität und Eigenständigkeit. In Polen aber schufen Jazzmusiker Freiräume, die weit über den Jazz hinausreichten. Kristian Brodackis Buch erzählt die Geschichte des Jazz in Polen von den 1920er Jahren bis heute, und ein Subtext seines Buches ist neben den biographischen Stationen der erwähnten Musiker immer, wie diese Musik sich in einem System durchsetzen konnte, das dem Jazz eigentlich eher suspekt gegenüberstand. Die ersten Jahre bis Kriegsende füllen die ersten 100 Seiten und handeln von Ady Rosner und von Strategien in angespanntester Lage, jene faszinierende amerikanische Musik zu machen, zu hören und dazu zu tanzen. Dann geht Brodacki chronologisch in Fünfjahresschritten vor, beleuchtet einzelne Biographien, lokale Szenen und die um die Jazzszene langsam entstehenden Netzwerke, Clubs und Zeitschriften. International bekannte Musiker wie Krzysztof Komeda oder Tomasz Stanko werden ausführlich gewürdigt, aber allein beim Durchblicken des Namensindex merkt man schnell, dass es Brodacki auf Vollständigkeit ankam. Die macht die Lektüre denn auch stellenweise etwas anstrengend, wenn sie über lange Strecken Namensketten bildet, aber weniger über die Besonderheit des betreffenden Individualstils aussagt. Solche musikalischen Chatakterisierungen überlässt Brodacki vor allem Musikerzitaten, die er immer wieder in seinen Text einfließen lässt. Brodackis Werk ist auf jeden Fall ein wichtiger Stein auf dem Weg zu einer immer noch nicht vollendeten europäischen Jazzgeschichte, die die vielen nationalen Geschichten dieser Musik zusammenfasst und miteinander verwebt.
Unter den europäischen Jazzgeschichten ist die polnische die vielleicht konnotationsbelastete. Überall im Osten stand der Jazz für Freiheit, war ein Fenster in den Westen, ein Symbol für eine andere Art von Demokratie, für Individualität und Eigenständigkeit. In Polen aber schufen Jazzmusiker Freiräume, die weit über den Jazz hinausreichten. Kristian Brodackis Buch erzählt die Geschichte des Jazz in Polen von den 1920er Jahren bis heute, und ein Subtext seines Buches ist neben den biographischen Stationen der erwähnten Musiker immer, wie diese Musik sich in einem System durchsetzen konnte, das dem Jazz eigentlich eher suspekt gegenüberstand. Die ersten Jahre bis Kriegsende füllen die ersten 100 Seiten und handeln von Ady Rosner und von Strategien in angespanntester Lage, jene faszinierende amerikanische Musik zu machen, zu hören und dazu zu tanzen. Dann geht Brodacki chronologisch in Fünfjahresschritten vor, beleuchtet einzelne Biographien, lokale Szenen und die um die Jazzszene langsam entstehenden Netzwerke, Clubs und Zeitschriften. International bekannte Musiker wie Krzysztof Komeda oder Tomasz Stanko werden ausführlich gewürdigt, aber allein beim Durchblicken des Namensindex merkt man schnell, dass es Brodacki auf Vollständigkeit ankam. Die macht die Lektüre denn auch stellenweise etwas anstrengend, wenn sie über lange Strecken Namensketten bildet, aber weniger über die Besonderheit des betreffenden Individualstils aussagt. Solche musikalischen Chatakterisierungen überlässt Brodacki vor allem Musikerzitaten, die er immer wieder in seinen Text einfließen lässt. Brodackis Werk ist auf jeden Fall ein wichtiger Stein auf dem Weg zu einer immer noch nicht vollendeten europäischen Jazzgeschichte, die die vielen nationalen Geschichten dieser Musik zusammenfasst und miteinander verwebt.
Wolfram Knauer (August 2011)
The Jazz Loft Project. Photographs and Tapes of W. Eugene Smith from 821 Sixth Avenue, 1957-1965
von Sam Stephenson
New York 2010 (Alfred A. Knopf)
268 Seiten, 40,00 US-Dollar
ISBN: 978-0-307-26709-2
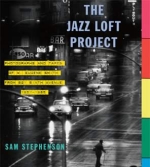 Es ist eine skurile Geschichte, die Anlass dieses Buchs ist: Der Fotograf W. Eugene Smith, der einen gut bezahlten Job bei der Illustrierten “Life” hatte, zog 1957 in ein heruntergekommenes Gebäude auf der Sixth Avenue zwischen 28ster und 29ster Straße. Er begann das Treiben auf der Straße im New Yorker Blumenviertel zu dokumentieren, aber auch das nächtliche Treiben im Haus selbst, in dem neben ihm der Fotograf David X. Young lebte, aber auch die Jazzmusiker Hall Overton und Dick Cary. Das Gebäude wurde bald zu einem der heißesten Jam-Session und Probenorte der Stadt, und Smith, der wie ein Besessener seine Umwelt mit der Kamera dokumentierte, begann auch die Klänge mitzuschneiden, indem er das ganze Gebäude mit Mikrofonen überzog und aufnahm, was immer sich im Gebäude tat. Im Nachlass des Fotografen fanden sich so etwa 40.000 Bilder, die er zwischen 1957 und 1965 im oder um das Gebäude herum aufgenommen hatte sowie 1.740 Tonbänder (also 4.000 Stunden) mit Musik, Gesprächen, Telefonaten, Rundfunksendungen und vielem mehr – eine Komplett-Dokumentation von Zeitgeschichte, vergleichbar vielleicht den Dean-Benedetti-Mitschnitten Charlie Parkers, die vor einigen Jahren auf dem Mosaic-Label veröffentlicht wurden, nur noch viel verrückter und umfassender.
Es ist eine skurile Geschichte, die Anlass dieses Buchs ist: Der Fotograf W. Eugene Smith, der einen gut bezahlten Job bei der Illustrierten “Life” hatte, zog 1957 in ein heruntergekommenes Gebäude auf der Sixth Avenue zwischen 28ster und 29ster Straße. Er begann das Treiben auf der Straße im New Yorker Blumenviertel zu dokumentieren, aber auch das nächtliche Treiben im Haus selbst, in dem neben ihm der Fotograf David X. Young lebte, aber auch die Jazzmusiker Hall Overton und Dick Cary. Das Gebäude wurde bald zu einem der heißesten Jam-Session und Probenorte der Stadt, und Smith, der wie ein Besessener seine Umwelt mit der Kamera dokumentierte, begann auch die Klänge mitzuschneiden, indem er das ganze Gebäude mit Mikrofonen überzog und aufnahm, was immer sich im Gebäude tat. Im Nachlass des Fotografen fanden sich so etwa 40.000 Bilder, die er zwischen 1957 und 1965 im oder um das Gebäude herum aufgenommen hatte sowie 1.740 Tonbänder (also 4.000 Stunden) mit Musik, Gesprächen, Telefonaten, Rundfunksendungen und vielem mehr – eine Komplett-Dokumentation von Zeitgeschichte, vergleichbar vielleicht den Dean-Benedetti-Mitschnitten Charlie Parkers, die vor einigen Jahren auf dem Mosaic-Label veröffentlicht wurden, nur noch viel verrückter und umfassender.
Das Buch “The Jazz Loft Project” erzählt die Geschichte des Hauses 821 Sixth Avenue und seiner Bewohner, festgehalten durch die Bilder und Tonbänder W. Eugene Smiths und untermauert durch Interviews mit Zeitzeugen. Die Bilder zeigen Musiker wie Thelonious Monk, der sich im Haus regelmäßig mit Hall Overton traf, um sein Town-Hall-Konzert vorzubereiten und mit der Bigband dort zu proben, Zoot Sims, Buck Clayton, Dave McKenna, Bud Freeman, Wingy Manone, Gus Johnson, Jimmy Giuffre, Bob Brookmeyer, Jim Hall, Ronnie Free und viele andere, bei Sessions oder in Gesprächen. Viele der exzellenten Fotos aber haben gar keinen Jazzgehalt, sondern zeigen einfach Szenen von der Straße, Blumenlieferungen für den Floristen gegenüber, einen Tortenbäcker, aus Autos ein- und aussteigende Menschen, Spaziergänger im Schnee, einen Unfall, Norman Mailer, Salvador Dali, einen Polizisten, eine Frau mit Kinderwagen. Dazwischengeschaltet, mit Datum versehen Transkripte aus den Bändern, Dialoge zwischen Musikern, Gesprächsfetzen, den Hörtrack zu Sonny Clark, wie er sich Heroin spritzt und langsam high wird und seine Freunde sich Sorgen machen, ob alles in Ordnung ist. Monk und Overton unterhalten sich über das bevorstehende Konzert. Roland Kirk spricht mit Jay Cameron, Alice Coltrane und Smith diskutieren darüber, ob es wohl rechtlich und ethisch in Ordnung sei, all die Musik im Loft aufzunehmen. Zwischendrin bunte Abbildungen der Tonband-Cover und ihrer Beschriftungen, der Leihhausquittungen für Kameras, die Smith kurzzeitig weggab, um Geld locker zu machen. Zoot Sims erzählt von einem Club, in dem er für Striptease-Tänzerinnen spielte. Eine Frau wühlt in ihrer Handtasche. Ein Mann fegt Blumen von der Straße auf. Zufällige Szenen und doch nicht zufällig, herausgegriffen aus acht Jahren Fotos und Tonbändern, dem Blick aus dem Haus, in das Haus auf der Sixth Avenue.
Ein Buch für Voyeure, meint man stellenweise, und doch mit so viel Gespür und sorgfältigen liebevollen Kommentaren ediert, dass die Frage, “Darf der das überhaupt?!” nicht wirklich aufkommt. Ein wunderbares Buch, das in der Unaufgeregtheit, der Dokumentation des Belanglosen die Zeit genauso zurechtrückt wie es sie verklärt. Für Fotoliebhaber, für Jazzfans, für jeden, für Historiker der Beats. Ein erstaunliches Dokument der Zeitgeschichte, begleitet von einer Website (www.jazzloftproject.org), auf der man in einige der Bänder hineinhören kann und dass außerdem eine Rundfunkdokumentation über das Jazz Loft Project verlinkt.
Wolfram Knauer (Juli 2011)
Monument Eternal. The Music of Alice Coltrane
von Franya J. Berkman
Middletown/CT 2010 (Wesleyan University Press)
132 Seiten, 27,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8195-6925-7
 Nicht nur in der klassischen Musik hat das Schicksal einige Musikerinnen um ihren Ruhm gebracht, weil sie mit Männern verheiratet waren, deren Glanz sie so stark überstrahlte, dass ihre eigene Kreativität kaum mehr wahrgenommen oder wertgeschätzt wurde. Was für Clara Schumann, Fanny Mendelssohn und andere gilt, das findet im Jazz quasi in Alice Coltrane eine Entsprechung. Die Musikwissenschaftlerin Franya J. Berkman hat sich nun daran gemacht, Alice Coltrane aus der Versenkung zu befreien, in die die Jazzgeschichte sie hat fallen lassen, würdigt in ihrer aus einer Dissertation hervorgegangenen Studie die Eigenständigkeit der Musik, die Alice Coltrane seit den frühen 1960er Jahren hervorgebracht hat und die den Jazz als klar abgegrenztes Genre weit transzendiert. Die Jahre nach dem Tod ihres Mannes verbrachte Swamimi Turiyasanitananada, wie Alice Coltrane in ihrem Vedanic Center in Kalifornien genannt wurde, mit der Erforschung einer Verbindung afro-amerikanischer Wurzeln und südasiatischer Musizierpraktiken. Dabei liegt dem lebenslangen Wirken der Pianistin, Harfenistin und Komponistin eine spirituelle Grundhaltung zugrunde, die aus familiärer Spiritualität stammt und die sie als religiöse Sucherin bis zuletzt hochhielt. Die Untersuchung von Spiritualität in der Musik der 1960er und 1970er Jahre aber, weiß Berkman, hat immer auch hoch-politische Gehalt, so dass sie neben der Geschichte der Musikerin und ihrer spirituellen Entwicklung immer auch die Einbettung dieser Entwicklung in die politische Lage der USA in jenen Jahren zu betrachten hat.
Nicht nur in der klassischen Musik hat das Schicksal einige Musikerinnen um ihren Ruhm gebracht, weil sie mit Männern verheiratet waren, deren Glanz sie so stark überstrahlte, dass ihre eigene Kreativität kaum mehr wahrgenommen oder wertgeschätzt wurde. Was für Clara Schumann, Fanny Mendelssohn und andere gilt, das findet im Jazz quasi in Alice Coltrane eine Entsprechung. Die Musikwissenschaftlerin Franya J. Berkman hat sich nun daran gemacht, Alice Coltrane aus der Versenkung zu befreien, in die die Jazzgeschichte sie hat fallen lassen, würdigt in ihrer aus einer Dissertation hervorgegangenen Studie die Eigenständigkeit der Musik, die Alice Coltrane seit den frühen 1960er Jahren hervorgebracht hat und die den Jazz als klar abgegrenztes Genre weit transzendiert. Die Jahre nach dem Tod ihres Mannes verbrachte Swamimi Turiyasanitananada, wie Alice Coltrane in ihrem Vedanic Center in Kalifornien genannt wurde, mit der Erforschung einer Verbindung afro-amerikanischer Wurzeln und südasiatischer Musizierpraktiken. Dabei liegt dem lebenslangen Wirken der Pianistin, Harfenistin und Komponistin eine spirituelle Grundhaltung zugrunde, die aus familiärer Spiritualität stammt und die sie als religiöse Sucherin bis zuletzt hochhielt. Die Untersuchung von Spiritualität in der Musik der 1960er und 1970er Jahre aber, weiß Berkman, hat immer auch hoch-politische Gehalt, so dass sie neben der Geschichte der Musikerin und ihrer spirituellen Entwicklung immer auch die Einbettung dieser Entwicklung in die politische Lage der USA in jenen Jahren zu betrachten hat.
Berkman beginnt mit biographischen Notizen: Geboren in Detroit nahm Alice McLeod mit sieben Jahren Klavierunterricht und spielte bald in der Baptistengemeinde, der ihre Familie angehörte. Berkman beschreibt die Musik- und insbesondere die lebendige Jazzszene Detroits in den 1940er und 1950er Jahren und das Modern-Jazz-Network, das sich dort bald zwischen vielen später namhaften Musikern herauskristallisierte. Alices älterer Halbbruder Ernest Farrow war ein angesehener Kontrabassist auf der Detroiter Jazzszene und der Pianist Barry Harris, der fast Alices Halbschwester geheiratet hätte, waren wichtige Lehrer für die Pianistin. In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre spielte Alice mit den Premieres, einem “Lounge Act”, der Gospel und Rhythm ‘n’ Blues jener Jahre mischte. 1960 verbrachte zusammen mit ihrem ersten Mann, dem Bebop-Sänger Kenny Hagood, ein Jahr in Paris, wo sie Bud Powell traf, der für sie ein weiterer wichtiger musikalischer Mentor werden sollte. Zurück in den USA (inzwischen geschieden und mit einem ersten Kind) trat Alice mit eigener Band in Detroit auf, der unter anderem der Saxophonist Bennie Maupin angehörte. Während ihrer Pariser Zeit hatte sie John Coltrane ein erstes Mal gehört, als dieser mit Miles Davis dort auftrat. 1962 spielte Coltrane mit eigener Band in Detroit und Alice war hingerissen davon, wie weit er die musikalische Sprache des Bebop vorangebracht hatte. Alice tourte mit der Band des Vibraphonisten Terry Gibbs, mit dem sie 1963 ihre ersten Aufnahmen machte. Berkman analysiert einige ihrer Soli und zeigt dabei die Einflüsse von Harris und Powell, zeigt zugleich, dass Alice McLeod hier schon lange keine Novizin mehr war, sondern eine gereifte Musikerin.
Terry Gibbs’ Band spielte im Sommer 1963 als Vorgruppe für John Coltranes Quartett, und bald waren die beiden erst ein Liebes-, dann ein Ehepaar. Im Februar 1966 machte Alice ihre ersten Aufnahmen mit John Coltrane, und der Einfluss, den ihr Mann auf ihre musikalische Sprache hatte, ging wohl durchaus auch in die andere Richtung: Sie beide entwickelten ihre musikalische genauso wie ihre familiäre und ihre spirituelle Seite nunmehr gemeinsam weiter. Berkman nähert sich all diesen Aspekten und verortet das Interesse der beiden an einer Art universeller Spiritualität auch in der politischen Situation der 1960er Jahre. Coltrane, konstatiert sie, habe in Alice die musikalische Suche geweckt – zuvor sei sie doch recht konventionell in ihren ästhetischen Vorstellungen gewesen. Ihr Mann habe ihr vor allem durch die Praxis des Zusammenspiels neue Wege gewiesen, sagt Alice, nicht etwa durch technische Erklärungen. Vor diesem Hintergrund analysiert Berkman “Manifestation”, einen Mitschnitt der John Coltrane Band, der erst 1995 veröffentlicht wurde.
Nach dem Tod ihres Mannes musste Alice Coltrane sein musikalisches, spirituelles und familiäres Erbe weitertragen. Berkman spielt einen Moment lang die Psychoanalytikerin und diagnostiziert eine schwere Depression, ausgelöst durch den Verlust des Saxophonisten. Ihre ersten Alben nach Coltranes Tod fanden zwar nicht den größten kritischen Zuspruch, zeigten aber, wie Berkman schreibt, eine sich entwickelnde Komponistin, die mit neuen Timbres und Instrumentierungen experimentiert, mit der Beziehung zwischen Struktur und Freiheit und dem Potential einer ruhigeren Dynamik. Berkman analysiert die ersten Alben der frühen 1970er Jahre, insbesondere “Universal Consciousness” von 1971 und beschreibt den Einfluss ihres indischen Gurus auf ihre Arbeit. 1976 hatte Alice eine Erweckungserfahrung, aufgrund derer sie die orange Kluft eines spirituellen Führers der Hindu-Tradition aufnahm und einen Ashram gründete. Berkman beschreibt die Hymnen, die jetzt Teil eines spirituellen Rituals wurden und dabei den Zirkelschluss einer Entwicklung von religiösem Erwachen bis religiöser Erweckung bilden.
Berkmans Buch ist aus einer Dissertation entstanden, dennoch über weite Strecken flüssig zu lesen, da die Autorin sich an der Biographie genauso wie den Aufnahmen von Alice Coltrane entlang hangelt. Stellenweise würde man sich eine etwas ausführlichere Diskussion spiritueller Tendenzen in der afro-amerikanischen Community ihrer Zeit wünschen, um John und Alice Coltranes Entwicklung besser einpassen zu können. Das aber war nicht die von der Autorin selbst gestellte Aufgabe, und so liefert “Monument Eternal” einen mehr als brauchbaren Einblick in Leben und Werk einer von der Jazzgeschichte zu Unrecht links liegen gelassenen Künstlerin.
Wolfram Knauer (Juli 2011)
Kurt Henkels. Eine Musiker-Biographie mit ausführlicher Diskographie
von Gerhard Conrad
Hildesheim 2010 (Olms)
252 Seiten, 19,80 Euro
ISBN: 978-3-487-08499-2
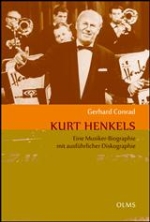 Kurt Henkels war einer der erfolgreichsten deutschen Bandleader, der in der DDR als Leiter des Rundfunk-Tanzorchesters gekonnt Swing und Schlager miteinander verband, 1959 dann die DDR verließ und in Westdeutschland erst beim, NDR, und später kurze Zeit beim ZDF ein Orchester leitete. Henkels wäre im Jahr 2010 hundert Jahre alt geworden; aus Anlass des Jubiläums widmet Gerhard Conrad ihm eine Biographie. Conrad ist einer der kenntnisreichsten Experten zum frühem Jazz und zur Tanzmusik in Deutschland, und er kann für sein Buch auf eigene Recherchen, vor allem aber auch auf Gespräche mit vielen Zeitgenossen des Bandleaders, ja sogar mit Henkels selbst zurückgreifen.
Kurt Henkels war einer der erfolgreichsten deutschen Bandleader, der in der DDR als Leiter des Rundfunk-Tanzorchesters gekonnt Swing und Schlager miteinander verband, 1959 dann die DDR verließ und in Westdeutschland erst beim, NDR, und später kurze Zeit beim ZDF ein Orchester leitete. Henkels wäre im Jahr 2010 hundert Jahre alt geworden; aus Anlass des Jubiläums widmet Gerhard Conrad ihm eine Biographie. Conrad ist einer der kenntnisreichsten Experten zum frühem Jazz und zur Tanzmusik in Deutschland, und er kann für sein Buch auf eigene Recherchen, vor allem aber auch auf Gespräche mit vielen Zeitgenossen des Bandleaders, ja sogar mit Henkels selbst zurückgreifen.
Sein Buch ist vollgefüllt mit Fakten, Details und Geschichten, vermittelt dabei über die Daten eines Lebens und musikalischen Wirkens hinaus auch viel über die Lebenswirklichkeit eines Musikers zwischen Jazz und Unterhaltungsmusik, eines Musikers, der seine Liebe, die swingende Musik, auch in einem Land hochhalten wollte, in dem der Jazz als Musik des Klassenfeind galt. Conrad unterscheidet dabei meist klar zwischen Jazz und Tanzmusik, ohne diese Unterscheidung zu einer Wertung werden zu lassen. Und immer wieder beschreibt er knapp, aber kenntnisreich einzelne Aufnahmen Henkels.
Das Buch wird abgerundet durch eine ausführliche Diskographie der Aufnahmen Kurt Henkels von 1948 bis 1965. Conrad beleuchtet mit seiner Biographie Henkels scheinbar nur ein Randkapitel deutscher Jazzgeschichte, schildert dabei aber zugleich viel von der Lebenswirklichkeit, mit der auch Jazzmusiker sich immer wieder auseinanderzusetzen hatten.
Wolfram Knauer (März 2011)
Blues In My Eyes. Jazzfotografien aus sechs Jahrzehnten
Weitra (Österreich) 2010 (Bibliothek der Provinz)
204 Seiten, 39 Euro
ISBN: 978-3-85252-603-4
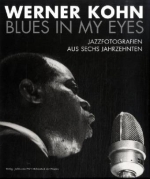 Der Bamberger Fotograf Werner Kohn ist seit den späten 1950er Jahren mit der Kamera unterwegs und dokumentiert seit 1959 regelmäßig auch Konzerte mit Jazz- oder Blueskünstlern. Nun ist ein opulenter Bildband erschienen, in dem fast 200 seiner Fotos zu sehen sind, schwarzweiß oder Farbe, meist auf der Bühne und bei der Arbeit. Das Buch heißt “Jazzfotografien”, daneben aber sind auch Blues- und Rockmusiker zu sehen, in Aufnahmen von 1959 bis 2004 (also aus eigentlich fünf statt sechs Jahrzehnten). Die Armstrong All Stars machen den Anfang, Ella, Ellington, Monk, Coltrane, Doldinger und viele andere. Es sind teils witzige, teils spannende Fotos, etwa von Bertice Reading in einem genialen Sackkleid von 1961, Jimmy Rushing schräg von oben mit Hut, Champion Jack Dupree tanzend, Prince und die Beatles, Miles Davis, Gunter Hampel, Herb Geller. Die meisten der Fotos sind Bühnenportraits, zeigen die Musiker bei der Arbeit am Instrument, vermitteln Intensität, Konzentration oder auch relaxtes Swingen. Viele der Fotos, gerade auch von unbekannteren Musikern, scheinen einen Einblick in die tatsächliche Arbeitswelt der Musiker zu geben; andere Fotos sind wohl vor allem der historischen Bedeutung wegen in die Sammlung aufgenommen worden. Auch unter den farbigen Portraits immerhin gibt es einige exzellente Bilder, das von Pharoah Sanders etwa, oder vom schweißüberströmten Maceo Parker, und auch auf den ersten Blick unscharfe Bilder können durchaus eine bewegende künstlerische Aussage besitzen, etwa das Bild vom träumerisch spielenden Woody Allen an der Klarinette.
Der Bamberger Fotograf Werner Kohn ist seit den späten 1950er Jahren mit der Kamera unterwegs und dokumentiert seit 1959 regelmäßig auch Konzerte mit Jazz- oder Blueskünstlern. Nun ist ein opulenter Bildband erschienen, in dem fast 200 seiner Fotos zu sehen sind, schwarzweiß oder Farbe, meist auf der Bühne und bei der Arbeit. Das Buch heißt “Jazzfotografien”, daneben aber sind auch Blues- und Rockmusiker zu sehen, in Aufnahmen von 1959 bis 2004 (also aus eigentlich fünf statt sechs Jahrzehnten). Die Armstrong All Stars machen den Anfang, Ella, Ellington, Monk, Coltrane, Doldinger und viele andere. Es sind teils witzige, teils spannende Fotos, etwa von Bertice Reading in einem genialen Sackkleid von 1961, Jimmy Rushing schräg von oben mit Hut, Champion Jack Dupree tanzend, Prince und die Beatles, Miles Davis, Gunter Hampel, Herb Geller. Die meisten der Fotos sind Bühnenportraits, zeigen die Musiker bei der Arbeit am Instrument, vermitteln Intensität, Konzentration oder auch relaxtes Swingen. Viele der Fotos, gerade auch von unbekannteren Musikern, scheinen einen Einblick in die tatsächliche Arbeitswelt der Musiker zu geben; andere Fotos sind wohl vor allem der historischen Bedeutung wegen in die Sammlung aufgenommen worden. Auch unter den farbigen Portraits immerhin gibt es einige exzellente Bilder, das von Pharoah Sanders etwa, oder vom schweißüberströmten Maceo Parker, und auch auf den ersten Blick unscharfe Bilder können durchaus eine bewegende künstlerische Aussage besitzen, etwa das Bild vom träumerisch spielenden Woody Allen an der Klarinette.
Gewiss zeigen einige Bilder fotografische Schwächen, sind leicht unscharf, sehr pixelig oder haben kaum Tiefenschärfe. So passiert es, dass etwa das Gesicht von Margie Evans zu einem flachen orangenen Mond zu werden scheint oder die Silhouetten von Harry Belafonte und Dianne (nicht “Diana!”!) Reeves wie platte Scherenschnitte vor einen schwarzen Hintergrund geklebt wirken. An diesen Stellen hätte man sich einen kritischeren Bildlektor gewünscht. Einige dieser Fotos haben sicher dokumentarischem Wert, doch bedarf dieser dann auch der Erklärung. Von daher man meint im Vorwort von Rolf Sachsse ein gewisses Augenzwinkern mitzulesen, wenn dieser anmerkt, dass sich Kohn “beim Jazz an William P. Gottlieb, Herman Leonard und William Claxton messen lassen” muss. Diese Messlatte ist ziemlich hoch, und Gottlieb, Claxton und Leonard hatten meistens eine editorische Begleitung, die ähnliche Ausrutscher zumindest erklärten. Nichtsdestotrozu schafft es Werner Kohn, uns mitzunehmen in die Konzerte und leiht uns für den Augenblick des Kameraklicks seine Augen, seine Sicht auf den Jazz.
Wolfram Knauer (März 2011)
Der zornige Baron. Das Prinzip Diskontinuität im Leben und konzept-kompositorischen Schaffen des Charles Mingus jr.
von Hans-Joachim Heßler
Duisburg 2010 (United Dictions of Music)
589 Seiten, 29,80 Euro
ISBN: 978-3-942677-00-4
 Der Titel des Buches sagt bereits einiges über seinen Inhalt aus: Ein etwas reißerisch wirkender Ober- und ein wissenschaftlich komplexer Untertitel. “Der zornige Baron” steht als Metapher für die Persönlichkeit von Charles Mingus, die sich in seiner Musik widerspiegelt und biographische wie gesellschaftliche Unzufriedenheit abbildet. “Das Prinzip Diskontinuität im Leben und konzept-kompositorischen Schaffen des Charles Mingus jr.” steht für die wissenschaftliche Reflektion über Persönlichkeit und Musik. Ein Spagat also zwischen dem Begreifen und Beschreiben des enorm emotionalen Ausdrucks der Musik des Kontrabassisten und Bandleaders und ihrer Verwurzelung in Lebens- und Gesellschaftserfahrungen sowie der Analyse und Einordnung nach unterschiedlichen wissenschaftlichen Kriterien.
Der Titel des Buches sagt bereits einiges über seinen Inhalt aus: Ein etwas reißerisch wirkender Ober- und ein wissenschaftlich komplexer Untertitel. “Der zornige Baron” steht als Metapher für die Persönlichkeit von Charles Mingus, die sich in seiner Musik widerspiegelt und biographische wie gesellschaftliche Unzufriedenheit abbildet. “Das Prinzip Diskontinuität im Leben und konzept-kompositorischen Schaffen des Charles Mingus jr.” steht für die wissenschaftliche Reflektion über Persönlichkeit und Musik. Ein Spagat also zwischen dem Begreifen und Beschreiben des enorm emotionalen Ausdrucks der Musik des Kontrabassisten und Bandleaders und ihrer Verwurzelung in Lebens- und Gesellschaftserfahrungen sowie der Analyse und Einordnung nach unterschiedlichen wissenschaftlichen Kriterien.
Heßlers Einleitung verweist dabei gleich auf seinen interdisziplinären Ansatz, der vor allem musiksoziologische, sozialpsychologische und musikanalytische Herangehensweisen miteinander verbinden will. Einer der roten Fäden, die sich durch seine Arbeit ziehen, ist dabei die stilistische Vielfältigkeit, der sich Mingus in seiner Arbeit bedient und die ihn Heßler “im Kontext des Idealtypus einer musikalischen Postmoderne” analysieren lässt – bereits hier ein Verweis auf die im Untertitel der Arbeit apostrophierte “Diskontinuität”. Ein zweiter roter Faden ist der Einfluss von Hautfarbe und tatsächlichem oder gefühltem Rassismus auf Mingus’ Werk und Ästhetik. Der problematischste der präsentierten Ansätze scheint auf den ersten Blick jener der sozialpsychologischen Methodik zu sein, innerhalb dessen Heßler die These aufstellt: “Im Verlauf seiner Sozialisation fühlte sich Charles Mingus jr. verschiedenen kulturellen Systemen zugehörig: dem weißen, dem mulattischen und dem schwarzen”, um dann aus den “unterschiedlichen sozialen Rollen, die er dabei einzunehmen hatte” seine “diskontinuierliche Persönlichkeitsstruktur und letztendlich [das] strukturbildende Merkmal der Diskontinuität in seiner Musik” abzuleiten (S. 64). Im folgenden dann bemüht Heßler Freud, Lacan und andere Psychoanalytiker, Philosophen und Soziologen, um Mingus’ Persönlichkeit aus seiner Familie, der sozialen Spannung seines Aufwachsens heraus zu erklären.
Das Kapitel über Mingus’ Sozialisation in Kindheit und Jugend beginnt Heßler mit einem Verweis auf die biologische Anthropologie bedient und spricht dabei – zugegeben: in Vorbereitung auf eine komplexere Betrachtungsweise – von “drei unterschiedlichen Erscheinungsformen (Rassen)” (S. 87), die Charles Mingus in sich vereinige. Im Wissen darum, worum es Heßler dabei tatsächlich geht, fühlte sich der Rezensent hier und in der folgenden Auseinandersetzung mit Mingus’ eigener Identitätskrise als Afro-Amerikaner doch etwas unwohl bei der Verwendung Hautfarbe beschreibender Termini. Es mag dies vielleicht mehr ein begriffliches als ein inhaltliches Problem sein: Im Deutschen jedenfalls sind Begriffe wie “Rasse”, “Mulatte” etc. nun mal belastet. Vielleicht wäre es hilfreicher, hier mit den englischen Originalbegriffen zu operieren, also “race”, “mulatto”, um dadurch den Unterschied der Konnotationen im Englischen und im Deutschen in den Terminus mit einzubeziehen. Überhaupt aber wäre es dem Thema angemessen (und dem Leser durchaus zuzumuten), die Quellen (etwa aus “Beneath the Underdog”) im englischen Original zu präsentieren statt in deutschen Übersetzungen oder das englische Original zumindest in Fußnoten zu zitieren.
Solche kritischen Anmerkungen beziehen sich allerdings eher auf Marginalien ins Heßlers Argumentation. Seine ausführlichen Darstellung von Mingus’ Biographie und deren Einfluss auf seine ästhetischen Haltungen macht letzten Endes sehr klar deutlich, dass Mingus vor allem ein soziales Identitätsproblem besaß, mit dem er sich in einer durch die Bedeutung von Hautfarbe dominierten Gesellschaft keiner der ihn umgebenden Gruppen richtig zugehörig fühlte. Seine Analysen von Aufnahmen des Komponisten beschreiben Klangeindrücke und Strukturabläufe, greifen charakteristische Details heraus und bieten auch schon mal interessante Vergleiche, etwa wenn er Mingus’ “The Chill of Death” Richard Strauß’ “Tod und Verklärung” gegenüberstellt. Gerade in Bezug auf diese Komposition wäre darüber hinaus eine Diskussion der Einordnung des Mingus’schen Schaffens in den Third-Stream-Diskurs der 50er Jahre interessant, an dem Mingus ja durchaus aktiv teilnahm.
Ein eigenes Kapitel widmet Heßler den musikalischen Einflüssen etwa durch Jelly Roll Morton, Art Tatum, Louis Armstrong, Lionel Hampton, Charlie Parker und Red Norvo. Er analysiert Übernahmen und Annäherungen an Mortons Stil, sowohl was den Ragtime als auch den Einfluss lateinamerikanischer Musik anbelangt. Er entdeckt den harmonischen Einfluss Tatums vor allem auf die kompositorische Sprache des Bassisten. Er benennt die klare Aussage durch improvisatorische Mittel, aber auch die New-Orleans-spezifischen Besetzungsdetails als Aspekte, die Mingus von Armstrong übernommen habe. Bei Hampton habe er sein Solotalent entdeckt (etwa in “Mingus Fingers”). Parker habe nicht nur neue musikalische Möglichkeiten aufgezeigt, sondern die Musik auch ins Politische hinein geöffnet; er habe ihm außerdem das Verständnis von Musik als Sprache vermittelt. Norvo habe kammermusikalische Klangkombinationen erforscht, die Mingus in späteren Bands auf andere Art und Weise fortführen sollte.
Eine ganz andere Herangehensweise an Mingus’ Musik versucht Heßler, indem er Studierende der Universität Dortmund einer Befragung zum Gesamteindruck über Stücke von Mingus, Frank Zappa und John Zorn unterzog – jeweils Stücken, die ähnlich wie Mingus mit strukturellen Brüchen arbeiteten. Er fragt nach Hörerwartungen und dem Erlebnis der kompositorischen und strukturellen Umbrüche im Ablauf der Stücke. Im selben Kapitel (das überschrieben ist mit “Mingus im Blickfeld von Philosophie und Soziologie”) fragt Heßler dann auch nach den ökonomischen Bedingungen, innerhalb derer Mingus’ Musik entstand. Er beschreibt wirtschaftliche Abhängigkeiten, Eigeninitiativen, etwa beim Plattenlabel Debut, beim Jazz Workshop oder der Firma Charles Mingus Enterprises.
Das Kapitel “The Angry Man” nähert sich dem zornigen Mingus – zornig gegenüber den Medien, gegenüber anderen Musikern, gegenüber dem Publikum. Das Kapitel “Mingus als homo politicus” betrachtet den Bassisten und Komponisten in seinen politischen Aussagen, die er sowohl in den Titeln seiner Kompositionen, in Ansagen oder eigenen Texten machte. Ausführlich diskutiert Heßler hier Stücke wie “Fables of Faubus”, “Freedom”, “Haitian Fight Song”, “Remember Rockefeller at Attica”, “Free Cell Block F, ‘Tis Nazi USA” und “Meditations on Integration” als politische Musik.
Im Schlusskapitel schließlich verschränkt Heßler die verschiedenen Argumentationsstränge seiner Arbeit noch einmal: Sklaverei und Rassismus, schwarze Musik und schwarze Identität, Diskontinuität als Personalstil, und wendet all diese Diskurse auf “Pithecanthropus Erectus” an.
Heßlers Arbeit ist eine ambitionierte Studie zur Persönlichkeit und Musik von Charles Mingus. Insbesondere in den theoretischen Diskursen ist das – dem thematischen Ansatz der Studie zuzuschreiben – schon mal etwas schwerfällig zu lesen; doch versäumt Heßler es nicht, diese theoretische Ebene immer wieder ins Praktische hinüberzuretten, und die von ihm benutzten Diskurse ganz konkret auf die Musik anzuwenden. Seine Studie ist dabei keine Gesamtstudie des Mingus’schen Schaffens – so fehlt etwa eine Diskussion über improvisatorische Facetten in Mingus’ Arbeit, über seinen Personalstil als Kontrabassist oder über die kommunikativen Aspekte seiner Werke –, aber das ist auch nicht das Thema des Buchs. Dem strukturellen Arbeiten in Mingus’ Musik fügt Heßler auf jeden Fall einige interessante Facetten bei und bereichert so die Literatur zu Charles Mingus um ein wichtiges Kapitel.
(Wolfram Knauer, März 2011)
Jazz Behind the Iron Curtain
herausgegeben von Gertrud Pickhan & Rüdiger Ritter
Frankfurt/Main 2010 (Peter Lang)
316 Seiten, 49,80 Euro
ISBN: 978-3-631-59172-7
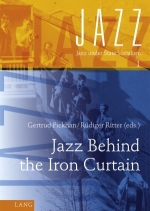 Das Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin hatte vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt unter dem Titel “Jazz im ‘Ostblock’ – Widerständigkeit durch Kulturtransfer” ins Leben gerufen, mit wissenschaftliche Arbeiten angeregt und unterstützt werden sollen, die sich mit der Geschichte des Jazz hinterm Eisernen Vorhang beschäftigen. Bei einer Tagung in Warschau im September 2008 wurden etliche dieser Projekte vorgestellt; das vorliegende Buch in englischer Sprache enthält die Referate der Warschauer Tagung und dabei in der Tat sehr vielfältige Ansätze an das vor allem als historisch begriffene Thema.
Das Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin hatte vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt unter dem Titel “Jazz im ‘Ostblock’ – Widerständigkeit durch Kulturtransfer” ins Leben gerufen, mit wissenschaftliche Arbeiten angeregt und unterstützt werden sollen, die sich mit der Geschichte des Jazz hinterm Eisernen Vorhang beschäftigen. Bei einer Tagung in Warschau im September 2008 wurden etliche dieser Projekte vorgestellt; das vorliegende Buch in englischer Sprache enthält die Referate der Warschauer Tagung und dabei in der Tat sehr vielfältige Ansätze an das vor allem als historisch begriffene Thema.
Insgesamt sind es 21 Beiträge sowie ein Tagungsbericht, aufgegliedert in fünf Schwerpunktgruppen: 1. USA – Europa, 2. Polen und die Sowjetunion als unterschiedliche Beispiele für die osteuropäische Jazzrezeption; 3. die baltischen Staaten; 4. Jazz in Zentral-Osteuropa; sowie 5. Jazz und Kunst.
Die meisten der Beiträge haben einen historischen Ansatz: Sie untersuchen Jazz als Zeichen der Widerständigkeit in totalitären Gesellschaften, als ein Symbol von Freiheit und Demokratie in Diktaturen. Als Gast der Tagung klopft der amerikanische Kulturwissenschaftler John Gennari das Verhältnis seines eigenen Landes, der USA, zum Freiheits-Topos des Jazz ab. Rüdiger Ritter schaut kritisch auf die Rolle des Radios, über das der Jazz viele aufstrebende Jazzfans im Osten erreichte, sei es über den RIAS, den AFN , Radio Free Europe oder die Voice of America.
Martin Lücke beleuchtet die Kampagne gegen den Jazz in der Sowjetunion der Jahre 1945-53; Michael Abeßer schließt an mit einer Darstellung der sowjetischen Jazz-Debatten zwischen 1953 und 1964. Marta Domurat liest die polnischen Zeitschriften “Jazz” und “Jazz Forum” und fragt nach ihrer Bedeutung für die ästhetische Akzeptanz dieser Musik. Piotr Baron nähert sich in einem der wenigen auf die Musik direkt abzielenden Beiträge des Buchs dem Phänomen “nationaler Stile” im Jazz am Beispiel des polnischen Jazz, stellt dabei letzten Endes aber vor allem Aussagen verschiedener polnischer Musiker nebeneinander, die Stimmungen, Haltungen wiedergeben, ohne diese anhand der Musik konkret näher zu beleuchten. Igor Pietraszewski schließlich nähert sich in einem eher soziologischen Ansatz der Lebenswirklichkeit polnischer Jazzmusiker.
Tiit Lauks Betrachtung des estnischen Jazz belässt es bei historischen Fakten; Heli Reimanns Annäherung an die Biographie des Lembit Saarsalu sagt weit mehr in den Interviewauszügen des Saxophonisten aus als in den Interpretationen derselben durch die Autorin. Gergö Havadi schaut für seinen Überblick über das Verhältnis des ungarischen Staats zum Jazz in die Berichte des ungarischen Geheimdienstes. Adrian Popan blickt auf ein “Jazz Revival” im Rumänien der Mitt-60er bis frühen 70er Jahre – mit Revival meint er hier ganz allgemein ein erstarkendes Interesse und vor allem ein vom System sanktioniertes Jazzleben nach einer Zeit weitgehender “Jazzlosigkeit”.
Peter Motycka widmet seinen Aufsatz der legendären Prager Jazz-Sektion, deren Aktivitäten letzten Endes mit zum Umbruch in der Tchechoslovakei beitrug. Christian Schmidt-Rost vergleicht, wie Musiker und Fans in der DDR und in Polen in den Jahren zwischen 1945 und 1961 mit dem Jazz in Berührung kamen. Marina Dmitrieva beleuchtet die “Stiliagi”, eine Art Jugendmode in der Sowjetunion, die eng mit dem Jazz assoziiert war und sich neben der Liebe zu dieser Musik auch in der Kleidung ausdrückte. Wiebke Janssen vergleicht die Jugendkultur der Halbstarken in der DDR und der BRD der 50er Jahre. Karl Brown dockt hier an und schreibt über Hooligans im kommunistischen Ungarn derselben Zeit. Michael Dörfel schließlich portraitiert die Jazz-und-Lyrik-Projekte, die in der DDR besonders populär waren.
All diese Beiträge bieten spannende und sehr unterschiedliche Ansätze an das Thema. Das Osteuropa-Projekt ist vor allem historisch orientiert, was sich auch in der Grundhaltung der Beiträge widerspiegelt. Und wenn man bedenkt, dass die Referenten hier aus ihrer laufenden Arbeit berichten, ist das gesamte Projekt nur zu beglückwünschen, schafft es doch ein Bewusstsein für eine historische Jazzforschung, die über kurz oder lang sicher über die Erfassung von Fakten und historisch-politische Zusammenhänge hinaus auch die Musik selbst betrachten wird.
Wolfram Knauer (März 2011)
Saxophone Colossus. A Portrait of Sonny Rollins
Fotos von John Abbott, Text von Bob Blumenthal
New York 2010 (Abrams)
160 Seiten, 45,00 US-$
ISBN: 978-0-8109-9615-1
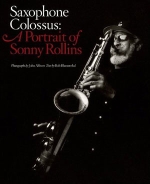 Der renommierte New Yorker Fotograf John Abbott dokumentierte Sonny Rollins seit 1993 auf und abseits der Bühne, und im vorliegenden Fotoband zeigt er, wie reich der Tenorsaxophonist ihn nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit exzellenten Motiven beschenkt hat. Wir sehen Rollins beim Newport Jazz Festival von 1993 vor jubelndem Publikum und Meer, beim Signieren von Schallplatten in seiner Berliner Garderobe, beim Soundcheck auf der Bühne der noch leeren Carnegie Hall, mit Pudelmütze beim Soundcheck in Frankfurt und Hamburg sowie in seinem Haus in Germantown, New York. Rollins ist eh fotogen, ob mit Rauschbart und wehenden Haaren, mit Hund oder mit Saxophon. Etliche von Abbotts meist farbigen Fotos zieren CDs, Plakate und Magazincover; man hat also durchaus sein Dejàvu-Erlebnis, etwa von Rollins ganz in rot oder von Rollins mit Christian McBride und Roy Haynes.
Der renommierte New Yorker Fotograf John Abbott dokumentierte Sonny Rollins seit 1993 auf und abseits der Bühne, und im vorliegenden Fotoband zeigt er, wie reich der Tenorsaxophonist ihn nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit exzellenten Motiven beschenkt hat. Wir sehen Rollins beim Newport Jazz Festival von 1993 vor jubelndem Publikum und Meer, beim Signieren von Schallplatten in seiner Berliner Garderobe, beim Soundcheck auf der Bühne der noch leeren Carnegie Hall, mit Pudelmütze beim Soundcheck in Frankfurt und Hamburg sowie in seinem Haus in Germantown, New York. Rollins ist eh fotogen, ob mit Rauschbart und wehenden Haaren, mit Hund oder mit Saxophon. Etliche von Abbotts meist farbigen Fotos zieren CDs, Plakate und Magazincover; man hat also durchaus sein Dejàvu-Erlebnis, etwa von Rollins ganz in rot oder von Rollins mit Christian McBride und Roy Haynes.
Dazwischen geschaltet sind Texte von Bob Blumenthal, der den Saxophonisten über die Jahre oft genug interviewte. Seine Kapitel strukturieren das Buch mit Überschriften wie “St. Thomas. Rollins & Rhythm” über die Liebe des Saxophonisten zu karibischen Rhythmen und sein Verhältnis zu Schlagzeugern; “You Don’t Know What Love Is. Sonny’s Sound” über ebendiesen, den kraftvollen Sound seines Instruments und den großen Einfluss Coleman Hawkins’; “Strode Rode. Rollins the Modernist” über Rollins Plattenproduktionen und den enormen Einfluss, den er selbst auf eine, ach was, gleich mehrere Generationen von Musikern hatte; sowie “Moritat. Sonny & Songs” über Sonny Rollins’ Liebe zur Melodie. Blumenthal gelingt dabei in der Konzentration eine knappe und doch sehr fundierte Charakterisierung der Rollins’schen Spielweise, so dass das Buch im ganzen – Fotos und Text zusammen – tatsächlich genau das ergeben, was der Titel des Buchs impliziert: “A Portrait of Sonny Rollins”. Liebevoll und empfehlenswert!
Wolfram Knauer (März 2011)
Unterhaltungsmusik im Dritten Reich
von Marc Brüninghaus
Hamburg 2010 (Diplomica Verlag)
106 Seiten, 39,50 Euro
ISBN: 978-3-8366-8813-0
 Jede Art der Kunst, vor allem aber die populäre Kunst war im Dritten Reich zugleich politisches Werkzeug. Der Jazz und die jazzverwandte Musik gehörten in den 1930er Jahren zur populären Musik, er verstieß allerdings zugleich gegen alle ästhetischen und rassischen “Reinheits”-Vorstellungen der Nazis. Marc Brüninghaus beschäftigt sich in seiner vorliegenden Arbeit mit der Rolle der Unterhaltungsmusik im Dritten Reich, fragt zugleich, wie es sein kann, dass “der Zeitraum von 12 Jahren, in dem von Deutschland aus größtes Leid über die Welt gebracht worden ist, gleichzeitig eine ‘Blüte’ einer unpolitisch erscheinenden Kunstform hervorbringen” konnte – insbesondere nämlich in den Schlagern von Stars wie Hans Albers, Marika Rökk, Zarah Leander oder Johannes Heesters.
Jede Art der Kunst, vor allem aber die populäre Kunst war im Dritten Reich zugleich politisches Werkzeug. Der Jazz und die jazzverwandte Musik gehörten in den 1930er Jahren zur populären Musik, er verstieß allerdings zugleich gegen alle ästhetischen und rassischen “Reinheits”-Vorstellungen der Nazis. Marc Brüninghaus beschäftigt sich in seiner vorliegenden Arbeit mit der Rolle der Unterhaltungsmusik im Dritten Reich, fragt zugleich, wie es sein kann, dass “der Zeitraum von 12 Jahren, in dem von Deutschland aus größtes Leid über die Welt gebracht worden ist, gleichzeitig eine ‘Blüte’ einer unpolitisch erscheinenden Kunstform hervorbringen” konnte – insbesondere nämlich in den Schlagern von Stars wie Hans Albers, Marika Rökk, Zarah Leander oder Johannes Heesters.
Nach seiner Einleitung beginnt Brüninghaus im zweiten Kapitel mit einer Bestandsaufnahme der Musiklandschaft im Dritten Reich, fragt nach ästhetischen und Wertevorstellungen im Bereich der “Ernsten” und der “Unterhaltungsmusik”, diskutiert die Idee einer “Deutschen Musik”, die sich als so schwer zu begründen herausstellte, dass sie spätestens 1936 aufgegeben wurde. Er diskutiert Wertmaßstäbe wie “Erhabenheit” im Bereich der Ernsten Musik und die Bevorzugung der Unterhaltungsmusik durch Propagandaminister Hoseph Goebbels, die “bei konservativen Musikern und Musikwissenschaftlern nicht nur auf Zustimmung” traf.
Im dritten Kapitel beleuchtet Brüninghaus die “Institutionalisierung der Musik im 3. Reich”, also insbesondere das “Amt Rosenberg” und die Reichsmusikkammer und ihre Aufgaben. Das vierte Kapitel widmet sich der politischen Rolle der Unterhaltungsmusik im nationalsozialistischen Deutschland, insbesondere ihrer Nutzbarkeit in Rundfunk, auf Schallplatten und im Film. Zugleich diskutiert der Autor die wechselnden Anforderungen an Unterhaltungsmusik während der zwölf Jahre der Nazi-Herrschaft sowie den Versuch einer Neudefinition von Kriterien für gute Unterhaltungsmusik – insbesondere letzteres ein klarer Vorstoß gegen den Jazz.
Dem Jazz wird das ganze fünfte Kapitel gewidmet. Brüninghaus macht klar, dass der Jazz “während des Dritten Reiches die am stärksten bekämpfte Musikrichtung im Bereich der Unterhaltungsmusik” war. Er ordnet den Jazzhass der Nazis ein in rassistisch und antisemitisch begründete Ablehnung dieser Musik bereits in den 1920er Jahren, beschreibt den Unterschied von staatlichem Anspruch und Realität (also dem Wunsch, Jazz aus dem Alltag zu verdrängen und der Popularität der Musik in der Bevölkerung). Er zitiert offizielle Stellungnahmen und die Umsetzung der Regeln in der musikalischen Wirklichkeit, und er benennt die unterschiedlichen Wege, auf denen Jazzanhänger dennoch ihre Musik hörten. Brüninghaus definiert die Jazzanhänger dabei als eine heterogene Gruppe, eher lokal verortet, “meist männliche Angehörige der Mittelschicht, Angehörige der Unterschicht wollten durch die Zugehörigkeit zu Jazzclubs oft den eigenen sozialen Status verbessern”. Längere Abschnitte widmet er in diesem Kapitel außerdem den “Jazzanhängern im Dienst des Regimes” sowie der Swingbewegung als einer Jugendbewegung der Zeit.
Alles in allem ist Brüninghaus eine knappe, aber durchaus der Sache angemessene Studie zur Situation der Unterhaltungsmusik im Dritten Reich gelungen. Er blendet biographische Details aus, schreibt weder über konkrete Musiker, Bands oder Aufnahmen, sondern konzentriert sich auf das Auseinanderdriften von öffentlicher Haltung und alltäglicher Wirklichkeit. Der Verweis auf die eine oder andere Quelle fehlt (etwa auf die samisdat-ähnlichen “Mitteilungen” zum Jazz, die in den Kriegsjahren vor allem auch an Wehrmachtsanhänger verschickt wurden und die 1993 im Buch “Jazz in Deutschland” des Jazzinstituts Darmstadt reproduziert wurden); das aber sind eher Randnotizen des Rezensenten. Auch bleibt Brüninghaus zum Schluss die Antwort auf die in der Einleitung dezidiert gestellte Frage schuldig bleibt, warum viele der Schlager, die in den 1930er Jahren geschrieben waren, noch heute populär sind. Doch hatte man diese Eingangsfrage während der Lektüre eh schon wieder vergessen, und so bleibt “Unterhaltungsmusik im Dritten Reich” eine lesenswerte Einführung ins Thema.
Wolfram Knauer (März 2011)
Hi-De-Ho. The Life of Cab Calloway
von Alyn Shipton
New York 2010 (Oxford University Press)
283 Seiten, 29,95 US-$
ISBN: 978-0-19-514153-5
 Alyn Shipton ist ein Vielschreiber, seine Biographien decken die Jazzgeschichte zwischen Swing und Modern Jazz ab, ein wenig wirkt er wie der Nachfolger John Chiltons, des phänomenalen Biographen von Sidney Bechet, Coleman Hawkins und anderen.
Alyn Shipton ist ein Vielschreiber, seine Biographien decken die Jazzgeschichte zwischen Swing und Modern Jazz ab, ein wenig wirkt er wie der Nachfolger John Chiltons, des phänomenalen Biographen von Sidney Bechet, Coleman Hawkins und anderen.
Shiptons neues Buch geht der Lebensgeschichte eines der größten Hipsters (wenn nicht gar des ersten) der Jazzgeschichte nach, Cab Calloways, dessen Einfluss auf die schwarze Musikgeschichte gar nicht groß genug eingeschätzt werden kann, weil er von in seiner Musik und seiner Bühnenpersönlichkeit schwarze Sprache und schwarze Kultur als Hipness feierte und dabei weit über die afro-amerikanische Bevölkerung hinaus populär machte.
Shipton ist ein Detektiv biographischer Forschung, wühlte in Archiven und sprach mit Zeitzeugen, Freunden, Bekannten, Kollegen und Geschäftspartnern des Sängers und Orchesterleiters. Er verfolgt Calloways Lebensweg ab seiner Geburt am Weihnachtstag 1907 in Baltimore. Calloways ältere Schwester Blanche war die erste, die eine Showbusiness-Karriere begann; sie schloss sich 1921 einer Tourband an und gehörte im Herbst 1924 bereits zu den etablierten Figuren der Chicagoer Jazzszene. 1927 kam Cab nach Chicago, sang in verschiedenen Clubs und lernte Louis Armstrong kennen, dessen Gesangsstil ihn besonders beeinflusste. Nachdem Armstrong Chicago in Richtung New York verließ, trat Calloway mit den Alabamians im Chicagoer Sunset Club auf, doch nach einem legendären Band-Wettstreit im New Yorker Savoy Ballroom wechselte er die Bands, trat mit den Missourians auf, die sich nicht viel später zum Cab Calloway Orchestra wurden. Mit ihnen und mit seinem Engagement im New Yorker Cotton Club beginnt zugleich die Zeit, in der Calloway auf Platten dokumentiert ist.
Shipton verweist auf Einflüsse aus dem afro-amerikanischen Showbusiness, von der Show “In Dahomey” bis zum Comedy-Duo Williams & Walker, noch mehr aber stellt er heraus, was Calloway aus diesen und anderen Einflüssen machte, wenn er die verschiedenen Timbres seiner Stimme einsetzte, um quasi mit sich selbst Call-and-Response-Phrasen zu erzeugen, wenn er scattete wie Armstrong, aber eben doch nicht wie der, sondern in seinem ganz eigenen Stil, der etwas sauberer wirkte und dennoch leicht verrucht, dem immer ein leichter Unterton der Ironie innezuwohnen schien.
Irving Mills, der Manager Duke Ellingtons erkannte, dass Calloway marktfähig war und übernahm schnell sein Management. Er pries ihn als “His Hi-De-Highness of Ho-De-Ho” an und machte so aus der Hipness des immer extravagant gekleideten Calloway ein Markenzeichen. Shipton beschreibt jene legendären drei Betty-Boop-Cartoons, die Calloway und seine Musik Anfang der 1930er Jahre auf die Leinwand brachten; er beschreibt aber auch die durch Calloways Popularität bedingte Schieflage im Niveau seiner Band: “Weil Cabs Band um ihn herum und seine Rolle als Sänger, Tänzer und Entertainer gebaut war statt um hoch-individuelle Solisten, auf die einzelne Kompositionen direkt zugeschneidert wurden, fiel sie im kritischen Vergleich immer etwas ab.”
Der Autor begleitet Calloway auf seiner Europatournee von 1934, die großen Einfluss hatte, da insbesondere die europäischen Fans Calloways Mode und Teile seiner Sprache übernahmen – die ZaZous, wie sich die französischen Swinganhänger in den 1930er Jahren nannten, leiteten sich direkt aus Calloways Texten ab.
Shipton beschreibt die “großen” Bands Calloways, jene mit Ben Webster Mitte der 1930er Jahre und jene mit Chu Berry Ende der 1930er Jahre und geht dabei auch auf wichtige Aufnahmen ein. Natürlich erzählt er die Geschichte Dizzy Gillespies, der von 1939 bis 1941 in der Band saß, bis ihn Calloway feuerte, weil er ihn (fälschlich) beschuldigte, mit einem Papierball nach ihm geworfen zu haben, was in einen Streit ausartete, bei dem Gillespie schließlich ein Messer zückte. Immerhin hatte Dizzy, während er in Calloways Band spielte, zusammen mit Milt Hinton harmonische Neuerungen ausprobiert, die wenig später bei der Entwicklung des Bebop von Bedeutung sein sollten.
Mit dem Krieg und dem Bebop begann der Niedergang der Bigbands, und Cab Calloway suchte nach neuen Möglichkeiten für seine Karriere. Die fand er als er 1952 die Rolle des Sportin’ Life in Gershwins Oper “Porgy and Bess” angeboten bekam, die Gershwin seinerseits nach dem Modell Calloways entworfen hatte, den er angeblich sogar für die Premiere der Oper 1935 als mögliche Besetzung im Sinn gehabt habe. “Porgy” wurde ein Riesenerfolg, sowohl in der Broadway- wie auch (zumindest kurz) in der Tournee-Version der Show. In den folgenden Jahren zog sich Calloway etwas zurück, bis ihm 1964 eine Rolle in “Hello Dolly” angeboten wurde.
In den 1970er Jahren waren Calloways Auftritte mehr Erinnerung an eine vergangene Zeit als wirklich aktuelle Musik; immerhin übernahm er 1978 eine Rolle im Broadway-Hit “Bubbling Brown Sugar”. Als er 1980 im Film “The Blues Brothers” zu sehen war, wurde allerdings eine neue, junge Generation hip über den Erfinder der Hipness. Calloway stand noch bis kurz vor seinem Tod im November 1984 auf der Bühne.
Shipton erzählt Calloways Geschichte als neutraler Beobachter, durchsetzt mit Verweisen auf Quellen aus zeitgenössischen Berichten, Interviews oder sonstige Quellen. Zwischendurch beleuchtet er auch etwa die kurze Ehe der Calloway-Tochter und Sängerin Chris Calloway mit dem Trompeter Hugh Masekela (sie hielt gerade mal drei Monate). Allerdings betrachtet er Calloway vor allem als historisches Phänomen und verpasst dabei ein wenig die Chance, ihn als Vorreiter weit späterer schwarzer Gesamtkunstwerke zu benennen – James Brown, Michael Jackson, Prince –, die dem weiß-gewandeten Calloway viel zu verdanken hatten. Nichtsdestotrotz ist diese Biographie ein solides Buch Jazzgeschichte und ergänzt damit hervorragend die 1976 erschienene Autobiographie des Sängers, Tänzers und Entertainers.
Wolfram Knauer (März 2011)
Ray Charles. Yes Indeed! Photographs by Joe Adams
Guildford, Surrey/England 2010 (Genesis Publications Limited)
152 Seiten, 235 Britische Pfund
ISBN: 978-1-905662-08-1
 Ray Charles war Star und Legende, und nur solchen wird es wohl zuteil, in enorm exklusiv aufgemachten Publikationen verewigt zu werden. “Ray Charles. Yes Indeed!” jedenfalls ist nichts geringeres, ein Coffee-Table-Buch zum Blättern und Erinnern, an eigene oder imaginierte Erlebnisse zur Musik des großen Soulkünstlers. Joe Adams arbeitete 44 Jahre lang für Ray Charles als Bühnenansager und Master of Ceremonies. Seine Kamera hatte er immer mit dabei, und so entstand eine Sammlung ungemein persönlicher Fotos von Konzerten, Proben, Aufnahmesitzungen, auf der Bühne, in der Garderobe, im Flieger oder vor Fernsehkameras. Die Dias wurden nach Charles Tod im den Büroräumen der Produktionsfirma des Künstlers gefunden. Sie zeigen vor allem einen Musiker, der allein durch seinen Starstatus offenbar immer im Mittelpunkt stand, der selbst in ruhigen Minuten, bei der Tasse Kaffee in der Garderobe, dem musikalischen Augenblick entgegenfieberte. Das Besondere des Buchs ist sicher auch die Tatsache, dass alle Fotos Farbaufnahmen sind, was dem Genre, in dem Charles tätig war, entgegenkommt: die Zeit des Soul war nun mal eine Zeit der bunten Farben.
Ray Charles war Star und Legende, und nur solchen wird es wohl zuteil, in enorm exklusiv aufgemachten Publikationen verewigt zu werden. “Ray Charles. Yes Indeed!” jedenfalls ist nichts geringeres, ein Coffee-Table-Buch zum Blättern und Erinnern, an eigene oder imaginierte Erlebnisse zur Musik des großen Soulkünstlers. Joe Adams arbeitete 44 Jahre lang für Ray Charles als Bühnenansager und Master of Ceremonies. Seine Kamera hatte er immer mit dabei, und so entstand eine Sammlung ungemein persönlicher Fotos von Konzerten, Proben, Aufnahmesitzungen, auf der Bühne, in der Garderobe, im Flieger oder vor Fernsehkameras. Die Dias wurden nach Charles Tod im den Büroräumen der Produktionsfirma des Künstlers gefunden. Sie zeigen vor allem einen Musiker, der allein durch seinen Starstatus offenbar immer im Mittelpunkt stand, der selbst in ruhigen Minuten, bei der Tasse Kaffee in der Garderobe, dem musikalischen Augenblick entgegenfieberte. Das Besondere des Buchs ist sicher auch die Tatsache, dass alle Fotos Farbaufnahmen sind, was dem Genre, in dem Charles tätig war, entgegenkommt: die Zeit des Soul war nun mal eine Zeit der bunten Farben.
Einleitend berichtet Adams selbst von seiner Arbeit für Charles, und auch Ray Charles selbst kommt zu Wort in einem Kapitel, in dem er knapp über seine Karriere bis zum Ende seines Atlantic-Vertrags erzählt. Zwischendrin finden sich kurze Zitate von Zeitgenossen, Musikerkollegen, Produzenten, Freunden, die sich an Ray Charles als Musiker, als Geschäftsmann, als Privatmensch erinnern.
“Ray Charles. Yes Indeed!” ist ein opulentes Buch, das sicher keine Biographie des Künstlers ersetzt und auch der Musik nur bedingt nahe kommt, das aber den Menschen Charles erahnen lässt in den visuellen wie verbalen Erinnerungen. Und es ist gewiss – mit Ledereinband, Silberschnitt, dickem Pappschuber udn einem hellblauen Stoffsäckchen, in dem das alles sauber aufbewahrt wird – ein exquisites (dabei leider auch entsprechend teures) Geschenk für jeden Ray-Charles-Fan.
Wolfram Knauer (Februar 2011)
Coltrane on Coltrane. The John Coltrane Interviews
herausgegeben von Chris DeVito
Chicago 2010 (Chicago Review Press)
396 Seiten, 26,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-56976-287-5
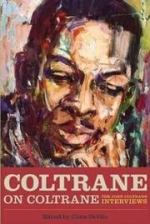 Hätte John Coltrane eine Autobiographie geschrieben, so läse diese sich gewiss völlig anders als das Buch “Coltrane on Coltrane”, das Chris DeVito aus veröffentlichten wie bislang unveröffentlichten Interviews mit dem Saxophonisten zusammenstellte. Die berühmten Interviews, etwa von August Blume, Don DeMichael, Ralph Gleason, Valerie Wilmer, François Postif oder Frank Kofsky sind genauso mit dabei – zum Teil in neuen Abschriften oder gar erstmaligen englischen Übersetzungen – wie kürzere Interview, Interviewausschnitte oder Artikel und Plattentexte, in denen Coltrane zu Worte kommt. Selbst ein wenig Fankorrespondenz ist da zu lesen, auch Interviews, in denen Coltrane sich vielleicht nicht ganz so wohl fühlte, etwa wenn er die Eingangsfrage Erik Lindgrens in Stockholm, was er zu den vielen kritischen Kommentaren über seinen Sound missversteht und denkt, Lindholm selbst hielte seinen Ton für scheußlich. Neues erfährt man dabei kaum; Coltrane war auch in beiläufigen Interviews ein seiner Worte bedächtiger Mann. Ausführliche Erinnerungen eines Jugendfreundes sowie der Leiterin der Granoff School, an der er in den 40er und frühen 50er Jahren Unterricht nahm. Eine opulente Sammlung immerhin, ein “case book” für weitere Forschung und als solches äußerst willkommen, hat man doch damit alle Quellen in einem Band vor sich. Aus Forschersicht sei allerdings auch in diesem Buch (wie auch bei anderen solchen Quellensammlungen) kritisch angemerkt, dass es wünschenswert wäre, wenn in den Texten die Seitenumbrüche angegeben würden, so dass man beim Zitieren auch entsprechend der Originalquellen zitieren kann. Aber das ist nun wirklich nur eine kleine Fußnote…
Hätte John Coltrane eine Autobiographie geschrieben, so läse diese sich gewiss völlig anders als das Buch “Coltrane on Coltrane”, das Chris DeVito aus veröffentlichten wie bislang unveröffentlichten Interviews mit dem Saxophonisten zusammenstellte. Die berühmten Interviews, etwa von August Blume, Don DeMichael, Ralph Gleason, Valerie Wilmer, François Postif oder Frank Kofsky sind genauso mit dabei – zum Teil in neuen Abschriften oder gar erstmaligen englischen Übersetzungen – wie kürzere Interview, Interviewausschnitte oder Artikel und Plattentexte, in denen Coltrane zu Worte kommt. Selbst ein wenig Fankorrespondenz ist da zu lesen, auch Interviews, in denen Coltrane sich vielleicht nicht ganz so wohl fühlte, etwa wenn er die Eingangsfrage Erik Lindgrens in Stockholm, was er zu den vielen kritischen Kommentaren über seinen Sound missversteht und denkt, Lindholm selbst hielte seinen Ton für scheußlich. Neues erfährt man dabei kaum; Coltrane war auch in beiläufigen Interviews ein seiner Worte bedächtiger Mann. Ausführliche Erinnerungen eines Jugendfreundes sowie der Leiterin der Granoff School, an der er in den 40er und frühen 50er Jahren Unterricht nahm. Eine opulente Sammlung immerhin, ein “case book” für weitere Forschung und als solches äußerst willkommen, hat man doch damit alle Quellen in einem Band vor sich. Aus Forschersicht sei allerdings auch in diesem Buch (wie auch bei anderen solchen Quellensammlungen) kritisch angemerkt, dass es wünschenswert wäre, wenn in den Texten die Seitenumbrüche angegeben würden, so dass man beim Zitieren auch entsprechend der Originalquellen zitieren kann. Aber das ist nun wirklich nur eine kleine Fußnote…
Wolfram Knauer (Februar 2011)
Klänge im Zeitalter ihrer medialen Verfügbarkeit. Popmusik auf globalen Märkten und in lokalen Kontexten
Von Susanne Binas-Preisendörfer
Bielefeld 2010 (transcript)
277 Seiten, 27,80 Euro
ISBN: 978-3-8376-1459-6
 Globalisierung, mediale Verfügbarkeit, das tagesaktuelle Wissen um Entwicklungen in anderen Kulturen und die schnelle Kommunikation sind Gegebenheiten unseres heutigen Lebens, die uns alle betreffen, und alle Bereiche unseres Lebens beeinflussen. Der Jazz, meint man, hat unter den Globalisierungstendenzen weniger zu leiden, weil er immer eine individualisierte und zumal noch eine “Minderheiten”-Musik war und die neuen Medien ihm vielleicht noch mehr nutzen als anderen Musiksparten. Doch den Jazz betrifft es natürlich auch, ist er schließlich nicht nur Genre, sondern eine Spielhaltung und hat doch gerade der Jazz immer global gehandelt, ist als musikalische Sprache durch die Welt gereist und hat Musiker immer dazu aufgefordert, “sie selbst” zu sein, “sich selbst” zu spielen. Susane Binas-Preisendöfer allerdings widmet sich der populären Musik, bei der die Gegensätze, die Frage nach Nutzen und Ausnutzen globaler Tendenzen sich weit stärker stellt als beim Jazz.
Globalisierung, mediale Verfügbarkeit, das tagesaktuelle Wissen um Entwicklungen in anderen Kulturen und die schnelle Kommunikation sind Gegebenheiten unseres heutigen Lebens, die uns alle betreffen, und alle Bereiche unseres Lebens beeinflussen. Der Jazz, meint man, hat unter den Globalisierungstendenzen weniger zu leiden, weil er immer eine individualisierte und zumal noch eine “Minderheiten”-Musik war und die neuen Medien ihm vielleicht noch mehr nutzen als anderen Musiksparten. Doch den Jazz betrifft es natürlich auch, ist er schließlich nicht nur Genre, sondern eine Spielhaltung und hat doch gerade der Jazz immer global gehandelt, ist als musikalische Sprache durch die Welt gereist und hat Musiker immer dazu aufgefordert, “sie selbst” zu sein, “sich selbst” zu spielen. Susane Binas-Preisendöfer allerdings widmet sich der populären Musik, bei der die Gegensätze, die Frage nach Nutzen und Ausnutzen globaler Tendenzen sich weit stärker stellt als beim Jazz.
Ihre Ausgangsfragen sind einfach: Wie verändert die Globalisierung die Popmusik? Wie bedingen sich die kulturell-sozialen und die technologisch-ökonomischen Aspekte von Popmusik und Globalisierung gegenseitig?
Im ersten Kapitel befasst sich die Autorin mit übergreifenden Aspekten zum Themenbereich und geht auf einzelne Beispiele ein. Sie diagnostiziert die “globale Präsenz” populärer Musik und die daraus sich ableitende Ortlosigkeit, der die Ortsgebundenheit einzelner populärer Musikerscheinungen gegenübersteht (Detroit-Techno, Berlin-Dub, Wiener Electronica). Sie fragt nach globalisierten Formen von Musik, also solchen Formen, die erst durch die Globalisierung möglich wurden. Sie überlegt, was tatsächlich an kulturellem Austausch stattfindet in dieser Globalisierung, und sie diskutiert die Beispiele der Ausnutzung lokaler traditioneller Musiken durch die aktuelle Popmusikindustrie, wenn etwa ein pazifisches Wiegenlied es auf die amerikanischen Billboard-Charts schafft und in Dance-Tracks eingebaut wird. Dieses Beispiel verfolgt sie dabei wieder aus verschiedenen Blickwinkeln, untersucht dabei die Marktmechanismen genauso wie die emotionalen Effekte, die musikethnologischen Gründe für die ursprüngliche Aufnahme des Liedes und die moralischen Aspekte seiner weltweiten Verwendung und Vermarktung ohne Rücksicht auf den Ursprung und ohne Nachdenken, was seine globale Verbreitung für Rückwirkungen haben könnte. Sie blickt dabei auf die verschiedenen Akteure im Musikprozess, betrachtet die Rechtslage, fragt nach ästhetischen Kriterien (warum ist ein pazifisches Wiegenlied für europäische Ohren angenehm?) und konstatiert die Suche nach der authentischen Fremdheit.
Im zweiten Kapitel geht es um Musiken der Welt, um World Music, um Global Pop, um die kulturelle Durchdringung musikalischer Traditionen also. Musik sei eine universale Sprache, hieße es immer wieder, zitiert die Autorin verschiedene Quellen, also werde Musik oft auch als eine universelle Problemlösung angesehen. (Tatsächlich sei europäische Kunstmusik eine veritable Weltmusik.) Dann befasst Binas-Preisendörfer sich mit Migration und kulturellem Austausch, mit der Frage um Homogenisierung oder Diversifizierung und mit der seltsamen Repertoirekategorie und Marketingstrategie “World Music” im 20sten Jahrhundert.
Das dritte Kapitel des Buchs beschäftigt sich mit der medialen Verfügbarkeit. Die Autorin beginnt mit einem Blick zurück auf die Entwicklung der Tonaufnahme und Vervielfältigungstechnologien. Sie dokumentiert die unterschiedlichen Umgänge mit Tondokumenten, die zum einen der Archivierung dienten, zum anderen eine Ware waren und damit bewusst marktgerecht verändert werden sollten. Sie nennt den Tonträger “eine Existenzform populärer Musik” und verweist auf die Entwicklung der Musikkassette in den 1960er Jahren als dezentralisierendes Format. Sie diskutiert Sampling und Copyright und schließlich die Bedeutung lokaler Märkte für die global agierende Musikwirtschaft. Zum Schluss stellt sie die Strategien der Musikgiganten gegenüber: “Think Globally, Act Locally” (SONY), “Globalize Local Repertoire” (BMG) und “One Planet – One Music” (MTV).
Susanne Binas-Preisendörfers Buch ist eine umfangreiche Analyse der globalen Aspekte populärer Musikkultur. Der Autorin gelingt es ihr komplexes Thema sachgerecht und dennoch gut lesbar zu sezieren, Denkanstöße zu geben und klarzustellen, dass sie letzten Endes über eine Entwicklung schreibt und damit nur ein Augenblicksurteil abgeben kann für Veränderungen, von denen man kaum absehen kann, wie sie weitergehen. Über den Jazz schreibt sie nicht, aber den Jazz als die erste globale populäre Musik betrifft ihre Analyse genauso wie jede Musik, die den Spagat ästhetischen Wollens und aktueller Marktgängigkeit eingehen muss.
Wolfram Knauer (Februar 2011)
Goin’ Home. The Uncompromising Life and Music of Ken Colyer
von Mark Pointon & Ray Smith
London 2010 (Ken Colyer Trust)
368 Seiten + CD, 20 Britische Pfund
ISBN: 978-0-9562940-1-2
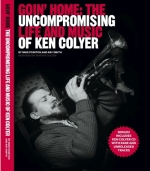 Das Wort “kompromisslos” kommt einem normalerweise wahrscheinlich eher bei Musikern avantgardistischer Stilrichtungen in den Sinn, und so mag es den oberflächlichen Kenner erstaunen, dass ausgerechnet dieses Wort den Titel der neuen umfangreichen Biographie des Trompeters Ken Colyer schmückt, der gemeinhin als die Vorzeigefigur für das Revival des New-Orleans-Jazz in England (und weit darüber hinaus in Europa) gilt, also alles andere als einem Genre der Avantgarde, weder der 40er, 50er noch 60er Jahre. Trotzdem hat es seine Berechtigung, Colyers Ästhetik als kompromisslos zu bezeichnen, und das großformatige Buch, das Mike Pointon und Ray Smith liebevoll zusammengestellt haben, erklärt warum dies so ist.
Das Wort “kompromisslos” kommt einem normalerweise wahrscheinlich eher bei Musikern avantgardistischer Stilrichtungen in den Sinn, und so mag es den oberflächlichen Kenner erstaunen, dass ausgerechnet dieses Wort den Titel der neuen umfangreichen Biographie des Trompeters Ken Colyer schmückt, der gemeinhin als die Vorzeigefigur für das Revival des New-Orleans-Jazz in England (und weit darüber hinaus in Europa) gilt, also alles andere als einem Genre der Avantgarde, weder der 40er, 50er noch 60er Jahre. Trotzdem hat es seine Berechtigung, Colyers Ästhetik als kompromisslos zu bezeichnen, und das großformatige Buch, das Mike Pointon und Ray Smith liebevoll zusammengestellt haben, erklärt warum dies so ist.
Die beiden Autoren haben Erfahrung mit dem Thema; sie schrieben zuvor eine Biographie Bill Russells, des Vaters des US-amerikanischen New-Orleans-Jazz-Revivals. Ihr Ansatz ist der einer Biographie mit vielen Zeitzeugenaussagen. Sie interviewten Musikerkollegen und mischen diese Erinnerungen – ein wenig wie in Shapiro Hentoffs legendärem “Hear Me Talkin’ To Ya” mit Auszügen aus Manuskriptfragmenten und Notizen, die Colyer für ein geplantes eigenes Buch auf Hotelbriefpapier und die Rückseiten von Flugtickets geschrieben hatte. Dazu kommen viele, zum großen Teil seltene Fotos, die Colyers Karriere dokumentieren.
Es beginnt mit dem Kapitel “Sounds in My Head”, einer Annäherung an Colyers musikalische Ästhetik. Natürlich habe er die New-Orleans-Trompeter geliebt, Percy Humphrey etwa. Louis Armstrongs In-den-Vordergrund-Spielen habe er nicht unbedingt für der Musik dienlich empfunden. Andererseits habe er immer enorm lyrisch gespielt, sei keiner dieser “Stomper” gewesen, die quasi mit der Rhythmusgruppe mitgespielt hätten. Es gäbe, sagt sein Trompeterkollege Pat Hawes an einer Stelle gar, eine direkte Verbindung zwischen Colyer und Miles Davis. Ein Jazzfan sei er gewesen, ein wenig mürrisch oft, manchmal sogar ein Bully gegenüber seinen Kollegen. Aber wenn man in seine Band kam, wusste man, was man zu erwarten hatte. Colyer spielte, was ihm gefiel; er hatte seine konkreten ästhetischen Vorstellungen, und er kannte dabei kein links und kein rechts. Das mag für moderne Ohren altbacken klingen, aber wer immer ihm rein musikalisch zuhörte, musste das anerkennen, selbst Dizzy Gillespie, wie Ron Ward erzählt; der habe bei einem Konzert, bei dem die Bands der beiden in Leicester auftraten, eine halbe Stunde aufmerksam zugehört und ihm dann ein Kompliment gemacht. Judy Garland und Frank Sinatra habe Colyer gemocht, erfahren wir, habe aber keine Lust dazu gehabt sich selbst Showbusiness-Praktiken zu unterwerfen, sondern habe einzig durch die Musik überzeugen wollen. Auch im Mittelpunkt habe er eigentlich nie stehen wollen, weil es sich in der Ästhetik des New-Orleans-Jazz nun mal um das Ensemble drehe, nicht um den Bandleader. Mitmusiker berichten darüber, was sie konkret von Colyer gelernt hätten, und immer wieder, das prägt durchaus die Ehrlichkeit des Buchs, sind die Lobeshymnen mit einem “aber” oder einem “wenn er gute Laune hatte” durchsetzt und zeigen so die offenbar allseits bekannte komplexe Persönlichkeit Colyers.
Das zweite Kapitel widmet sich dem 51 Club in der Great Newport Street in London, in dem Ken Colyer ab Mitte der 1950er Jahre so oft spielte – allein im Programmzettel für einen April in den 1950er Jahren, der im Buch reproduziert wird an acht Terminen –, dass der Club bald umbenannt wurde in “Ken Colyer Club”.
In Kapitel drei lesen wir über Colyers Kindheit, über seine Familie und darüber, wie er zum Jazz kam. Mit 12 Jahren habe er die Bluesplattens eines Bruders verschlungen und bald auf einer Mundharmonika dazu gespielt. Gleich nach dem Krieg trat er der Handelsmarine bei. In Kanada, erzählt Colyer, habe er Louis Metcalf erlebt, und dann sei plötzlich Oscar Peterson in den Club gekommen, der Pianist hätte sofort sein Instrument verlassen und hinter Peterson habe sich eine Menschentraube gebildet, alles Pianisten, die auf seine Hände starrten. In New York hörte er Wild Bill Davison, Pee Wee Russell und andere, und seine Erinnerungen gehören mit zu den lebendigsten über die New Yorker Dixieland/Swingszene der späten 1940er Jahre, die ich kenne.
Kapitel vier widmet sich der Crane River Jazz Band. Colyer war von verschiedenen Bands abgelehnt worden, bei denen er sich beworben hatte – sie wollten eher im Stile Eddie Condons oder Lu Watters’ spielen als im authentischen New-Orleans-Stil, der Colyer vorschwebte. Also gründete er mit Freunden einfach seine eigene Band, in der Besetzung von King Oliver’s Creole Jazz Band: zwei Trompeten, Klarinette, Posaune, Piano, Banjo, Kontrabass und Schlagzeug. Die Band probte in einem Pub in Cranford, und irgendwann kam einer auf die Idee, bei den eh anwesenden Gästen mit dem Hut rumzugehen, was immerhin die Kosten für die Proben-Biere reinbrachte. Dann fingen die Leute an, zur Musik der Proben zu tanzen – es störte sie nicht, wenn die Band mittendrin mal abbrach, um das Stück nochmal zu beginnen. Im Juli 1951 spielte die Band bei einem Konzert, bei dem auch die Prinzessinnen Margaret und Elisabeth anwesend waren – die Organisatoren hatten überredet werden müssen, die Band spielen zu lassen; sie fürchteten, die Band spiele zu “dirty” für die königlichen Ohren.
Kapitel fünf berichtet von den Christie Brothers Stompers, mit denen Colyer in jenen frühen Jahren ebenfalls spielte. Kapitel sechs handelt dann von Colyers erster Reise nach New Orleans, wieder dokumentiert durch Briefe und Erinnerungsfragmente des Trompeters. Hier war Colyer beides: Musiker und Fan. Er spielte und er traf auf all die Zeitzeugen des frühen Jazz, konnte seine Vorstellung von der Ästhetik des New-Orleans-Jazz am Original überprüfen. Im Februar 1953 wurde er für 38 Tage unter Arrest gestellt, weil er länger geblieben war als sein Visum es ihm erlaubt hatte. Vor den Beamten der Einwanderungsbehörde gab er zu, dass er in New Orleans bleiben wollte, um Jazz zu studieren, offenbar Grund genug für die Behörde, ihn nicht auf Kaution freizulassen, wie ein zeitgenössischer Artikel berichtet. Colyer wurde schließlich in ein Abschiebegefängnis in Ellis Island, New York, gebracht und dann des Landes verwiesen. Auch dieses Kapitel gibt einen der besten Einblicke in die New-Orleans-Szene jener Jahre, den ich kenne – vielleicht gerade, weil es ein Blick von außen ist.
In Kapitel sieben geht es um die Popularisierung des New-Orleans-Jazz in London und die anderen Musiker dieser Szene, Monty Sunshine, Chris Barber, Lonnie Donegan. Kapitel acht beschäftigt sich mit den ersten Platteneinspielungen, dem langsamen Ruhm der Band über die Grenzen Englands hinaus, ersten Tourneen, beispielsweise einem zweimonatigen Gig in der New Orleans Bier Bar in Düsseldorf, der dann auf vier Monate verlängert wurde und – Colyer zufolge – die Jazzwelt Deutschlands verwandelte und sie einer anderen Art von Musik gegenüber geöffnet habe.
Kapitel neun ist das längste Kapitel des Buchs und widmet sich der “klassischen” Band Colyers, seiner Mitwirkung bei Street Parades, zeigt auch ein Foto, auf dem Ken Colyer 1957 den legendären Dobbell’s Record Shop einweiht, indem er eine 78er-Schallplatte auf dem Tresen des Geschäftes zerbricht. Vor allem aber berichtet das Kapitel von Colyers zunehmender US-amerikanischen Gefolgschaft und davon, wie es 1957 zu dem legendären Besuch des Klarinettisten George Lewis in England und den darauf folgenden Tourneen der beiden Musiker beiderseits des Atlantiks kam.
Kapitel 10 beleuchtet den Skiffle-Craze der späten 1950er, frühen 1960er Jahre, an dem Colyer zusammen mit Lonnie Donegan besonders beteiligt waren. In Kapitel 11 geht es um den “Trad Boom” jener Jahre, aber auch um Colyers Meinung zu anderen Jazzstilen. Colyer lässt sich über Ellington aus, von dem er die frühen Aufnahmen bevorzugt; er erzählt, welche Dämpfer er für welche Zwecke verwendet; er findet, die Individualität Thelonious Monks oder Charles Mingus’ verdiene Respekt. Das Kapitel handelt aber auch von den Problemem Colyers mit Alkohol, die zunehmend seine Konzerte in Mitleidenschaft zogen. Er hatte keinen Ton mehr, zeigte seltsames Bühnenverhalten, etwa, als er bei einem Konzert in Deutschland die Blumen, die er von einem kleinen Mädchen überreicht bekam, einfach verspeiste. Es ging ihm nicht gut, aber er sprach mit niemandem darüber, was ihn plagte. War es der Alkohol oder war es Krebs? 1971 löste Colyer seine legendäre Band auf, und Max Jones schrieb im Melody Maker: “Er ist mehr als nur ein Musiker; er ist eine musikalische Haltung.” In der Folge, lernen wir in Kapitel 12, arbeitete Colyer als Freelancer mit unterschiedlichen Trad-Bands, die ihn engagierten. Zwischendurch kam es immer wieder zu Revival-Tourneen der Crane River Jazz Band, wie Kapitel 13 berichtet. 1987 dann meldete sich Colyer von der Musikerszene ab, weil seine Gesundheit nicht mehr mitspielte. Er war krank, ging nach Frejus in Südfrankreich. Ein deutscher Freund sorgte dafür, dass er im Krankenhaus in Gifhorn durchgecheckt wurde. Wenige Monate später, am 11. März 1988 starb Colyer.
Nach einem Blick auf das Erbe des Trompeters und seinen Einfluss auf die Trad-Jazz-Szene Europas widmet sich ein erster Anhang des Buchs Colyers wichtigsten Aufnahmen, wobei dies keine Diskographie im üblichen Sinne ist, sondern eine kommentierte Auflistung der Platten mit Kommentaren der Autoren, von Colyers selbst und anderen Mitmusikern. Ein zweiter Anhang versucht die Persönlichkeit des Trompeters zusammenzufassen. Ein dritter Anhang enthält seine Notizen für eine Art Lehrbuch für New-Orleans-Jazz. Ein ausführlicher Namensindex beendet das Buch, das weit mehr ist als eine simple Biographie. Einige der Kapitel aus “Goin’ Home” bieten Quellenmaterial zu Aspekten der Jazzgeschichte, die so noch nie dargestellt wurden. Vor allem aber beeindruckt die Offenheit, in der alle Interviewten sich über ihre Musik, über Colyers Musik, über Musikästhetik und anderes äußern. Wer glaubt, hier nur über eine seltsame britische Spezies des Jazz-Revivals etwas zu lernen, wird schnell eines Besseren belehrt: Man liest und lernt über die kompromisslose Welt eines Künstlers, der auf der Suche nach seiner eigenen Stimme in einem fremden Land fündig wurde. Die beiheftende CD enthält Aufnahmen von 1951 bis 1982 und dokumentiert die verschiedenen Phasen seines Schaffens zwischen klassischer Besetzung, Brass Band, Skiffle und dem Trompeter als sich selbst auf der Gitarre begleitender Sänger.
Alles in allem: Eine wunderbare Lektüre, die eigentlich gerade auch denjenigen Lesern empfohlen wird, die sich mit dem Trad Jazz Colyer’scher Prägung nie anfreunden konnten, weil es so viel erklärt über ästhetische Selbstfindung und ein Konzept, das nie wirklich den Moden folgte. Und nicht zuletzt: Ein unglaublicher Fundus an Material zu einem ganz speziellen und weithin vernachlässigten Kapitel der europäischen Jazzgeschichte.
Wolfram Knauer (Januar 2011)
Les Cahiers du Jazz, #4 (2007)
Les Cahiers du Jazz, #5 (2008)
Les Cahiers du Jazz, #6 (2009)
Les Cahiers du Jazz, #7 (2010)
jeweils erschienen beim Verlag Outre Mesure, Paris
www.outre-mesure.net
 Es gibt in der Jazzforschung mittlerweile eine Reihe an regelmäßig erscheinenden wissenschaftlich ausgerichteten Publikationen. Am längsten existiert die “Jazzforschung / jazz research” des Instituts für Jazzforschung in Graz, die jährlich bereits seit 1969 erscheint. In den USA gibt es seit fünf Jahren die Fachzeitschrift “Jazz Perspectives”; seit den 1970er Jahren außerdem das “Journal of Jazz Studies”, das in den 1980er Jahren in “Annual Review of Jazz Studies” umbenannt wurde, allerdings nach kurzem nicht wirklich mehr jährlich erscheint. In Deutschland gibt es die Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung, die seit 1989 alle zwei Jahre erscheinen. All diese Veröffentlichungen allerdings werden quasi überholt von “Les cahiers du jazz”, das in erster Auflage Anfang der 1960er erschien, dann eine lange Pause einlegte, 1994 in zweiter Auflage neu begann und 2001 wiederum eine neue Auflage erfuhr. Diese erscheint jährlich; uns liegen alle Ausgaben vor; die letzten vier kamen erst kürzlich auf unseren Schreibtisch.
Es gibt in der Jazzforschung mittlerweile eine Reihe an regelmäßig erscheinenden wissenschaftlich ausgerichteten Publikationen. Am längsten existiert die “Jazzforschung / jazz research” des Instituts für Jazzforschung in Graz, die jährlich bereits seit 1969 erscheint. In den USA gibt es seit fünf Jahren die Fachzeitschrift “Jazz Perspectives”; seit den 1970er Jahren außerdem das “Journal of Jazz Studies”, das in den 1980er Jahren in “Annual Review of Jazz Studies” umbenannt wurde, allerdings nach kurzem nicht wirklich mehr jährlich erscheint. In Deutschland gibt es die Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung, die seit 1989 alle zwei Jahre erscheinen. All diese Veröffentlichungen allerdings werden quasi überholt von “Les cahiers du jazz”, das in erster Auflage Anfang der 1960er erschien, dann eine lange Pause einlegte, 1994 in zweiter Auflage neu begann und 2001 wiederum eine neue Auflage erfuhr. Diese erscheint jährlich; uns liegen alle Ausgaben vor; die letzten vier kamen erst kürzlich auf unseren Schreibtisch.
2007 stehen vor allem Laurent Batailles Artikel über das Schlagzeug im heutigen Jazz im Vordergrund, ein Beitrag über Foto und Jazz oder eine Vorstellung französischer Rapmusik. Außerdem findet sich ein analytischer Beitrag des Trompeters Roger Guerin über den musikalischen Stil Louis Armstrongs.
Das Jahrbuch für 2008 enthält eine ausführliche Analyse von Herbie Hancocks Benutzung von Pygmäengesängen und eine Diskussion der ethischen Konsequenzen solcher Projekte mit indigener Musik aus der “dritten” Welt; einen Artikel über David Murray, einen ausführlichen Nachruf auf Michael Brecker und die Analyse eines Fotos des Kornettisten Bix Beiderbecke.
2009 ging es im Boris Vian, den Jazzfan der direkten Nachkriegszeit, um John Coltranes Spiritualität und ihre Ausprägung in seiner Musik und über Duke Ellingtons “Heaven”.
In der jüngsten Ausgabe von 2010 finden sich neun Aufsätze zu Michael Brecker, darunter ein Nachruf seines Bruders Randy Brecker, analytische Annäherungen an seine Musik von Pierre Sauvanet, Piere Genty und Bertrant Lauer und eine Diskographie. Ein Aufsatz über Albert Ayler von Frédéric Bisson, eine Untersuchung unterschiedlicher Ansätze der Jazzforschung von Laurent Cugny und ein kurzer Beitrag über Bricktop in Rom sind ebenfalls interessante Beiträge dieses Bandes, an dem uns aber vor allem eine kleine Fußnote faszinierte, die Lucien Malson kurz vor Schluss vorstellt: ein Beispiel für das Messen ästhetischer Urteilsfindung in einem Textbuch der philosophischen Fakultät der Universität von Dijon, in dem die Korrelation zwischen (weiblicher) Haarfarbe – blond oder brünett – und Musikgeschmack – Bach oder Bebop – ausgerechnet wird. Alle Bände enthalten ausführliche Buchbesprechungen jüngster Neuerscheinungen und das eine oder andere Gedicht von Alain Gerber.
Wolfram Knauer (Januar 2011)
Streiflichter. Erinnerungen und Überlegungen zum Jazz in Dresden rund um die politische Wende
herausgegeben von Matthias Bäumel & Viviane Czok-Gökkurt
Dresden 2010 (Jazzclub Neue Tonne)
56 Seiten, 5 Euro
ISBN: 978-3-941209-04-6
 Zwanzig Jahre nach der Wende ist vielleicht endlich die notwendige zeitliche Distanz geschaffen, um die Situation des Jazz in der DDR und der Wendezeit aufzuarbeiten. Das vorliegende Büchlein dokumentiert die Ereignisse und Diskussionen seit dem 18. September 1989, als in Berlin Musiker aus dem Rock- und Unterhaltungsbereich – unter ihnen beispielsweise Conny Bauer – eine Resolution unterzeichneten, mit der sie den öffentlichen Dialog im Land forderten. Diese Resolution wurde von den Tageszeitungen nicht abgedruckt, also entschlossen die Unterzeichner sich, sie vor jedem ihrer Auftritte zu verlesen. In Dresden wird am 6. Oktober der junge Schlagzeuger Harald Thiemann festgenommen und für eine Woche in Untersuchungshaft nach Bautzen gebracht, weil er, mehr zufällig, in eine der Dresdner Demonstrationen kam. Beim Tonne-Konzert mit Hannes Zerbe an diesem Abend kann er daher nicht dabeisein. In der Tonne wird derweil darüber diskutiert, ob man in dieser politisch brenzligen Situation überhaupt Kunst machen könne. Wir lesen, wie am 9. November bei einem Konzert im Berliner Babylon die Zuhörer nebenher den neuesten Meldungen aus mitgebrachten Kofferradios lauschten, wie Baby Sommer die Wende erlebte, und wie er bei einer Kundgebung seine Vision kundtat: “Täte man die Parteiabzeichen aller unfähigen Funktionäre in eine große Metallschüssel, ich könnt euch ein Perkussionskonzert spielen, dass es durchs ganze Elbtal raschelt!” Wir erfahren von der nahezu jazzlosen Zeit in der Tonne im Oktober 1989. Niemand wusste, wie die Lage sich verändern würde, ist die eine Erklärung dafür, ob nicht vielleicht auch politische Aktionen befürchtet würden, die von den Konzerten ausgingen, kann nur gemutmaßt werden. Immerhin gab es neben einer Dixielandveranstaltung zwei zeitgenössische Konzerte: das eine mit Hannes Zerbe, dem sein Schlagzeuger in Bautzen abhanden kam, das andere unter dem Titel “Klänge, Gesten und Gestalten” mit der Sängerin Roswitha Trexler, der Tänzerin Hanne Wandtke und dem Pianisten Frederic Rzewski. 20 Jahre später erinnerten zwei Konzerte an diese beiden Events aus dem Wendejahr. Das Büchlein, dass all diese Erinnerungen dokumentiert, ist eine liebevoll gestaltete Broschüre mit vielen Fotos, mit Zeichnungen des viel zu früh verstorbenen Jürgen Haufe, mit einem kurzen Essay über die (möglichen) Verbindungen zwischen Jazz und Staatssicherheit, in dem vor allem die Erkenntnisse von Viviane Czok-Gökkurt, die ihre Diplomarbeit zum Thema schrieb, zusammengefasst sind. Lesenswert, nachdenkenswert, und doch immer noch erst der Beginn einer Aufarbeitung.
Zwanzig Jahre nach der Wende ist vielleicht endlich die notwendige zeitliche Distanz geschaffen, um die Situation des Jazz in der DDR und der Wendezeit aufzuarbeiten. Das vorliegende Büchlein dokumentiert die Ereignisse und Diskussionen seit dem 18. September 1989, als in Berlin Musiker aus dem Rock- und Unterhaltungsbereich – unter ihnen beispielsweise Conny Bauer – eine Resolution unterzeichneten, mit der sie den öffentlichen Dialog im Land forderten. Diese Resolution wurde von den Tageszeitungen nicht abgedruckt, also entschlossen die Unterzeichner sich, sie vor jedem ihrer Auftritte zu verlesen. In Dresden wird am 6. Oktober der junge Schlagzeuger Harald Thiemann festgenommen und für eine Woche in Untersuchungshaft nach Bautzen gebracht, weil er, mehr zufällig, in eine der Dresdner Demonstrationen kam. Beim Tonne-Konzert mit Hannes Zerbe an diesem Abend kann er daher nicht dabeisein. In der Tonne wird derweil darüber diskutiert, ob man in dieser politisch brenzligen Situation überhaupt Kunst machen könne. Wir lesen, wie am 9. November bei einem Konzert im Berliner Babylon die Zuhörer nebenher den neuesten Meldungen aus mitgebrachten Kofferradios lauschten, wie Baby Sommer die Wende erlebte, und wie er bei einer Kundgebung seine Vision kundtat: “Täte man die Parteiabzeichen aller unfähigen Funktionäre in eine große Metallschüssel, ich könnt euch ein Perkussionskonzert spielen, dass es durchs ganze Elbtal raschelt!” Wir erfahren von der nahezu jazzlosen Zeit in der Tonne im Oktober 1989. Niemand wusste, wie die Lage sich verändern würde, ist die eine Erklärung dafür, ob nicht vielleicht auch politische Aktionen befürchtet würden, die von den Konzerten ausgingen, kann nur gemutmaßt werden. Immerhin gab es neben einer Dixielandveranstaltung zwei zeitgenössische Konzerte: das eine mit Hannes Zerbe, dem sein Schlagzeuger in Bautzen abhanden kam, das andere unter dem Titel “Klänge, Gesten und Gestalten” mit der Sängerin Roswitha Trexler, der Tänzerin Hanne Wandtke und dem Pianisten Frederic Rzewski. 20 Jahre später erinnerten zwei Konzerte an diese beiden Events aus dem Wendejahr. Das Büchlein, dass all diese Erinnerungen dokumentiert, ist eine liebevoll gestaltete Broschüre mit vielen Fotos, mit Zeichnungen des viel zu früh verstorbenen Jürgen Haufe, mit einem kurzen Essay über die (möglichen) Verbindungen zwischen Jazz und Staatssicherheit, in dem vor allem die Erkenntnisse von Viviane Czok-Gökkurt, die ihre Diplomarbeit zum Thema schrieb, zusammengefasst sind. Lesenswert, nachdenkenswert, und doch immer noch erst der Beginn einer Aufarbeitung.
Wolfram Knauer (Dezember 2010)
Plattenboss aus Leidenschaft
von Siggi Loch
Hamburg 2010 (Edel Vita)
272 Seiten, 26,95 Euro
ISBN: 978-3-941378-81-0
 Manfred Eicher, Stephan Winter, Matthias Winckelmann, Horst Weber, Jost Gebers, Siggi Loch – sie alle prägten die deutsche Jazzszene genauso wie es die Musiker taten, sorgten dafür, dass Jazz in Deutschland nicht nur einen Namen, sondern vor allem auch einen guten Klang hatte. Loch ist der Dienstälteste unter diesen Plattenmachern und Produzenten und hat jetzt ein Buch vorgelegt, in dem er ausführlich aus seinem Leben und vor allem aus seinem Geschäft berichtet.
Manfred Eicher, Stephan Winter, Matthias Winckelmann, Horst Weber, Jost Gebers, Siggi Loch – sie alle prägten die deutsche Jazzszene genauso wie es die Musiker taten, sorgten dafür, dass Jazz in Deutschland nicht nur einen Namen, sondern vor allem auch einen guten Klang hatte. Loch ist der Dienstälteste unter diesen Plattenmachern und Produzenten und hat jetzt ein Buch vorgelegt, in dem er ausführlich aus seinem Leben und vor allem aus seinem Geschäft berichtet.
Wir lesen von seiner ersten Faszination mit dem Jazz durch ein Konzert (und eine Platte) des Sopransaxophonisten Sidney Bechet, von ersten Jobs als Vertreter für die Electrola, spätere Positionen als Label-Manager und bald auch Produzent für Philips, schließlich als Chef der europäischen Dependence des US-Plattengiganten Liberty Records, zu dem neben anderen auch das legendäre Blue-Note-Label gehörte. Loch erzählt über Erfolge und Flops, über Zufälle und Strategien, über Musiker und Produkte, über Produzentenkollegen und die Unterschiede des Geschäfts in den USA und Europa, über Jazz, Pop, Schlager und vieles mehr. Das liest sich mehr als flüssig, und die Tatsache, dass Loch quasi auf jeder Seite von einem Genre ins nächste gleitet, wie es eben seine Karriere vorgegeben hat, macht die Lektüre ungemein abwechslungsreich.
Wir begegnen Klaus Doldinger (dessen erstes Album Loch produzierte), Al Jarreau, Katja Epstein, Frank Sinatra, Mick Jagger, Francis Wolff, Jürgen Drews und Franz Beckenbauer, erfahren über Beruf und Privatleben des Produzenten, Fußball-WMs und Segelregatten. Loch war 1967 als einer der jüngsten Plattenbosse mit eigener Firma gestartet gehörte spätestens seitdem er eine leitende Position bei Warner Brothers bekleidete zu den wichtigsten Tieren der internationalen Plattenbranche. Neben der Musik hatte er sich dabei vor allem ums Geschäft zu kümmern, um die Probleme mit Schwarzpressungen, um laufende Fusionen und gegenseitige Aufkäufe der Plattengiganten. Mit den Bonuszahlungen kaufte er sich schon mal ein Haus in Kiel-Schilksee, “dem Hafen meiner Segelyacht ‘Tambour'” und wurde durch seinen Freund, den französischen Pressemagnaten Daniel Filipacchi auf ein weiteres kostspieliges Hobby gebracht; das Sammeln zeitgenössischer Kunst.
Als klar wurde, dass sich mit dem Weggang Neshui Erteguns aus dem Vorstand der WEA einiges bei dem Plattengiganten ändern würde, besann sich Loch der Gründe, warum er eigentlich in dieses Berufsfeld eingestiegen war: “Hatte ich nicht immer vom eigenen Label geträumt? Inzwischen hatte ich die Erfahrung von 27 Berufsjahren und war wirtschaftlich unabhängig.” Geburtstunde: ACT, erst als ein Poplabel, das Loch zusammen mit Annette Humpe und Jim Rakete betrieb, dann, ab 1990, vor allem als Jazzlabel. Er erzählt von seinen ersten Alben für ACT, vom Entdecken neuer Künstler, wieder von Verkaufsstrategien, vom Jazz, der eine wunderbare Musik sei, aber eben auch Geschäft. Loch erzählt dabei durchaus auch aus dem Nähkästchen, etwa wenn er berichtet, wie ihm Roger Cicero abhanden kam oder wie Julia Hülsmann zu ECM gewechselt sei, und man ahnt dabei, dass es da auch eine andere Seite der Geschichte geben mag. Aber Loch ist eben ein gewiefter Geschäftsmann – einer, soviel wird schnell klar, wie ihn der Jazz dringend braucht, um aus der durchaus auch selbstgeschaffenen Nische herauszukommen.
Lochs Autobiographie enthält jede Menge Hintergrundinformation übers Musikgeschäft. Es ist ein lesenswertes Buch, gerade weil es so andere Geschichten des Business erzählt als man sie aus Musikerbiographien kennt. Und bei der Lektüre teilt sich immer wieder mit, was Loch im Titel seines Buchs andeutet, dass neben dem Geschäft eben auch die Leidenschaft vorhanden sein muss, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein.
Wolfram Knauer (Dezember 2010)
Dusk Fire. Jazz in English Hands
von Michael Garrick & Trevor Barrister
Earley, Reading 2010 (Springdale Publishing)
260 Seiten, 15 Britische Pfund
ISBN: 978-0-9564353-0-9
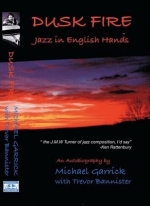 Michael Garrick gehört seit den späten 1950er Jahren zu den aktivsten Musikern der modernen britischen Jazzszene. Mit “Dusk Fire” legt er seine Autobiographie vor. 1933 in Enfield, Middlesex, geboren, erhielt er erste Klavierstunden von seiner Mutter. Sein erster großer Einfluss war das enge Zusammenspiel der vier Musiker des Modern Jazz Quartet, und so ist es kein Wunder, dass sein erstes Quartett dieselbe Besetzung hatte. Frühzeitig interessierte ihn dabei auch genuin englisches Material als Grundlage für die Improvisationen, also arrangierte er Songs wie “Barbara Allen” oder “Bobby Shaftoe” und schrieb erste eigene Stücke die ähnlichen Mustern folgten. 1961 gründete er die Konzertreihe “Poetry and Jazz in Concert”, 1967 eine weitere Reihe an Kirchenkonzerten, “Jazz Praises”. Anfangs verdiente er sich sein Geld noch als Lehrer, ab 1965 war Garrick dann “Full-time”-Musiker.
Michael Garrick gehört seit den späten 1950er Jahren zu den aktivsten Musikern der modernen britischen Jazzszene. Mit “Dusk Fire” legt er seine Autobiographie vor. 1933 in Enfield, Middlesex, geboren, erhielt er erste Klavierstunden von seiner Mutter. Sein erster großer Einfluss war das enge Zusammenspiel der vier Musiker des Modern Jazz Quartet, und so ist es kein Wunder, dass sein erstes Quartett dieselbe Besetzung hatte. Frühzeitig interessierte ihn dabei auch genuin englisches Material als Grundlage für die Improvisationen, also arrangierte er Songs wie “Barbara Allen” oder “Bobby Shaftoe” und schrieb erste eigene Stücke die ähnlichen Mustern folgten. 1961 gründete er die Konzertreihe “Poetry and Jazz in Concert”, 1967 eine weitere Reihe an Kirchenkonzerten, “Jazz Praises”. Anfangs verdiente er sich sein Geld noch als Lehrer, ab 1965 war Garrick dann “Full-time”-Musiker.
In seinem Buch berichtet er über Plattenveröffentlichungen, etwa “Moonscape” von 1964, über Kollegen wie Joe Harriott, Don Rendell und Ian Carr, über den Einfluss durch Bill Evans, den er im März 1965 in London hörte. 1976 ging Garrick in die USA, um am Berklee College in Boston zu studieren; daneben nahm er Unterricht bei der legendären Madame Chaloff, der Mutter des Saxophonisten Serge Chaloff, die ihm gezeigt habe, wie man allein durch Körperbeherrschung einen kraftvollen Sound erzeugen könne — Keith Jarrett habe bei ihr gelernt und Herbie Hancock und Chick Corea hätten Stunden bei ihr genommen. Nach seiner Rückkehr gründete Garrick eine neue Band, der die Sängerin Norma Winstone angehörte. Er spielte mit Nigel Kennedy und der großartigen Adelaide Hall, begleitete amerikanische Solisten bei Konzerten in England und spielte Duos mit Dorothy Donegan. 1985 wurde er Dozent an der Royal Academy of Music, und er schreibt ausführlich über seine Erlebnisse als Lehrer und Teil der britischen Schulbürokratie. Duke Ellingtons Musik hatte ihn immer fasziniert, und als er die Möglichkeit hatte, eine eigene Bigband zusammenzustellen, was der Duke offensichtlich eines seiner großen Vorbilder.
Garricks Buch ist eine Sammlung an Erinnerungen an eine lange Karriere, manchmal ein wenig schwerfällig lesbar angesichts der vielen Namen, bei denen man zurückblättern möchte, um den Zusammenhang zu verstehen, voller Anekdoten auch, die immerhin einen Einblick in das Wirken eines bedeutenden britischen Musikers erlauben, zwischen insularer Verwurzeltheit und Faszination mit dem Fremden des amerikanischen Jazz. Eine Sammlung eigener journalistischer Artikel, eine Diskographie und ein ausführlicher Index runden das Buch ab, das reich bebildert ist und ein Kapitel britischer Jazzgeschichte aus der Sicht der Musiker beschreibt und gibt damit einen interessanten Einblick in den Alltag eines Musikers in den 1960er bis 1990er Jahren.
Wolfram Knauer (Dezember 2010)
Miles Davis. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2010 (rowohlt Berlin)
304 Seiten, 19,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-677-4
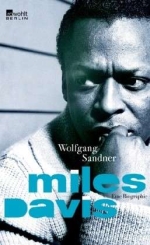 Es ist immer so eine Frage: Warum braucht es noch eine weitere Biographie der bekannten Jazzgrößen? Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis … über sie alle ist so viel geschrieben worden! Doch tatsächlich muss sich jede Zeit ihre Jazzgrößen neu entdecken. Und so ist Wolfgang Sandners Blick auf das Leben und Werk von Miles Davis eben der Blick aus dem Jahr 2010 und damit ein neues Buch, kein Wiederaufguss. Es ist ein liebevolles, sprachlich gelungenes Buch – wie nicht anders zu erwarten beim ehemaligen FAZ-Musikredakteur. Und es ist, wie Sandner in seinem Vorwort zugibt, ein Bekenntnis: für “den eigenen Geschmack, die eigene Anschauung und die eigene ästhetische Vorliebe”. Dabei hat er sich einen Satz, den Miles einst einem Interviewer mitgab, zu Herzen genommen: “Wenn du alles verstündest, was ich sage, wärst du ich.”
Es ist immer so eine Frage: Warum braucht es noch eine weitere Biographie der bekannten Jazzgrößen? Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis … über sie alle ist so viel geschrieben worden! Doch tatsächlich muss sich jede Zeit ihre Jazzgrößen neu entdecken. Und so ist Wolfgang Sandners Blick auf das Leben und Werk von Miles Davis eben der Blick aus dem Jahr 2010 und damit ein neues Buch, kein Wiederaufguss. Es ist ein liebevolles, sprachlich gelungenes Buch – wie nicht anders zu erwarten beim ehemaligen FAZ-Musikredakteur. Und es ist, wie Sandner in seinem Vorwort zugibt, ein Bekenntnis: für “den eigenen Geschmack, die eigene Anschauung und die eigene ästhetische Vorliebe”. Dabei hat er sich einen Satz, den Miles einst einem Interviewer mitgab, zu Herzen genommen: “Wenn du alles verstündest, was ich sage, wärst du ich.”
Mit diesem Caveat, dass eine Biographie immer nur eine Annäherung sein kann, beginnt Sandner also seine Reise zur Person und zur Musik des Miles Davis. Er berichtet etwa vom Vater, der ein durchaus wohlhabender Zahnarzt in St. Louis war und seine Kinder in Sinfoniekonzerte mitnahm, Miles auf seinem eigenen Pferd reiten ließ und dabei zugleich ein Anhänger von Marcus Garvey war. Diese Mischung aus dem Stolz auf die eigene Hautfarbe und mittelständischen Werten prägte Miles sein Leben lang sowohl im Positiven wie auch im Negativen, in seiner politischen Haltung wie im Versuch dem Bourgeoisen seiner eigenen Biographie zu entkommen. Erste Jobs als Musiker, erste Freundin, erstes Kind, Streit mit dem Vater, Flucht nach New York. Sandner beschreibt die Situation: “Da kam ein gut erzogener, schüchterner Schwarzer aus dem Mittleren Westen nach New York: Achtzehn Jahre alt, Nichtraucher, ohne Erfahrung mit Alkohol und keinen blassen Schimmer von Kokain, Heroin und anderen Versuchungen des Bösen. Mit einer Trompete unter dem Arm und einem einzigen Gedanken im Kopf: Wo finde ich Charlie Parker, den größten Jazzmusiker der Gegenwart, der sich anschickt, der größte Jazzmusiker der Zukunft zu werden?” Parker fand er bald, spielte mit ihm und anderen, tauchte zugleich ein in eine Welt, die von Musik und Drogen beherrscht wurde, denen letzten Endes auch er sich nicht würde entziehen können. Mit John Lewis, Gerry Mulligan und anderen jungen Musikern traf er sich in Gil Evans’ Kellerapartment und entwickelte die Idee einer Musik, in der mit möglichst wenigen Instrumenten eine Klangvielfalt und klangliche Durchorganisation erlangt wurde, wie man sie sonst beispielsweise von großen Orchestern wie dem von Claude Thornhill kannte. Die Aufnahmen seines Nonets, das diese Arrangements verwirklichte, wurden später als “The Birth of the Cool” herausgebracht und Miles damit als einer der Väter des Cool Jazz gesehen, so wie er als einer der Großen des Hard-Bop, einer der Erfinder des modalen Jazz oder noch später als der Wegbereiter der Fusion zwischen Jazz und Rock gesehen wurde. Wie immer man seine Wendungen beurteilt, es ist klar, dass es Miles darum ging, neue Sounds zu erkunden, am Puls der Zeit zu bleiben, seine eigene Stimme in die jeweils augenblickliche Sprache der Musik einzubringen.
Sandner beschreibt Miles’ liebevolle Beziehung zu Juliette Greco und seine späteren Ehen, die irgendwo zwischen Liebe, Vergötterung und Gewalttätigkeit lagen; er beschreibt die so wechselvolle Persönlichkeit des Trompeters, die aus Stolz, übersteigertem Selbstbewusstsein und Verletzlichkeit zugleich zu entstehen schien. Er beschreibt die Meisterwerke, “Kind of Blue” etwa, seine Alben mit Gil Evans, das großartige Quintett der 1960er Jahre, “Bitches Brew”, seine Fusionerfolge der 1970er Jahre, Rückschläge, Erholungen, die Rückkehr zum Blues und verflicht all das mit einer Beschreibung des Menschen, die sprachlich so gelungen ist, dass man sich gern festliest, dass man in den musikalischen Beschreibungen den Ton des Meisters zu hören glaubt und dass selbst die Beschreibung der dunklen Seiten des Klangmagiers einer gewissen Lyrik nicht entbehren, weil sie nicht entschuldigt, aber erklärt, warum Miles ist wie er ist und damit eben auch, warum er spielt wie er spielt. Ein gelungenes Buch, eine spannende Lektüre.
Wolfram Knauer (Dezember 2010)
African Rhythms. The Autobiography of Randy Weston
Von Randy Weston & Willard Jenkins
Durham/NC 2010 (Duke University Press)
326 Seiten, 32,95 US-Dollar
ISBN: 798-0-8223-4784-2
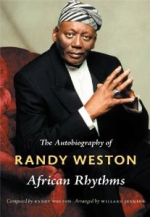 Von all den Jazzmusikern, die irgendwann in ihrem Leben nach den Wurzeln ihrer Musik suchten, ist Randy Weston einer der wenigen der sie gefunden hat: in der Musik Afrikas, die er genauso umarmte wie sie ihn, die er aber bereits zu einer Zeit “gefunden” hatte, als er den afrikanischen Kontinent physisch noch gar nicht betreten hatte. Willard Jenkins erzählt im Vorwort, wie es zu diesem Buchprojekt kam, wie sehr er erst von Westons Musik, dann von seinen Geschichten und seiner Fähigkeit zum Geschichtenerzählen begeistert war, aber auch von der Bewunderung, die Weston in seiner zweiten Heimat, Marokko, entgegenschlägt, wann immer er dort auftritt oder auch nur durch die Straßen läuft. Jenkins hatte eigentlich eine Biographie des Pianisten geplant, aber mehr und mehr wurde klar, dass das Buch eine Autobiographie werden würde, für die Weston quasi als “Komponist” diente, während Jenkins als “Arrangeur” tätig wurde.
Von all den Jazzmusikern, die irgendwann in ihrem Leben nach den Wurzeln ihrer Musik suchten, ist Randy Weston einer der wenigen der sie gefunden hat: in der Musik Afrikas, die er genauso umarmte wie sie ihn, die er aber bereits zu einer Zeit “gefunden” hatte, als er den afrikanischen Kontinent physisch noch gar nicht betreten hatte. Willard Jenkins erzählt im Vorwort, wie es zu diesem Buchprojekt kam, wie sehr er erst von Westons Musik, dann von seinen Geschichten und seiner Fähigkeit zum Geschichtenerzählen begeistert war, aber auch von der Bewunderung, die Weston in seiner zweiten Heimat, Marokko, entgegenschlägt, wann immer er dort auftritt oder auch nur durch die Straßen läuft. Jenkins hatte eigentlich eine Biographie des Pianisten geplant, aber mehr und mehr wurde klar, dass das Buch eine Autobiographie werden würde, für die Weston quasi als “Komponist” diente, während Jenkins als “Arrangeur” tätig wurde.
“Ich bin eigentlich ein Geschichtenerzähler”, beginnt Weston die Einleitung des Buchs, “kein Jazzmusiker. Ich bin ein Geschichtenerzähler durch Musik, und ich kann von erstaunlichen und einzigartigen Erlebnissen berichten. (…) Gott ist der wirkliche Musiker. Ich bin ein Instrument und das Klavier ist ein weiteres Instrument. Das habe ich in Afrika gelernt.”
Mit solchen Worten zieht Weston den Leser ein in eine tatsächlich faszinierende und einzigartige Geschichte. Er erzählt von seinem Vater, der aus einer jamaikanischen Familie stammte und ein ergebener Anhänger von Marcus Garvey war, der in den 1920er Jahren die Back-to-Africa-Bewegung mitbegründet hatte, sowie von seiner Mutter, einer zerbrechlichen kleinen Frau, die für wenig Geld die Böden anderer Leute schrubbte und nie klagte, nie bettelte, immer mit Würde lebte. Er erzählt über seine Kindheit in Brooklyn, seine ersten musikalischen Erlebnisse und wie seine Größe (Weston misst über 2 Meter) ihm immer Komplexe bereitete, für die Musik die beste Zuflucht war. Er erzählt, wie die Häuser großer Musiker wie Max Roach oder Duke Jordan interessierten Kollegen in jenen Jahren immer offenstanden. 1944 wurde Weston zur Armee eingezogen, entgegen seinen Hoffnungen, dass er wegen seiner Körpergröße untauglich geschrieben würde. Er verbrachte ein Jahr auf Okinawa und baute dort eine Kommunikationsstellung aus, kehrte dann nach Brooklyn zurück, hörte sich jeden Abend die großen Pianisten an, die in der Stadt auftraten, Art Tatum, Erroll Garner oder Hank Jones, und führte das Restaurant seines Vaters. Er erinnert sich, wie Charlie Parker ihn eines Abends abschleppte, um mit ihm eine halbe Stunde lang zu spielen, das einzige Mal, dass sie zusammen auftraten, einen Moment, den er nie vergessen werde.
Er arbeitete Anfang der 1950er Jahre als Tellerwäscher in den Berkshires, als er mehr zufällig einen Vortrag des Jazzhistorikers Marshall Stearns im Music Inn in Lenox hörte. In der Folge kam Weston die nächsten zehn Jahre jedes Jahr nach Lenox, trat dort bald mit seinem Trio auf und begleitete Stearns Vorträge mit Musikbeispielen. Was ihn an Stearns beeindruckte, war, dass dieser immer die Wurzeln des Jazz in Afrika hervorhob, die Geschichte dieser Musik also nicht in New Orleans beginnen ließ, wie dies sonst üblich war. Zusammen mit Stearns ging Westons Trio auf Tournee mit einem Programm, dass Schülern und Studenten überall im Land die Jazzgeschichte näher bringen sollte, dem ersten Jazzgeschichtskurs im amerikanischen Schulsystem.
Weston erzählt von seinen Begegnungen mit Langston Hughes, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, mit dem Ghanaischen Jazzmusiker Kofi Ghanaba oder Gnawa-Musikern in Marokko. Vor allem aber erzählt er eine Geschichte, in der seine musikalische Entwicklung eingebettet ist in ein Leben mit scheinbar glücklichen Zufällen, tatsächlich aber offenen Ohren und Augen, mit denen er angebotene Gelegenheiten aufgreifen und ausnutzen konnte. Nach wenigen Seiten ist man in “African Rhythm” versunken, mag es nicht mehr aus der Hand legen. “Diagonallesen”, wie man das oft durchaus erfolgreich macht, wenn man professionell mit dieser Musik zu tun hat, geht hier nicht mehr, weil man in jeder Geschichte, in jedem Geschichtenstrang so gefangen ist, dass man mehr wissen will, weil Weston die Begebenheiten und Begegnungen mit Menschen so plastisch schildert, dass man das Gefühl hat selbst mit dabei zu sein. Man spürt die Mischung aus Selbstbewusstsein und Schüchternheit, die auch dem Menschen Weston eigen ist, die kraftvolle linke Hand und die betörenden Melodien in der rechten, das Wissen und die Neugier.
Es hat lange kein Buch mehr gegeben, dass sich in die großen Autobiographien des Jazz einreihen könnte, wie sie von Louis Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Art Pepper und Miles Davis vorgelegt wurden. Randy Westons “African Rhythms” gehört ganz gewiss in diese Reihe. Ein großartiges Lesevergnügen!
Wolfram Knauer (Oktober 2010)
Scandinavian Wood. Niels-Henning Ørsted Pedersens musikalske løbebane i lyset af hans diskografi
Von Jørgen Mathiasen
Kopenhagen 2010 (Books on Demand)
350 Seiten, 335 Dänische Kronen
ISBN: 978-87-7114-599-1
Scandinavian Wood. The musical career of Niels-Henning Ørsted Pedersen in the light of his discography
Von Jørgen Mathiasen
Copenhagen 2010 (Books on Demand)
358 Seiten, 335 Dänische Kronen
ISBN: 978-3-8423-5157-8
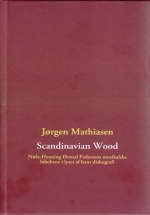 Jørgen Mathiasen ist ein in Berlin lebender dänischer Musikwissenschaftler mit speziellem Interesse sowohl an der Musik Duke Ellingtons wie auch an Musikästhetik oder dem Jazz aus seiner eigenen Heimat, Dänemark. Seit einiger Zeit beschäftigt er sich mit Niels-Henning Ørsted Pedersens “musikalischer Laufbahn im Lichte seiner Diskographie”, wie es im Untertitel seiner dicken Monographie heißt. Die Diskographie macht den größten Teil des Buchs aus, das daneben aber auch eine sechzigseitige Würdigung des musikalischen Schaffens des Kontrabassisten bietet.
Jørgen Mathiasen ist ein in Berlin lebender dänischer Musikwissenschaftler mit speziellem Interesse sowohl an der Musik Duke Ellingtons wie auch an Musikästhetik oder dem Jazz aus seiner eigenen Heimat, Dänemark. Seit einiger Zeit beschäftigt er sich mit Niels-Henning Ørsted Pedersens “musikalischer Laufbahn im Lichte seiner Diskographie”, wie es im Untertitel seiner dicken Monographie heißt. Die Diskographie macht den größten Teil des Buchs aus, das daneben aber auch eine sechzigseitige Würdigung des musikalischen Schaffens des Kontrabassisten bietet.
Im Vorwort thematisiert Mathiasen erst einmal grundsätzlich die Bedeutung von Diskographien für die Jazzforschung. Sein erstes Hauptkapitel ordnet Ørsted Pedersens Biographie in die Geschichte seines Heimatlandes ein. Mathiasen beschreibt die Situation der Jazzszene in den Jahren vor Ørsted Pedersens Geburt im Mai 1946, das Elternhaus des Bassisten, musikalische Einflüsse, seine ersten Auftritte als Bassist, als vierzehnjähriger Gymnasiast in der Band des schwedischen Saxophonisten Rolf Billberg. Eigene Kapitel widmet Mathiasen Ensembles, in denen Ørsted Pedersen sein Handwerkszeug verfeinerte oder aber sich weit über die Grenzen Dänemarks hinaus einen Namen machte, der DR Big Band etwa, also dem dänischen Rundfunkorchester, seiner Zeit als Hausbassist des Montmartre Jazz Clubs in Kopenhagen, Engagements mit Dexter Gordon, Kenny Drew, Ben Webster und natürlich Oscar Peterson. Mathiasens Anmerkungen zur Zusammenarbeit NHØPs mit Musikern wie diesen versucht vor allem, faktische und biographische Informationen zu liefern, die die folgende Diskographie in den notwendigen Kontext stellen. Auch die Aufnahmen unter eigenem Namen werden gewürdigt, und in einem kurzen Kapitel diskutiert Mathiasen Ørsted Pedersens skandinavische musikalische Identität, die Idee des “nordischen Tons”, der weit über die Benutzung von Volksmelodien hinausgehe. Schließlich stellt sich die Frage nach “Imitation und Emanzipation” bei einem Musiker wie Ørsted-Pedersen besonders, der so intensiv mit amerikanischen Kollegen zusammenspielte, ohne seine Heimat und sein Bewusstsein als dänischer Musiker aufzugeben.
 Nach einer Bibliographie über NHØP macht den Hauptteil des Buchs dann die Diskographie aus, die Aufnahmen zwischen September 1960 (Don Camillo and his Feetwarmers) und März 2005 (mit seinem eigenen Trio) listet. Dieser Teil enthält die üblichen Details jazzmusikalischer Werkverzeichnisse: Besetzungen, Ort und Datum der Aufnahme, eingespielte Titel, Erst- und Wiederveröffentlichungen, sowie, wo immer nötig, Kommentare zur Aufnahmesitzung. Neben den schon genannten Namen sind dabei Musiker wie Bud Powell, Don Byas, Albert Ayler, Roland Kirk, Archie Shepp oder Sonny Rollins zu nennen, aber auch dänische Kollegen wie Ib Glindemann, Svend Asmussen oder Palle Mikkelborg. Mathiasen zählt weit über 500 Aufnahmesitzungen, an denen Ørsted Pedersen beteiligt war – wahrlich ein klanglicher Nachlass erster Güte.
Nach einer Bibliographie über NHØP macht den Hauptteil des Buchs dann die Diskographie aus, die Aufnahmen zwischen September 1960 (Don Camillo and his Feetwarmers) und März 2005 (mit seinem eigenen Trio) listet. Dieser Teil enthält die üblichen Details jazzmusikalischer Werkverzeichnisse: Besetzungen, Ort und Datum der Aufnahme, eingespielte Titel, Erst- und Wiederveröffentlichungen, sowie, wo immer nötig, Kommentare zur Aufnahmesitzung. Neben den schon genannten Namen sind dabei Musiker wie Bud Powell, Don Byas, Albert Ayler, Roland Kirk, Archie Shepp oder Sonny Rollins zu nennen, aber auch dänische Kollegen wie Ib Glindemann, Svend Asmussen oder Palle Mikkelborg. Mathiasen zählt weit über 500 Aufnahmesitzungen, an denen Ørsted Pedersen beteiligt war – wahrlich ein klanglicher Nachlass erster Güte.
Die Entscheidung des Autors, das Buch auf Dänisch erscheinen zu lassen, ist wahrscheinlich der Hauptzielgruppe seiner Leserschaft zu schulden; dabei hätte eine englische Übersetzung zumindest des ersten Teils vielleicht keine zu großen zusätzlichen Kosten verursacht. Alles in allem: ein nüchternes Werkverzeichnis und dennoch eine labor of love, der man die Akribie und Genauigkeit anmerkt, die der Autor in seine Recherchen gesteckt hat.
Wolfram Knauer (Oktober 2010)
Zusatz: Inzwischen ist das Buch auch auf englisch erschienen und damit für eine breitere Leserschaft interessant. Die Übersetzung entspricht in Form und Inhalt der dänischen Originalausgabe.
(Wolfram Knauer (März 2012)
Die Wiener Jazzszene. Eine Musikszene zwischen Selbsthilfe und Institution
Von Stefanie Bramböck
Frankfurt/Main 2010 (Peter Lang)
194 Seiten, 39,80 Euro
ISBN: 978-3-631-59652-4
 Soziologische Studien zur Jazzszene gestalten sich erfahrungsgemäß schwierig: Es ist von vornherein nicht gerade leicht, die zu untersuchenden Gruppen genauer zu identifizieren: Musiker, Publikum, und wenn, dann welches: Konzertpublikum, traditioneller Jazz oder zeitgenössischere Spielrichtungen, Festivalbesucher oder Clubgänger, Plattenkäufer oder Downloader und so weiter und so fort. Hypothesen neigen in diesem Bereich noch mehr als in anderen dazu, zu self-fulfilling prophecies zu werden, und systematisch erhobene Daten sind oft bei Drucklegung der Studie bereits wieder hoffnungslos überholt. Trotz all solcher Schwierigkeiten ist es wichtig, soziologisch an den Jazz heranzugehen, weil empirische Untersuchungen Zahlen und Fakten bringen können, die für die politische Argumentation etwa über den Sinn einer Jazzförderung notwendig sind.
Soziologische Studien zur Jazzszene gestalten sich erfahrungsgemäß schwierig: Es ist von vornherein nicht gerade leicht, die zu untersuchenden Gruppen genauer zu identifizieren: Musiker, Publikum, und wenn, dann welches: Konzertpublikum, traditioneller Jazz oder zeitgenössischere Spielrichtungen, Festivalbesucher oder Clubgänger, Plattenkäufer oder Downloader und so weiter und so fort. Hypothesen neigen in diesem Bereich noch mehr als in anderen dazu, zu self-fulfilling prophecies zu werden, und systematisch erhobene Daten sind oft bei Drucklegung der Studie bereits wieder hoffnungslos überholt. Trotz all solcher Schwierigkeiten ist es wichtig, soziologisch an den Jazz heranzugehen, weil empirische Untersuchungen Zahlen und Fakten bringen können, die für die politische Argumentation etwa über den Sinn einer Jazzförderung notwendig sind.
In Deutschland gab es über die Jahre Studien zum Jazzpublikum, zu den Arbeitsbedingungen von Musikern und zur Lage der Clubs. Eine übergreifende Studie über “die Jazzszene” als soziologisch spannendes Geflecht unterschiedlichster Beziehungen zwischen Musikern und Musikern; Musikern und Veranstaltern; Musikern, Veranstaltern und Publikum; all dieser Bereiche und der Jazzkritik und vielem mehr lässt leider nach wie vor auf sich warten. Stefanie Bramböck hat jetzt mit ihrer als Diplomarbeit im Fach Musikwirtschaft entstandenen Diplomarbeit eine die verschiedenen Seiten dieses Beziehungsgeflechts berücksichtigende Studie vorgelegt, die die aktuelle Wiener Jazzszene als eine “Musikszene zwischen Selbsthilfe und Institution” beschreibt und analysiert.
Der Jazz sei eine Musik von Individualisten, stellt Bramböck gleich im Vorwort fest, der anders als Klassik und Popmusik nie wirklich systematisierbar bzw. strukturierbar gewesen sei. Sie geht ihre Aufgabe von unterschiedlichen Seiten an, fragt etwa zu Beginn nach den Musikern und ihrer Motivation dazu, überhaupt Jazz zu machen. Sie beleuchtet die Auftrittsorte und wirft einen besonderen Blick auf zwei Wiener Clubs, das Porgy & Bess und Jow Zawinuls Birdland, das nach großem Erfolg in die Pleite rutschte. Sie vergleicht die Clubsituation mit der größerer Konzerte, fragt nach der Aufgabe von Musikagenten und Musikmanagern, beleuchtet die Rolle der Medien – Fernsehen, Rundfunk und Printmedien – und wirft auch einen Blick aufs Publikum selbst. Die Musikindustrie erhält ein eigenes Kapitel, in dem Bramböck die Situation von Plattenlabels genauso hinterfragt wie aktuelle Produktionswege für Musiker (YouTube, MySpace, die CD als künstlerische Visitenkarte). Schließlich befasst sie sich in einem letzten Kapitel mit den unterschiedlichen Fördermöglichkeiten für Jazzmusiker in Wien – durch den Bund, die Stadt, den SKE-Fonds oder den Österreichischen Musikfonds. Während Bramböck für den größten Teil ihres Buchs vor allem auf Sekundärliteratur sowie Interviews mit Betroffenen zurückgreift, ist dieser Teil ihrer Studie der einzige, der konkrete Zahlen vorlegt.
Die fünfseitige Zusammenfassung macht noch einmal klar worum es der Autorin geht: Sie fragt danach, was es braucht, um in einer Stadt wie Wien einen Szenetreffpunkt zu etablieren, wie er für eine kreative Jazzszene unabdingbar ist. Sie stellt die Fragmentierung der Szene fest und auch das Fehlen von Lobbystrukturen. In ihrem Fazit fordert sie schließlich eine verstärkte Institutionalisierung und Internationalisierung der bereits vorhandenen funktionierenden Infrastruktur. Sie identifiziert Handlungsbedarf insbesondere in der medialen Unterstützung und Präsenz des Jazz und fordert die Geldgeber öffentlicher Subventionen auf, “bestehende und beharrende Förderstrukturen aufzubrechen, um einerseits Neues entstehen lassen zu können und andererseits auf bereits bestehende Finanzierungsbedürfnisse zu reagieren”.
Bramböcks Buch ist eine Fachstudie, also keine “Geschichte des Wiener Jazz”. Sie kann als Anleitung zur Konsolidierung einer überaus aktiven Szene gelesen werden und dabei auch Jazzaktiven in anderen Städten Hinweise darauf geben, was zu tun sei, um die so ungemein lockeren und oft wenig greifbaren Strukturen der Jazzszene zu festigen, um kreative Freiräume zu schaffen, in denen Musiker experimentieren und Neues entwickeln können. “Die Wiener Jazzszene” ist damit ein Argument in einer auch hierzulande bereits geführten Diskussion.
Wolfram Knauer (Oktober 2010)
Talking Jazz
von Till Brönner & Claudius Seidl
Köln 2010 (Kiepenheuer & Witsch)
207 Seiten, 18,95 Euro
ISBN: 978-3-462-04167-5
 Claudius Seidl ist Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Außerdem ist er Jazzfan. Liebhaber sei er, deshalb würde er selten über Jazz schreiben. Als aber ein Verleger ihn anrief, um zu fragen, ob er nicht einen guten Schreiber kenne, der zusammen mit Till Brönner ein Buch über sine Erfahrungen und ästhetischen Haltungen schreiben könne, da juckte es ihn in den Fingern. Eine Woche lang trafen sie sich jeden Morgen am Ufer der Havel, fuhren im Boot auf eine der Havelinseln und unterhielten sich, über Deutschland, die Welt und den Jazz. Das Ergebnis ist ein sehr persönliches Buch, in dem die Gespräche aufgelöst sind in kleine Kapitel mit den auf “kurz” zusammengefassten Fragen quasi als Überschriften, denen Brönners Antworten folgen, voller Liebe für die Musik, voll Unzufriedenheit darüber, dass die Musik, die er liebt, in Deutschland manchmal einen so seltsamen Ruf genießt und voll fast schon missionarischen Eifer, das zu ändern. So viele Leute liefen mit Missverständnissen darüber herum, was Jazz eigentlich sei; da täte Aufklärung dringend Not. Denn: “Jeder liebt Jazz!. Es gibt aber Menschen, die wissen schon, dass sie Jazz-Liebhaber sind. Und es gibt Menschen, die haben es noch gar nicht gemerkt.”
Claudius Seidl ist Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Außerdem ist er Jazzfan. Liebhaber sei er, deshalb würde er selten über Jazz schreiben. Als aber ein Verleger ihn anrief, um zu fragen, ob er nicht einen guten Schreiber kenne, der zusammen mit Till Brönner ein Buch über sine Erfahrungen und ästhetischen Haltungen schreiben könne, da juckte es ihn in den Fingern. Eine Woche lang trafen sie sich jeden Morgen am Ufer der Havel, fuhren im Boot auf eine der Havelinseln und unterhielten sich, über Deutschland, die Welt und den Jazz. Das Ergebnis ist ein sehr persönliches Buch, in dem die Gespräche aufgelöst sind in kleine Kapitel mit den auf “kurz” zusammengefassten Fragen quasi als Überschriften, denen Brönners Antworten folgen, voller Liebe für die Musik, voll Unzufriedenheit darüber, dass die Musik, die er liebt, in Deutschland manchmal einen so seltsamen Ruf genießt und voll fast schon missionarischen Eifer, das zu ändern. So viele Leute liefen mit Missverständnissen darüber herum, was Jazz eigentlich sei; da täte Aufklärung dringend Not. Denn: “Jeder liebt Jazz!. Es gibt aber Menschen, die wissen schon, dass sie Jazz-Liebhaber sind. Und es gibt Menschen, die haben es noch gar nicht gemerkt.”
Brönners Mission läuft ja schon länger: Er ist in Talkshows präsent wie kein anderer seiner Zunft; über ihn wird in Bild genauso wie in Frauenzeitschriften berichtet; er moderierte den Jazz Echo und er sitzt in der Jury zum “X Factor”. Brönner also hat bereits einen Fuß in der Tür derjenigen, die noch nicht gemerkt haben, dass sie Jazz-Liebhaber sind. Mit seinem Buch will er die Tür ein wenig weiter öffnen, will Überzeugungsarbeit leisten, indem er von seinem eigenen Enthusiasmus berichtet, weil er fest davon überzeugt ist, dass Enthusiasmus mitreißen kann, ja mitreißen muss.
Brönners Buch ist keine übliche Autobiographie, aber natürlich spielt seine eigene Geschichte eine wichtige Rolle, denn Musik erklärt sich aus dem Individuum heraus, das sie macht. Er berichtet von seiner musikalischen Familie, von der ersten Platte, von seiner Faszination durch Bigbands im Fernsehen, von seinen ersten Gehversuchen als musikbegeisterter Jugendlicher, und davon, dass er heute noch wisse, “an welcher Stelle des Schulhofes das Auto stand, in dem ich, staunend und sprachlos, zum ersten Mal Charlie Parker hörte”.
Der Trompete ist mindestens ein eigenes Kapitel gewidmet, aber natürlich taucht sie überall auf im Buch. Die Königin des Jazz sei sie, der Trompeter “geradezu naturgemäß der Chef”. Im Musikaliengeschäft von “Tante Doris”, der Schwester seiner Mutter, konnte er alle möglichen Instrumente ausprobieren; hier bekam er auch seine erste Trompete, ein Geschenk zur Erstkommunion. Er erzählt vom Trompetenunterricht, vom klassischen Wettbewerb “Jugend musiziert”, bei dem er mitmachte und nur den zweiten Platz belegte. Er wusste warum: Seine wahre Liebe galt dem Jazz. Er schreibt über den Klang und die Körperlichkeit des Klangs, über die Anstrengung das Instrument zu beherrschen und seine Beherrschung auch zu behalten, und über die ewige Konkurrenz zwischen Trompete und Saxophon.
Mitte der 80er Jahre kam Brönner ins Landesjugendjazzorchester, wenig später ins neu gegründete Bundesjazzorchester unter Leitung Peter Herbolzheimers. Der war Respekt einflößender Orchesterchef, zugleich aber auch Mensch, und Brönner wurde immer wieder eingeladen, in Herbolzheimers anderer Band, der Rhythm Combination & Brass mitzuwirken. Immer spielte er “A Night in Tunesia” vor, bei “Jugend jazzt” genauso wie beim BuJazzo oder beim Rias-Tanzorchester unter Horst Jankowski, in dem er als jüngster Kollege unter Vertrag genommen wurde und acht Jahre lang arbeitete. Im Rias-Orchester konnte er lernen, dass zur Professionalität eines Musikers auch gehörte, nicht immer nur Jazz zu spielen und sich selbst “nicht immer und bei jedem Stück so furchtbar wichtig zu nehmen”. Er erzählt von Playback-Konzerten, von Dieter Thomas Heck, der schon mal über diese “Negermusik” schimpfte, von Peter Alexanders Jazztalent, von Harald Juhnke, der sich seine Programmabfolge nicht merken konnte, und vom Orchesterchef Horst Jankowski, den er bewunderte und doch auch immer wieder bemitleidete.
Natürlich geht’s ums Business: Brönner erzählt, wie er seine Solokarriere 1993 begann, erstes Album, Pressekontakte, erstes Renommee, erster Verriss: Rückwärtsgewandt sei das, was er mache, oberflächlich. Von Anfang an also musste er sich mit dem Problem auseinandersetzen, dass viele seiner Kritiker den Jazz vor allem dann gelten ließen, wenn er in ihren Augen Avantgarde sei, wobei sie das “Prinzip Avantgarde” kaum hinterfragten. Die Musiker würden sich selten so äußern; die “Deuter und Hüter der Reinheitsgebote” fänden sich vor allem unter den Kritikern. “Der kann doch viel mehr”, werde ihm dann etwa vorgeworfen, “Das sei kein Jazz mehr”, oder “Der dient sich dem Publikum an”. Brönner erzählt die Kritiken nach und ist sichtbar getroffen darüber, dass diese Kritiker ihn als Musiker nicht ernst nehmen, seinen eigenen Weg nicht sehen und ihn nicht nach Kriterien beurteilen wollen, die sie aus seiner Musik ableiten.
Brönner erzählt über seine Debüt-Platte, für die er eigenhändig Ray Brown verpflichtete, über eine Produktion mit Kindheitsfreund Stefan Raab, darüber, wie er bei Universal landete, über Platten mit Carla Bruni, Sergio Mendes oder über jene Plattenproduktion, bei der Annie Lennox aus der Ferne zugespielt wurde. Er räsoniert über sein Leben, über Freunde, über das Klischee des Jazzmusikers als Drogensüchtigen, über Liebe, Romantik und Frauen. Er reflektiert über die Tatsache, dass er als deutscher Musiker eine Musik mit afro-amerikanischen Wurzeln spielt, und er mach gleich zwei Liebeserklärungen: an Berlin und an Johann Sebastian Bach. Er spricht über den Markt, den Geschmack des Publikums, über die Notwendigkeit guten Marketings und darüber, dass Deutschland immer noch ein großer Markt für die Musikwelt ist. Die Tatsache, dass Marketing offenbar manchmal wichtiger als die Musik selbst ist, sei Grund für erheblichen Frust. So sähe man das ja auch Abend für Abend bei den Casting Shows im Fernsehen, bei denen es nicht so sehr ums Talent gehe als darum, dass jeder ein Star sein könne. Brönner sei solchen Shows gegenüber sehr misstrauisch und es habe eine Weile gebraucht, bis er sich entschlossen habe, selbst in der Jury zu “X Facto” mitzumischen. Ob man als Jazzmusiker von Plattenkäufen leben könne? “Das hängt”, antwortet Brönner” nicht nur davon ab, wie viel man verkauft. Es hängt auch davon ab, wie viel man investiert.” Er nennt die Zahl der ersten Abrechnung, die er 2007 von Unversal erhalten hatte: 1.300 Euro. Zugleich seien Platten aber auch eine Investition ins eigene Repertoire, in den eigenen Namen, die Bekanntheit, das Image.
In einem der persönlichsten Kapitel berichtet Brönner dann noch ausführlich über eine Begegnung, die ihn besonders prägte. Hildegard Knef, für deren letztes Album er komponierte, es sogar produzierte, die von der Kollegin zur Vertrauten und Freundin wurde. Er spricht über die besondere Beziehung zum Publikum, dass oft besser weiß, wie gut man war als man besser, über die Freiheit des Improvisierens, für die es immer einen Rahmen braucht, über Saxophonisten, die ihn beeindruckten, Ben Webster, Johnny Griffin, Lee Konitz, über Groupies, hohe Töne, musikalische Duelle auf der Bühne, über das elitäre Getue einiger “Mitglieder des Betriebs, ob sie jetzt Musiker, Redakteure, Kritiker sind” und über das typische Till-Brönner-Publikum.
Und zum Schluss: Die Vision. Ein Plädoyer für den Erhalt der Rundfunk-Bigbands, für die Gründung einer Jazzakademie nicht passgleich, aber durchaus vergleichbar mit Jazz at Lincoln Center mit eigenen Räumen, eigener Band, eigenen Nachwuchsprojekten. Und Plattenempfehlungen – für Trompeter, für Jazz-Verächter, für die einsame Insel
Alles in allem: ein von Claudius Seidl spannend zusammengestelltes, äußerst flüssig zu lesendes Buch, auch deshalb empfehlenswert, weil Till Brönner mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält, seine eigene Position offen verteidigt und den Leser damit zum Nachdenken bringt, zum Selbst-Position-Beziehen. Man mag nicht überall einer Meinung mit ihm sein; man mag seine Kritikerschelte manchmal für etwas überzogen, seine Sicht auf “die Avantgarde” für etwas kurzsichtig halten; und man mag auch sein Verständnis vom Jazz nicht überall nachvollziehen: Auseinandersetzen aber muss man sich mit seinen Argumenten, die er wohl begründet und mit denen er einen wichtigen Diskurs über den Jazz und seine Rolle im deutschen Kulturleben anschiebt, wie er auch von Künstlerseite her geführt werden muss.
Wolfram Knauer (Oktober 2010)
William Parker. Conversazioni sul jazz
Von Marcello Lorrai
Milano 2010 (Auditorium)
140 Seiten (plus 50 Seiten Fotos), 18 Euro
ISBN: 97888-86784-52-8
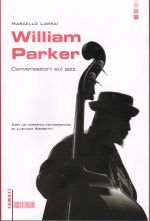 Es ist erstaunlich, dass sich daran kaum etwas geändert hat: Viele der aktuellen Entwicklungen im amerikanischen Jazz werden in Europa intensiver rezipiert und gewürdigt als im Heimatland dieser Musik. Der deutsche Verlag buddy’s knife hatte vor drei Jahren ein Buch mit Texten und Gedichten des New Yorker Kontrabassisten William Parker herausgebracht; jetzt legt Marcello Lorrai in Italien mit einem Buch nach, in dem Parker in einem langen Interview über seine Erfahrungen in der Musik berichtet, aber auch über seine musikalische Ästhetik. Es geht los mit der Kindheit in Goldsboro, North Carolina, musikalischen Einflüssen zwischen Ellington und Beethoven. Er erzählt von seinem Vater, der den ganzen Tag lang Musik gehört habe, Jack McDuff, Gene Ammons, Coleman Hawkins, Ben Webster. Er berichtet von seiner ersten Hörbegegnung mit dem New Thing, dem Free Jazz Ornette Colemans oder Cecil Taylors, von seiner Faszination durch Gedichte Kenneth Patchens. Er erzählt vom Jazzmobile, jener 1964 von Billy Taylor gegründeten Stadtteilinitiative in Harlem, die den Jazz zu den Menschen bringen sollte. Er berichtet über Weggefährten, Don Cherry etwa, Cecil Taylor vor allem, Bill Dixon, Peter Brötzmann und andere. 1978 sei er mit Jemeel Moondoc und Billy Bang zum ersten Mal nach Europa gereist, wo er seither immer wieder gespielt habe, in kleinen Clubs, auf großen Festivals. Parker reflektiert über Rassismus und die Haltung Amiri Barakas und anderer angry black men. Und zum Schluss berichtet er über drei Bassisten, die in seinem Leben eine wichtige Rolle spielten: Charles Mingus, der ihn so sehr beeinflusst habe; Henry Grimes, dem er nach dessen Wiederentdeckung 2003 ein Instrument besorgte; und den Weggefährten Peter Kowald, mit dem er zusammen das spätere Vision Festival entwickelte und der 2002 in seiner New Yorker Wohnung verstarb. Im Mittelteil des Buches finden sich außerdem 50 Seiten voller Fotos von Luciano Rossetti, der Parker beim Konzert oder backstage abgelichtet hat. William Parker bleibt eine Art Weiser im Jazzgeschäft New Yorks: ein großer Künstler, der ohne Scheuklappen genauso viel Respekt vor der Tradition besitzt wie die Kraft Neues anzugehen, der seine musikalische Weisheit aber auch mitteilen will – anderen Musikern genauso wie im Konzert seinem Publikum oder, in diesem Buch, den Lesern. Für die Lektüre sind Italienischkenntnisse vonnöten – eine Übersetzung, zumindest ins Englische, wäre mehr als wünschenswert.
Es ist erstaunlich, dass sich daran kaum etwas geändert hat: Viele der aktuellen Entwicklungen im amerikanischen Jazz werden in Europa intensiver rezipiert und gewürdigt als im Heimatland dieser Musik. Der deutsche Verlag buddy’s knife hatte vor drei Jahren ein Buch mit Texten und Gedichten des New Yorker Kontrabassisten William Parker herausgebracht; jetzt legt Marcello Lorrai in Italien mit einem Buch nach, in dem Parker in einem langen Interview über seine Erfahrungen in der Musik berichtet, aber auch über seine musikalische Ästhetik. Es geht los mit der Kindheit in Goldsboro, North Carolina, musikalischen Einflüssen zwischen Ellington und Beethoven. Er erzählt von seinem Vater, der den ganzen Tag lang Musik gehört habe, Jack McDuff, Gene Ammons, Coleman Hawkins, Ben Webster. Er berichtet von seiner ersten Hörbegegnung mit dem New Thing, dem Free Jazz Ornette Colemans oder Cecil Taylors, von seiner Faszination durch Gedichte Kenneth Patchens. Er erzählt vom Jazzmobile, jener 1964 von Billy Taylor gegründeten Stadtteilinitiative in Harlem, die den Jazz zu den Menschen bringen sollte. Er berichtet über Weggefährten, Don Cherry etwa, Cecil Taylor vor allem, Bill Dixon, Peter Brötzmann und andere. 1978 sei er mit Jemeel Moondoc und Billy Bang zum ersten Mal nach Europa gereist, wo er seither immer wieder gespielt habe, in kleinen Clubs, auf großen Festivals. Parker reflektiert über Rassismus und die Haltung Amiri Barakas und anderer angry black men. Und zum Schluss berichtet er über drei Bassisten, die in seinem Leben eine wichtige Rolle spielten: Charles Mingus, der ihn so sehr beeinflusst habe; Henry Grimes, dem er nach dessen Wiederentdeckung 2003 ein Instrument besorgte; und den Weggefährten Peter Kowald, mit dem er zusammen das spätere Vision Festival entwickelte und der 2002 in seiner New Yorker Wohnung verstarb. Im Mittelteil des Buches finden sich außerdem 50 Seiten voller Fotos von Luciano Rossetti, der Parker beim Konzert oder backstage abgelichtet hat. William Parker bleibt eine Art Weiser im Jazzgeschäft New Yorks: ein großer Künstler, der ohne Scheuklappen genauso viel Respekt vor der Tradition besitzt wie die Kraft Neues anzugehen, der seine musikalische Weisheit aber auch mitteilen will – anderen Musikern genauso wie im Konzert seinem Publikum oder, in diesem Buch, den Lesern. Für die Lektüre sind Italienischkenntnisse vonnöten – eine Übersetzung, zumindest ins Englische, wäre mehr als wünschenswert.
Wolfram Knauer (Oktober 2010)
Von Hitler vertrieben, von Stalin verfolgt. Der Jazzmusiker Eddie Rosner
von Gertrud Pickhan & Maximilian Preisler
Berlin 2010 (be.bra Wissenschaft Verlag)
168 Seiten, 19,95 Euro
 Bis 1933 hieß er Adolf Rosner, änderte dann, aus naheliegenden Gründen, seinen Vornamen, erst in Ady oder Adi, später in Eddie. Ein jüdischer Jazztrompeter, der in den 20er Jahren in Berlin Karriere machte, an den Aufnahmen der legendären Weintraub Syncopators beteiligt war, dann nach Polen, schließlich nach Russland ging, wo er anfangs als Star gefeiert, dann aber als Jazzmusiker verfolgt wurde. Der Journalist Maximilian Preisler ist schon seit einer Weile auf Rosners Spuren und fand in der Historikerin Gertrud Pickhan nun eine Forschungspartnerin bei der Aufgabe, die Lebensgeschichte des Trompeters, dessen Weg von “Erfolg” zu “verfolgt” führte, niederzuschreiben. Die beiden recherchierten auf Ämtern und in Archiven, wühlten in Büchern und Tageszeitungen, und erstellten aus all den so zusammengetragenen Informationen ein überaus lebendiges Bild des Musikers.
Bis 1933 hieß er Adolf Rosner, änderte dann, aus naheliegenden Gründen, seinen Vornamen, erst in Ady oder Adi, später in Eddie. Ein jüdischer Jazztrompeter, der in den 20er Jahren in Berlin Karriere machte, an den Aufnahmen der legendären Weintraub Syncopators beteiligt war, dann nach Polen, schließlich nach Russland ging, wo er anfangs als Star gefeiert, dann aber als Jazzmusiker verfolgt wurde. Der Journalist Maximilian Preisler ist schon seit einer Weile auf Rosners Spuren und fand in der Historikerin Gertrud Pickhan nun eine Forschungspartnerin bei der Aufgabe, die Lebensgeschichte des Trompeters, dessen Weg von “Erfolg” zu “verfolgt” führte, niederzuschreiben. Die beiden recherchierten auf Ämtern und in Archiven, wühlten in Büchern und Tageszeitungen, und erstellten aus all den so zusammengetragenen Informationen ein überaus lebendiges Bild des Musikers.
Vom Aufwachsen in einer jüdischen Familie im Berlin des frühen 20sten Jahrhunderts erfahren wir da, von der kulturellen Ader der Familie, und davon, dass Adolf bereits als Sechsjähriger als Wunderkind aufs Konservatorium geschickt wurde, um Geige zu lernen. Erstes Geld verdiente er in Tanzkapellen wie denen von Efim Schachmeister oder Marek Weber, vor allem aber bei der großen Jazzsensation im Berlin der späten 20er und frühen 30er Jahre, den Weintraub Syncopators. Da hatte er bereits zur Trompete gewechselt und wurde fortan nur noch selten als Geiger erwähnt. Rosner war nicht nur ein erstklassiger Musiker, er war auch ein Showman: Das Publikum tobte, wenn er zwei Trompeten gleichzeitig spielte. 1932 reisten die Weintraub Syncopators als Schiffskapelle nach New York – das Buch druckt ein Faksimile der Passagierliste der SS New York ab –, aber dort durften sie aufgrund des Einspruchs der amerikanischen Musikergewerkschaft ihre Instrumente nicht mit von Bord nehmen.
Nach der Machtergreifung Hitlers emigrierten etliche der Musiker der Weintraubs – darunter auch Friedrich Hollaender – in die USA und anderswohin. Rosner blieb eine Weile in den Niederlanden, trat mit dem Orchester des belgischen Bandleaders Fud Candrix auf und traf Louis Armstrong, der sich gerade auf Europatournee befand und ihm ein Foto mit den Worten widmete “To the white Louis Armstrong from the black Adi Rosner”. Als die Behörden sein Visum nicht verlängerten, ging Rosner 1935 nach Polen. In Krakau und Warschau wurde er gefeiert, zog aber 1938 wieder gen Westen, genauer: nach Paris, wo er nicht nur auf gleichgesinnte Musiker aus Jazz und Showbusiness traf, sondern auch erste Plattenaufnahmen unter eigenem Namen – für das amerikanische Columbia-Label – machte.
Wenig später aber wurde es für jüdische Musiker ernst in Europa. Pickhan und Preisler schildern anschaulich, wie etwa Rosners Schlagzeuger Maurice van Kleef im Durchgangslager Westerborg zusammen mit Kabarettisten und anderen Musikern auftrat. Van Kleef kam erst nach Auschwitz, dann nach Buchenau, und war einer der wenigen, die die KZs überlebten. Im Jahr des Kriegsausbruchs lernte Rosner in Warschau seine zukünftige Frau kennen. Im Oktober 1939 floh das junge Paar nach Bialystock; Rosner wurde kurz darauf Leiter des Belorussischen Jazzorchesters, mit dem er Erfolge in ganz Russland feiern konnte. Das Kapitel über diese Jahre ist reich an Anmerkungen zur sich laufend wandelnden sowjetischen Haltung gegenüber Amerika und dem Jazz in den Kriegs- und frühen Nachkriegsjahren. 1946 passte die Musik vom einen auf den anderen Tag nicht mehr ins ideologische Bild der Machthaber. Rosner als einer der Stars dieser Musik wurde verhaftet, als er nach Polen zurückkehren wollte, und wegen Verrats ins sowjetische Straflager gesteckt. Acht Jahre lang lebte er in verschiedenen Lagern, in denen er, der Vollblutmusiker, bald bereits Lagerorchester zusammenstellte und auch selbst komponierte.
1954 wurde Rosner entlassen, ging nach Moskau und schloss an seine Karriere als Jazzmusiker und Entertainer an, nachdem die Kulturpolitik der Sowjetunion dem Jazz wieder etwas offener gegenüberstand. Er wurde ein für sowjetische Verhältnisse wohlhabender Mann mit großer Wohnung und acht Sparbüchern. Als Benny Goodman 1962 die UdSSR bereiste, stattete er Rosner in dessen Wohnung einen Besuch ab, aß Borschtsch und andere russische Spezialitäten und jammte noch ein bisschen mit dem Trompeter. Anekdoten von Konzerten vor unzufriedenen Werktätigen in der Provinz oder im Theater der Stadt Magadan, in der Rosner lange Zeit inhaftiert gewesen war, beleuchten den Alltag eines Musikers im Russland jener Jahre. Die Zeit aber wurde immer schwieriger, und die Popularität Rosners ließ mit dem Aufkommen anderer musikalischer Moden auch in der Sowjetunion nach.
1973 wurde Rosners Gesuch auf Ausreise in die USA stattgegeben, wo er seine Schwester besuchen wollte. Sechs Tage später flog er weiter nach Berlin und wurde kurz darauf im Durchgangslager Friedland registriert, wo er und seine Frau deutsche Pässe erhielten. Im letzten Kapitel des Buchs nähern sich die Autoren Rosners Versuch in seiner Geburtsstadt wieder Fuß zu fassen. Dieses Kapitel handelt sowohl vom Streit mit Behörden um Entschädigungszahlungen und Rente als auch vom Versuch musikalisch an seine Vorkriegskarriere anzuknüpfen, als die Jugendmode nun wirklich nicht mehr Jazz hieß. Es gab Pläne für Auftritte in nostalgischen Tanzclubs und für Tourneen nach Brasilien und Israel. Doch bevor es dazu kommen konnte, starb Rosner 1976, im Alter von 66 Jahren, an einem Herzinfarkt.
Auch nach seinem Tod verklang Rosners Stimme allerdings nicht vollständig: In Russland kam es 2001 zu einer Art Rosner-Revival, als Alexey Batashev in Moskau ein Gedenkkonzert an den Trompeter organisierte, bei der eine Band Rosners Arrangements aus den 40er bis 60er Jahren nachspielte. Der Dokumentarfilm “The Jazzman from the Gulag” von 1999 erinnerte an Rosners Schicksal in der UdSSR. Der Berliner Saxophonist Dirk Engelhardt arbeitet in seinem Eddie-Rosner-Projekt Rosners verschiedene musikalische Lebensphasen auf. Rosners Tochter Irina Prokofieva-Rosner gab 2005 eine Doppel-CD mit Aufnahmen des Trompeters heraus. Und Gertrud Pickhan und Maximilian Preisler gelingt es in ihrem Buch, die so überaus wechselvolle Geschichte des Adolf / Ady / Adi / Eddie Rosner lebendig werden zu lassen und damit ein Stück pan-europäischer Jazzgeschichte als der Geschichte einer unter Diktaturen immer verfemten Musik.
Wolfram Knauer (September 2010)
Das brennende Klavier. Der Musiker Wolfgang Dauner
Von Wolfgang Schorlau
Hamburg 2010 (Nautilus)
190 Seiten, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-89401-730-9
 Die großen Jazzer des Nachkriegsdeutschlands sind dann doch mit einer Hand abzuzählen. Albert Mangelsdorff, Klaus Doldinger, Gunter Hampel … Peter Brötzmann und Alexander von Schlippenbach scheinen schon ein wenig später zu kommen. Und dann ist da Wolfgang Dauner, jener Tastenzauberer aus Stuttgart, der vom Jazz der amerikanischen Besatzer begeistert bald zum jungen Wilden der Szene wurde, der eine Geige auf der Bühne zertrümmerte oder zum “Urschrei” aufrief, der aber neben dem brennenden Piano, das auf dem Cover Titel seiner Biographie zu sehen ist, die wunderschönsten Harmonien aus dem Klavier herauszaubern kann, der freie Improvisation nicht nur im Free Jazz, sondern auch in der gebundenen Harmonik entdeckt, der Klangflächen erschließt und den Hörer einsaugt mit seinen musikalischen Ideen. Wolfgang Dauner hat viel geschaffen in seinem künstlerischen Leben: wegweisende Platten, etwa “Dream Talk” von 1964 oder “Free Action” von 1967, ein nachhaltig wirkendes paneuropäisches Orchester (das United Jazz and Rock Ensemble); er war Mitgründer des Plattenlabels Mood, schrieb Film- und Fernsehmusiken, trat mit den Größen des deutschen, europäischen, internationalen Jazz auf. Er hat aber auch viel erlebt, und von diesem Leben, von diesem Er-Leben handelt das Buch von Wolfgang Schorlau. Schorlau ist bekannt als Autor politischer Kriminalromane, und seine literarische Ader macht die Dauner-Biographie zu einem flotten Lesevergnügen. Ja, er hängt vieles an Anekdoten auf, aber das Nebeneinander der Anekdoten ist nirgends beliebig, sondern verdichtet sich mehr und mehr zur vielseitigen Persönlichkeit des Pianisten Wolfgang Dauner. Der hält nichts zurück, erzählt von seiner Jugend als Pflegekind, von Drogen und Orgien (oder, wie Schorlau schreibt: “der Begriff Party ist wohl zu lau für das, was in seiner Wohnung stattfindet”, von der Suche und dem Finden, ob in künstlerischer oder privater Hinsicht. Dauner selbst kommt ausführlich zu Wort: über ästhetische Ansichten, lange Haare, die Trauerfeier für Willy Brandt, den “Urschrei”, einen Besuch in New Orleans und und und. Seltene Fotos sind zu sehen, etwa vom splitterfasernackten Fred Braceful (bei einem Happening während des Deutschen Jazzfestivals in Frankfurt) oder auch die kuriose Korrespondenz Dauners mit einer von ihm phantasierten “Cowboy Band Texas”, an die der Zwölfjährige einen Brief schrieb, und über den der “Fort Worth Star-Telegram1948 prompt berichtete (und ihm im Anschluss eine Antwort und eine Cowboy-Banduniform schickte). Schorlaus Buch ist eine lesenswerte Biographie, weil sie sich nicht bei den Fakten aufhält, sondern immer den Menschen dahinter sucht – und findet: den Musiker Wolfgang Dauner.
Die großen Jazzer des Nachkriegsdeutschlands sind dann doch mit einer Hand abzuzählen. Albert Mangelsdorff, Klaus Doldinger, Gunter Hampel … Peter Brötzmann und Alexander von Schlippenbach scheinen schon ein wenig später zu kommen. Und dann ist da Wolfgang Dauner, jener Tastenzauberer aus Stuttgart, der vom Jazz der amerikanischen Besatzer begeistert bald zum jungen Wilden der Szene wurde, der eine Geige auf der Bühne zertrümmerte oder zum “Urschrei” aufrief, der aber neben dem brennenden Piano, das auf dem Cover Titel seiner Biographie zu sehen ist, die wunderschönsten Harmonien aus dem Klavier herauszaubern kann, der freie Improvisation nicht nur im Free Jazz, sondern auch in der gebundenen Harmonik entdeckt, der Klangflächen erschließt und den Hörer einsaugt mit seinen musikalischen Ideen. Wolfgang Dauner hat viel geschaffen in seinem künstlerischen Leben: wegweisende Platten, etwa “Dream Talk” von 1964 oder “Free Action” von 1967, ein nachhaltig wirkendes paneuropäisches Orchester (das United Jazz and Rock Ensemble); er war Mitgründer des Plattenlabels Mood, schrieb Film- und Fernsehmusiken, trat mit den Größen des deutschen, europäischen, internationalen Jazz auf. Er hat aber auch viel erlebt, und von diesem Leben, von diesem Er-Leben handelt das Buch von Wolfgang Schorlau. Schorlau ist bekannt als Autor politischer Kriminalromane, und seine literarische Ader macht die Dauner-Biographie zu einem flotten Lesevergnügen. Ja, er hängt vieles an Anekdoten auf, aber das Nebeneinander der Anekdoten ist nirgends beliebig, sondern verdichtet sich mehr und mehr zur vielseitigen Persönlichkeit des Pianisten Wolfgang Dauner. Der hält nichts zurück, erzählt von seiner Jugend als Pflegekind, von Drogen und Orgien (oder, wie Schorlau schreibt: “der Begriff Party ist wohl zu lau für das, was in seiner Wohnung stattfindet”, von der Suche und dem Finden, ob in künstlerischer oder privater Hinsicht. Dauner selbst kommt ausführlich zu Wort: über ästhetische Ansichten, lange Haare, die Trauerfeier für Willy Brandt, den “Urschrei”, einen Besuch in New Orleans und und und. Seltene Fotos sind zu sehen, etwa vom splitterfasernackten Fred Braceful (bei einem Happening während des Deutschen Jazzfestivals in Frankfurt) oder auch die kuriose Korrespondenz Dauners mit einer von ihm phantasierten “Cowboy Band Texas”, an die der Zwölfjährige einen Brief schrieb, und über den der “Fort Worth Star-Telegram1948 prompt berichtete (und ihm im Anschluss eine Antwort und eine Cowboy-Banduniform schickte). Schorlaus Buch ist eine lesenswerte Biographie, weil sie sich nicht bei den Fakten aufhält, sondern immer den Menschen dahinter sucht – und findet: den Musiker Wolfgang Dauner.
Wolfram Knauer (September 2010)
Vorort von New York? Die Amerikaner in Bremerhaven. Ergebnisse einer Studie am Museum der 50er Jahre Bremerhaven
Von Rüdiger Ritter
Bremerhaven 2010 (Wissenschaftsverlag NW)
372 Seiten, 24,80 Euro
ISBN: 978-3-86509-929-7
 Deutschland Nachkriegs-Jazzgeschichte hängt eng mit seiner Besatzungsgeschichte zusammen. Knapp gesagt: In den englisch besetzten Gebieten spielte man andere Musik als in den amerikanisch besetzten Gebieten. Unter den Briten florierte der in England beliebte Trad Jazz; bei den Amerikanern und unter dem Einfluss der Begegnung deutscher und amerikanischer Musiker der moderne Jazz, der Bebop, Cool Jazz, später der Hard Bop. Albert Mangelsdorff wäre wahrscheinlich überall ein Modernist geworden, aber die Tatsache, dass er in Frankfurt am Main lebte, half erfreulich nach. In letzter Zeit sind einige Studien zum Verhältnis der Deutschen und der Amerikaner in der Zeit der Besatzung erschienen, und die meisten befassen sich mit den “klassischen” amerikanischen Besatzungsgebieten in Süd- und Südwestdeutschland. Dabei war Bremerhaven als Hafenstadt eine ganz besondere Enklave, und die Präsenz der Amerikaner beeinflusste auch hier deutsche Musiker dahingehend, dass sie modernen Jazz spielten, experimentierten, sich die soul-vollen Grooves ihrer amerikanischen Kollegen abschauten oder aber in den Clubs der Stadt durch die Erwartungshaltung ihres amerikanischen Publikums ein anderes musikalisches Bewusstsein entwickelten.
Deutschland Nachkriegs-Jazzgeschichte hängt eng mit seiner Besatzungsgeschichte zusammen. Knapp gesagt: In den englisch besetzten Gebieten spielte man andere Musik als in den amerikanisch besetzten Gebieten. Unter den Briten florierte der in England beliebte Trad Jazz; bei den Amerikanern und unter dem Einfluss der Begegnung deutscher und amerikanischer Musiker der moderne Jazz, der Bebop, Cool Jazz, später der Hard Bop. Albert Mangelsdorff wäre wahrscheinlich überall ein Modernist geworden, aber die Tatsache, dass er in Frankfurt am Main lebte, half erfreulich nach. In letzter Zeit sind einige Studien zum Verhältnis der Deutschen und der Amerikaner in der Zeit der Besatzung erschienen, und die meisten befassen sich mit den “klassischen” amerikanischen Besatzungsgebieten in Süd- und Südwestdeutschland. Dabei war Bremerhaven als Hafenstadt eine ganz besondere Enklave, und die Präsenz der Amerikaner beeinflusste auch hier deutsche Musiker dahingehend, dass sie modernen Jazz spielten, experimentierten, sich die soul-vollen Grooves ihrer amerikanischen Kollegen abschauten oder aber in den Clubs der Stadt durch die Erwartungshaltung ihres amerikanischen Publikums ein anderes musikalisches Bewusstsein entwickelten.
Rüdiger Ritter ist ein jazz-beflissener Historiker und hat quasi nebenher in der ehemaligen Militärkirche auf dem Gelände der einstigen US-Kaserne “Carl Schurz” in Bremerhaven-Weddewarden ein Museum der 50er Jahre aufgebaut. Nun legt er eine ausführliche Studie vor, für die er akribisch in den Akten gewälzt, aber auch jede Menge Zeitzeugeninterviews geführt hat und in der er beleuchtet, wie die Präsenz der Amerikaner das Leben in Bremerhaven in allen Bereichen beeinflusste.
Die Bremerhavener nannten ihre Stadt selbst scherzhaft “Vorort New Yorks” – allerdings gar nicht mit Bezug auf die amerikanische Besatzung, sonder vielmehr mit Bezug auf die Zeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert, als von Bremerhaven aus die großen Passagierschiffe in Richtung Amerika ausliefen, als Bremerhaven für viele Auswanderer die letzte deutsche Stadt war, bevor sie in Ellis Island amerikanischen Boden betraten. Als die Amerikaner nach dem II. Weltkrieg entschieden, Bremerhaven als “Port of Embarkation” zu nutzen, bauten sie genauso wie die Bremerhavener auf dieser Vorgeschichte auf – eine Vorgeschichte, die durchaus dazu beitrug, dass die Besatzung auch durch die Bürger der Stadt von Anfang an positiver gesehen wurde als anderswo.
Ritters Buch beschreibt die Stationierung der Amerikaner, die am 7. Mai 1945 begann und am 5. Juni 1993 mit der Schließung der letzten US-Kaserne endete. Er erklärt, wie sich Briten und Amerikaner nach dem Krieg auf die Aufteilung der Besatzungsgebiete einigten. Er beschreibt die Bedeutung des Standorts Bremerhaven für die US-Streitkräfte in Europa und die US-amerikanische Infrastruktur inner- und außerhalb der Barracks. Zugleich betrachtet er die Lebensumstände der Deutschen zur selben Zeit, Nachkriegsarmut und Überlebensstrategien, den Schwarzmarkt und die Amerikaner als Arbeitgeber. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit den Re-education-Maßnahmen, ein weiteres mit der innerhalb dieses Programms zu sehenden Jugendarbeit der Amerikaner. Fraternisierung, die “German Fräuleins” und “spontane Amerikanisierung in der Kneipe” bringen uns dann langsam zum Thema Kulturtransfer, dem Jazzfreund Ritter ein ausführliches Kapitel einräumt. Er beschreibt “Chico’s Place”, jene Kneipe, in der seit den 50er Jahren Jazz erklang und in die selbst Hamburger Jazzfreunde pilgerten Er schreibt über Armeekappellen, die auch auf Bremerhavens Straßen zu hören waren und neben Marschmusik immer auch Jazziges im Gepäck hatten. Der AFN wird erwähnt und natürlich die Ankunft Elvis Presleys 1958. Vor allem aber beschreibt Ritter die Amerikaner “als Geburtshelfer der Bremerhavener Jazz-Szene” – und man könnte ergänzen: auch der Bremer Szene. Von den Namen, die er nennt, ist kaum einer über die Region hinaus bekannt geworden, doch die Legende lebt weiter. Von “Chico’s Place” erzählen sich alte Jazzer noch heute, und auch der Mythos eines fröhlichen Nebeneinanderlebens hält sich.
Ritter aber setzt auch ein wenig dagegen, indem er stichprobenhaft die verschiedenen Mythen amerikanisch-deutschen Zusammenlebens in Bremerhaven auf ihre Wirklichkeitsnähe hin überprüft, etwa wenn er auf den Umgang der Amerikaner mit Homosexualität, auf den alltäglichen Rassismus und seinen Widerspruch zu den Idealen der Umerziehung, auf “Gis als Unruhestifter” oder auf den Clash der Generationen jener Jahre hinweist, in dem der amerikanische Einfluss immer mehr als ein kulturzersetzender, jugendgefährdender gesehen wurde. Sein Buch ist eine beispielhafte Studie, die zugleich vorführt, wie vielfältig die Beziehungen zwischen eng miteinander lebenden Kulturkreisen sind und vor allem, wieviel Forschungsaufgaben noch vor uns liegen, um konkrete Entwicklungen nachzuzeichnen. Für die deutsche Jazzgeschichte, die das Phänomen der amerikanischen Präsenz in Deutschland ja fast am stärksten betrifft, ist das alles ein besonders spannendes Thema, und Ritters Buch eine gute Ausgangsbasis zur Reflektion über die vielfältigen gegenseitigen Einflüsse.
Wolfram Knauer (September 2010)
Coltrane
Von Paolo Parisi
Bologna 2010 (Blackvelvet Biopop)
128 Seiten, 13,00 Euro
ISBN: 978-88-87827-86-6
 “Am Anfang war der Ton”, beginnt das Buch des Comicautors Paolo Parisi, das die musikalische Lebensgeschichte von John Coltrane erzählt: von seiner Jugend in North Carolina, ersten musikalischen Gehversuchen in Philadelphia, der Zeit bei Dizzy Gillespie, Thelonious Monk und Miles Davis, von Alkohol- und Drogenexzessen, vom Rassismus, von Liebe, Geschäft, Erfolg, von ästhetischen Wollen und vom künstlerischen Nachlass des großen Saxophonisten. Wir begegnen all den wichtigen Personen in seinem Leben, seinem klassischen Quartett, seiner Frau Alice, vielen Kollegen, die an der New Yorker Jazz-Avantgarde der 1960er Jahre mitwirkten, Orten wie dem Birdland und dem Village Vanguard, Aufnahmesessions wie der für “My Favorite Things” oder der für “A Love Supreme”, dessen vier Sätzen der Autor die Überschriften über die vier Großkapitel entlieh. Ein schönes Buch für jeden (italienisch sprechenden) Coltraneliebhaber.
“Am Anfang war der Ton”, beginnt das Buch des Comicautors Paolo Parisi, das die musikalische Lebensgeschichte von John Coltrane erzählt: von seiner Jugend in North Carolina, ersten musikalischen Gehversuchen in Philadelphia, der Zeit bei Dizzy Gillespie, Thelonious Monk und Miles Davis, von Alkohol- und Drogenexzessen, vom Rassismus, von Liebe, Geschäft, Erfolg, von ästhetischen Wollen und vom künstlerischen Nachlass des großen Saxophonisten. Wir begegnen all den wichtigen Personen in seinem Leben, seinem klassischen Quartett, seiner Frau Alice, vielen Kollegen, die an der New Yorker Jazz-Avantgarde der 1960er Jahre mitwirkten, Orten wie dem Birdland und dem Village Vanguard, Aufnahmesessions wie der für “My Favorite Things” oder der für “A Love Supreme”, dessen vier Sätzen der Autor die Überschriften über die vier Großkapitel entlieh. Ein schönes Buch für jeden (italienisch sprechenden) Coltraneliebhaber.
Wolfram Knauer (August 2010)
In Search of Don Ellis, Forgotten Genius, Volume 1-3
von Ken Orton
England 2010 (UniBook / Ken Orton)
Vol. 1: 418 Seiten, 32,94 Euro
Vol. 2: 438 Seiten, 34,23 Euro
Vol. 3: 157 Seiten, 42,97 Euro
ISBN: 9781935038962 (Vol. 1)
ISBN: 9781935038979 (Vol. 2)
ISBN: 9781935038986 (Vol. 3)
Direkt erhältlich über www.unibook.com
Ken Orton ist wahrscheinlich der kenntnisreichste Experte, wenn es um den Trompeter Don Ellis geht, dessen Experimente mit Form und Metrum, aber auch mit außereuropäischen (bzw. außeramerikanischen) Musiktraditionen in den 1960er Jahren weit einflussreicher waren, als es sein Bekanntheitsgrad vermuten lässt. Seine Don Ellis-Biographie ist jetzt erschienen, und sie ist umfangreich geworden: ein Werk mit drei Bänden von insgesamt knapp 1.000 Seiten, auf denen Ellis’ Leben genauso dokumentiert wird wie sein musikalisches Werk. Es ist eine “labor of love”, und es ist ein akribisches Projekt, ohne Zweifel ein Standardwerk über den Trompeter, an dem niemand vorbeikommen wird.
 Der erste Band widmet sich Ellis’ Biographie bis etwa 1971. Orton verfolgt die Familiengeschichte ausführlich, weiß um Leben und Arbeit des Vaters genauso wie um die geographischen Umstände der Kindheit Don Ellis’. Er zitiert aus Interviews mit Familienangehörigen und Bekannten, vor allem aber auch aus persönlichen Papieren, Briefen, Familienbüchern und vielem mehr. Mit acht Jahren erhielt Don sein erstes Instrument, mit zehn Jahren wurde sein musikalisches Talent offiziell festgehalten; mit elf hatte er seine erste Band, für die er auch die Arrangements schrieb. 1956 wurde Ellis in die Armee eingezogen und war bald in Deutschland stationiert, wo er in der 7th Army Symphony spielte. Orton macht überall in seinem Buch ausführlichen gebrauch von persönlichen Briefen, die Don Ellis an seine Eltern und Großeltern schrieb. In solchen Briefen liest man etwa von einer Session mit Tony Scott, von seinem neuen Porsche, von Reisen mit der Band und seiner Unzufriedenheit mit einem neuen Bandleader der Armeekapelle. 1958 wurde Ellis ehrenhaft aus der Armee entlassen. Zurück in New York traf er Joe Zawinul, den er aus Wien kannte und der ihm einen Job in Maynard Fergusons Band vermittelte. Zwischendurch finden sich dabei immer wieder kurze Anmerkungen, die Orton nicht auflöst, die der jazzgeschichtlich bewanderte Leser aber mit Interesse zur Kenntnis nimmt, etwa (aus einem Brief vom Oktober 1959): “Der Gitarrist in meiner Band ist ein Typ, mit dem ich in Frankfurt immer zusammengespielt hatte. Er hat letztes Jahr in die europäischen Jazzumfragen gewonnen.” – gemeint ist wahrscheinlich Attila Zoller, der genau zu dieser Zeit in New York ankam. 1959 nahm Ellis eine Platte mit Charles Mingus auf; 1960 stellte er sein eigenes Quintett im New Yorker Club Birdland vor; später im Jahr erhielt er ein Vollstipendium zur Lenox School of Jazz, über die er einen ausführlichen Report verfasste. Im Herbst nahm er dann sein erstes Album unter eigenem Namen auf, “How Time Passes”, und wieder geben viele persönliche Briefe einen Einblick in das tägliche Leben eines Musikers in jenen Jahren. Orton verfolgt Ellis’ Biographie mehr oder weniger chronologisch, notiert akribisch jeden Termin, jedes Engagement, über das es Belege gibt, zitiert aus Briefen, zeitgenössischen Kritiken, Zeitzeugeninterviews etwa mit seiner Frau Connie. Ellis selbst äußert sich etwa auf eine Frage Leonard Feathers über seine Einstellung zur Ästhetik des Jazz (den er immer noch als “Folk Music” ansieht) und über staatliche Subventionen (“Ich bin absolut dagegen.”). 1962 besuchte Don mit seiner Frau das Jazz Jamboree in Warschau, und Orton druckt sein Tagebuch der Reise ab. 1964 arbeitete Ellis an einem Buch über Rhythmik und bezieht sich darin sowohl auf seine eigenen Experimente mit ungeraden Metren wie auch auf indische Ragas. Wenig später gründete er das Hindustani Jazz Sextet, mit dem er eine Fusion aus indischen und Jazzstilistiken versuchte. Zur selben Zeit fing er an, sich für das Spiel mit Vierteltönen zu interessieren. 1966 übernahm er die Programmplanung des Clubs Bonesville in Los Angeles; im selben Jahr lud er Karin Krog ein, auf einem seiner Alben mitzuwirken. Inzwischen leitete er eine Bigband, die vor allem seine eigenen Kompositionen umsetzte und mit der er in den nächsten Jahren auf großen Festivals zu hören war. Ellis war immer ein sehr aktiver Vertreter des Third Stream und trat etwa 1967 mit seiner Bigband und dem Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Leitung von Zubin Mehta in einem Konzert auf, dass die beiden Klangkörper gegenüberstellte. Etwa zur selben Zeit wandte er sich elektrisch verstärkten Instrumenten für seine Band zu (einschließlich seines eigenen), gehörte damit zu den Vorreitern einer Jazz-Rock-Fusion, was auch außerhalb der Jazzwelt wahrgenommen wurde. 1968 veröffentlichte er mit “Electric Bath” seine erste LP für das Label Columbia, die weltweit Furore machte. Nächste Station auf seinem Weg war die Electric Band, mit der er 1968 auch bei den Berliner Jazztagen zu hören war. Orton spürt Konzertrezensionen selbst in Provinzblättern auf und druckt sie ab, Rezensionen, die manchmal ein wenig sehr ins Einzelne zu gehen scheinen, dabei aber doch das Bild des Alltags eines reisenden Musikers widerspiegeln.
Der erste Band widmet sich Ellis’ Biographie bis etwa 1971. Orton verfolgt die Familiengeschichte ausführlich, weiß um Leben und Arbeit des Vaters genauso wie um die geographischen Umstände der Kindheit Don Ellis’. Er zitiert aus Interviews mit Familienangehörigen und Bekannten, vor allem aber auch aus persönlichen Papieren, Briefen, Familienbüchern und vielem mehr. Mit acht Jahren erhielt Don sein erstes Instrument, mit zehn Jahren wurde sein musikalisches Talent offiziell festgehalten; mit elf hatte er seine erste Band, für die er auch die Arrangements schrieb. 1956 wurde Ellis in die Armee eingezogen und war bald in Deutschland stationiert, wo er in der 7th Army Symphony spielte. Orton macht überall in seinem Buch ausführlichen gebrauch von persönlichen Briefen, die Don Ellis an seine Eltern und Großeltern schrieb. In solchen Briefen liest man etwa von einer Session mit Tony Scott, von seinem neuen Porsche, von Reisen mit der Band und seiner Unzufriedenheit mit einem neuen Bandleader der Armeekapelle. 1958 wurde Ellis ehrenhaft aus der Armee entlassen. Zurück in New York traf er Joe Zawinul, den er aus Wien kannte und der ihm einen Job in Maynard Fergusons Band vermittelte. Zwischendurch finden sich dabei immer wieder kurze Anmerkungen, die Orton nicht auflöst, die der jazzgeschichtlich bewanderte Leser aber mit Interesse zur Kenntnis nimmt, etwa (aus einem Brief vom Oktober 1959): “Der Gitarrist in meiner Band ist ein Typ, mit dem ich in Frankfurt immer zusammengespielt hatte. Er hat letztes Jahr in die europäischen Jazzumfragen gewonnen.” – gemeint ist wahrscheinlich Attila Zoller, der genau zu dieser Zeit in New York ankam. 1959 nahm Ellis eine Platte mit Charles Mingus auf; 1960 stellte er sein eigenes Quintett im New Yorker Club Birdland vor; später im Jahr erhielt er ein Vollstipendium zur Lenox School of Jazz, über die er einen ausführlichen Report verfasste. Im Herbst nahm er dann sein erstes Album unter eigenem Namen auf, “How Time Passes”, und wieder geben viele persönliche Briefe einen Einblick in das tägliche Leben eines Musikers in jenen Jahren. Orton verfolgt Ellis’ Biographie mehr oder weniger chronologisch, notiert akribisch jeden Termin, jedes Engagement, über das es Belege gibt, zitiert aus Briefen, zeitgenössischen Kritiken, Zeitzeugeninterviews etwa mit seiner Frau Connie. Ellis selbst äußert sich etwa auf eine Frage Leonard Feathers über seine Einstellung zur Ästhetik des Jazz (den er immer noch als “Folk Music” ansieht) und über staatliche Subventionen (“Ich bin absolut dagegen.”). 1962 besuchte Don mit seiner Frau das Jazz Jamboree in Warschau, und Orton druckt sein Tagebuch der Reise ab. 1964 arbeitete Ellis an einem Buch über Rhythmik und bezieht sich darin sowohl auf seine eigenen Experimente mit ungeraden Metren wie auch auf indische Ragas. Wenig später gründete er das Hindustani Jazz Sextet, mit dem er eine Fusion aus indischen und Jazzstilistiken versuchte. Zur selben Zeit fing er an, sich für das Spiel mit Vierteltönen zu interessieren. 1966 übernahm er die Programmplanung des Clubs Bonesville in Los Angeles; im selben Jahr lud er Karin Krog ein, auf einem seiner Alben mitzuwirken. Inzwischen leitete er eine Bigband, die vor allem seine eigenen Kompositionen umsetzte und mit der er in den nächsten Jahren auf großen Festivals zu hören war. Ellis war immer ein sehr aktiver Vertreter des Third Stream und trat etwa 1967 mit seiner Bigband und dem Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Leitung von Zubin Mehta in einem Konzert auf, dass die beiden Klangkörper gegenüberstellte. Etwa zur selben Zeit wandte er sich elektrisch verstärkten Instrumenten für seine Band zu (einschließlich seines eigenen), gehörte damit zu den Vorreitern einer Jazz-Rock-Fusion, was auch außerhalb der Jazzwelt wahrgenommen wurde. 1968 veröffentlichte er mit “Electric Bath” seine erste LP für das Label Columbia, die weltweit Furore machte. Nächste Station auf seinem Weg war die Electric Band, mit der er 1968 auch bei den Berliner Jazztagen zu hören war. Orton spürt Konzertrezensionen selbst in Provinzblättern auf und druckt sie ab, Rezensionen, die manchmal ein wenig sehr ins Einzelne zu gehen scheinen, dabei aber doch das Bild des Alltags eines reisenden Musikers widerspiegeln.
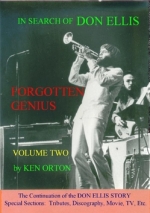 Band 2 der Reihe nimmt den Faden im Jahr 1971 auf und geht im selben Duktus weiter: Konzert auf Konzert, Platte auf Platte werden sorgfältig aufgelistet, Rezensionen gesammelt, Erinnerungen von Musikern und Auszüge aus Ellis’ Tagebuch zugeordnet. Höhepunkte hier etwa seine Filmmusik zu “The French Connection”, für die er 1972 einen Grammy erhielt. Beziehungsprobleme des Trompeters und Probleme mit den Steuerbehörden werden genauso erörtert wie der Bau seines Traumhauses, das 1974 sogar in einer Beilage der Los Angeles Times vorgestellt wurde. 1975 wurde eine Herzerkrankung bei Ellis diagnostiziert, und wenig später musste er nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden. 1976 griff er zusätzlich zu seinen bisherigen Instrumenten zur Posaune; 1977 nahm er eine Platte mit Musik auf, die durch den Film “Star Wars” inspiriert war. 1977 auch korrespondierte er mit Hans Georg Brunner-Schwer über ein Plattenprojekt für das MPS-Label, das Joachim Ernst Berendt angedacht und für das er außerdem Karin Krog vorgemerkt hatte, das aber nie realisiert werden konnte. Im Februar 1978 spielte Ellis’ Quintett beim Jazz Yatra Festival in Bombay, Indien. Der Trompeter war bereits schwer krank zu dieser Zeit, trat aber wie vor auf, wenn er auch mehr und mehr die Trompete auf die Seite legte und stattdessen auf dem Synthesizer spielte. Am 10. Mai 1978 meldete der Melody Maker, Ellis habe sich auf Anraten seiner Ärzte vom aktiven Musikmachen zurückgezogen. Am 17. Dezember 1978 besuchte Ellis eine Vorstellung des Musicals “Evolution of the Blues” von Jon Hendricks. Zurück zuhause unterhielt er sich mit seiner Mutter und brach mitten im Gespräch tot zusammen. Seine Eltern übernahmen die Aufgabe, sein Vermächtnis zu erfüllen, seine Kompositionen und Korrespondenz in einem geeigneten Archiv unterzubringen (sie entschieden sich für das Eastfield College in Texas, an dem Ellis sein letztes Konzert gegeben hatte) und die Erinnerung an ihren Sohn aufrecht zu erhalten.
Band 2 der Reihe nimmt den Faden im Jahr 1971 auf und geht im selben Duktus weiter: Konzert auf Konzert, Platte auf Platte werden sorgfältig aufgelistet, Rezensionen gesammelt, Erinnerungen von Musikern und Auszüge aus Ellis’ Tagebuch zugeordnet. Höhepunkte hier etwa seine Filmmusik zu “The French Connection”, für die er 1972 einen Grammy erhielt. Beziehungsprobleme des Trompeters und Probleme mit den Steuerbehörden werden genauso erörtert wie der Bau seines Traumhauses, das 1974 sogar in einer Beilage der Los Angeles Times vorgestellt wurde. 1975 wurde eine Herzerkrankung bei Ellis diagnostiziert, und wenig später musste er nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden. 1976 griff er zusätzlich zu seinen bisherigen Instrumenten zur Posaune; 1977 nahm er eine Platte mit Musik auf, die durch den Film “Star Wars” inspiriert war. 1977 auch korrespondierte er mit Hans Georg Brunner-Schwer über ein Plattenprojekt für das MPS-Label, das Joachim Ernst Berendt angedacht und für das er außerdem Karin Krog vorgemerkt hatte, das aber nie realisiert werden konnte. Im Februar 1978 spielte Ellis’ Quintett beim Jazz Yatra Festival in Bombay, Indien. Der Trompeter war bereits schwer krank zu dieser Zeit, trat aber wie vor auf, wenn er auch mehr und mehr die Trompete auf die Seite legte und stattdessen auf dem Synthesizer spielte. Am 10. Mai 1978 meldete der Melody Maker, Ellis habe sich auf Anraten seiner Ärzte vom aktiven Musikmachen zurückgezogen. Am 17. Dezember 1978 besuchte Ellis eine Vorstellung des Musicals “Evolution of the Blues” von Jon Hendricks. Zurück zuhause unterhielt er sich mit seiner Mutter und brach mitten im Gespräch tot zusammen. Seine Eltern übernahmen die Aufgabe, sein Vermächtnis zu erfüllen, seine Kompositionen und Korrespondenz in einem geeigneten Archiv unterzubringen (sie entschieden sich für das Eastfield College in Texas, an dem Ellis sein letztes Konzert gegeben hatte) und die Erinnerung an ihren Sohn aufrecht zu erhalten.
Ein Schlusskapitel des biographischen Teils, “Where Do We Go From Here?” stellt sich als das persönlichste des Buchs heraus: Es schildert den Weg des Autors, den Weg Ken Ortons zum Buch, einen Weg, den er Anfang der 1980er Jahre begonnen hatte, als er sich mit Ellis’ Eltern in Kalifornien traf. Orton war mitverantwortlich dafür, dass die Don Ellis Collection 2000 vom Eastfield College an die University of California in Los Angeles überführt wurde, wo sie sinnvoll erschlossen und zugänglich gemacht werden konnte. Orton ist selbst Saxophonist und leitete in den 1990er Jahren eine eigene Bigband, die er The Don Ellis Connection” nannte und mit der er mit Erlaubnis der Familie vor allem Kompositionen des Trompeters aufführte. Die zweite Hälfte des zweiten Bandes füllen Erinnerungen von Kollegen an Don Ellis, unveröffentlichte Manuskripte des Trompeters über Musik, über Jazz, über Ästhetik, sowie eine ausführliche Diskographie, die sowohl seine eigenen Projekte enthält als auch diejenigen, an denen er mitwirkte, Filmmusikern sowie Fernseh- und Videomitschnitte. Eine Liste seiner Kompositionen und Arrangements beschließt den Band.
 Band 3 des opulenten Werks schließlich enthält eine Bildergalerie einiger öffentlicher, vor allem aber privater Fotos: Kinderbilder, die ersten Bands, Fotos aus Deutschland, New York in den 1960ern, die junge Familie, Reise- und Tourneefotos, Plattensitzungen, Bilder, bei denen die Hingabe an die Musik deutlich wird (wenn auch auf den ersten Blick eher der Wandel der Frisuren auffällt). Am Schluss stehen zwei Fotos von einer Ehrung in Boston, auf denen man deutlich sieht, wie krank Ellis bereits war, drei Monate vor seinem Tod.
Band 3 des opulenten Werks schließlich enthält eine Bildergalerie einiger öffentlicher, vor allem aber privater Fotos: Kinderbilder, die ersten Bands, Fotos aus Deutschland, New York in den 1960ern, die junge Familie, Reise- und Tourneefotos, Plattensitzungen, Bilder, bei denen die Hingabe an die Musik deutlich wird (wenn auch auf den ersten Blick eher der Wandel der Frisuren auffällt). Am Schluss stehen zwei Fotos von einer Ehrung in Boston, auf denen man deutlich sieht, wie krank Ellis bereits war, drei Monate vor seinem Tod.
Ken Ortons Buch ist keine schnelle Lesereise. Er hat die letzten dreißig Jahre seinen Recherchen zu Don Ellis gewidmet, und es wirkt, als habe er alles, was er dabei gefunden hat, auch in das Buch gesteckt. Das mag ein Grund dafür sein, dass Orton Schwierigkeiten hatte, einen Verlag für dieses Mammutwerk zu finden – die akribisch festgehaltenen Details zu jedem Auftritt, jeder Platte sind wahrscheinlich tatsächlich vor allem für den Don-Ellis-Fan richtig interessant. Doch wenn man zwischendurch auch manchmal meint, das sei schon ein wenig viel des Guten, liest man sich gleich im nächsten Moment wieder fest in einer Quelle, die Orton nüchtern einführt, die für sich belanglos scheint, im Umfeld aber so ein enorm menschliches Licht auf den Künstler und Komponisten, auf den Trompeter und … ja, man mag sagen Philosophen Don Ellis wirft. Und am Ende ist man dankbar für die Akribie, auch dafür, dass Orton sich dazu entschlossen hat, dieses Material sorgfältig geordnet komplett im “books on demand”-.Verfahren zugänglich zu machen. Man wünschte sich vielleicht noch einen Personen-, Platten-, Titel- und Themenindex. Aber das war’s dann auch schon. Über Don Ellis weiß man fast alles nach der Lektüre. Nur die Musik, die muss man selbst hören.
Wolfram Knauer (August 2010)
PS: Quasi parallel zum Buch erschien eine CD mit Konzertmitschnitten vom Februar 1978, als Ellis mit seinem Quintett in Indien auftrat: Don Ellis, “Live in India. The Lost Tapes of a Musical Legend, Vol. 1” (Sleepy Night Records SNR003CD). Siehe www.sleepynightrecords.com.
Pierre Courbois > Révocation
Herausgegeben von Paul Kusters & Titus Schulz
Westervoort/Niederlande 2010 (Uitgeverij Van Gruting)
226 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 97890-75879-537
 Pierre Courbois hat in seiner musikalischen Karriere eine Menge Dinge als erster gemacht: Er war einer der ersten europäischen Musiker, die mit dem Free Jazz liebäugelten, als er 1961 das Original Dutch Free Jazz Quartet gründete; er leitete mit seiner Association PC aber auch eine der ersten Fusionbands Europas; und spielte darüber hinaus mit Musikern wie Gunter Hampel, Theo Loevendie, Mal Waldron, Rein de Graaf, Manfred Schoof, Willem Breuker, Jasper Van’t Hof und vielen anderen. Er erhielt in seinem Heimatland die höchsten Preise, so 1994 den Bird Award beim Northsea Jazz Festival und 2008 den Boy Edgar Prijs.
Pierre Courbois hat in seiner musikalischen Karriere eine Menge Dinge als erster gemacht: Er war einer der ersten europäischen Musiker, die mit dem Free Jazz liebäugelten, als er 1961 das Original Dutch Free Jazz Quartet gründete; er leitete mit seiner Association PC aber auch eine der ersten Fusionbands Europas; und spielte darüber hinaus mit Musikern wie Gunter Hampel, Theo Loevendie, Mal Waldron, Rein de Graaf, Manfred Schoof, Willem Breuker, Jasper Van’t Hof und vielen anderen. Er erhielt in seinem Heimatland die höchsten Preise, so 1994 den Bird Award beim Northsea Jazz Festival und 2008 den Boy Edgar Prijs.
Jetzt, pünktlich zu seinem 70. Geburtstag, haben Paul Kusters und Titus Schulz dem einflussreichen holländischen Musiker ein Buch gewidmet, in dem Courbois selbst genauso zu Worte kommt wie viele seiner Weggefährten über die Jahre. Es beginnt mit einer biographischen Skizze, einem kursorischen Überblick über die Kapitel seines musikalischen Werdegangs. Dann erzählt einer der Bassklarinettist und Vibraphonist Gunter Hampel über ihre gemeinsame Zeit in den 1960er Jahren, als Courbois in Hampels Band spielte und auch bei der LP “Heartplants” mit von der Partie war. Jasper Van’t Hof und Peter Crijnen erinnern sich gemeinsam mit Courbois an die Association PC und die Auseinandersetzung mit den verschiedenen rhythmischen und ästhetischen Ansätzen der beiden Genres Jazz und Rock, sind sich außerdem einig in ihrer Wertung, dass die Association PC wohl eher eine Jazzrock- als eine Rockjazz-Band gewesen sei. Die meisten der im Buch enthaltenen Interviews sind solche Doppelinterviews, wobei einer der beiden Interviewpartner oft Courbois selbst ist, was dazu führt, dass man als Leser Einblicke in Gespräche zwischen Eingeweihten erhält, dass die Diskussionen sich bald ums Eigentliche drehen, um rhythmische Absprachen (mit Rein de Graaf), Harmonik (mit Theo Loevendie), darum, wie Pierre Courbois rhythmisch Druck machen konnte (mit Leo van Oostroom und Ilja Reijngoud), wie wichtig ihm seine rhythmische Eigenständigkeit auch im Zusammenspiel war (mit Egon Kracht und Niko Langenhuijsen). Courbois selbst erzählt über seine Technik und über Einflüsse auf ihn sowie über sein Instrument, das er aus vielen verschiedenen Einzelteilen zusammengestellt hat und bei dem viele Teile von ihm selbst konstruiert wurden. Mit Jos Janssen unterhalten die Autoren sich über Pierres Gongtechnik und seine Soloaufnahmen. Manfred Schoof lobt Courbois Komposition “Révocation”, die gleich darauf von Martin Fondse ausführlich analysiert wird. Der Geiger Heribert Wagner kommt zu Wort und der Pianist Pol de Haas, mit denen Courbois in den 1980er und 1990er Jahren zusammengespielt hatte. Saxophonist Jasper Blom berichtet, dass die Band nach den Konzerten wenig über die Musik gesprochen habe, und der Schlagzeuger Colin Seidel erzählt, was er bei seinem Lehrer Pierre Courbois hat lernen können. Ein Buch voller Respekt von allen Seiten, aber auch ein Buch, das einen Einblick erlaubt ins Denken eines kreativen Musikers und ins Funktionieren improvisierter Musik zwischen den frühen 1960er Jahren und heute. Und natürlich gibt es jede Menge menschlicher Informationen über Courbois und die Musiker, mit denen er über all diese Jahre zusammengearbeitet hat. Es ist ein überaus opulentes Werk geworden, mit vielen Fotos sowohl aus Courbois’ langen Berufsjahren als auch von seinen selbstgebauten Instrumenten. Zur Lektüre allerdings sollte man schon des Holländischen mächtig sein. Das Buch erschien, wie gesagt, pünktlich zum 70. Geburtstag des Schlagzeugers im April 2010. Es ist eine Labor of Love aller Beteiligten und ein weiterer Baustein zu einer noch ausstehenden europäischen Jazzgeschichte.
Wolfram Knauer (Juli 2010)
Jazz de France. Le guide-annuaire du jazz en France
Herausgegeben von Pascal Anquetil
Paris 2010 (irma = Centre d’Information et de Resources pour les Musiques Actuelles)
608 Seiten, 36 Euro
ISBN: 978-2-916668-27-7
 Wir werden immer wieder gefragt, ob es so etwas wie den von uns alle zwei Jahre vorgelegten “Wegweiser Jazz” auch für andere Länder gibt, und für die meisten Länder müssen wir verneinen. Die eine Ausnahme ist Frankreich, das mit blendendem Beispiel vorangeht mit dem Verzeichnis “Jazz de France”, herausgegeben vom Informationszentrum für zeitgenössische Musik “irma” und betreut von Pascal Anquetil. Das Buch ist ein überaus übersichtliches Verzeichnis der französischen Jazzszene und enthält auf 600 Seiten noch erheblich mehr als wir in die Printausgabe unseres Wegweisers stecken, beispielsweise die Kontaktdaten zu Musikern (die fast 300 Seiten des Buchs ausmachen) oder Journalisten. Clubs, Festivals sind genauso verzeichnet wie Plattenlabels, Agenturen, Schulen oder Workshops. Neben Jazzclubs enthält das Buch dabei auch große Konzertsäle, die in der Vergangenheit regelmäßige Jazzkonzerte präsentierten. Ähnlich wie der “Wegweiser Jazz” verzeichnet auch “Jazz de France” die Größe der Veranstaltungsorte, Ansprechpartner, technische Ausstattung, stilistische Ausrichtung und was immer sonst an Information für die Jazzszene wichtig sein könnte. Mehr als 6.000 Einträge, mehr als 15.000 Kontakte, Adressen von 60 Verbänden, 200 Agenten und Produzenten, 30 Wettbewerben, 540 (!) Festivals, 420 Clubs und 380 größeren Sälen. Dazu die Kontaktdaten für 110 Journalisten, 150 Plattenlabels, 200 Schulen mit Jazzangebot … und vieles mehr. Unverzichtbar für jeden, der mit der französischen Jazzszene arbeitet, und ein wünschenswertes Beispiel für ganz Europa. “Jazz de France” hat übrigens auch uns zu vielen Neuerungen angeregt, die wir in die letzte Ausgabe unseres “Wegweisers Jazz” aufgenommen haben.
Wir werden immer wieder gefragt, ob es so etwas wie den von uns alle zwei Jahre vorgelegten “Wegweiser Jazz” auch für andere Länder gibt, und für die meisten Länder müssen wir verneinen. Die eine Ausnahme ist Frankreich, das mit blendendem Beispiel vorangeht mit dem Verzeichnis “Jazz de France”, herausgegeben vom Informationszentrum für zeitgenössische Musik “irma” und betreut von Pascal Anquetil. Das Buch ist ein überaus übersichtliches Verzeichnis der französischen Jazzszene und enthält auf 600 Seiten noch erheblich mehr als wir in die Printausgabe unseres Wegweisers stecken, beispielsweise die Kontaktdaten zu Musikern (die fast 300 Seiten des Buchs ausmachen) oder Journalisten. Clubs, Festivals sind genauso verzeichnet wie Plattenlabels, Agenturen, Schulen oder Workshops. Neben Jazzclubs enthält das Buch dabei auch große Konzertsäle, die in der Vergangenheit regelmäßige Jazzkonzerte präsentierten. Ähnlich wie der “Wegweiser Jazz” verzeichnet auch “Jazz de France” die Größe der Veranstaltungsorte, Ansprechpartner, technische Ausstattung, stilistische Ausrichtung und was immer sonst an Information für die Jazzszene wichtig sein könnte. Mehr als 6.000 Einträge, mehr als 15.000 Kontakte, Adressen von 60 Verbänden, 200 Agenten und Produzenten, 30 Wettbewerben, 540 (!) Festivals, 420 Clubs und 380 größeren Sälen. Dazu die Kontaktdaten für 110 Journalisten, 150 Plattenlabels, 200 Schulen mit Jazzangebot … und vieles mehr. Unverzichtbar für jeden, der mit der französischen Jazzszene arbeitet, und ein wünschenswertes Beispiel für ganz Europa. “Jazz de France” hat übrigens auch uns zu vielen Neuerungen angeregt, die wir in die letzte Ausgabe unseres “Wegweisers Jazz” aufgenommen haben.
Zu beziehen ist “Jazz de France” direkt bei irma über <http://www.irma.asso.fr/Jazz-de-France>
(Wolfram Knauer, Juli 2010)
Queere Tracks. Subversive Strategien in der Rock- und Popmusik
Von Doris Leibetseder
Bielefeld 2010 (transcript)
336 Seiten, 29,80 Euro
ISBN: 978-3-8376-1193-9
 Die queere Kulturforschung, soviel sei Uneingeweihten kurz verraten, untersucht Kulturentwicklungen auf ihre ganz unterschiedlichen Wechselwirkung mit schwul-lesbischen oder sonstigen nicht-heterosexuellen Lebens-, Denkens- und Fühlensweisen. Das können Verweise auf von heterosexueller Orientierung abweichende Lebensweisen sein, die in Texten vorkommen, die biographische Erfahrung von Musikern genauso wie ihrem Publikum, das Feststellen von Unterdrückungs- oder Sublimierungsstrukturen, also sowohl von deutlicher Ablehnung wie auch vom einfachen Ignorieren des Einflusses nicht-heterosexueller Erfahrungen auf die Musik. Studien zur Queer Theory gibt es mittlerweile zuhauf, und auch für die Musik ist dies ein spannendes Forschungsfeld. Im Bereich des Jazz (wie allgemein der afro-amerikanischen Musik) finden sich aus unterschiedlichen Gründen etliche Verdrängungsbeispiele, die entweder die Existenz schwuler, lesbischer oder gar transsexueller Aktivität in dieser Musik leugnen oder aber die Bedeutung offen gelebter queerer Sexualität für die Entwicklung der Musik abstreiten. John Gill legte 1995 sein Buch Queer Noises vor, und Sherrie Tucker beschäftigt sich seit längerem damit, inwieweit queere Theorie nicht auch die Jazzforschung in Frage stellt.
Die queere Kulturforschung, soviel sei Uneingeweihten kurz verraten, untersucht Kulturentwicklungen auf ihre ganz unterschiedlichen Wechselwirkung mit schwul-lesbischen oder sonstigen nicht-heterosexuellen Lebens-, Denkens- und Fühlensweisen. Das können Verweise auf von heterosexueller Orientierung abweichende Lebensweisen sein, die in Texten vorkommen, die biographische Erfahrung von Musikern genauso wie ihrem Publikum, das Feststellen von Unterdrückungs- oder Sublimierungsstrukturen, also sowohl von deutlicher Ablehnung wie auch vom einfachen Ignorieren des Einflusses nicht-heterosexueller Erfahrungen auf die Musik. Studien zur Queer Theory gibt es mittlerweile zuhauf, und auch für die Musik ist dies ein spannendes Forschungsfeld. Im Bereich des Jazz (wie allgemein der afro-amerikanischen Musik) finden sich aus unterschiedlichen Gründen etliche Verdrängungsbeispiele, die entweder die Existenz schwuler, lesbischer oder gar transsexueller Aktivität in dieser Musik leugnen oder aber die Bedeutung offen gelebter queerer Sexualität für die Entwicklung der Musik abstreiten. John Gill legte 1995 sein Buch Queer Noises vor, und Sherrie Tucker beschäftigt sich seit längerem damit, inwieweit queere Theorie nicht auch die Jazzforschung in Frage stellt.
Doris Leibetseder beschäftigt sich in ihrer Studie kaum mit dem Jazz, sondern vor allem mit Rock- und Popmusik, die auf den ersten Blick vielleicht auch ein dankbareres Feld für das Thema zu sein scheint. Sie beginnt mit einem historischen Kapitel, in dem sie auf female impersonators verweist, die in Vaudeville Shows des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts aufzutreten pflegten. Sie diskutiert die Bedeutung, die das Zurschaustellen von Sexualität etwa durch Josephine Baker erhielt und wie darin zugleich rassistische Klischees festgeschrieben wurden. Sie verweist auf relativ offen lebende lesbische Künstler wie Ma Rainey, auf deutlich mit queeren Klischees spielende Tanzfiguren des Rock ‘n’ Roll, auf den Glamrock, Little Richard, David Bowie, Andy Warhol und späte Auswirkungen des Glamrock bei Boy George, Annie Lennox oder Grace Jones. Selbst (oder insbesondere) offen queere Beispiele der Rock- und Popmusik, erklärt Leibetseder, spielen oft und gern mit Parodie, Täuschung, sarkastischen Gesten, Ironie, Camp, Maske und nutzen dabei sowohl queere Vorlieben wie auch jahrhundertelange Schutzmechanismen. Leibetseders Grundtheorie ist, dass es kein Geschlechteroriginal gäbe, kein richtiges oder falsches Geschlecht, so dass das Spiel mit sexuellen Rollen oder Identitäten auf der Bühne letztlich auf Bedingtheiten im realen Leben verweisen bzw. diese kommentieren.
In einem ersten Kapitel analysiert Leibetsreder die “Ironie” als Strategie, etwa im feministischen Diskurs, bei Madonna oder im Wirken der Riot Grrrls. Dabei spielt neben der Musik auch die Selbstdarstellung im Video oder der Kleidung eine Rolle. Im zweiten Kapitel beleuchtet sie das Mittel der Parodie, grenzt diese etwa von Satire, Burlesque, Persiflage, Pastiche ab, beschreibt das Subversive der Parodie und nennt als ein klassisches Beispiele aus dem Bereich der Pop- und Rockmusik Jimi Hendrix’ berühmte Interpretation der amerikanischen Nationalhymne. Für ihr Thema besonders interessant sind Geschlechterparodien, Travestie, Drag und die damit verbundene Camp-Kultur. Sie zitiert aus Anleitungen zu einem Drag-King-Workshop und bringt als musikalisches Beispiel schließlich Peaches ins Spiel, die Sängerin, die immer wieder männliche Musiker imitierte.
Leibetseder beschäftigt sich in ihrem dritten Kapitel mit “Camp”, dessen Definition und Wortherleitung allein einige Seiten in Anspruch nehmen. Sieht man Camp als sprachliche, gestische, kommunikative Methode einer Aufweichung von Geschlechterrollen und dabei eines ironischen Infragestellens einer jeden sexuellen Sicherheit, einschließlich der eigenen, so ist es eine bewusst ein-, nicht ausschließende Strategie. Camp habe einen riesigen Einfluss auf die Pop-Ästhetik gehabt, betont Leibetseder und stellt nebenbei auch einen subversiven Camp fest, der politischer ist, Stellung bezieht. Ihre Musikbeispiele sind Madonnas Spiel mit Sex- und Geschlechterrollen sowie die Androgynität bei Annie Lennox oder Grace Jones. Geschlechterrollen als Masken analysiert Leibetseder in ihrem vierten Kapitel, fragt nach Fetischisierung, dem Verständnis von Weiblichkeit oder Männlichkeit als Maskerade und geht auf Stücke von Annie Lenox und Peaches ein. Ein weiteres Kapitel ist überschrieben “Mimesis / Mimikry”, behandelt die Gründzüge beider bei Platon und Aristoteles, das Thema Mimesis und Macht sowie die feministische Mimesis, etwa im Werk Irigarays. Ihre Musikbeispiele sind diesmal Grace Jones und Bishi sowie die Band Lesbianson Ecstacy.
Ein eigenes Kapitel ist dem “Cyborg” gewidmet. Cyborg ist ein Kunstwort, gebildet aus cybernetic und organism und wurde von der Popmusik als Strategie genutzt, sexuelle Identität durch die Verbindung mit Maschinen zugleich zu ver- wie zu entkörperlichen. Als Beispiel dient Björks Musikvideo “All is Full of Love”, in dem Björks Gesicht mit einer Roboterfigur vermengt wird. Das Kapitel “Transsexualität” beginnt mit einer Erklärung, warum ein Begriff wie “Technologie” für das Verstehen von Sexualität so wichtig sein kann, bringt eine kurze Geschichte der Transsexualität von Chevalier d’Eon de Beaumont bis in die Jetztzeit. Leibetseder diskutiert die Identitätsprobleme, die sich aus Transsexualität sowohl für die Betroffenen wie für ihre Umwelt geben können (weil Transsexualität nun mal nicht nur in Frage stellt, nicht imitiert, parodiert, sondern aktiv verändert), sie weist auf Vorurteile innerhalb der lesbisch-schwulen Welt gegenüber Transsexuellen hin, und sie nennt als Beispiel aus der Musikwelt (mit vergleichendem Verweis auf Billy Tipton, den Jazzpianisten, bei dem man nach seinem Tod herausfand, dass er tatsächlich eine Frau war) den HipHop-Künstler und “Transmann” Katastrophe. Das letzte Kapitel des Buchs schließlich ist überschrieben mit “Dildo – ‘Gender Bender'” und beschäftigt sich mit sexuellen Praktiken, mit Dildos, Vibratoren und die subversive Benutzung des Motivs Dildo, etwa in Aufnahmen der Band Tribe 8 oder der Sängerin Peaches.
Eine lesenswerte Zusammenfassung der Kapitel (ohne die historischen und ästhetischen Diskurse, aber einschließlich knapper Hinweise auf die Musikbeispiele) beschließt das Buch, das sicher kaum Jazzgehalt hat, als Referenz für eine queere Theorie auch in anderen Genres aber durchaus taugt.
Wolfram Knauer (Juli 2010)
Sonny Rollins. Improvisation und Protest. Interviews
von Christian Broecking
Berlin 2010 (Christian Broecking Verlag)
136 Seiten, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-938763-29-2
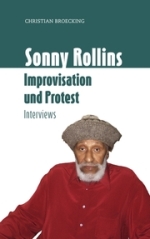 Christian Broecking versammelt in seinem Buch über Sonny Rollins fünf Interviews, die er zwischen 1996 und 2010 mit dem Tenorsaxophonisten geführt hat und schaltet dazwischen Gespräche mit Weggefährten wie Jim Hall, Max Roach oder Roy Haynes sowie mit Zeitzeugen wie David S. Ware, Gary Giddins, Roy Hargrove und Abbey Lincoln. Im Vorwort zum Gespräch von 1996 erzählt Broecking, dass Rollins sich seine Interviews sorgfältig aussuche, sich dann aber Zeit nehme. Der Saxophonist erzählt, wie wichtig es ihm sei, auf die Jazztradition Bezug zu nehmen, berichtet über das Community-Gefühl im Harlem der 1950er und 1960er Jahre, sowie darüber, wie man ihn kritisiert habe, als er 1960 den weißen Gitarristen Jim Hall in seine Band geholt habe. 1998 erzählt er über die “Freedom Suite” und die politische Aufgabe des Jazz, äußert sich vorsichtig über Wynton Marsalis und Jazz at Lincoln Center und berichtet über die Bedeutung von Spiritualität für sein Leben. Im Jahr 2000 verrät Rollins, warum er sich Anfang der 1960er Jahre einen Irokesen-Haarschnitt zugelegt habe und wie wichtig Image und Bühnenpräsenz für einen Jazzmusiker seien. Das wichtigste Element im Jazz, sagt er, sei “die spontane Kreation von Klängen” und verrät dann drei seiner Lieblingssongs: Lester Youngs “Afternoon of a Basie-ite”, Coleman Hawkins’ “The Man I Love” sowie Billie Holidays “Lover Man”. 2006 erzählt er mehr über die legendäre Aufnahmesession, bei der er 1963 mit Coleman Hawkins spielte, über Free Jazz und seinen Schüler, den Saxophonisten David S. Ware, über die Anschläge vom 11. September 2001 und welche Auswirkungen sie gehabt hätten, sowie über sein Leben auf dem Lande. Er berichtet davon, wie er einmal mit Jean-Paul Sartre zusammengetroffen sei und kommentiert die kritischen Positionen von Amiri Baraka und Stanley Crouch zu Entwicklungen im Jazz: diese mögen ja ganz interessant sein, “aber sie bewegen den Berg nicht”. 2010 schließlich äußert er sich verhalten optimistisch über die Wahl Barack Obamas zum amerikanischen Präsidenten sowie über das harte Leben eines Jazzmusikers im Allgemeinen. Mit Jim Hall unterhält sich Broecking über die Platte “The Bridge”, die der Gitarrist 1960 mit Rollins einspielte sowie über Rassismus und Gegenrassismus. Max Roach äußert sich ganz konkret zu Rassismuserfahrungen und betont wie wichtig es sei, sich der politischen Bedeutung von Musik bewusst zu bleiben. Abbey Lincoln erzählt, welche Rolle Roach für ihre Karriere gespielt habe und wie schwierig die politischen Texte, die sie immer wieder gesungen hatte, sich für ihre Karriere erwiesen hätten. Roy Haynes erzählt, wie er sich nur nach und nach bewusst wurde, dass er ja selbst Teil der großen Jazzgeschichte ist. David S. Ware klagt über die Benachteiligung durch Clubbesitzer. Gary Giddins erzählt, wie er auf die Spur des korrekten Geburtsdatums von Louis Armstrong gekommen sei und diskutiert, warum es immer noch so wenig schwarze Jazzkritiker in den USA gäbe. Roy Hargrove schließlich berichtet über all die Einflüsse auf ihn, über Wynton Marsalis sowie über Präsident George W. Bush. Sie alle legen Zeugnis dafür ab, dass der Jazz weder im luft- noch im gesellschaftsleeren Raum geschieht, sondern eine politische Äußerung eben gerade deshalb ist, weil er aus der Gegenwart heraus entsteht, weil er über die Gegenwart reflektiert und weil er zur Kommunikation über die Gegenwart animiert.
Christian Broecking versammelt in seinem Buch über Sonny Rollins fünf Interviews, die er zwischen 1996 und 2010 mit dem Tenorsaxophonisten geführt hat und schaltet dazwischen Gespräche mit Weggefährten wie Jim Hall, Max Roach oder Roy Haynes sowie mit Zeitzeugen wie David S. Ware, Gary Giddins, Roy Hargrove und Abbey Lincoln. Im Vorwort zum Gespräch von 1996 erzählt Broecking, dass Rollins sich seine Interviews sorgfältig aussuche, sich dann aber Zeit nehme. Der Saxophonist erzählt, wie wichtig es ihm sei, auf die Jazztradition Bezug zu nehmen, berichtet über das Community-Gefühl im Harlem der 1950er und 1960er Jahre, sowie darüber, wie man ihn kritisiert habe, als er 1960 den weißen Gitarristen Jim Hall in seine Band geholt habe. 1998 erzählt er über die “Freedom Suite” und die politische Aufgabe des Jazz, äußert sich vorsichtig über Wynton Marsalis und Jazz at Lincoln Center und berichtet über die Bedeutung von Spiritualität für sein Leben. Im Jahr 2000 verrät Rollins, warum er sich Anfang der 1960er Jahre einen Irokesen-Haarschnitt zugelegt habe und wie wichtig Image und Bühnenpräsenz für einen Jazzmusiker seien. Das wichtigste Element im Jazz, sagt er, sei “die spontane Kreation von Klängen” und verrät dann drei seiner Lieblingssongs: Lester Youngs “Afternoon of a Basie-ite”, Coleman Hawkins’ “The Man I Love” sowie Billie Holidays “Lover Man”. 2006 erzählt er mehr über die legendäre Aufnahmesession, bei der er 1963 mit Coleman Hawkins spielte, über Free Jazz und seinen Schüler, den Saxophonisten David S. Ware, über die Anschläge vom 11. September 2001 und welche Auswirkungen sie gehabt hätten, sowie über sein Leben auf dem Lande. Er berichtet davon, wie er einmal mit Jean-Paul Sartre zusammengetroffen sei und kommentiert die kritischen Positionen von Amiri Baraka und Stanley Crouch zu Entwicklungen im Jazz: diese mögen ja ganz interessant sein, “aber sie bewegen den Berg nicht”. 2010 schließlich äußert er sich verhalten optimistisch über die Wahl Barack Obamas zum amerikanischen Präsidenten sowie über das harte Leben eines Jazzmusikers im Allgemeinen. Mit Jim Hall unterhält sich Broecking über die Platte “The Bridge”, die der Gitarrist 1960 mit Rollins einspielte sowie über Rassismus und Gegenrassismus. Max Roach äußert sich ganz konkret zu Rassismuserfahrungen und betont wie wichtig es sei, sich der politischen Bedeutung von Musik bewusst zu bleiben. Abbey Lincoln erzählt, welche Rolle Roach für ihre Karriere gespielt habe und wie schwierig die politischen Texte, die sie immer wieder gesungen hatte, sich für ihre Karriere erwiesen hätten. Roy Haynes erzählt, wie er sich nur nach und nach bewusst wurde, dass er ja selbst Teil der großen Jazzgeschichte ist. David S. Ware klagt über die Benachteiligung durch Clubbesitzer. Gary Giddins erzählt, wie er auf die Spur des korrekten Geburtsdatums von Louis Armstrong gekommen sei und diskutiert, warum es immer noch so wenig schwarze Jazzkritiker in den USA gäbe. Roy Hargrove schließlich berichtet über all die Einflüsse auf ihn, über Wynton Marsalis sowie über Präsident George W. Bush. Sie alle legen Zeugnis dafür ab, dass der Jazz weder im luft- noch im gesellschaftsleeren Raum geschieht, sondern eine politische Äußerung eben gerade deshalb ist, weil er aus der Gegenwart heraus entsteht, weil er über die Gegenwart reflektiert und weil er zur Kommunikation über die Gegenwart animiert.
Wolfram Knauer (Juli 2010)
Herbie Hancock. Interviews
Von Christian Broecking
Berlin 2010 (Christian Broecking Verlag)
77 Seiten, 16,90 Euro
ISBN: 978-3-938763-12-4
 Christian Broecking ist sicher einer der fleißigsten deutschen Interviewer über den amerikanischen Jazz; er berichtet seit vielen Jahren über die Diskussionen innerhalb der afro-amerikanischen Jazzszene. Rechtzeitig zu Herbie Hancocks 70. Geburtstag brachte er kürzlich in seinem noch jungen, aber bereits überaus regen eigenen Verlag ein Büchlein mit Interviews heraus, die er über die Jahre mit dem Pianisten und zwei seiner engen Mitstreiter geführt hat. 1994 sprach Broecking mit Hancock über “Dis Is Da Drum”, eine Produktion, mit der dieser an seinen “Rockit!”-Hit aus den 1980er Jahren anschließen wollte. 1994 war die Marsalis/Crouch-Debatte darüber in vollem Gang, was denn noch als Jazz durchgehe und was bestimmt nicht, und Hancock nimmt kein Blatt vor den Mund: Marsalis sei bestimmt ein wunderbarer Musiker, ansonsten eher ein Historiker, und Engstirnigkeit und Begrenztheit sei seine, Hancocks Sache noch nie gewesen. Er verstehe den Kreuzzug gegen Miles Davis’ Fusion-Projekte nicht ganz und sehe auch seine eigenen Crossover-Versuche durchaus in der Tradition afro-amerikanischer Musik. Im April 2000 sprach Broecking mit Hancock anlässlich seines 60sten Geburtstags und seiner George-Gershwin-Tribut-Tournee. “Gershwin’s World” sei seine bislang ambitionierteste Platte, wirbt Hancock und habe dabei insbesondere großen Spaß an der Zusammenarbeit mit Künstlern gehabt, die nicht aus dem Jazzlager kommen, Joni Mitchell etwa, Stevie Wonder oder Kathleen Battle. Früher habe er sich vor allem als Musiker gesehen, heute sehe er sich als Menschen, der Musik macht. Er spricht über die Möglichkeiten des (damals noch recht jungen) Internets und über eventuelle Projekte im Avantgardebereich. Ein Jahr später war die CD “Future 2 Future” Grund für ein kurzes Interview, in dem Hancock sich u.a. über die Möglichkeiten moderner Technologien auslässt. Bei einem weiteren kurzen Gespräch kommentiert er 2005 die Auswirkungen von Hurrikane Katrina. 2007 schließlich traf Broecking Hancock bei der CD-Veröffentlichung von “The Joni Letters”, und sprach mit ihm über seinen Weg zum Jazz, über Visionen, Freiheit, den afro-amerikanischen Einfluss auf seine Musik, über Buddhismus, und noch einmal über die verengte Sicht von Wynton Marsalis und seiner Clique. Zwischengeschaltet ist ein Interview mit Wayne Shorter über dessen Bandkonzept, über Inspirationsquellen für seine Musik, über das Alter, Buddhismus und darüber, wie Miles Davis in seiner elektrischen Phase das Gefühl der schwarzen Kirche mit Strawinsky verbinden wollte. Ron Carter wiederum äußert sich über seine eigene Entwicklung seit den Tagen, als er im Miles Davis Quintett spielte, über Fusion, politische Meinungsäußerungen von Musikern, sowie darüber, was einen guten Produzenten und was einen guten Bandleader ausmacht. Alles in allem: ein kurzweiliges Buch, das keine Lebensgeschichte bietet, dafür Einsichten in Herbie Hancocks Gedankenwelt und die zweier enger Mitstreiter.
Christian Broecking ist sicher einer der fleißigsten deutschen Interviewer über den amerikanischen Jazz; er berichtet seit vielen Jahren über die Diskussionen innerhalb der afro-amerikanischen Jazzszene. Rechtzeitig zu Herbie Hancocks 70. Geburtstag brachte er kürzlich in seinem noch jungen, aber bereits überaus regen eigenen Verlag ein Büchlein mit Interviews heraus, die er über die Jahre mit dem Pianisten und zwei seiner engen Mitstreiter geführt hat. 1994 sprach Broecking mit Hancock über “Dis Is Da Drum”, eine Produktion, mit der dieser an seinen “Rockit!”-Hit aus den 1980er Jahren anschließen wollte. 1994 war die Marsalis/Crouch-Debatte darüber in vollem Gang, was denn noch als Jazz durchgehe und was bestimmt nicht, und Hancock nimmt kein Blatt vor den Mund: Marsalis sei bestimmt ein wunderbarer Musiker, ansonsten eher ein Historiker, und Engstirnigkeit und Begrenztheit sei seine, Hancocks Sache noch nie gewesen. Er verstehe den Kreuzzug gegen Miles Davis’ Fusion-Projekte nicht ganz und sehe auch seine eigenen Crossover-Versuche durchaus in der Tradition afro-amerikanischer Musik. Im April 2000 sprach Broecking mit Hancock anlässlich seines 60sten Geburtstags und seiner George-Gershwin-Tribut-Tournee. “Gershwin’s World” sei seine bislang ambitionierteste Platte, wirbt Hancock und habe dabei insbesondere großen Spaß an der Zusammenarbeit mit Künstlern gehabt, die nicht aus dem Jazzlager kommen, Joni Mitchell etwa, Stevie Wonder oder Kathleen Battle. Früher habe er sich vor allem als Musiker gesehen, heute sehe er sich als Menschen, der Musik macht. Er spricht über die Möglichkeiten des (damals noch recht jungen) Internets und über eventuelle Projekte im Avantgardebereich. Ein Jahr später war die CD “Future 2 Future” Grund für ein kurzes Interview, in dem Hancock sich u.a. über die Möglichkeiten moderner Technologien auslässt. Bei einem weiteren kurzen Gespräch kommentiert er 2005 die Auswirkungen von Hurrikane Katrina. 2007 schließlich traf Broecking Hancock bei der CD-Veröffentlichung von “The Joni Letters”, und sprach mit ihm über seinen Weg zum Jazz, über Visionen, Freiheit, den afro-amerikanischen Einfluss auf seine Musik, über Buddhismus, und noch einmal über die verengte Sicht von Wynton Marsalis und seiner Clique. Zwischengeschaltet ist ein Interview mit Wayne Shorter über dessen Bandkonzept, über Inspirationsquellen für seine Musik, über das Alter, Buddhismus und darüber, wie Miles Davis in seiner elektrischen Phase das Gefühl der schwarzen Kirche mit Strawinsky verbinden wollte. Ron Carter wiederum äußert sich über seine eigene Entwicklung seit den Tagen, als er im Miles Davis Quintett spielte, über Fusion, politische Meinungsäußerungen von Musikern, sowie darüber, was einen guten Produzenten und was einen guten Bandleader ausmacht. Alles in allem: ein kurzweiliges Buch, das keine Lebensgeschichte bietet, dafür Einsichten in Herbie Hancocks Gedankenwelt und die zweier enger Mitstreiter.
(Wolfram Knauer, Juli 2010)
Where the Dark and the Light Folks Meet
Race and the Mythology, Politics, and Business of Jazz
von Randall Sandke
Lanham/MD 2010 (Scarecrow Press)
275 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-6652-2
 Randy Sandke ist vor allem als swing-betonter Trompeter bekannt, der in den 1990er Jahren außerdem oft als Gastdirigent und Arrangeur fürs Carnegie Hall Jazz Orchestra einsprang. In der Buchreihe des Institute of Jazz Studies an der Rutgers University legt er mit “Where the Dark and the Light Folks Meet” eine Sammlung an interessanten und nachdenkenswerten Essays über eine alternative Sichtweise der Jazzgeschichte vor. Nicht jeder werde seinen Argumenten zustimmen, schreibt Dan Morgenstern, Direktor des Institute of Jazz Studies, im Klappentext, aber man müsse nach der Lektüre dieses Buches einfach viele Details der Jazzgeschichte neu überdenken. Worum geht es im Jazz eigentlich, fragt Sandke im Eingangskapitel und stellt fest, dass es neben der reinen Musik jede Menge an Subtexten gäbe, die da existierten und denen er sich in seinem Buch widmen wolle: Jazz als Musik der Unterdrückung und des Rassismus, Jazz als politische Waffe, und als Antwort auf die Unterdrückung … sind nur zwei dieser Subtexte, die er dabei andeutet. Er befasst sich beispielsweise mit der Jazzkritik, also der Jazzgeschichtsschreibung, fragt, ob es wahr sei, dass diese über lange Zeit weiße Musiker bevorzugt behandelt habe, und überprüft dann Bücher und Essays von namhaften Kritikern wie Marshall Stearns, John Hammond, Leonard Feather, Rudy Blesh, Nat Hentoff, Martin Williams sowie LeRoi Jones, Albert Murray und Stanley Crouch auf die mögliche Zielrichtung ihrer Ausführungen. “Good Intentions and Bad History” nimmt sich dann einige Klischees der Jazzgeschichtsschreibung vor und rückt die Tatsachen ein wenig zurück. Randke hinterfragt hier etwa die afrikanische Genese des Jazz, den Mythos des Congo Square als “missing link” zurück nach Afrika, die Auswirkungen der rassistischen Jim-Crow-Gesetze auf den Jazz, die Legenden um Buddy Bolden oder um die Geburt des Bebop, aber auch die Quellen der “Avantgarde” auf ihren tatsächliche Rückhalt in der Realität – und macht dabei klar, dass wohl nicht alles so einfach und eindimensional war, wie die Jazzgeschichtsschreibung es uns gern glauben machen will. “What Gets Left Out” lautet die Überschrift über einem weiteren Kapitel, in dem Sandke über Aspekte der Jazzgeschichte schreibt, die er in den allgemeinen Narrativen der Jazzbücher vermisst: die Minstrelsy, die nicht nur, wie sie oft abgetan wird, ein rassistisches Spektakel war, sondern durchaus auch andere Deutungsmöglichkeiten besaß; die Geschichte weißer Musiker in New Orleans, die recht früh damit begonnen hätten Jazz zu spielen und aus ähnlichen Gründen wie ihre schwarzen oder “creole” Mitbürger: weil es nämlich Bedarf nach dieser Musik gab; der Einfluss klassischer Techniken und klassischer Musik auf Musiker von Scott Joplin über Fats Waller, Jelly Roll Morton, Art Tatum, Thelonous Monk bis zu McCoy Tyner, Eric Dolphy, Charles Mingus und weit darüber hinaus. Er stellt die Frage nach Hautfarben-Identität (race identity), die im politischen Bewusstsein mancher Jazzmusiker und vieler die Jazzmusik begleitenden politischer Wortführer immer wichtiger wurde; und er beleuchtet die Retro-Bewegung der 1980er Jahre um Wynton Marsalis. Ein eigenes Kapitel widmet Sandke dem Publikum und fragt, für wen denn wohl genau die Musiker über die Jahrzehnte gespielt hätten. Es habe da immer mal wieder den Mythos gegeben, Jazzmusiker hätten vor allem für ein weißes Publikum gespielt, also befasst sich Sandke mit den verschiedenen Schauplätzen in den Clubs und Spielorten der Jazzgeschichte – insbesondere der frühen Jahre und der Bebop-Phase. “It’s Strictly Business” ist das Kapitel überschrieben, in dem Sandke sich mit dem Geschäftlichen um den Jazz beschäftigt. Waren Plattenlabels und Plattenproduzenten wirklich so korrupte Geldgeier, wie ihnen nachgesagt wird? Verdienten die weißen Musiker in den Studios von New York, Chicago oder Hollywood wirklich mehr als ihre schwarzen Kollegen (nachdem diese sich den Zutritt zu solchen Ensembles erstritten – oder erarbeitet – hatten)? Waren Agenten wirklich immer die Parasiten, als die sie gern hingestellt werden, fragt er und beleuchtet Beispiele wie den “Erfinder” des Newport Jazz Festivals George Wein, die Melrose Brothers, Irving Mills, Joe Glaser, Norman Granz, Willard Alexander, Tommy Rockwell, Billy Shaw, eddy Blume, Jack Whittemore und andere. Er befasst sich mit dem leidigen Thema Copyright und stellt dabei einige legendäre Streitfälle um die Urheberschaft vor, um den “Original Dixieland One-Step” etwa, den “Tiger Rag”, “Shimmie Like My Sister Kate”, “Muskrat Ramble” und viele andere Titel der Jazzgeschichte, Fälle, die Musiker wie Louis Armstrong, Kid Ory, Jelly Roll Morton, Duke Ellington, Sonny Rollins, Charlie Parker, Miles Davis und viele andere betrafen. “Show Me the Money” schließlich” heißt es über einem Kapitel, das die Bezahlung von Jazzmusikern zum Thema hat. Von 2 Dollar pro Abend in New Orleans bis zu 100.000 Dollar pro Konzert für Oscar Peterson geht dieser interessante Vergleich des finanziellen Erfolgs der Jazzheroen. Die durchgängig immer wieder erörterte Frage ist, “Geht es bei alledem immer nur um die Hautfarbe?”, und Sandkes Antworten sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Oft hat er gar keine abschließende Antwort auf seine Fragen, will nur ein wenig am allgemeinen scheinbaren Wissen um die Fakten rütteln, um das Bewusstsein des Lesers zu wecken, dass es vielleicht auch ein wenig anders gewesen sein könnte, dass Einzelbeispiele nicht für das Ganze genommen werden dürfen, dass man immer auch die Perspektive desjenigen, der über etwas berichtet, mitlesen müsse. Das alles gelingt ihm in einem überaus spannenden Stil, der einen quasi zum Mitdiskutieren zwingt, zum Revidieren von Meinungen, zum offenen Nachdenken auch über Dinge, die in seinem Buch gar nicht vorkommen. Ein lesenswertes und nachdenkenswertes Buch also, wärmstens gerade denjenigen empfohlen, die meinen, eigentlich alles über die Jazzgeschichte zu wissen.
Randy Sandke ist vor allem als swing-betonter Trompeter bekannt, der in den 1990er Jahren außerdem oft als Gastdirigent und Arrangeur fürs Carnegie Hall Jazz Orchestra einsprang. In der Buchreihe des Institute of Jazz Studies an der Rutgers University legt er mit “Where the Dark and the Light Folks Meet” eine Sammlung an interessanten und nachdenkenswerten Essays über eine alternative Sichtweise der Jazzgeschichte vor. Nicht jeder werde seinen Argumenten zustimmen, schreibt Dan Morgenstern, Direktor des Institute of Jazz Studies, im Klappentext, aber man müsse nach der Lektüre dieses Buches einfach viele Details der Jazzgeschichte neu überdenken. Worum geht es im Jazz eigentlich, fragt Sandke im Eingangskapitel und stellt fest, dass es neben der reinen Musik jede Menge an Subtexten gäbe, die da existierten und denen er sich in seinem Buch widmen wolle: Jazz als Musik der Unterdrückung und des Rassismus, Jazz als politische Waffe, und als Antwort auf die Unterdrückung … sind nur zwei dieser Subtexte, die er dabei andeutet. Er befasst sich beispielsweise mit der Jazzkritik, also der Jazzgeschichtsschreibung, fragt, ob es wahr sei, dass diese über lange Zeit weiße Musiker bevorzugt behandelt habe, und überprüft dann Bücher und Essays von namhaften Kritikern wie Marshall Stearns, John Hammond, Leonard Feather, Rudy Blesh, Nat Hentoff, Martin Williams sowie LeRoi Jones, Albert Murray und Stanley Crouch auf die mögliche Zielrichtung ihrer Ausführungen. “Good Intentions and Bad History” nimmt sich dann einige Klischees der Jazzgeschichtsschreibung vor und rückt die Tatsachen ein wenig zurück. Randke hinterfragt hier etwa die afrikanische Genese des Jazz, den Mythos des Congo Square als “missing link” zurück nach Afrika, die Auswirkungen der rassistischen Jim-Crow-Gesetze auf den Jazz, die Legenden um Buddy Bolden oder um die Geburt des Bebop, aber auch die Quellen der “Avantgarde” auf ihren tatsächliche Rückhalt in der Realität – und macht dabei klar, dass wohl nicht alles so einfach und eindimensional war, wie die Jazzgeschichtsschreibung es uns gern glauben machen will. “What Gets Left Out” lautet die Überschrift über einem weiteren Kapitel, in dem Sandke über Aspekte der Jazzgeschichte schreibt, die er in den allgemeinen Narrativen der Jazzbücher vermisst: die Minstrelsy, die nicht nur, wie sie oft abgetan wird, ein rassistisches Spektakel war, sondern durchaus auch andere Deutungsmöglichkeiten besaß; die Geschichte weißer Musiker in New Orleans, die recht früh damit begonnen hätten Jazz zu spielen und aus ähnlichen Gründen wie ihre schwarzen oder “creole” Mitbürger: weil es nämlich Bedarf nach dieser Musik gab; der Einfluss klassischer Techniken und klassischer Musik auf Musiker von Scott Joplin über Fats Waller, Jelly Roll Morton, Art Tatum, Thelonous Monk bis zu McCoy Tyner, Eric Dolphy, Charles Mingus und weit darüber hinaus. Er stellt die Frage nach Hautfarben-Identität (race identity), die im politischen Bewusstsein mancher Jazzmusiker und vieler die Jazzmusik begleitenden politischer Wortführer immer wichtiger wurde; und er beleuchtet die Retro-Bewegung der 1980er Jahre um Wynton Marsalis. Ein eigenes Kapitel widmet Sandke dem Publikum und fragt, für wen denn wohl genau die Musiker über die Jahrzehnte gespielt hätten. Es habe da immer mal wieder den Mythos gegeben, Jazzmusiker hätten vor allem für ein weißes Publikum gespielt, also befasst sich Sandke mit den verschiedenen Schauplätzen in den Clubs und Spielorten der Jazzgeschichte – insbesondere der frühen Jahre und der Bebop-Phase. “It’s Strictly Business” ist das Kapitel überschrieben, in dem Sandke sich mit dem Geschäftlichen um den Jazz beschäftigt. Waren Plattenlabels und Plattenproduzenten wirklich so korrupte Geldgeier, wie ihnen nachgesagt wird? Verdienten die weißen Musiker in den Studios von New York, Chicago oder Hollywood wirklich mehr als ihre schwarzen Kollegen (nachdem diese sich den Zutritt zu solchen Ensembles erstritten – oder erarbeitet – hatten)? Waren Agenten wirklich immer die Parasiten, als die sie gern hingestellt werden, fragt er und beleuchtet Beispiele wie den “Erfinder” des Newport Jazz Festivals George Wein, die Melrose Brothers, Irving Mills, Joe Glaser, Norman Granz, Willard Alexander, Tommy Rockwell, Billy Shaw, eddy Blume, Jack Whittemore und andere. Er befasst sich mit dem leidigen Thema Copyright und stellt dabei einige legendäre Streitfälle um die Urheberschaft vor, um den “Original Dixieland One-Step” etwa, den “Tiger Rag”, “Shimmie Like My Sister Kate”, “Muskrat Ramble” und viele andere Titel der Jazzgeschichte, Fälle, die Musiker wie Louis Armstrong, Kid Ory, Jelly Roll Morton, Duke Ellington, Sonny Rollins, Charlie Parker, Miles Davis und viele andere betrafen. “Show Me the Money” schließlich” heißt es über einem Kapitel, das die Bezahlung von Jazzmusikern zum Thema hat. Von 2 Dollar pro Abend in New Orleans bis zu 100.000 Dollar pro Konzert für Oscar Peterson geht dieser interessante Vergleich des finanziellen Erfolgs der Jazzheroen. Die durchgängig immer wieder erörterte Frage ist, “Geht es bei alledem immer nur um die Hautfarbe?”, und Sandkes Antworten sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Oft hat er gar keine abschließende Antwort auf seine Fragen, will nur ein wenig am allgemeinen scheinbaren Wissen um die Fakten rütteln, um das Bewusstsein des Lesers zu wecken, dass es vielleicht auch ein wenig anders gewesen sein könnte, dass Einzelbeispiele nicht für das Ganze genommen werden dürfen, dass man immer auch die Perspektive desjenigen, der über etwas berichtet, mitlesen müsse. Das alles gelingt ihm in einem überaus spannenden Stil, der einen quasi zum Mitdiskutieren zwingt, zum Revidieren von Meinungen, zum offenen Nachdenken auch über Dinge, die in seinem Buch gar nicht vorkommen. Ein lesenswertes und nachdenkenswertes Buch also, wärmstens gerade denjenigen empfohlen, die meinen, eigentlich alles über die Jazzgeschichte zu wissen.
(Wolfram Knauer, Juni 2010)
We Want Miles
herausgegeben von Vincent Bessières
Montréal 2010 (Montréal Museum of Fine Arts)
223 Seiten, 39 Euro
ISBN: 978-2-80192-343-9
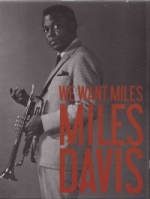 “We Want Miles” heißt die oppulente Ausstellung die Vincent Bessières für die Cité de la Musique in Paris zusammengestellt hat und die zurzeit (und noch bis August 2010) im Montréal Museum of Fine Arts zu sehen ist. Die Ausstellung in Paris umfasst zwei Stockwerke voll mit Material, das sich auf Miles bezieht: Klangkabinen, in denen man Musik aus den verschiedenen Schaffensperioden seines Lebens hören kann, seltene Filmausschnitte von Konzerten oder Interviews, in denen er über seine Musik spricht, seine Kleidung und Gemälde, vieler seiner Instrumente, originale Notenblätter etlicher Aufnahmesessions, einschließlich der legendären Capitol-Nonett-Aufnahmen von 1949, sowie handschriftliche Notizen über die Aufnahmesitzungen, die oft von seinem langjährigen Produzenten Teo Macero stammen. Dem Kurator der Ausstellung Vincent Bessières und seinen Mitarbeitern von der Cité de la Musique ist es gelungen, ein wenig vom Geist des Trompeters einzufangen, den Besucher langsam in Miles’ Welt eintauchen zu lassen. Sie zeichnen seine musikalische und persönliche Entwicklung über die Jahre in Saal nach Saal nach und geben selbst seinem Rückzug von Musik und Öffentlichkeit in den späten 1970er Jahren einen eigenen Raum: einen dunklen Durchgang mit wenigen Dokumenten an den schwarzen Wänden, die knappe Einblicke in seine Probleme der Zeit geben. Am Anfang der Ausstellung mag man noch meinen, dieses Foto sei einem doch eh bekannt, diese Platten ebenfalls oder jener Zeitungsartikel. Mehr und mehr aber wird man in den Sog der Ausstellung gezogen und erlebt bestimmte Phasen in Miles’ Entwicklung anders als man sie zuvor erlebt hat, einfach durch die Art und Weise, wie die Ausstellungsstücke einander gegenübergestellt sind, wie die Musik aus den Klangkabinen, die Videos und all die anderen Dokumente einander ergänzen und einen die Musik und das Leben von Miles Davis neu entdecken, neu sehen, neu hören lassen. Der Ausstellungskatalog zeigt viele der in der Cité de la Musique zu sehenden Exponate und enthält daneben einen ausführlichen Text von Franck Bergerot sowie kürzere Texte von George Avakian, Laurent Cugny, Ira Gitler, David Liebman, Francis Marmande, John Szwed und Mike Zwerin. Nun ist der ursprünglich nur auf Französisch erhältliche Katalog auch in englischer Übersetzung erschienen: eine wunderbare Sammlung an Dokumenten, Fotos und Erinnerungen.
“We Want Miles” heißt die oppulente Ausstellung die Vincent Bessières für die Cité de la Musique in Paris zusammengestellt hat und die zurzeit (und noch bis August 2010) im Montréal Museum of Fine Arts zu sehen ist. Die Ausstellung in Paris umfasst zwei Stockwerke voll mit Material, das sich auf Miles bezieht: Klangkabinen, in denen man Musik aus den verschiedenen Schaffensperioden seines Lebens hören kann, seltene Filmausschnitte von Konzerten oder Interviews, in denen er über seine Musik spricht, seine Kleidung und Gemälde, vieler seiner Instrumente, originale Notenblätter etlicher Aufnahmesessions, einschließlich der legendären Capitol-Nonett-Aufnahmen von 1949, sowie handschriftliche Notizen über die Aufnahmesitzungen, die oft von seinem langjährigen Produzenten Teo Macero stammen. Dem Kurator der Ausstellung Vincent Bessières und seinen Mitarbeitern von der Cité de la Musique ist es gelungen, ein wenig vom Geist des Trompeters einzufangen, den Besucher langsam in Miles’ Welt eintauchen zu lassen. Sie zeichnen seine musikalische und persönliche Entwicklung über die Jahre in Saal nach Saal nach und geben selbst seinem Rückzug von Musik und Öffentlichkeit in den späten 1970er Jahren einen eigenen Raum: einen dunklen Durchgang mit wenigen Dokumenten an den schwarzen Wänden, die knappe Einblicke in seine Probleme der Zeit geben. Am Anfang der Ausstellung mag man noch meinen, dieses Foto sei einem doch eh bekannt, diese Platten ebenfalls oder jener Zeitungsartikel. Mehr und mehr aber wird man in den Sog der Ausstellung gezogen und erlebt bestimmte Phasen in Miles’ Entwicklung anders als man sie zuvor erlebt hat, einfach durch die Art und Weise, wie die Ausstellungsstücke einander gegenübergestellt sind, wie die Musik aus den Klangkabinen, die Videos und all die anderen Dokumente einander ergänzen und einen die Musik und das Leben von Miles Davis neu entdecken, neu sehen, neu hören lassen. Der Ausstellungskatalog zeigt viele der in der Cité de la Musique zu sehenden Exponate und enthält daneben einen ausführlichen Text von Franck Bergerot sowie kürzere Texte von George Avakian, Laurent Cugny, Ira Gitler, David Liebman, Francis Marmande, John Szwed und Mike Zwerin. Nun ist der ursprünglich nur auf Französisch erhältliche Katalog auch in englischer Übersetzung erschienen: eine wunderbare Sammlung an Dokumenten, Fotos und Erinnerungen.
(Wolfram Knauer)
silent solos. improvisers speak
herausgegeben von Renata Da Rin
Köln 2010 (buddy’s knife)
176 Seiten, 22,00 Euro
ISBN: 978-3-00-030557-3
 Die Bücher aus dem Kölner Verlag Buddy’s Knife haben in nur wenigen Ausgaben bereits ein ganz eigenes Profil: schwarz eingebunden mit einem matt-bunten Foto- oder Grafik-Querstreifen in der Mitte des Covers, feines Papier, eine schöne Type, die Schrift in tiefdunklem Grau; und auch inhaltlich: meist Literarisches und Poetisches aus der Feder von Musikern der amerikanischen Avantgardeszene. Das neueste Buch ist da nicht anders: 50 Musiker vor allem der New Yorker Downtown-Szene haben Gedichte beigetragen, die mit Musik zu tun haben oder auch nicht, die abstrakt sind oder reflexiv oder sehr realitätsbezogen. Wahrscheinlich stimmt, was George Lewis in seinem Vorwort sagt, dass man zuerst geneigt sein mag, Ähnlichkeiten zwischen den Texten und der Musik ihrer Autoren zu suchen. Lewis auch stellt die provokante These auf, dass Worte schneller reisten als Musik. Auf jeden Fall käme in der Poesie eine weitere Spielebene hinzu, die der Bedeutungen nämlich, die sich aufeinander und auf die Worte zuvor und danach beziehen, eine Ebene, die sich laufend verändert und die den Leser involviert. Nun, in den Gedichten, die sich in diesem Band befinden, lassen sich allerhand Dinge entdecken, die über das poetische Genießen hinaus Bedeutung besitzen. Wirklich wahllos herausgepickt: Lee Konitzs “no easy way” über die Schwierigkeiten des Zusammenspielens; Gunther Hampels “improvisation – the celebration of the moment” über genau das, was also geschieht, wenn man improvisiert; Katie Bulls “improvisation is the jazz-mandala-voyage” ebenfalls über den Improvisationsprozess; Jayne Cortezs “what’s your take” über die ökonomische Globalisierung und die Notwendigkeit, in diesem Prozess Stellung zu beziehen; Roy Nathansons “charles’ song” über und für Charles Gayle; David Liebmans “what jazz means to me” über seine ganz persönliche Beziehung zu dieser Musik; Assif Tsahars “untitled” über die Stille der Natur; Joseph Jarmans “a vision against violence”; Charles Gayles “untitled”, ein großer Dank ans Publikum … und so viele andere Gedichte, die Geschichten erzählen oder Stimmungen schaffen, die auf reale Erlebnisse rekurrieren oder in sich (den Autor) hineinhorchen. Von David Amram bis Henry P. Warner sind es insgesamt 82 Texte, alphabetisch nach Autoren sortiert, abwechslungsreich, lyrisch, hoffnungsvoll, oft das Suchen widerspiegelnd, das die Autoren auch in ihrer Musik vorantreibt. All diese Texte und Gedichte erlauben einen anderen Blick auf die Musik, nicht beschreibend, sondern wie Soli in einem anderen Medium, “silent solos”, die nichtsdestotrotz heftigst klingen können.
Die Bücher aus dem Kölner Verlag Buddy’s Knife haben in nur wenigen Ausgaben bereits ein ganz eigenes Profil: schwarz eingebunden mit einem matt-bunten Foto- oder Grafik-Querstreifen in der Mitte des Covers, feines Papier, eine schöne Type, die Schrift in tiefdunklem Grau; und auch inhaltlich: meist Literarisches und Poetisches aus der Feder von Musikern der amerikanischen Avantgardeszene. Das neueste Buch ist da nicht anders: 50 Musiker vor allem der New Yorker Downtown-Szene haben Gedichte beigetragen, die mit Musik zu tun haben oder auch nicht, die abstrakt sind oder reflexiv oder sehr realitätsbezogen. Wahrscheinlich stimmt, was George Lewis in seinem Vorwort sagt, dass man zuerst geneigt sein mag, Ähnlichkeiten zwischen den Texten und der Musik ihrer Autoren zu suchen. Lewis auch stellt die provokante These auf, dass Worte schneller reisten als Musik. Auf jeden Fall käme in der Poesie eine weitere Spielebene hinzu, die der Bedeutungen nämlich, die sich aufeinander und auf die Worte zuvor und danach beziehen, eine Ebene, die sich laufend verändert und die den Leser involviert. Nun, in den Gedichten, die sich in diesem Band befinden, lassen sich allerhand Dinge entdecken, die über das poetische Genießen hinaus Bedeutung besitzen. Wirklich wahllos herausgepickt: Lee Konitzs “no easy way” über die Schwierigkeiten des Zusammenspielens; Gunther Hampels “improvisation – the celebration of the moment” über genau das, was also geschieht, wenn man improvisiert; Katie Bulls “improvisation is the jazz-mandala-voyage” ebenfalls über den Improvisationsprozess; Jayne Cortezs “what’s your take” über die ökonomische Globalisierung und die Notwendigkeit, in diesem Prozess Stellung zu beziehen; Roy Nathansons “charles’ song” über und für Charles Gayle; David Liebmans “what jazz means to me” über seine ganz persönliche Beziehung zu dieser Musik; Assif Tsahars “untitled” über die Stille der Natur; Joseph Jarmans “a vision against violence”; Charles Gayles “untitled”, ein großer Dank ans Publikum … und so viele andere Gedichte, die Geschichten erzählen oder Stimmungen schaffen, die auf reale Erlebnisse rekurrieren oder in sich (den Autor) hineinhorchen. Von David Amram bis Henry P. Warner sind es insgesamt 82 Texte, alphabetisch nach Autoren sortiert, abwechslungsreich, lyrisch, hoffnungsvoll, oft das Suchen widerspiegelnd, das die Autoren auch in ihrer Musik vorantreibt. All diese Texte und Gedichte erlauben einen anderen Blick auf die Musik, nicht beschreibend, sondern wie Soli in einem anderen Medium, “silent solos”, die nichtsdestotrotz heftigst klingen können.
Wolfram Knauer (Mai 2010)
Long Lost Blues. Popular Blues in America, 1850-1920
Von Peter C. Muir
Urbana/Illinois 2010 (University of Illinois Press)
254 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-07676-3
 Wie der Jazz wird auch der Blues allgemein als eine Musik des 20. Jahrhunderts wahrgenommen, eine Musik, die sich parallel zur Tonaufzeichnung entwickelt hat. Anders als der Jazz aber hat der Blues tatsächlich eine längere Geschichte, die Peter Muir in seinem Buch nachzeichnet, das sich den Jahren vor den ersten Bluesaufnahmen widmet, den Jahrzehnten vor Mamie Smith’s “Crazy Blues”. Er schreibt damit über ein Genre, das er selbst als “Popular Blues” bezeichnet und damit sowohl vom Folk Blues wie auch vom Nachkriegs-Chicago-Blues unterscheidet. Entscheidend für die Zuordnung ist ihm dabei die Zielgruppe und Marktorientierung der Musik. Zu den Künstlern dieses Popular Blues zählen also Musiker wie W.C. Handy, Spencer Williams, James P. Johnson, George W. Thomas und Perry Bradford. Muirs Definition des Blues ist dabei denkbar einfach: Wo “Blues” draufsteht, entscheidet er, da wird reingeschaut: Der Titel oder Untertitel der Musik ist ihm wichtiger als eine musikalische Einordnung, auch deshalb, weil es ihm vor allem um eine kulturelle Studie geht und ihn daher diejenige Musik interessiert, die von der Kultur, in der sie entstand, als Blues verkauft werden wollte. Wenn sein Buch im Untertitel auch bis aufs Jahr 1850 zurückgreift, so widmet er sich im Hauptteil allerdings der Musik, die zwischen 1912 und 1920 entstanden ist und für die er eine “Popular Blues Industry” feststellt. Am 12. Januar 1912 meldeten Chris Smith und Tim Brymn beim Urheberrechtsbüro in Washington eine Komposition mit dem simplen Titel “The Blues” an, eigentlich ein Ragtime-Song, der aber in der Thematik (eine Frau, die um ihren Liebsten klagt) wie auch in harmonischen Wendungen Bluesmomente evoziert. Muir untersucht die Veröffentlichungen der nächsten neun Jahre und stellt eine Zunahme der “Blues”-Notenpublikationen fest von 5 im Jahre 1912 bis 456 im Jahr 1920. Er zählt die Blues-Schellackplatten jener Jahre genauso wie die Zylinder und Klavierwalzen und stellt fest, dass die Notenveröffentlichungen damals deutlich einen wichtigeren Marktanteil besaßen als die Plattenveröffentlichungen. Er schaut auf die Verwendung des Bluesklischees im Varieté (Vaudeville) jener Jahre, in Musicals, Minstrel Shows, in Aufführungen von weißen genauso wie schwarzen Künstlern. Er diskutiert das damals kaum vorhandene Bewusstsein der Musiker zur Dualität von Roots Music und Popmusik, in der ihre Aufführungen standen. Muir analysiert einzelne Blueskompositionen, etwa den “Broadway Blues” von Arthur Swanstrom und Morgan Carey, der auch in seiner Klavier/Gesangsfassung komplett abgedruckt ist. Er klassifiziert die von ihm gefundenen Stücke nach Themen, etwa “Beziehungs-Blues”, “Nostalgie-Blues”, “Prohibitions-Blues”, “Kriegs-Blues” und “reflektive Blues”, schaut aber auch auf die rein instrumentalen Blueskompositionen, die oft einen stärkeren Folkduktus besaßen als die vokalen Stücke. Muir erwähnt die Verbindungen zwischen Blues und Ragtime, Blues und Foxtrott und auch Blues und Jazz, wobei er etwa Jelly Roll Mortons “Jelly Roll Blues” diskutiert. Natürlich befasst er sich mit der zwölftaktigen Form des klassischen Bluesmodells, mit Blue Notes, Barbershop Endings, einer der typischsten melodischen Viernotenfiguren jener frühen Blues sowie einem textlichen Klischee, der Zeile “I’ve Got the Blues”, die sich in so vielen der Titel findet. Ein eigenes Kapitel widmet Mur den Konnotationen des Begriffs “Blues”, also den nicht-musikalischen und nicht-textlichen Verständnissen von Traurigkeit, Depression, Schicksalsschlag, und fragt nach den homöopathischen oder allopathischen Qualitäten des Blues, die dabei helfen könnten, solchen Gemütszuständen entgegenzuwirken. Der erfolgreichste Blueskomponist dieser Jahre, W.C. Handy, verdient und erhält ein eigenes Großkapitel. Muir unterteilt sein Wirken in seine Zeit in Memphis (1909-1917) und seine New Yorker Jahre (nach 1917) und untersucht etliche seiner Kompositionen auf ihre Machart, darunter “Yellow Dog Blues”, “Beale Street Blues” und “Saint Louis Blues”. Einige der kreativsten Blueskompositionen, konstatiert Muir, stammten von Komponisten aus den amerikanischen Südstaaten. Als Beispiele führt er Titel an wie “Baby Seals’ Blues”, den “Dallas Blues” oder aber Kompositionen von Euday L. Bowman, George W. Thomas und Perry Bradford. Im abschließenden Kapitel wirft Muir dann noch einen Blick auf Kompositionen, die vor 1912 veröffentlicht wurden und deutliche musikalische oder textliche Beziehungen zum Blues zeigen. Hier wird er dann auch dem Untertitel seines Buchs gerecht und reicht bis 1850 zurück (ein Stück namens “I Have Got the Blues To Day”). Er verfolgt die zwölftaktige Bluesform immerhin bis zurück ins Jahr 1895 (Muir bezieht sich auch hier nur auf Notenveröffentlichungen) und streicht dabei vor allem den Komponisten Hughie Cannon heraus, einen weißen Ragtimepianisten, der heute vor allem noch wegen seines Stücks “Bill Bailey” bekannt ist, daneben aber immerhin dreizehn Stücke schrieb, die Muir zu jenen “Proto-Blues” zählt, Stücke, die vor allem in der formalen und harmonischen Struktur wichtige Einflüsse auf die spätere Bluesmode der Jahre nach 1912 haben sollten. Muir diskutiert das Phänomen der Bluesballade (insbesondere “Frankie and Johnny”) und begründet, warum der Bluesstimmenverlauf, wie wir ihn kennen, und nicht die harmonische Form von “Frankie” sich wohl letzten Endes im populären Blues durchgesetzt haben. Ein Anhang des Buchs listet Stücke, die “Blues” im Titel tragen und zwischen 1912 und 1915 zum Copyright angemeldet wurden. Muirs Buch ist durchsetzt mit musikalischen Beispielen, Auszügen aus den Notenveröffentlichungen, um die sich seine Studie hauptsächlich dreht. Er problematisiert kaum (gerade mal im Vorwort) die performativen Eigenheiten all dieser Kompositionen, die Vereinfachungen ihrer Notenveröffentlichungen, die Ver- und Überarbeitungen, die viele dieser populären Stücke in Arrangements von Bands, Minstrelkünstlern und anderen Musikern erhielten. Sein Buch deckt allerdings recht erschöpfend ein Kapitel ab, das sich manchem als Frage gestellt haben mag, der sich mit dem Repertoire vor 1920 beschäftigt hat und dabei über eine Vielzahl an mit “Blues” betitelten Stücken gestolpert ist, die aber nur bedingt dem entsprechen, was man nach 1920 als Blues versteht. “Long Lost Blues” ist damit also eine überaus spannende und umfassende Aufarbeitung eines wichtigen Teils der Vorgeschichte des Jazz.
Wie der Jazz wird auch der Blues allgemein als eine Musik des 20. Jahrhunderts wahrgenommen, eine Musik, die sich parallel zur Tonaufzeichnung entwickelt hat. Anders als der Jazz aber hat der Blues tatsächlich eine längere Geschichte, die Peter Muir in seinem Buch nachzeichnet, das sich den Jahren vor den ersten Bluesaufnahmen widmet, den Jahrzehnten vor Mamie Smith’s “Crazy Blues”. Er schreibt damit über ein Genre, das er selbst als “Popular Blues” bezeichnet und damit sowohl vom Folk Blues wie auch vom Nachkriegs-Chicago-Blues unterscheidet. Entscheidend für die Zuordnung ist ihm dabei die Zielgruppe und Marktorientierung der Musik. Zu den Künstlern dieses Popular Blues zählen also Musiker wie W.C. Handy, Spencer Williams, James P. Johnson, George W. Thomas und Perry Bradford. Muirs Definition des Blues ist dabei denkbar einfach: Wo “Blues” draufsteht, entscheidet er, da wird reingeschaut: Der Titel oder Untertitel der Musik ist ihm wichtiger als eine musikalische Einordnung, auch deshalb, weil es ihm vor allem um eine kulturelle Studie geht und ihn daher diejenige Musik interessiert, die von der Kultur, in der sie entstand, als Blues verkauft werden wollte. Wenn sein Buch im Untertitel auch bis aufs Jahr 1850 zurückgreift, so widmet er sich im Hauptteil allerdings der Musik, die zwischen 1912 und 1920 entstanden ist und für die er eine “Popular Blues Industry” feststellt. Am 12. Januar 1912 meldeten Chris Smith und Tim Brymn beim Urheberrechtsbüro in Washington eine Komposition mit dem simplen Titel “The Blues” an, eigentlich ein Ragtime-Song, der aber in der Thematik (eine Frau, die um ihren Liebsten klagt) wie auch in harmonischen Wendungen Bluesmomente evoziert. Muir untersucht die Veröffentlichungen der nächsten neun Jahre und stellt eine Zunahme der “Blues”-Notenpublikationen fest von 5 im Jahre 1912 bis 456 im Jahr 1920. Er zählt die Blues-Schellackplatten jener Jahre genauso wie die Zylinder und Klavierwalzen und stellt fest, dass die Notenveröffentlichungen damals deutlich einen wichtigeren Marktanteil besaßen als die Plattenveröffentlichungen. Er schaut auf die Verwendung des Bluesklischees im Varieté (Vaudeville) jener Jahre, in Musicals, Minstrel Shows, in Aufführungen von weißen genauso wie schwarzen Künstlern. Er diskutiert das damals kaum vorhandene Bewusstsein der Musiker zur Dualität von Roots Music und Popmusik, in der ihre Aufführungen standen. Muir analysiert einzelne Blueskompositionen, etwa den “Broadway Blues” von Arthur Swanstrom und Morgan Carey, der auch in seiner Klavier/Gesangsfassung komplett abgedruckt ist. Er klassifiziert die von ihm gefundenen Stücke nach Themen, etwa “Beziehungs-Blues”, “Nostalgie-Blues”, “Prohibitions-Blues”, “Kriegs-Blues” und “reflektive Blues”, schaut aber auch auf die rein instrumentalen Blueskompositionen, die oft einen stärkeren Folkduktus besaßen als die vokalen Stücke. Muir erwähnt die Verbindungen zwischen Blues und Ragtime, Blues und Foxtrott und auch Blues und Jazz, wobei er etwa Jelly Roll Mortons “Jelly Roll Blues” diskutiert. Natürlich befasst er sich mit der zwölftaktigen Form des klassischen Bluesmodells, mit Blue Notes, Barbershop Endings, einer der typischsten melodischen Viernotenfiguren jener frühen Blues sowie einem textlichen Klischee, der Zeile “I’ve Got the Blues”, die sich in so vielen der Titel findet. Ein eigenes Kapitel widmet Mur den Konnotationen des Begriffs “Blues”, also den nicht-musikalischen und nicht-textlichen Verständnissen von Traurigkeit, Depression, Schicksalsschlag, und fragt nach den homöopathischen oder allopathischen Qualitäten des Blues, die dabei helfen könnten, solchen Gemütszuständen entgegenzuwirken. Der erfolgreichste Blueskomponist dieser Jahre, W.C. Handy, verdient und erhält ein eigenes Großkapitel. Muir unterteilt sein Wirken in seine Zeit in Memphis (1909-1917) und seine New Yorker Jahre (nach 1917) und untersucht etliche seiner Kompositionen auf ihre Machart, darunter “Yellow Dog Blues”, “Beale Street Blues” und “Saint Louis Blues”. Einige der kreativsten Blueskompositionen, konstatiert Muir, stammten von Komponisten aus den amerikanischen Südstaaten. Als Beispiele führt er Titel an wie “Baby Seals’ Blues”, den “Dallas Blues” oder aber Kompositionen von Euday L. Bowman, George W. Thomas und Perry Bradford. Im abschließenden Kapitel wirft Muir dann noch einen Blick auf Kompositionen, die vor 1912 veröffentlicht wurden und deutliche musikalische oder textliche Beziehungen zum Blues zeigen. Hier wird er dann auch dem Untertitel seines Buchs gerecht und reicht bis 1850 zurück (ein Stück namens “I Have Got the Blues To Day”). Er verfolgt die zwölftaktige Bluesform immerhin bis zurück ins Jahr 1895 (Muir bezieht sich auch hier nur auf Notenveröffentlichungen) und streicht dabei vor allem den Komponisten Hughie Cannon heraus, einen weißen Ragtimepianisten, der heute vor allem noch wegen seines Stücks “Bill Bailey” bekannt ist, daneben aber immerhin dreizehn Stücke schrieb, die Muir zu jenen “Proto-Blues” zählt, Stücke, die vor allem in der formalen und harmonischen Struktur wichtige Einflüsse auf die spätere Bluesmode der Jahre nach 1912 haben sollten. Muir diskutiert das Phänomen der Bluesballade (insbesondere “Frankie and Johnny”) und begründet, warum der Bluesstimmenverlauf, wie wir ihn kennen, und nicht die harmonische Form von “Frankie” sich wohl letzten Endes im populären Blues durchgesetzt haben. Ein Anhang des Buchs listet Stücke, die “Blues” im Titel tragen und zwischen 1912 und 1915 zum Copyright angemeldet wurden. Muirs Buch ist durchsetzt mit musikalischen Beispielen, Auszügen aus den Notenveröffentlichungen, um die sich seine Studie hauptsächlich dreht. Er problematisiert kaum (gerade mal im Vorwort) die performativen Eigenheiten all dieser Kompositionen, die Vereinfachungen ihrer Notenveröffentlichungen, die Ver- und Überarbeitungen, die viele dieser populären Stücke in Arrangements von Bands, Minstrelkünstlern und anderen Musikern erhielten. Sein Buch deckt allerdings recht erschöpfend ein Kapitel ab, das sich manchem als Frage gestellt haben mag, der sich mit dem Repertoire vor 1920 beschäftigt hat und dabei über eine Vielzahl an mit “Blues” betitelten Stücken gestolpert ist, die aber nur bedingt dem entsprechen, was man nach 1920 als Blues versteht. “Long Lost Blues” ist damit also eine überaus spannende und umfassende Aufarbeitung eines wichtigen Teils der Vorgeschichte des Jazz.
Wolfram Knauer (Mai 2010)
Groove – Kultur – Unterricht. Studien zur pädagogischen Erschließung einer musikkulturellen Praktik
von Heinrich Klingmann
Bielefeld 2010 (transcript Verlag)
436 Seiten, 34,80 Euro
ISBN: 978-3-8376-1354-4
 Afroamerikanischer Groove, sagt Heinrich Klingmann in der Einleitung zu seinem Buch, sei ein Phänomen, das nicht nur für rhythmisch-musikalische Praktiken stehe, sondern daneben eine musikalische Gestaltungsweise beschreibe, die inzwischen weltweit rezipiert werde. Sie sei darüber hinaus unterrichtbar und müsse heute auch unterrichtet werden. Sein Buch wolle so einen “Beitrag zur wissenschaftlichen Legitimierung der pädagogischen Arbeit mit dem rhythmischen Aspekt afroamerikanischer Musik leisten”. In einem ersten Kapitel beschreibt er, wie Groove bislang im wissenschaftlichen Diskurs behandelt wurde, stellt unterschiedliche musikologische wie erlebnis- und rezeptionstheoretische Erklärungen oder Annäherungen an das Phänomen Groove vor, geht dabei auch auf musikethnologische Forschungen zur Funktion von Rhythmus bzw. Groove in verschiedenen Kulturen ein. Er erklärt kulturwissenschaftliche Perspektiven, also beispielsweise unterschiedliche Codes, die sich mit musikalischen Parametern verbinden und diskutiert in diesem Zusammenhang ausführlich die Probleme, die die westlich geprägte Hochkultur mit der scheinbaren Unmitttelbarkeit als “primitiv” angesehener Kulturen hatte, also auch mit Rhythmik und Groove (und vor allem: Körperlichkeit) afrikanischer bzw. afroamerikanischer Musik. Der zweite Teil, der etwas mehr als ein Viertel seines Buchs ausmacht, ist dem Thema “Musikpädagogik und Groovemusik” gewidmet. Hier geht es Klingmann darum, ob und wie man Groove an Schulen unterrichten könne. Er stellt kurz dar, wie sich der Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten geändert und geöffnet habe, schildert unterschiedliche musikdidaktische Positionen und die Rolle, die afroamerikanische Rhythmik in ihnen spielt, und überlegt schließlich, wie rhythmisches Bewusstsein in unterschiedliche Lehrkonzepte einzubauen sein könnte, etwa als Einführung in die Musikkulturen, als Möglichkeit persönlicher Authentifizierung und einer Authentifizierung in der Gruppe, oder als Möglichkeit der Ausbildung von Teilkompetenzen (nach dem Motto “Kunst kommt nicht ohne handwerkliches Können aus”). Afroamerikanische Rhythmik, erklärt er resümierend, könne damit erheblich zur musikalischen Bildung beitragen, gerade weil sie praktisch orientiert sei und die Schüler mit einbinde. Klingmanns Buch entstand aus seiner Dissertation (im Fach Musikpädagogik), und so ist das Buch eine entsprechend theoretische Lektüre mit viel Querverweisen und Literaturdiskussion. Dabei aber gelingt es ihm Argumente für den Einsatz rhythmischer Modelle in den Musikunterricht zu stützen und nebenbei auch einen sehr speziellen Blick auf die Bedürfnisse des Musikunterrichts im 21. Jahrhundert zu richten.
Afroamerikanischer Groove, sagt Heinrich Klingmann in der Einleitung zu seinem Buch, sei ein Phänomen, das nicht nur für rhythmisch-musikalische Praktiken stehe, sondern daneben eine musikalische Gestaltungsweise beschreibe, die inzwischen weltweit rezipiert werde. Sie sei darüber hinaus unterrichtbar und müsse heute auch unterrichtet werden. Sein Buch wolle so einen “Beitrag zur wissenschaftlichen Legitimierung der pädagogischen Arbeit mit dem rhythmischen Aspekt afroamerikanischer Musik leisten”. In einem ersten Kapitel beschreibt er, wie Groove bislang im wissenschaftlichen Diskurs behandelt wurde, stellt unterschiedliche musikologische wie erlebnis- und rezeptionstheoretische Erklärungen oder Annäherungen an das Phänomen Groove vor, geht dabei auch auf musikethnologische Forschungen zur Funktion von Rhythmus bzw. Groove in verschiedenen Kulturen ein. Er erklärt kulturwissenschaftliche Perspektiven, also beispielsweise unterschiedliche Codes, die sich mit musikalischen Parametern verbinden und diskutiert in diesem Zusammenhang ausführlich die Probleme, die die westlich geprägte Hochkultur mit der scheinbaren Unmitttelbarkeit als “primitiv” angesehener Kulturen hatte, also auch mit Rhythmik und Groove (und vor allem: Körperlichkeit) afrikanischer bzw. afroamerikanischer Musik. Der zweite Teil, der etwas mehr als ein Viertel seines Buchs ausmacht, ist dem Thema “Musikpädagogik und Groovemusik” gewidmet. Hier geht es Klingmann darum, ob und wie man Groove an Schulen unterrichten könne. Er stellt kurz dar, wie sich der Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten geändert und geöffnet habe, schildert unterschiedliche musikdidaktische Positionen und die Rolle, die afroamerikanische Rhythmik in ihnen spielt, und überlegt schließlich, wie rhythmisches Bewusstsein in unterschiedliche Lehrkonzepte einzubauen sein könnte, etwa als Einführung in die Musikkulturen, als Möglichkeit persönlicher Authentifizierung und einer Authentifizierung in der Gruppe, oder als Möglichkeit der Ausbildung von Teilkompetenzen (nach dem Motto “Kunst kommt nicht ohne handwerkliches Können aus”). Afroamerikanische Rhythmik, erklärt er resümierend, könne damit erheblich zur musikalischen Bildung beitragen, gerade weil sie praktisch orientiert sei und die Schüler mit einbinde. Klingmanns Buch entstand aus seiner Dissertation (im Fach Musikpädagogik), und so ist das Buch eine entsprechend theoretische Lektüre mit viel Querverweisen und Literaturdiskussion. Dabei aber gelingt es ihm Argumente für den Einsatz rhythmischer Modelle in den Musikunterricht zu stützen und nebenbei auch einen sehr speziellen Blick auf die Bedürfnisse des Musikunterrichts im 21. Jahrhundert zu richten.
(Wolfram Knauer)
Der Wind, das Licht. ECM und das Bild
herausgegeben von Lars Müller
Baden/Schweiz 2010 (Lars Müller Publishers)
447 Seiten, 54,90 Euro
ISBN: 978-3-03778-197-5
 Das Label ECM besteht seit 40 Jahren und seit bald 35 Jahren ist es quasi ein Mythos: der Musik wegen, des Sounds wegen und auch der Covergestaltung seiner Alben wegen. Neben Blue Note ist es wohl das einzige Plattenlabel des Jazz, das Forscher zu unterschiedlichsten wissenschaftlichen Arbeiten anregte, mit denen sie versuchten, dem Geheimnis von ECM auf die Spur zu kommen. Lars Müllers neuestes Buch tut dies relativ direkt: Er präsentiert sämtliche Cover, die seit Beginn des Labels erschienen sind, setzt auf den Plattencovern verwendete Originalfotos in Verbindung zu den erschienenen Produkten und erlaubt damit einen Überblick über die Entwicklung des grafischen Konzepts und der Veränderungen über die Jahre. Immer wieder sind es Bilder, die zwischen Fotorealismus und Abstraktion schwanken, die Atmosphärisches heraufbeschwören und bei denen man quasi auf die Musik schließen möchte, auch wenn man die Aufnahmen selbst nicht kennt. “Der Wind, das Licht” — allein der Titel ist sicher Beschreibung genug für viele der Fotos, die weite Landschaft, Natur (und Natürlichkeit) vermitteln. Fünf Essays nähern sich den Bildern auch textlich; Thomas Steinfeld schreibt einen allgemeinen Einführungstext; Katharina Epprecht macht sich Gedanken über “transmediale Sinnbilder”, also über den Eindruck, den die ECM-Coverkunst selbst bei flüchtigem Anblick hervorrufen können; Geoff Andrew reflektiert über den Einfluss des Filmregisseurs Michel Godard auf die Bildästhetik hinter den von Manfred Eicher ausgewählten Bildern; Kjetil Bjornstad beschreibt seine ganz persönliche Reaktion auf die Covergestaltung; und der Herausgeber Lars Müller schließlich macht sich Gedanken über die in den Bildern dargestellten Motive und ihre Wirkung vor und nach der genaueren Betrachtung. Auch die Buchgestaltung orientiert sich am ECM-Design: edel-zurückhaltend, im grauen Einband durchscheinend das aufgewühlte Meer, klare silbern-schwarze Schrift, auf der Vorderumschlag der geprägte Abdruck eines CD-Covers, auf der Rückseite der geprägte Abdruck einer CD. Alles in allem: ein opulentes Werk über das grafische Konzept eines Plattenlabels — und ganz gewiss ein passendes Geschenk für Kunsthistoriker oder ECM-Fans.
Das Label ECM besteht seit 40 Jahren und seit bald 35 Jahren ist es quasi ein Mythos: der Musik wegen, des Sounds wegen und auch der Covergestaltung seiner Alben wegen. Neben Blue Note ist es wohl das einzige Plattenlabel des Jazz, das Forscher zu unterschiedlichsten wissenschaftlichen Arbeiten anregte, mit denen sie versuchten, dem Geheimnis von ECM auf die Spur zu kommen. Lars Müllers neuestes Buch tut dies relativ direkt: Er präsentiert sämtliche Cover, die seit Beginn des Labels erschienen sind, setzt auf den Plattencovern verwendete Originalfotos in Verbindung zu den erschienenen Produkten und erlaubt damit einen Überblick über die Entwicklung des grafischen Konzepts und der Veränderungen über die Jahre. Immer wieder sind es Bilder, die zwischen Fotorealismus und Abstraktion schwanken, die Atmosphärisches heraufbeschwören und bei denen man quasi auf die Musik schließen möchte, auch wenn man die Aufnahmen selbst nicht kennt. “Der Wind, das Licht” — allein der Titel ist sicher Beschreibung genug für viele der Fotos, die weite Landschaft, Natur (und Natürlichkeit) vermitteln. Fünf Essays nähern sich den Bildern auch textlich; Thomas Steinfeld schreibt einen allgemeinen Einführungstext; Katharina Epprecht macht sich Gedanken über “transmediale Sinnbilder”, also über den Eindruck, den die ECM-Coverkunst selbst bei flüchtigem Anblick hervorrufen können; Geoff Andrew reflektiert über den Einfluss des Filmregisseurs Michel Godard auf die Bildästhetik hinter den von Manfred Eicher ausgewählten Bildern; Kjetil Bjornstad beschreibt seine ganz persönliche Reaktion auf die Covergestaltung; und der Herausgeber Lars Müller schließlich macht sich Gedanken über die in den Bildern dargestellten Motive und ihre Wirkung vor und nach der genaueren Betrachtung. Auch die Buchgestaltung orientiert sich am ECM-Design: edel-zurückhaltend, im grauen Einband durchscheinend das aufgewühlte Meer, klare silbern-schwarze Schrift, auf der Vorderumschlag der geprägte Abdruck eines CD-Covers, auf der Rückseite der geprägte Abdruck einer CD. Alles in allem: ein opulentes Werk über das grafische Konzept eines Plattenlabels — und ganz gewiss ein passendes Geschenk für Kunsthistoriker oder ECM-Fans.
(Wolfram Knauer, April 2010)
What a Wonderful World. Als Louis Armstrong durch den Osten tourte
von Stephan Schulz
Berlin 2010 (Neues Leben)
255 Seiten, 14,95 Euro
ISBN: 978-3-355-01772-5
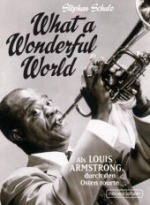 Louis Armstrong kam im März 1965 zu 17 Konzerten in der DDR, eine Sensation mitten im Kalten Krieg. Der Journalist Stephan Schulz recherchierte die Geschichte eigentlich für eine Rundfunkreportage, stieß dabei aber auf so viele interessante Dokumente und enthusiastische Zeitzeugen, dass aus seinen Recherchen ein opulentes Buch wurde, das, reich bebildert, jetzt im Verlag Neues Leben erschien. Schulz ordnet Armstrongs Tournee in die Lebenswirklichkeit in der DDR der 1960er Jahre ein, kontrastiert Begeisterung, Wünsche, Ängste, Hoffnungen, Befürchtungen, Argwohn und wieder Begeisterung — alles Emotionen, die zu spüren sind im Umgang der Behörden mit der ungewöhnlichen Tournee, im Enthusiasmus der Fans, den Überstar des Jazz persönlich erleben zu dürfen, in den augenzwinkernden Reaktionen Satchmos selbst auf die Lebenswirklichkeit im real existierenden Sozialismus. Schulz befragte viele Fans, die dabei waren bei den Konzerten in Berlin, Leipzig, Magdeburg, Erfurt und Schwerin. In Berlin gaben die All Stars sechs Konzerte, die innerhalb eines Tages ausverkauft waren – 18.000 Tickets an einem Tag! Schulz fragt, inwieweit Armstrongs Konzerte das Regime stützen sollten und inwieweit sie dazu beitrugen, den Jazz in DDR stärker hoffähig zu machen als zuvor, wo er oft noch als “Affenmusik des Imperialismus” abgetan wurde. Er recherchiert, wie es überhaupt zu der Tournee kam, spricht mit Roland Trisch, der einst in der Künstleragentur der DDR gearbeitet hatte, und mit dem Jazzexperten Karlheinz Drechsel, der Armstrong auf der Tournee begleitete und die Konzerte ansagte, geht ins Bundesarchiv, in dem die Akten der Künstleragentur lagern. Der Schweizer Zwischenagent habe als Honorar ein Observatorium der Firma Carl Zeiss Jena gefordert, hieß es, oder aber er habe alte Waffen aus dem Dreißigjährigen Krieg erhalten. Schulz spricht mit dem damaligen Kulturminister der DDR, und er tut jenen Schweizer Agenten auf, der ihm einen Rückruf zusichert, dann aber wenige Tage nach dem Telefonat verstirbt. Schulz beschreibt die Ankunft der All Stars auf dem Flughafen Berlin-Schöneberg, auf dem die Jazz-Optimisten den Trompeter musikalisch mit seiner Erkennungsmelodie begrüßten und er sofort mit einstimmt. Er schreibt über die Pressekonferenz, in der Armstrong klar macht, dass es ihm bei seiner Tournee vor allem um Musik geht, darum, sein Publikum zu erfreuen, und nicht um Politik. Schulz liest die internationalen Presseberichte über die Konzerte, beschreibt die Atmosphäre bei und nach den Konzerten, begleitet den Trompeter nach Leipzig, wo Armstrong eine Zahnkrone abhanden kam und er einen Zahnarzt aufsuchen musste. Schulz spricht mit der Ehefrau des damaligen Zahnarztes. Ein kurzes Kapitel befasst sich mit der Überwachung des Konzertpublikums durch die Stasi. Er berichtet davon, wie Satchmo bei seiner Reise seine Liebe für Eisbein entdeckt habe. Auf dem Weg von Berlin nach Magdeburg wurde der Bandbus von der sowjetischen Armee gestoppt, die Truppenübungen machte, mit denen sie auf die am nächsten Tag stattfindende Sitzung des Deutschen Bundestags in Westberlin reagierte, aus DDR-Sicht eine Provokation und ein Verstoß gegen den Status der Stadt. Bei derselben Fahrt war plötzlich der Kühler des Busses defekt, und die Musiker mussten in der Kleinstadt Genthin eine Zwangspause einlegen, wo er sofort von Menschen umringt war, die ihn um Autogramme baten. Ähnliche Geschichten gibt es auch von anderswo, und Schulzes Buch ist voll von ihnen, voll von Zeugnissen dafür, wie menschennah, wie wenig “Star” Armstrong zeitlebens war. Er erzählt die Geschichte hinter einer seltsamen Blumensamenwerbung, für die Armstrong Modell stand. Und im mecklenburgischen Barth setzte ein Reporter Armstrong den Floh ins Ohr, Bix Beiderbecke (dessen Vorfahren aus Westfalen kommen) würde angeblich von hier stammen, was Satchmo noch zuhause brav weiter ausspann. Zum Schluss entdeckt Schulz die Abrechnung der Künstleragentur und stellt fest, dass Armstrong mit 15.745,66 Mark im Jahr 1965 nach dem Bolschoi-Theater das meiste Geld in die Kassen der Künstleragentur gespielt hatte. Schulzes Buch ist voller seltener Fotos aus den Privatalben von Fans genauso wie aus dem Archiv von Pressefotografen, zeigt Ausrisse aus Zeitungen genauso wie Anzeigen oder Plakate oder auch Fotos, die vordergründig überhaupt nichts mit Armstrong zu tun haben, aber mit der Unterschrift versehen sind “In dieser Kneipe in Parchen soll Louis Armstrong um Kühlwasser für sein Wasser gebeten haben”. Ein unterhaltsames und zugleich informatives Buch, das einen sehr fokussierten Einblick in den Arbeitsalltags des Trompeters Louis Armstrong und zugleich Einblicke in das Leben in der DDR und die unterschiedlichen Möglichkeiten des Umgehens staatlicher Hindernissen vermittelt.
Louis Armstrong kam im März 1965 zu 17 Konzerten in der DDR, eine Sensation mitten im Kalten Krieg. Der Journalist Stephan Schulz recherchierte die Geschichte eigentlich für eine Rundfunkreportage, stieß dabei aber auf so viele interessante Dokumente und enthusiastische Zeitzeugen, dass aus seinen Recherchen ein opulentes Buch wurde, das, reich bebildert, jetzt im Verlag Neues Leben erschien. Schulz ordnet Armstrongs Tournee in die Lebenswirklichkeit in der DDR der 1960er Jahre ein, kontrastiert Begeisterung, Wünsche, Ängste, Hoffnungen, Befürchtungen, Argwohn und wieder Begeisterung — alles Emotionen, die zu spüren sind im Umgang der Behörden mit der ungewöhnlichen Tournee, im Enthusiasmus der Fans, den Überstar des Jazz persönlich erleben zu dürfen, in den augenzwinkernden Reaktionen Satchmos selbst auf die Lebenswirklichkeit im real existierenden Sozialismus. Schulz befragte viele Fans, die dabei waren bei den Konzerten in Berlin, Leipzig, Magdeburg, Erfurt und Schwerin. In Berlin gaben die All Stars sechs Konzerte, die innerhalb eines Tages ausverkauft waren – 18.000 Tickets an einem Tag! Schulz fragt, inwieweit Armstrongs Konzerte das Regime stützen sollten und inwieweit sie dazu beitrugen, den Jazz in DDR stärker hoffähig zu machen als zuvor, wo er oft noch als “Affenmusik des Imperialismus” abgetan wurde. Er recherchiert, wie es überhaupt zu der Tournee kam, spricht mit Roland Trisch, der einst in der Künstleragentur der DDR gearbeitet hatte, und mit dem Jazzexperten Karlheinz Drechsel, der Armstrong auf der Tournee begleitete und die Konzerte ansagte, geht ins Bundesarchiv, in dem die Akten der Künstleragentur lagern. Der Schweizer Zwischenagent habe als Honorar ein Observatorium der Firma Carl Zeiss Jena gefordert, hieß es, oder aber er habe alte Waffen aus dem Dreißigjährigen Krieg erhalten. Schulz spricht mit dem damaligen Kulturminister der DDR, und er tut jenen Schweizer Agenten auf, der ihm einen Rückruf zusichert, dann aber wenige Tage nach dem Telefonat verstirbt. Schulz beschreibt die Ankunft der All Stars auf dem Flughafen Berlin-Schöneberg, auf dem die Jazz-Optimisten den Trompeter musikalisch mit seiner Erkennungsmelodie begrüßten und er sofort mit einstimmt. Er schreibt über die Pressekonferenz, in der Armstrong klar macht, dass es ihm bei seiner Tournee vor allem um Musik geht, darum, sein Publikum zu erfreuen, und nicht um Politik. Schulz liest die internationalen Presseberichte über die Konzerte, beschreibt die Atmosphäre bei und nach den Konzerten, begleitet den Trompeter nach Leipzig, wo Armstrong eine Zahnkrone abhanden kam und er einen Zahnarzt aufsuchen musste. Schulz spricht mit der Ehefrau des damaligen Zahnarztes. Ein kurzes Kapitel befasst sich mit der Überwachung des Konzertpublikums durch die Stasi. Er berichtet davon, wie Satchmo bei seiner Reise seine Liebe für Eisbein entdeckt habe. Auf dem Weg von Berlin nach Magdeburg wurde der Bandbus von der sowjetischen Armee gestoppt, die Truppenübungen machte, mit denen sie auf die am nächsten Tag stattfindende Sitzung des Deutschen Bundestags in Westberlin reagierte, aus DDR-Sicht eine Provokation und ein Verstoß gegen den Status der Stadt. Bei derselben Fahrt war plötzlich der Kühler des Busses defekt, und die Musiker mussten in der Kleinstadt Genthin eine Zwangspause einlegen, wo er sofort von Menschen umringt war, die ihn um Autogramme baten. Ähnliche Geschichten gibt es auch von anderswo, und Schulzes Buch ist voll von ihnen, voll von Zeugnissen dafür, wie menschennah, wie wenig “Star” Armstrong zeitlebens war. Er erzählt die Geschichte hinter einer seltsamen Blumensamenwerbung, für die Armstrong Modell stand. Und im mecklenburgischen Barth setzte ein Reporter Armstrong den Floh ins Ohr, Bix Beiderbecke (dessen Vorfahren aus Westfalen kommen) würde angeblich von hier stammen, was Satchmo noch zuhause brav weiter ausspann. Zum Schluss entdeckt Schulz die Abrechnung der Künstleragentur und stellt fest, dass Armstrong mit 15.745,66 Mark im Jahr 1965 nach dem Bolschoi-Theater das meiste Geld in die Kassen der Künstleragentur gespielt hatte. Schulzes Buch ist voller seltener Fotos aus den Privatalben von Fans genauso wie aus dem Archiv von Pressefotografen, zeigt Ausrisse aus Zeitungen genauso wie Anzeigen oder Plakate oder auch Fotos, die vordergründig überhaupt nichts mit Armstrong zu tun haben, aber mit der Unterschrift versehen sind “In dieser Kneipe in Parchen soll Louis Armstrong um Kühlwasser für sein Wasser gebeten haben”. Ein unterhaltsames und zugleich informatives Buch, das einen sehr fokussierten Einblick in den Arbeitsalltags des Trompeters Louis Armstrong und zugleich Einblicke in das Leben in der DDR und die unterschiedlichen Möglichkeiten des Umgehens staatlicher Hindernissen vermittelt.
(Wolfram Knauer, März 2010)
Ornette Coleman. Klang der Freiheit. Interviews
von Christian Broecking
Berlin 2010 (Broecking Verlag)
123 Seiten, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-938763-13-1
 Christian Broecking unterhält sich in seinem neuen Buch mit Ornette Coleman über dessen ganz persönliche Sicht auf Musik und Gesellschaft. Coleman ist weit weniger Zorniger Schwarzer Mann als andere Kollegen seiner Generation. Er kommt zwar aus Armut und wuchs in einer rassistischen gesellschaft auf, doch sieht er seine Musik kaum durch dieses Spannungsfeld beeinflusst, sieht im Gegenteil in seiner Musik vor allem etwas Anti-Segregationistisches. In zwei Interviews spricht er über seinen Sohn, über Armut, Glück und Liebe, über Improvisation und darüber, wie man mit Musik die Welt verändern kann. Broecking unterhält sich außerdem mit zwei Weggefährten Colemans: Don Cherry und Charlie Haden. Cherry erzählt ihm über den Unterschied der Generationen im Jazz, über seine erste Taschentrompete, über Steve Lacy, der sein erster Lehrer war, über seine Zeit in Schweden und darüber, warum er anders als etliche seiner Kollegen nicht verbittert sei. Er berichtet von Ansatzschwierigkeiten, seitdem er ein künstliches Gebiss hat, über die Rolle der großen Schwarzen Musiker als Propheten, nicht role models, und natürlich über den Schock, den Ornette Colemans Musik anfangs bei den Leuten auslöste. Charlie Haden erzählt in vier Interviews über sein Quartet West und seine politischen Ambitionen, über das Liberation Music Orchestra, konservativen und progressiven Sound im Jazz. Er berichtet über seine Aufnahmen mit John Coltrane, über seine Reaktion auf den Hurricane Katrina in New Orleans, über die Musikindustrie, Country Music und darüber, welche Rolle Ornette Colemans Musik in seinem Leben spielte. In einem abschließenden Kapitel sammelt Broecking schließlich Äußerungen unterschiedlichster Wegbegleiter Colemans über den Saxophonisten, Trompeter, Geiger und Komponisten. Zu Worte kommen Pat Metheny, Bruce Lundvall, Jason Moran, Greg Osby, Geri Allen, Joshua Redman, Dewey Redman, Michael Cuscuna, Walter Norris, Vijay Iyer, Terence Blanchard, Dave Holland, David Sanborn, Hank Jones, Curtis Fuller, Philip Glass, Manfred Eicher, Barre Philips, Evan Parker, David Murray, Butch Morris, Anthony Braxton, George Lewis und Henry Threagill. “Klang der Freiheit” ist ein kleines Büchlein über Ornette Coleman, durchsetzt mit Fotos, die Broecking bei Konzerten oder im New Yorker Loft des Saxophonisten aufgenommen hat, und gibt in der Sammlung der Geschichten und Biographien, die sich immer wieder kreuzten, einen wunderbaren Einblick in die musikalische Ästhetik Ornette Colemans und die Umgebung, in der diese sich entwickelte.
Christian Broecking unterhält sich in seinem neuen Buch mit Ornette Coleman über dessen ganz persönliche Sicht auf Musik und Gesellschaft. Coleman ist weit weniger Zorniger Schwarzer Mann als andere Kollegen seiner Generation. Er kommt zwar aus Armut und wuchs in einer rassistischen gesellschaft auf, doch sieht er seine Musik kaum durch dieses Spannungsfeld beeinflusst, sieht im Gegenteil in seiner Musik vor allem etwas Anti-Segregationistisches. In zwei Interviews spricht er über seinen Sohn, über Armut, Glück und Liebe, über Improvisation und darüber, wie man mit Musik die Welt verändern kann. Broecking unterhält sich außerdem mit zwei Weggefährten Colemans: Don Cherry und Charlie Haden. Cherry erzählt ihm über den Unterschied der Generationen im Jazz, über seine erste Taschentrompete, über Steve Lacy, der sein erster Lehrer war, über seine Zeit in Schweden und darüber, warum er anders als etliche seiner Kollegen nicht verbittert sei. Er berichtet von Ansatzschwierigkeiten, seitdem er ein künstliches Gebiss hat, über die Rolle der großen Schwarzen Musiker als Propheten, nicht role models, und natürlich über den Schock, den Ornette Colemans Musik anfangs bei den Leuten auslöste. Charlie Haden erzählt in vier Interviews über sein Quartet West und seine politischen Ambitionen, über das Liberation Music Orchestra, konservativen und progressiven Sound im Jazz. Er berichtet über seine Aufnahmen mit John Coltrane, über seine Reaktion auf den Hurricane Katrina in New Orleans, über die Musikindustrie, Country Music und darüber, welche Rolle Ornette Colemans Musik in seinem Leben spielte. In einem abschließenden Kapitel sammelt Broecking schließlich Äußerungen unterschiedlichster Wegbegleiter Colemans über den Saxophonisten, Trompeter, Geiger und Komponisten. Zu Worte kommen Pat Metheny, Bruce Lundvall, Jason Moran, Greg Osby, Geri Allen, Joshua Redman, Dewey Redman, Michael Cuscuna, Walter Norris, Vijay Iyer, Terence Blanchard, Dave Holland, David Sanborn, Hank Jones, Curtis Fuller, Philip Glass, Manfred Eicher, Barre Philips, Evan Parker, David Murray, Butch Morris, Anthony Braxton, George Lewis und Henry Threagill. “Klang der Freiheit” ist ein kleines Büchlein über Ornette Coleman, durchsetzt mit Fotos, die Broecking bei Konzerten oder im New Yorker Loft des Saxophonisten aufgenommen hat, und gibt in der Sammlung der Geschichten und Biographien, die sich immer wieder kreuzten, einen wunderbaren Einblick in die musikalische Ästhetik Ornette Colemans und die Umgebung, in der diese sich entwickelte.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
The Music of Django Reinhardt
von Benjamin Givan
Ann Arbor 2010 (University of Michigan Press)
242 Seiten; 29,95 US-$
ISBN: 978-0-472-03408-6
 2010 wird überall in der Jazzwelt der 100. Geburtstag Django Reinhardts gefeiert, und neben unzähligen Geburtstags-Homages als Konzert oder auf CD legt die University of Michigan Press eine musikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Gitarristen vor, die auf der Dissertation basiert, die Benjamin Givan bereits 2003 an der Yale University eingereicht hatte. Givans Buch ist keine Biographie — davon gibt es inzwischen genügend –, sondern eine Auseinandersetzung mit der Technik des Gitarristen, der sich bei einem Feuer in seinem Wohnwagen 1928 die linke Hand so schwer verletzte, dass er deren Mittel- und Ringfinger nicht weiter benutzen konnte. Gleich im ersten Kapitel spekuliert Givan, welche Verletzungen das Feuer wohl konkret angerichtet haben könnten und welche Auswirkungen die Verletzungen auf Reinhardts Gitarrenspiel hatte. Givan analysiert mögliche Grifftechniken einzelner Titel und findet heraus, dass Reinhardt seinen Mittelfinger offenbar durchaus noch gezielt einsetzen konnte und dass er sein Handicap durch andere Griffmethoden wettmachte, etwa den Einsatz des Daumens für Bassnoten. Im zweiten Kapitel beschäftigt sich Givan mit der Beobachtung, dass, wo in anderen Werken auch aus dem Jazzkontext der einheitliche dynamische Bogen besonders wertgeschätzt wird, bei Reinhardt ein Moment laufender Diskontinuität eine wichtige Rolle spielt. Er untersucht dafür verschiedene Aufnahmen auf das Phänomen abrupter Brüche, die durch harmonische, rhythmische, melodische oder formale Entscheidungen des Gitarristen ausgelöst werden. Givan lässt bei aller analytischen Diskussion allerdings ein wenig die Tatsache außer Acht, dass “discontinuity” nicht wirklich der Gegensatz zu “unity” ist, dass Beschreibungen wie “Geschlossenheit”, “dramaturgischer Bogen” etc. durchaus mit der Idee musikalischer Brüche als stilistisches Werkzeug kompatibel sind. Im dritten Kapitel wendet Givan das Beispiel der Thomas Owens’schen Analyse von Improvisationsformeln im Spiel Charlie Parkers auf die Musik Reinhardts an, sucht also nach melodischen Formeln, die sich an bestimmten Stellen, etwa bei speziellen Harmoniewechseln, immer wieder finden. Im vierten Kapitel analysiert er drei “klassische” Soli Reinhardts: “I’ll See You In My Dreams”, “Love’s Melody” und “Embraceable You” — wie sonstwo im Buch einschließlich ausführlicher Solotranskriptionen. Givans fünftes Kapitel betrachtet spätere stilistische Änderungen im Gitarrenspiel Djangos, also den Einfluss des Bebop oder den Wechsel zur elektrisch verstärkten Gitarre. Biographische Notizen sind in Givans Buch auf ein Minimum beschränkt, auch Anmerkungen auf Einflüsse etwa anderer Gitarristen oder eine Diskussion der Musik der Manouche. Er schreibt eine analytische musikwissenschaftliche Studie, die für den “einfachen” Fan eher schwere Lektüre sein dürfte. Givan vermag dabei aus der Musik selbst heraus den Blick auf bestimmte Aspekte der Technik des Gitarristen zu lenken und dabei mit Hilfe der musikalischen Analyse die Kunst Django Reinhardts ein wenig näher zu erklären.
2010 wird überall in der Jazzwelt der 100. Geburtstag Django Reinhardts gefeiert, und neben unzähligen Geburtstags-Homages als Konzert oder auf CD legt die University of Michigan Press eine musikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Gitarristen vor, die auf der Dissertation basiert, die Benjamin Givan bereits 2003 an der Yale University eingereicht hatte. Givans Buch ist keine Biographie — davon gibt es inzwischen genügend –, sondern eine Auseinandersetzung mit der Technik des Gitarristen, der sich bei einem Feuer in seinem Wohnwagen 1928 die linke Hand so schwer verletzte, dass er deren Mittel- und Ringfinger nicht weiter benutzen konnte. Gleich im ersten Kapitel spekuliert Givan, welche Verletzungen das Feuer wohl konkret angerichtet haben könnten und welche Auswirkungen die Verletzungen auf Reinhardts Gitarrenspiel hatte. Givan analysiert mögliche Grifftechniken einzelner Titel und findet heraus, dass Reinhardt seinen Mittelfinger offenbar durchaus noch gezielt einsetzen konnte und dass er sein Handicap durch andere Griffmethoden wettmachte, etwa den Einsatz des Daumens für Bassnoten. Im zweiten Kapitel beschäftigt sich Givan mit der Beobachtung, dass, wo in anderen Werken auch aus dem Jazzkontext der einheitliche dynamische Bogen besonders wertgeschätzt wird, bei Reinhardt ein Moment laufender Diskontinuität eine wichtige Rolle spielt. Er untersucht dafür verschiedene Aufnahmen auf das Phänomen abrupter Brüche, die durch harmonische, rhythmische, melodische oder formale Entscheidungen des Gitarristen ausgelöst werden. Givan lässt bei aller analytischen Diskussion allerdings ein wenig die Tatsache außer Acht, dass “discontinuity” nicht wirklich der Gegensatz zu “unity” ist, dass Beschreibungen wie “Geschlossenheit”, “dramaturgischer Bogen” etc. durchaus mit der Idee musikalischer Brüche als stilistisches Werkzeug kompatibel sind. Im dritten Kapitel wendet Givan das Beispiel der Thomas Owens’schen Analyse von Improvisationsformeln im Spiel Charlie Parkers auf die Musik Reinhardts an, sucht also nach melodischen Formeln, die sich an bestimmten Stellen, etwa bei speziellen Harmoniewechseln, immer wieder finden. Im vierten Kapitel analysiert er drei “klassische” Soli Reinhardts: “I’ll See You In My Dreams”, “Love’s Melody” und “Embraceable You” — wie sonstwo im Buch einschließlich ausführlicher Solotranskriptionen. Givans fünftes Kapitel betrachtet spätere stilistische Änderungen im Gitarrenspiel Djangos, also den Einfluss des Bebop oder den Wechsel zur elektrisch verstärkten Gitarre. Biographische Notizen sind in Givans Buch auf ein Minimum beschränkt, auch Anmerkungen auf Einflüsse etwa anderer Gitarristen oder eine Diskussion der Musik der Manouche. Er schreibt eine analytische musikwissenschaftliche Studie, die für den “einfachen” Fan eher schwere Lektüre sein dürfte. Givan vermag dabei aus der Musik selbst heraus den Blick auf bestimmte Aspekte der Technik des Gitarristen zu lenken und dabei mit Hilfe der musikalischen Analyse die Kunst Django Reinhardts ein wenig näher zu erklären.
(Wolfram Knauer 2010)
[:]