[:de]Duke Ellington
von Wolfram Knauer
Ditzingen 2017 (Reclam)
328 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-15-011127-7
 Da lesen wir laufend “fremder Leute” Bücher und vergessen dabei fast die Eigenwerbung. Im letzten Herbst jedenfalls brachte die Post Wolfram Knauers “Duke Ellington” , das, so die Verlagsankündigung, “den Komponisten, Pianisten und Orchesterleiter Duke Ellington als eine Integrationsfigur des Jazz” würdigt. Weiter heißt es da: “Musiker aller Epochen, aller Stilrichtungen, aller künstlerischen Ansätze scheinen sich mit seiner musikalischen Ästhetik identifizieren zu können. Knauer, Musikwissenschaftler und international bekannter Experte zum Jazz, lauscht seinen Aufnahmen, um aus ihnen heraus Ellingtons Biographie zu erzählen, den geradlinigen Weg eines Musikers, der weiß, dass seine Stärke im Zusammenfügen der vielen Stimmen seines Orchesters besteht. Anschaulich und mit Wissen auch um Ellingtons privates Umfeld und die wirtschaftlichen Zwänge im amerikanischen Musikbusiness schildert er die Gründe für ästhetische Entscheidungen des Duke und kann damit die verschiedenen Phasen seines Schaffens angemessen würdigen.”
Da lesen wir laufend “fremder Leute” Bücher und vergessen dabei fast die Eigenwerbung. Im letzten Herbst jedenfalls brachte die Post Wolfram Knauers “Duke Ellington” , das, so die Verlagsankündigung, “den Komponisten, Pianisten und Orchesterleiter Duke Ellington als eine Integrationsfigur des Jazz” würdigt. Weiter heißt es da: “Musiker aller Epochen, aller Stilrichtungen, aller künstlerischen Ansätze scheinen sich mit seiner musikalischen Ästhetik identifizieren zu können. Knauer, Musikwissenschaftler und international bekannter Experte zum Jazz, lauscht seinen Aufnahmen, um aus ihnen heraus Ellingtons Biographie zu erzählen, den geradlinigen Weg eines Musikers, der weiß, dass seine Stärke im Zusammenfügen der vielen Stimmen seines Orchesters besteht. Anschaulich und mit Wissen auch um Ellingtons privates Umfeld und die wirtschaftlichen Zwänge im amerikanischen Musikbusiness schildert er die Gründe für ästhetische Entscheidungen des Duke und kann damit die verschiedenen Phasen seines Schaffens angemessen würdigen.”
Oder, in Knauers eigenen Worten: “Was ich in dem Buch versucht habe, war buchstäblich: in die Musik hineinzuhören und dabei immer wieder zu fragen, warum Ellington so schrieb, spielte und dachte, wie er es zu verschiedenen Zeiten seiner Karriere tat. Was führte zu den ästhetischen und musikalischen Entscheidungen, wohin führten die Experimente, an denen ihm ohrenscheinlich lag? Warum entschied er sich zu Richtungsänderungen, warum klang seine Musik in den verschiedenen Jahrzehnten seiner langen Karriere immer wieder anders, und wie sollte man sich den klanglichen Ergebnissen nähern, um fair über sie zu schreiben (oder sie zu hören)? Wie ich im Vorwort andeute, war meine Herangehensweise insofern unüblich, als ich das Ellington-Archiv an der Smithsonian Institution besuchte, bevor ich auch nur ein einziges Wort geschrieben hatte, um mir auf gut Glück Kisten kommen zu lassen in der Hoffnung, dass das darin befindliche Material mir vielleicht einige der Fragen liefern würde, die ich in meinem Buch zu beantworten beabsichtigte (schließlich kommt es einem so vor, als sei schon alles über Ellington gesagt worden). Danach begann ich mit dem intensiven Hören, fragte dabei dauernd “Warum?” und “Was?”, mehr noch als “Wer?” oder “Wann und Wo?”. Diese Fragen führten dann zu einer Kontextualisierung seiner Biographie, seines Kompositionsprozesses, dem Konzept von Komposition im Jazz ganz allgemein, seiner Interaktion mit seinen Bandmitgliedern und mit anderen Musikern, seines privaten Lebens, seiner Geschäftspraktiken und – vor allem – seiner Aufnahmen. Als das Rohmanuskript fertig war, kehrte ich ins Ellington-Archiv zurück und ließ mir diesmal ganz gezielt die Kisten kommen, vor allem jene, die seine Kompositionsskizzen oder aber die Stimmen seines Orchesters enthielten, um an ihnen zu verifizieren, was konkret in den Noten steht und wo der Zauber anfängt, der das alles zum Leben erweckt und so ungemein persönlich werden lässt. Ich glaube, dass mein Ansatz sich durchaus von dem unterscheidet, was bislang über Ellington geschrieben wurde, und ich hoffe, dass es gelegentlich eine englische Übersetzung des Buchs geben wird.”
Johannes Breckner liest das Buch für das Darmstädter Echo, Wolfgang Sandner für die FAZ, Johannes Kaiser für SWR Cluster, Johann Buddecke für Concerti. Christian Broecking, Stefan Franzen und Martin Laurentius für die Jazzthetik.
zugegeben: Eigenwerbung, dennoch: Wolfram Knauer (Juli 2018)
Um Blues und Groove. Afroamerikanische Musik im 20. Jahrhundert
von Manfred Miller
Dreieich 2017 (Song Bücherei / Heupferd Musik Verlag)
454 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-923445-18-9
 Er macht es einem nicht einfach: Ein Druckbild langer Zeilen, die viel zu weit in den Bundsteg reichen, eine Schrifttype, die entweder weitere Zeilenabstände oder aber klarere Absätze verlangen würde, lange Sätze, oft mit Nebengedanken in Parenthese oder (wie ein Unterkapitel überschrieben ist) “Kleine Nebenbemerkung zur Nebenbemerkung” (64). Ein ausschweifender Stil, in dem sich der Autor sehr wohl bewusst ist, dass es sich hier um ein Alterswerk handelt. Er weiß, dass er seinen Leser:innen etwas zumutet, wenn er sie “dem Autor beim Verfertigen seiner Gedanken zuschauen” lässt (7). Ein Stil, der laufend die Position zu wechseln scheint, mal erzählend ist, dann historisch einordnend, dann aus der Gegenwart heraus wertend, nein nicht aus der Gegenwart, sondern aus seiner, des Autoren Gegenwart, oft gespeist durch Verweise auf seine eigene Zeugenschaft, als er etwa für Rundfunk- und Fernsehdokumentationen Interviews mit den Protagonisten der Musik führte, über die er hier schreibt.
Er macht es einem nicht einfach: Ein Druckbild langer Zeilen, die viel zu weit in den Bundsteg reichen, eine Schrifttype, die entweder weitere Zeilenabstände oder aber klarere Absätze verlangen würde, lange Sätze, oft mit Nebengedanken in Parenthese oder (wie ein Unterkapitel überschrieben ist) “Kleine Nebenbemerkung zur Nebenbemerkung” (64). Ein ausschweifender Stil, in dem sich der Autor sehr wohl bewusst ist, dass es sich hier um ein Alterswerk handelt. Er weiß, dass er seinen Leser:innen etwas zumutet, wenn er sie “dem Autor beim Verfertigen seiner Gedanken zuschauen” lässt (7). Ein Stil, der laufend die Position zu wechseln scheint, mal erzählend ist, dann historisch einordnend, dann aus der Gegenwart heraus wertend, nein nicht aus der Gegenwart, sondern aus seiner, des Autoren Gegenwart, oft gespeist durch Verweise auf seine eigene Zeugenschaft, als er etwa für Rundfunk- und Fernsehdokumentationen Interviews mit den Protagonisten der Musik führte, über die er hier schreibt.
Manfred Miller gehört seit den 1960er Jahren zu den wichtigen Popularmusikforschern Deutschlands. Er leitete die Jazzredaktion in Bremen (wo er neben vielem anderen auch die legendäre LP “Machine Gun” Peter Brötzmanns ermöglichte), moderierte eine regelmäßige Bluessendung im Südwestfunk, gründete das SWF-Bluesfestival in Lahnstein, produzierte TV- und Hörfunkdokumentationen zur Rock- und Bluesgeschichte. Ihm war es dabei immer wichtig, über den Tellerrand der Genres hinauszublicken, mit denen er sich beschäftigte. So erkannte er im Blues immer auch eine Reflexion der Welt, aus der dieser kam. Denn es sei viel Unsinn verzapft worden beim Schreiben über diese Musik. So sei in Zeugnissen früher Musiker neben dem Blues immer wieder von “rihls” die Rede gewesen (in unterschiedlichen Schreibweisen), und etliche Autoren hätten darin den “reel” aus irisch-schottischer Volksmusik erkannt. “[W]ie minimal die Wahrscheinlichkeit sein mochte”, ärgert sich Miller, “dass der Interviewte jemals einen solchen Tanz oder dessen Namen gehört haben konnte, haben sie sich offenbar nicht gefragt.” Und ein leicht rechthaberischer Tonfall klingt durch, wenn er fortfährt: “Dabei, scheint mir, drängt sich die korrekte Transkription förmlich auf, nämlich ‘Reals'”. Der Blues als Beschreibung der wirklichen Welt, der Realität: auch eine Theorie, und keineswegs eine schlechte. Die Rückführung des betreffenden Begriffs auf keltische “reels” ist allerdings auch nicht so falsch, wie Miller suggeriert: Irische und schottische Kulturtraditionen waren in die “neue Welt” transferiert worden, und es ist gut möglich, dass “reel” quasi als Deonym generisch für eine bestimmte Art von Tanz(musik) verwandt wurde. Was richtig ist, weiß ich als Leser (und Nicht-Blues-Experte) auch nicht, allerdings stößt es leicht sauer auf, wenn Miller ein Zitat Little Brother Montgomerys nachschiebt, in dem dieser betont, wie wichtig das Abbild der Realität im Blues sei, um dann verächtlich zu urteilen: “Dass sie Mist verzapft haben, können unter feldforschenden Musikethnologen offenbar etliche selbst dann nicht riechen, wenn jemand sie mit der Nase hineinstößt.” (16)
Den Hauptteil seines Buchs beginnt Miller mit Platon und der Bedeutung von Musik seit der Antike. Er sinniert über die Polyphonie des Mittelalters und die Mehrchörigkeit bei Schütz und Bach, über Castrati und Countertenöre, über Gesualdos Madrigale, über Musik und Macht, genauer: Musik als Symbol von Herrschaft. Er ist sich bewusst, dass in Musik oft Erinnerung an Rituale transportiert werden, deren Funktion längst nicht mehr erinnerbar ist. Und er beschreibt, wie Musik immer im Hier und Jetzt wahrgenommen wurde, bis der Phonograph erfunden wurde und sie damit vom Ritual zur Ware werden konnte (Miller spricht von “fundamentaler Um- und Abwertung der Gebrauchswerte von Musik zu einer der gängigsten unter den angstlösenden Alltagsdrogen” [69]).
Millers zweites Kapitel befasst sich mit den musikalischen Grundlagen afro-amerikanischer Musik. Es geht um Artikulation, vor allem aber um swing. Er fragt danach, wie sich die rhythmische Komplexität in afro-amerikanischer (und afrikanischer) Musik aus unterschiedlichen Perspektiven hören lässt und beschäftigt sich mit dem Missverständnis der Synkope im Jazz. Er hinterfragt Begriffe wie Pulse, Beat und Groove und diskutiert sie anhand konkreter Aufnahmen etwa von Louis Armstrong, Art Blakey und Fats Waller. Woher kommt dieser Groove, fragt er, bemüht dann gleich noch einmal die gesamte (westliche) Musikgeschichte, fragt etwa nach dem Verhältnis zwischen Harmonik und Metrik, um schließlich (ich habe etwas vorgeblättert) bei seiner Erklärung anzulangen: Der Groove käme aus der Momenthaftigkeit der Musik, aus dem Jetzt, aus dem “Now”. Das ist durchaus einleuchtend, doch jetzt ist Miller in Fahrt. Er reflektiert über Ellingtons “It Don’t Mean a Thing”, über Aufnahmen der King Oliver Creole Jazz Band und Frankie Trumbauers, über den Wirtschaftsliberalismus Thatchers und Reagans, über Technobastler, die eine Software namens “Humanizer” entwickelt haben, über die Kontroverse zwischen Barack Obama und der “Tea Party” in den USA…. Man kommt viel rum als Leser:in, und man ist seinen Anmerkungen zum Ende der Kapitel dankbar, bei denen er sozusagen den eigenen Text noch einmal mit etwas Abstand liest und einordnet.
Als nächstes: der Blues! Genre, Gattung, Form? Um dem Wesen, nein den verschiedenen Wesen des Blues auf die Spur zu kommen, lauscht Miller zahlreichen Aufnahmen. Billie Holiday, Miles Davis, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Jabbo Smith. Er stellt die Form in Frage, sucht Beispiele heraus , die deutlich als Blues konnotiert sind, aber auf die sprichwörtlichen 12 Takte weitgehend verzichten. Dann der Einfluss der Tin Pan Alley auf die Popularisierung des Blues – Stichwort: “Blues als Tanzmusik”. Es folgen Beispiele aus dem Bereich des Country-Blues, des Chicago-Blues und des britischen Rock-Blues, die belegen, wie fließend die Form ist. Das ist gerade in der Mischung der Beispiele spannend, wenn auch etwas schwer zu lesen, insbesondere wenn wieder einmal der Unterton des Rechthabens mitschwingt, als hätten wirklich alle Autor:innen über Musik den Blues nur mit “12 Takte und traurig” beschrieben.
“Traurig” ist dann auch das nächste Klischee, das Miller zu entzaubern trachtet. Wo kommt die Zuschreibung her, fragt er, welche anderen Zuschreibungen hat der Blues über die Jahre erhalten? Dabei landet er bei Joachim Ernst Berendt und seiner Beschreibung der “Blue Notes” von 1957, die Miller als vereinfacht und eurozentristisch klassifiziert, um dann eine Art Urzustand der Blue Notes beispielsweise in einer Rede von Dr. Martin Luther King zu finden, von dem ausgehend er den Blue Notes dann vor allem eine rhetorische Funktion zuschreibt: “sie unterstreichen, sie heben hervor, was der Sängerin, dem Sänger besonders wichtig ist” (148). Er hinterfragt die autobiographische Haltung des Blues, die Rollenfigur, die der oder die Sänger/in einnimmt, und er analysiert beispielhaft, etwa den Text zum “Down Hearted Blues”, den er sich daraufhin gleich noch von verschiedenen Sängerinnen anhört. Miller ist ein exzellenter Übersetzer von Bluestexten, dazu in der Lage, auch im Deutschen den Inhalt mit dem Rhythmus des Originaltextes zu verbinden. Und er ist sich der Grenzen seiner Übersetzermöglichkeiten bewusst, die etwa dort aufhören, wo das englischsprachige Original (insbesondere das Black English des Blues) mit double entendre, mit semantischer Mehrdeutigkeit spielt, die nicht so einfach zu übertragen ist. Er diskutiert die Themen des Blues, Liebe, Tod, aber auch das Themenfeld Protz und Prahlerei (“Was hab ich mit da nur aufgehalst!”), und er schreibt darüber, wie sich in den Songs die alltägliche Gewalt und der Rassismus der USA wiederspiegeln.
Es findet sich ein anregendes Kapitel über Billie Holidays Bluesästhetik, eines über aus dem Vaudeville stammende Duos wie Butterbeans & Susie, sowie eines über Bluestexte, die es nur knapp an der Zensur vorbeigeschafft haben. Er diskutiert Aufnahmen Jelly Roll Mortons aus dessen Sitzung für die Library of Congress, bei denen der Pianist lange, schnell ins Pornographische ausartende Titel spielte und sang, und er mutmaßt, dass diese Beispiel für ein ansonsten nicht dokumentiertes Repertoire seien, das den musikalischen Feldforschern nur deshalb entgangen sei, weil sie es an die Orte, an denen es erklang (Bordelle) selten gezogen hätte.
Am Schluss seines Buchs bemüht Miller den afro-amerikanischen Philosophen Cornel West, den er mithilfe von Textauszüge in ein fiktives Interview verstrickt, um abschließend noch ein wenig Trübsal zu blasen: Leider gäbe es heute keinen aktuellen Mainstream afro-amerikanischer Musik mehr, der entsprechende “Resonanz in der großen Gemeinde der schwarzen Amerikaner” fände. Rap und HipHop hätten nicht dieselben inklusiven Merkmale wie Blues und Jazz der Vergangenheit und die “schwarze Gemeinde in Amerika” habe durch den “vom Marktliberalismus produzierte[n] Wandel des Gesellschaftlichen und der Gesellschaft” aufgehört, sich selbst als “Gemeinde” zu sehen. “Tut mir leid”, schreibt er, “Auch wenn ich hin und wieder aus klanglichen oder rhythmischen Gründen das Präsenz benutze – was ich in dieser Arbeit verhandle, ist Vergangenheit. – Jedoch: welch einmalige Vergangenheit! Musik, die ein Volk trägt!”
Er macht es einem nicht einfach, habe ich diese Rezension begonnen. Manfred Miller, der aus dem Vollen seines Wissens, seiner Hörerfahrung schöpfen kann, lässt genau dies seine Leser:innen an jeder Stelle spüren: dort, wo er mit Fakten um sich wirft, dort wo er sofort Vergleichsbeispiele aus der globalen Kulturgeschichte zur Hand hat, insbesondere auch dort, wo er seine Leser:innen direkt anspricht, ihre Einwände vorwegahnt, um dann seine Thesen näher unterlegen zu können. Der leicht verächtlich wirkende Blick herab auf Forscher:innen, Journalist:innen und andere Autor:innen (gerne auch der Verweis darauf, dass dies oder jenes doch ein gutes “Referat im Oberseminar der Musikethnologen ” sei) findet sich zuhauf in Millers Buch. Er macht es einem nicht einfach, weil all diese schriftstellerischen Tricks seine Leser eben gerade nicht mitnehmen, und weil man gerade bei einem so als Bleiwüste gestalteten Buch (dem weder die Typographie noch die Kursivschreibung Abwechslung verleihen) eigentlich keine Lust hat, dauernd als virtueller Sparringpartner herhalten zu müssen. Das aber ist schade. Denn tatsächlich hat Miller etliches zu erzählen. Tatsächlich sind seine Denkansätze ungemein spannend, wert diskutiert, weitergedacht, immer wieder auch widersprochen zu werden. Doch dazu lädt Manfred Miller nicht so recht ein mit seinem Buch, das, obwohl es weder eine Geschichte des Blues noch des Jazz ist, ein Füllhorn anregender Gedanken über afro-amerikanische Musik enthält – und die westeuropäische Rezeption derselben.
Wolfram Knauer (Juni 2020)
Träume aus dem Untergrund. Als Beatfans, Hippies und Folkfreaks Baden-Württemberg aufmischten
von Christoph Wagner
Tübingen 2017 (Silberburg-Verlag)
180 Seiten, 24,90 Euro
ISBN: 978-3-8425-2039-4
 Christoph Wagner, in Baden-Württemberg geborener und seit Jahren nahe London lebender Journalist, beschreibt die musikalische Subkultur der 1960er und 1970er Jahre in Baden-Württemberg. Zwischen Mannheim und Freiburg findet er dabei jede Menge Beispiele aus populären Genres zwischen Blues, Rock, Jazz und Folk.
Christoph Wagner, in Baden-Württemberg geborener und seit Jahren nahe London lebender Journalist, beschreibt die musikalische Subkultur der 1960er und 1970er Jahre in Baden-Württemberg. Zwischen Mannheim und Freiburg findet er dabei jede Menge Beispiele aus populären Genres zwischen Blues, Rock, Jazz und Folk.
Er blickt auf die Einflüsse, beispielsweise die lebendige Jazzszene ums Heidelberger Cave oder die Stuttgarter Atlantik-Bar, betrachtet die Aktivitäten des Südwestfunks und den Kulturschock, den Möhringer Bürger erlebten, als sie einen Musiker wie Cecil Taylor durch den Ort joggen sahen oder als sich Abdullah Ibrahim eine Bretzel in der Dorfbäckerei holte, während er in Tourneepausen bei Gabi Kleinschmidt wohnte.
Er weiß um die Beat- und Soulszene in Stuttgart, die vor allem durch einheimische Amateurgruppen befeuert wurde und oft genug auf die Eltern als Fahrdienst angewiesen war. Aber auch internationale Bands machten im Ländle Station, The Who etwa, über die der Tourneeveranstalter Walter Puls einige Geschichten zu erzählen weiß.
Joachim Ernst Berendt war einerseits für die Jazzgeschichte des Landes wichtig, schnitt aber auch Konzerte des American Folk Blues Festival mit, das seit 1962 von Horst Lippmann und Fritz Rau veranstaltet wurde. Die Bluesszene wurde Anfang der 1970er durch Clubs geprägt, die tourende amerikanische Künstler genauso engagierten wie solche, die sich wie etwa Memphis Slim oder Champion Jack Dupree in Europa niedergelassen hatten. Neben der Blues- gab es aber auch eine lebendige Folkszene, die, in Folge des legendären Waldeck-Festivals im Hunsrück “deutschen Protestsängern, Liedermachern und Kabarettisten”, aber auch englischen, schottischen und amerikanischen Folkmusiker:innen eine Bühne bot. Nicht selten stand diese in dieselben Clubs, in denen auch Jazz oder Blues zu hören war: Das Publikum hatte zu jener Zeit doch beträchtliche Schnittmengen. Folkmusik war damals zugleich ein Soundtrack zu den Anti-AKW-Protesten und den Friedensdemonstrationen jener Jahre, eine Protesthaltung, die sich erst gegen Ende der 1970er, wie Wagner schreibt, andere musikalische Formen suchte, “ob im Punk, im anarchistischen Rock oder im Sponti-Kabarett”.
Am 19. Januar 1969 trat Jimi Hendrix in der Stuttgarter Liedermacherhalle auf. Bald darauf ließen sich mit Rockmusik, insbesondere aus englischsprachigen Ländern, Hallen mittlerer Größe leicht füllen. Als Vorgruppe standen dabei oft regionale Bands auf der Bühne, in denen Musiker groß wurden, die später zwischen Jazz, Rock und Pop von sich Reden machten. Wagner skizziert die Veranstaltungsorte, an denen diese Musik zu hören waren, in den Großstädten Stuttgart, Mannheim und Freiburg genauso wie in Kleinstädten wie Schorndorf, wo in der Manufaktur Peter Brötzmann zu hören war (für 250 Mark Gage), die amerikanische Folkmusikerin Hedy West (für 220 Mark) und der Liedermacher Reinhard Mey (für 170 Mark). Wagner berichtet über zwei Black-Sabbath-Tourneen durch den Südwesten in den Jahren 1969 und 1970, oder über das Rolling-Stones-Konzert in der Messehalle 6 in Stuttgart, das 20 Mark Eintritt kosten sollte, was in der Szene für heftigen Protest und für Boykottaufrufe sorgte.
Den erfolgreichen und kommerziellen Rockshows stellten sich mit der Zeit Kulturinitiativen entgegen, die eine andere Vorstellung von Musikvermarktung hatten, insbesondere der Verein GIG, der sich die “Durchführung von Veranstaltungen zu gewinnlosen Eintrittspreisen” auf die Fahnen schrieb. Insbesondere in Tübingen und anderen Studentenstädten fanden zur selben Zeit eher links orientierte deutsche Bands wie Floh de Cologne oder Ihre Kinder Zulauf; selbst hier aber wehrte sich das studentische Publikum schon mal gegen als zu hoch empfundene Eintrittspreise, einen Diskurs zwischen Veranstalterinitiative und Publikum, den Wagner detailliert nachzeichnet. In Stuttgart hatte Werner Schretzmeier mittlerweile Kontakte zum SDR-Fernsehen geknüpft, durch die er Rockbands wie Pink Floyd, Black Sabbath und Deep Purple zu Produktionen einladen konnte. In einem letzten Kapitel befasst sich Wagner schließlich noch mit Mundartrock zwischen Joy Fleming (Neckar-Blues), Wolle Krinwanek (Schwabenrock) und der Band Schwoißfuaß.
Christoph Wagners “Träume aus dem Untergrund” bieten einen unterhaltsamen Streifzug durch eine Zeit, in der Musik mehr und mehr als ästhetischer genauso wie als politischer Ausdruck wahrgenommen wurde und dabei zwischen den Polen einer Community-bindenden Kunst und Kommerz existierte. In seinen Kapiteln gelingt es ihm, sicher auch dank der zahlreichen Abbildungen, viele Facetten dieses Lebensgefühls deutlich zu machen. Ihm geht es dabei nur bedingt um eine Beschreibung der Musik selbst; wichtiger ist ihm der Kontext, die Bildung und Selbstdefinition einer Szene also. In dieser verorteten sich in jenen Jahren auch die Jazzfans, und Wagners Darstellung der Strukturen, in denen sich Rock und Pop in diesen Jahren entwickelte, macht schnell klar, wie wichtig der weitere Blick sein kann, um Kontexte zu erklären, die letztlich auch die Entwicklung des Jazz mit beeinflussten.
Wolfram Knauer (Juni 2020)
André Hodeir. Le jazz et son double
von Pierre Fargeton
Lyon 2017 (collection Symétrie recherche)
772 Seiten, 70 Euro
ISBN: 978-2-36485-028-6
 Es ist eine mehr als passende Würdigung: ein fast 800 Seiten starkes Buch über den Kritiker, Musikwissenschaftler, Geiger und Komponisten André Hodeir, das seiner Biographie genauso gerecht zu werden versucht wie seiner Musik und seiner musikwissenschaftlichen Erkenntnisse. Pierre Fargeton ist prädestiniert für diese Aufgabe: Der Musikwissenschaftler verfasste 2006 seine Dissertation über Hodeir und arbeitet zurzeit an der Herausgabe der Korrespondenz zwischen Hugues Panassié und André Hodeir.
Es ist eine mehr als passende Würdigung: ein fast 800 Seiten starkes Buch über den Kritiker, Musikwissenschaftler, Geiger und Komponisten André Hodeir, das seiner Biographie genauso gerecht zu werden versucht wie seiner Musik und seiner musikwissenschaftlichen Erkenntnisse. Pierre Fargeton ist prädestiniert für diese Aufgabe: Der Musikwissenschaftler verfasste 2006 seine Dissertation über Hodeir und arbeitet zurzeit an der Herausgabe der Korrespondenz zwischen Hugues Panassié und André Hodeir.
Sein Buch beginnt – chronologisch – im Geburtsjahr seines Sujets 1921 und beschreibt, wie der junge André, der dem Klavierunterricht seines älteren Bruders mehr abgewinnen konnte als jener, im Alter von 11 Jahren zur Geigenausbildung aufs Konservatorium geschickt wurde, wo er bereits 1935 seine “6 Pièces de Virtuosité” komponierte. Zur selben Zeit interessierten ihn aber genauso das Tischtennisspiel, Poker und der Jazz, für den er sich begeisterte, nachdem er Benny Carter mit dem Orchester von Willie Lewis gehört hatte. Er entdeckte erst Stéphane Grappelli, dann Eddie South als role models auf seinem eigenen Instrument und lernte Charles Delaunay kennen, den Jazzkenner und Autor der Hot Discography.
Eine Lungenentzündung, wegen der er Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre lange Zeit ans Bett gefesselt war, machte dem Traum seiner Mutter ein Ende, die ihren Sohn als einen “neuen Menuhin” sah. Doch bis Ende der 1940er Jahre war Hodeir durchaus auf der Geige zu hören, im Jazzkontext meist unter dem Pseudonym Claude Laurence, unter dem er 1942 seine ersten Titel für das Label Swing aufnahm, kurz darauf außerdem Platten mit dem Gitarristen Joseph Reinhardt. Nach dem Krieg begann Hodeir seine ersten Artikel für das Magazin Jazz Hot zu schreiben, besuchte eine Analyseklasse bei Olivier Messiaen und beschäftigte sich zeitgleich mit den Aufnahmen Charlie Parkers und Dizzy Gillespies. Von 1947 bis 1951 fungierte er als Chefredakteur von Jazz Hot, eine Position, in der er mehr und mehr das Bewusstsein dafür ausbildete, dass der Jazz Vordenker braucht, die seine Struktur und Machart verstehen, ihn aber auch ästhetisch und intellektuell in die Diskurse der aktuellen Musik einordnen können.
Fargeton nennt ihn “zweisprachig”, weil Hodeir in diesen Jahren musikalisch den Jazz genauso bedienen konnte wie die zeitgenössische Musik, weil er mit Kenny Clarke genauso spielte wie er sich an Streichquartetten versuchte. Und schließlich gibt es erste Beispiele einer Vermengung der beiden Welten, etwa in Stücken wie dem 1953 eingespielte “Saint-Tropez”. Fargeton zeigt, wie sich Hodeirs analytische Beschäftigung mit dem amerikanischen Jazz auch auf seine eigene Kompositionsweise niederschlägt, etwa in der Betonung motivischer Beziehungen oder in seiner Auseinandersetzung mit formaler Gliederung seiner Musik. Es folgten Experimente mit Zwölftontechniken und die Beschäftigung mit anderen seriellen Techniken, etwa im verschworenen Kreis um den Klassiker Pierre Boulez.
1954 veröffentlichte Hodeir das Buch Hommes et problèmes du jazz, eine Sammlung bereits veröffentlichter und bislang unveröffentlichter Aufsätze, die drei Jahre später unter dem Titel Jazz: Its Evolution and Essence auch auf Englisch erscheinen und großen Einfluss auf die ernsthafte Beschäftigung mit dem Jazz haben sollte. Im selben Jahr gründete Hodeir die Jazz Groupe de Paris, ein am Miles Davis Capitol Nonet orientiertes Ensemble, das etwa zehn Jahre lang bestand und Hodeirs Third-Stream-orientierte Kompositionen, aber auch Filmmusik einspielte. Fargeton verfolgt Hodeirs Karriere, beschreibt seine Reise in die USA 1957, den Auftritt der Jazz Groupe bei den Donaueschinger Musiktagen im selben Jahr, sowie die Kooperation mit John Lewis und dem Modern Jazz Quartet, für das er drei Stücke schrieb. Wie Lewis, wie Gunther Schuller und wenige andere blieb André Hodeir dabei ein Mittler zwischen den Welten, konnte sich am Diskurs der zeitgenössischen Musik genauso beteiligen, wie er jenen im Jazz mit seinen Schriften und Stücken selbst mitbestimmte.
1964 wandte sich Hodeir Stücken für größeres Ensemble zu, schrieb für Bigband oder Goßensemble ungewöhnlicherer Besetzung. Zu letzterer gehört insbesondere “Anna Liva Plurabelle”, eine durchkomponierte Jazzkantate über Texte aus James Joyces Finnegans Wake. Mit dem Free Jazz hatte Hodeir weniger am Hut, was ihm Kritik jüngerer Autorenkollegen einbrachte. 1970 brachte Hodeir Les Mondes du Jazz heraus, ein Buch, das einerseits literarischer gefasst ist, anderseits weniger konkrete musikalische als vielmehr ästhetische Themen im Zentrum hat. In den nächsten Jahren zog sich Hodeir weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, forschte am Pariser IRCAM, schrieb Romane, und trat höchstens auf Anregung des Pianisten Martial Solal, für den er in den 1960er Jahren immer wieder geschrieben hatte, für einige Konzerte wieder auf die Bühne. 1992 wurde “Anna Livia Plurabelle” wieder aufgeführt, in Brest, Wien und Paris und schließlich unter Leitung des Bassisten Patrice Caratini auch auf Platte aufgenommen.
Im zweiten Teil seines Buchs analysiert Fargeton die musikalische Sprache André Hodeirs, fragt nach Klangfarbenmelodie, -rhythmus und -melodie, Kompositionstechniken, Individualisierung der Töne, nach Textur und Kontrapunkt in seiner Musik, um dann im dritten Teil die Form in Hodeirs Werk unter die Lupe zu nehmen, das Variationsprinzip, sowie die simulierte Improvisation.
Pierre Fargetons Buch ist ohne Zweifel ein Standardwerk zu Leben und Werk André Hodeirs. Insbesondere in den analytischen Passagen, die etwa die Hälfte des Buchs ausmachen, bietet es zeitweilig etwas sperrige Lektüre (was vielleicht auch nicht anders zu erwarten ist). Im biographischen Teil lässt er vor allem die Rezeption ein wenig beiseite, die ja weit über Frankreich hinaus ging. John Gennari hat beispielsweise darauf hingewiesen, wie wichtig Jazz: Its Evolution and Essence für den US-amerikanischen Jazzdiskurs der 1960er Jahre wurde, wo Autoren, egal ob sie ihn umarmten (Martin Williams) oder eher ablehnten (Dan Morgenstern, Whitney Balliett), sich auf jeden Fall zu ihm zu verhalten hatten. Eine solche Diskussion der Auswirkungen seines Denkens und Schreibens, die beispielsweise auch den britischen Autor Eric Hobsbawm oder den deutschen Kritiker Joachim Ernst Berendt mit einzubeziehen hätte, wäre eine sinnvolle Ergänzung. Und wenn auch das Thema des Third Stream sowohl im biographischen wie auch im analytischen Teil des Buchs immer wieder angerissen wird, wäre auch hier eine weiterführende Einordnung der Folgen wünschenswert, in Hodeirs Fall insbesondere auf das Umfeld von Jazzmusikern (Michel Portal beispielsweise), die ähnlich wie er “bi-lingual” unterwegs waren, also einen Fuß in der Jazztradition hatten, sich aber genauso in der Welt der Zeitgenössischen Musik zuhause fühlten. Doch hätten solche Ergänzungen wohl dazu geführt, das ohnedies dicke Buch auf über 1000 Seiten anschwellen zu lassen.
Es bleibt abzuwarten, was die Korrespondenz zwischen Hugues Panassié und André Hodeir an ästhetischen Streits enthält, an der Fargeton zur Zeit als Herausgeber arbeitet. André Hodeir. Le jazz et son double immerhin ist eine mehr als angemessene und ausgesprochen gelungene Würdigung des Multitalents. In seinem Vorwort schreibt Martial Solal, all die verschiedenen Seiten Hodeirs seien untrennbar miteinander verbunden gewesen. Er habe ihm immer den größten Respekt entgegengebracht, und Bewunderung empfunden für seinen Humor und seine Feinsinnigkeit, die sich denen, die ihn gut kannten, mitteilte. Nun, zumindest letztere Elemente sind durchaus auch in seiner Musik deutlich zu spüren, und durch Fargetons Buch kommen auch wir Leser dem Phänomen André Hodeirs ein wenig näher.
Wolfram Knauer (Januar 2020)
Sonor in Weissenfels, 1875-1950
Von Klaus Ruple
Weißenfels 2017 (Arps Verlag Weißenfels)
240 Seiten, 28 Euro
ISBN: 978-3-936341-30-0
 Das Schlagzeug-Drumset entwickelte sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und ermöglichte Perkussionsvirtuosen die Bedienung mehrerer Trommeln zur gleichen Zeit. Vor allem die Erfindung des Bass-Drum-Pedals förderte die erfolgreiche Vermarktung eines kompletten Drumsets, das spätestens mit der Aufnahme der ersten Jazzaufnahmen weitgehend komplett war. Trommeln gab es in allen Kulturen, Trommelfabriken bald überall in der westlichen Welt. Klaus Ruple hat nun quasi die Biographie einer dieser Firmen geschrieben, Sonor, gegründet vom Drechsler und Weißgerber Johannes Link in Weißenfels an der Saale und bis heute ein Name im Instrumentenbau.
Das Schlagzeug-Drumset entwickelte sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und ermöglichte Perkussionsvirtuosen die Bedienung mehrerer Trommeln zur gleichen Zeit. Vor allem die Erfindung des Bass-Drum-Pedals förderte die erfolgreiche Vermarktung eines kompletten Drumsets, das spätestens mit der Aufnahme der ersten Jazzaufnahmen weitgehend komplett war. Trommeln gab es in allen Kulturen, Trommelfabriken bald überall in der westlichen Welt. Klaus Ruple hat nun quasi die Biographie einer dieser Firmen geschrieben, Sonor, gegründet vom Drechsler und Weißgerber Johannes Link in Weißenfels an der Saale und bis heute ein Name im Instrumentenbau.
Ruple beginnt mit einer üblichen Handwerkergeschichte des 19. Jahrhunderts, erzählt, wie der auf der Schwäbischen Alb geborene Johannes Link 1875 nach den damals üblichen Jahren der Wanderschaft im sachsen-anhaltinischen Weißenfels eine Trommelfabrik für die Fertigung von Militärtrommeln gründete. Er beschreibt handwerkliche Prozesse der Zeit, insbesondere das Gerben der Kalbs- oder Ziegenfelle, und findet in der Buchhaltung der Firma Hinweise auf die laufende Expansion: mehr Aufträge, mehr Angestellte, eine größere Produktpalette. Im Jahr 1900 beschäftigte die Firma bereits 50 Mitarbeiter, und 1907 wurde aus der “Ersten Trommelfabrik Weißenfels” die Firma “Sonor” mit den Geschäftsbereichen “Herstellung und Vertrieb von Schlaginstrumenten und Spielwaren: Trommeln, Pauken, Trommelfelle, Schlaginstrumente aller Art und deren Bestandteile, Kindertrommeln, Ballschläger und Tischtennisschläger”. Militäraufträge lasteten die Firma bis 1914 gut aus, die sich immer mehr erweiterte und im Februar 1914 einen Fabrikneubau auf einem größeren Grundstück plante, der allerdings durch den Ersten Weltkrieg verhindert wurde.
Ein eigenes Kapitel widmet Ruple der Trommelproduktion für den “Großen Krieg”, der Sonor Produktionszuwächse sicherte, die auch nach Kriegsende nicht nachließen. Nach einem Brand der alten Fabrik baute die Firma an einem neuen Standort, einer ehemaligen Badeanstalt, die Ende des 19. Jahrhunderts von einer Brauerei aufgekauft und zu einem großes Gesellschaftshaus umgenutzt worden war. 1925 beschäftigte Sonor 145 Mitarbeiter in der nunmehr vollends vom Handwerksbetrieb zu industrieller Fertigung gewachsenen Fabrik, die in ihren Verkaufsräumen auch historische Schlaginstrumente vom Dreißigjährigen Krieg bis in die Gegenwart ausstellte. Zum 50-jährige Jubiläum, das der 1914 verstorbene Firmengründer nicht mehr miterlebt, spielte paradoxerweise ein Streichquartett; Sohn Otto und Stiefsohn Max Straubel führten forthin die Geschäfte weiter. Militärinstrumente traten immer mehr in den Hintergrund, stattdessen warb die Firma ab Mitte der 1920er Jahre für die “Eigene Fabrikation von Schlag-Instrumenten jeder Art, Trommelfellen, Banjos, Jazz-Schlagzeugen”. Für eine Weile war Sonor Weltmarktführer bei der Herstellung und Verarbeitung von Fellen, entwickelte daneben immer neue Verbesserungen von Trommeln, Mechanik, Pedalen und Hängesystemen für das Drumset. Einige dieser Lösungen wurden auch von anderen Herstellen übernommen, wie Ruple andeutet, wenn er zumindest Ähnlichkeiten in Design, Ausführung und Verkaufsprogrammen der Firmen erkennt.
1930 reiste Otto Link in die Vereinigten Staaten, um mögliche neue Kunden für seine Produkte zu finden; hatte bald aber auch zuhause wieder große Aufträge, obwohl die Rohstoffversorgung zusehends schwieriger wurde. Insbesondere Eisen und Messing wurden ab 1937 kontingentiert, so dass Sonor insbesondere eine Reihe an Auslandsaufträgen verlor, die stattdessen in die Tschechoslowakei oder nach England gingen. “Den wirtschaftlich und politisch schweren Jahren folgt der Zweite Weltkrieg mit Inflation und Kriegswirren”, formuliert Ruple und fährt fort: “Mit Link-Trommeln marschieren die Deutschen nach Polen, Frankreich, Russland und zahlreiche andere europäische bzw. gar afrikanische Länder ein.” Bis Ende des Krieges produzierte Sonor einerseits Marschtrommeln für Reichsheer, Luftwaffe, Hitlerjugend und Polizei, wurde aber auch “in die direkte Kriegsproduktion einbezogen, wie Ruple (jetzt etwas weniger konkret) schreibt, “fertigte u.a. für die Junkers Werke in Dessau und Merseburg”. 1945 wird die Firmenbezeichnung von “Trommelfabrik” gar in “Herstellung von Kriegsgerät” umbenannt.
Nach dem Krieg flüchtete Otto Links Sohn Horst nach Aue, einen Ortsteil von Bad Berleburg, die Weißenfelser Fabrik, die bei einem Bombenangriff 1944 keinen Schaden nahm, stellte die Produktion währenddessen um auf “Autoumbauten, Herstellung kleiner Kohlenschaufeln und Messer aus Kriegsmaterial, Tische, Wandtafeln für Schulen, Rollwagen aus Abfallholz”. In Aue/Westfalen begann Horst Link mit kleinen Mitteln wieder die Trommelherstellung, während Otto Link im Weißenfels 1948/49 einen Großauftrag über 5000 Trommeln und 1000 Holzkoffer für die Rote Armee an Land zog. Am 7. Oktober wurde die DDR gegründet, und nachdem Links Firma anfänglich noch ins Handelsregister aufgenommen wurde, erfolgte im Jahr darauf schrittweise die Enteignung, verbunden mit der Androhung einer Anklage gegen Link wegen “Wirtschaftsverbrechen”. Otto Link floh in den Westen; die Weißenburger Firma ging in Volkseigentum über. In den 1950er Jahren, die Ruple nur noch am Rande streift, wurde Sonor dann zu einer wichtigen Marke im Jazzbereich, gespielt von Musikern wie Kenny Clarke, Connie Kay, Roy Haynes, Karl Sanner oder Teddy Paris.
Klaus Ruple endet sein Buch mit einer knapp gehaltenen “Fotostory”, die bis in die Gegenwart führt, zeigt Fabrikräume, neue Produkte und Sonor-Künstler aus unterschiedlichen Stilbereichen. Er besucht den Ort der ersten Weißenfelder Fabrik, die wegen Baufälligkeit 2011 abgerissen werden musste, und das ehemalige Bad, das 2015 von von einem kanadischen Investor gekauft wurde, der, wie man zuletzt hörte, plant, daraus wieder ein Kulturzentrum mit Hotel und Ballsaal zu machen. Auch in der DDR wurde in der VEB Trommelfabrik Weißenfels weiterproduziert, erzählt er, die noch bis zur Wende Instrumente der Marken Tacton und Trowa herstellte, dann aber abgewickelt wurde.
Der Buchtitel “Sonor in Weissenfels” ist viel zu nüchtern für eine so reich gestaltete Dokumentation, die akribisch in die Bücher schaut, viele der zahlreichen Abbildungen genau erklärt, und zwar sowohl Fotos über den Ort der Produktion, über die Instrumente selbst oder über die Familiengeschichte. Bei alledem gelingt es Ruple, die wechselvolle Geschichte einer Fabrik lebendig werden zu lassen, die von der Militärtrommel zum Jazzschlagzeug die Musik des 20sten Jahrhunderts begleitete.
Wolfram Knauer (Juli 2018)
Downtown Düsseldorf. Jazz am Rhein
von Peter K. Kirchhof
Düsseldorf 2017 (Droste Verlag)
176 Seiten, 25 Euro
ISBN: 978-3-7700-2027-0
 Mit einer Dokumentation der Düsseldorfer Jazzgeschichte schließt sich Peter Kirchhof ähnlichen Lokalgeschichten für andere Städte an. Die Zeit bis 1945 wird handelt er darin auf knapp zehn Seiten ab, bevor er die Nachkriegsszene beschreibt zwischen Dixieland, Deutschem Amateur Jazzfestival, der Nähe zur Jazz- und Hochschulstadt Köln, Spielorten wie dem New Orleans, dem Jazz Cap oder dem Dum Dum, Workshops, und Tourneekonzerten internationaler Stars und vielem mehr. Einen besonderen Schwerpunkt legt Kirchhof auf den 1966 eröffneten Club Downtown, das mit Unterbrechungen bis Ende der 1980er Jahre bestand.
Mit einer Dokumentation der Düsseldorfer Jazzgeschichte schließt sich Peter Kirchhof ähnlichen Lokalgeschichten für andere Städte an. Die Zeit bis 1945 wird handelt er darin auf knapp zehn Seiten ab, bevor er die Nachkriegsszene beschreibt zwischen Dixieland, Deutschem Amateur Jazzfestival, der Nähe zur Jazz- und Hochschulstadt Köln, Spielorten wie dem New Orleans, dem Jazz Cap oder dem Dum Dum, Workshops, und Tourneekonzerten internationaler Stars und vielem mehr. Einen besonderen Schwerpunkt legt Kirchhof auf den 1966 eröffneten Club Downtown, das mit Unterbrechungen bis Ende der 1980er Jahre bestand.
“Downtown Düsseldorf” hält minutiös die Entwicklungen der lokalen Szene fest, nennt Akteure wie Wilton Gaynair, Peter Weiss oder Wolf Doldinger, weiß um die Vernetzung in andere Jazzregionen Nordrhein-Westfalens und um Versuche, das von viel ehrenamtlicher Arbeit getragene städtische Jazzleben den neuesten Entwicklungen und der Stadtkultur anzupassen. Kirchhof bebildert das alles mit historischen Dokumente, Anzeigen, Plakaten, Zeitungsausrissen, vor allem aber mit Fotos des Düsseldorfer Fotografen Hans Harzheim, der nicht nur die Szene in seiner Stadt seit den 1950er Jahren mit der Kamera begleitet hatte.
Alles in allem: eine zu lobende Lokalgeschichte des Jazz, die sich der Vollständigkeit halber allerdings manchmal ein wenig zu sehr im Detail verliert und dabei die Lesbarkeit etwas außer Acht lässt. Ein Musikerregister schließt das Buch ab.
Wolfram Knauer (Juli 2018)
Experiencing Bessie Smith. A Listener’s Companion
von John Clark
Lanham/MD 2017 (Rowman & Littlefield)
187 Seiten, 40 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4340-8
 Anders als die Welt der Bigbands, der Jeff Sultanof seinen Listeners’ Companion gewidmet hat und deren viele Facetten fast zu umfangreich für das Konzept der Buchreihe sind, anders auch als Chick Corea, dessen Aufnahmen Monika Herzig in ihrem Band abhandelte, das aber bis in die Gegenwart reicht, handelt es sich beim Untersuchungsgegenstand, den John Clark sich für diesen Band vorgenommen hat, um ein abgeschlossenes Oeuvre, um Aufnahmen der Bluessängerin Bessie Smith zwischen 1923 und 1933. Clark interessiert dabei, wie Bessie Smiths zu einer Zeit aktiv war, als weder die Genres Jazz oder Blues vollständig ausgebildet waren, als Künstler in populären Genres immer auch Teil eines größeren Programms auf Varietébühnen waren, als sich das alles schließlich erst langsam als ein großes, umfassendes, kommerziell interessantes und zugleich kulturelle Identität beschreibendes Geschäft erwies.
Anders als die Welt der Bigbands, der Jeff Sultanof seinen Listeners’ Companion gewidmet hat und deren viele Facetten fast zu umfangreich für das Konzept der Buchreihe sind, anders auch als Chick Corea, dessen Aufnahmen Monika Herzig in ihrem Band abhandelte, das aber bis in die Gegenwart reicht, handelt es sich beim Untersuchungsgegenstand, den John Clark sich für diesen Band vorgenommen hat, um ein abgeschlossenes Oeuvre, um Aufnahmen der Bluessängerin Bessie Smith zwischen 1923 und 1933. Clark interessiert dabei, wie Bessie Smiths zu einer Zeit aktiv war, als weder die Genres Jazz oder Blues vollständig ausgebildet waren, als Künstler in populären Genres immer auch Teil eines größeren Programms auf Varietébühnen waren, als sich das alles schließlich erst langsam als ein großes, umfassendes, kommerziell interessantes und zugleich kulturelle Identität beschreibendes Geschäft erwies.
Clark beginnt mit einer Beschreibung des Unterhaltungsangebots für Afro-Amerikaner zu Beginn des I. Weltkriegs, beschreibt das Format der Tent Shows, die Tradition des Blues und die ersten Beispiele dafür, wie dieser seinen Weg in die populäre Musik fand. Er erklärt, wie sich eine Art “classic blues” herausbildete und wie sich in einer der ersten Aufnahmen des Genres in Mamie Smiths “Crazy Blues” Einflüsse aus Vaudeville, Ragtime und Tin Pan Alley mischten. Der Erfolg dieser Aufnahme brachte eine ganze Industrie zum Leben, und Clark nennt Beispiele, von denen viele aus der Talentschmiede des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und Plattenproduzenten Clarence Williams stammten. Trixie Smith, Alberta Hunter, Ma Rainey und Ethel Waters fanden jeweils ihren eigenen Stil in der Gemengelage eines noch nicht völlig ausgebildeten Genres, und in seiner Besprechung einzelner Aufnahmen dieser Sängerinnen deutet Clark bereits an, was an Bessie Smith so besonders war.
Er beschreibt das mögliche Repertoire zwischen populären Blues-Hits etwa aus der Feder von W.C. Handy, und schlüpfrig-doppeldeutigen Texten. Er beleuchtet Titel wie “Alexander’s Ragtime Band”, den “Yellow Dog Blues”, den Einfluss der Gospelmusik in “Moan You Moaners”, und die Zielgerichtetheit der Texte auf ein afro-amerikanisches Publikum anhand “Mama’s Got the Blues”. Er erklärt das Konzept der auf den afro-amerikanischen Markt ausgerichteten “race records” und weiß zu berichten, dass auch eine Sängerin wie Bessie Smith erst Testaufnahmen vorlegen musste, bevor sie einen Vertrag mit einer Plattenfirma erhielt. Seine Höranalysen fokussieren sich mal auf musikalische Besonderheiten, Smiths’ Art der Tonbeugung etwa, ihre Stimmqualität, ihren Sound, mal auf den Text und darauf, welche Konnotationen dieser in den 1920er Jahren gehabt hatte. Er stellt fest, dass allein im ersten Jahr ihres Aufnahmeschaffens sie ganz unterschiedliche Begleitbands hatte, von Jazzensembles bis zu eher folk-orientierten Besetzungen mit Mandoline oder mit Harmonika, Gitarre und Kazoo. In den Aufnahmen nach 1924 erkennt er, wie sich ein ganz eigener Stil herausschält, urbaner, stärker von Jazz durchdrungen, und zwar nicht nur, wenn Fletcher Henderson, Charlie Green oder Louis Armstrong mit von der Partie sind. Clark sucht für all diese Besetzungsformate erhellende Aufnahmen heraus, in denen er Einflüsse auf die verschiedenen Beteiligten genauso erklärt wie das, was da zwischen Solostimme und Begleitung musikalisch geschieht und welche Wirkung es auf die Musik als solche hat.
1927, schreibt Clark, war Bessie Smith eine der am höchsten bezahlten schwarzen Entertainer der Welt. Er beschreibt den Einfluss des Erfolgs auf ihr Schaffen und hinterfragt die Erinnerungen ihrer Nichte Ruby Walker, aus er wir viel über Smiths’ Privatleben und den professionellen Druck auf sie wissen. Er befasst sich ausführlich mit den Aufnahmen, die Bessie Smith mit James P. Johnson machte, konzentriert sich auch hier abwechselnd auf die Musik, das Zusammenspiel zwischen Stride-Piano und expressivem Gesang, und die Texte, in denen schon mal in einer Zeile biblische Zitate und überdeutliche sexuelle Andeutungen kombiniert werden. Er macht den Leser immer wieder auf die Formgestalt der Stücke aufmerksam oder auf Unterschiede im musikalischen Ansatz etwa von Tommy Ladnier im Vergleich zum früheren Armstrong.
Clark erklärt, dass die Plattenindustrie in den 1920er und frühen 1930er Jahren höchstens ein Zusatzeinkommen, vor allem aber eine Art Werbung für Liveauftritte waren, die immer noch den Hauptteil des Einkommens von Musikern ausmachten. Er diskutiert, warum Aufnahmen nach 1928 von vielen als weit unter Smiths Niveau gehandelt werden, erklärt, dass dies insbesondere an den Begleitbands gelegen habe, die nicht immer auf dem Level der Sängerin waren. Zwischendurch streut er Informationen über Smiths Privatleben genauso ein wie einen Exkurs darüber, welche Rolle die Sängerin wohl bei der Komposition ihrer Songs gespielt habe. 1931 endete Bessie Smiths Vertrag mit Columbia Records, und zwei Jahre später machte sie letzte Aufnahmen für den Produzenten John Hammond, der ihr dazu eine Band mit Frankie Newton, Chu Berry, Jack Teagarden und Benny Goodman zur Seite stellte. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Film “St. Louis Blues” von 1929, und ein letztes Kapitel dem Einfluss Bessie Smiths’ auf nachfolgende Generationen, wobei Clark Sängerinen aus dem Bluesbereich diskutiert wie Ruby Walker, Mildred Bailey und Dinah Washington, andere aus dem Jazzbereich wie Connee Boswell und Billie Holiday, sowie spätere von Bessie Smith beeinflusste Sänger/innen wie Mahalia Jackson. Jimmy Rushing, Big Joe Turner, Bob Wills, Nina Simone und Janis Joplin. Eine kommentierte Bibliographie, eine Diskographie mit kompletter Besetzungsnennung der verschiedenen Bands und ein Index runden das Buch ab.
John Clarks Buch ist als Höreinführung angelegt, letzten Endes aber weit mehr als das. Zwischen den Erklärungen zu den Titeln gelingt es ihm, den urbanen Vaudeville-Blues der 1920er Jahre musikalisch genauso einzuordnen wie in seiner kommerziellen Verwertbarkeit, erzählt er von ästhetischen Wegscheiden, an denen viele der Musiker beteiligt waren, die auf Bessie Smiths Aufnahmen zu hören sind. Er weiß die Musik dabei nicht nur aus der historischen Perspektive zu hören, sondern fordert seine Leser auf, sich die Avanciertheit dieses Genres vor Augen zu halten, die Tatsache, dass sich diese Art von Musik ja quasi parallel zu den Aufnahmen erst entwickelte und als eigenständiges Genre ausbildete. Das alles mischt er auf eine Art und Weise, dass die Lektüre an keiner Stelle langweilig wird und man sehr gerne auch die wertenden Passagen seines Buchs am eigenen Höreindruck überprüft.
Wolfram Knauer (März 2018)
Experiencing Chick Corea. A Listener’s Companion
von Monika Herzig
Lanham/MD 2017 (Rowman & Littlefield)
139 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4468-9
 Monika Herzig, selbst Pianistin und Pädagogin, hat für die Reihe der Listening Companions das Kapitel “Chick Corea” übernommen. Im Vorwort erinnert sie sich ihr eigenes erstes Livekonzert mit dem Pianisten, dass sie in Tübingen erlebte, und an viele andere Konzerte, die sie besuchte, nachdem sie sich in den Vereinigten Staaten niedergelassen hatte.
Monika Herzig, selbst Pianistin und Pädagogin, hat für die Reihe der Listening Companions das Kapitel “Chick Corea” übernommen. Im Vorwort erinnert sie sich ihr eigenes erstes Livekonzert mit dem Pianisten, dass sie in Tübingen erlebte, und an viele andere Konzerte, die sie besuchte, nachdem sie sich in den Vereinigten Staaten niedergelassen hatte.
Herzig beginnt ihr Buch mit einem Schnelldurchlauf durch die Geschichte des Klaviers im Jazz von den Anfängen bis zu Bud Powell und Thelonious Monk. Eine Timeline bietet eine Übersicht über Lebens- und Karrieredaten Chick Coreas von seiner Geburt 1941 bis ins Jahr 2017. Den Hauptteil des Buchs aber macht wie in den anderen Bänden der Reihe auch hier das gelenkte Hören aus, für das Herzig Aufnahmen aus allen Schaffensperioden auswählt, die sie eingehend beschreibt, indem sie die technischen Details kontextualisiert, also etwa auf Einflüsse, aktuelle musikalische Diskurse zur Zeit der Aufnahme oder auf die spezifische Besetzung hinweist. Sie bedient sich Aufnahmen aus Coreas gesamten Diskographie, in denen Besonderheiten seines Stils besonders gut darzustellen sind, und beschränkt sich dabei auch nicht nur auf solche, die unter seinem Namen herauskamen, sondern diskutiert auch Aufnahmen etwa mit Blue Mitchell oder Miles Davis.
Herzig widmet sich seinen akustischen Bands genauso wie den elektronischen Besetzungen, Duo-Aufnahmen etwa mit Gary Burton, Herbie Hancock, Bobby McFerrin oder Hiromi Uehara. Obwohl die Kapitel grob chronologisch angelegt sind, nimmt sie sich dabei die Freiheit, in einem Abschnitt wie “Playing with Friends” auch gleich bis in die Gegenwart zu gehen, weil es eben Sinn macht, diese Aufnahmen, die einen ähnlichen Kontext besitzen, auch zusammen zu betrachten.
Sie diskutiert den stilistischen und ästhetischen Wandel der Jahrzehnte und Coreas Reaktion etwa darauf, dass Jazz in den 1980er Jahren immer mehr zu einer Konzertmusik wurde, es zugleich auch ein steigendes Interesse an akustischen Besetzungen gab. Zwischendurch streut sie immer wieder Zitate des Pianisten ein, die zeigen, dass die stilistischen Richtungswechsel bewusste Entscheidungen waren und eine deutliche Reaktion auf die ästhetischen Diskurse seiner Zeit. Ein eigenes Kapitel (“Back to Electric”) widmet sich Coreas Auseinandersetzung mit dem technischen Fortschritt, mit seiner Verwendung elektrischer und elektronischer Instrumente und Hilfsmittel; ein weiteres Kapitel (“So Many Things to Do”) dem Wandel der Musikindustrie im neuen Jahrtausend, in dem erst Filesharing, dann Downloads zum neuen Distributionsmittel wurden. Dieses Kapitel enthält außerdem eine Diskussion von 24 Aufnahmen aus den Jahren 2001 bis 2015, die zeigen soll, wie es Chick Corea in dieser jüngsten Phase seiner Karriere gelang, die verschiedenen Ausprägungen seines Stils weiterzuentwickeln. Notiz am Rande: Im Kapitel über Chick Coreas Avantgarde-Trio Circle in der ersten Hälfte des Buchs gibt es auch einen kurzen Exkurs über die Zugehörigkeit des Pianisten zur Church of Scientology und seinen Rechtsstreit mit deutschen Behörden, als das Land Baden-Württemberg entschied, dass mit öffentlichen Geldern keine Veranstaltungen gefördert werden dürften, die mit Scientology in Verbindung stünden. Eine Diskographie, ein Literaturverzeichnis und ein Register schließen das Buch ab.
Monika Herzig gelingt es in ihrem Listener’s Companion, dem Leser genügend Zusatzwissen mit auf den Weg zu geben, um in der Musik Chick Coreas Verbindungen zu musikalischen und ästhetischen Entwicklungen des Jazz von den 1960er Jahren bis heute zu erkennen. Ihre analytischen Annäherungen an seine Aufnahmen sind beschreibend, dabei aber eingehend genug, um sowohl den Laien wie auch den Experten auf Kontexte aufmerksam zu machen, die zum vertieften Nochmal-Hören anregen.
Nehmen wir ein Beispiel: Sie beschreibt den Verlauf von “Chick’s Tune” von 1964 und ordnet dieses Stück gleich als letzten Titel der Aufnahmesitzung ein, für den die Musiker einen Wechsel der musikalischen Textur für ganz sinnvoll erachten. Sie beschreibt, wie das Latin-Thema erklingt, man darunter aber eine bekannte Akkordprogression erkennen kann, verweist auf die Tradition seit dem Bebop, neue Themen über altbekannte Harmonien zu schreiben, und verrät schließlich – im Idealfall hat der Leser sich das Thema jetzt bereits wiederholt angehört –, dass es sich dabei um “You Stepped Out of a Dream” handelt. Als “fun fact” ergänzt sie, dass diese Komposition im Geburtsjahr Coreas populär wurde, nachdem sie im Film “Ziegfeld Girl” mit Judy Garland und Lana Turner gezeigt wurde, weist dann auf die für Standards eher unübliche Harmonik des Stücks hin und darauf, was Corea damit melodisch anfängt. Sie beschreibt nicht nur sein Solo, sondern betont zugleich, dass es damals durchaus nicht selbstverständlich war, dass ein Klavier- und nicht ein Bläsersolo dem Thema folgt, hat dann noch ein paar Anmerkungen zur üblichen Dramaturgie solcher Titel, und dazu, wieso diese Aufnahme der perfekte Schluss für die Platte sein könnte. Nach ähnlichem Muster geht sie auch die anderen Aufnahmen an, die sie beschreibt: Von der Großform zu Details, immer darauf bedacht, diese aus der Jazzgeschichte heraus zu erklären und zu kontextualisieren.
Monika Herzig gelingt dabei mit ihrem Buch mehr als eine Anleitung zum Hören der Musik von Chick Corea. “Experiencing Chick Corea” ist nicht nur ein Buch für Laien, wenn es diese auch an keiner Stelle abschreckt. Herzig nämlich gelingt die perfekte Balance der musikalischen Erklärung und Kontextualisierung der von ihr ausgesuchten Aufnahmen genauso wie der musikalischen Karriere Chick Coreas. Last not least ist das alles auch noch gut lesbar, überzeugend gruppiert und macht – immer noch das größte Lob für Literatur zur Musik – Lust auf eingehenderes Nachhören.
Wolfram Knauer (März 2018)
Experiencing Big Band Jazz. A Listener’s Companion
von Jeff Sultanof
Lanham/MD 2017 (Rowman & Littlefield)
207 Seiten, 38 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4242-5
 Die Reihe “A Listener’s Companion” will musikalischen Laien das Werk einzelner Künstler oder ganzer Genres näherbringen. Der Fokus liegt dabei auf der Musik; Ziel ist es, den Leser zum gezielten, aufmerksamen Lauschen zu verleiten. Es geht also weder um eine tiefe musikalische Analyse, noch sind die Bände als Biographien oder Stilgeschichten zu lesen. Stattdessen sollen sie genau das sein, was der Untertitel andeutet: Begleiter beim aufmerksamen Zuhören.
Die Reihe “A Listener’s Companion” will musikalischen Laien das Werk einzelner Künstler oder ganzer Genres näherbringen. Der Fokus liegt dabei auf der Musik; Ziel ist es, den Leser zum gezielten, aufmerksamen Lauschen zu verleiten. Es geht also weder um eine tiefe musikalische Analyse, noch sind die Bände als Biographien oder Stilgeschichten zu lesen. Stattdessen sollen sie genau das sein, was der Untertitel andeutet: Begleiter beim aufmerksamen Zuhören.
Der Komponist, Arrangeur und Musikhistoriker Jeff Sultanof hat die Aufgabe übernommen, einen Bereich des Jazz abzudecken, der von den Anfängen bis in die Gegenwart immer neue Ausprägungen erfahren hat: den Bigband-Jazz. Er beginnt sein Buch mit einer Timeline, in der europäische Walzerorchester und Ragtimebands als Vorläufer ebenso enthalten sind wie die klassische Bigbands der Swingära und spätere modernere Besetzungen. Kurz handelt er die üblichen Formate und gängigen Formmodelle des Genres ab; dann geht es auch gleich los¬:
Sultanof beginnt mit James Reese Europe und Art Hickman, er erwähnt all die erwartbaren Größen des Metiers, Henderson, Ellington, Goodman, Basie, aber auch Beispiele, die eher Eingeweihten bekannt sein dürften, Red Norvo, Don Redman, Ray McKinley. Neben den Swingbands handelt er auch jene des modernen Jazz ab, also Dizzy Gillespie, Gil Evans, Gerry Mulligan, Thad Jones, und kommt mit Maria Schneider oder der Mingus Big Band bis in die Gegenwart.
Seine kurzen Höranalysen verweisen auf Besetzungsänderungen, Soli, auf bestimmte rhythmische oder harmonische Facetten. In diesen versteht er sich als “tour guide”, als Stadtführer durch eine Region, die er besonders gut kennt. Er macht auf Besonderheiten aufmerksam, erklärt Kontexte, weist darauf hin, woher bestimmte Entwicklungen kommen oder wohin andere gehen. Und er hält auch mit dem eigenen Enthusiasmus nicht hinterm Berg, wenn er insbesondere einzelne Soli lobend heraushebt. Immer wieder verweist er auf den Hintergrund, auf die Tricks, mit denen Arrangeure aus der Zusammenstellung bestimmter Instrumente besondere Klänge erzeugen.
Ab und an fühlt man sich dabei an Fußballreportagen erinnert. Ein zufällig herausgegriffenes Beispiel: “Nach einer Einleitung”, lautet etwa Sultanofs Tour durch Shorty Rogers’ Version von “Topsy”, “spielen Tenor- und Baritonsaxophone den A-Teil der Melodie (0:14); der B-Teil wird von der ganzen Band übernommen (0:41). Rogers soliert mit einfachem Dämpfer (1:08), und Herb Geller spielt ein Solo auf dem Altsaxophon (1:36). Die ganze Band spielt bis zum Solo des Tenorsaxophonisten Jimmy Giuffre (2:19). Marty Paich spielt ein Klaviersolo (2:32), und dann erklingt die Melodie wieder in den Saxophonen (2:46). Die Einleitung wird wiederholt und schließt mit einem gehaltenen Akkord am Ende.” Hier wie anderswo gibt Sultanof dem unerfahrenen Hörer die Chance Strukturen zu erkennen und musikalische Entwicklungen nachzuvollziehen. Nun gut, meint der Jazzkenner, das meiste davon hört man doch eh, warum also noch extra darauf hinweisen? Und tatsächlich wäre es vielleicht genauso interessant gewesen zu erklären, warum sich jemand wie Rogers ausgerechnet die Basie-Band zum Vorbild nimmt, dass das Thema des Anfangs sehr bewusst in einem ruhigen Unisono gehalten ist, während die Bridge dem genauso bewusst komplexere Harmonien entgegensetzt, als die Basie-Band sie je gespielt hätte. Vielleicht wäre ein Hinweis darauf ganz interessant gewesen, wie die Posaunen im letzten A-Teil des Themas die Basslinie verdoppeln und alles dunkel einfärben, so dass Rogers’ gedämpftes Solo als ganz besonderer Kontrast hervortritt, oder darauf, dass die Wiederholung der Einleitung am Ende der Aufnahme eben nicht nur eine solche ist, sondern Rogers sich wieder mit seiner gedämpften Trompete darüber setzt und damit im Schluss das Stück quasi öffnet. Will sagen: Neben der bloßen Ablaufbeschreibung ließe sich ja auch eine Beschreibung der Dramaturgie, der Klangentwicklung, der Qualität einzelner Soli denken, ohne dass man dazu zu technisch werden müsste. Oder eben, und zwar gerne für jedes Stück unterschiedlich, die jeweils eine Frage: Was sagt uns das Stück im Kontext der Jazzgeschichte.
Die Verzahnung der sehr unterschiedlichen Beispiele immerhin gelingt Sultanof in den Zwischentexten, in denen er neue Protagonisten einführt, besondere Ereignisse (Konzerte oder Aufnahmen) schildert, musikalische Einflüsse nachzeichnet oder ästhetische Richtungsentscheidungen erklärt. Und hier deutet er dann auch an, wie Personalstile in diesem Bereich entstehen und was den Sound der betreffenden Aufnahme so besonders macht. Die verständliche Entscheidung, das alles quasi chronologisch darzustellen, vergibt dabei die Chance, etwa nach Klangfarben, nach Avanciertheit oder auch nach persönlicher Entwicklung zu gruppieren. In einer solchen Lesart hätte sich darstellen lassen, wie sich Ellingtons Orchesterstil über die Jahre veränderte, wie die Bigbandklänge von Stan Kenton, Count Basie, jenem gerade erwähnten Shorty Rogers und Thad Jones miteinander in Beziehung stehen, wie die Auseinandersetzung mit Klangfarben bei Claude Thornhill, Eddie Sauter, Sun Ra oder dem Orchestra USA unterschiedliche Resultate gezeitigt hat – wobei das Orchestra USA überhaupt nicht vorkommt – usw.
Die Grundsatzfrage also ist : Muss ein Buch, dass sich an Jazzlaien richtet, an der Oberfläche bleiben? Reicht es aus, Ellingtons Karriere von den 1920er bis in die 1960er Jahre anhand von Beispielen zu verfolgen, aber nirgends zu erklären, dass Ellingtons Art des Konzipierens von Musik für großes Ensemble sich grundsätzlich von der Herangehensweise anderer Bigbands unterscheidet? Kann allein die Identifikation von Soli in diesen Aufnahmen wirklich die Musik erklären?
Nun gibt es sicher auch gute Argumente für Sultanofs Darstellungsweise. Er will mit seinem Buch ja Mut machen, sich eingehender mit der Musik zu beschäftigen; er will Kontexte liefern, aus denen heraus auch ein nicht mit dieser Musik aufgewachsener Leser vielleicht zu verstehen vermag, was sie so faszinierend machte. Warum allerdings die Stücke im Fließtext in den dicken Unterbrechern, die auf sie aufmerksam machen sollen, einzig durch Titel mit Komponist, gegebenenfalls Arrangeur, Aufnahmeort und -datum identifiziert werden, man dann aber drumherum suchen muss, welches Orchester denn für diese Aufnahme verantwortlich war, ist schwer verständlich.
Das wiederum ist eine editorische Schwäche des Buchs, dem es nicht nur an dieser Stelle an Übersichtlichkeit mangelt. Auch dass am Schluss die verschiedenen Register nicht miteinander verzahnt werden, trägt zu diesem Bild bei: Da gibt es ein Register, dass die einzelnen Aufnahmen – wie im Buch vorkommend, Kapitel nach Kapitel –, aufzählt, aber keine Seitenzahl gibt. Dann ein Register der wichtigsten Orchester mit den im Buch genannten Titeln, aber wieder ohne Seitenzahl. Und schließlich ein Personen- und ein Titelregister mit Seitenzahl, wobei bei letzteren darauf verzichtet wird die Zuordnung zu den Ausführenden zu erwähnen. Das ist besonders schade, da Sultanof doch sehr bewusst immer mal wieder einzelne Titel auswählt, die gleich von verschiedenen Bands aufgenommen wurden, um im Vergleich des scheinbar selben Grundmaterials Unterschiede erklären zu können.
Last not least, eine Anmerkung des europäischen Lesers: Dass Sultanof zwar ein paar britische Bands und Francy Boland mit einbezieht, Europa ansonsten außen vor lässt (Orchestre National du Jazz? George Gruntz? oder gar: Globe Unity???), ist wohl vor allem dem angepeilten amerikanischen Publikum zu schulden. Sein Buch richtet sich insbesondere an musikalische Laien, an Amateur-Bigbandmusiker, an Lehrer und an Schüler. Auf den knappen Ausflug bis in die Gegenwart allerdings hätte er auch verzichten können: seine kurzen Sätze zu Kamasi Washingtons “The Epic” und Ted Nashs “Presidential Suite” sind nicht einmal mehr beschreibend.
Alles in allem also eine gute Idee, von Sultanof, einem ausgewiesenen Kenner der Materie, mit viel Gefühl für die Zwischentöne ausgeführt. Auch die Wahl der Beispiele ist gelungen, bei der Bekanntes neben Unerwartetem steht und sich so die Varietät des Genres bestens beleuchten lässt. Vielleicht liegen all die kritischen Untertöne dieser Rezension ja in der Grundidee der Reihe begründet, die im Vorwort des Herausgebers im Satz mündet, man wolle Leser erreichen, die keine exzessive musikalische Ausbildung besäßen und sich nicht laufend ihres elitären Wissensstands (wörtlich spricht er von “elitist shoulder rubbing”) vergewissern müssten. Nun ja, unterfordern sollte man die Leser und Hörer aber auch nicht…
Wolfram Knauer (März 2018)
Jazz en 150 Figures
von Guillaume Belhomme
Paris 2017 (Editions du Layeur)
360 Seiten, 39,90 Euro
ISBN: 9-782-91512-631-0
 Guillaume Belhomme ist ein französischer Musiker und Journalist. Sein jüngstes Buch will die Jazzgeschichte in 150 Musikerportraits erzählen und damit die Abfolge instrumentaler und vokaler Helden bis in die Gegenwart fortschreiben. Die Künstler werden chronologisch in die üblichen Stilschubladen-Kapitel sortiert, von “Early Jazz” über “Swing”, “Bebop”, “Cool”, “Hard Bop, “Post Bop”, “Free Jazz” bis zu “Modernes”, einer Abteilung, die Musiker fasst, die irgendwo zwischen freier Improvisation und eklektischen Experimenten arbeiten. Belhomme wählt für jeden der 150 Musiker von King Oliver bis Mats Gustafsson jeweils fünf Platten aus, die für ihn die Bandbreite ihrer künstlerischen Arbeit beleuchten. Dafür nimmt er sich jeweils zwei, in Ausnahmefällen vier Seiten Platz, bebildert das alles mit einem, selten zwei Fotos und zwischen zwei und vier Abbildungen der erwähnten Platten. Er beginnt seinen Text mit knappen biographischen Anmerkungen, streicht dann wichtige Aufnahmen heraus und betont die Bedeutung der Musiker für die Jazzgeschichte. Tief kann das alles nicht gehen, und das Buch lebt neben den kurzen Annäherungen an die Kunst der Musiker vor allem von den Abbildungen.
Guillaume Belhomme ist ein französischer Musiker und Journalist. Sein jüngstes Buch will die Jazzgeschichte in 150 Musikerportraits erzählen und damit die Abfolge instrumentaler und vokaler Helden bis in die Gegenwart fortschreiben. Die Künstler werden chronologisch in die üblichen Stilschubladen-Kapitel sortiert, von “Early Jazz” über “Swing”, “Bebop”, “Cool”, “Hard Bop, “Post Bop”, “Free Jazz” bis zu “Modernes”, einer Abteilung, die Musiker fasst, die irgendwo zwischen freier Improvisation und eklektischen Experimenten arbeiten. Belhomme wählt für jeden der 150 Musiker von King Oliver bis Mats Gustafsson jeweils fünf Platten aus, die für ihn die Bandbreite ihrer künstlerischen Arbeit beleuchten. Dafür nimmt er sich jeweils zwei, in Ausnahmefällen vier Seiten Platz, bebildert das alles mit einem, selten zwei Fotos und zwischen zwei und vier Abbildungen der erwähnten Platten. Er beginnt seinen Text mit knappen biographischen Anmerkungen, streicht dann wichtige Aufnahmen heraus und betont die Bedeutung der Musiker für die Jazzgeschichte. Tief kann das alles nicht gehen, und das Buch lebt neben den kurzen Annäherungen an die Kunst der Musiker vor allem von den Abbildungen.
Der Jazzkenner wird in diesem Buch also inhaltlich wenig Neues entdecken, wird immerhin auf den einen oder anderen Musiker verwiesen, der in seinem persönlichen Kanon vielleicht nicht denselben Stellenwert hat. Eine solche Auswahl ist nun mal immer persönlich, und eigentlich ist es müßig, sich an den Entscheidungen des Autors zu reiben. Allerdings irriert dann doch, dass Belhomme in seiner Auswahl kaum die Chance ergreift, die Heldengeschichte des Jazz vielleicht auch mal in Frage zu stellen, dass er sie stattdessen als eine Geschichte männlicher und meist amerikanischer Künstler fortschreibt. Naja, unter den 150 portraitierten Musikern befinden sich immerhin siebzehn Nicht-Amerikaner, allerdings nur sechs Frauen, und unter diesen nur zwei Instrumentalistinnen. Nicht einmal Django Reinhardt oder Mary Lou Williams fanden Eingang in Belhommes Tableau des Jazz. Man mag das als lässliches Versehen entschuldigen, ein Buch selbst diesen Umfangs kann schließlich nicht alles abdecken. Und doch ist es schade, dass Jazzgeschichte im Jahr 2017 immer noch nach alten Mustern erzählt wird, insbesondere durch einen Autoren, der den Jazz eigentlich als eine Musik der Offenheit und Vielfalt versteht.
Fazit: Man sollte sich also nicht zu tief hineinvertiefen in die Auswahlentscheidungen Belhommes, sollte stattdessen die schön layouteten Seiten genießen, die Hörerinnerungen hervorrufen oder neugierig machen auf neue Hörentdeckungen. Und die Lektüre als Aufforderung verstehen, als Leser seine eigenen Namen hinzuzufügen und auch für diese fünf Alben auszuwählen, die Jazzgeschichte aus einer noch anderen Perspektive wahrnehmbar werden lassen.
Wolfram Knauer (Februar 2018)
Commemoration of the Centenary of the arrival of the African-American military bands in France during World War I
von Dan Vernhettes
Saint-Etienne-du-Rouvray 2017 (Jazz’edit)
54 Seiten, 20 Euro
Bestellungen unter http://www.jazzedit.org/English/Centenaire/Centenaire%201918.html
 Im Februar 2018 jährt sich zum 100sten Mal die Ankunft afro-amerikanischer Regimenter in Europa. Das 15. Regiment der New York National Guard, das in Frankreich als 369stes Regiment der IV. französischen Armee zugeordnet wurde, kämpfte an der Front, kam bis zum Rhein und wurde nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten als Harlem Hellfighters gefeiert. Zu dem Regiment gehörte eine Militärkapelle, die von Ltd. James Reese Europe geleitet wurde und deren Mitglieder nicht nur Musik machten, sondern auch aktiv mitkämpften. Neben der Tatsache, dass hier Soldaten für Demokratie und Freiheit kämpften, die zuhause Segregation und Rassismus zu erdulden hatten, ist vor allem die Tatsache bemerkenswert, dass Europe und seine Band wahrscheinlich den ersten Jazz nach Europa brachten. Dass diese Musik mit der Art von Jazz wenig zu tun hatte, die bald auf Schallplatten erschien und weltweit begeistert aufgenommen wurde, dass der Marschkapellen-Charakter deutlich stärker war als die Improvisation kleinerer Besetzungen, führte dazu, dass die Jazzgeschichte oft genug höchstens von “Proto-Jazz” sprach. Und doch ist es die Spielhaltung dieser Bands, die von ihr als wohl erster Jazzerfahrung für viele europäische Zuhörer sprechen lässt. Vom 1. Januar 1918 bis zum 13. Januar 1919 waren europe und seine Band in ganz Frankreich zu hören, in Brest, wo sie per Schiff anlandeten (und wieder abreisten), sowie in Orten wie Saint-Nazaire, Aix-les-Bains, Givry, Maffrécourt, Châlons, Paris, Vouziers, Bladhelsheim, Belfort und Les Mans. Aus Anlass des Zentenariums findet im Februar 2018 in Nantes eine Konzertreihe und eine kleine Konferenz statt. Zuvor hat der französische Jazzhistoriker Dan Vernhettes ein lohnenswertes und reich bebildertes Buch herausgegeben, das die Stationen von Europes Hellfighters Band sowie die anderer, weniger bekannter afro-amerikanischer Armeekapellen in Europa im I. Weltkrieg oder kurz danach verfolgt.
Im Februar 2018 jährt sich zum 100sten Mal die Ankunft afro-amerikanischer Regimenter in Europa. Das 15. Regiment der New York National Guard, das in Frankreich als 369stes Regiment der IV. französischen Armee zugeordnet wurde, kämpfte an der Front, kam bis zum Rhein und wurde nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten als Harlem Hellfighters gefeiert. Zu dem Regiment gehörte eine Militärkapelle, die von Ltd. James Reese Europe geleitet wurde und deren Mitglieder nicht nur Musik machten, sondern auch aktiv mitkämpften. Neben der Tatsache, dass hier Soldaten für Demokratie und Freiheit kämpften, die zuhause Segregation und Rassismus zu erdulden hatten, ist vor allem die Tatsache bemerkenswert, dass Europe und seine Band wahrscheinlich den ersten Jazz nach Europa brachten. Dass diese Musik mit der Art von Jazz wenig zu tun hatte, die bald auf Schallplatten erschien und weltweit begeistert aufgenommen wurde, dass der Marschkapellen-Charakter deutlich stärker war als die Improvisation kleinerer Besetzungen, führte dazu, dass die Jazzgeschichte oft genug höchstens von “Proto-Jazz” sprach. Und doch ist es die Spielhaltung dieser Bands, die von ihr als wohl erster Jazzerfahrung für viele europäische Zuhörer sprechen lässt. Vom 1. Januar 1918 bis zum 13. Januar 1919 waren europe und seine Band in ganz Frankreich zu hören, in Brest, wo sie per Schiff anlandeten (und wieder abreisten), sowie in Orten wie Saint-Nazaire, Aix-les-Bains, Givry, Maffrécourt, Châlons, Paris, Vouziers, Bladhelsheim, Belfort und Les Mans. Aus Anlass des Zentenariums findet im Februar 2018 in Nantes eine Konzertreihe und eine kleine Konferenz statt. Zuvor hat der französische Jazzhistoriker Dan Vernhettes ein lohnenswertes und reich bebildertes Buch herausgegeben, das die Stationen von Europes Hellfighters Band sowie die anderer, weniger bekannter afro-amerikanischer Armeekapellen in Europa im I. Weltkrieg oder kurz danach verfolgt.
Vernhettes beginnt mit einem Überblick über zeitnahe Begegnungen amerikanischer Jazzbands mit einem europäischen Publikum, sowie über den Eintritt der Vereinigten Staaten in den “Großen Krieg”. Er beschreibt das Camp Pontanézen in Brest, in dem am 12. November 1917 die ersten amerikanischen Truppen anlangten, und beziffert die Soldaten in den 27 afro-amerikanischen Regimentern auf 42.000, darunter immerhin ca. 1.000 Musiker, die in den Armeekapellen Dienst taten. Er widmet sich Jim Europes Biographie, der 1880 in Mobile, Alabama, geboren wurde und um die Jahrhundertwende nach Washington, D.C., zog. Europe arbeitete als Pianist, Geiger und Dirigent für verschiedene Varietéshows und machte sich ab 1903 auf der New Yorker Musikszene einen Namen. Dort setzte er sich auch für eine Interessenvertretung für afro-amerikanische Musiker ein und gründete 1910 den Clef Club, der ein eigenes Symphony Orchestra organisierte und Musikern in der ganzen Stadt Arbeit vermittelte. Bald begleitete seine Band das populäre Tanz-Duo Irene und Vernon Castles, für die er Stücke im Repertoire hatte, die er auch auf Schallplatte aufnahm. Noch vor Kriegseintritt der Vereinigten Staaten meldete er sich im September 1916 zusammen mit dem Sänger Noble Sissle freiwillig zum Wehrdienst, ein halbes Jahr später wurde er damit beauftragt, “die beste Militärkapelle der Vereinigten Staaten” zu organisieren. Per Zeitungsannonce suchte Europe Musiker im ganzen Land und reiste sogar nach Puerto Rico, um dort Instrumentalisten zu rekrutieren. Am 22. Juni 1917 gab die Kapelle ihr erstes Konzert im New Yorker Manhattan Casino vor 4000 Zuhörern, im Monat darauf wurden die Mitglieder in den aktiven Dienst berufen.
Vernhettes beschreibt, wie diese Kapelle im Januar 1918 in Brest ankam und wie sie und alle anderen afro-amerikanischen Soldaten in den französischen Dörfern und Städten, durch die sie kamen, willkommen geheißen wurden. In Orten wie Aix-les-Bains blieben sie einen vollen Monat, gaben Konzerte in Parks, Krankenhäusern und im Kasino. Im März wurde das Regiment, dem die Band angehörte, unter die Befehlsgewalt der französischen Armee gestellt und die weitere Ausbildung der Soldaten von französischen Offizieren übernommen. Zwischenzeitlich wurde Europe den kämpfenden Truppen zugeteilt und war der erste schwarze Offizier, der Truppen in den Grabenkämpfen kommandierte. Vernhettes hat etliche Fotos gefunden, die die Band in Aktion zeigt, teils bei Konzerten für das zivile französische Publikum, teils für Mitglieder der US-Armee. Es gibt ein Foto, dass einzelne Musiker neben einem Schlagzeug zeigt, auf dem deutlich “Jass Band” zu lesen steht, das damit klar macht, dass der musikalische Grat zwischen Jazz und sonstiger Musik zumindest für die Musiker nicht sonderlich hoch war. Im September 1918 waren etliche der Soldaten an der großen Schlacht zwischen Verdun und Reims beteiligt, im November erreichten sie den Rhein. Im Dezember erhielten Europe und andere Mitglieder des 369sten Regiments das Croix de Guerre, im Januar 1919 kehrten sie alle zurück nach New York, wo sie mit einer großen Parade empfangen wurden. Ein kurzer Einschub beschreibt die Aufnahmen, die Europes Band 1919 für das Pathé Label machte, und in einem Nachsatz beschreibt Vernhettes, wie Europe während eines Konzerts im Mai 1919 vom Schlagzeuger der Band erstochen wurde.
Die Hellfighters schrieben Geschichte, aber Vernhettes ist es auch wichtig auf andere Bands hinzuweisen, die zur selben Zeit in Frankreich zu hören waren. Er fasst zusammen, was über die weiteren Regimentskapellen zu finden ist, beschreibt das Wirken etwa der Bands unter Leitung von Tim Brymn, George Dulf und Will Vodery. Ein kurzer Ausblick widmet sich dem Wirken des Schlagzeugers Louis Mitchell, des Sängers Noble Sissle und des Pianisten und Bandleaders Sam Wooding, die alle ihren Anteil an der Popularisierung von Jazz und afro-amerikanischer Musik in Europa in den Jahren direkt nach dem 1. Weltkrieg hatten.
Dan Vernhettes Buch ist überaus reich bebildert und fasst lesenswert zusammen, was über die Aktivitäten afro-amerikanischer Militärkapellen in den Jahren zwischen 1917 und 1919 zu finden ist. Er geht nicht weiter auf die Frage ein, inwieweit die Musik Europes und anderer als “Jazz” zu werten ist oder damals als “Jazz” rezipiert wurde, diskutiert in seinen knappen Anmerkungen zu den Aufnahmen James Reese Europes immerhin, wie sich deren Musik zwischen Vorbildern wie John Philip Sousa und Arthur Pryor und dem instrumentalen Ragtime der Zeit bewegten. Das lesenswerte Büchlein ist allemal ein würdiger Tribut an das hundertjährige Jubiläum der Ankunft des Jazz in Europa.
Wolfram Knauer (Februar 2018)
Jazz in Concert. Mein Leben als Konzertveranstalter
von Oskar Riha & Susanne Schulzke-Riha
Ludwigshafen 2017 (Rosamontis Verlag)
275 Seiten, 19,80 Euro
ISBN: 978-3-940212-87-0
 1994 entschloss sich Oskar Riha, Gitarrenlehrer aus Memmingen im Allgäu, ein Konzert mit dem Trio des Schlagzeugers Paul Wertico zu organisieren, der in den 1980er und 1990er Jahren in der Band des von Riha so bewunderten Pat Metheny mitgewirkt hatte. Aus dem einen Konzert wurden bald mehr, und vier Jahre später gründete er einen Verein, JAMM, Jazz & More Memmingen, um Verstärkung für die vielen Aufgaben zu haben und zugleich besser Fördergelder einwerben zu können. Mit JAMM brachte Riha die nächsten 18 Jahre über viele namhafte Musiker der amerikanischen wie europäischen Jazzszene in die kleinen Stadt im Allgäu, bis sich der Verein 2016 auflöste und er sich selbst von Konzerte-Organisieren zurückzog.
1994 entschloss sich Oskar Riha, Gitarrenlehrer aus Memmingen im Allgäu, ein Konzert mit dem Trio des Schlagzeugers Paul Wertico zu organisieren, der in den 1980er und 1990er Jahren in der Band des von Riha so bewunderten Pat Metheny mitgewirkt hatte. Aus dem einen Konzert wurden bald mehr, und vier Jahre später gründete er einen Verein, JAMM, Jazz & More Memmingen, um Verstärkung für die vielen Aufgaben zu haben und zugleich besser Fördergelder einwerben zu können. Mit JAMM brachte Riha die nächsten 18 Jahre über viele namhafte Musiker der amerikanischen wie europäischen Jazzszene in die kleinen Stadt im Allgäu, bis sich der Verein 2016 auflöste und er sich selbst von Konzerte-Organisieren zurückzog.
Jetzt erinnert sich Oskar Riha in dem von seiner Frau Susanne Schulzke-Riha verfassten Buch an die vielen Begegnungen mit Stars, an die Freuden und die oft unvorhergesehenen Probleme, die diese Konzerte mit sich brachten, und er lässt seine Leser dabei teilhaben an den alltäglichen, den spontanen und absurden Erlebnissen, denen sich (insbesondere ehrenamtliche) Konzertveranstalter immer mal wieder ausgesetzt sehen.
Riha ist dabei, wie man der Lektüre anmerkt, immer ein Fan dieser Musik geblieben. Er liebt den Jazz, und er hat klare Präferenzen für das, was er präsentieren will. Selbst Gitarrist schlägt sein Herz natürlich für Metheny, Ralph Towner, John Abercrombie oder Robben Ford, daneben aber auch für Charlie Haden, Charles Lloyd, Bill Evans, Brad Mehldau, Michael Wollny, Jan Garbarek und andere mehr.
Über die Jahre erarbeitete er sich ein Publikum, das teils aus der Region stammte, für die Memminger Events teils aber auch aus der Ferne anreiste. Der Ruf seiner Konzertreihe sprach sich bei anderen Veranstaltern in Deutschland genauso herum wie bei Musikern international. Riha schaffte es nach und nach ein Netzwerk zu bilden mit Künstlern, Agenturen, Veranstaltern und vielen anderen, die er durch sein Engagement überzeugen konnte und die ihm helfen wollten, die Konzerte zu Erfolgen werden zu lassen.
Rihas Buch handelt also von all dem, was auch dazugehört, um die Musik erklingen zu lassen. Es handelt von Verträgen, von Gagenverhandlungen, von technischen Ridern, von Backlines und von vertraglich festgehaltenen Sonderwünschen aller Art. Es handelt von dem Bemühen, den Künstlern einen guten Aufenthalt und die besten Spielmöglichkeiten zu bieten, und es handelt davon, wie schwer all das sein kann, wenn man keinen festen Veranstaltungsort zur Verfügung hat und sich um alle zusätzlichen Details neben dem Brotberuf kümmern muss. Riha beschreibt lebhaft, wie er über die Jahre Erfahrungen sammeln konnte, wie er mit Problemen umging und sie meistens erfolgreiche meisterte, und wie die Künstler, die er zu betreuen hatte, seinen ganz persönlichen Einsatz in der Regel auch zu schätzen wussten.
Der Jazz lebt, wie wenige andere Sparten des Musikgeschäfts, von genau solchen engagierten “Verrückten” wie Oskar Riha. Er lebt davon, dass es eine flächendeckende Struktur von Kleinveranstaltern und ehrenamtlichen Initiativen gibt, deren Mitglieder Konzerte in erster Linie deshalb veranstalten, weil sie die Künstler in ihrer Region sonst nie hören könnten. Oskar Rihas Buch bringt einem die Freuden genauso wie die Beschwernisse dieses Engagements anschaulich vor Augen, und Riha streicht neben der großartigen Musik, die er erleben konnte, immer auch heraus, wie befriedigend die Begeisterung des Publikums für ihn war. Sein Buch, das genauso über hervorragende Konzerte berichtet wie über Freundschaften, die er über die Jahre mit “seinen” Künstlern schließen konnte, ist für Memminger ein einziges Erinnerungsalbum, für alle anderen ein Beispiel für die ehrenamtliche Arbeit von der die hiesige Jazzszene auch lebt, und außerdem eine schnelle und überaus vergnügliche Lektüre.
Wolfram Knauer (Februar 2018)
PS: Lieber Oskar Riha: Es gibt einen Unterschied zwischen Roadies und Rowdies (S. 110), aber ich habe herzhaft gelacht!
Joe Sydow und “Kleopatra”
herausgegeben von Martina Schmoll
Hamburg 2017 (Fokumala Verlag)
100 Seiten, 39 Euro (Selbstkostenpreis, plus Porto)
Bestellung über info@fokumala.de
 Der Bassist Joe Sydow verstarb am 3. Januar 2018 im Alter von 91 Jahren. Er konnte das Erscheinen des Bildbandes gerade noch miterleben, den Martina Schmoll aus mit Dokumenten über seine Karriere, Zeitungsartikeln über seine musikalischen Aktivitäten, privaten Fotos und Gedichten zusammengestellt hat, die Sydow seit seiner Jugend gerne schrieb und durchaus auch gerne vortrug. Das Ergebnis ist ein liebevoll layoutetes und sehr persönliches Buch, keine kritische Dokumentation, sondern eine freundschaftliche Erinnerung an ein reiches musikalisches Leben und an einen Hamburger Fan- und Freundeskreis, der ihm bis zum Schluss treu blieb.
Der Bassist Joe Sydow verstarb am 3. Januar 2018 im Alter von 91 Jahren. Er konnte das Erscheinen des Bildbandes gerade noch miterleben, den Martina Schmoll aus mit Dokumenten über seine Karriere, Zeitungsartikeln über seine musikalischen Aktivitäten, privaten Fotos und Gedichten zusammengestellt hat, die Sydow seit seiner Jugend gerne schrieb und durchaus auch gerne vortrug. Das Ergebnis ist ein liebevoll layoutetes und sehr persönliches Buch, keine kritische Dokumentation, sondern eine freundschaftliche Erinnerung an ein reiches musikalisches Leben und an einen Hamburger Fan- und Freundeskreis, der ihm bis zum Schluss treu blieb.
Ekkehard Sydow kam 1926 in Rottach-Egern am Tegernsee zur Welt, und begann zu Schulzeiten klassischen Kontrabass zu spielen. Nach Kriegsende begann er seine Jazzkarriere in der Band von Klaus Gering, spielte dann von 1947 bis in die 1960er Jahre mit dem Orchester Kurt Edelhagen, daneben mit dem Geiger Helmut Weglinski. Ab den späten 1960er Jahren war er Bassist des NDR Tanz- und Unterhaltungsorchesters und gehörte damit fest zur Hamburger Jazzszene, die eher traditionell, also irgendwo zwischen New Orleans und Swing, ausgerichtet war. In den 1980er Jahren wirkte er bei Musicals mit und war 2010 im Film “Schenk mir dein Herz” mit Paul Kuhn zu sehen, den er noch von seiner Jugend in Heidelberg her kannte.
All diese Stationen dokumentiert Martina Schmoll mit vielen Fotos, Zeitungsausrissen und liebevollen Anmerkungen. Da finden sich Erinnerungen an eine Nordafrikatournee Edelhagens, Korrespondenz mit der GEMA, die Kopie seines Vertrags für eine Aufzeichnung zum 25-jährigen Jubiläum der Edelhagen Big Band beim WDR, und Erinnerungen von Sydow und Mitmusikern an die Tücken des Musikerlebens und wie man sie meistert. Dazwischen immer wieder Gedichte, die Sydow über die Jahre verfasst hatte, und zwar zu allem und jedem: manchmal im Stile eines Eugen Roth, zu Themen wie dem pekuniären Wert des menschlichen Körpers, zu Ehrgeiz, Hunden, Parfum und Körpergeruch, zum Wert der Verlobung, aber auch über Orchesterleiter wie Alfred Hause und Franz Thon, über Mitmusiker wie Günter Fuhlisch und Ladi Geisler.
Man sollte bei alledem also keine zusammenhängende Biographie erwarten, sondern vor allem eine Sammlung von Anekdoten. Bei alledem – und wissend, dass es ihr um die Würdigung eines Freundes ging und eben nicht um die lückenlose Dokumentation seiner Karriere – erlauben die von Martina Schmoll gesammelten Erinnerungen dennoch einen Einblick ins Schaffen eines über die Jahre verlässlichen Musikers, der im Hintergrund den deutschen Jazz mit geprägt hat.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Modern Piano School. Klavier. Band 1+2. Schule für Jugendliche & Erwachsene
von Axel Kemper-Moll
Offenbach 2017 (Art Edition)
jeweils 76 Seiten
jeder Band: 19,90 Euro; Begleit-CDs je Heft: 10 Euro
ISBN: 978-3-947071-00-5 (Band 1)
ISBN: 978-3-947071-02-9 (Band 1)
www.modern-piano-school.de
 Als erfahrener Klavierpädagoge hörte Axel Kemper-Moll von Kolleg/innen immer wieder, dass sie, um ihre Schüler/innen mit interessantem Material bedienen zu können, Notenmaterial aus unterschiedlichsten Quellen zusammenstückeln müssen. Ihm ging es in seiner täglichen Arbeit nicht viel anders, und so entschied er sich, eine eigene Klavierschule herauszugeben, in der all die pädagogischen Facetten enthalten sind, die ihm wichtig schienen: Ansätze an klassische Kompositionen also genauso wie an populäre Klavierstile, an Latin-, Blues- und Jazzstandards sowie überhaupt an das Thema der Improvisation.
Als erfahrener Klavierpädagoge hörte Axel Kemper-Moll von Kolleg/innen immer wieder, dass sie, um ihre Schüler/innen mit interessantem Material bedienen zu können, Notenmaterial aus unterschiedlichsten Quellen zusammenstückeln müssen. Ihm ging es in seiner täglichen Arbeit nicht viel anders, und so entschied er sich, eine eigene Klavierschule herauszugeben, in der all die pädagogischen Facetten enthalten sind, die ihm wichtig schienen: Ansätze an klassische Kompositionen also genauso wie an populäre Klavierstile, an Latin-, Blues- und Jazzstandards sowie überhaupt an das Thema der Improvisation.
Nach elementarem Grundwissen über die Tastatur, das Tonsystem, den grundlegenden Fingersatz und Körperhaltung folgt im ersten Band gleich der musikalische Spaß: zum Teil selbstgeschriebene Kompositionen, zum Teil Bearbeitungen klassischer Themen. Kemper-Moll erhöht den Schwierigkeitsgrad mäßig; er empfiehlt den Schülern die komplexeren Titel auf der zu den Heften erhältlichen CD zu hören, um die Melodien oder die Rhythmik im Zusammenhang zu erleben und sich aus dem Mix von Notenbild und Hörerinnerung an die Musik heranzuarbeiten. Viele Titel sind vierhändig gesetzt mit den schwereren Teil für den Lehrer, der etwa Wagners “Pilgerchor” auffüllt oder Jacques Offenbachs “La Vie Parisienne” den nötigen Schwung verleiht. Kemper-Moll weiß, wie sehr gerade Anfänger auf dem Instrument an feste Fingerhaltungen gewöhnt sind und erweitert die Klaviatur Stück für Stück um weitere Lagen, erläutert auch, wie erste technische Schwierigkeiten zu lösen sind (etwa das Verschieben des zweiten und fünften Fingers). Dem Lehrer bleibt es insbesondere in den jazzigeren Stücken aus Kemper-Molls Feder belassen, die vorgegebenen Lehrerstimme oder aber eine Begleitung aus den in der Schülerstimme benannten Harmoniesymbolen zu spielen. Der erste Band endet mit einem gerade für Klavieranfänger besonders wichtigen Kapitel: vier Weihnachtsliedern, von denen zwei allein und zwei mit dem Lehrer zu spielen sind (den aber vielleicht nicht jeder zur privaten Weihnachtsfeier im Kreis der Familie einladen mag).
Band 2 erweitert das Wissen um die Klaviertastatur nun deutlich um die bislang noch fehlenden Noten, um Pedale und Vorzeichen am Zeichenanfang, um Durtonleitern (wobei zum Schluss auch die Molltonleitern erläutert werden) und um die Einladung, dem Ohr genauso zu vertrauen wie den Augen (also hörend zu lernen, nicht nur lesend) und sich dabei bewusst zu sein, das Improvisation oder Fantasieren schon immer mit zur Musikausübung gehörte. Zu Beginn des Bands lässt Kemper-Moll seine Schüler jeden einzelnen Ton auf der Klaviatur identifizieren, ermutigt zum Erkennen der Lagen und ermutigt, sofern man einzelne Stücke zu können meint, die sich dazu anbieten, mit Rhythmik, Pausen und eigenen Melodien zu experimentieren. Er stellt die Pedale vor und zeigt ihren Einsatz am Beispiel des Gospels “Michael Row the Boat Ashore”. “Hit the Road Jack” lässt ihn außerdem Swingachtel und Bluestonleiter einführen. Lehrer-/Schüler-Stücke sind in diesem Band schon seltener, und wenn (wie im “D Moll Menuett” von Johann Sebastian Bach) sehr effektvoll gesetzt. Einen besonderen Schwerpunkt lenkt Kemper-Moll auf Fingerhaltung und Fingersätze und reißt knapp die Welt der Pentatonik an. Dann gibt es noch ein paar Vorführstücke: Auf Eigenes wie den “Tanz auf Hawaii” oder “Tom’s Boogie” folgt Bachs “Präludium C-Dur” (unbearbeitet), eigene Stücke mit Anleihen aus irischer Folklore oder jiddischer Musik, Tschaikowski, Händel, und – mit all dem Üben ist wahrscheinlich wieder ein Jahr vergangen – weitere Weihnachtslieder, mit denen man die Familie beglücken kann.
Der geplante dritte Band wird sich stärker mit handwerklichen Grundlagen befassen und außerdem eine Anleitung zum Spiel nach Akkordsymbolen und zur Improvisation geben.
Kemper-Molls “Modern Piano School” ist so angelegt, dass Langeweile eigentlich weder beim Lehrer noch beim Schüler aufkommen sollte. Sie bietet genug stilistische Abwechslung, einen behutsamen Fortgang der Unterrichts mit etlichen Möglichkeiten für die Klavierlehrer, die angerissenen Themen weiter zu vertiefen. Vor allem versucht Kemper-Moll in seiner Klavierschule immer wieder die Furcht vor den Noten auf dem Papier zu nehmen und den Schüler zu ermutigen, daneben seinem Ohr zu vertrauen.
Wolfram Knauer (November 2017)
The Jazz Repertoire. A Survey
von Jan J. Mulder
Almere/Netherlands 2017 (Names & Numbers)
598 Seiten, 45 Euro
ISBN: 978-90-77260-24-1
www.names-and-numbers.nl
 Names & Numbers ist genau das: eine in den Niederlanden publizierte Zeitschrift, die sich der diskographischen Erforschung des Jazz widmet, also fragt, wer wann was aufgenommen hat, dabei Lücken in der Dokumentation des Aufnahmeschaffens vieler Künstler schließt, auf Fehler bisheriger Diskographien hinweist oder generelle Fragen darüber aufwirft, was Diskographien leisten können und leisten sollen. Eigentlich, sollte man meinen, ist gerade das Feld der Diskographie eines, das heutzutage am besten im Internet bearbeitet werden könnte, weil es hier auf die Vernetzung von unzähligem Einzelwissen ankommt, das insbesondere bei Sammlern vorhanden ist, die die Originalveröffentlichungen vor sich haben, in sie hineinhören und auf das Label oder, sofern vorhanden, auf die Plattencover schauen können. Tatsächlich gibt es mittlerweile eine Reihe an Datenbanken, die die ehedem in Buch- oder Zettelform (Brian Rust, Willem Bruyninckx, Tom Lord) publizierten Diskographien ablösen. Es gibt Mailinglisten, in denen Sammler sich genau über solche Fragen austauschen. Und es gibt vereinzelte Versuche kommentierbarer Diskographien, die das auch in Zeitschriften wie Names & Numbers gesammelte Wissen zusammenfassen und die Diskussionen über einzelne Aufnahmen dokumentieren können.
Names & Numbers ist genau das: eine in den Niederlanden publizierte Zeitschrift, die sich der diskographischen Erforschung des Jazz widmet, also fragt, wer wann was aufgenommen hat, dabei Lücken in der Dokumentation des Aufnahmeschaffens vieler Künstler schließt, auf Fehler bisheriger Diskographien hinweist oder generelle Fragen darüber aufwirft, was Diskographien leisten können und leisten sollen. Eigentlich, sollte man meinen, ist gerade das Feld der Diskographie eines, das heutzutage am besten im Internet bearbeitet werden könnte, weil es hier auf die Vernetzung von unzähligem Einzelwissen ankommt, das insbesondere bei Sammlern vorhanden ist, die die Originalveröffentlichungen vor sich haben, in sie hineinhören und auf das Label oder, sofern vorhanden, auf die Plattencover schauen können. Tatsächlich gibt es mittlerweile eine Reihe an Datenbanken, die die ehedem in Buch- oder Zettelform (Brian Rust, Willem Bruyninckx, Tom Lord) publizierten Diskographien ablösen. Es gibt Mailinglisten, in denen Sammler sich genau über solche Fragen austauschen. Und es gibt vereinzelte Versuche kommentierbarer Diskographien, die das auch in Zeitschriften wie Names & Numbers gesammelte Wissen zusammenfassen und die Diskussionen über einzelne Aufnahmen dokumentieren können.
Names & Numbers also veröffentlicht neben seiner Vierteljahreszeitschrift ab und an Bücher, oft Diskographien einzelner Künstler oder Labels. Das wohl dickste Buch der bisherigen Reihe ist soeben erschienen, Jan J. Mulders “The Jazz Repertoire. A Survey”, in dem der Autor, selbst einer der fleißigsten Diskographen Europas, das Repertoire von Jazzmusikern in Augenschein nimmt, aufgelistet von “A” wie “ABC Blues” bis “Z” wie “Zumba”.
Im Vorwort erklärt Mulder, dass er sehr bewusst vom Jazzrepertoire statt von Jazz Standards spricht, da etliche der Titel einem breiteren Publikum (und auch vielen Musikern) kaum bekannt sein dürften. Jeder Eintrag des Buchs ist mit Informationen über die Autoren (Text / Musik) und das ursprüngliche Veröffentlichungsjahr versehen. Eine knappe Kategorisierung indiziert, wie oft das Stück aufgenommen wurde (von “100-300 Mal” bis “900-1100 Mal”, wobei zwei Titel, nämlich “Body and Soul” und der “St. Louis Blues” eine eigene Kategorie erhalten, nämlich “über 1100 Mal”. Und schließlich gibt es den Hinweis auf – meist zwischen drei und sechs – wichtige Künstler, die den betreffenden Titel aufgenommen haben. Es finden sich Verweise auf alternative Titelungen genauso wie kurze Erklärungen der Titel (etwa: “9:20 Special: die Uhrzeit der Aufnahme am 10. April 1941” oder “Mahoganny Hall Stomp: ein Bordell in New Orleans”).
Das Ergebnis also ist eine ausführliche Listung von – nun ja, wieviel Titel es genau in Mulders Buch geschafft haben, wissen wir nicht. Und hier kommt dann auch die Kritik, die an die anfangs gemachten Anmerkungen zum Nutzen von Datenbanken anknüpft: So hilfreich dieses Buch auch zum schnellen Nachblättern über Titel ist – eine Art ausführlicherer Titelindex zu bestehenden Diskographien –, so wäre es ein Leichtes gewesen, zusätzliche Information zur Erhebung zu liefern, also etwa dazu, welches die Eckdaten sind, die der Autor berücksichtigt hat, wieviel Titel dieses Jazzrepertoire in Zahlen umfasst, vielleicht auch eine Aufgliederung der Menge an Titel nach Jahren oder wenigstens Jahrzehnten. All das wäre unter dem Untertitel “A Survey” eigentlich zu erwarten und würde dem Forscher, der diese Datensammlung nutzen will, helfen, sie über die reine Listung hinaus einzuordnen. 40 weitere Seiten hätten wahrscheinlich gereicht, die gesammelten Daten nach verschiedenen Fragestellungen darzustellen. Ohne diese Information bleibt das Buch nicht mehr – aber eben auch nicht weniger – als ein gutes Nachschlagewerk zum Repertoire der Jazzgeschichte.
Wolfram Knauer (November 2017)
Long Play
von Arne Reimer
Köln 2017 (Buchhandlung Walther König)
248 Seiten, 39,80 Euro
ISBN: 978-3-96098-037-7
 Arne Reimers zweibändige “American Jazz Heroes” waren mehr als ein Fotobuch; in ihnen gingen die Bilder mit den Texten, die der Fotograf selbst verfasst hatte, eine Einheit ein, ergänzten sich gegenseitig, beleuchteten die Besuche Reimers bei den Giganten der Jazzgeschichte von unterschiedlichen Perspektiven. In “Long Play” müssen die Fotos für sich sprechen. Reimer reiste für die vorgenannten Bücher ja viel durch die Vereinigten Staaten und besuchte – Plattensammler, der er ist -, wo immer er war, die Läden, in denen antiquarisch LPs gehandelt wurden. Von nichts anderem handelt “Long Play”, von der Aura der schwarzen Scheiben, von den Geschäften, in denen diese auf neue Liebhaber warten, und von den Kunden, auf die sie eine so unendliche Faszination ausüben.
Arne Reimers zweibändige “American Jazz Heroes” waren mehr als ein Fotobuch; in ihnen gingen die Bilder mit den Texten, die der Fotograf selbst verfasst hatte, eine Einheit ein, ergänzten sich gegenseitig, beleuchteten die Besuche Reimers bei den Giganten der Jazzgeschichte von unterschiedlichen Perspektiven. In “Long Play” müssen die Fotos für sich sprechen. Reimer reiste für die vorgenannten Bücher ja viel durch die Vereinigten Staaten und besuchte – Plattensammler, der er ist -, wo immer er war, die Läden, in denen antiquarisch LPs gehandelt wurden. Von nichts anderem handelt “Long Play”, von der Aura der schwarzen Scheiben, von den Geschäften, in denen diese auf neue Liebhaber warten, und von den Kunden, auf die sie eine so unendliche Faszination ausüben.
Da sind Platten aufeinandergestapelt oder warten im Rack aufs Durchblättern. Ein Poster an der Wand preist Abtastsysteme und –nadeln an. Im Schaufenster oder an Wandregalen sind einzelne Plattencover aufgestellt, um das Publikum anzuziehen. Plattenspieler stehen bereit, damit man in das eine oder andere Exemplar hineinhören kann. Kunden mit Kopfhörern oder mit deutlichem Sucherblick tauchen völlig ab in die Welt der zu Vinyl erstarrten Musik. Man meint die Läden geradezu riechen zu können, Low-Budget-Geschäfte, oft eher provisorisch zusammengezimmert, in heruntergekommenen Hütten oder im Keller eines Hauses. Alles wirkt improvisiert, selbst da, wo statt Jazz Paul Anka oder Buddy Holly zum Verkauf steht. Überhaupt: Schallplatten, scheint es, sind das Medium vor der Genretrennung. Doch, da stehen Reiter mit Beschriftungen wie “Punk”, “Oldies”, “Vocals”, aber man ahnt, dass bei dem Durcheinander der Läden, bei den Hinguckern unter den Plattencovern, selbst der stilkonformistischste aller Käufer gern auch im Nachbarregal wühlt. Man ahnt, dass selbst bei zielgerichteten Sammlern die Plattencover Neugier mindestens genauso auslösen müssen wie die Hoffnung, endlich die noch fehlende Scheibe zu ergattern.
Und noch etwas fällt auf: Schallplatten sind ein Ding für junge Leute, und nicht nur für die DJs, die dabei etwas zum Sampeln und Mischen suchen. So wirken die Archivfotos, die am Schluss des Buchs Bilder aus den 1950er bis 1970er Jahren zeigen, als all diese Platten den Markt ursprünglich eroberten, auch wie ein seltsamer Kontrast: Von der Ware zum Kultobjekt. Seltener kam die Atmosphäre dieser Erfahrung so überzeugend rüber wie in diesem Buch, ganz ohne Erklärung, denn: Ein Essay von Ulf Erdmann Ziegler beschreibt zwar die Faszination des Plattensammelns, doch hielt die fürs Design Verantwortliche es hier leider für eine gute Idee, den Text in silbernen Buchstaben auf schwarzem Grund zu drucken. Und so ist man dankbar, dass das Buch gerade keinen Text benötigt, weil die Bilder alles sagen…
Wolfram Knauer (Oktober 2017)
The Original Blues. The Emergence of the Blues in African American Vaudeville
von Lynn Abbott & Doug Seroff
Jackson/MS 2017 8University Press of Mississippi)
420 Seiten, 85 US-Dollar
ISBN: 978-1-4968-1002-1
 Der Blues ist eine der wichtigsten Grundlagen amerikanischer populärer Musik. Oft wird er vereinfacht als eine Art ländliche Volksmusik dargestellt, und tatsächlich liegt man mit dieser Beschreibung bei vielen seiner Protagonisten nicht ganz falsch. Im frühen 20sten Jahrhundert wurde der Blues allerdings auch zu einer wichtigen Bühnenmusik in den Varietés der Vereinigten Staaten, den Vaudeville-Shows, in denen bald auch Sängerinnen wie Ma Rainey, Bessie, Clara oder Trixie Smith zu hören waren. Lynn Abbott und Doug Seroff, die sich bereits in zwei vorausgegangenen Büchern mit der Frühgeschichte afro-amerikanischer Musik beschäftigt und dabei immer auch die Einbindung musikalischer Praktiken in die afro-amerikanische Community berücksichtigt haben, legen jetzt ein dickes Werk vor, das die Schnittstellen zwischen Blues und Showbusiness untersucht.
Der Blues ist eine der wichtigsten Grundlagen amerikanischer populärer Musik. Oft wird er vereinfacht als eine Art ländliche Volksmusik dargestellt, und tatsächlich liegt man mit dieser Beschreibung bei vielen seiner Protagonisten nicht ganz falsch. Im frühen 20sten Jahrhundert wurde der Blues allerdings auch zu einer wichtigen Bühnenmusik in den Varietés der Vereinigten Staaten, den Vaudeville-Shows, in denen bald auch Sängerinnen wie Ma Rainey, Bessie, Clara oder Trixie Smith zu hören waren. Lynn Abbott und Doug Seroff, die sich bereits in zwei vorausgegangenen Büchern mit der Frühgeschichte afro-amerikanischer Musik beschäftigt und dabei immer auch die Einbindung musikalischer Praktiken in die afro-amerikanische Community berücksichtigt haben, legen jetzt ein dickes Werk vor, das die Schnittstellen zwischen Blues und Showbusiness untersucht.
Im ersten Kapitel datieren sie die Geburt der schwarzen Vaudeville-Show ins Jahrzehnt zwischen 1899 und 1909, nennen Saloon-Theater etwa in Jacksonville, Tampa, Savannah, Louisville, New Orleans, Memphis oder Atlanta und beschreiben das Programm in solchen Shows, das Anklänge an die Minstrelshow des 19. Jahrhunderts besaß, sowie die Wahl des musikalischen Repertoires, das in ihnen zu hören war. Um 1910 gab es mehr als 100 kleine schwarze Vaudeville-Theater in den amerikanischen Südstaaten, die Tourneen von Texas nach Florida oder Virginia erlaubten und sogar dazu führten, dass Künstler aus Chicago oder dem Mittleren Westen in den Süden kamen, um hier zu touren.
Etwa um 1910 auch machte Butler May von sich reden, der als “String Beans” große Bühnenerfolge als Sänger und Komiker feierte. Die Autoren verfolgen im zweiten Kapitel ihres Buchs die Karriere dieses Entertainers, der bald zusammen mit seiner Frau Sweetie Matthews unter dem Namen May & May auftrat und nicht nur im Süden der USA, sondern auch in New York und anderswo zu erleben war. Für eine Beschreibung der Musik müssen sie sich dabei auf zeitgenössische Presseberichte verlassen, da String Beans nie ins Studio ging. Sein Einfluss allerdings war riesig; nicht nur nahmen etliche Bluessängerinnen später Stücke aus seinem Repertoire auf und hielten etwa W.C. Handy, Jelly Roll Morton und andere große Stücke auf ihn, der “String Beans Blues” wurde zudem in zahlreichen Aufnahmen zitiert.
Kapitel 3 beleuchtet männliche Bluessänger, die auf den Vaudevillebühnen im Süden auftraten, etwa Baby Seals, Charles Anderson und andere. Kapitel 5 erklärt, wie dieselben Bühnen dazu führten, dass Bluessängerinnen wie Ma Rainey und Bessie Smith populär wurden, die hier ihr Handwerk lernten. In einem Zwischenkapitel gehen die Autoren auf die Realität des Tourneelebens ein, beschreiben die Aufgabe von Agenturen wie T.O.B.A., der Theatre Owners Booking Association, die dafür sorgten, dass Künstler Anschlussengagements erhielten, die bei diesen allerdings nicht nur beliebt waren.
Kapitel 5 schließlich führt uns in die 1920er Jahre, als der Blues mehr und mehr auch ein kommerzielles Geschäft darstellte, beleuchtet die Folgen von “Shuffle Along”, jener rein afro-amerikanischen Show, die 1921 enorme Erfolge am Broadway feierte, aber auch außerdem die Auswirkungen der Schallplattenindustrie, die insbesondere schwarze Bluessängerinnen für ihre “race records” entdeckte, also jenen Teil der Produktion, der sich primär an afro-amerikanische Käufer wandte. Die Autoren beschreiben geschäftliche Usancen, sowohl in Bezug auf Auftritte und Tourneen als auch in Bezug auf Plattenaufnahmen, nennen Gagen und Honorare und erzählen, wie viele der Künstler sich, insbesondere, wenn sie im Süden tourten, mit rassistischen Übergriffen konfrontiert sahen.
70 Seiten Fußnoten, ein ausführlicher Namens-, Titel- und Ortsindex belegen, wie akribisch Abbott und Seroff für ihr Buch recherchiert haben. In jedem Teilkapitel, in dem sie die Beziehung einzelner Künstler/innen mit den Vaudevillebühnen beschreiben, steckt so viel an neuen biographischen und kulturhistorischen Einsichten, dass man den Blues der 1920er Jahre und die Professionalität der vielen in dieser Musik aktiven Künstler/innen nach der Lektüre mit deutlich anderem Blick sieht. Eine ungemein gelungene Perspektivverschiebung also, die zudem reich bebildert und spannend zu lesen ist.
Wolfram Knauer (Oktober 2017)
Jazz and Art. Two Steps Ahead of the Century
von Sharon Jordan
Hamburg 2017 (Edel earbooks)
220 Seiten, 3 beigeheftete CDs, 49,95 Euro
ISBN: 978-3-9435-7331-2
 Vor zwei Jahren zeigte das Kunstmuseum Stuttgart die sagenhafte Ausstellung “I Got Rhythm. Kunst und Jazz seit 1920”, die von einem ausführlichen Katalog begleitet wurde. Jetzt erscheint ein großformatiger Band der amerikanischen Kunsthistorikerin Sharon Jones, die sich ebenfalls – und, da es sich um keinen Ausstellungskatalog handelt, mit etwas mehr Freiheit bei der Auswahl der Abbildungen – mit dem Thema beschäftigt. Sie fragt, welche Wechselwirkungen Kunst und Jazz im 20sten Jahrhundert hatten, wie also der Jazz als Sujet in Gemälden auftaucht, wie auf der anderen Seite bildende Künstler Jazz als Inspirationsquelle für ihre Kunstwerke nutzten.
Vor zwei Jahren zeigte das Kunstmuseum Stuttgart die sagenhafte Ausstellung “I Got Rhythm. Kunst und Jazz seit 1920”, die von einem ausführlichen Katalog begleitet wurde. Jetzt erscheint ein großformatiger Band der amerikanischen Kunsthistorikerin Sharon Jones, die sich ebenfalls – und, da es sich um keinen Ausstellungskatalog handelt, mit etwas mehr Freiheit bei der Auswahl der Abbildungen – mit dem Thema beschäftigt. Sie fragt, welche Wechselwirkungen Kunst und Jazz im 20sten Jahrhundert hatten, wie also der Jazz als Sujet in Gemälden auftaucht, wie auf der anderen Seite bildende Künstler Jazz als Inspirationsquelle für ihre Kunstwerke nutzten.
Jordan gliedert ihr Buch in eine Einleitung (“Die Ursprünge der Moderne, 1960-1900”) und drei Großkapitel: “Ragtime und populäre Unterhaltung, 1900-1917”, “Das Jazz-Zeitalter in Europa und Amerika, 1920-1930” und “Nachkriegskunst und Jazz, 1940-1990”. Innerhalb dieser Kapitel identifiziert sie Stilrichtungen, künstlerische Ansätze sowie konkrete Künstler, deren Verhältnis zum Jazz sie in Unterkapiteln herausarbeitet. Da geht es dann einerseits um Primitivismus, den deutschen Expressionismus, um Kubismus und Abstraktion, um Surrealismus, Bauhaus und Neue Sachlichkeit, oder um die “entartete Kunst” und “entartete Musik” im Dritten Reich, andererseits um Künstler wie Man Ray, Francis Picabia, Picasso, Aaron Douglas und Archibald Motley, Stuart Davis, Alexander Calder, Otto Dix, Max Beckmann, Piet Mondrian, Henri Matisse, Jean Dubuffet, Jackson Pollock, Romare Bearden, Roy DeCarava, Andy Warhol, Larry Rivers und Jean-Michel Basquiat. Sie alle werden reich bebildert mit teils ganzseitigen, teils kleineren Beispielen, bekannteren Exempeln genauso wie eher selten gezeigten.
“Jazz”, beginnt Jordan ihre inhaltliche Argumentation, “war die erste wirklich moderne Kunstform, deren Ursprung in Amerika liegt.” Schnell wird klar, dass für ihr Thema eine differenzierte Sicht auf die Geschichte, die ästhetische und gesellschaftliche Haltung der Musik zu komplex ist und sie sich deshalb darauf beschränkt, Stereotype der Jazzgeschichtsschreibung als Kontext für das ihr eigentlich Wichtige, nämlich die Umsetzung der Musik in Farbe auf Leinwand, wiederzugeben. Also wird der Jazz wieder einmal (nur) in New Orleans geboren, das Schlagzeug spielt eine große Rolle, Ragtime heißt ursprünglich Stride (?), Kreolen sind hellhäutige Farbige und so weiter und so fort. Diese doch recht unbefangene Sicht auf Jazzgeschichte mag dem Jazzexperten stellenweise etwas zu klischeehaft sein, doch ist dieses Buch eher für den Neugierigen gedacht, der an beidem Spaß hat, Bildender Kunst des 20sten Jahrhunderts und Jazz. Die Individualitätsästhetik des Jazz begeisterte vor allem die modernen Bildenden Künstler, die ab dem Impressionismus ihre eigene Perspektive auf Kunst und Gesellschaft entwickelten. Jordan schildert anhand ihrer Unterkapitel, auf welche Diskurse innerhalb der Bildenden Kunst die Maler rekurrierten, welche Musikdarbietungen sie überhaupt sehen und hören konnten und welche ikonischen Konnotationen sie mit der Darstellung von Jazzszenen ansteuerten. Ihre Kapitel sind kurz und zusammenfassend, fokussiert auf die Rolle des Jazz für die Motivwahl, die Ausführung oder überhaupt fürs Denken der behandelten Künstler oder Stile. Sie zeigt, dass die Faszination mit dem Jazz in Europa genauso wie in Amerika Künstler beflügelte, bleibt in ihren Ausführungen weitgehend beschreibend, geht etwa in Bezug auf Action-Painting-Bilder etwa von Jackson Pollock aber auch auf die Transformation improvisatorischer Praktiken in die malerische Umsetzung ein.
Jordans Buch ist dabei eine durchaus lesenswerte Einführung ins Thema. Von Sonia Delaunay abgesehen, die in einem der Kapitel wenigstens kurz erwähnt wird, behandelt sie keine Künstlerinnen, sondern ausschließlich Männer. Neben der Lektüre aber kann der Leser sich vor allem über die beigehefteten CDs freuen, von denen jede einzelne für eines der drei Kapitel steht und diesen die passende Begleitmusik liefert. Von der Original Dixieland Jazz Band über Jelly Roll Morton und Fats Waller bis zu den Boogie-Woogie-Pianisten, von Louis Armstrong über Count Basie und Duke Ellington bis zu Marlene Dietrich und den Weintraub Syncopators, von Charlie Parker über Art Blakey und Miles Davis bis zu John Coltrane: Die Auswahl der Titel korrespondiert zur Erwähnung in einzelnen Unterkapiteln und hält den Leser bei der Stange, lässt ihn vielleicht weitere Facetten in den Abbildungen entdecken.
Und so ist “Jazz and Art” trotz des etwas holzschnittartigen Verständnisses von Jazzgeschichte ein durchaus empfehlenswertes Buch für Jazz- genauso wie für Kunstfreunde, ein im wahrsten Sinne bunter und swingender Blick auf die Kunstdiskurse des 20sten Jahrhunderts und darauf, wie diese durch eine afro-amerikanische Kulturpraxis neue Impulse erhielten.
Wolfram Knauer (Oktober 2017)
The Art of Conduction. A Conduction Workbook
von Lawrence D. “Butch” Morris (herausgegeben von Daniela Beronesi)
New York 2017 (Karma)
220 Seiten, 40 US-Dollar
ISBN: 978-1-942607-42-7
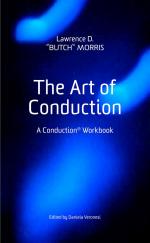 Dirigierte Improvisation: Der im Januar 2013 verstorbene Kornettist Butch Morris hatte sein Leben lang an diesem Traum gearbeitet: als Dirigent vor einem Ensemble jedweder Größe stehen zu können, das improvisiert, jedem einzelnen der Musiker seine individuelle Kreativität zu belassen und doch die Fäden all dessen in der Hand zu behalten und aus der freien Improvisation der Einzelnen eine gelenkte Improvisation des Ensembles zu machen. Das Spannende dabei: Keiner fühlte sich durch Morris’ Dirigat eingeschränkt, alle empfanden das Ergebnis als ein eindrückliche Bündelung ihrer individuellen kreativen Energie. Morris hatte dafür quasi ein Alphabet an Handgesten entwickelt, die er einsetzte, egal ob er mit wenigen Musiker/innen oder mit übergroßen Ensembles arbeitete, und die er über die letzten zehn Jahre seines Lebens für das jetzt veröffentlichte Buch zusammenfasste.
Dirigierte Improvisation: Der im Januar 2013 verstorbene Kornettist Butch Morris hatte sein Leben lang an diesem Traum gearbeitet: als Dirigent vor einem Ensemble jedweder Größe stehen zu können, das improvisiert, jedem einzelnen der Musiker seine individuelle Kreativität zu belassen und doch die Fäden all dessen in der Hand zu behalten und aus der freien Improvisation der Einzelnen eine gelenkte Improvisation des Ensembles zu machen. Das Spannende dabei: Keiner fühlte sich durch Morris’ Dirigat eingeschränkt, alle empfanden das Ergebnis als ein eindrückliche Bündelung ihrer individuellen kreativen Energie. Morris hatte dafür quasi ein Alphabet an Handgesten entwickelt, die er einsetzte, egal ob er mit wenigen Musiker/innen oder mit übergroßen Ensembles arbeitete, und die er über die letzten zehn Jahre seines Lebens für das jetzt veröffentlichte Buch zusammenfasste.
Die Linguistin Daniela Veranesi traf Morris erstmals 2002, war fasziniert von seinem Konzept und organisierte bald Conduction-Workshops mit ihm in Italien. Kurz vor seinem Tod gab Morris ihr auf den Weg, das Buch fertigzustellen und bat sie, “Make it clear, elegant and ‘travelable'”. Nun ist es zum Reisen fast ein wenig zu umfangreich geworden, großformatig mit festen Seiten und festem Einband, aber die Klarheit und Eleganz ist auf jeden Fall da.
Nach Vorworten von Howard Mandel, der Butch Morris’ Konzept in die Geschichte des Jazz und der afro-amerikanischen Musik einbindet, und der Herausgeberin, die erklärt, wieso sie diese Aufgabe übernahm und wie sie das Buch strukturierte, sowie Erfahrungsberichten des Posaunisten J.A. Deane und des Dichters Alan Graubard beginnt der eigentliche, Morris’ Handschrift tragende und durch seine Erklärungen eingeleitete Teil.
Morris erklärt, was Conduction zu leisten in der Lage ist, wie er aus seinen Erfahrungen mit Conduction kreative Lehren gezogen habe in Bezug auf Musik und seine eigene musikalische Ausdrucksweise, aber auch in Bezug auf die teilnehmenden Musiker/innen, weil er Conduction als “Akt der Gemeinschaft” versteht, an dem Musiker jedweden Hintergrunds teilnehmen können. Er erklärt die Aufgabe des Dirigenten, die Rolle der einzelnen Musiker/innen, die Gesamtheit des Ensembles, sowie die Notwendigkeit Geduld zu haben und Conduction als musikalische Praxis zu üben. Den Hauptteil des Buchs macht dann die Klassifikation der Handgesten aus, sortiert nach “Beginn und Ende gemeinsamer Aktion”, “Dynamik”, “Artikulation”, “Wiederholung”, “Rhythmik”, Tempo”, Tonalität und Tonhöhe”, verschiedene Arten der “Transformation”, herausragende “Events”, “Effekte bzw. Instrumentenspezifische Vorgaben”, und das Steuern einer Performance durch vorab notierte Passagen. Jede Geste erhält eine eigene Seite mit erklärenden Zeichnungen, Beschreibungen und Kommentaren. Schließlich folgen ein Interview mit Butch Morris sowie Notizen und Sketche aus Morris’ Notizbüchern über die verschiedenen Aspekte von Conduction. J.A. Deane, der selbst Morris’ Methode der Conduction verwendet, und Daniela Beronesi ergänzen das alles mit praktischen Übungen. Eine Chronologie führt die verschiedenen Conduction-Performances Butch Morris’ von 1985 bis zu seinem Tod vor Augen und nennt die daran beteiligten Musiker/innen auf mehreren Kontinenten; eine Diskographie listet veröffentlichte Aufnahmen seiner Conductions.
Butch Morris hat mit der Conduction eine Ausdruckspraxis entwickelt, die das Ensemble als aus vielen Individuen bestehende improvisierende Einheit ernst nimmt. Sein Handbuch ermöglicht es Musiker/innen mit seinem Vokabular weiterzuarbeiten, es um eigene Gesten oder Ideen zu erweitern und diese fürwahr genre- und kulturüberschreitende kreative Praxis lebendig zu halten. Morris traf sich in den letzten Jahren seines Lebens jeden Montagabend mit Musiker im New Yorker Stone, von denen einige öfters dabei waren, andere zum ersten Mal, und jeder Workshop war zugleich ein neues Kennenlernen und eine neue Performance, die man, auch im Publikum, im gesamten gemeinsamen Entstehungsprozess erleben konnte. Daniela Veronesi ist mit der Herausgabe von “The Art of Conduction” eine angemessene Umsetzung des Morris’schen Konzepts gelungen, ein Buch, dem zu wünschen ist, dass es von Musiker/innen auf der ganzen Welt – und durchaus auch in anderen Genres als dem Jazz – eingesetzt wird.
Wolfram Knauer (Oktober 2017)
For the Love of Music
Von Nathalie Lans
Amsterdam 2017 (Scriptum)
112 Seiten
ISBN: 978-94-6319-111-1
 Das Konzept ist einfach: Natalie Lans bat 50 Musiker/innen, ihr zu sagen, was Musik für sie bedeutet. Die kurzen prägnanten Antworten machen, zusammen mit einer kurzen Biographie der Interviewten, die eine Hälfte einer Doppelseite aus, deren zweite Hälfte aus einem aussagekräftiges Konzertfoto von vier Fotografen und einer Fotografin besteht. Die ausgewählten Musiker stammen aus den Niederlanden und den USA, ihre Antworten sind jeweils in der eigenen Sprache abgedruckt, in Holländisch und in Englisch. Vom Pianisten Marco Apicello geht es also alphabetisch bis zum Saxophonisten Bart Wirtz, und ihre Antworten sprechen von der ungemein persönlichen Betroffenheit und Hingabe, die es verlangt, diese Musik zu machen.
Das Konzept ist einfach: Natalie Lans bat 50 Musiker/innen, ihr zu sagen, was Musik für sie bedeutet. Die kurzen prägnanten Antworten machen, zusammen mit einer kurzen Biographie der Interviewten, die eine Hälfte einer Doppelseite aus, deren zweite Hälfte aus einem aussagekräftiges Konzertfoto von vier Fotografen und einer Fotografin besteht. Die ausgewählten Musiker stammen aus den Niederlanden und den USA, ihre Antworten sind jeweils in der eigenen Sprache abgedruckt, in Holländisch und in Englisch. Vom Pianisten Marco Apicello geht es also alphabetisch bis zum Saxophonisten Bart Wirtz, und ihre Antworten sprechen von der ungemein persönlichen Betroffenheit und Hingabe, die es verlangt, diese Musik zu machen.
Beispiele: “Ich sehe den Sound wirklich” (Matt Wilson) – “Live das zu spielen, was man gedacht hat, und es mit seinem Publikum zu teilen. Magisch!” (Jeffrey Spalburg) – “Afrikanische und afro-amerikanische polyrhythmische Sounds fließen durch meine Venen. Ich höre sie in der Natur, im Schlaf, in der Art und Weise, wie wir sprechen” (Camille Sledge) – “Musik dringt bis in die Knochen vor, egal, ob es ein Instrument gibt, mit dem man sie ausdrücken kann oder nicht” (Miron Rafajlovic) – “Musik zeigt das Innenleben des Menschen, das wir mit den Augen nicht sehen können; es zeigt das menschliche Herz” (Steve Nelson) – “Ein Leben ohne Musik ist meine Vorstellung der Hölle!” (Kit Morgan) – “Für mich ist Musik der Gesang der Vögel am Morgen” (Chris Jagger) – “Musik ist eine Reflexion der menschlichen Existenz und ein Hauch Gottes” (Gene Jackson) –”Musik bewegt mich, beruhigt mich, befreit meinen Kopf” (Bernard Fowler) – “Musik kann das perfekte Zusammenleben sein” (Ben van den Dungen) – “Musik beschreibt meinen wirklichen Charakter und meine Leidenschaft: meine Seele” (Joseph Bowie) – “Musik ist mein Sauerstoff” (Zep Barnasconi).
Allein diese Auswahl an Beispielen zeigt die Bandbreite der Künstler/innen, die Nathalie Lans bat, ihre eigene Philosophie über die Musik auszubreiten. Arrivierte und junge Musiker, internationale Stars und nationale Aufsteiger: Letzten Endes ist es egal, wen man fragt: Wenn Künstler sich intensiv mit den Gründen auseinandergesetzt haben, warum sie Musik machen, werden sie dazu etwas zu sagen haben.
Nathalie Lans’ Buch ist ein schön layoutetes Coffeetable-Buch, zum Blättern mehr als zum In-einem-Stück-Lesen. Ein grundlegendes Verständnis der holländischen Sprache ist von Vorteil.
Wolfram Knauer (Oktober 2017)
Komponieren & Dirigieren. Doppelbegabungen als Thema der Interpretationsgeschichte
herausgegeben von Alexander Drčar & Wolfgang Gratzer
Freiburg 2017 (Rombach Verlag)
630 Seiten, 78 Euro
ISBN: 978-3-7930-9861-4
 Es gab in der Musikgeschichte immer wieder Doppelbegabungen, Komponisten, die zugleich dirigierten oder Dirigenten, die zugleich komponierten. Mit diesem – zugegeben dennoch recht speziellen – Phänomen beschäftigt sich das vorliegende, von den beiden am Salzburger Mozarteum wirkenden Musikwissenschaftlern Alexander Drčar und Wolfgang Gratzer herausgegebene Buch. Die für den Band beauftragten Autoren sollten sich insbesondere auf drei Fragen konzentrieren: “(1) Welche Rolle spiel(t)en die Tätigkeiten des Komponierens und Dirigierens in der künstlerischen Entwicklung des jeweils thematisierten Künstlers? (2) Inwiefern lassen sich Wechselwirkungen zwischen den Tätigkeiten des Dirigierens und Komponierens dokumentieren? (3) Welche Entwicklung nahm bzw. nimmt die Rezeption dieser Doppeltätigkeit?”
Es gab in der Musikgeschichte immer wieder Doppelbegabungen, Komponisten, die zugleich dirigierten oder Dirigenten, die zugleich komponierten. Mit diesem – zugegeben dennoch recht speziellen – Phänomen beschäftigt sich das vorliegende, von den beiden am Salzburger Mozarteum wirkenden Musikwissenschaftlern Alexander Drčar und Wolfgang Gratzer herausgegebene Buch. Die für den Band beauftragten Autoren sollten sich insbesondere auf drei Fragen konzentrieren: “(1) Welche Rolle spiel(t)en die Tätigkeiten des Komponierens und Dirigierens in der künstlerischen Entwicklung des jeweils thematisierten Künstlers? (2) Inwiefern lassen sich Wechselwirkungen zwischen den Tätigkeiten des Dirigierens und Komponierens dokumentieren? (3) Welche Entwicklung nahm bzw. nimmt die Rezeption dieser Doppeltätigkeit?”
Die Bandbreite des Buchs reicht von Joseph Haydn bis Johannes Kalitzke, von klassischer Musik über Neue Musik bis zur Filmmusik und zum Jazz. Den Jazz berühren dabei vor allem vier Kapitel, von denen der “Überblick über die Tradition von Komposition und Dirigat im Jazz” von Wolfram Knauer (full disclosure: also dem Autor auch dieses Textes) versucht einige grundlegende Fragen zu klären darüber, was überhaupt Komposition im Jazz bedeutet und inwieweit diese sich von Komposition in insbesondere europäischen Musikgenres unterscheidet, welche Techniken des Dirigats Jazzmusiker von Count Basie über Duke Ellington bis zu Thad Jones oder Butch Morris verwandten, um dann in zwei Interviews mit Dieter Glawischnig und Mathias Rüegg deren Herangehensweise an die Themen Komposition und Dirigat zu diskutieren. Alexander Drčar spricht mit dem Posaunisten, Komponisten und Dirigenten Christian Muthspiel über die verschiedenen Anforderungen zwischen den Welten des Jazz und der klassischen Musik, die er zumindest in seiner Arbeit recht klar getrennt hält, aber auch über den Respekt des Dirigenten vor den Anweisungen des Komponisten und darüber, was er als Komponist aus seinen Erfahrungen als Dirigent gelernt hat. Joachim Brügge beschreibt, wie die Filmmusiken Bernard Herrmanns (etwa für Hitchcocks “Psycho” oder “Die Vögel”) von seinen Erfahrungen als klassischer Dirigent profitiert hatten. Frédéric Döhl schließlich diskutiert in seinem Beitrag die Parallelen und Unterschiede in der Herangehensweise vierer klassischer Musiker – Antal Doráti, Igor Markevitch, André Previn und Lorin Maazel – von denen Previn auch einen Jazzbackground besitzt.
In seiner Gesamtheit gibt in diesem Buch viele kluge Hinweise darauf, wie wichtig ein Dirigat zur Umsetzung von (insbesondere klassischen) Kompositionen sein kann, wie die intime Annäherung an komponierte Werke zahlreiche Dirigenten dazu animierte, selbst kompositorisch tätig zu werden, wie auf der anderen Seite Komponisten, sofern sie zugleich dirigierten, ein verstärktes Bewusstsein für die Interpretation und Interpretierbarkeit auch ihrer eigenen Werke erhielten.
Wolfram Knauer (August 2017)
100 Jahre Jazz. Von der Klassik bis zur Moderne. Die größten Stars
von Philippe Margotin
Bielefeld 2017 (Delius Klasing Verlag)
424 Seiten, 59,90 Euro
ISBN: 978-3-667-10607-0
 Endlich ein Buch zum 100sten Geburtstag des Jazz, das “größte Freude” bereitet – allerdings nur, wenn man Spaß an Stilblüten und Fehlern auf gefühlt jeder einzelnen Seite hat!
Endlich ein Buch zum 100sten Geburtstag des Jazz, das “größte Freude” bereitet – allerdings nur, wenn man Spaß an Stilblüten und Fehlern auf gefühlt jeder einzelnen Seite hat!
Philippe Margotin hat bislang Bücher über die Beatles, die Rolling Stones oder Bob Dylan geschrieben; als Jazzautor dagegen tat er sich eher weniger hervor. Zum 100sten Jahrestag der ersten Jazzaufnahme hat er nun einen schweren Wälzer vorgelegt, ein dickes Buch mit zahlreichen Fotos, auf dem die Helden der einhundertjährigen Jazzgeschichte gefeiert werden. Margotin unterteilt diese Geschichte in eine “erste Epoche” (New Orleans, Hot Jazz, Swingära) und eine “zweite Epoche” (Bebop, Cool Jazz, Hard Bop, Neue Klangwelten). In dieses Raster passt er dann Portraits von 63 Künstlerinnen und Künstlern des Jazz ein (nun ja: 58 Künstlern und 5 Künstlerinnen, von denen bis auf Carla Bley alle Sängerinnen sind), den großen Namen des Genres, von Armstrong über Parker, Miles bis zu Coltrane. Ornette Coleman und die allzu experimentelle Fraktion fehlen, dafür werden zum Schluss mit Steve Coleman und Esbjörn Svensson noch zwei Musiker mit aktuellem Einfluss aufgenommen. Pro Musiker meist 6 Seiten: stichwortartige Lebensdaten, kurzer biographischer Essay, drei Fotos sowie eine einseitige Würdigung der musikalischen Stilistik des betreffenden Künstlers, oft anhand zitierter Fremdlektüre.
So weit, so gut, so erwartbar. Natürlich könnte man über die Auswahl der Portraitierten streiten, doch sind solche Entscheidungen nun wirklich Sache des Autors und akzeptabel, wenn ihre Bedeutung erklärt und ihr Schaffen sinnvoll in den Kontext der Jazzgeschichte eingepasst wird. Man mag sich über einige der Zuordnungen wundern – warum etwa werden Coleman Hawkins und Lester Young unter die Überschrift “Diven und Romantik” sortiert und was hat Nat King Cole im Großkapitel “Hard Bop und Soul Jazz” zu suchen? (S. 314) –, aber auch das wären Kleinigkeiten, vielleicht sogar interessante Schlaglichter, sofern der Rest stimmt. Bei Margotin aber stimmt so wenig, dass man geneigt ist, auch dem Rest zu misstrauen. Und als Rezensent hat man noch eine weitere Schwierigkeit: Man weiß zuweilen nicht, ob die Fehler dem Autor oder den beiden Übersetzerinnen anzulasten sind, die für eine eher holprige als spannende Lektüre verantwortlich zeichnen.
Vielleicht erklärt sich das grundlegende Missverständnis von Jazzgeschichte als einer Heldengeschichte ja bereits aus den Quellen, die Margotin in seiner Bibliographie angibt. Kein einziger Literaturhinweis, der nach 2000 publiziert wurde; eine erstaunlich unkritische Sammlung an Büchern von Journalisten und Jazzkennern der vorletzten Generation, aus einer Zeit also, als man Jazzgeschichte noch als eine Abfolge klar umgrenzter Stilistiken und genialer Einfälle einzelner Individuen darstellte, nicht als ein Ineinandergreifen persönlicher künstlerischer Aussagen, allgemeiner – und zwar weit über den Jazz hinausreichender – ästhetischer Diskurse, und wirtschaftlicher Zwänge. Mit solch einem Verständnis von Jazz und der völligen Unkenntnis aktueller Diskurse auch über Jazzgeschichte lässt sich wahrscheinlich kein anderes Buch schreiben. Selbst unter diesen Voraussetzungen allerdings ist “100 Jahre Jazz” so voller Fehler, Ungenauigkeiten, Verallgemeinerungen und Stilblüten, dass man für knapp 60 Euro wahrlich Besseres erstehen kann.
Mehr wahllos als systematisch seien hier also ein paar Beispiele für die Sorglosigkeit angeführt, mit der das Thema behandelt wird: Dass Paul Whiteman als erstes Beispiel für “Die Swingära” genannt wird (S. 65) ließe sich zumindest diskutieren (wird es aber nicht). Duke Ellingtons Orchester nennt Margotin eine “Swingband” (S. 80), lässt dabei völlig außer Acht, dass dieses so ganz anders als die üblichen Swingorchester funktionierte, selbst wenn sich auch Ellington auf dem Markt der Swingmusik bewegte. Dessen “Black, Brown and Beige”, heißt es (S. 80), habe “länger als eine Stunde” gedauert, wo es tatsächlich gut 45 Minuten waren. Und Benny Goodman, dessen problematische Führungsqualitäten Legende sind, wird unerklärterweise als ein “Menschenführer” gelobt (S. 93).
Dass dem Lektorat etliche Tippfehler entgingen, zeigt, wie wenig sorgfältig hier auf allen Ebenen gearbeitet wurde. Da ist vom “Livery Staple Blues” die Rede (S. 59), wird “Joachim-Ernst Behrendt” mit “h” geschrieben (S. 87) und “Miles Davies” mit einem zusätzlichen “e” (S. 142). Und Bennie Motens Aufnahme “Prince of Wails” heisst eben nicht “Prince of Wales” (S. 97). Auch inhaltlich reicht es von flüchtig bis ignorant: Sonny Greer spielte nie bei Count Basie (S. 98) – das war Sonny Payne. Und wenn man schon die Basie-Rhythmusgruppe heraushebt, ist es irreführend, die erste Besetzung mit Clifford McYntire (!), Walter Page und Jesse Price zu erwähnen, Freddie Green aber nur in einem Halbsatz zu streifen (S. 98) und auf die Bedeutung von Jo Jones ebenfalls nicht hinzuweisen. Dass Bobby Hackett im Artikel über Glenn Miller als “Trompeter und Gitarrist” identifiziert wird (S. 117), ist zwar richtig, aber irreführend. Und Jan Garbarek in der Überschrift zum ihn betreffenden Artikel “Ethno-Jazz auf dem Altsaxophon” zuzuschreiben (S. 392), verfälscht das Hauptinstrument des Saxophonisten. In letzterem Fall mag man fast schon entschuldigend ahnen, dass vielleicht jemand das gebogene Sopran auf dem Bild gegenüber falsch identifiziert haben mag – aber ist das wirklich eine Entschuldigung?
Dizzy Gillespie reiste nicht im Auftrag des Weißen Hauses (S. 232, 236), sondern in dem des amerikanischen State Department in den Mittleren Osten. Dass Fats Waller andererseits “eine Weile in Paris” lebte (S. 124) ist übertrieben – er verbrachte 1932 vielleicht anderthalb Monate in Frankreich, eher also eine Art ausgedehnten Urlaub. Keine Ahnung, wer für das großartige Foto von Illinois Jacquet verantwortlich zeichnet, das den Artikel zu Roy Eldridge ziert und auf dem Jacquet als der Trompeter identifiziert wird, obwohl er doch eindeutig ein Saxophon bedient (S. 157; ein Auge und der Haaransatz Eldridges ist immerhin abgebildet). Das Foto von Al Grey im Artikel zu J.J. Johnson (S. 249) wird im Untertext wenigstens richtig identifiziert, nur: Warum? Warum nicht eher Kai Winding? Dass der Autor es als eine wichtige Information über Billie Holiday erachtet, dass sie keinen Sex mit Lester Young gehabt habe (S. 198), mag man ebenfalls unter der Rubrik “Warum?” verbuchen. Und Coleman Hawkins’ Aufnahme von “I’ll Be Glad When You’re Dead, You’re Rascal You” ist nur ein einziges Stück und nicht zwei, wie auf S. 209 zu lesen ist.
Andere Fehler sind klar den Übersetzerinnen zuzuschreiben. “Die Revue Negrè” hieß genauso und nicht “Black Revue” (S. 47), und Teddy Hills “Revue ‘The Cotton Club Show'” (S. 235) hieß tatsächlich “The Cotton Club Revue”. Was die Überschrift “Rückkehr zur Gnade” im Artikel zu Sidney Bechet (ebenfalls S. 47) zu bedeuten hat, erschließt sich wahrscheinlich erst, wenn man die französische Originalausgabe des Buchs zur Hand hat. Ähnliches gilt für die Überschrift “Riverboats in Harlem” im Artikel über Henry Red Allen (S. 147), die wahrscheinlich “Von den Riverboats nach Harlem” heißen sollte. Über eine frühe Charlie Parker-Aufnahme zitiert Margotin Ross Russell: “Der Hootie Blues verursachte bei allen Musikern, die ihn zunächst nur zufällig hörten, einen Aufruhr…” (S. 231) – so weit im Buch hat man allerdings die Lust zur Nachforschung darüber verloren, was Russell wohl wirklich geschrieben hat, und ergibt sich in der Erkenntnis, dass im Verlauf der “Stillen Post”, der Mehrfachübersetzung (englisch – französisch – deutsch) also, irgendetwas, im schlimmsten Fall einfach der Sinn, verloren gegangen ist. Begriffsübertragungen wie “falscher Fingersatz” für “false fingering” im Artikel über Bix Beiderbecke (S. 61) machen im Deutschen keinen wirklichen Sinn, und was die auf derselben Seite erwähnten “synonymen Noten” sein sollen, mag man erahnen, der Nutzwert solch innovativer Übersetzungen ist für den Leser allerdings eher gering.
Über Dizzy Gillespie heißt es: “Und schließlich zeigte Dizzy Gillespie mit seinem leichthändigen Umgang mit dem Spott, ja manchmal sogar ausgesprochenem Blödsinn, dass man sehr wohl Jazz spielen konnte, ohne sich allzu ernst nehmen zu müssen” (S. 237) – Gillespies Bühnenscherze allerdings hatten weder mit Spott noch Blödsinn etwas zu tun, sondern mit Traditionen des afro-amerikanischen Showbusiness. Ob es so passend ist, Django Reinhardt in einer Zwischenüberschrift “erfolgreiche Kriegsjahre” zu attestieren, ist letzten Endes nicht nur Geschmackssache. Auch die Zwischenüberschrift “Die Qualen der künstlichen Paradiese” im Artikel über Charlie Parker (S. 230) lässt den Leser ratlos zurück. Warum “die Geistlichen in der Baptistenkirche [Duke Ellingtons] Botschaft [in dessen Sacred Concerts] allerdings nicht verstanden” (S. 80) blieb diesem Rezensenten unklar, wie überhaupt die Beschreibung von Ellingtons Stil (S. 81) hilflos wirkt und seiner Musik nicht wirklich nahe kommt.
Und so geht es durch das gesamte Buch: Eine Mischung aus Fehlern, Nachlässigkeiten, mangelndem Fachwissen oder mangelnder Recherche auf allen Ebenen der Produktion, dass es wirklich nur zwei Empfehlungen gibt: Für den jazzinteressierten Laien: Finger weg!!! Für den Jazzkenner: Warten, bis das Buch im modernen Antiquariat gelandet ist (das kann nicht so lange dauern), dann kaufen und mit Genuss weitere Stilblüten entdecken!
Wolfram Knauer (Juli 2017)
The Cambridge Companion to Duke Ellington
herausgegeben von Edward Green
Cambridge 2014 (Cambridge University Press)
296 Seiten, 29,99 US-Dollar (Paperback)
ISBN: 978-0-521-70753-4
Duke Ellington Studies
von John Howland
Cambridge 2017 (Cambridge University Press)
308 Seiten, 75 Britische Pfund (Hardcover)
ISBN: 978-0-521-76404-9
Neben Charlie Parker ist Duke Ellington wahrscheinlich der am meisten untersuchte Musiker der Jazzgeschichte. Sein kompositorisches Œuvre, sein Umgang mit Klangfarben, sein Einsatz einzelner Musiker, die Wandlung seiner musikalischen Sprache über mehr als fünf Jahrzehnte bieten mehr als genug Stoff für Untersuchungen aus allen möglichen Perspektiven. Jetzt sind innerhalb von nur zweieinhalb Jahren gleich zwei Sammlungen solcher Perspektiven beim Verlag Cambridge University Press erschienen. Die Herausgeber Edward Green und John Howland planten die beiden Bände ursprünglich als einander ergänzende Bücher, die dann in ihrer Konzeption ein Eigenleben entwickelten und so unabhängig voneinander veröffentlicht wurden.
 Im von Edward Green herausgegebenen “Cambridge Companion” wird Ellingtons Schaffen in 19 Kapitel abgehandelt, die ihn zum einen in den ästhetischen Kontext seiner Zeit einordnen sollen, zum zweiten seine Rezeption beleuchten und schließlich auf sein musikalisches Schaffen mit Bezug auf die Jazztradition eingehen. Wo dieses Buch zumindest in Teilen noch chronologisch angelegt ist, steht in den von John Howland herausgegebenen “Duke Ellington Studies” tatsächlich die Perspektive im Vordergrund: auf seine Musik, auf die Kritik, auf seine Rezeption in Großbritannien, auf seine Manuskripte, auf sein Konzept von Afrika, auf wegweisende Komposition und Alben wie etwa “Such Sweet Thunder oder “A Drum is a Woman”.
Im von Edward Green herausgegebenen “Cambridge Companion” wird Ellingtons Schaffen in 19 Kapitel abgehandelt, die ihn zum einen in den ästhetischen Kontext seiner Zeit einordnen sollen, zum zweiten seine Rezeption beleuchten und schließlich auf sein musikalisches Schaffen mit Bezug auf die Jazztradition eingehen. Wo dieses Buch zumindest in Teilen noch chronologisch angelegt ist, steht in den von John Howland herausgegebenen “Duke Ellington Studies” tatsächlich die Perspektive im Vordergrund: auf seine Musik, auf die Kritik, auf seine Rezeption in Großbritannien, auf seine Manuskripte, auf sein Konzept von Afrika, auf wegweisende Komposition und Alben wie etwa “Such Sweet Thunder oder “A Drum is a Woman”.
Als Autoren konnten beide Herausgeber ausgewiesene Ellington-Kenner genauso gewinnen wie weitsichtige Musikwissenschaftler oder Journalisten. In Howlands Buch etwa fragt David Berger nach dem Unterschied zwischen Komposition und Rekomposition in Ellingtons Werk, blickt Brian Priestley auf Ellingtons Reisen ins Ausland und verstehen Olly Wilson und Trevor Weston Ellington als eine kulturelle Ikone. In einem eher historischen Block betrachtet Jeffrey Magee Ellingtons afro-modernistische Vision der 1920er Jahre, Andrew Berish die Zeit zwischen Anpassung und Experiment in den 1930ern, Anna Harwell Celenza die Blanton-Webster Band sowie die Carnegie-Hall-Konzerte, Anthony Brown die 1950er und Dan Morgenstern die 1960er und 1970er Jahre. Die analytisch interessantesten Kapitel kommen zum Schluss, wenn Benjamin Givan auf die Bluesbehandlung beim Duke eingeht und Walter van de Leur auf die musikalische Beziehung zwischen Ellington und Billy Strayhorn, wenn Bill Dobbins Ellingtons Einfluss aufs Jazzklavier beleuchtet und Marcello Piras seine fast programmatischen Kompositionen, wenn Will Friedwald ihn als einen eher zufälligen Songschreiber charakterisiert, David Berger die Suiten des Duke miteinander vergleicht und Benjamin Bierman seinen Einfluss auf die Nachwelt untersucht.
 Dobbins und Van de Leur sind auch in den “Duke Ellington Studies” präsent, Dobbins mit einer Studie, die Dukes Klavierstil analysiert und Van De Leur mit einem Blick auf die Manuskripte in der Duke Ellington Collection der Smithsonian Institution. Phil Ford analysiert Ellingtons Selbstdarstellung als Afro-Amerikaner in frühen Filme und vergleicht diese mit der Selbstdarstellung des Präsidenten Barack Obama. John Howland hinterfragt die Interpretation Ellingtons in der frühen Jazzkritik als “ernsthafter” Jazzkomponist, Catherine Tackley verfolgt die Jazzrezeption des Duke über die Jahrzehnte in Großbritannien. David Schiff blickt hinter die auch politische Bedeutung des Albums “Such Sweet Thunder”, Gabriel Solis auf die Auswirkung des LP-Formats auf Ellingtons Œuvre, Carl Woidecks auf Ellingtons Bild von Afrika, wie es sich in seiner Musik abbildet, und John Wriggle auf “A Drum Is a Woman” als “Mother of All Albums”
Dobbins und Van de Leur sind auch in den “Duke Ellington Studies” präsent, Dobbins mit einer Studie, die Dukes Klavierstil analysiert und Van De Leur mit einem Blick auf die Manuskripte in der Duke Ellington Collection der Smithsonian Institution. Phil Ford analysiert Ellingtons Selbstdarstellung als Afro-Amerikaner in frühen Filme und vergleicht diese mit der Selbstdarstellung des Präsidenten Barack Obama. John Howland hinterfragt die Interpretation Ellingtons in der frühen Jazzkritik als “ernsthafter” Jazzkomponist, Catherine Tackley verfolgt die Jazzrezeption des Duke über die Jahrzehnte in Großbritannien. David Schiff blickt hinter die auch politische Bedeutung des Albums “Such Sweet Thunder”, Gabriel Solis auf die Auswirkung des LP-Formats auf Ellingtons Œuvre, Carl Woidecks auf Ellingtons Bild von Afrika, wie es sich in seiner Musik abbildet, und John Wriggle auf “A Drum Is a Woman” als “Mother of All Albums”
Beide Bücher richten sich auf wohltuende Art und Weise an Experten und interessierte Fans gleichermaßen. Sie sind nicht als Biographien des Duke gedacht, sondern als Versuch, sein Werk aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit unterschiedlichem Fokus zu beleuchten. Sie sind ausführlich annotiert und belegen auch damit das Eingangsstatement dieser Rezension: dass nämlich Ellington schon lange nicht nur ein Säulenheiliger der Jazzgeschichte, sondern auch einer der Jazzforschung ist.
Wolfram Knauer (Juni 2017)
New Jazz Conceptions. History, Theory, Practice
herausgegeben von Roger Fagge & Nicolas Pillai
New York 2017 (Routledge)
209 Seiten,110 Britische Pfund
ISBN 978-1-84893-609-6
 “New Jazz Conceptions” hieß das Debütalbum von Bill Evans aus dem Jahr 1956 (nicht 1957 übrigens, wie die Herausgeber dieses Buchs in ihrem Vorwort schreiben), ein Album, das, so zumindest kann man im Rückblick sagen, tatsächlich etwas Neues heraufbeschwor im Jazz, sei es die sehr spezielle und enorm einflussreiche Spielweise des Pianisten, sei es ein neues Ineinandergreifen der Instrumente innerhalb der Klaviertrio-Besetzung im Jazz. “New Jazz Conceptions” hieß auch eine Konferenz an der University of Warwick im Mai 2014, deren Vorträge jetzt in Druckform vorliegen. Die Organisatoren und Herausgeber dieses Buchs Roger Fagge und Nicolas Pillai sind Vertreter der “New Jazz Studies”, eines Zweigs der Jazzforschung, der in den letzten Jahren versucht, sich zum einen stärker auf einzelne Facetten der Jazzgeschichte und ihres Umfelds zu fokussieren, der auf der anderen Seite den interdisziplinären Diskurs insbesondere auf den Jazz praktiziert. Eine solche neue Art von Jazzforschung, schreiben die Herausgeber, reagiere auf Veränderungen in der Musik, sei sich aber auch bewusst, dass sie Verantwortung dafür trage, wie wir die Musik in der Zukunft verstehen. Die Auswahl der Beiträge zur ersten Konferenz könne nur genau das sein, eine Auswahl verschiedener Ansatzpunkte, nehmen sie dann eine offenbar bereits erahnte Kritik vorweg, zu der wir dann zum Schluss auch gerne kommen werden.
“New Jazz Conceptions” hieß das Debütalbum von Bill Evans aus dem Jahr 1956 (nicht 1957 übrigens, wie die Herausgeber dieses Buchs in ihrem Vorwort schreiben), ein Album, das, so zumindest kann man im Rückblick sagen, tatsächlich etwas Neues heraufbeschwor im Jazz, sei es die sehr spezielle und enorm einflussreiche Spielweise des Pianisten, sei es ein neues Ineinandergreifen der Instrumente innerhalb der Klaviertrio-Besetzung im Jazz. “New Jazz Conceptions” hieß auch eine Konferenz an der University of Warwick im Mai 2014, deren Vorträge jetzt in Druckform vorliegen. Die Organisatoren und Herausgeber dieses Buchs Roger Fagge und Nicolas Pillai sind Vertreter der “New Jazz Studies”, eines Zweigs der Jazzforschung, der in den letzten Jahren versucht, sich zum einen stärker auf einzelne Facetten der Jazzgeschichte und ihres Umfelds zu fokussieren, der auf der anderen Seite den interdisziplinären Diskurs insbesondere auf den Jazz praktiziert. Eine solche neue Art von Jazzforschung, schreiben die Herausgeber, reagiere auf Veränderungen in der Musik, sei sich aber auch bewusst, dass sie Verantwortung dafür trage, wie wir die Musik in der Zukunft verstehen. Die Auswahl der Beiträge zur ersten Konferenz könne nur genau das sein, eine Auswahl verschiedener Ansatzpunkte, nehmen sie dann eine offenbar bereits erahnte Kritik vorweg, zu der wir dann zum Schluss auch gerne kommen werden.
Tim Wall widmet sich in seinem Beitrag einer Livesendung mit dem Duke Ellington Orchestra vom 14. Juni 1933 durch den BBC und fragt dabei, was diese Ausstrahlung einerseits für die Programmpolitik des Sendes, andererseits für die Wahrnehmung des Jazz im allgemeinen und Duke Ellingtons im Besonderen in Großbritannien bedeutete. Er blickt zurück auf die Jazzprogramme, die der Sender vor 1933 ausgestrahlt hatte und fragt, warum gerade Ellington die Ehre dieser Aufmerksamkeit zur besten Sendezeit zuteilwurde. Er untersucht den Wandel der öffentlichen Wahrnehmung von Jazz infolge des Ellington-Besuchs, der sich in Berichten genauso niederschlug wie in Schallplattenausgaben und der schließlich auch das Selbstverständnis der britischen Jazzszene und ihrer medialen Vermittlung weit über die 1930er Jahre hinaus mit prägte.
Tom Sykes schaut auf die Bildung von Szenen, die sich in den letzten Jahren durch die Einbeziehung und Benutzung sozialer Medien erheblich verändert habe. Er fragt, welchen Einfluss soziale Medien auf lokale Szenen haben und ob die neu entstandenen Szenen / Gruppen / Communities wohl auch ohne e-mail, Video-Sharing oder soziales Netzwerken bestehen könnten. Dabei benutzt er als Ausgangspunkt verschiedene soziologische Beschreibungen des Phänomens von Community, insbesondere mit Bezug auf Jazz, beschreibt den Unterschied zu virtuellen Communities und die Scheinhaftigkeit einer Gruppenzugehörigkeit etwa durch Online-Diskussionsforen. Schließlich gibt er einige konkrete Beispiele der Durchlässigkeit zwischen realen und virtuellen Szenen und schlussfolgert, dass, wenn auch virtuelle Netzwerke immer wichtiger werden, Jazzfans daneben auch in semi-virtuellen und lokalen Szenen verankert seien und der Jazz als Liveerlebnis daher nicht zur Disposition stünde.
Andrew Hodgetts betrachtet die diversen Versuche der britischen Musikergewerkschaft zwischen den 1930er und 1950er Jahren, ausländischen Musikern Auftritte im Land zu verbieten und so die einheimischen Kollegen zu schützen. Er gibt konkrete Beispiele für Auswirkungen etwa auf geplante Konzerte oder Tourneen amerikanischer Bands und vergleicht die protektionistischen Anstrengungen mit denen der amerikanischen Musikergewerkschaft sowie mit der Situation beispielsweise in Schweden und Frankreich zur selben Zeit. Schließlich beschreibt er den über die Jahre sich wandelnden Diskurs über Internationalität versus Protektionismus, der insbesondere im Melody Maker gut dokumentiert sei.
Nicolas Pillai nähert sich den unterschiedlichen Publikumsreaktionen auf Dave Brubeck anhand einer Fernsehaufnahme für den BBC im Jahre 1964 und der Diskussionen über die Tournee seines Quartetts aus dem selben Jahr in der britischen Presse. Brubeck war zu der Zeit bereits in die ästhetische Spalte zwischen “innovativem Jazz” und “zu kommerziell” geraten, eine Einschätzung, die sich auch in den Presseberichten über die Tournee niederschlug. Diese reflektieren über seine Hits genauso wie über sein Anwesen in Connecticut, und Pillai vergleicht die unterschiedlichen Berichte, die letzten Endes verantwortlich sind für die öffentliche Wahrnehmung des Pianisten in Großbritannien, mit der Fernsehdokumentation, in der zu erleben sei, dass diese Musik nach wie vor subkulturelle Qualitäten besäße, sich in einem konstanten Dialog auch mit populären Strömungen in der Musik befunden habe.
Katherine Williams konzentriert sich in ihrem Kapitel auf Duke Ellingtons legendäres Newport-Konzert vom Juli 1956, erzählt die Vorgeschichte und den Ablauf des Abends und berichtet über die Veröffentlichungsgeschichte des Mitschnitts, der zwar als “Live at Newport” herauskam, tatsächlich aber zum Teil im Studio nach-produziert worden war. Sie diskutiert die Faszination mit Live-Alben und die Problematik der Nachbearbeitungsmöglichkeiten – für die Künstler genauso wie für die ästhetische Einschätzung des scheinbar “historischen” Ereignisses.
Adrian Litvinoff beschäftigt sich mit Musikgeschmack im Jazz und fragt, warum es vielen Hörern so schwer falle, sich auf Neues, Unbekanntes einzulassen. Er hinterfragt die Rolle des Marktes für den Musikgeschmack und deutet an, wie stark letztlich auch die Hörerwartung das Hörerlebnis prägt.
Roger Fagge verfolgt den wandelnden kritischen und ästhetischen Ansatz dreier britischer Autoren und Kritiker. Philip Larkin hatte zeitlebens ein Problem mit dem modernen Jazz (also mit allem ab dem Bebop), und Fagge diskutiert einige seiner Verrisse über Konzerte und Platten der Hardbop- und frühen Free-Jazz-Generation. Kingley Amis’ Haltung gegenüber Miles Davis, Monk und anderen Vertretern des modernen Jazz war sehr viel positiver, er versuchte, wie Fagge schreibt, die Musik angemessen, “objektiv” zu beurteilen. Dennoch beklagte Amis sich gegenüber Larkins, dass er für seine Artikel im Observer heftig angegriffen würde. Beide hätten den Jazz im Gegensatz zu Eric Hobsbawm allerdings kaum als eine politische Musik verstanden. Letzterer veröffentlichte 1959 unter dem Pseudonym Francis Newton das Buch The Jazz Scene und schrieb für den New Stateman Kritiken, von denen Fagge besonders solche über den Avantgardejazz der 1960er Jahre hervorhebt. Fagge beschreibt die unterschiedlichen Beweggründe der drei Autoren, ihre jeweilige Herangehensweise an die Musik und ihren meist unausgesprochenen emotionalen wie intellektuellen Disput, der den Jazzdiskurs im Großbritannien der 1950er und 1960er Jahre gut umschreiben kann.
Mike Fletcher blickt auf die Gegenwart des Jazz in Großbritannien und fragt nach “Tradition, Community und musikalische Identität”, danach also, inwieweit aktuell aktive Musiker sich nach wie vor mit der Geschichte des Jazz und mit seinen Ursprüngen identifizieren, wie sie sich im Vergleich zu anderen musikalischen Entwicklungen verorten, und welche Auswirkungen all das auf ihre konkrete Musik hat. Er stellt die Frage danach, inwieweit man als improvisierender Musiker in Großbritannien immer noch die amerikanischen Roots im Blick habe, betont die Bedeutung persönlicher Lehrer-Schüler-Verhältnisse für den Jazz, diskutiert die Rolle, die Schallplatten für das Selbstverständnis von Musikern spielen, und spricht mit Musikern wie Soweto Kinch, Alexander Hawkins und anderen über ihre eigenes Selbstverständnis einer ethnischen genauso wie kulturellen Identität und wie sich dieses mit den diversen Bildern des Jazz verträgt. Schließlich fragt er nach der Bedeutung von Community für die Jazzmusiker-Szene und danach, inwiefern Musiker sich in einer Art britischer Traditionslinie verorten.
Nicholas Gebhardt wirft im Schlusskapitel einen Blick auf Alan Lomax’s Oral-History-Interview mit Jelly Roll Morton, das er 1938 für die Library of Congress aufnahm. Er fragt dabei nach den Inhalten der Geschichten, die Morton erzählt, nach dem Bild also, das dieser seinem Interviewer von sich selbst und von New Orleans vermitteln will. Ihn interessiert daneben aber auch Lomax’ Interesse an diesem Material, das helfen sollte, seinem eigenen historischen Verständnis der frühen Jazzgeschichte konkrete Inhalte zu geben, die die Legende zum Leben erwecken, dabei aber auch von der lebenslangen Erfahrung des Pianisten zehren kann.
Neun verschiedene Ansätze also, aus historischer, soziologischer, medienwissenschaftlicher, Sicht, die mal mit der Auswertung historischer Quellen, mal mit Textkritik, mal mit eigenem Interviewmaterial arbeiten. Die Autoren sind Wissenschaftler und Musiker, eine wichtige Mischung, da gerade im Jazz (aber nicht nur da) die Ausübenden immer eine Stimme haben sollten. Was fehlt, ist der direkte Bezug auf die erklingende Musik. Eine “neue Jazzforschung” kann eben auch nicht sein, nur über die Umstände, die Wahrnehmung oder die verschiedenen Arten der Reflektion über Musik zu sprechen. Sie sollte sich immer wieder auch an die Musik selbst herantrauen, zumindest ihre Fragen aus der Musik heraus entwickeln. Katherine Williams kommt dem in diesem Buch am nächsten, scheut dann aber, da sie so viel über die Umstände von Newport und der Rezeption des Konzerts erzählen muss, doch vor einer eingehenderen Diskussion der Musik selbst zurück. Aber den Herausgebern ist – und deshalb bleibt dies eher eine Anregung als eine Kritik – durchaus bewusst, dass die Beiträge ihrer Konferenz und dieses Buches alles andere als erschöpfend die Aspekte der “new jazz studies” betrachten können.
Wolfram Knauer (Juni 2017)
Keith Jarretts Klavier-Solokonzerte. Eine Stilanalyse von Keith Jarretts Solo-Klavierkonzerten aus den Jahren 1973 bis 1975
von Babak Pakzad
Saarbrücken 2017 (AV Akademikerverlag)
112 Seiten, 32,90 Euro
ISBN: 978-3-330-51516-1
 Ein wichtiger Teil in Keith Jarretts musikalischem Schaffen waren seine Solo-Performances, die sich Babak Pakzad in seiner Arbeit zum Thema macht. Der Autor braucht dazu keine große Einleitung, sondern geht gleich in medias res, beschreibt, wie Jarretts Solokonzerte üblicherweise mit einer fast meditativen Konzentrationsphase am Flügel beginnen, wie er dann eine Zelle vorgibt, einen einzelnen Ton etwa, aus dem heraus er die kreative Energie entwickeln kann. Er erklärt die Notwendigkeit, die Jarrett für Rituale empfindet, um bei Konzentration zu bleiben und warum ihn kleinste Geräusche, sei es ein Husten aus dem Publikum, aus dieser Konzentration reißen können. In einem zweiten Kapitel setzt Pakzad Jarretts Aussagen zur Improvisation in Verbindung zu philosophischen Einflüssen insbesondere durch George I. Gurdjieff. Im dritten Kapitel stellt er Entwicklungen im Jazz der 1960er Jahre vor, in denen diese Musik als eine politische Stimme wahrgenommen worden sei, in dem sich kulturelle Diskurse auch aus anderen Kunstgattungen der Zeit spiegeln.
Ein wichtiger Teil in Keith Jarretts musikalischem Schaffen waren seine Solo-Performances, die sich Babak Pakzad in seiner Arbeit zum Thema macht. Der Autor braucht dazu keine große Einleitung, sondern geht gleich in medias res, beschreibt, wie Jarretts Solokonzerte üblicherweise mit einer fast meditativen Konzentrationsphase am Flügel beginnen, wie er dann eine Zelle vorgibt, einen einzelnen Ton etwa, aus dem heraus er die kreative Energie entwickeln kann. Er erklärt die Notwendigkeit, die Jarrett für Rituale empfindet, um bei Konzentration zu bleiben und warum ihn kleinste Geräusche, sei es ein Husten aus dem Publikum, aus dieser Konzentration reißen können. In einem zweiten Kapitel setzt Pakzad Jarretts Aussagen zur Improvisation in Verbindung zu philosophischen Einflüssen insbesondere durch George I. Gurdjieff. Im dritten Kapitel stellt er Entwicklungen im Jazz der 1960er Jahre vor, in denen diese Musik als eine politische Stimme wahrgenommen worden sei, in dem sich kulturelle Diskurse auch aus anderen Kunstgattungen der Zeit spiegeln.
Keith Jarretts Solokonzerte sind schließlich Inhalt des vierten, nämlich des Hauptkapitels, das unter anderem die Rolle von Körper und stimmlicher Begleitung für seine Performances beschreibt, den formalen Ablauf seiner Soloexkurse und die Mischung unterschiedlicher Stileinflüsse. Pakzad betrachtet die formalen Bestandteile in Jarretts Solointerpretationen, etwa “stabile Passagen”, zu denen er verschiedene Arten von Vamps, Gospelstrecken oder solche zählt, die er als “Folk-Ballade” benennt, oder “instabile Passagen”, zu denen “Ballade”, “Rhapsodie”, “Drone”, freie Passagen und Choralhaftes gehören. Und schließlich legt er aufgrund dieser formalen Parameter eine tabellarische Ablaufanalyse der Konzerte “Lausanne”, “Bremen”, “Köln”, “Sunbear”, “Bregenz-München”, “Paris”, “Vienna”, “La Scala”, “Radiance”, “Carnegie Hall”, “Paris-London”, “Rio” und “Creation” vor. Zwei kurze Transkriptionen mit analytischen Anmerkungen, aber ohne Fragestellung oder Schlussfolgerung, schließen sich an, bevor Pakzad seine abschließende Unterteilung vornimmt: Es gäbe in Jarretts Solokonzerten vier “Zyklen”, nämlich einen ersten, der vor allem aus “Jazz-Improvisationen” bestehe, die voller Energie und emotionalem Ausdruck seien, einen zweiten, der “klassische Improvisationen” beinhalte, “weniger Abenteuer und Exploration in der Musik”, der “reifer” wirke und dessen “Strategien und Methoden” stärker “entwickelt” seien, einen dritten, der sich dadurch auszeichne, dass “die Stile sehr gut miteinander verschmelzen”, sowie einen vierten, in dem es keine langen Improvisationen mehr gebe, “sondern jeder Stil ist ein selbstständiges Stück”.
So schön so gut. Pakzads Arbeit bleibt an der Oberfläche, geht kaum wirklich in die Musik hinein, verallgemeinert die improvisatorische Praxis und ist leider in den wenigen Passagen, in denen er auf Jazzgeschichte eingeht, von wenig Sachkenntnis getrübt. Es gibt keine Fragestellung und dementsprechend auch kein Resümee. Seine Thesen zur Stilanalyse entnimmt er den Dissertationen von Gernot Blume und Peter Elsdon, wendet sie dann aber nur ansatzweise und dazu auch noch völlig unkritisch an, als würde ein einmal entdecktes System die Musik erklären können. Die Strukturskizzen der Solokonzerte bleibt an der Oberfläche der Musik, er untersucht weder melodische, harmonische noch rhythmische Verdichtungen. Pakzad nennt zwar die Bedeutung von Körperlichkeit und Spiritualität, findet dazu dann in der Musik selbst aber kein einziges Wort. Was das seltsame Kapitel über “Free Jazz” in seinem Text zu suchen hat, wird nirgends erklärt, ganz abgesehen davon, dass die darin behaupteten politischen, kulturellen und musikalischen Entwicklungen arg vereinfacht, wenn nicht gar falsch dargestellt werden. Da steht dann so etwas wie: “Im Free Jazz gewinnt die Idee des Rituals an Bedeutung. Er wird als Vereinigung mit dem Übernatürlichen beschrieben, in der es nicht um die Vereinigung der Musiker als einzelne Individuen geht, sondern um eine Einheit in einer größeren Gruppe. Diese Idee kann man auch in einem größeren Kulturellen Kontext verstehen, der auf eine die geografischen Grenzen außer Acht lassende Vereinigung der afrikanischen und der afroamerikanischen Gesellschaft verweist.” Pakzad hat offenbar nicht viel Ahnung davon, was Free Jazz wirklich war und wie sich der Stil entwickelte; er schwimmt, wie überhaupt in seinem Text, auf Gemeinplätzen dahin und subsumiert schließlich auch noch Sonny Rollins zu diesem Stil. Überhaupt zieren nicht nur für den Kenner erkenntliche Stilblüten den Text, der als Abschlussarbeit, wo auch immer, dem Autoren hoffentlich keine Lorbeeren eingebracht hat und dessen Veröffentlichung eher ärgerlich ist als dass sie auch nur irgendeinen neuen Aspekt in die Erforschung der Musik Keith Jarretts bringen würde.
Wolfram Knauer (Mai 2017)
New Orleans and the Global South. Caribbean, Creolization, Carnival
von Ottmar Ette & Gesine Müller
Hildesheim 2017 (Olms)
403 Seiten, 68 Euro
ISBN: 978-3-487-15504-3
 New Orleans wird als Wiege des Jazz gefeiert, als nördlichste Stadt der Karibik, als ein Schmelztiegel der Kulturen, als die amerikanische Stadt mit den über die Jahrhunderte tiefsten und prägendsten kulturellen Verbindungen nach Europa. New Orleans ist eine Stadt der Traditionsbewahrung, obwohl jeder Bewohner der Stadt quasi seine eigenen Traditionen mit einbringt, die Traditionen seiner Vorfahren und seiner Community.
New Orleans wird als Wiege des Jazz gefeiert, als nördlichste Stadt der Karibik, als ein Schmelztiegel der Kulturen, als die amerikanische Stadt mit den über die Jahrhunderte tiefsten und prägendsten kulturellen Verbindungen nach Europa. New Orleans ist eine Stadt der Traditionsbewahrung, obwohl jeder Bewohner der Stadt quasi seine eigenen Traditionen mit einbringt, die Traditionen seiner Vorfahren und seiner Community.
Eine Tagung in Köln im Februar 2015 widmete sich dem Thema der Karibik, der Kreolisierung und des Karnevals, alles Klischees, die mit New Orleans verbunden werden und die, differenziert betrachtet, dazu beitragen können, den kulturellen Diskurs in dieser Stadt zu beschreiben. Konkret näherte sich die Tagung diesem Thema von vier Seiten: Literatur und Sprache in einer Stadt, die ihren eigenen Akzent aus der Mischung der Bevölkerung entwickelte; die Tradition des Karnevals; Musik; sowie die Verbindungen zwischen New Orleans, der Karibik und Südamerika. Ottmar Ette setzt in seinem Beitrag die gegenseitige Bedingtheit des karnevalistischen Zukunftsmuts und der natürlichen Katastrophen, die New Orleans immer wieder einholten zueinander in Bezug. Ingrid Neumann-Holzschuh setzt sich mit den Besonderheiten und dem Wandel der Sprache, des “créole” in Louisiana auseinander. Philipp Krämer untersucht, wie das “créole” der Region die enge Bindung nach Frankreich beeinflusst. Gesine Müller liest Texte von “freien Schwarzen” im Louisiana des 19. Jahrhundertsund untersucht sie auf ihr transkulturelles Bewusstsein hin – sowohl in Richtung früheres “französisches Mutterland” wie auch in Richtung der anderen amerikanischen Rehionen. Owen Robinson findet in Baron Ludwig von Reizensteins Roman “The Mysteries of New Orleans” eine fiktionalisierte Zeitzeugenbeschreibung der schon Mitte des 19. Jahrhunderts recht freizügigen Hafenstadt.
Aurélie Godet untersucht die Sprache des Mardi Gras auf Aspekte von “creolization” und damit auch die Funktion kreolischer Prozesse innerhalb der Community/Communities von Louisiana. Rosary O’Neill beleuchtet die geschichte der Carnival Krewes in New Orleans und die Evolution dieser Tradition aus europäischen Vorbildern heraus. Wolfram Knauer untersucht den Einfluss eines “kreolischen Konzepts” in der Musik von New Orleans bis in die globale Gegenwart hinein. William Boelhower untersucht die Topologie innerhalb dessen der Jazz sich in new Orleans entwickelte. Hans-Jürgen Lüsebrink weist auf Verbindungen zwischen den frankophonen Regionen Nordamerikas hin, die über die Sprache hinausgehen. Tobias Kraft fragt, was es bedeutet, dass eine farbige Kreolin, Aveline, seit 2012 im Videospiel “Assassin’s Creed III: Liberation”, das in New Orleans spielt, eine der Hauptprotagonisten ist. Berndt Ostendorf argumentiert, dass die Stadt ihre Diversität an Straßenkultur, ethnischer Mischung, Finanzkraft, Cuisine, Klang-, Wasser- und Landschaften als eigene Identität in der Vielfalt angenommen hat. Sona Arnold betrachtet die Reisebeschreibungen von Friedrich Gerstäcker über New Orleans und Brasilien als ein frühes Beispiel des Bewusstseins einer Verbindung zwischen Louisiana und Latein- bzw. Südamerika. Bill Marshall verweist auf die Bedeutung des “French Atlantic”, also der politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen New Orleans und Frankreich, als Erklärhilfen für die spezifische Mischung der Kulturen, die in Lousiana möglich war. Michael Zeuske vergleicht Havanna, Kuba und New Orleans als historische Zentren des Sklavenhandels. Und Eugenio Matibag verweist auf die Cajun Filipinos und das Phänomen der asiatisch-amerikanischen Kreolisierung in Louisiana.
So ist das ganze Buch (also die ganze Konferenz, die 2015 in Köln stattfand) eine lebendige Annäherung an die verschiedenen Aspekte von “creolity” oder “creolization”. Gerade, weil sich die Musik und all die anderen Subthemen hier in den Kanon der verschiedenen Kreolisierungstheorien eingereiht finden, handelt es sich damit um eine Perspektivbereicherung, die allen Teilnehmern und damit auch dem Leser dieses Bandes neue Erkenntnisse bringen kann.
Wolfram Knauer (März 2017)
Jazz As Visual Language. Film, Television and the Dissonant Image
von Nicolas Pillai
London 2017 (I.B. Tauris)
176 Seiten, 64 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78453-344-1
 Jazz, beginnt Nicolas Pillai sein Buch, war nie nur Musik. Als kommunikative Kunstform war Jazz auch immer immens visuell. Bildende Künstler haben immer wieder ihre Faszination mit dem Jazz betont, Tatsächlich entwickelte sich der Jazz etwa parallel zum Film, und so macht es Sinn, die Interaktionen zwischen beiden Genres zu untersuchen. Statt sich dabei auf Geschichten über Jazz zu konzentrieren, interessiert Pillai sich insbesondere für formale und strukturelle Parallelen zwischen den Künsten, analysiert dafür Bildsequenzen, Erzählstrategien mehr als die Story selbst. Dabei entdeckt er Kamerablicke genauso wie ikonische Motive und fragt sowohl, welche Gründe der Regisseur für seine filmischen Entscheidungen gehabt haben mag, als auch, welche Aussagen diese über die Zeit zulassen und wie sie auf das Publikum wirken.
Jazz, beginnt Nicolas Pillai sein Buch, war nie nur Musik. Als kommunikative Kunstform war Jazz auch immer immens visuell. Bildende Künstler haben immer wieder ihre Faszination mit dem Jazz betont, Tatsächlich entwickelte sich der Jazz etwa parallel zum Film, und so macht es Sinn, die Interaktionen zwischen beiden Genres zu untersuchen. Statt sich dabei auf Geschichten über Jazz zu konzentrieren, interessiert Pillai sich insbesondere für formale und strukturelle Parallelen zwischen den Künsten, analysiert dafür Bildsequenzen, Erzählstrategien mehr als die Story selbst. Dabei entdeckt er Kamerablicke genauso wie ikonische Motive und fragt sowohl, welche Gründe der Regisseur für seine filmischen Entscheidungen gehabt haben mag, als auch, welche Aussagen diese über die Zeit zulassen und wie sie auf das Publikum wirken.
Pillai wählt drei konkrete Fälle für seine Hauptkapitel. Len Lyes dreiminütiger Film “A Colour Box” ist ein Klassiker der filmischen Abstraktion. Für neun seiner elf abstrakten Filme zwischen 1934 und 1940 wählte Lye Jazzaufnahmen, die klar den Verlaub der filmischen Abstraktion strukturieren. Für “Colour Box” entschied er sich nach dem Durchhören hunderter Platten für Don Barretos Aufnahme “La Belle Creole”. Lye, der aus Neuseeland stammt, verweist in einzelnen seiner Bilder, die er direkt auf das Zelluloid malte oder kratzte, auf die Kunst der Aboriginees. Lye hatte seiner Erfahrungen in der Werbebranche gesammelt, für die er Animationsfilme machte, und Pillai vergleicht seine Technik mit Werbestrategien, die in den 1930er Jahren aufkamen, nicht so sehr das Produkt als vielmehr die Firma oder Marke zu bewerben. Hintergrund war, dass man damit umgehen wollte, dem Mittelklasse-Publikum, an das sich die Werbung richtete, zu offen die Rolle des Konsumenten zuzuschieben. Also fragt Pillai, wie das Publikum wohl die erkennbaren textlichen Inhalte von “A Colour Box” dechiffriert haben mag, Hinweise auf Postwertzeichen und –gewichte, oder auf den aus verschiedenen kommerziell erhältlichen Versionen des “Lambeth Walk” zusammengeschnittenen Soundtrack des Films “Swinging the Lambeth Walk” von 1938. In Len Lyes Kunst, schlussfolgert Pillai, gehe es zuvorderst um Kino als Technologie, um die Besonderheit des projizierten Bildes, all das aber vor dem Hintergrund klarer gesellschaftlicher Vorstellungen und mit dem Bewusstsein der Wirkung seiner Filme auf ihr zeitgenössisches Publikum.
Im zweiten Kapitel beleuchtet Pillai Gjon Milis legendären Film “Jammin’ the Blues” von 1944, der sich von anderen Kurzfilmen mit amerikanischem Jazz in jenen Jahren insbesondere dadurch unterscheidet, dass er die Jazzszenen (etwa mit Lester Young und Harry Edison) als bewusste Reaktion auf den aktuellen künstlerischen Diskurs der Zeit setzt. In der Einleitung des Films sagt ein Erzähler, dies sei eine Jam Session, tatsächlich aber handelt es sich bei dem Kurzfilm um eine Hollywood-Produktion, und bewegen die Musiker ihre Finger zum vorab aufgenommenen Soundtrack. Und so interessieren Pillai hier vor allem Kompetenzen wie “Ehrlichkeit” und “Ernsthaftigkeit”, verweist auf der ähnliche Kameraführungen wie jene ikonische, in der Lester Youngs Pork Pie Hat zu Beginn von “Jammin’ the Blues” als geometrische Kreise von oben gezeigt wird, um sich dann mit der Kamerafahrt und Youngs Erheben seines Kopfes als materielles Objekt zu entpuppen. Pillai berichtet kurz über Milis Karriere, sein Interesse am Film als eines künstlerischen Mediums, seine fotografischen Aktivitäten fürs LIFE-Magazin, die immer wieder auch Szenen aus der Jazzwelt beinhalteten, betrachtet einzelne Szenen als Reflex der Fotografenerfahrung Milis, und endet mit einem Aside über ein ähnliches Projekt aus dem Jahr 1950, bei dem Musiker aus Norman Granzs Jazz at the Philharmonic-Truppe zu sehen waren, unter ihnen Coleman Hawkins, Buddy Rich und Charlie Parker, die aber, da der vor-aufgenommene Soundtrack, zu dem die Musiker ihr Spiel mimen musste, verloren ging, nicht zu hören sind.
Pillais drittes Kapitel widmet sich der britischen Fernsehreihe “Jazz 625”, bei der durchreisende amerikanische Stars oft mit britischen Musikern zusammenwirkten und im Zusammenhang mit dem ihn insbesondere die Fernsehästhetik interessiert, einschließlich der Präsentation der Musiker durch Ansager wie Steve Race und Humphrey Lyttelton. Er beschreibt die Kamera als Sympathisanten der Musiker und schussfolgert, dass musikalische Bedeutung und musikalischer Effekt hier genauso der Crew hinter der Kamera zu verdanken sind wie den Musikern an ihren Instrumenten. Pillai holt kurz aus und beschreibt, wie Live-Jazz vor “Jazz 625” im britischen Fernsehen präsentiert wurde, vergleicht dies auch mit Produktionen aus den USA, die wie ein Vorbild zur britischen Reihe wirken mögen, insbesondere “Jazz Casual” und “Jazz Scene USA”. Er beschreibt, wie die Sendung eine überhöhte Form von Live-Atmosphäre kreierte und diskutiert schließlich, wie sich die daraus abgeleitete Ästhetik mit Musik im Fernsehen bis heute vergleichen ließe.
Pillai versteht seine eigene Forschung zum Jazz als Teil der interdisziplinären New Jazz Studies, die sehr bewusst darauf Rücksicht nehmen, dass jede Beschreibung oder Analyse eines künstlerischen Gegenstandes des Bewusstseins der jeweils eingenommenen Perspektive bedarf. Und so ist “Jazz as Visual Language” denn auch nicht als umfassende Geschichte der Verwendung von Jazz im Film zu verstehen, sondern vielmehr als eine Versammlung von Fallbeispielen, die zeigen, dass die Darstellung von Jazz im Film Einfluss auf die Rezeption der Musik genauso haben wie die gespielte Musik Einfluss auf die Dramaturgie des Films haben wird.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)[:en]Duke Ellington
von Wolfram Knauer
Ditzingen 2017 (Reclam)
328 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-15-011127-7
 Da lesen wir laufend “fremder Leute” Bücher und vergessen dabei fast die Eigenwerbung. Im letzten Herbst jedenfalls brachte die Post Wolfram Knauers “Duke Ellington” , das, so die Verlagsankündigung, “den Komponisten, Pianisten und Orchesterleiter Duke Ellington als eine Integrationsfigur des Jazz” würdigt. Weiter heißt es da: “Musiker aller Epochen, aller Stilrichtungen, aller künstlerischen Ansätze scheinen sich mit seiner musikalischen Ästhetik identifizieren zu können. Knauer, Musikwissenschaftler und international bekannter Experte zum Jazz, lauscht seinen Aufnahmen, um aus ihnen heraus Ellingtons Biographie zu erzählen, den geradlinigen Weg eines Musikers, der weiß, dass seine Stärke im Zusammenfügen der vielen Stimmen seines Orchesters besteht. Anschaulich und mit Wissen auch um Ellingtons privates Umfeld und die wirtschaftlichen Zwänge im amerikanischen Musikbusiness schildert er die Gründe für ästhetische Entscheidungen des Duke und kann damit die verschiedenen Phasen seines Schaffens angemessen würdigen.”
Da lesen wir laufend “fremder Leute” Bücher und vergessen dabei fast die Eigenwerbung. Im letzten Herbst jedenfalls brachte die Post Wolfram Knauers “Duke Ellington” , das, so die Verlagsankündigung, “den Komponisten, Pianisten und Orchesterleiter Duke Ellington als eine Integrationsfigur des Jazz” würdigt. Weiter heißt es da: “Musiker aller Epochen, aller Stilrichtungen, aller künstlerischen Ansätze scheinen sich mit seiner musikalischen Ästhetik identifizieren zu können. Knauer, Musikwissenschaftler und international bekannter Experte zum Jazz, lauscht seinen Aufnahmen, um aus ihnen heraus Ellingtons Biographie zu erzählen, den geradlinigen Weg eines Musikers, der weiß, dass seine Stärke im Zusammenfügen der vielen Stimmen seines Orchesters besteht. Anschaulich und mit Wissen auch um Ellingtons privates Umfeld und die wirtschaftlichen Zwänge im amerikanischen Musikbusiness schildert er die Gründe für ästhetische Entscheidungen des Duke und kann damit die verschiedenen Phasen seines Schaffens angemessen würdigen.”
Oder, in Knauers eigenen Worten: “Was ich in dem Buch versucht habe, war buchstäblich: in die Musik hineinzuhören und dabei immer wieder zu fragen, warum Ellington so schrieb, spielte und dachte, wie er es zu verschiedenen Zeiten seiner Karriere tat. Was führte zu den ästhetischen und musikalischen Entscheidungen, wohin führten die Experimente, an denen ihm ohrenscheinlich lag? Warum entschied er sich zu Richtungsänderungen, warum klang seine Musik in den verschiedenen Jahrzehnten seiner langen Karriere immer wieder anders, und wie sollte man sich den klanglichen Ergebnissen nähern, um fair über sie zu schreiben (oder sie zu hören)? Wie ich im Vorwort andeute, war meine Herangehensweise insofern unüblich, als ich das Ellington-Archiv an der Smithsonian Institution besuchte, bevor ich auch nur ein einziges Wort geschrieben hatte, um mir auf gut Glück Kisten kommen zu lassen in der Hoffnung, dass das darin befindliche Material mir vielleicht einige der Fragen liefern würde, die ich in meinem Buch zu beantworten beabsichtigte (schließlich kommt es einem so vor, als sei schon alles über Ellington gesagt worden). Danach begann ich mit dem intensiven Hören, fragte dabei dauernd “Warum?” und “Was?”, mehr noch als “Wer?” oder “Wann und Wo?”. Diese Fragen führten dann zu einer Kontextualisierung seiner Biographie, seines Kompositionsprozesses, dem Konzept von Komposition im Jazz ganz allgemein, seiner Interaktion mit seinen Bandmitgliedern und mit anderen Musikern, seines privaten Lebens, seiner Geschäftspraktiken und – vor allem – seiner Aufnahmen. Als das Rohmanuskript fertig war, kehrte ich ins Ellington-Archiv zurück und ließ mir diesmal ganz gezielt die Kisten kommen, vor allem jene, die seine Kompositionsskizzen oder aber die Stimmen seines Orchesters enthielten, um an ihnen zu verifizieren, was konkret in den Noten steht und wo der Zauber anfängt, der das alles zum Leben erweckt und so ungemein persönlich werden lässt. Ich glaube, dass mein Ansatz sich durchaus von dem unterscheidet, was bislang über Ellington geschrieben wurde, und ich hoffe, dass es gelegentlich eine englische Übersetzung des Buchs geben wird.”
Johannes Breckner liest das Buch für das Darmstädter Echo, Wolfgang Sandner für die FAZ, Johannes Kaiser für SWR Cluster, Johann Buddecke für Concerti. Christian Broecking, Stefan Franzen und Martin Laurentius für die Jazzthetik.
zugegeben: Eigenwerbung, dennoch: Wolfram Knauer (Juli 2018)
Um Blues und Groove. Afroamerikanische Musik im 20. Jahrhundert
von Manfred Miller
Dreieich 2017 (Song Bücherei / Heupferd Musik Verlag)
454 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-923445-18-9
 Er macht es einem nicht einfach: Ein Druckbild langer Zeilen, die viel zu weit in den Bundsteg reichen, eine Schrifttype, die entweder weitere Zeilenabstände oder aber klarere Absätze verlangen würde, lange Sätze, oft mit Nebengedanken in Parenthese oder (wie ein Unterkapitel überschrieben ist) “Kleine Nebenbemerkung zur Nebenbemerkung” (64). Ein ausschweifender Stil, in dem sich der Autor sehr wohl bewusst ist, dass es sich hier um ein Alterswerk handelt. Er weiß, dass er seinen Leser:innen etwas zumutet, wenn er sie “dem Autor beim Verfertigen seiner Gedanken zuschauen” lässt (7). Ein Stil, der laufend die Position zu wechseln scheint, mal erzählend ist, dann historisch einordnend, dann aus der Gegenwart heraus wertend, nein nicht aus der Gegenwart, sondern aus seiner, des Autoren Gegenwart, oft gespeist durch Verweise auf seine eigene Zeugenschaft, als er etwa für Rundfunk- und Fernsehdokumentationen Interviews mit den Protagonisten der Musik führte, über die er hier schreibt.
Er macht es einem nicht einfach: Ein Druckbild langer Zeilen, die viel zu weit in den Bundsteg reichen, eine Schrifttype, die entweder weitere Zeilenabstände oder aber klarere Absätze verlangen würde, lange Sätze, oft mit Nebengedanken in Parenthese oder (wie ein Unterkapitel überschrieben ist) “Kleine Nebenbemerkung zur Nebenbemerkung” (64). Ein ausschweifender Stil, in dem sich der Autor sehr wohl bewusst ist, dass es sich hier um ein Alterswerk handelt. Er weiß, dass er seinen Leser:innen etwas zumutet, wenn er sie “dem Autor beim Verfertigen seiner Gedanken zuschauen” lässt (7). Ein Stil, der laufend die Position zu wechseln scheint, mal erzählend ist, dann historisch einordnend, dann aus der Gegenwart heraus wertend, nein nicht aus der Gegenwart, sondern aus seiner, des Autoren Gegenwart, oft gespeist durch Verweise auf seine eigene Zeugenschaft, als er etwa für Rundfunk- und Fernsehdokumentationen Interviews mit den Protagonisten der Musik führte, über die er hier schreibt.
Manfred Miller gehört seit den 1960er Jahren zu den wichtigen Popularmusikforschern Deutschlands. Er leitete die Jazzredaktion in Bremen (wo er neben vielem anderen auch die legendäre LP “Machine Gun” Peter Brötzmanns ermöglichte), moderierte eine regelmäßige Bluessendung im Südwestfunk, gründete das SWF-Bluesfestival in Lahnstein, produzierte TV- und Hörfunkdokumentationen zur Rock- und Bluesgeschichte. Ihm war es dabei immer wichtig, über den Tellerrand der Genres hinauszublicken, mit denen er sich beschäftigte. So erkannte er im Blues immer auch eine Reflexion der Welt, aus der dieser kam. Denn es sei viel Unsinn verzapft worden beim Schreiben über diese Musik. So sei in Zeugnissen früher Musiker neben dem Blues immer wieder von “rihls” die Rede gewesen (in unterschiedlichen Schreibweisen), und etliche Autoren hätten darin den “reel” aus irisch-schottischer Volksmusik erkannt. “[W]ie minimal die Wahrscheinlichkeit sein mochte”, ärgert sich Miller, “dass der Interviewte jemals einen solchen Tanz oder dessen Namen gehört haben konnte, haben sie sich offenbar nicht gefragt.” Und ein leicht rechthaberischer Tonfall klingt durch, wenn er fortfährt: “Dabei, scheint mir, drängt sich die korrekte Transkription förmlich auf, nämlich ‘Reals'”. Der Blues als Beschreibung der wirklichen Welt, der Realität: auch eine Theorie, und keineswegs eine schlechte. Die Rückführung des betreffenden Begriffs auf keltische “reels” ist allerdings auch nicht so falsch, wie Miller suggeriert: Irische und schottische Kulturtraditionen waren in die “neue Welt” transferiert worden, und es ist gut möglich, dass “reel” quasi als Deonym generisch für eine bestimmte Art von Tanz(musik) verwandt wurde. Was richtig ist, weiß ich als Leser (und Nicht-Blues-Experte) auch nicht, allerdings stößt es leicht sauer auf, wenn Miller ein Zitat Little Brother Montgomerys nachschiebt, in dem dieser betont, wie wichtig das Abbild der Realität im Blues sei, um dann verächtlich zu urteilen: “Dass sie Mist verzapft haben, können unter feldforschenden Musikethnologen offenbar etliche selbst dann nicht riechen, wenn jemand sie mit der Nase hineinstößt.” (16)
Den Hauptteil seines Buchs beginnt Miller mit Platon und der Bedeutung von Musik seit der Antike. Er sinniert über die Polyphonie des Mittelalters und die Mehrchörigkeit bei Schütz und Bach, über Castrati und Countertenöre, über Gesualdos Madrigale, über Musik und Macht, genauer: Musik als Symbol von Herrschaft. Er ist sich bewusst, dass in Musik oft Erinnerung an Rituale transportiert werden, deren Funktion längst nicht mehr erinnerbar ist. Und er beschreibt, wie Musik immer im Hier und Jetzt wahrgenommen wurde, bis der Phonograph erfunden wurde und sie damit vom Ritual zur Ware werden konnte (Miller spricht von “fundamentaler Um- und Abwertung der Gebrauchswerte von Musik zu einer der gängigsten unter den angstlösenden Alltagsdrogen” [69]).
Millers zweites Kapitel befasst sich mit den musikalischen Grundlagen afro-amerikanischer Musik. Es geht um Artikulation, vor allem aber um swing. Er fragt danach, wie sich die rhythmische Komplexität in afro-amerikanischer (und afrikanischer) Musik aus unterschiedlichen Perspektiven hören lässt und beschäftigt sich mit dem Missverständnis der Synkope im Jazz. Er hinterfragt Begriffe wie Pulse, Beat und Groove und diskutiert sie anhand konkreter Aufnahmen etwa von Louis Armstrong, Art Blakey und Fats Waller. Woher kommt dieser Groove, fragt er, bemüht dann gleich noch einmal die gesamte (westliche) Musikgeschichte, fragt etwa nach dem Verhältnis zwischen Harmonik und Metrik, um schließlich (ich habe etwas vorgeblättert) bei seiner Erklärung anzulangen: Der Groove käme aus der Momenthaftigkeit der Musik, aus dem Jetzt, aus dem “Now”. Das ist durchaus einleuchtend, doch jetzt ist Miller in Fahrt. Er reflektiert über Ellingtons “It Don’t Mean a Thing”, über Aufnahmen der King Oliver Creole Jazz Band und Frankie Trumbauers, über den Wirtschaftsliberalismus Thatchers und Reagans, über Technobastler, die eine Software namens “Humanizer” entwickelt haben, über die Kontroverse zwischen Barack Obama und der “Tea Party” in den USA…. Man kommt viel rum als Leser:in, und man ist seinen Anmerkungen zum Ende der Kapitel dankbar, bei denen er sozusagen den eigenen Text noch einmal mit etwas Abstand liest und einordnet.
Als nächstes: der Blues! Genre, Gattung, Form? Um dem Wesen, nein den verschiedenen Wesen des Blues auf die Spur zu kommen, lauscht Miller zahlreichen Aufnahmen. Billie Holiday, Miles Davis, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Jabbo Smith. Er stellt die Form in Frage, sucht Beispiele heraus , die deutlich als Blues konnotiert sind, aber auf die sprichwörtlichen 12 Takte weitgehend verzichten. Dann der Einfluss der Tin Pan Alley auf die Popularisierung des Blues – Stichwort: “Blues als Tanzmusik”. Es folgen Beispiele aus dem Bereich des Country-Blues, des Chicago-Blues und des britischen Rock-Blues, die belegen, wie fließend die Form ist. Das ist gerade in der Mischung der Beispiele spannend, wenn auch etwas schwer zu lesen, insbesondere wenn wieder einmal der Unterton des Rechthabens mitschwingt, als hätten wirklich alle Autor:innen über Musik den Blues nur mit “12 Takte und traurig” beschrieben.
“Traurig” ist dann auch das nächste Klischee, das Miller zu entzaubern trachtet. Wo kommt die Zuschreibung her, fragt er, welche anderen Zuschreibungen hat der Blues über die Jahre erhalten? Dabei landet er bei Joachim Ernst Berendt und seiner Beschreibung der “Blue Notes” von 1957, die Miller als vereinfacht und eurozentristisch klassifiziert, um dann eine Art Urzustand der Blue Notes beispielsweise in einer Rede von Dr. Martin Luther King zu finden, von dem ausgehend er den Blue Notes dann vor allem eine rhetorische Funktion zuschreibt: “sie unterstreichen, sie heben hervor, was der Sängerin, dem Sänger besonders wichtig ist” (148). Er hinterfragt die autobiographische Haltung des Blues, die Rollenfigur, die der oder die Sänger/in einnimmt, und er analysiert beispielhaft, etwa den Text zum “Down Hearted Blues”, den er sich daraufhin gleich noch von verschiedenen Sängerinnen anhört. Miller ist ein exzellenter Übersetzer von Bluestexten, dazu in der Lage, auch im Deutschen den Inhalt mit dem Rhythmus des Originaltextes zu verbinden. Und er ist sich der Grenzen seiner Übersetzermöglichkeiten bewusst, die etwa dort aufhören, wo das englischsprachige Original (insbesondere das Black English des Blues) mit double entendre, mit semantischer Mehrdeutigkeit spielt, die nicht so einfach zu übertragen ist. Er diskutiert die Themen des Blues, Liebe, Tod, aber auch das Themenfeld Protz und Prahlerei (“Was hab ich mit da nur aufgehalst!”), und er schreibt darüber, wie sich in den Songs die alltägliche Gewalt und der Rassismus der USA wiederspiegeln.
Es findet sich ein anregendes Kapitel über Billie Holidays Bluesästhetik, eines über aus dem Vaudeville stammende Duos wie Butterbeans & Susie, sowie eines über Bluestexte, die es nur knapp an der Zensur vorbeigeschafft haben. Er diskutiert Aufnahmen Jelly Roll Mortons aus dessen Sitzung für die Library of Congress, bei denen der Pianist lange, schnell ins Pornographische ausartende Titel spielte und sang, und er mutmaßt, dass diese Beispiel für ein ansonsten nicht dokumentiertes Repertoire seien, das den musikalischen Feldforschern nur deshalb entgangen sei, weil sie es an die Orte, an denen es erklang (Bordelle) selten gezogen hätte.
Am Schluss seines Buchs bemüht Miller den afro-amerikanischen Philosophen Cornel West, den er mithilfe von Textauszüge in ein fiktives Interview verstrickt, um abschließend noch ein wenig Trübsal zu blasen: Leider gäbe es heute keinen aktuellen Mainstream afro-amerikanischer Musik mehr, der entsprechende “Resonanz in der großen Gemeinde der schwarzen Amerikaner” fände. Rap und HipHop hätten nicht dieselben inklusiven Merkmale wie Blues und Jazz der Vergangenheit und die “schwarze Gemeinde in Amerika” habe durch den “vom Marktliberalismus produzierte[n] Wandel des Gesellschaftlichen und der Gesellschaft” aufgehört, sich selbst als “Gemeinde” zu sehen. “Tut mir leid”, schreibt er, “Auch wenn ich hin und wieder aus klanglichen oder rhythmischen Gründen das Präsenz benutze – was ich in dieser Arbeit verhandle, ist Vergangenheit. – Jedoch: welch einmalige Vergangenheit! Musik, die ein Volk trägt!”
Er macht es einem nicht einfach, habe ich diese Rezension begonnen. Manfred Miller, der aus dem Vollen seines Wissens, seiner Hörerfahrung schöpfen kann, lässt genau dies seine Leser:innen an jeder Stelle spüren: dort, wo er mit Fakten um sich wirft, dort wo er sofort Vergleichsbeispiele aus der globalen Kulturgeschichte zur Hand hat, insbesondere auch dort, wo er seine Leser:innen direkt anspricht, ihre Einwände vorwegahnt, um dann seine Thesen näher unterlegen zu können. Der leicht verächtlich wirkende Blick herab auf Forscher:innen, Journalist:innen und andere Autor:innen (gerne auch der Verweis darauf, dass dies oder jenes doch ein gutes “Referat im Oberseminar der Musikethnologen ” sei) findet sich zuhauf in Millers Buch. Er macht es einem nicht einfach, weil all diese schriftstellerischen Tricks seine Leser eben gerade nicht mitnehmen, und weil man gerade bei einem so als Bleiwüste gestalteten Buch (dem weder die Typographie noch die Kursivschreibung Abwechslung verleihen) eigentlich keine Lust hat, dauernd als virtueller Sparringpartner herhalten zu müssen. Das aber ist schade. Denn tatsächlich hat Miller etliches zu erzählen. Tatsächlich sind seine Denkansätze ungemein spannend, wert diskutiert, weitergedacht, immer wieder auch widersprochen zu werden. Doch dazu lädt Manfred Miller nicht so recht ein mit seinem Buch, das, obwohl es weder eine Geschichte des Blues noch des Jazz ist, ein Füllhorn anregender Gedanken über afro-amerikanische Musik enthält – und die westeuropäische Rezeption derselben.
Wolfram Knauer (Juni 2020)
Träume aus dem Untergrund. Als Beatfans, Hippies und Folkfreaks Baden-Württemberg aufmischten
von Christoph Wagner
Tübingen 2017 (Silberburg-Verlag)
180 Seiten, 24,90 Euro
ISBN: 978-3-8425-2039-4
 Christoph Wagner, in Baden-Württemberg geborener und seit Jahren nahe London lebender Journalist, beschreibt die musikalische Subkultur der 1960er und 1970er Jahre in Baden-Württemberg. Zwischen Mannheim und Freiburg findet er dabei jede Menge Beispiele aus populären Genres zwischen Blues, Rock, Jazz und Folk.
Christoph Wagner, in Baden-Württemberg geborener und seit Jahren nahe London lebender Journalist, beschreibt die musikalische Subkultur der 1960er und 1970er Jahre in Baden-Württemberg. Zwischen Mannheim und Freiburg findet er dabei jede Menge Beispiele aus populären Genres zwischen Blues, Rock, Jazz und Folk.
Er blickt auf die Einflüsse, beispielsweise die lebendige Jazzszene ums Heidelberger Cave oder die Stuttgarter Atlantik-Bar, betrachtet die Aktivitäten des Südwestfunks und den Kulturschock, den Möhringer Bürger erlebten, als sie einen Musiker wie Cecil Taylor durch den Ort joggen sahen oder als sich Abdullah Ibrahim eine Bretzel in der Dorfbäckerei holte, während er in Tourneepausen bei Gabi Kleinschmidt wohnte.
Er weiß um die Beat- und Soulszene in Stuttgart, die vor allem durch einheimische Amateurgruppen befeuert wurde und oft genug auf die Eltern als Fahrdienst angewiesen war. Aber auch internationale Bands machten im Ländle Station, The Who etwa, über die der Tourneeveranstalter Walter Puls einige Geschichten zu erzählen weiß.
Joachim Ernst Berendt war einerseits für die Jazzgeschichte des Landes wichtig, schnitt aber auch Konzerte des American Folk Blues Festival mit, das seit 1962 von Horst Lippmann und Fritz Rau veranstaltet wurde. Die Bluesszene wurde Anfang der 1970er durch Clubs geprägt, die tourende amerikanische Künstler genauso engagierten wie solche, die sich wie etwa Memphis Slim oder Champion Jack Dupree in Europa niedergelassen hatten. Neben der Blues- gab es aber auch eine lebendige Folkszene, die, in Folge des legendären Waldeck-Festivals im Hunsrück “deutschen Protestsängern, Liedermachern und Kabarettisten”, aber auch englischen, schottischen und amerikanischen Folkmusiker:innen eine Bühne bot. Nicht selten stand diese in dieselben Clubs, in denen auch Jazz oder Blues zu hören war: Das Publikum hatte zu jener Zeit doch beträchtliche Schnittmengen. Folkmusik war damals zugleich ein Soundtrack zu den Anti-AKW-Protesten und den Friedensdemonstrationen jener Jahre, eine Protesthaltung, die sich erst gegen Ende der 1970er, wie Wagner schreibt, andere musikalische Formen suchte, “ob im Punk, im anarchistischen Rock oder im Sponti-Kabarett”.
Am 19. Januar 1969 trat Jimi Hendrix in der Stuttgarter Liedermacherhalle auf. Bald darauf ließen sich mit Rockmusik, insbesondere aus englischsprachigen Ländern, Hallen mittlerer Größe leicht füllen. Als Vorgruppe standen dabei oft regionale Bands auf der Bühne, in denen Musiker groß wurden, die später zwischen Jazz, Rock und Pop von sich Reden machten. Wagner skizziert die Veranstaltungsorte, an denen diese Musik zu hören waren, in den Großstädten Stuttgart, Mannheim und Freiburg genauso wie in Kleinstädten wie Schorndorf, wo in der Manufaktur Peter Brötzmann zu hören war (für 250 Mark Gage), die amerikanische Folkmusikerin Hedy West (für 220 Mark) und der Liedermacher Reinhard Mey (für 170 Mark). Wagner berichtet über zwei Black-Sabbath-Tourneen durch den Südwesten in den Jahren 1969 und 1970, oder über das Rolling-Stones-Konzert in der Messehalle 6 in Stuttgart, das 20 Mark Eintritt kosten sollte, was in der Szene für heftigen Protest und für Boykottaufrufe sorgte.
Den erfolgreichen und kommerziellen Rockshows stellten sich mit der Zeit Kulturinitiativen entgegen, die eine andere Vorstellung von Musikvermarktung hatten, insbesondere der Verein GIG, der sich die “Durchführung von Veranstaltungen zu gewinnlosen Eintrittspreisen” auf die Fahnen schrieb. Insbesondere in Tübingen und anderen Studentenstädten fanden zur selben Zeit eher links orientierte deutsche Bands wie Floh de Cologne oder Ihre Kinder Zulauf; selbst hier aber wehrte sich das studentische Publikum schon mal gegen als zu hoch empfundene Eintrittspreise, einen Diskurs zwischen Veranstalterinitiative und Publikum, den Wagner detailliert nachzeichnet. In Stuttgart hatte Werner Schretzmeier mittlerweile Kontakte zum SDR-Fernsehen geknüpft, durch die er Rockbands wie Pink Floyd, Black Sabbath und Deep Purple zu Produktionen einladen konnte. In einem letzten Kapitel befasst sich Wagner schließlich noch mit Mundartrock zwischen Joy Fleming (Neckar-Blues), Wolle Krinwanek (Schwabenrock) und der Band Schwoißfuaß.
Christoph Wagners “Träume aus dem Untergrund” bieten einen unterhaltsamen Streifzug durch eine Zeit, in der Musik mehr und mehr als ästhetischer genauso wie als politischer Ausdruck wahrgenommen wurde und dabei zwischen den Polen einer Community-bindenden Kunst und Kommerz existierte. In seinen Kapiteln gelingt es ihm, sicher auch dank der zahlreichen Abbildungen, viele Facetten dieses Lebensgefühls deutlich zu machen. Ihm geht es dabei nur bedingt um eine Beschreibung der Musik selbst; wichtiger ist ihm der Kontext, die Bildung und Selbstdefinition einer Szene also. In dieser verorteten sich in jenen Jahren auch die Jazzfans, und Wagners Darstellung der Strukturen, in denen sich Rock und Pop in diesen Jahren entwickelte, macht schnell klar, wie wichtig der weitere Blick sein kann, um Kontexte zu erklären, die letztlich auch die Entwicklung des Jazz mit beeinflussten.
Wolfram Knauer (Juni 2020)
André Hodeir. Le jazz et son double
von Pierre Fargeton
Lyon 2017 (collection Symétrie recherche)
772 Seiten, 70 Euro
ISBN: 978-2-36485-028-6
 Es ist eine mehr als passende Würdigung: ein fast 800 Seiten starkes Buch über den Kritiker, Musikwissenschaftler, Geiger und Komponisten André Hodeir, das seiner Biographie genauso gerecht zu werden versucht wie seiner Musik und seiner musikwissenschaftlichen Erkenntnisse. Pierre Fargeton ist prädestiniert für diese Aufgabe: Der Musikwissenschaftler verfasste 2006 seine Dissertation über Hodeir und arbeitet zurzeit an der Herausgabe der Korrespondenz zwischen Hugues Panassié und André Hodeir.
Es ist eine mehr als passende Würdigung: ein fast 800 Seiten starkes Buch über den Kritiker, Musikwissenschaftler, Geiger und Komponisten André Hodeir, das seiner Biographie genauso gerecht zu werden versucht wie seiner Musik und seiner musikwissenschaftlichen Erkenntnisse. Pierre Fargeton ist prädestiniert für diese Aufgabe: Der Musikwissenschaftler verfasste 2006 seine Dissertation über Hodeir und arbeitet zurzeit an der Herausgabe der Korrespondenz zwischen Hugues Panassié und André Hodeir.
Sein Buch beginnt – chronologisch – im Geburtsjahr seines Sujets 1921 und beschreibt, wie der junge André, der dem Klavierunterricht seines älteren Bruders mehr abgewinnen konnte als jener, im Alter von 11 Jahren zur Geigenausbildung aufs Konservatorium geschickt wurde, wo er bereits 1935 seine “6 Pièces de Virtuosité” komponierte. Zur selben Zeit interessierten ihn aber genauso das Tischtennisspiel, Poker und der Jazz, für den er sich begeisterte, nachdem er Benny Carter mit dem Orchester von Willie Lewis gehört hatte. Er entdeckte erst Stéphane Grappelli, dann Eddie South als role models auf seinem eigenen Instrument und lernte Charles Delaunay kennen, den Jazzkenner und Autor der Hot Discography.
Eine Lungenentzündung, wegen der er Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre lange Zeit ans Bett gefesselt war, machte dem Traum seiner Mutter ein Ende, die ihren Sohn als einen “neuen Menuhin” sah. Doch bis Ende der 1940er Jahre war Hodeir durchaus auf der Geige zu hören, im Jazzkontext meist unter dem Pseudonym Claude Laurence, unter dem er 1942 seine ersten Titel für das Label Swing aufnahm, kurz darauf außerdem Platten mit dem Gitarristen Joseph Reinhardt. Nach dem Krieg begann Hodeir seine ersten Artikel für das Magazin Jazz Hot zu schreiben, besuchte eine Analyseklasse bei Olivier Messiaen und beschäftigte sich zeitgleich mit den Aufnahmen Charlie Parkers und Dizzy Gillespies. Von 1947 bis 1951 fungierte er als Chefredakteur von Jazz Hot, eine Position, in der er mehr und mehr das Bewusstsein dafür ausbildete, dass der Jazz Vordenker braucht, die seine Struktur und Machart verstehen, ihn aber auch ästhetisch und intellektuell in die Diskurse der aktuellen Musik einordnen können.
Fargeton nennt ihn “zweisprachig”, weil Hodeir in diesen Jahren musikalisch den Jazz genauso bedienen konnte wie die zeitgenössische Musik, weil er mit Kenny Clarke genauso spielte wie er sich an Streichquartetten versuchte. Und schließlich gibt es erste Beispiele einer Vermengung der beiden Welten, etwa in Stücken wie dem 1953 eingespielte “Saint-Tropez”. Fargeton zeigt, wie sich Hodeirs analytische Beschäftigung mit dem amerikanischen Jazz auch auf seine eigene Kompositionsweise niederschlägt, etwa in der Betonung motivischer Beziehungen oder in seiner Auseinandersetzung mit formaler Gliederung seiner Musik. Es folgten Experimente mit Zwölftontechniken und die Beschäftigung mit anderen seriellen Techniken, etwa im verschworenen Kreis um den Klassiker Pierre Boulez.
1954 veröffentlichte Hodeir das Buch Hommes et problèmes du jazz, eine Sammlung bereits veröffentlichter und bislang unveröffentlichter Aufsätze, die drei Jahre später unter dem Titel Jazz: Its Evolution and Essence auch auf Englisch erscheinen und großen Einfluss auf die ernsthafte Beschäftigung mit dem Jazz haben sollte. Im selben Jahr gründete Hodeir die Jazz Groupe de Paris, ein am Miles Davis Capitol Nonet orientiertes Ensemble, das etwa zehn Jahre lang bestand und Hodeirs Third-Stream-orientierte Kompositionen, aber auch Filmmusik einspielte. Fargeton verfolgt Hodeirs Karriere, beschreibt seine Reise in die USA 1957, den Auftritt der Jazz Groupe bei den Donaueschinger Musiktagen im selben Jahr, sowie die Kooperation mit John Lewis und dem Modern Jazz Quartet, für das er drei Stücke schrieb. Wie Lewis, wie Gunther Schuller und wenige andere blieb André Hodeir dabei ein Mittler zwischen den Welten, konnte sich am Diskurs der zeitgenössischen Musik genauso beteiligen, wie er jenen im Jazz mit seinen Schriften und Stücken selbst mitbestimmte.
1964 wandte sich Hodeir Stücken für größeres Ensemble zu, schrieb für Bigband oder Goßensemble ungewöhnlicherer Besetzung. Zu letzterer gehört insbesondere “Anna Liva Plurabelle”, eine durchkomponierte Jazzkantate über Texte aus James Joyces Finnegans Wake. Mit dem Free Jazz hatte Hodeir weniger am Hut, was ihm Kritik jüngerer Autorenkollegen einbrachte. 1970 brachte Hodeir Les Mondes du Jazz heraus, ein Buch, das einerseits literarischer gefasst ist, anderseits weniger konkrete musikalische als vielmehr ästhetische Themen im Zentrum hat. In den nächsten Jahren zog sich Hodeir weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, forschte am Pariser IRCAM, schrieb Romane, und trat höchstens auf Anregung des Pianisten Martial Solal, für den er in den 1960er Jahren immer wieder geschrieben hatte, für einige Konzerte wieder auf die Bühne. 1992 wurde “Anna Livia Plurabelle” wieder aufgeführt, in Brest, Wien und Paris und schließlich unter Leitung des Bassisten Patrice Caratini auch auf Platte aufgenommen.
Im zweiten Teil seines Buchs analysiert Fargeton die musikalische Sprache André Hodeirs, fragt nach Klangfarbenmelodie, -rhythmus und -melodie, Kompositionstechniken, Individualisierung der Töne, nach Textur und Kontrapunkt in seiner Musik, um dann im dritten Teil die Form in Hodeirs Werk unter die Lupe zu nehmen, das Variationsprinzip, sowie die simulierte Improvisation.
Pierre Fargetons Buch ist ohne Zweifel ein Standardwerk zu Leben und Werk André Hodeirs. Insbesondere in den analytischen Passagen, die etwa die Hälfte des Buchs ausmachen, bietet es zeitweilig etwas sperrige Lektüre (was vielleicht auch nicht anders zu erwarten ist). Im biographischen Teil lässt er vor allem die Rezeption ein wenig beiseite, die ja weit über Frankreich hinaus ging. John Gennari hat beispielsweise darauf hingewiesen, wie wichtig Jazz: Its Evolution and Essence für den US-amerikanischen Jazzdiskurs der 1960er Jahre wurde, wo Autoren, egal ob sie ihn umarmten (Martin Williams) oder eher ablehnten (Dan Morgenstern, Whitney Balliett), sich auf jeden Fall zu ihm zu verhalten hatten. Eine solche Diskussion der Auswirkungen seines Denkens und Schreibens, die beispielsweise auch den britischen Autor Eric Hobsbawm oder den deutschen Kritiker Joachim Ernst Berendt mit einzubeziehen hätte, wäre eine sinnvolle Ergänzung. Und wenn auch das Thema des Third Stream sowohl im biographischen wie auch im analytischen Teil des Buchs immer wieder angerissen wird, wäre auch hier eine weiterführende Einordnung der Folgen wünschenswert, in Hodeirs Fall insbesondere auf das Umfeld von Jazzmusikern (Michel Portal beispielsweise), die ähnlich wie er “bi-lingual” unterwegs waren, also einen Fuß in der Jazztradition hatten, sich aber genauso in der Welt der Zeitgenössischen Musik zuhause fühlten. Doch hätten solche Ergänzungen wohl dazu geführt, das ohnedies dicke Buch auf über 1000 Seiten anschwellen zu lassen.
Es bleibt abzuwarten, was die Korrespondenz zwischen Hugues Panassié und André Hodeir an ästhetischen Streits enthält, an der Fargeton zur Zeit als Herausgeber arbeitet. André Hodeir. Le jazz et son double immerhin ist eine mehr als angemessene und ausgesprochen gelungene Würdigung des Multitalents. In seinem Vorwort schreibt Martial Solal, all die verschiedenen Seiten Hodeirs seien untrennbar miteinander verbunden gewesen. Er habe ihm immer den größten Respekt entgegengebracht, und Bewunderung empfunden für seinen Humor und seine Feinsinnigkeit, die sich denen, die ihn gut kannten, mitteilte. Nun, zumindest letztere Elemente sind durchaus auch in seiner Musik deutlich zu spüren, und durch Fargetons Buch kommen auch wir Leser dem Phänomen André Hodeirs ein wenig näher.
Wolfram Knauer (Januar 2020)
Sonor in Weissenfels, 1875-1950
Von Klaus Ruple
Weißenfels 2017 (Arps Verlag Weißenfels)
240 Seiten, 28 Euro
ISBN: 978-3-936341-30-0
 Das Schlagzeug-Drumset entwickelte sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und ermöglichte Perkussionsvirtuosen die Bedienung mehrerer Trommeln zur gleichen Zeit. Vor allem die Erfindung des Bass-Drum-Pedals förderte die erfolgreiche Vermarktung eines kompletten Drumsets, das spätestens mit der Aufnahme der ersten Jazzaufnahmen weitgehend komplett war. Trommeln gab es in allen Kulturen, Trommelfabriken bald überall in der westlichen Welt. Klaus Ruple hat nun quasi die Biographie einer dieser Firmen geschrieben, Sonor, gegründet vom Drechsler und Weißgerber Johannes Link in Weißenfels an der Saale und bis heute ein Name im Instrumentenbau.
Das Schlagzeug-Drumset entwickelte sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und ermöglichte Perkussionsvirtuosen die Bedienung mehrerer Trommeln zur gleichen Zeit. Vor allem die Erfindung des Bass-Drum-Pedals förderte die erfolgreiche Vermarktung eines kompletten Drumsets, das spätestens mit der Aufnahme der ersten Jazzaufnahmen weitgehend komplett war. Trommeln gab es in allen Kulturen, Trommelfabriken bald überall in der westlichen Welt. Klaus Ruple hat nun quasi die Biographie einer dieser Firmen geschrieben, Sonor, gegründet vom Drechsler und Weißgerber Johannes Link in Weißenfels an der Saale und bis heute ein Name im Instrumentenbau.
Ruple beginnt mit einer üblichen Handwerkergeschichte des 19. Jahrhunderts, erzählt, wie der auf der Schwäbischen Alb geborene Johannes Link 1875 nach den damals üblichen Jahren der Wanderschaft im sachsen-anhaltinischen Weißenfels eine Trommelfabrik für die Fertigung von Militärtrommeln gründete. Er beschreibt handwerkliche Prozesse der Zeit, insbesondere das Gerben der Kalbs- oder Ziegenfelle, und findet in der Buchhaltung der Firma Hinweise auf die laufende Expansion: mehr Aufträge, mehr Angestellte, eine größere Produktpalette. Im Jahr 1900 beschäftigte die Firma bereits 50 Mitarbeiter, und 1907 wurde aus der “Ersten Trommelfabrik Weißenfels” die Firma “Sonor” mit den Geschäftsbereichen “Herstellung und Vertrieb von Schlaginstrumenten und Spielwaren: Trommeln, Pauken, Trommelfelle, Schlaginstrumente aller Art und deren Bestandteile, Kindertrommeln, Ballschläger und Tischtennisschläger”. Militäraufträge lasteten die Firma bis 1914 gut aus, die sich immer mehr erweiterte und im Februar 1914 einen Fabrikneubau auf einem größeren Grundstück plante, der allerdings durch den Ersten Weltkrieg verhindert wurde.
Ein eigenes Kapitel widmet Ruple der Trommelproduktion für den “Großen Krieg”, der Sonor Produktionszuwächse sicherte, die auch nach Kriegsende nicht nachließen. Nach einem Brand der alten Fabrik baute die Firma an einem neuen Standort, einer ehemaligen Badeanstalt, die Ende des 19. Jahrhunderts von einer Brauerei aufgekauft und zu einem großes Gesellschaftshaus umgenutzt worden war. 1925 beschäftigte Sonor 145 Mitarbeiter in der nunmehr vollends vom Handwerksbetrieb zu industrieller Fertigung gewachsenen Fabrik, die in ihren Verkaufsräumen auch historische Schlaginstrumente vom Dreißigjährigen Krieg bis in die Gegenwart ausstellte. Zum 50-jährige Jubiläum, das der 1914 verstorbene Firmengründer nicht mehr miterlebt, spielte paradoxerweise ein Streichquartett; Sohn Otto und Stiefsohn Max Straubel führten forthin die Geschäfte weiter. Militärinstrumente traten immer mehr in den Hintergrund, stattdessen warb die Firma ab Mitte der 1920er Jahre für die “Eigene Fabrikation von Schlag-Instrumenten jeder Art, Trommelfellen, Banjos, Jazz-Schlagzeugen”. Für eine Weile war Sonor Weltmarktführer bei der Herstellung und Verarbeitung von Fellen, entwickelte daneben immer neue Verbesserungen von Trommeln, Mechanik, Pedalen und Hängesystemen für das Drumset. Einige dieser Lösungen wurden auch von anderen Herstellen übernommen, wie Ruple andeutet, wenn er zumindest Ähnlichkeiten in Design, Ausführung und Verkaufsprogrammen der Firmen erkennt.
1930 reiste Otto Link in die Vereinigten Staaten, um mögliche neue Kunden für seine Produkte zu finden; hatte bald aber auch zuhause wieder große Aufträge, obwohl die Rohstoffversorgung zusehends schwieriger wurde. Insbesondere Eisen und Messing wurden ab 1937 kontingentiert, so dass Sonor insbesondere eine Reihe an Auslandsaufträgen verlor, die stattdessen in die Tschechoslowakei oder nach England gingen. “Den wirtschaftlich und politisch schweren Jahren folgt der Zweite Weltkrieg mit Inflation und Kriegswirren”, formuliert Ruple und fährt fort: “Mit Link-Trommeln marschieren die Deutschen nach Polen, Frankreich, Russland und zahlreiche andere europäische bzw. gar afrikanische Länder ein.” Bis Ende des Krieges produzierte Sonor einerseits Marschtrommeln für Reichsheer, Luftwaffe, Hitlerjugend und Polizei, wurde aber auch “in die direkte Kriegsproduktion einbezogen, wie Ruple (jetzt etwas weniger konkret) schreibt, “fertigte u.a. für die Junkers Werke in Dessau und Merseburg”. 1945 wird die Firmenbezeichnung von “Trommelfabrik” gar in “Herstellung von Kriegsgerät” umbenannt.
Nach dem Krieg flüchtete Otto Links Sohn Horst nach Aue, einen Ortsteil von Bad Berleburg, die Weißenfelser Fabrik, die bei einem Bombenangriff 1944 keinen Schaden nahm, stellte die Produktion währenddessen um auf “Autoumbauten, Herstellung kleiner Kohlenschaufeln und Messer aus Kriegsmaterial, Tische, Wandtafeln für Schulen, Rollwagen aus Abfallholz”. In Aue/Westfalen begann Horst Link mit kleinen Mitteln wieder die Trommelherstellung, während Otto Link im Weißenfels 1948/49 einen Großauftrag über 5000 Trommeln und 1000 Holzkoffer für die Rote Armee an Land zog. Am 7. Oktober wurde die DDR gegründet, und nachdem Links Firma anfänglich noch ins Handelsregister aufgenommen wurde, erfolgte im Jahr darauf schrittweise die Enteignung, verbunden mit der Androhung einer Anklage gegen Link wegen “Wirtschaftsverbrechen”. Otto Link floh in den Westen; die Weißenburger Firma ging in Volkseigentum über. In den 1950er Jahren, die Ruple nur noch am Rande streift, wurde Sonor dann zu einer wichtigen Marke im Jazzbereich, gespielt von Musikern wie Kenny Clarke, Connie Kay, Roy Haynes, Karl Sanner oder Teddy Paris.
Klaus Ruple endet sein Buch mit einer knapp gehaltenen “Fotostory”, die bis in die Gegenwart führt, zeigt Fabrikräume, neue Produkte und Sonor-Künstler aus unterschiedlichen Stilbereichen. Er besucht den Ort der ersten Weißenfelder Fabrik, die wegen Baufälligkeit 2011 abgerissen werden musste, und das ehemalige Bad, das 2015 von von einem kanadischen Investor gekauft wurde, der, wie man zuletzt hörte, plant, daraus wieder ein Kulturzentrum mit Hotel und Ballsaal zu machen. Auch in der DDR wurde in der VEB Trommelfabrik Weißenfels weiterproduziert, erzählt er, die noch bis zur Wende Instrumente der Marken Tacton und Trowa herstellte, dann aber abgewickelt wurde.
Der Buchtitel “Sonor in Weissenfels” ist viel zu nüchtern für eine so reich gestaltete Dokumentation, die akribisch in die Bücher schaut, viele der zahlreichen Abbildungen genau erklärt, und zwar sowohl Fotos über den Ort der Produktion, über die Instrumente selbst oder über die Familiengeschichte. Bei alledem gelingt es Ruple, die wechselvolle Geschichte einer Fabrik lebendig werden zu lassen, die von der Militärtrommel zum Jazzschlagzeug die Musik des 20sten Jahrhunderts begleitete.
Wolfram Knauer (Juli 2018)
Downtown Düsseldorf. Jazz am Rhein
von Peter K. Kirchhof
Düsseldorf 2017 (Droste Verlag)
176 Seiten, 25 Euro
ISBN: 978-3-7700-2027-0
 Mit einer Dokumentation der Düsseldorfer Jazzgeschichte schließt sich Peter Kirchhof ähnlichen Lokalgeschichten für andere Städte an. Die Zeit bis 1945 wird handelt er darin auf knapp zehn Seiten ab, bevor er die Nachkriegsszene beschreibt zwischen Dixieland, Deutschem Amateur Jazzfestival, der Nähe zur Jazz- und Hochschulstadt Köln, Spielorten wie dem New Orleans, dem Jazz Cap oder dem Dum Dum, Workshops, und Tourneekonzerten internationaler Stars und vielem mehr. Einen besonderen Schwerpunkt legt Kirchhof auf den 1966 eröffneten Club Downtown, das mit Unterbrechungen bis Ende der 1980er Jahre bestand.
Mit einer Dokumentation der Düsseldorfer Jazzgeschichte schließt sich Peter Kirchhof ähnlichen Lokalgeschichten für andere Städte an. Die Zeit bis 1945 wird handelt er darin auf knapp zehn Seiten ab, bevor er die Nachkriegsszene beschreibt zwischen Dixieland, Deutschem Amateur Jazzfestival, der Nähe zur Jazz- und Hochschulstadt Köln, Spielorten wie dem New Orleans, dem Jazz Cap oder dem Dum Dum, Workshops, und Tourneekonzerten internationaler Stars und vielem mehr. Einen besonderen Schwerpunkt legt Kirchhof auf den 1966 eröffneten Club Downtown, das mit Unterbrechungen bis Ende der 1980er Jahre bestand.
“Downtown Düsseldorf” hält minutiös die Entwicklungen der lokalen Szene fest, nennt Akteure wie Wilton Gaynair, Peter Weiss oder Wolf Doldinger, weiß um die Vernetzung in andere Jazzregionen Nordrhein-Westfalens und um Versuche, das von viel ehrenamtlicher Arbeit getragene städtische Jazzleben den neuesten Entwicklungen und der Stadtkultur anzupassen. Kirchhof bebildert das alles mit historischen Dokumente, Anzeigen, Plakaten, Zeitungsausrissen, vor allem aber mit Fotos des Düsseldorfer Fotografen Hans Harzheim, der nicht nur die Szene in seiner Stadt seit den 1950er Jahren mit der Kamera begleitet hatte.
Alles in allem: eine zu lobende Lokalgeschichte des Jazz, die sich der Vollständigkeit halber allerdings manchmal ein wenig zu sehr im Detail verliert und dabei die Lesbarkeit etwas außer Acht lässt. Ein Musikerregister schließt das Buch ab.
Wolfram Knauer (Juli 2018)
Experiencing Bessie Smith. A Listener’s Companion
von John Clark
Lanham/MD 2017 (Rowman & Littlefield)
187 Seiten, 40 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4340-8
 Anders als die Welt der Bigbands, der Jeff Sultanof seinen Listeners’ Companion gewidmet hat und deren viele Facetten fast zu umfangreich für das Konzept der Buchreihe sind, anders auch als Chick Corea, dessen Aufnahmen Monika Herzig in ihrem Band abhandelte, das aber bis in die Gegenwart reicht, handelt es sich beim Untersuchungsgegenstand, den John Clark sich für diesen Band vorgenommen hat, um ein abgeschlossenes Oeuvre, um Aufnahmen der Bluessängerin Bessie Smith zwischen 1923 und 1933. Clark interessiert dabei, wie Bessie Smiths zu einer Zeit aktiv war, als weder die Genres Jazz oder Blues vollständig ausgebildet waren, als Künstler in populären Genres immer auch Teil eines größeren Programms auf Varietébühnen waren, als sich das alles schließlich erst langsam als ein großes, umfassendes, kommerziell interessantes und zugleich kulturelle Identität beschreibendes Geschäft erwies.
Anders als die Welt der Bigbands, der Jeff Sultanof seinen Listeners’ Companion gewidmet hat und deren viele Facetten fast zu umfangreich für das Konzept der Buchreihe sind, anders auch als Chick Corea, dessen Aufnahmen Monika Herzig in ihrem Band abhandelte, das aber bis in die Gegenwart reicht, handelt es sich beim Untersuchungsgegenstand, den John Clark sich für diesen Band vorgenommen hat, um ein abgeschlossenes Oeuvre, um Aufnahmen der Bluessängerin Bessie Smith zwischen 1923 und 1933. Clark interessiert dabei, wie Bessie Smiths zu einer Zeit aktiv war, als weder die Genres Jazz oder Blues vollständig ausgebildet waren, als Künstler in populären Genres immer auch Teil eines größeren Programms auf Varietébühnen waren, als sich das alles schließlich erst langsam als ein großes, umfassendes, kommerziell interessantes und zugleich kulturelle Identität beschreibendes Geschäft erwies.
Clark beginnt mit einer Beschreibung des Unterhaltungsangebots für Afro-Amerikaner zu Beginn des I. Weltkriegs, beschreibt das Format der Tent Shows, die Tradition des Blues und die ersten Beispiele dafür, wie dieser seinen Weg in die populäre Musik fand. Er erklärt, wie sich eine Art “classic blues” herausbildete und wie sich in einer der ersten Aufnahmen des Genres in Mamie Smiths “Crazy Blues” Einflüsse aus Vaudeville, Ragtime und Tin Pan Alley mischten. Der Erfolg dieser Aufnahme brachte eine ganze Industrie zum Leben, und Clark nennt Beispiele, von denen viele aus der Talentschmiede des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und Plattenproduzenten Clarence Williams stammten. Trixie Smith, Alberta Hunter, Ma Rainey und Ethel Waters fanden jeweils ihren eigenen Stil in der Gemengelage eines noch nicht völlig ausgebildeten Genres, und in seiner Besprechung einzelner Aufnahmen dieser Sängerinnen deutet Clark bereits an, was an Bessie Smith so besonders war.
Er beschreibt das mögliche Repertoire zwischen populären Blues-Hits etwa aus der Feder von W.C. Handy, und schlüpfrig-doppeldeutigen Texten. Er beleuchtet Titel wie “Alexander’s Ragtime Band”, den “Yellow Dog Blues”, den Einfluss der Gospelmusik in “Moan You Moaners”, und die Zielgerichtetheit der Texte auf ein afro-amerikanisches Publikum anhand “Mama’s Got the Blues”. Er erklärt das Konzept der auf den afro-amerikanischen Markt ausgerichteten “race records” und weiß zu berichten, dass auch eine Sängerin wie Bessie Smith erst Testaufnahmen vorlegen musste, bevor sie einen Vertrag mit einer Plattenfirma erhielt. Seine Höranalysen fokussieren sich mal auf musikalische Besonderheiten, Smiths’ Art der Tonbeugung etwa, ihre Stimmqualität, ihren Sound, mal auf den Text und darauf, welche Konnotationen dieser in den 1920er Jahren gehabt hatte. Er stellt fest, dass allein im ersten Jahr ihres Aufnahmeschaffens sie ganz unterschiedliche Begleitbands hatte, von Jazzensembles bis zu eher folk-orientierten Besetzungen mit Mandoline oder mit Harmonika, Gitarre und Kazoo. In den Aufnahmen nach 1924 erkennt er, wie sich ein ganz eigener Stil herausschält, urbaner, stärker von Jazz durchdrungen, und zwar nicht nur, wenn Fletcher Henderson, Charlie Green oder Louis Armstrong mit von der Partie sind. Clark sucht für all diese Besetzungsformate erhellende Aufnahmen heraus, in denen er Einflüsse auf die verschiedenen Beteiligten genauso erklärt wie das, was da zwischen Solostimme und Begleitung musikalisch geschieht und welche Wirkung es auf die Musik als solche hat.
1927, schreibt Clark, war Bessie Smith eine der am höchsten bezahlten schwarzen Entertainer der Welt. Er beschreibt den Einfluss des Erfolgs auf ihr Schaffen und hinterfragt die Erinnerungen ihrer Nichte Ruby Walker, aus er wir viel über Smiths’ Privatleben und den professionellen Druck auf sie wissen. Er befasst sich ausführlich mit den Aufnahmen, die Bessie Smith mit James P. Johnson machte, konzentriert sich auch hier abwechselnd auf die Musik, das Zusammenspiel zwischen Stride-Piano und expressivem Gesang, und die Texte, in denen schon mal in einer Zeile biblische Zitate und überdeutliche sexuelle Andeutungen kombiniert werden. Er macht den Leser immer wieder auf die Formgestalt der Stücke aufmerksam oder auf Unterschiede im musikalischen Ansatz etwa von Tommy Ladnier im Vergleich zum früheren Armstrong.
Clark erklärt, dass die Plattenindustrie in den 1920er und frühen 1930er Jahren höchstens ein Zusatzeinkommen, vor allem aber eine Art Werbung für Liveauftritte waren, die immer noch den Hauptteil des Einkommens von Musikern ausmachten. Er diskutiert, warum Aufnahmen nach 1928 von vielen als weit unter Smiths Niveau gehandelt werden, erklärt, dass dies insbesondere an den Begleitbands gelegen habe, die nicht immer auf dem Level der Sängerin waren. Zwischendurch streut er Informationen über Smiths Privatleben genauso ein wie einen Exkurs darüber, welche Rolle die Sängerin wohl bei der Komposition ihrer Songs gespielt habe. 1931 endete Bessie Smiths Vertrag mit Columbia Records, und zwei Jahre später machte sie letzte Aufnahmen für den Produzenten John Hammond, der ihr dazu eine Band mit Frankie Newton, Chu Berry, Jack Teagarden und Benny Goodman zur Seite stellte. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Film “St. Louis Blues” von 1929, und ein letztes Kapitel dem Einfluss Bessie Smiths’ auf nachfolgende Generationen, wobei Clark Sängerinen aus dem Bluesbereich diskutiert wie Ruby Walker, Mildred Bailey und Dinah Washington, andere aus dem Jazzbereich wie Connee Boswell und Billie Holiday, sowie spätere von Bessie Smith beeinflusste Sänger/innen wie Mahalia Jackson. Jimmy Rushing, Big Joe Turner, Bob Wills, Nina Simone und Janis Joplin. Eine kommentierte Bibliographie, eine Diskographie mit kompletter Besetzungsnennung der verschiedenen Bands und ein Index runden das Buch ab.
John Clarks Buch ist als Höreinführung angelegt, letzten Endes aber weit mehr als das. Zwischen den Erklärungen zu den Titeln gelingt es ihm, den urbanen Vaudeville-Blues der 1920er Jahre musikalisch genauso einzuordnen wie in seiner kommerziellen Verwertbarkeit, erzählt er von ästhetischen Wegscheiden, an denen viele der Musiker beteiligt waren, die auf Bessie Smiths Aufnahmen zu hören sind. Er weiß die Musik dabei nicht nur aus der historischen Perspektive zu hören, sondern fordert seine Leser auf, sich die Avanciertheit dieses Genres vor Augen zu halten, die Tatsache, dass sich diese Art von Musik ja quasi parallel zu den Aufnahmen erst entwickelte und als eigenständiges Genre ausbildete. Das alles mischt er auf eine Art und Weise, dass die Lektüre an keiner Stelle langweilig wird und man sehr gerne auch die wertenden Passagen seines Buchs am eigenen Höreindruck überprüft.
Wolfram Knauer (März 2018)
Experiencing Chick Corea. A Listener’s Companion
von Monika Herzig
Lanham/MD 2017 (Rowman & Littlefield)
139 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4468-9
 Monika Herzig, selbst Pianistin und Pädagogin, hat für die Reihe der Listening Companions das Kapitel “Chick Corea” übernommen. Im Vorwort erinnert sie sich ihr eigenes erstes Livekonzert mit dem Pianisten, dass sie in Tübingen erlebte, und an viele andere Konzerte, die sie besuchte, nachdem sie sich in den Vereinigten Staaten niedergelassen hatte.
Monika Herzig, selbst Pianistin und Pädagogin, hat für die Reihe der Listening Companions das Kapitel “Chick Corea” übernommen. Im Vorwort erinnert sie sich ihr eigenes erstes Livekonzert mit dem Pianisten, dass sie in Tübingen erlebte, und an viele andere Konzerte, die sie besuchte, nachdem sie sich in den Vereinigten Staaten niedergelassen hatte.
Herzig beginnt ihr Buch mit einem Schnelldurchlauf durch die Geschichte des Klaviers im Jazz von den Anfängen bis zu Bud Powell und Thelonious Monk. Eine Timeline bietet eine Übersicht über Lebens- und Karrieredaten Chick Coreas von seiner Geburt 1941 bis ins Jahr 2017. Den Hauptteil des Buchs aber macht wie in den anderen Bänden der Reihe auch hier das gelenkte Hören aus, für das Herzig Aufnahmen aus allen Schaffensperioden auswählt, die sie eingehend beschreibt, indem sie die technischen Details kontextualisiert, also etwa auf Einflüsse, aktuelle musikalische Diskurse zur Zeit der Aufnahme oder auf die spezifische Besetzung hinweist. Sie bedient sich Aufnahmen aus Coreas gesamten Diskographie, in denen Besonderheiten seines Stils besonders gut darzustellen sind, und beschränkt sich dabei auch nicht nur auf solche, die unter seinem Namen herauskamen, sondern diskutiert auch Aufnahmen etwa mit Blue Mitchell oder Miles Davis.
Herzig widmet sich seinen akustischen Bands genauso wie den elektronischen Besetzungen, Duo-Aufnahmen etwa mit Gary Burton, Herbie Hancock, Bobby McFerrin oder Hiromi Uehara. Obwohl die Kapitel grob chronologisch angelegt sind, nimmt sie sich dabei die Freiheit, in einem Abschnitt wie “Playing with Friends” auch gleich bis in die Gegenwart zu gehen, weil es eben Sinn macht, diese Aufnahmen, die einen ähnlichen Kontext besitzen, auch zusammen zu betrachten.
Sie diskutiert den stilistischen und ästhetischen Wandel der Jahrzehnte und Coreas Reaktion etwa darauf, dass Jazz in den 1980er Jahren immer mehr zu einer Konzertmusik wurde, es zugleich auch ein steigendes Interesse an akustischen Besetzungen gab. Zwischendurch streut sie immer wieder Zitate des Pianisten ein, die zeigen, dass die stilistischen Richtungswechsel bewusste Entscheidungen waren und eine deutliche Reaktion auf die ästhetischen Diskurse seiner Zeit. Ein eigenes Kapitel (“Back to Electric”) widmet sich Coreas Auseinandersetzung mit dem technischen Fortschritt, mit seiner Verwendung elektrischer und elektronischer Instrumente und Hilfsmittel; ein weiteres Kapitel (“So Many Things to Do”) dem Wandel der Musikindustrie im neuen Jahrtausend, in dem erst Filesharing, dann Downloads zum neuen Distributionsmittel wurden. Dieses Kapitel enthält außerdem eine Diskussion von 24 Aufnahmen aus den Jahren 2001 bis 2015, die zeigen soll, wie es Chick Corea in dieser jüngsten Phase seiner Karriere gelang, die verschiedenen Ausprägungen seines Stils weiterzuentwickeln. Notiz am Rande: Im Kapitel über Chick Coreas Avantgarde-Trio Circle in der ersten Hälfte des Buchs gibt es auch einen kurzen Exkurs über die Zugehörigkeit des Pianisten zur Church of Scientology und seinen Rechtsstreit mit deutschen Behörden, als das Land Baden-Württemberg entschied, dass mit öffentlichen Geldern keine Veranstaltungen gefördert werden dürften, die mit Scientology in Verbindung stünden. Eine Diskographie, ein Literaturverzeichnis und ein Register schließen das Buch ab.
Monika Herzig gelingt es in ihrem Listener’s Companion, dem Leser genügend Zusatzwissen mit auf den Weg zu geben, um in der Musik Chick Coreas Verbindungen zu musikalischen und ästhetischen Entwicklungen des Jazz von den 1960er Jahren bis heute zu erkennen. Ihre analytischen Annäherungen an seine Aufnahmen sind beschreibend, dabei aber eingehend genug, um sowohl den Laien wie auch den Experten auf Kontexte aufmerksam zu machen, die zum vertieften Nochmal-Hören anregen.
Nehmen wir ein Beispiel: Sie beschreibt den Verlauf von “Chick’s Tune” von 1964 und ordnet dieses Stück gleich als letzten Titel der Aufnahmesitzung ein, für den die Musiker einen Wechsel der musikalischen Textur für ganz sinnvoll erachten. Sie beschreibt, wie das Latin-Thema erklingt, man darunter aber eine bekannte Akkordprogression erkennen kann, verweist auf die Tradition seit dem Bebop, neue Themen über altbekannte Harmonien zu schreiben, und verrät schließlich – im Idealfall hat der Leser sich das Thema jetzt bereits wiederholt angehört –, dass es sich dabei um “You Stepped Out of a Dream” handelt. Als “fun fact” ergänzt sie, dass diese Komposition im Geburtsjahr Coreas populär wurde, nachdem sie im Film “Ziegfeld Girl” mit Judy Garland und Lana Turner gezeigt wurde, weist dann auf die für Standards eher unübliche Harmonik des Stücks hin und darauf, was Corea damit melodisch anfängt. Sie beschreibt nicht nur sein Solo, sondern betont zugleich, dass es damals durchaus nicht selbstverständlich war, dass ein Klavier- und nicht ein Bläsersolo dem Thema folgt, hat dann noch ein paar Anmerkungen zur üblichen Dramaturgie solcher Titel, und dazu, wieso diese Aufnahme der perfekte Schluss für die Platte sein könnte. Nach ähnlichem Muster geht sie auch die anderen Aufnahmen an, die sie beschreibt: Von der Großform zu Details, immer darauf bedacht, diese aus der Jazzgeschichte heraus zu erklären und zu kontextualisieren.
Monika Herzig gelingt dabei mit ihrem Buch mehr als eine Anleitung zum Hören der Musik von Chick Corea. “Experiencing Chick Corea” ist nicht nur ein Buch für Laien, wenn es diese auch an keiner Stelle abschreckt. Herzig nämlich gelingt die perfekte Balance der musikalischen Erklärung und Kontextualisierung der von ihr ausgesuchten Aufnahmen genauso wie der musikalischen Karriere Chick Coreas. Last not least ist das alles auch noch gut lesbar, überzeugend gruppiert und macht – immer noch das größte Lob für Literatur zur Musik – Lust auf eingehenderes Nachhören.
Wolfram Knauer (März 2018)
Experiencing Big Band Jazz. A Listener’s Companion
von Jeff Sultanof
Lanham/MD 2017 (Rowman & Littlefield)
207 Seiten, 38 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4242-5
 Die Reihe “A Listener’s Companion” will musikalischen Laien das Werk einzelner Künstler oder ganzer Genres näherbringen. Der Fokus liegt dabei auf der Musik; Ziel ist es, den Leser zum gezielten, aufmerksamen Lauschen zu verleiten. Es geht also weder um eine tiefe musikalische Analyse, noch sind die Bände als Biographien oder Stilgeschichten zu lesen. Stattdessen sollen sie genau das sein, was der Untertitel andeutet: Begleiter beim aufmerksamen Zuhören.
Die Reihe “A Listener’s Companion” will musikalischen Laien das Werk einzelner Künstler oder ganzer Genres näherbringen. Der Fokus liegt dabei auf der Musik; Ziel ist es, den Leser zum gezielten, aufmerksamen Lauschen zu verleiten. Es geht also weder um eine tiefe musikalische Analyse, noch sind die Bände als Biographien oder Stilgeschichten zu lesen. Stattdessen sollen sie genau das sein, was der Untertitel andeutet: Begleiter beim aufmerksamen Zuhören.
Der Komponist, Arrangeur und Musikhistoriker Jeff Sultanof hat die Aufgabe übernommen, einen Bereich des Jazz abzudecken, der von den Anfängen bis in die Gegenwart immer neue Ausprägungen erfahren hat: den Bigband-Jazz. Er beginnt sein Buch mit einer Timeline, in der europäische Walzerorchester und Ragtimebands als Vorläufer ebenso enthalten sind wie die klassische Bigbands der Swingära und spätere modernere Besetzungen. Kurz handelt er die üblichen Formate und gängigen Formmodelle des Genres ab; dann geht es auch gleich los¬:
Sultanof beginnt mit James Reese Europe und Art Hickman, er erwähnt all die erwartbaren Größen des Metiers, Henderson, Ellington, Goodman, Basie, aber auch Beispiele, die eher Eingeweihten bekannt sein dürften, Red Norvo, Don Redman, Ray McKinley. Neben den Swingbands handelt er auch jene des modernen Jazz ab, also Dizzy Gillespie, Gil Evans, Gerry Mulligan, Thad Jones, und kommt mit Maria Schneider oder der Mingus Big Band bis in die Gegenwart.
Seine kurzen Höranalysen verweisen auf Besetzungsänderungen, Soli, auf bestimmte rhythmische oder harmonische Facetten. In diesen versteht er sich als “tour guide”, als Stadtführer durch eine Region, die er besonders gut kennt. Er macht auf Besonderheiten aufmerksam, erklärt Kontexte, weist darauf hin, woher bestimmte Entwicklungen kommen oder wohin andere gehen. Und er hält auch mit dem eigenen Enthusiasmus nicht hinterm Berg, wenn er insbesondere einzelne Soli lobend heraushebt. Immer wieder verweist er auf den Hintergrund, auf die Tricks, mit denen Arrangeure aus der Zusammenstellung bestimmter Instrumente besondere Klänge erzeugen.
Ab und an fühlt man sich dabei an Fußballreportagen erinnert. Ein zufällig herausgegriffenes Beispiel: “Nach einer Einleitung”, lautet etwa Sultanofs Tour durch Shorty Rogers’ Version von “Topsy”, “spielen Tenor- und Baritonsaxophone den A-Teil der Melodie (0:14); der B-Teil wird von der ganzen Band übernommen (0:41). Rogers soliert mit einfachem Dämpfer (1:08), und Herb Geller spielt ein Solo auf dem Altsaxophon (1:36). Die ganze Band spielt bis zum Solo des Tenorsaxophonisten Jimmy Giuffre (2:19). Marty Paich spielt ein Klaviersolo (2:32), und dann erklingt die Melodie wieder in den Saxophonen (2:46). Die Einleitung wird wiederholt und schließt mit einem gehaltenen Akkord am Ende.” Hier wie anderswo gibt Sultanof dem unerfahrenen Hörer die Chance Strukturen zu erkennen und musikalische Entwicklungen nachzuvollziehen. Nun gut, meint der Jazzkenner, das meiste davon hört man doch eh, warum also noch extra darauf hinweisen? Und tatsächlich wäre es vielleicht genauso interessant gewesen zu erklären, warum sich jemand wie Rogers ausgerechnet die Basie-Band zum Vorbild nimmt, dass das Thema des Anfangs sehr bewusst in einem ruhigen Unisono gehalten ist, während die Bridge dem genauso bewusst komplexere Harmonien entgegensetzt, als die Basie-Band sie je gespielt hätte. Vielleicht wäre ein Hinweis darauf ganz interessant gewesen, wie die Posaunen im letzten A-Teil des Themas die Basslinie verdoppeln und alles dunkel einfärben, so dass Rogers’ gedämpftes Solo als ganz besonderer Kontrast hervortritt, oder darauf, dass die Wiederholung der Einleitung am Ende der Aufnahme eben nicht nur eine solche ist, sondern Rogers sich wieder mit seiner gedämpften Trompete darüber setzt und damit im Schluss das Stück quasi öffnet. Will sagen: Neben der bloßen Ablaufbeschreibung ließe sich ja auch eine Beschreibung der Dramaturgie, der Klangentwicklung, der Qualität einzelner Soli denken, ohne dass man dazu zu technisch werden müsste. Oder eben, und zwar gerne für jedes Stück unterschiedlich, die jeweils eine Frage: Was sagt uns das Stück im Kontext der Jazzgeschichte.
Die Verzahnung der sehr unterschiedlichen Beispiele immerhin gelingt Sultanof in den Zwischentexten, in denen er neue Protagonisten einführt, besondere Ereignisse (Konzerte oder Aufnahmen) schildert, musikalische Einflüsse nachzeichnet oder ästhetische Richtungsentscheidungen erklärt. Und hier deutet er dann auch an, wie Personalstile in diesem Bereich entstehen und was den Sound der betreffenden Aufnahme so besonders macht. Die verständliche Entscheidung, das alles quasi chronologisch darzustellen, vergibt dabei die Chance, etwa nach Klangfarben, nach Avanciertheit oder auch nach persönlicher Entwicklung zu gruppieren. In einer solchen Lesart hätte sich darstellen lassen, wie sich Ellingtons Orchesterstil über die Jahre veränderte, wie die Bigbandklänge von Stan Kenton, Count Basie, jenem gerade erwähnten Shorty Rogers und Thad Jones miteinander in Beziehung stehen, wie die Auseinandersetzung mit Klangfarben bei Claude Thornhill, Eddie Sauter, Sun Ra oder dem Orchestra USA unterschiedliche Resultate gezeitigt hat – wobei das Orchestra USA überhaupt nicht vorkommt – usw.
Die Grundsatzfrage also ist : Muss ein Buch, dass sich an Jazzlaien richtet, an der Oberfläche bleiben? Reicht es aus, Ellingtons Karriere von den 1920er bis in die 1960er Jahre anhand von Beispielen zu verfolgen, aber nirgends zu erklären, dass Ellingtons Art des Konzipierens von Musik für großes Ensemble sich grundsätzlich von der Herangehensweise anderer Bigbands unterscheidet? Kann allein die Identifikation von Soli in diesen Aufnahmen wirklich die Musik erklären?
Nun gibt es sicher auch gute Argumente für Sultanofs Darstellungsweise. Er will mit seinem Buch ja Mut machen, sich eingehender mit der Musik zu beschäftigen; er will Kontexte liefern, aus denen heraus auch ein nicht mit dieser Musik aufgewachsener Leser vielleicht zu verstehen vermag, was sie so faszinierend machte. Warum allerdings die Stücke im Fließtext in den dicken Unterbrechern, die auf sie aufmerksam machen sollen, einzig durch Titel mit Komponist, gegebenenfalls Arrangeur, Aufnahmeort und -datum identifiziert werden, man dann aber drumherum suchen muss, welches Orchester denn für diese Aufnahme verantwortlich war, ist schwer verständlich.
Das wiederum ist eine editorische Schwäche des Buchs, dem es nicht nur an dieser Stelle an Übersichtlichkeit mangelt. Auch dass am Schluss die verschiedenen Register nicht miteinander verzahnt werden, trägt zu diesem Bild bei: Da gibt es ein Register, dass die einzelnen Aufnahmen – wie im Buch vorkommend, Kapitel nach Kapitel –, aufzählt, aber keine Seitenzahl gibt. Dann ein Register der wichtigsten Orchester mit den im Buch genannten Titeln, aber wieder ohne Seitenzahl. Und schließlich ein Personen- und ein Titelregister mit Seitenzahl, wobei bei letzteren darauf verzichtet wird die Zuordnung zu den Ausführenden zu erwähnen. Das ist besonders schade, da Sultanof doch sehr bewusst immer mal wieder einzelne Titel auswählt, die gleich von verschiedenen Bands aufgenommen wurden, um im Vergleich des scheinbar selben Grundmaterials Unterschiede erklären zu können.
Last not least, eine Anmerkung des europäischen Lesers: Dass Sultanof zwar ein paar britische Bands und Francy Boland mit einbezieht, Europa ansonsten außen vor lässt (Orchestre National du Jazz? George Gruntz? oder gar: Globe Unity???), ist wohl vor allem dem angepeilten amerikanischen Publikum zu schulden. Sein Buch richtet sich insbesondere an musikalische Laien, an Amateur-Bigbandmusiker, an Lehrer und an Schüler. Auf den knappen Ausflug bis in die Gegenwart allerdings hätte er auch verzichten können: seine kurzen Sätze zu Kamasi Washingtons “The Epic” und Ted Nashs “Presidential Suite” sind nicht einmal mehr beschreibend.
Alles in allem also eine gute Idee, von Sultanof, einem ausgewiesenen Kenner der Materie, mit viel Gefühl für die Zwischentöne ausgeführt. Auch die Wahl der Beispiele ist gelungen, bei der Bekanntes neben Unerwartetem steht und sich so die Varietät des Genres bestens beleuchten lässt. Vielleicht liegen all die kritischen Untertöne dieser Rezension ja in der Grundidee der Reihe begründet, die im Vorwort des Herausgebers im Satz mündet, man wolle Leser erreichen, die keine exzessive musikalische Ausbildung besäßen und sich nicht laufend ihres elitären Wissensstands (wörtlich spricht er von “elitist shoulder rubbing”) vergewissern müssten. Nun ja, unterfordern sollte man die Leser und Hörer aber auch nicht…
Wolfram Knauer (März 2018)
Jazz en 150 Figures
von Guillaume Belhomme
Paris 2017 (Editions du Layeur)
360 Seiten, 39,90 Euro
ISBN: 9-782-91512-631-0
 Guillaume Belhomme ist ein französischer Musiker und Journalist. Sein jüngstes Buch will die Jazzgeschichte in 150 Musikerportraits erzählen und damit die Abfolge instrumentaler und vokaler Helden bis in die Gegenwart fortschreiben. Die Künstler werden chronologisch in die üblichen Stilschubladen-Kapitel sortiert, von “Early Jazz” über “Swing”, “Bebop”, “Cool”, “Hard Bop, “Post Bop”, “Free Jazz” bis zu “Modernes”, einer Abteilung, die Musiker fasst, die irgendwo zwischen freier Improvisation und eklektischen Experimenten arbeiten. Belhomme wählt für jeden der 150 Musiker von King Oliver bis Mats Gustafsson jeweils fünf Platten aus, die für ihn die Bandbreite ihrer künstlerischen Arbeit beleuchten. Dafür nimmt er sich jeweils zwei, in Ausnahmefällen vier Seiten Platz, bebildert das alles mit einem, selten zwei Fotos und zwischen zwei und vier Abbildungen der erwähnten Platten. Er beginnt seinen Text mit knappen biographischen Anmerkungen, streicht dann wichtige Aufnahmen heraus und betont die Bedeutung der Musiker für die Jazzgeschichte. Tief kann das alles nicht gehen, und das Buch lebt neben den kurzen Annäherungen an die Kunst der Musiker vor allem von den Abbildungen.
Guillaume Belhomme ist ein französischer Musiker und Journalist. Sein jüngstes Buch will die Jazzgeschichte in 150 Musikerportraits erzählen und damit die Abfolge instrumentaler und vokaler Helden bis in die Gegenwart fortschreiben. Die Künstler werden chronologisch in die üblichen Stilschubladen-Kapitel sortiert, von “Early Jazz” über “Swing”, “Bebop”, “Cool”, “Hard Bop, “Post Bop”, “Free Jazz” bis zu “Modernes”, einer Abteilung, die Musiker fasst, die irgendwo zwischen freier Improvisation und eklektischen Experimenten arbeiten. Belhomme wählt für jeden der 150 Musiker von King Oliver bis Mats Gustafsson jeweils fünf Platten aus, die für ihn die Bandbreite ihrer künstlerischen Arbeit beleuchten. Dafür nimmt er sich jeweils zwei, in Ausnahmefällen vier Seiten Platz, bebildert das alles mit einem, selten zwei Fotos und zwischen zwei und vier Abbildungen der erwähnten Platten. Er beginnt seinen Text mit knappen biographischen Anmerkungen, streicht dann wichtige Aufnahmen heraus und betont die Bedeutung der Musiker für die Jazzgeschichte. Tief kann das alles nicht gehen, und das Buch lebt neben den kurzen Annäherungen an die Kunst der Musiker vor allem von den Abbildungen.
Der Jazzkenner wird in diesem Buch also inhaltlich wenig Neues entdecken, wird immerhin auf den einen oder anderen Musiker verwiesen, der in seinem persönlichen Kanon vielleicht nicht denselben Stellenwert hat. Eine solche Auswahl ist nun mal immer persönlich, und eigentlich ist es müßig, sich an den Entscheidungen des Autors zu reiben. Allerdings irriert dann doch, dass Belhomme in seiner Auswahl kaum die Chance ergreift, die Heldengeschichte des Jazz vielleicht auch mal in Frage zu stellen, dass er sie stattdessen als eine Geschichte männlicher und meist amerikanischer Künstler fortschreibt. Naja, unter den 150 portraitierten Musikern befinden sich immerhin siebzehn Nicht-Amerikaner, allerdings nur sechs Frauen, und unter diesen nur zwei Instrumentalistinnen. Nicht einmal Django Reinhardt oder Mary Lou Williams fanden Eingang in Belhommes Tableau des Jazz. Man mag das als lässliches Versehen entschuldigen, ein Buch selbst diesen Umfangs kann schließlich nicht alles abdecken. Und doch ist es schade, dass Jazzgeschichte im Jahr 2017 immer noch nach alten Mustern erzählt wird, insbesondere durch einen Autoren, der den Jazz eigentlich als eine Musik der Offenheit und Vielfalt versteht.
Fazit: Man sollte sich also nicht zu tief hineinvertiefen in die Auswahlentscheidungen Belhommes, sollte stattdessen die schön layouteten Seiten genießen, die Hörerinnerungen hervorrufen oder neugierig machen auf neue Hörentdeckungen. Und die Lektüre als Aufforderung verstehen, als Leser seine eigenen Namen hinzuzufügen und auch für diese fünf Alben auszuwählen, die Jazzgeschichte aus einer noch anderen Perspektive wahrnehmbar werden lassen.
Wolfram Knauer (Februar 2018)
Commemoration of the Centenary of the arrival of the African-American military bands in France during World War I
von Dan Vernhettes
Saint-Etienne-du-Rouvray 2017 (Jazz’edit)
54 Seiten, 20 Euro
Bestellungen unter http://www.jazzedit.org/English/Centenaire/Centenaire%201918.html
 Im Februar 2018 jährt sich zum 100sten Mal die Ankunft afro-amerikanischer Regimenter in Europa. Das 15. Regiment der New York National Guard, das in Frankreich als 369stes Regiment der IV. französischen Armee zugeordnet wurde, kämpfte an der Front, kam bis zum Rhein und wurde nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten als Harlem Hellfighters gefeiert. Zu dem Regiment gehörte eine Militärkapelle, die von Ltd. James Reese Europe geleitet wurde und deren Mitglieder nicht nur Musik machten, sondern auch aktiv mitkämpften. Neben der Tatsache, dass hier Soldaten für Demokratie und Freiheit kämpften, die zuhause Segregation und Rassismus zu erdulden hatten, ist vor allem die Tatsache bemerkenswert, dass Europe und seine Band wahrscheinlich den ersten Jazz nach Europa brachten. Dass diese Musik mit der Art von Jazz wenig zu tun hatte, die bald auf Schallplatten erschien und weltweit begeistert aufgenommen wurde, dass der Marschkapellen-Charakter deutlich stärker war als die Improvisation kleinerer Besetzungen, führte dazu, dass die Jazzgeschichte oft genug höchstens von “Proto-Jazz” sprach. Und doch ist es die Spielhaltung dieser Bands, die von ihr als wohl erster Jazzerfahrung für viele europäische Zuhörer sprechen lässt. Vom 1. Januar 1918 bis zum 13. Januar 1919 waren europe und seine Band in ganz Frankreich zu hören, in Brest, wo sie per Schiff anlandeten (und wieder abreisten), sowie in Orten wie Saint-Nazaire, Aix-les-Bains, Givry, Maffrécourt, Châlons, Paris, Vouziers, Bladhelsheim, Belfort und Les Mans. Aus Anlass des Zentenariums findet im Februar 2018 in Nantes eine Konzertreihe und eine kleine Konferenz statt. Zuvor hat der französische Jazzhistoriker Dan Vernhettes ein lohnenswertes und reich bebildertes Buch herausgegeben, das die Stationen von Europes Hellfighters Band sowie die anderer, weniger bekannter afro-amerikanischer Armeekapellen in Europa im I. Weltkrieg oder kurz danach verfolgt.
Im Februar 2018 jährt sich zum 100sten Mal die Ankunft afro-amerikanischer Regimenter in Europa. Das 15. Regiment der New York National Guard, das in Frankreich als 369stes Regiment der IV. französischen Armee zugeordnet wurde, kämpfte an der Front, kam bis zum Rhein und wurde nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten als Harlem Hellfighters gefeiert. Zu dem Regiment gehörte eine Militärkapelle, die von Ltd. James Reese Europe geleitet wurde und deren Mitglieder nicht nur Musik machten, sondern auch aktiv mitkämpften. Neben der Tatsache, dass hier Soldaten für Demokratie und Freiheit kämpften, die zuhause Segregation und Rassismus zu erdulden hatten, ist vor allem die Tatsache bemerkenswert, dass Europe und seine Band wahrscheinlich den ersten Jazz nach Europa brachten. Dass diese Musik mit der Art von Jazz wenig zu tun hatte, die bald auf Schallplatten erschien und weltweit begeistert aufgenommen wurde, dass der Marschkapellen-Charakter deutlich stärker war als die Improvisation kleinerer Besetzungen, führte dazu, dass die Jazzgeschichte oft genug höchstens von “Proto-Jazz” sprach. Und doch ist es die Spielhaltung dieser Bands, die von ihr als wohl erster Jazzerfahrung für viele europäische Zuhörer sprechen lässt. Vom 1. Januar 1918 bis zum 13. Januar 1919 waren europe und seine Band in ganz Frankreich zu hören, in Brest, wo sie per Schiff anlandeten (und wieder abreisten), sowie in Orten wie Saint-Nazaire, Aix-les-Bains, Givry, Maffrécourt, Châlons, Paris, Vouziers, Bladhelsheim, Belfort und Les Mans. Aus Anlass des Zentenariums findet im Februar 2018 in Nantes eine Konzertreihe und eine kleine Konferenz statt. Zuvor hat der französische Jazzhistoriker Dan Vernhettes ein lohnenswertes und reich bebildertes Buch herausgegeben, das die Stationen von Europes Hellfighters Band sowie die anderer, weniger bekannter afro-amerikanischer Armeekapellen in Europa im I. Weltkrieg oder kurz danach verfolgt.
Vernhettes beginnt mit einem Überblick über zeitnahe Begegnungen amerikanischer Jazzbands mit einem europäischen Publikum, sowie über den Eintritt der Vereinigten Staaten in den “Großen Krieg”. Er beschreibt das Camp Pontanézen in Brest, in dem am 12. November 1917 die ersten amerikanischen Truppen anlangten, und beziffert die Soldaten in den 27 afro-amerikanischen Regimentern auf 42.000, darunter immerhin ca. 1.000 Musiker, die in den Armeekapellen Dienst taten. Er widmet sich Jim Europes Biographie, der 1880 in Mobile, Alabama, geboren wurde und um die Jahrhundertwende nach Washington, D.C., zog. Europe arbeitete als Pianist, Geiger und Dirigent für verschiedene Varietéshows und machte sich ab 1903 auf der New Yorker Musikszene einen Namen. Dort setzte er sich auch für eine Interessenvertretung für afro-amerikanische Musiker ein und gründete 1910 den Clef Club, der ein eigenes Symphony Orchestra organisierte und Musikern in der ganzen Stadt Arbeit vermittelte. Bald begleitete seine Band das populäre Tanz-Duo Irene und Vernon Castles, für die er Stücke im Repertoire hatte, die er auch auf Schallplatte aufnahm. Noch vor Kriegseintritt der Vereinigten Staaten meldete er sich im September 1916 zusammen mit dem Sänger Noble Sissle freiwillig zum Wehrdienst, ein halbes Jahr später wurde er damit beauftragt, “die beste Militärkapelle der Vereinigten Staaten” zu organisieren. Per Zeitungsannonce suchte Europe Musiker im ganzen Land und reiste sogar nach Puerto Rico, um dort Instrumentalisten zu rekrutieren. Am 22. Juni 1917 gab die Kapelle ihr erstes Konzert im New Yorker Manhattan Casino vor 4000 Zuhörern, im Monat darauf wurden die Mitglieder in den aktiven Dienst berufen.
Vernhettes beschreibt, wie diese Kapelle im Januar 1918 in Brest ankam und wie sie und alle anderen afro-amerikanischen Soldaten in den französischen Dörfern und Städten, durch die sie kamen, willkommen geheißen wurden. In Orten wie Aix-les-Bains blieben sie einen vollen Monat, gaben Konzerte in Parks, Krankenhäusern und im Kasino. Im März wurde das Regiment, dem die Band angehörte, unter die Befehlsgewalt der französischen Armee gestellt und die weitere Ausbildung der Soldaten von französischen Offizieren übernommen. Zwischenzeitlich wurde Europe den kämpfenden Truppen zugeteilt und war der erste schwarze Offizier, der Truppen in den Grabenkämpfen kommandierte. Vernhettes hat etliche Fotos gefunden, die die Band in Aktion zeigt, teils bei Konzerten für das zivile französische Publikum, teils für Mitglieder der US-Armee. Es gibt ein Foto, dass einzelne Musiker neben einem Schlagzeug zeigt, auf dem deutlich “Jass Band” zu lesen steht, das damit klar macht, dass der musikalische Grat zwischen Jazz und sonstiger Musik zumindest für die Musiker nicht sonderlich hoch war. Im September 1918 waren etliche der Soldaten an der großen Schlacht zwischen Verdun und Reims beteiligt, im November erreichten sie den Rhein. Im Dezember erhielten Europe und andere Mitglieder des 369sten Regiments das Croix de Guerre, im Januar 1919 kehrten sie alle zurück nach New York, wo sie mit einer großen Parade empfangen wurden. Ein kurzer Einschub beschreibt die Aufnahmen, die Europes Band 1919 für das Pathé Label machte, und in einem Nachsatz beschreibt Vernhettes, wie Europe während eines Konzerts im Mai 1919 vom Schlagzeuger der Band erstochen wurde.
Die Hellfighters schrieben Geschichte, aber Vernhettes ist es auch wichtig auf andere Bands hinzuweisen, die zur selben Zeit in Frankreich zu hören waren. Er fasst zusammen, was über die weiteren Regimentskapellen zu finden ist, beschreibt das Wirken etwa der Bands unter Leitung von Tim Brymn, George Dulf und Will Vodery. Ein kurzer Ausblick widmet sich dem Wirken des Schlagzeugers Louis Mitchell, des Sängers Noble Sissle und des Pianisten und Bandleaders Sam Wooding, die alle ihren Anteil an der Popularisierung von Jazz und afro-amerikanischer Musik in Europa in den Jahren direkt nach dem 1. Weltkrieg hatten.
Dan Vernhettes Buch ist überaus reich bebildert und fasst lesenswert zusammen, was über die Aktivitäten afro-amerikanischer Militärkapellen in den Jahren zwischen 1917 und 1919 zu finden ist. Er geht nicht weiter auf die Frage ein, inwieweit die Musik Europes und anderer als “Jazz” zu werten ist oder damals als “Jazz” rezipiert wurde, diskutiert in seinen knappen Anmerkungen zu den Aufnahmen James Reese Europes immerhin, wie sich deren Musik zwischen Vorbildern wie John Philip Sousa und Arthur Pryor und dem instrumentalen Ragtime der Zeit bewegten. Das lesenswerte Büchlein ist allemal ein würdiger Tribut an das hundertjährige Jubiläum der Ankunft des Jazz in Europa.
Wolfram Knauer (Februar 2018)
Jazz in Concert. Mein Leben als Konzertveranstalter
von Oskar Riha & Susanne Schulzke-Riha
Ludwigshafen 2017 (Rosamontis Verlag)
275 Seiten, 19,80 Euro
ISBN: 978-3-940212-87-0
 1994 entschloss sich Oskar Riha, Gitarrenlehrer aus Memmingen im Allgäu, ein Konzert mit dem Trio des Schlagzeugers Paul Wertico zu organisieren, der in den 1980er und 1990er Jahren in der Band des von Riha so bewunderten Pat Metheny mitgewirkt hatte. Aus dem einen Konzert wurden bald mehr, und vier Jahre später gründete er einen Verein, JAMM, Jazz & More Memmingen, um Verstärkung für die vielen Aufgaben zu haben und zugleich besser Fördergelder einwerben zu können. Mit JAMM brachte Riha die nächsten 18 Jahre über viele namhafte Musiker der amerikanischen wie europäischen Jazzszene in die kleinen Stadt im Allgäu, bis sich der Verein 2016 auflöste und er sich selbst von Konzerte-Organisieren zurückzog.
1994 entschloss sich Oskar Riha, Gitarrenlehrer aus Memmingen im Allgäu, ein Konzert mit dem Trio des Schlagzeugers Paul Wertico zu organisieren, der in den 1980er und 1990er Jahren in der Band des von Riha so bewunderten Pat Metheny mitgewirkt hatte. Aus dem einen Konzert wurden bald mehr, und vier Jahre später gründete er einen Verein, JAMM, Jazz & More Memmingen, um Verstärkung für die vielen Aufgaben zu haben und zugleich besser Fördergelder einwerben zu können. Mit JAMM brachte Riha die nächsten 18 Jahre über viele namhafte Musiker der amerikanischen wie europäischen Jazzszene in die kleinen Stadt im Allgäu, bis sich der Verein 2016 auflöste und er sich selbst von Konzerte-Organisieren zurückzog.
Jetzt erinnert sich Oskar Riha in dem von seiner Frau Susanne Schulzke-Riha verfassten Buch an die vielen Begegnungen mit Stars, an die Freuden und die oft unvorhergesehenen Probleme, die diese Konzerte mit sich brachten, und er lässt seine Leser dabei teilhaben an den alltäglichen, den spontanen und absurden Erlebnissen, denen sich (insbesondere ehrenamtliche) Konzertveranstalter immer mal wieder ausgesetzt sehen.
Riha ist dabei, wie man der Lektüre anmerkt, immer ein Fan dieser Musik geblieben. Er liebt den Jazz, und er hat klare Präferenzen für das, was er präsentieren will. Selbst Gitarrist schlägt sein Herz natürlich für Metheny, Ralph Towner, John Abercrombie oder Robben Ford, daneben aber auch für Charlie Haden, Charles Lloyd, Bill Evans, Brad Mehldau, Michael Wollny, Jan Garbarek und andere mehr.
Über die Jahre erarbeitete er sich ein Publikum, das teils aus der Region stammte, für die Memminger Events teils aber auch aus der Ferne anreiste. Der Ruf seiner Konzertreihe sprach sich bei anderen Veranstaltern in Deutschland genauso herum wie bei Musikern international. Riha schaffte es nach und nach ein Netzwerk zu bilden mit Künstlern, Agenturen, Veranstaltern und vielen anderen, die er durch sein Engagement überzeugen konnte und die ihm helfen wollten, die Konzerte zu Erfolgen werden zu lassen.
Rihas Buch handelt also von all dem, was auch dazugehört, um die Musik erklingen zu lassen. Es handelt von Verträgen, von Gagenverhandlungen, von technischen Ridern, von Backlines und von vertraglich festgehaltenen Sonderwünschen aller Art. Es handelt von dem Bemühen, den Künstlern einen guten Aufenthalt und die besten Spielmöglichkeiten zu bieten, und es handelt davon, wie schwer all das sein kann, wenn man keinen festen Veranstaltungsort zur Verfügung hat und sich um alle zusätzlichen Details neben dem Brotberuf kümmern muss. Riha beschreibt lebhaft, wie er über die Jahre Erfahrungen sammeln konnte, wie er mit Problemen umging und sie meistens erfolgreiche meisterte, und wie die Künstler, die er zu betreuen hatte, seinen ganz persönlichen Einsatz in der Regel auch zu schätzen wussten.
Der Jazz lebt, wie wenige andere Sparten des Musikgeschäfts, von genau solchen engagierten “Verrückten” wie Oskar Riha. Er lebt davon, dass es eine flächendeckende Struktur von Kleinveranstaltern und ehrenamtlichen Initiativen gibt, deren Mitglieder Konzerte in erster Linie deshalb veranstalten, weil sie die Künstler in ihrer Region sonst nie hören könnten. Oskar Rihas Buch bringt einem die Freuden genauso wie die Beschwernisse dieses Engagements anschaulich vor Augen, und Riha streicht neben der großartigen Musik, die er erleben konnte, immer auch heraus, wie befriedigend die Begeisterung des Publikums für ihn war. Sein Buch, das genauso über hervorragende Konzerte berichtet wie über Freundschaften, die er über die Jahre mit “seinen” Künstlern schließen konnte, ist für Memminger ein einziges Erinnerungsalbum, für alle anderen ein Beispiel für die ehrenamtliche Arbeit von der die hiesige Jazzszene auch lebt, und außerdem eine schnelle und überaus vergnügliche Lektüre.
Wolfram Knauer (Februar 2018)
PS: Lieber Oskar Riha: Es gibt einen Unterschied zwischen Roadies und Rowdies (S. 110), aber ich habe herzhaft gelacht!
Joe Sydow und “Kleopatra”
herausgegeben von Martina Schmoll
Hamburg 2017 (Fokumala Verlag)
100 Seiten, 39 Euro (Selbstkostenpreis, plus Porto)
Bestellung über info@fokumala.de
 Der Bassist Joe Sydow verstarb am 3. Januar 2018 im Alter von 91 Jahren. Er konnte das Erscheinen des Bildbandes gerade noch miterleben, den Martina Schmoll aus mit Dokumenten über seine Karriere, Zeitungsartikeln über seine musikalischen Aktivitäten, privaten Fotos und Gedichten zusammengestellt hat, die Sydow seit seiner Jugend gerne schrieb und durchaus auch gerne vortrug. Das Ergebnis ist ein liebevoll layoutetes und sehr persönliches Buch, keine kritische Dokumentation, sondern eine freundschaftliche Erinnerung an ein reiches musikalisches Leben und an einen Hamburger Fan- und Freundeskreis, der ihm bis zum Schluss treu blieb.
Der Bassist Joe Sydow verstarb am 3. Januar 2018 im Alter von 91 Jahren. Er konnte das Erscheinen des Bildbandes gerade noch miterleben, den Martina Schmoll aus mit Dokumenten über seine Karriere, Zeitungsartikeln über seine musikalischen Aktivitäten, privaten Fotos und Gedichten zusammengestellt hat, die Sydow seit seiner Jugend gerne schrieb und durchaus auch gerne vortrug. Das Ergebnis ist ein liebevoll layoutetes und sehr persönliches Buch, keine kritische Dokumentation, sondern eine freundschaftliche Erinnerung an ein reiches musikalisches Leben und an einen Hamburger Fan- und Freundeskreis, der ihm bis zum Schluss treu blieb.
Ekkehard Sydow kam 1926 in Rottach-Egern am Tegernsee zur Welt, und begann zu Schulzeiten klassischen Kontrabass zu spielen. Nach Kriegsende begann er seine Jazzkarriere in der Band von Klaus Gering, spielte dann von 1947 bis in die 1960er Jahre mit dem Orchester Kurt Edelhagen, daneben mit dem Geiger Helmut Weglinski. Ab den späten 1960er Jahren war er Bassist des NDR Tanz- und Unterhaltungsorchesters und gehörte damit fest zur Hamburger Jazzszene, die eher traditionell, also irgendwo zwischen New Orleans und Swing, ausgerichtet war. In den 1980er Jahren wirkte er bei Musicals mit und war 2010 im Film “Schenk mir dein Herz” mit Paul Kuhn zu sehen, den er noch von seiner Jugend in Heidelberg her kannte.
All diese Stationen dokumentiert Martina Schmoll mit vielen Fotos, Zeitungsausrissen und liebevollen Anmerkungen. Da finden sich Erinnerungen an eine Nordafrikatournee Edelhagens, Korrespondenz mit der GEMA, die Kopie seines Vertrags für eine Aufzeichnung zum 25-jährigen Jubiläum der Edelhagen Big Band beim WDR, und Erinnerungen von Sydow und Mitmusikern an die Tücken des Musikerlebens und wie man sie meistert. Dazwischen immer wieder Gedichte, die Sydow über die Jahre verfasst hatte, und zwar zu allem und jedem: manchmal im Stile eines Eugen Roth, zu Themen wie dem pekuniären Wert des menschlichen Körpers, zu Ehrgeiz, Hunden, Parfum und Körpergeruch, zum Wert der Verlobung, aber auch über Orchesterleiter wie Alfred Hause und Franz Thon, über Mitmusiker wie Günter Fuhlisch und Ladi Geisler.
Man sollte bei alledem also keine zusammenhängende Biographie erwarten, sondern vor allem eine Sammlung von Anekdoten. Bei alledem – und wissend, dass es ihr um die Würdigung eines Freundes ging und eben nicht um die lückenlose Dokumentation seiner Karriere – erlauben die von Martina Schmoll gesammelten Erinnerungen dennoch einen Einblick ins Schaffen eines über die Jahre verlässlichen Musikers, der im Hintergrund den deutschen Jazz mit geprägt hat.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Modern Piano School. Klavier. Band 1+2. Schule für Jugendliche & Erwachsene
von Axel Kemper-Moll
Offenbach 2017 (Art Edition)
jeweils 76 Seiten
jeder Band: 19,90 Euro; Begleit-CDs je Heft: 10 Euro
ISBN: 978-3-947071-00-5 (Band 1)
ISBN: 978-3-947071-02-9 (Band 1)
www.modern-piano-school.de
 Als erfahrener Klavierpädagoge hörte Axel Kemper-Moll von Kolleg/innen immer wieder, dass sie, um ihre Schüler/innen mit interessantem Material bedienen zu können, Notenmaterial aus unterschiedlichsten Quellen zusammenstückeln müssen. Ihm ging es in seiner täglichen Arbeit nicht viel anders, und so entschied er sich, eine eigene Klavierschule herauszugeben, in der all die pädagogischen Facetten enthalten sind, die ihm wichtig schienen: Ansätze an klassische Kompositionen also genauso wie an populäre Klavierstile, an Latin-, Blues- und Jazzstandards sowie überhaupt an das Thema der Improvisation.
Als erfahrener Klavierpädagoge hörte Axel Kemper-Moll von Kolleg/innen immer wieder, dass sie, um ihre Schüler/innen mit interessantem Material bedienen zu können, Notenmaterial aus unterschiedlichsten Quellen zusammenstückeln müssen. Ihm ging es in seiner täglichen Arbeit nicht viel anders, und so entschied er sich, eine eigene Klavierschule herauszugeben, in der all die pädagogischen Facetten enthalten sind, die ihm wichtig schienen: Ansätze an klassische Kompositionen also genauso wie an populäre Klavierstile, an Latin-, Blues- und Jazzstandards sowie überhaupt an das Thema der Improvisation.
Nach elementarem Grundwissen über die Tastatur, das Tonsystem, den grundlegenden Fingersatz und Körperhaltung folgt im ersten Band gleich der musikalische Spaß: zum Teil selbstgeschriebene Kompositionen, zum Teil Bearbeitungen klassischer Themen. Kemper-Moll erhöht den Schwierigkeitsgrad mäßig; er empfiehlt den Schülern die komplexeren Titel auf der zu den Heften erhältlichen CD zu hören, um die Melodien oder die Rhythmik im Zusammenhang zu erleben und sich aus dem Mix von Notenbild und Hörerinnerung an die Musik heranzuarbeiten. Viele Titel sind vierhändig gesetzt mit den schwereren Teil für den Lehrer, der etwa Wagners “Pilgerchor” auffüllt oder Jacques Offenbachs “La Vie Parisienne” den nötigen Schwung verleiht. Kemper-Moll weiß, wie sehr gerade Anfänger auf dem Instrument an feste Fingerhaltungen gewöhnt sind und erweitert die Klaviatur Stück für Stück um weitere Lagen, erläutert auch, wie erste technische Schwierigkeiten zu lösen sind (etwa das Verschieben des zweiten und fünften Fingers). Dem Lehrer bleibt es insbesondere in den jazzigeren Stücken aus Kemper-Molls Feder belassen, die vorgegebenen Lehrerstimme oder aber eine Begleitung aus den in der Schülerstimme benannten Harmoniesymbolen zu spielen. Der erste Band endet mit einem gerade für Klavieranfänger besonders wichtigen Kapitel: vier Weihnachtsliedern, von denen zwei allein und zwei mit dem Lehrer zu spielen sind (den aber vielleicht nicht jeder zur privaten Weihnachtsfeier im Kreis der Familie einladen mag).
Band 2 erweitert das Wissen um die Klaviertastatur nun deutlich um die bislang noch fehlenden Noten, um Pedale und Vorzeichen am Zeichenanfang, um Durtonleitern (wobei zum Schluss auch die Molltonleitern erläutert werden) und um die Einladung, dem Ohr genauso zu vertrauen wie den Augen (also hörend zu lernen, nicht nur lesend) und sich dabei bewusst zu sein, das Improvisation oder Fantasieren schon immer mit zur Musikausübung gehörte. Zu Beginn des Bands lässt Kemper-Moll seine Schüler jeden einzelnen Ton auf der Klaviatur identifizieren, ermutigt zum Erkennen der Lagen und ermutigt, sofern man einzelne Stücke zu können meint, die sich dazu anbieten, mit Rhythmik, Pausen und eigenen Melodien zu experimentieren. Er stellt die Pedale vor und zeigt ihren Einsatz am Beispiel des Gospels “Michael Row the Boat Ashore”. “Hit the Road Jack” lässt ihn außerdem Swingachtel und Bluestonleiter einführen. Lehrer-/Schüler-Stücke sind in diesem Band schon seltener, und wenn (wie im “D Moll Menuett” von Johann Sebastian Bach) sehr effektvoll gesetzt. Einen besonderen Schwerpunkt lenkt Kemper-Moll auf Fingerhaltung und Fingersätze und reißt knapp die Welt der Pentatonik an. Dann gibt es noch ein paar Vorführstücke: Auf Eigenes wie den “Tanz auf Hawaii” oder “Tom’s Boogie” folgt Bachs “Präludium C-Dur” (unbearbeitet), eigene Stücke mit Anleihen aus irischer Folklore oder jiddischer Musik, Tschaikowski, Händel, und – mit all dem Üben ist wahrscheinlich wieder ein Jahr vergangen – weitere Weihnachtslieder, mit denen man die Familie beglücken kann.
Der geplante dritte Band wird sich stärker mit handwerklichen Grundlagen befassen und außerdem eine Anleitung zum Spiel nach Akkordsymbolen und zur Improvisation geben.
Kemper-Molls “Modern Piano School” ist so angelegt, dass Langeweile eigentlich weder beim Lehrer noch beim Schüler aufkommen sollte. Sie bietet genug stilistische Abwechslung, einen behutsamen Fortgang der Unterrichts mit etlichen Möglichkeiten für die Klavierlehrer, die angerissenen Themen weiter zu vertiefen. Vor allem versucht Kemper-Moll in seiner Klavierschule immer wieder die Furcht vor den Noten auf dem Papier zu nehmen und den Schüler zu ermutigen, daneben seinem Ohr zu vertrauen.
Wolfram Knauer (November 2017)
The Jazz Repertoire. A Survey
von Jan J. Mulder
Almere/Netherlands 2017 (Names & Numbers)
598 Seiten, 45 Euro
ISBN: 978-90-77260-24-1
www.names-and-numbers.nl
 Names & Numbers ist genau das: eine in den Niederlanden publizierte Zeitschrift, die sich der diskographischen Erforschung des Jazz widmet, also fragt, wer wann was aufgenommen hat, dabei Lücken in der Dokumentation des Aufnahmeschaffens vieler Künstler schließt, auf Fehler bisheriger Diskographien hinweist oder generelle Fragen darüber aufwirft, was Diskographien leisten können und leisten sollen. Eigentlich, sollte man meinen, ist gerade das Feld der Diskographie eines, das heutzutage am besten im Internet bearbeitet werden könnte, weil es hier auf die Vernetzung von unzähligem Einzelwissen ankommt, das insbesondere bei Sammlern vorhanden ist, die die Originalveröffentlichungen vor sich haben, in sie hineinhören und auf das Label oder, sofern vorhanden, auf die Plattencover schauen können. Tatsächlich gibt es mittlerweile eine Reihe an Datenbanken, die die ehedem in Buch- oder Zettelform (Brian Rust, Willem Bruyninckx, Tom Lord) publizierten Diskographien ablösen. Es gibt Mailinglisten, in denen Sammler sich genau über solche Fragen austauschen. Und es gibt vereinzelte Versuche kommentierbarer Diskographien, die das auch in Zeitschriften wie Names & Numbers gesammelte Wissen zusammenfassen und die Diskussionen über einzelne Aufnahmen dokumentieren können.
Names & Numbers ist genau das: eine in den Niederlanden publizierte Zeitschrift, die sich der diskographischen Erforschung des Jazz widmet, also fragt, wer wann was aufgenommen hat, dabei Lücken in der Dokumentation des Aufnahmeschaffens vieler Künstler schließt, auf Fehler bisheriger Diskographien hinweist oder generelle Fragen darüber aufwirft, was Diskographien leisten können und leisten sollen. Eigentlich, sollte man meinen, ist gerade das Feld der Diskographie eines, das heutzutage am besten im Internet bearbeitet werden könnte, weil es hier auf die Vernetzung von unzähligem Einzelwissen ankommt, das insbesondere bei Sammlern vorhanden ist, die die Originalveröffentlichungen vor sich haben, in sie hineinhören und auf das Label oder, sofern vorhanden, auf die Plattencover schauen können. Tatsächlich gibt es mittlerweile eine Reihe an Datenbanken, die die ehedem in Buch- oder Zettelform (Brian Rust, Willem Bruyninckx, Tom Lord) publizierten Diskographien ablösen. Es gibt Mailinglisten, in denen Sammler sich genau über solche Fragen austauschen. Und es gibt vereinzelte Versuche kommentierbarer Diskographien, die das auch in Zeitschriften wie Names & Numbers gesammelte Wissen zusammenfassen und die Diskussionen über einzelne Aufnahmen dokumentieren können.
Names & Numbers also veröffentlicht neben seiner Vierteljahreszeitschrift ab und an Bücher, oft Diskographien einzelner Künstler oder Labels. Das wohl dickste Buch der bisherigen Reihe ist soeben erschienen, Jan J. Mulders “The Jazz Repertoire. A Survey”, in dem der Autor, selbst einer der fleißigsten Diskographen Europas, das Repertoire von Jazzmusikern in Augenschein nimmt, aufgelistet von “A” wie “ABC Blues” bis “Z” wie “Zumba”.
Im Vorwort erklärt Mulder, dass er sehr bewusst vom Jazzrepertoire statt von Jazz Standards spricht, da etliche der Titel einem breiteren Publikum (und auch vielen Musikern) kaum bekannt sein dürften. Jeder Eintrag des Buchs ist mit Informationen über die Autoren (Text / Musik) und das ursprüngliche Veröffentlichungsjahr versehen. Eine knappe Kategorisierung indiziert, wie oft das Stück aufgenommen wurde (von “100-300 Mal” bis “900-1100 Mal”, wobei zwei Titel, nämlich “Body and Soul” und der “St. Louis Blues” eine eigene Kategorie erhalten, nämlich “über 1100 Mal”. Und schließlich gibt es den Hinweis auf – meist zwischen drei und sechs – wichtige Künstler, die den betreffenden Titel aufgenommen haben. Es finden sich Verweise auf alternative Titelungen genauso wie kurze Erklärungen der Titel (etwa: “9:20 Special: die Uhrzeit der Aufnahme am 10. April 1941” oder “Mahoganny Hall Stomp: ein Bordell in New Orleans”).
Das Ergebnis also ist eine ausführliche Listung von – nun ja, wieviel Titel es genau in Mulders Buch geschafft haben, wissen wir nicht. Und hier kommt dann auch die Kritik, die an die anfangs gemachten Anmerkungen zum Nutzen von Datenbanken anknüpft: So hilfreich dieses Buch auch zum schnellen Nachblättern über Titel ist – eine Art ausführlicherer Titelindex zu bestehenden Diskographien –, so wäre es ein Leichtes gewesen, zusätzliche Information zur Erhebung zu liefern, also etwa dazu, welches die Eckdaten sind, die der Autor berücksichtigt hat, wieviel Titel dieses Jazzrepertoire in Zahlen umfasst, vielleicht auch eine Aufgliederung der Menge an Titel nach Jahren oder wenigstens Jahrzehnten. All das wäre unter dem Untertitel “A Survey” eigentlich zu erwarten und würde dem Forscher, der diese Datensammlung nutzen will, helfen, sie über die reine Listung hinaus einzuordnen. 40 weitere Seiten hätten wahrscheinlich gereicht, die gesammelten Daten nach verschiedenen Fragestellungen darzustellen. Ohne diese Information bleibt das Buch nicht mehr – aber eben auch nicht weniger – als ein gutes Nachschlagewerk zum Repertoire der Jazzgeschichte.
Wolfram Knauer (November 2017)
Long Play
von Arne Reimer
Köln 2017 (Buchhandlung Walther König)
248 Seiten, 39,80 Euro
ISBN: 978-3-96098-037-7
 Arne Reimers zweibändige “American Jazz Heroes” waren mehr als ein Fotobuch; in ihnen gingen die Bilder mit den Texten, die der Fotograf selbst verfasst hatte, eine Einheit ein, ergänzten sich gegenseitig, beleuchteten die Besuche Reimers bei den Giganten der Jazzgeschichte von unterschiedlichen Perspektiven. In “Long Play” müssen die Fotos für sich sprechen. Reimer reiste für die vorgenannten Bücher ja viel durch die Vereinigten Staaten und besuchte – Plattensammler, der er ist -, wo immer er war, die Läden, in denen antiquarisch LPs gehandelt wurden. Von nichts anderem handelt “Long Play”, von der Aura der schwarzen Scheiben, von den Geschäften, in denen diese auf neue Liebhaber warten, und von den Kunden, auf die sie eine so unendliche Faszination ausüben.
Arne Reimers zweibändige “American Jazz Heroes” waren mehr als ein Fotobuch; in ihnen gingen die Bilder mit den Texten, die der Fotograf selbst verfasst hatte, eine Einheit ein, ergänzten sich gegenseitig, beleuchteten die Besuche Reimers bei den Giganten der Jazzgeschichte von unterschiedlichen Perspektiven. In “Long Play” müssen die Fotos für sich sprechen. Reimer reiste für die vorgenannten Bücher ja viel durch die Vereinigten Staaten und besuchte – Plattensammler, der er ist -, wo immer er war, die Läden, in denen antiquarisch LPs gehandelt wurden. Von nichts anderem handelt “Long Play”, von der Aura der schwarzen Scheiben, von den Geschäften, in denen diese auf neue Liebhaber warten, und von den Kunden, auf die sie eine so unendliche Faszination ausüben.
Da sind Platten aufeinandergestapelt oder warten im Rack aufs Durchblättern. Ein Poster an der Wand preist Abtastsysteme und –nadeln an. Im Schaufenster oder an Wandregalen sind einzelne Plattencover aufgestellt, um das Publikum anzuziehen. Plattenspieler stehen bereit, damit man in das eine oder andere Exemplar hineinhören kann. Kunden mit Kopfhörern oder mit deutlichem Sucherblick tauchen völlig ab in die Welt der zu Vinyl erstarrten Musik. Man meint die Läden geradezu riechen zu können, Low-Budget-Geschäfte, oft eher provisorisch zusammengezimmert, in heruntergekommenen Hütten oder im Keller eines Hauses. Alles wirkt improvisiert, selbst da, wo statt Jazz Paul Anka oder Buddy Holly zum Verkauf steht. Überhaupt: Schallplatten, scheint es, sind das Medium vor der Genretrennung. Doch, da stehen Reiter mit Beschriftungen wie “Punk”, “Oldies”, “Vocals”, aber man ahnt, dass bei dem Durcheinander der Läden, bei den Hinguckern unter den Plattencovern, selbst der stilkonformistischste aller Käufer gern auch im Nachbarregal wühlt. Man ahnt, dass selbst bei zielgerichteten Sammlern die Plattencover Neugier mindestens genauso auslösen müssen wie die Hoffnung, endlich die noch fehlende Scheibe zu ergattern.
Und noch etwas fällt auf: Schallplatten sind ein Ding für junge Leute, und nicht nur für die DJs, die dabei etwas zum Sampeln und Mischen suchen. So wirken die Archivfotos, die am Schluss des Buchs Bilder aus den 1950er bis 1970er Jahren zeigen, als all diese Platten den Markt ursprünglich eroberten, auch wie ein seltsamer Kontrast: Von der Ware zum Kultobjekt. Seltener kam die Atmosphäre dieser Erfahrung so überzeugend rüber wie in diesem Buch, ganz ohne Erklärung, denn: Ein Essay von Ulf Erdmann Ziegler beschreibt zwar die Faszination des Plattensammelns, doch hielt die fürs Design Verantwortliche es hier leider für eine gute Idee, den Text in silbernen Buchstaben auf schwarzem Grund zu drucken. Und so ist man dankbar, dass das Buch gerade keinen Text benötigt, weil die Bilder alles sagen…
Wolfram Knauer (Oktober 2017)
The Original Blues. The Emergence of the Blues in African American Vaudeville
von Lynn Abbott & Doug Seroff
Jackson/MS 2017 8University Press of Mississippi)
420 Seiten, 85 US-Dollar
ISBN: 978-1-4968-1002-1
 Der Blues ist eine der wichtigsten Grundlagen amerikanischer populärer Musik. Oft wird er vereinfacht als eine Art ländliche Volksmusik dargestellt, und tatsächlich liegt man mit dieser Beschreibung bei vielen seiner Protagonisten nicht ganz falsch. Im frühen 20sten Jahrhundert wurde der Blues allerdings auch zu einer wichtigen Bühnenmusik in den Varietés der Vereinigten Staaten, den Vaudeville-Shows, in denen bald auch Sängerinnen wie Ma Rainey, Bessie, Clara oder Trixie Smith zu hören waren. Lynn Abbott und Doug Seroff, die sich bereits in zwei vorausgegangenen Büchern mit der Frühgeschichte afro-amerikanischer Musik beschäftigt und dabei immer auch die Einbindung musikalischer Praktiken in die afro-amerikanische Community berücksichtigt haben, legen jetzt ein dickes Werk vor, das die Schnittstellen zwischen Blues und Showbusiness untersucht.
Der Blues ist eine der wichtigsten Grundlagen amerikanischer populärer Musik. Oft wird er vereinfacht als eine Art ländliche Volksmusik dargestellt, und tatsächlich liegt man mit dieser Beschreibung bei vielen seiner Protagonisten nicht ganz falsch. Im frühen 20sten Jahrhundert wurde der Blues allerdings auch zu einer wichtigen Bühnenmusik in den Varietés der Vereinigten Staaten, den Vaudeville-Shows, in denen bald auch Sängerinnen wie Ma Rainey, Bessie, Clara oder Trixie Smith zu hören waren. Lynn Abbott und Doug Seroff, die sich bereits in zwei vorausgegangenen Büchern mit der Frühgeschichte afro-amerikanischer Musik beschäftigt und dabei immer auch die Einbindung musikalischer Praktiken in die afro-amerikanische Community berücksichtigt haben, legen jetzt ein dickes Werk vor, das die Schnittstellen zwischen Blues und Showbusiness untersucht.
Im ersten Kapitel datieren sie die Geburt der schwarzen Vaudeville-Show ins Jahrzehnt zwischen 1899 und 1909, nennen Saloon-Theater etwa in Jacksonville, Tampa, Savannah, Louisville, New Orleans, Memphis oder Atlanta und beschreiben das Programm in solchen Shows, das Anklänge an die Minstrelshow des 19. Jahrhunderts besaß, sowie die Wahl des musikalischen Repertoires, das in ihnen zu hören war. Um 1910 gab es mehr als 100 kleine schwarze Vaudeville-Theater in den amerikanischen Südstaaten, die Tourneen von Texas nach Florida oder Virginia erlaubten und sogar dazu führten, dass Künstler aus Chicago oder dem Mittleren Westen in den Süden kamen, um hier zu touren.
Etwa um 1910 auch machte Butler May von sich reden, der als “String Beans” große Bühnenerfolge als Sänger und Komiker feierte. Die Autoren verfolgen im zweiten Kapitel ihres Buchs die Karriere dieses Entertainers, der bald zusammen mit seiner Frau Sweetie Matthews unter dem Namen May & May auftrat und nicht nur im Süden der USA, sondern auch in New York und anderswo zu erleben war. Für eine Beschreibung der Musik müssen sie sich dabei auf zeitgenössische Presseberichte verlassen, da String Beans nie ins Studio ging. Sein Einfluss allerdings war riesig; nicht nur nahmen etliche Bluessängerinnen später Stücke aus seinem Repertoire auf und hielten etwa W.C. Handy, Jelly Roll Morton und andere große Stücke auf ihn, der “String Beans Blues” wurde zudem in zahlreichen Aufnahmen zitiert.
Kapitel 3 beleuchtet männliche Bluessänger, die auf den Vaudevillebühnen im Süden auftraten, etwa Baby Seals, Charles Anderson und andere. Kapitel 5 erklärt, wie dieselben Bühnen dazu führten, dass Bluessängerinnen wie Ma Rainey und Bessie Smith populär wurden, die hier ihr Handwerk lernten. In einem Zwischenkapitel gehen die Autoren auf die Realität des Tourneelebens ein, beschreiben die Aufgabe von Agenturen wie T.O.B.A., der Theatre Owners Booking Association, die dafür sorgten, dass Künstler Anschlussengagements erhielten, die bei diesen allerdings nicht nur beliebt waren.
Kapitel 5 schließlich führt uns in die 1920er Jahre, als der Blues mehr und mehr auch ein kommerzielles Geschäft darstellte, beleuchtet die Folgen von “Shuffle Along”, jener rein afro-amerikanischen Show, die 1921 enorme Erfolge am Broadway feierte, aber auch außerdem die Auswirkungen der Schallplattenindustrie, die insbesondere schwarze Bluessängerinnen für ihre “race records” entdeckte, also jenen Teil der Produktion, der sich primär an afro-amerikanische Käufer wandte. Die Autoren beschreiben geschäftliche Usancen, sowohl in Bezug auf Auftritte und Tourneen als auch in Bezug auf Plattenaufnahmen, nennen Gagen und Honorare und erzählen, wie viele der Künstler sich, insbesondere, wenn sie im Süden tourten, mit rassistischen Übergriffen konfrontiert sahen.
70 Seiten Fußnoten, ein ausführlicher Namens-, Titel- und Ortsindex belegen, wie akribisch Abbott und Seroff für ihr Buch recherchiert haben. In jedem Teilkapitel, in dem sie die Beziehung einzelner Künstler/innen mit den Vaudevillebühnen beschreiben, steckt so viel an neuen biographischen und kulturhistorischen Einsichten, dass man den Blues der 1920er Jahre und die Professionalität der vielen in dieser Musik aktiven Künstler/innen nach der Lektüre mit deutlich anderem Blick sieht. Eine ungemein gelungene Perspektivverschiebung also, die zudem reich bebildert und spannend zu lesen ist.
Wolfram Knauer (Oktober 2017)
Jazz and Art. Two Steps Ahead of the Century
von Sharon Jordan
Hamburg 2017 (Edel earbooks)
220 Seiten, 3 beigeheftete CDs, 49,95 Euro
ISBN: 978-3-9435-7331-2
 Vor zwei Jahren zeigte das Kunstmuseum Stuttgart die sagenhafte Ausstellung “I Got Rhythm. Kunst und Jazz seit 1920”, die von einem ausführlichen Katalog begleitet wurde. Jetzt erscheint ein großformatiger Band der amerikanischen Kunsthistorikerin Sharon Jones, die sich ebenfalls – und, da es sich um keinen Ausstellungskatalog handelt, mit etwas mehr Freiheit bei der Auswahl der Abbildungen – mit dem Thema beschäftigt. Sie fragt, welche Wechselwirkungen Kunst und Jazz im 20sten Jahrhundert hatten, wie also der Jazz als Sujet in Gemälden auftaucht, wie auf der anderen Seite bildende Künstler Jazz als Inspirationsquelle für ihre Kunstwerke nutzten.
Vor zwei Jahren zeigte das Kunstmuseum Stuttgart die sagenhafte Ausstellung “I Got Rhythm. Kunst und Jazz seit 1920”, die von einem ausführlichen Katalog begleitet wurde. Jetzt erscheint ein großformatiger Band der amerikanischen Kunsthistorikerin Sharon Jones, die sich ebenfalls – und, da es sich um keinen Ausstellungskatalog handelt, mit etwas mehr Freiheit bei der Auswahl der Abbildungen – mit dem Thema beschäftigt. Sie fragt, welche Wechselwirkungen Kunst und Jazz im 20sten Jahrhundert hatten, wie also der Jazz als Sujet in Gemälden auftaucht, wie auf der anderen Seite bildende Künstler Jazz als Inspirationsquelle für ihre Kunstwerke nutzten.
Jordan gliedert ihr Buch in eine Einleitung (“Die Ursprünge der Moderne, 1960-1900”) und drei Großkapitel: “Ragtime und populäre Unterhaltung, 1900-1917”, “Das Jazz-Zeitalter in Europa und Amerika, 1920-1930” und “Nachkriegskunst und Jazz, 1940-1990”. Innerhalb dieser Kapitel identifiziert sie Stilrichtungen, künstlerische Ansätze sowie konkrete Künstler, deren Verhältnis zum Jazz sie in Unterkapiteln herausarbeitet. Da geht es dann einerseits um Primitivismus, den deutschen Expressionismus, um Kubismus und Abstraktion, um Surrealismus, Bauhaus und Neue Sachlichkeit, oder um die “entartete Kunst” und “entartete Musik” im Dritten Reich, andererseits um Künstler wie Man Ray, Francis Picabia, Picasso, Aaron Douglas und Archibald Motley, Stuart Davis, Alexander Calder, Otto Dix, Max Beckmann, Piet Mondrian, Henri Matisse, Jean Dubuffet, Jackson Pollock, Romare Bearden, Roy DeCarava, Andy Warhol, Larry Rivers und Jean-Michel Basquiat. Sie alle werden reich bebildert mit teils ganzseitigen, teils kleineren Beispielen, bekannteren Exempeln genauso wie eher selten gezeigten.
“Jazz”, beginnt Jordan ihre inhaltliche Argumentation, “war die erste wirklich moderne Kunstform, deren Ursprung in Amerika liegt.” Schnell wird klar, dass für ihr Thema eine differenzierte Sicht auf die Geschichte, die ästhetische und gesellschaftliche Haltung der Musik zu komplex ist und sie sich deshalb darauf beschränkt, Stereotype der Jazzgeschichtsschreibung als Kontext für das ihr eigentlich Wichtige, nämlich die Umsetzung der Musik in Farbe auf Leinwand, wiederzugeben. Also wird der Jazz wieder einmal (nur) in New Orleans geboren, das Schlagzeug spielt eine große Rolle, Ragtime heißt ursprünglich Stride (?), Kreolen sind hellhäutige Farbige und so weiter und so fort. Diese doch recht unbefangene Sicht auf Jazzgeschichte mag dem Jazzexperten stellenweise etwas zu klischeehaft sein, doch ist dieses Buch eher für den Neugierigen gedacht, der an beidem Spaß hat, Bildender Kunst des 20sten Jahrhunderts und Jazz. Die Individualitätsästhetik des Jazz begeisterte vor allem die modernen Bildenden Künstler, die ab dem Impressionismus ihre eigene Perspektive auf Kunst und Gesellschaft entwickelten. Jordan schildert anhand ihrer Unterkapitel, auf welche Diskurse innerhalb der Bildenden Kunst die Maler rekurrierten, welche Musikdarbietungen sie überhaupt sehen und hören konnten und welche ikonischen Konnotationen sie mit der Darstellung von Jazzszenen ansteuerten. Ihre Kapitel sind kurz und zusammenfassend, fokussiert auf die Rolle des Jazz für die Motivwahl, die Ausführung oder überhaupt fürs Denken der behandelten Künstler oder Stile. Sie zeigt, dass die Faszination mit dem Jazz in Europa genauso wie in Amerika Künstler beflügelte, bleibt in ihren Ausführungen weitgehend beschreibend, geht etwa in Bezug auf Action-Painting-Bilder etwa von Jackson Pollock aber auch auf die Transformation improvisatorischer Praktiken in die malerische Umsetzung ein.
Jordans Buch ist dabei eine durchaus lesenswerte Einführung ins Thema. Von Sonia Delaunay abgesehen, die in einem der Kapitel wenigstens kurz erwähnt wird, behandelt sie keine Künstlerinnen, sondern ausschließlich Männer. Neben der Lektüre aber kann der Leser sich vor allem über die beigehefteten CDs freuen, von denen jede einzelne für eines der drei Kapitel steht und diesen die passende Begleitmusik liefert. Von der Original Dixieland Jazz Band über Jelly Roll Morton und Fats Waller bis zu den Boogie-Woogie-Pianisten, von Louis Armstrong über Count Basie und Duke Ellington bis zu Marlene Dietrich und den Weintraub Syncopators, von Charlie Parker über Art Blakey und Miles Davis bis zu John Coltrane: Die Auswahl der Titel korrespondiert zur Erwähnung in einzelnen Unterkapiteln und hält den Leser bei der Stange, lässt ihn vielleicht weitere Facetten in den Abbildungen entdecken.
Und so ist “Jazz and Art” trotz des etwas holzschnittartigen Verständnisses von Jazzgeschichte ein durchaus empfehlenswertes Buch für Jazz- genauso wie für Kunstfreunde, ein im wahrsten Sinne bunter und swingender Blick auf die Kunstdiskurse des 20sten Jahrhunderts und darauf, wie diese durch eine afro-amerikanische Kulturpraxis neue Impulse erhielten.
Wolfram Knauer (Oktober 2017)
The Art of Conduction. A Conduction Workbook
von Lawrence D. “Butch” Morris (herausgegeben von Daniela Beronesi)
New York 2017 (Karma)
220 Seiten, 40 US-Dollar
ISBN: 978-1-942607-42-7
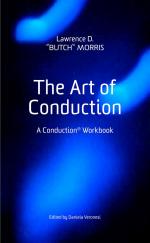 Dirigierte Improvisation: Der im Januar 2013 verstorbene Kornettist Butch Morris hatte sein Leben lang an diesem Traum gearbeitet: als Dirigent vor einem Ensemble jedweder Größe stehen zu können, das improvisiert, jedem einzelnen der Musiker seine individuelle Kreativität zu belassen und doch die Fäden all dessen in der Hand zu behalten und aus der freien Improvisation der Einzelnen eine gelenkte Improvisation des Ensembles zu machen. Das Spannende dabei: Keiner fühlte sich durch Morris’ Dirigat eingeschränkt, alle empfanden das Ergebnis als ein eindrückliche Bündelung ihrer individuellen kreativen Energie. Morris hatte dafür quasi ein Alphabet an Handgesten entwickelt, die er einsetzte, egal ob er mit wenigen Musiker/innen oder mit übergroßen Ensembles arbeitete, und die er über die letzten zehn Jahre seines Lebens für das jetzt veröffentlichte Buch zusammenfasste.
Dirigierte Improvisation: Der im Januar 2013 verstorbene Kornettist Butch Morris hatte sein Leben lang an diesem Traum gearbeitet: als Dirigent vor einem Ensemble jedweder Größe stehen zu können, das improvisiert, jedem einzelnen der Musiker seine individuelle Kreativität zu belassen und doch die Fäden all dessen in der Hand zu behalten und aus der freien Improvisation der Einzelnen eine gelenkte Improvisation des Ensembles zu machen. Das Spannende dabei: Keiner fühlte sich durch Morris’ Dirigat eingeschränkt, alle empfanden das Ergebnis als ein eindrückliche Bündelung ihrer individuellen kreativen Energie. Morris hatte dafür quasi ein Alphabet an Handgesten entwickelt, die er einsetzte, egal ob er mit wenigen Musiker/innen oder mit übergroßen Ensembles arbeitete, und die er über die letzten zehn Jahre seines Lebens für das jetzt veröffentlichte Buch zusammenfasste.
Die Linguistin Daniela Veranesi traf Morris erstmals 2002, war fasziniert von seinem Konzept und organisierte bald Conduction-Workshops mit ihm in Italien. Kurz vor seinem Tod gab Morris ihr auf den Weg, das Buch fertigzustellen und bat sie, “Make it clear, elegant and ‘travelable'”. Nun ist es zum Reisen fast ein wenig zu umfangreich geworden, großformatig mit festen Seiten und festem Einband, aber die Klarheit und Eleganz ist auf jeden Fall da.
Nach Vorworten von Howard Mandel, der Butch Morris’ Konzept in die Geschichte des Jazz und der afro-amerikanischen Musik einbindet, und der Herausgeberin, die erklärt, wieso sie diese Aufgabe übernahm und wie sie das Buch strukturierte, sowie Erfahrungsberichten des Posaunisten J.A. Deane und des Dichters Alan Graubard beginnt der eigentliche, Morris’ Handschrift tragende und durch seine Erklärungen eingeleitete Teil.
Morris erklärt, was Conduction zu leisten in der Lage ist, wie er aus seinen Erfahrungen mit Conduction kreative Lehren gezogen habe in Bezug auf Musik und seine eigene musikalische Ausdrucksweise, aber auch in Bezug auf die teilnehmenden Musiker/innen, weil er Conduction als “Akt der Gemeinschaft” versteht, an dem Musiker jedweden Hintergrunds teilnehmen können. Er erklärt die Aufgabe des Dirigenten, die Rolle der einzelnen Musiker/innen, die Gesamtheit des Ensembles, sowie die Notwendigkeit Geduld zu haben und Conduction als musikalische Praxis zu üben. Den Hauptteil des Buchs macht dann die Klassifikation der Handgesten aus, sortiert nach “Beginn und Ende gemeinsamer Aktion”, “Dynamik”, “Artikulation”, “Wiederholung”, “Rhythmik”, Tempo”, Tonalität und Tonhöhe”, verschiedene Arten der “Transformation”, herausragende “Events”, “Effekte bzw. Instrumentenspezifische Vorgaben”, und das Steuern einer Performance durch vorab notierte Passagen. Jede Geste erhält eine eigene Seite mit erklärenden Zeichnungen, Beschreibungen und Kommentaren. Schließlich folgen ein Interview mit Butch Morris sowie Notizen und Sketche aus Morris’ Notizbüchern über die verschiedenen Aspekte von Conduction. J.A. Deane, der selbst Morris’ Methode der Conduction verwendet, und Daniela Beronesi ergänzen das alles mit praktischen Übungen. Eine Chronologie führt die verschiedenen Conduction-Performances Butch Morris’ von 1985 bis zu seinem Tod vor Augen und nennt die daran beteiligten Musiker/innen auf mehreren Kontinenten; eine Diskographie listet veröffentlichte Aufnahmen seiner Conductions.
Butch Morris hat mit der Conduction eine Ausdruckspraxis entwickelt, die das Ensemble als aus vielen Individuen bestehende improvisierende Einheit ernst nimmt. Sein Handbuch ermöglicht es Musiker/innen mit seinem Vokabular weiterzuarbeiten, es um eigene Gesten oder Ideen zu erweitern und diese fürwahr genre- und kulturüberschreitende kreative Praxis lebendig zu halten. Morris traf sich in den letzten Jahren seines Lebens jeden Montagabend mit Musiker im New Yorker Stone, von denen einige öfters dabei waren, andere zum ersten Mal, und jeder Workshop war zugleich ein neues Kennenlernen und eine neue Performance, die man, auch im Publikum, im gesamten gemeinsamen Entstehungsprozess erleben konnte. Daniela Veronesi ist mit der Herausgabe von “The Art of Conduction” eine angemessene Umsetzung des Morris’schen Konzepts gelungen, ein Buch, dem zu wünschen ist, dass es von Musiker/innen auf der ganzen Welt – und durchaus auch in anderen Genres als dem Jazz – eingesetzt wird.
Wolfram Knauer (Oktober 2017)
For the Love of Music
Von Nathalie Lans
Amsterdam 2017 (Scriptum)
112 Seiten
ISBN: 978-94-6319-111-1
 Das Konzept ist einfach: Natalie Lans bat 50 Musiker/innen, ihr zu sagen, was Musik für sie bedeutet. Die kurzen prägnanten Antworten machen, zusammen mit einer kurzen Biographie der Interviewten, die eine Hälfte einer Doppelseite aus, deren zweite Hälfte aus einem aussagekräftiges Konzertfoto von vier Fotografen und einer Fotografin besteht. Die ausgewählten Musiker stammen aus den Niederlanden und den USA, ihre Antworten sind jeweils in der eigenen Sprache abgedruckt, in Holländisch und in Englisch. Vom Pianisten Marco Apicello geht es also alphabetisch bis zum Saxophonisten Bart Wirtz, und ihre Antworten sprechen von der ungemein persönlichen Betroffenheit und Hingabe, die es verlangt, diese Musik zu machen.
Das Konzept ist einfach: Natalie Lans bat 50 Musiker/innen, ihr zu sagen, was Musik für sie bedeutet. Die kurzen prägnanten Antworten machen, zusammen mit einer kurzen Biographie der Interviewten, die eine Hälfte einer Doppelseite aus, deren zweite Hälfte aus einem aussagekräftiges Konzertfoto von vier Fotografen und einer Fotografin besteht. Die ausgewählten Musiker stammen aus den Niederlanden und den USA, ihre Antworten sind jeweils in der eigenen Sprache abgedruckt, in Holländisch und in Englisch. Vom Pianisten Marco Apicello geht es also alphabetisch bis zum Saxophonisten Bart Wirtz, und ihre Antworten sprechen von der ungemein persönlichen Betroffenheit und Hingabe, die es verlangt, diese Musik zu machen.
Beispiele: “Ich sehe den Sound wirklich” (Matt Wilson) – “Live das zu spielen, was man gedacht hat, und es mit seinem Publikum zu teilen. Magisch!” (Jeffrey Spalburg) – “Afrikanische und afro-amerikanische polyrhythmische Sounds fließen durch meine Venen. Ich höre sie in der Natur, im Schlaf, in der Art und Weise, wie wir sprechen” (Camille Sledge) – “Musik dringt bis in die Knochen vor, egal, ob es ein Instrument gibt, mit dem man sie ausdrücken kann oder nicht” (Miron Rafajlovic) – “Musik zeigt das Innenleben des Menschen, das wir mit den Augen nicht sehen können; es zeigt das menschliche Herz” (Steve Nelson) – “Ein Leben ohne Musik ist meine Vorstellung der Hölle!” (Kit Morgan) – “Für mich ist Musik der Gesang der Vögel am Morgen” (Chris Jagger) – “Musik ist eine Reflexion der menschlichen Existenz und ein Hauch Gottes” (Gene Jackson) –”Musik bewegt mich, beruhigt mich, befreit meinen Kopf” (Bernard Fowler) – “Musik kann das perfekte Zusammenleben sein” (Ben van den Dungen) – “Musik beschreibt meinen wirklichen Charakter und meine Leidenschaft: meine Seele” (Joseph Bowie) – “Musik ist mein Sauerstoff” (Zep Barnasconi).
Allein diese Auswahl an Beispielen zeigt die Bandbreite der Künstler/innen, die Nathalie Lans bat, ihre eigene Philosophie über die Musik auszubreiten. Arrivierte und junge Musiker, internationale Stars und nationale Aufsteiger: Letzten Endes ist es egal, wen man fragt: Wenn Künstler sich intensiv mit den Gründen auseinandergesetzt haben, warum sie Musik machen, werden sie dazu etwas zu sagen haben.
Nathalie Lans’ Buch ist ein schön layoutetes Coffeetable-Buch, zum Blättern mehr als zum In-einem-Stück-Lesen. Ein grundlegendes Verständnis der holländischen Sprache ist von Vorteil.
Wolfram Knauer (Oktober 2017)
Komponieren & Dirigieren. Doppelbegabungen als Thema der Interpretationsgeschichte
herausgegeben von Alexander Drčar & Wolfgang Gratzer
Freiburg 2017 (Rombach Verlag)
630 Seiten, 78 Euro
ISBN: 978-3-7930-9861-4
 Es gab in der Musikgeschichte immer wieder Doppelbegabungen, Komponisten, die zugleich dirigierten oder Dirigenten, die zugleich komponierten. Mit diesem – zugegeben dennoch recht speziellen – Phänomen beschäftigt sich das vorliegende, von den beiden am Salzburger Mozarteum wirkenden Musikwissenschaftlern Alexander Drčar und Wolfgang Gratzer herausgegebene Buch. Die für den Band beauftragten Autoren sollten sich insbesondere auf drei Fragen konzentrieren: “(1) Welche Rolle spiel(t)en die Tätigkeiten des Komponierens und Dirigierens in der künstlerischen Entwicklung des jeweils thematisierten Künstlers? (2) Inwiefern lassen sich Wechselwirkungen zwischen den Tätigkeiten des Dirigierens und Komponierens dokumentieren? (3) Welche Entwicklung nahm bzw. nimmt die Rezeption dieser Doppeltätigkeit?”
Es gab in der Musikgeschichte immer wieder Doppelbegabungen, Komponisten, die zugleich dirigierten oder Dirigenten, die zugleich komponierten. Mit diesem – zugegeben dennoch recht speziellen – Phänomen beschäftigt sich das vorliegende, von den beiden am Salzburger Mozarteum wirkenden Musikwissenschaftlern Alexander Drčar und Wolfgang Gratzer herausgegebene Buch. Die für den Band beauftragten Autoren sollten sich insbesondere auf drei Fragen konzentrieren: “(1) Welche Rolle spiel(t)en die Tätigkeiten des Komponierens und Dirigierens in der künstlerischen Entwicklung des jeweils thematisierten Künstlers? (2) Inwiefern lassen sich Wechselwirkungen zwischen den Tätigkeiten des Dirigierens und Komponierens dokumentieren? (3) Welche Entwicklung nahm bzw. nimmt die Rezeption dieser Doppeltätigkeit?”
Die Bandbreite des Buchs reicht von Joseph Haydn bis Johannes Kalitzke, von klassischer Musik über Neue Musik bis zur Filmmusik und zum Jazz. Den Jazz berühren dabei vor allem vier Kapitel, von denen der “Überblick über die Tradition von Komposition und Dirigat im Jazz” von Wolfram Knauer (full disclosure: also dem Autor auch dieses Textes) versucht einige grundlegende Fragen zu klären darüber, was überhaupt Komposition im Jazz bedeutet und inwieweit diese sich von Komposition in insbesondere europäischen Musikgenres unterscheidet, welche Techniken des Dirigats Jazzmusiker von Count Basie über Duke Ellington bis zu Thad Jones oder Butch Morris verwandten, um dann in zwei Interviews mit Dieter Glawischnig und Mathias Rüegg deren Herangehensweise an die Themen Komposition und Dirigat zu diskutieren. Alexander Drčar spricht mit dem Posaunisten, Komponisten und Dirigenten Christian Muthspiel über die verschiedenen Anforderungen zwischen den Welten des Jazz und der klassischen Musik, die er zumindest in seiner Arbeit recht klar getrennt hält, aber auch über den Respekt des Dirigenten vor den Anweisungen des Komponisten und darüber, was er als Komponist aus seinen Erfahrungen als Dirigent gelernt hat. Joachim Brügge beschreibt, wie die Filmmusiken Bernard Herrmanns (etwa für Hitchcocks “Psycho” oder “Die Vögel”) von seinen Erfahrungen als klassischer Dirigent profitiert hatten. Frédéric Döhl schließlich diskutiert in seinem Beitrag die Parallelen und Unterschiede in der Herangehensweise vierer klassischer Musiker – Antal Doráti, Igor Markevitch, André Previn und Lorin Maazel – von denen Previn auch einen Jazzbackground besitzt.
In seiner Gesamtheit gibt in diesem Buch viele kluge Hinweise darauf, wie wichtig ein Dirigat zur Umsetzung von (insbesondere klassischen) Kompositionen sein kann, wie die intime Annäherung an komponierte Werke zahlreiche Dirigenten dazu animierte, selbst kompositorisch tätig zu werden, wie auf der anderen Seite Komponisten, sofern sie zugleich dirigierten, ein verstärktes Bewusstsein für die Interpretation und Interpretierbarkeit auch ihrer eigenen Werke erhielten.
Wolfram Knauer (August 2017)
100 Jahre Jazz. Von der Klassik bis zur Moderne. Die größten Stars
von Philippe Margotin
Bielefeld 2017 (Delius Klasing Verlag)
424 Seiten, 59,90 Euro
ISBN: 978-3-667-10607-0
 Endlich ein Buch zum 100sten Geburtstag des Jazz, das “größte Freude” bereitet – allerdings nur, wenn man Spaß an Stilblüten und Fehlern auf gefühlt jeder einzelnen Seite hat!
Endlich ein Buch zum 100sten Geburtstag des Jazz, das “größte Freude” bereitet – allerdings nur, wenn man Spaß an Stilblüten und Fehlern auf gefühlt jeder einzelnen Seite hat!
Philippe Margotin hat bislang Bücher über die Beatles, die Rolling Stones oder Bob Dylan geschrieben; als Jazzautor dagegen tat er sich eher weniger hervor. Zum 100sten Jahrestag der ersten Jazzaufnahme hat er nun einen schweren Wälzer vorgelegt, ein dickes Buch mit zahlreichen Fotos, auf dem die Helden der einhundertjährigen Jazzgeschichte gefeiert werden. Margotin unterteilt diese Geschichte in eine “erste Epoche” (New Orleans, Hot Jazz, Swingära) und eine “zweite Epoche” (Bebop, Cool Jazz, Hard Bop, Neue Klangwelten). In dieses Raster passt er dann Portraits von 63 Künstlerinnen und Künstlern des Jazz ein (nun ja: 58 Künstlern und 5 Künstlerinnen, von denen bis auf Carla Bley alle Sängerinnen sind), den großen Namen des Genres, von Armstrong über Parker, Miles bis zu Coltrane. Ornette Coleman und die allzu experimentelle Fraktion fehlen, dafür werden zum Schluss mit Steve Coleman und Esbjörn Svensson noch zwei Musiker mit aktuellem Einfluss aufgenommen. Pro Musiker meist 6 Seiten: stichwortartige Lebensdaten, kurzer biographischer Essay, drei Fotos sowie eine einseitige Würdigung der musikalischen Stilistik des betreffenden Künstlers, oft anhand zitierter Fremdlektüre.
So weit, so gut, so erwartbar. Natürlich könnte man über die Auswahl der Portraitierten streiten, doch sind solche Entscheidungen nun wirklich Sache des Autors und akzeptabel, wenn ihre Bedeutung erklärt und ihr Schaffen sinnvoll in den Kontext der Jazzgeschichte eingepasst wird. Man mag sich über einige der Zuordnungen wundern – warum etwa werden Coleman Hawkins und Lester Young unter die Überschrift “Diven und Romantik” sortiert und was hat Nat King Cole im Großkapitel “Hard Bop und Soul Jazz” zu suchen? (S. 314) –, aber auch das wären Kleinigkeiten, vielleicht sogar interessante Schlaglichter, sofern der Rest stimmt. Bei Margotin aber stimmt so wenig, dass man geneigt ist, auch dem Rest zu misstrauen. Und als Rezensent hat man noch eine weitere Schwierigkeit: Man weiß zuweilen nicht, ob die Fehler dem Autor oder den beiden Übersetzerinnen anzulasten sind, die für eine eher holprige als spannende Lektüre verantwortlich zeichnen.
Vielleicht erklärt sich das grundlegende Missverständnis von Jazzgeschichte als einer Heldengeschichte ja bereits aus den Quellen, die Margotin in seiner Bibliographie angibt. Kein einziger Literaturhinweis, der nach 2000 publiziert wurde; eine erstaunlich unkritische Sammlung an Büchern von Journalisten und Jazzkennern der vorletzten Generation, aus einer Zeit also, als man Jazzgeschichte noch als eine Abfolge klar umgrenzter Stilistiken und genialer Einfälle einzelner Individuen darstellte, nicht als ein Ineinandergreifen persönlicher künstlerischer Aussagen, allgemeiner – und zwar weit über den Jazz hinausreichender – ästhetischer Diskurse, und wirtschaftlicher Zwänge. Mit solch einem Verständnis von Jazz und der völligen Unkenntnis aktueller Diskurse auch über Jazzgeschichte lässt sich wahrscheinlich kein anderes Buch schreiben. Selbst unter diesen Voraussetzungen allerdings ist “100 Jahre Jazz” so voller Fehler, Ungenauigkeiten, Verallgemeinerungen und Stilblüten, dass man für knapp 60 Euro wahrlich Besseres erstehen kann.
Mehr wahllos als systematisch seien hier also ein paar Beispiele für die Sorglosigkeit angeführt, mit der das Thema behandelt wird: Dass Paul Whiteman als erstes Beispiel für “Die Swingära” genannt wird (S. 65) ließe sich zumindest diskutieren (wird es aber nicht). Duke Ellingtons Orchester nennt Margotin eine “Swingband” (S. 80), lässt dabei völlig außer Acht, dass dieses so ganz anders als die üblichen Swingorchester funktionierte, selbst wenn sich auch Ellington auf dem Markt der Swingmusik bewegte. Dessen “Black, Brown and Beige”, heißt es (S. 80), habe “länger als eine Stunde” gedauert, wo es tatsächlich gut 45 Minuten waren. Und Benny Goodman, dessen problematische Führungsqualitäten Legende sind, wird unerklärterweise als ein “Menschenführer” gelobt (S. 93).
Dass dem Lektorat etliche Tippfehler entgingen, zeigt, wie wenig sorgfältig hier auf allen Ebenen gearbeitet wurde. Da ist vom “Livery Staple Blues” die Rede (S. 59), wird “Joachim-Ernst Behrendt” mit “h” geschrieben (S. 87) und “Miles Davies” mit einem zusätzlichen “e” (S. 142). Und Bennie Motens Aufnahme “Prince of Wails” heisst eben nicht “Prince of Wales” (S. 97). Auch inhaltlich reicht es von flüchtig bis ignorant: Sonny Greer spielte nie bei Count Basie (S. 98) – das war Sonny Payne. Und wenn man schon die Basie-Rhythmusgruppe heraushebt, ist es irreführend, die erste Besetzung mit Clifford McYntire (!), Walter Page und Jesse Price zu erwähnen, Freddie Green aber nur in einem Halbsatz zu streifen (S. 98) und auf die Bedeutung von Jo Jones ebenfalls nicht hinzuweisen. Dass Bobby Hackett im Artikel über Glenn Miller als “Trompeter und Gitarrist” identifiziert wird (S. 117), ist zwar richtig, aber irreführend. Und Jan Garbarek in der Überschrift zum ihn betreffenden Artikel “Ethno-Jazz auf dem Altsaxophon” zuzuschreiben (S. 392), verfälscht das Hauptinstrument des Saxophonisten. In letzterem Fall mag man fast schon entschuldigend ahnen, dass vielleicht jemand das gebogene Sopran auf dem Bild gegenüber falsch identifiziert haben mag – aber ist das wirklich eine Entschuldigung?
Dizzy Gillespie reiste nicht im Auftrag des Weißen Hauses (S. 232, 236), sondern in dem des amerikanischen State Department in den Mittleren Osten. Dass Fats Waller andererseits “eine Weile in Paris” lebte (S. 124) ist übertrieben – er verbrachte 1932 vielleicht anderthalb Monate in Frankreich, eher also eine Art ausgedehnten Urlaub. Keine Ahnung, wer für das großartige Foto von Illinois Jacquet verantwortlich zeichnet, das den Artikel zu Roy Eldridge ziert und auf dem Jacquet als der Trompeter identifiziert wird, obwohl er doch eindeutig ein Saxophon bedient (S. 157; ein Auge und der Haaransatz Eldridges ist immerhin abgebildet). Das Foto von Al Grey im Artikel zu J.J. Johnson (S. 249) wird im Untertext wenigstens richtig identifiziert, nur: Warum? Warum nicht eher Kai Winding? Dass der Autor es als eine wichtige Information über Billie Holiday erachtet, dass sie keinen Sex mit Lester Young gehabt habe (S. 198), mag man ebenfalls unter der Rubrik “Warum?” verbuchen. Und Coleman Hawkins’ Aufnahme von “I’ll Be Glad When You’re Dead, You’re Rascal You” ist nur ein einziges Stück und nicht zwei, wie auf S. 209 zu lesen ist.
Andere Fehler sind klar den Übersetzerinnen zuzuschreiben. “Die Revue Negrè” hieß genauso und nicht “Black Revue” (S. 47), und Teddy Hills “Revue ‘The Cotton Club Show'” (S. 235) hieß tatsächlich “The Cotton Club Revue”. Was die Überschrift “Rückkehr zur Gnade” im Artikel zu Sidney Bechet (ebenfalls S. 47) zu bedeuten hat, erschließt sich wahrscheinlich erst, wenn man die französische Originalausgabe des Buchs zur Hand hat. Ähnliches gilt für die Überschrift “Riverboats in Harlem” im Artikel über Henry Red Allen (S. 147), die wahrscheinlich “Von den Riverboats nach Harlem” heißen sollte. Über eine frühe Charlie Parker-Aufnahme zitiert Margotin Ross Russell: “Der Hootie Blues verursachte bei allen Musikern, die ihn zunächst nur zufällig hörten, einen Aufruhr…” (S. 231) – so weit im Buch hat man allerdings die Lust zur Nachforschung darüber verloren, was Russell wohl wirklich geschrieben hat, und ergibt sich in der Erkenntnis, dass im Verlauf der “Stillen Post”, der Mehrfachübersetzung (englisch – französisch – deutsch) also, irgendetwas, im schlimmsten Fall einfach der Sinn, verloren gegangen ist. Begriffsübertragungen wie “falscher Fingersatz” für “false fingering” im Artikel über Bix Beiderbecke (S. 61) machen im Deutschen keinen wirklichen Sinn, und was die auf derselben Seite erwähnten “synonymen Noten” sein sollen, mag man erahnen, der Nutzwert solch innovativer Übersetzungen ist für den Leser allerdings eher gering.
Über Dizzy Gillespie heißt es: “Und schließlich zeigte Dizzy Gillespie mit seinem leichthändigen Umgang mit dem Spott, ja manchmal sogar ausgesprochenem Blödsinn, dass man sehr wohl Jazz spielen konnte, ohne sich allzu ernst nehmen zu müssen” (S. 237) – Gillespies Bühnenscherze allerdings hatten weder mit Spott noch Blödsinn etwas zu tun, sondern mit Traditionen des afro-amerikanischen Showbusiness. Ob es so passend ist, Django Reinhardt in einer Zwischenüberschrift “erfolgreiche Kriegsjahre” zu attestieren, ist letzten Endes nicht nur Geschmackssache. Auch die Zwischenüberschrift “Die Qualen der künstlichen Paradiese” im Artikel über Charlie Parker (S. 230) lässt den Leser ratlos zurück. Warum “die Geistlichen in der Baptistenkirche [Duke Ellingtons] Botschaft [in dessen Sacred Concerts] allerdings nicht verstanden” (S. 80) blieb diesem Rezensenten unklar, wie überhaupt die Beschreibung von Ellingtons Stil (S. 81) hilflos wirkt und seiner Musik nicht wirklich nahe kommt.
Und so geht es durch das gesamte Buch: Eine Mischung aus Fehlern, Nachlässigkeiten, mangelndem Fachwissen oder mangelnder Recherche auf allen Ebenen der Produktion, dass es wirklich nur zwei Empfehlungen gibt: Für den jazzinteressierten Laien: Finger weg!!! Für den Jazzkenner: Warten, bis das Buch im modernen Antiquariat gelandet ist (das kann nicht so lange dauern), dann kaufen und mit Genuss weitere Stilblüten entdecken!
Wolfram Knauer (Juli 2017)
The Cambridge Companion to Duke Ellington
herausgegeben von Edward Green
Cambridge 2014 (Cambridge University Press)
296 Seiten, 29,99 US-Dollar (Paperback)
ISBN: 978-0-521-70753-4
Duke Ellington Studies
von John Howland
Cambridge 2017 (Cambridge University Press)
308 Seiten, 75 Britische Pfund (Hardcover)
ISBN: 978-0-521-76404-9
Neben Charlie Parker ist Duke Ellington wahrscheinlich der am meisten untersuchte Musiker der Jazzgeschichte. Sein kompositorisches Œuvre, sein Umgang mit Klangfarben, sein Einsatz einzelner Musiker, die Wandlung seiner musikalischen Sprache über mehr als fünf Jahrzehnte bieten mehr als genug Stoff für Untersuchungen aus allen möglichen Perspektiven. Jetzt sind innerhalb von nur zweieinhalb Jahren gleich zwei Sammlungen solcher Perspektiven beim Verlag Cambridge University Press erschienen. Die Herausgeber Edward Green und John Howland planten die beiden Bände ursprünglich als einander ergänzende Bücher, die dann in ihrer Konzeption ein Eigenleben entwickelten und so unabhängig voneinander veröffentlicht wurden.
 Im von Edward Green herausgegebenen “Cambridge Companion” wird Ellingtons Schaffen in 19 Kapitel abgehandelt, die ihn zum einen in den ästhetischen Kontext seiner Zeit einordnen sollen, zum zweiten seine Rezeption beleuchten und schließlich auf sein musikalisches Schaffen mit Bezug auf die Jazztradition eingehen. Wo dieses Buch zumindest in Teilen noch chronologisch angelegt ist, steht in den von John Howland herausgegebenen “Duke Ellington Studies” tatsächlich die Perspektive im Vordergrund: auf seine Musik, auf die Kritik, auf seine Rezeption in Großbritannien, auf seine Manuskripte, auf sein Konzept von Afrika, auf wegweisende Komposition und Alben wie etwa “Such Sweet Thunder oder “A Drum is a Woman”.
Im von Edward Green herausgegebenen “Cambridge Companion” wird Ellingtons Schaffen in 19 Kapitel abgehandelt, die ihn zum einen in den ästhetischen Kontext seiner Zeit einordnen sollen, zum zweiten seine Rezeption beleuchten und schließlich auf sein musikalisches Schaffen mit Bezug auf die Jazztradition eingehen. Wo dieses Buch zumindest in Teilen noch chronologisch angelegt ist, steht in den von John Howland herausgegebenen “Duke Ellington Studies” tatsächlich die Perspektive im Vordergrund: auf seine Musik, auf die Kritik, auf seine Rezeption in Großbritannien, auf seine Manuskripte, auf sein Konzept von Afrika, auf wegweisende Komposition und Alben wie etwa “Such Sweet Thunder oder “A Drum is a Woman”.
Als Autoren konnten beide Herausgeber ausgewiesene Ellington-Kenner genauso gewinnen wie weitsichtige Musikwissenschaftler oder Journalisten. In Howlands Buch etwa fragt David Berger nach dem Unterschied zwischen Komposition und Rekomposition in Ellingtons Werk, blickt Brian Priestley auf Ellingtons Reisen ins Ausland und verstehen Olly Wilson und Trevor Weston Ellington als eine kulturelle Ikone. In einem eher historischen Block betrachtet Jeffrey Magee Ellingtons afro-modernistische Vision der 1920er Jahre, Andrew Berish die Zeit zwischen Anpassung und Experiment in den 1930ern, Anna Harwell Celenza die Blanton-Webster Band sowie die Carnegie-Hall-Konzerte, Anthony Brown die 1950er und Dan Morgenstern die 1960er und 1970er Jahre. Die analytisch interessantesten Kapitel kommen zum Schluss, wenn Benjamin Givan auf die Bluesbehandlung beim Duke eingeht und Walter van de Leur auf die musikalische Beziehung zwischen Ellington und Billy Strayhorn, wenn Bill Dobbins Ellingtons Einfluss aufs Jazzklavier beleuchtet und Marcello Piras seine fast programmatischen Kompositionen, wenn Will Friedwald ihn als einen eher zufälligen Songschreiber charakterisiert, David Berger die Suiten des Duke miteinander vergleicht und Benjamin Bierman seinen Einfluss auf die Nachwelt untersucht.
 Dobbins und Van de Leur sind auch in den “Duke Ellington Studies” präsent, Dobbins mit einer Studie, die Dukes Klavierstil analysiert und Van De Leur mit einem Blick auf die Manuskripte in der Duke Ellington Collection der Smithsonian Institution. Phil Ford analysiert Ellingtons Selbstdarstellung als Afro-Amerikaner in frühen Filme und vergleicht diese mit der Selbstdarstellung des Präsidenten Barack Obama. John Howland hinterfragt die Interpretation Ellingtons in der frühen Jazzkritik als “ernsthafter” Jazzkomponist, Catherine Tackley verfolgt die Jazzrezeption des Duke über die Jahrzehnte in Großbritannien. David Schiff blickt hinter die auch politische Bedeutung des Albums “Such Sweet Thunder”, Gabriel Solis auf die Auswirkung des LP-Formats auf Ellingtons Œuvre, Carl Woidecks auf Ellingtons Bild von Afrika, wie es sich in seiner Musik abbildet, und John Wriggle auf “A Drum Is a Woman” als “Mother of All Albums”
Dobbins und Van de Leur sind auch in den “Duke Ellington Studies” präsent, Dobbins mit einer Studie, die Dukes Klavierstil analysiert und Van De Leur mit einem Blick auf die Manuskripte in der Duke Ellington Collection der Smithsonian Institution. Phil Ford analysiert Ellingtons Selbstdarstellung als Afro-Amerikaner in frühen Filme und vergleicht diese mit der Selbstdarstellung des Präsidenten Barack Obama. John Howland hinterfragt die Interpretation Ellingtons in der frühen Jazzkritik als “ernsthafter” Jazzkomponist, Catherine Tackley verfolgt die Jazzrezeption des Duke über die Jahrzehnte in Großbritannien. David Schiff blickt hinter die auch politische Bedeutung des Albums “Such Sweet Thunder”, Gabriel Solis auf die Auswirkung des LP-Formats auf Ellingtons Œuvre, Carl Woidecks auf Ellingtons Bild von Afrika, wie es sich in seiner Musik abbildet, und John Wriggle auf “A Drum Is a Woman” als “Mother of All Albums”
Beide Bücher richten sich auf wohltuende Art und Weise an Experten und interessierte Fans gleichermaßen. Sie sind nicht als Biographien des Duke gedacht, sondern als Versuch, sein Werk aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit unterschiedlichem Fokus zu beleuchten. Sie sind ausführlich annotiert und belegen auch damit das Eingangsstatement dieser Rezension: dass nämlich Ellington schon lange nicht nur ein Säulenheiliger der Jazzgeschichte, sondern auch einer der Jazzforschung ist.
Wolfram Knauer (Juni 2017)
New Jazz Conceptions. History, Theory, Practice
herausgegeben von Roger Fagge & Nicolas Pillai
New York 2017 (Routledge)
209 Seiten,110 Britische Pfund
ISBN 978-1-84893-609-6
 “New Jazz Conceptions” hieß das Debütalbum von Bill Evans aus dem Jahr 1956 (nicht 1957 übrigens, wie die Herausgeber dieses Buchs in ihrem Vorwort schreiben), ein Album, das, so zumindest kann man im Rückblick sagen, tatsächlich etwas Neues heraufbeschwor im Jazz, sei es die sehr spezielle und enorm einflussreiche Spielweise des Pianisten, sei es ein neues Ineinandergreifen der Instrumente innerhalb der Klaviertrio-Besetzung im Jazz. “New Jazz Conceptions” hieß auch eine Konferenz an der University of Warwick im Mai 2014, deren Vorträge jetzt in Druckform vorliegen. Die Organisatoren und Herausgeber dieses Buchs Roger Fagge und Nicolas Pillai sind Vertreter der “New Jazz Studies”, eines Zweigs der Jazzforschung, der in den letzten Jahren versucht, sich zum einen stärker auf einzelne Facetten der Jazzgeschichte und ihres Umfelds zu fokussieren, der auf der anderen Seite den interdisziplinären Diskurs insbesondere auf den Jazz praktiziert. Eine solche neue Art von Jazzforschung, schreiben die Herausgeber, reagiere auf Veränderungen in der Musik, sei sich aber auch bewusst, dass sie Verantwortung dafür trage, wie wir die Musik in der Zukunft verstehen. Die Auswahl der Beiträge zur ersten Konferenz könne nur genau das sein, eine Auswahl verschiedener Ansatzpunkte, nehmen sie dann eine offenbar bereits erahnte Kritik vorweg, zu der wir dann zum Schluss auch gerne kommen werden.
“New Jazz Conceptions” hieß das Debütalbum von Bill Evans aus dem Jahr 1956 (nicht 1957 übrigens, wie die Herausgeber dieses Buchs in ihrem Vorwort schreiben), ein Album, das, so zumindest kann man im Rückblick sagen, tatsächlich etwas Neues heraufbeschwor im Jazz, sei es die sehr spezielle und enorm einflussreiche Spielweise des Pianisten, sei es ein neues Ineinandergreifen der Instrumente innerhalb der Klaviertrio-Besetzung im Jazz. “New Jazz Conceptions” hieß auch eine Konferenz an der University of Warwick im Mai 2014, deren Vorträge jetzt in Druckform vorliegen. Die Organisatoren und Herausgeber dieses Buchs Roger Fagge und Nicolas Pillai sind Vertreter der “New Jazz Studies”, eines Zweigs der Jazzforschung, der in den letzten Jahren versucht, sich zum einen stärker auf einzelne Facetten der Jazzgeschichte und ihres Umfelds zu fokussieren, der auf der anderen Seite den interdisziplinären Diskurs insbesondere auf den Jazz praktiziert. Eine solche neue Art von Jazzforschung, schreiben die Herausgeber, reagiere auf Veränderungen in der Musik, sei sich aber auch bewusst, dass sie Verantwortung dafür trage, wie wir die Musik in der Zukunft verstehen. Die Auswahl der Beiträge zur ersten Konferenz könne nur genau das sein, eine Auswahl verschiedener Ansatzpunkte, nehmen sie dann eine offenbar bereits erahnte Kritik vorweg, zu der wir dann zum Schluss auch gerne kommen werden.
Tim Wall widmet sich in seinem Beitrag einer Livesendung mit dem Duke Ellington Orchestra vom 14. Juni 1933 durch den BBC und fragt dabei, was diese Ausstrahlung einerseits für die Programmpolitik des Sendes, andererseits für die Wahrnehmung des Jazz im allgemeinen und Duke Ellingtons im Besonderen in Großbritannien bedeutete. Er blickt zurück auf die Jazzprogramme, die der Sender vor 1933 ausgestrahlt hatte und fragt, warum gerade Ellington die Ehre dieser Aufmerksamkeit zur besten Sendezeit zuteilwurde. Er untersucht den Wandel der öffentlichen Wahrnehmung von Jazz infolge des Ellington-Besuchs, der sich in Berichten genauso niederschlug wie in Schallplattenausgaben und der schließlich auch das Selbstverständnis der britischen Jazzszene und ihrer medialen Vermittlung weit über die 1930er Jahre hinaus mit prägte.
Tom Sykes schaut auf die Bildung von Szenen, die sich in den letzten Jahren durch die Einbeziehung und Benutzung sozialer Medien erheblich verändert habe. Er fragt, welchen Einfluss soziale Medien auf lokale Szenen haben und ob die neu entstandenen Szenen / Gruppen / Communities wohl auch ohne e-mail, Video-Sharing oder soziales Netzwerken bestehen könnten. Dabei benutzt er als Ausgangspunkt verschiedene soziologische Beschreibungen des Phänomens von Community, insbesondere mit Bezug auf Jazz, beschreibt den Unterschied zu virtuellen Communities und die Scheinhaftigkeit einer Gruppenzugehörigkeit etwa durch Online-Diskussionsforen. Schließlich gibt er einige konkrete Beispiele der Durchlässigkeit zwischen realen und virtuellen Szenen und schlussfolgert, dass, wenn auch virtuelle Netzwerke immer wichtiger werden, Jazzfans daneben auch in semi-virtuellen und lokalen Szenen verankert seien und der Jazz als Liveerlebnis daher nicht zur Disposition stünde.
Andrew Hodgetts betrachtet die diversen Versuche der britischen Musikergewerkschaft zwischen den 1930er und 1950er Jahren, ausländischen Musikern Auftritte im Land zu verbieten und so die einheimischen Kollegen zu schützen. Er gibt konkrete Beispiele für Auswirkungen etwa auf geplante Konzerte oder Tourneen amerikanischer Bands und vergleicht die protektionistischen Anstrengungen mit denen der amerikanischen Musikergewerkschaft sowie mit der Situation beispielsweise in Schweden und Frankreich zur selben Zeit. Schließlich beschreibt er den über die Jahre sich wandelnden Diskurs über Internationalität versus Protektionismus, der insbesondere im Melody Maker gut dokumentiert sei.
Nicolas Pillai nähert sich den unterschiedlichen Publikumsreaktionen auf Dave Brubeck anhand einer Fernsehaufnahme für den BBC im Jahre 1964 und der Diskussionen über die Tournee seines Quartetts aus dem selben Jahr in der britischen Presse. Brubeck war zu der Zeit bereits in die ästhetische Spalte zwischen “innovativem Jazz” und “zu kommerziell” geraten, eine Einschätzung, die sich auch in den Presseberichten über die Tournee niederschlug. Diese reflektieren über seine Hits genauso wie über sein Anwesen in Connecticut, und Pillai vergleicht die unterschiedlichen Berichte, die letzten Endes verantwortlich sind für die öffentliche Wahrnehmung des Pianisten in Großbritannien, mit der Fernsehdokumentation, in der zu erleben sei, dass diese Musik nach wie vor subkulturelle Qualitäten besäße, sich in einem konstanten Dialog auch mit populären Strömungen in der Musik befunden habe.
Katherine Williams konzentriert sich in ihrem Kapitel auf Duke Ellingtons legendäres Newport-Konzert vom Juli 1956, erzählt die Vorgeschichte und den Ablauf des Abends und berichtet über die Veröffentlichungsgeschichte des Mitschnitts, der zwar als “Live at Newport” herauskam, tatsächlich aber zum Teil im Studio nach-produziert worden war. Sie diskutiert die Faszination mit Live-Alben und die Problematik der Nachbearbeitungsmöglichkeiten – für die Künstler genauso wie für die ästhetische Einschätzung des scheinbar “historischen” Ereignisses.
Adrian Litvinoff beschäftigt sich mit Musikgeschmack im Jazz und fragt, warum es vielen Hörern so schwer falle, sich auf Neues, Unbekanntes einzulassen. Er hinterfragt die Rolle des Marktes für den Musikgeschmack und deutet an, wie stark letztlich auch die Hörerwartung das Hörerlebnis prägt.
Roger Fagge verfolgt den wandelnden kritischen und ästhetischen Ansatz dreier britischer Autoren und Kritiker. Philip Larkin hatte zeitlebens ein Problem mit dem modernen Jazz (also mit allem ab dem Bebop), und Fagge diskutiert einige seiner Verrisse über Konzerte und Platten der Hardbop- und frühen Free-Jazz-Generation. Kingley Amis’ Haltung gegenüber Miles Davis, Monk und anderen Vertretern des modernen Jazz war sehr viel positiver, er versuchte, wie Fagge schreibt, die Musik angemessen, “objektiv” zu beurteilen. Dennoch beklagte Amis sich gegenüber Larkins, dass er für seine Artikel im Observer heftig angegriffen würde. Beide hätten den Jazz im Gegensatz zu Eric Hobsbawm allerdings kaum als eine politische Musik verstanden. Letzterer veröffentlichte 1959 unter dem Pseudonym Francis Newton das Buch The Jazz Scene und schrieb für den New Stateman Kritiken, von denen Fagge besonders solche über den Avantgardejazz der 1960er Jahre hervorhebt. Fagge beschreibt die unterschiedlichen Beweggründe der drei Autoren, ihre jeweilige Herangehensweise an die Musik und ihren meist unausgesprochenen emotionalen wie intellektuellen Disput, der den Jazzdiskurs im Großbritannien der 1950er und 1960er Jahre gut umschreiben kann.
Mike Fletcher blickt auf die Gegenwart des Jazz in Großbritannien und fragt nach “Tradition, Community und musikalische Identität”, danach also, inwieweit aktuell aktive Musiker sich nach wie vor mit der Geschichte des Jazz und mit seinen Ursprüngen identifizieren, wie sie sich im Vergleich zu anderen musikalischen Entwicklungen verorten, und welche Auswirkungen all das auf ihre konkrete Musik hat. Er stellt die Frage danach, inwieweit man als improvisierender Musiker in Großbritannien immer noch die amerikanischen Roots im Blick habe, betont die Bedeutung persönlicher Lehrer-Schüler-Verhältnisse für den Jazz, diskutiert die Rolle, die Schallplatten für das Selbstverständnis von Musikern spielen, und spricht mit Musikern wie Soweto Kinch, Alexander Hawkins und anderen über ihre eigenes Selbstverständnis einer ethnischen genauso wie kulturellen Identität und wie sich dieses mit den diversen Bildern des Jazz verträgt. Schließlich fragt er nach der Bedeutung von Community für die Jazzmusiker-Szene und danach, inwiefern Musiker sich in einer Art britischer Traditionslinie verorten.
Nicholas Gebhardt wirft im Schlusskapitel einen Blick auf Alan Lomax’s Oral-History-Interview mit Jelly Roll Morton, das er 1938 für die Library of Congress aufnahm. Er fragt dabei nach den Inhalten der Geschichten, die Morton erzählt, nach dem Bild also, das dieser seinem Interviewer von sich selbst und von New Orleans vermitteln will. Ihn interessiert daneben aber auch Lomax’ Interesse an diesem Material, das helfen sollte, seinem eigenen historischen Verständnis der frühen Jazzgeschichte konkrete Inhalte zu geben, die die Legende zum Leben erwecken, dabei aber auch von der lebenslangen Erfahrung des Pianisten zehren kann.
Neun verschiedene Ansätze also, aus historischer, soziologischer, medienwissenschaftlicher, Sicht, die mal mit der Auswertung historischer Quellen, mal mit Textkritik, mal mit eigenem Interviewmaterial arbeiten. Die Autoren sind Wissenschaftler und Musiker, eine wichtige Mischung, da gerade im Jazz (aber nicht nur da) die Ausübenden immer eine Stimme haben sollten. Was fehlt, ist der direkte Bezug auf die erklingende Musik. Eine “neue Jazzforschung” kann eben auch nicht sein, nur über die Umstände, die Wahrnehmung oder die verschiedenen Arten der Reflektion über Musik zu sprechen. Sie sollte sich immer wieder auch an die Musik selbst herantrauen, zumindest ihre Fragen aus der Musik heraus entwickeln. Katherine Williams kommt dem in diesem Buch am nächsten, scheut dann aber, da sie so viel über die Umstände von Newport und der Rezeption des Konzerts erzählen muss, doch vor einer eingehenderen Diskussion der Musik selbst zurück. Aber den Herausgebern ist – und deshalb bleibt dies eher eine Anregung als eine Kritik – durchaus bewusst, dass die Beiträge ihrer Konferenz und dieses Buches alles andere als erschöpfend die Aspekte der “new jazz studies” betrachten können.
Wolfram Knauer (Juni 2017)
Keith Jarretts Klavier-Solokonzerte. Eine Stilanalyse von Keith Jarretts Solo-Klavierkonzerten aus den Jahren 1973 bis 1975
von Babak Pakzad
Saarbrücken 2017 (AV Akademikerverlag)
112 Seiten, 32,90 Euro
ISBN: 978-3-330-51516-1
 Ein wichtiger Teil in Keith Jarretts musikalischem Schaffen waren seine Solo-Performances, die sich Babak Pakzad in seiner Arbeit zum Thema macht. Der Autor braucht dazu keine große Einleitung, sondern geht gleich in medias res, beschreibt, wie Jarretts Solokonzerte üblicherweise mit einer fast meditativen Konzentrationsphase am Flügel beginnen, wie er dann eine Zelle vorgibt, einen einzelnen Ton etwa, aus dem heraus er die kreative Energie entwickeln kann. Er erklärt die Notwendigkeit, die Jarrett für Rituale empfindet, um bei Konzentration zu bleiben und warum ihn kleinste Geräusche, sei es ein Husten aus dem Publikum, aus dieser Konzentration reißen können. In einem zweiten Kapitel setzt Pakzad Jarretts Aussagen zur Improvisation in Verbindung zu philosophischen Einflüssen insbesondere durch George I. Gurdjieff. Im dritten Kapitel stellt er Entwicklungen im Jazz der 1960er Jahre vor, in denen diese Musik als eine politische Stimme wahrgenommen worden sei, in dem sich kulturelle Diskurse auch aus anderen Kunstgattungen der Zeit spiegeln.
Ein wichtiger Teil in Keith Jarretts musikalischem Schaffen waren seine Solo-Performances, die sich Babak Pakzad in seiner Arbeit zum Thema macht. Der Autor braucht dazu keine große Einleitung, sondern geht gleich in medias res, beschreibt, wie Jarretts Solokonzerte üblicherweise mit einer fast meditativen Konzentrationsphase am Flügel beginnen, wie er dann eine Zelle vorgibt, einen einzelnen Ton etwa, aus dem heraus er die kreative Energie entwickeln kann. Er erklärt die Notwendigkeit, die Jarrett für Rituale empfindet, um bei Konzentration zu bleiben und warum ihn kleinste Geräusche, sei es ein Husten aus dem Publikum, aus dieser Konzentration reißen können. In einem zweiten Kapitel setzt Pakzad Jarretts Aussagen zur Improvisation in Verbindung zu philosophischen Einflüssen insbesondere durch George I. Gurdjieff. Im dritten Kapitel stellt er Entwicklungen im Jazz der 1960er Jahre vor, in denen diese Musik als eine politische Stimme wahrgenommen worden sei, in dem sich kulturelle Diskurse auch aus anderen Kunstgattungen der Zeit spiegeln.
Keith Jarretts Solokonzerte sind schließlich Inhalt des vierten, nämlich des Hauptkapitels, das unter anderem die Rolle von Körper und stimmlicher Begleitung für seine Performances beschreibt, den formalen Ablauf seiner Soloexkurse und die Mischung unterschiedlicher Stileinflüsse. Pakzad betrachtet die formalen Bestandteile in Jarretts Solointerpretationen, etwa “stabile Passagen”, zu denen er verschiedene Arten von Vamps, Gospelstrecken oder solche zählt, die er als “Folk-Ballade” benennt, oder “instabile Passagen”, zu denen “Ballade”, “Rhapsodie”, “Drone”, freie Passagen und Choralhaftes gehören. Und schließlich legt er aufgrund dieser formalen Parameter eine tabellarische Ablaufanalyse der Konzerte “Lausanne”, “Bremen”, “Köln”, “Sunbear”, “Bregenz-München”, “Paris”, “Vienna”, “La Scala”, “Radiance”, “Carnegie Hall”, “Paris-London”, “Rio” und “Creation” vor. Zwei kurze Transkriptionen mit analytischen Anmerkungen, aber ohne Fragestellung oder Schlussfolgerung, schließen sich an, bevor Pakzad seine abschließende Unterteilung vornimmt: Es gäbe in Jarretts Solokonzerten vier “Zyklen”, nämlich einen ersten, der vor allem aus “Jazz-Improvisationen” bestehe, die voller Energie und emotionalem Ausdruck seien, einen zweiten, der “klassische Improvisationen” beinhalte, “weniger Abenteuer und Exploration in der Musik”, der “reifer” wirke und dessen “Strategien und Methoden” stärker “entwickelt” seien, einen dritten, der sich dadurch auszeichne, dass “die Stile sehr gut miteinander verschmelzen”, sowie einen vierten, in dem es keine langen Improvisationen mehr gebe, “sondern jeder Stil ist ein selbstständiges Stück”.
So schön so gut. Pakzads Arbeit bleibt an der Oberfläche, geht kaum wirklich in die Musik hinein, verallgemeinert die improvisatorische Praxis und ist leider in den wenigen Passagen, in denen er auf Jazzgeschichte eingeht, von wenig Sachkenntnis getrübt. Es gibt keine Fragestellung und dementsprechend auch kein Resümee. Seine Thesen zur Stilanalyse entnimmt er den Dissertationen von Gernot Blume und Peter Elsdon, wendet sie dann aber nur ansatzweise und dazu auch noch völlig unkritisch an, als würde ein einmal entdecktes System die Musik erklären können. Die Strukturskizzen der Solokonzerte bleibt an der Oberfläche der Musik, er untersucht weder melodische, harmonische noch rhythmische Verdichtungen. Pakzad nennt zwar die Bedeutung von Körperlichkeit und Spiritualität, findet dazu dann in der Musik selbst aber kein einziges Wort. Was das seltsame Kapitel über “Free Jazz” in seinem Text zu suchen hat, wird nirgends erklärt, ganz abgesehen davon, dass die darin behaupteten politischen, kulturellen und musikalischen Entwicklungen arg vereinfacht, wenn nicht gar falsch dargestellt werden. Da steht dann so etwas wie: “Im Free Jazz gewinnt die Idee des Rituals an Bedeutung. Er wird als Vereinigung mit dem Übernatürlichen beschrieben, in der es nicht um die Vereinigung der Musiker als einzelne Individuen geht, sondern um eine Einheit in einer größeren Gruppe. Diese Idee kann man auch in einem größeren Kulturellen Kontext verstehen, der auf eine die geografischen Grenzen außer Acht lassende Vereinigung der afrikanischen und der afroamerikanischen Gesellschaft verweist.” Pakzad hat offenbar nicht viel Ahnung davon, was Free Jazz wirklich war und wie sich der Stil entwickelte; er schwimmt, wie überhaupt in seinem Text, auf Gemeinplätzen dahin und subsumiert schließlich auch noch Sonny Rollins zu diesem Stil. Überhaupt zieren nicht nur für den Kenner erkenntliche Stilblüten den Text, der als Abschlussarbeit, wo auch immer, dem Autoren hoffentlich keine Lorbeeren eingebracht hat und dessen Veröffentlichung eher ärgerlich ist als dass sie auch nur irgendeinen neuen Aspekt in die Erforschung der Musik Keith Jarretts bringen würde.
Wolfram Knauer (Mai 2017)
New Orleans and the Global South. Caribbean, Creolization, Carnival
von Ottmar Ette & Gesine Müller
Hildesheim 2017 (Olms)
403 Seiten, 68 Euro
ISBN: 978-3-487-15504-3
 New Orleans wird als Wiege des Jazz gefeiert, als nördlichste Stadt der Karibik, als ein Schmelztiegel der Kulturen, als die amerikanische Stadt mit den über die Jahrhunderte tiefsten und prägendsten kulturellen Verbindungen nach Europa. New Orleans ist eine Stadt der Traditionsbewahrung, obwohl jeder Bewohner der Stadt quasi seine eigenen Traditionen mit einbringt, die Traditionen seiner Vorfahren und seiner Community.
New Orleans wird als Wiege des Jazz gefeiert, als nördlichste Stadt der Karibik, als ein Schmelztiegel der Kulturen, als die amerikanische Stadt mit den über die Jahrhunderte tiefsten und prägendsten kulturellen Verbindungen nach Europa. New Orleans ist eine Stadt der Traditionsbewahrung, obwohl jeder Bewohner der Stadt quasi seine eigenen Traditionen mit einbringt, die Traditionen seiner Vorfahren und seiner Community.
Eine Tagung in Köln im Februar 2015 widmete sich dem Thema der Karibik, der Kreolisierung und des Karnevals, alles Klischees, die mit New Orleans verbunden werden und die, differenziert betrachtet, dazu beitragen können, den kulturellen Diskurs in dieser Stadt zu beschreiben. Konkret näherte sich die Tagung diesem Thema von vier Seiten: Literatur und Sprache in einer Stadt, die ihren eigenen Akzent aus der Mischung der Bevölkerung entwickelte; die Tradition des Karnevals; Musik; sowie die Verbindungen zwischen New Orleans, der Karibik und Südamerika. Ottmar Ette setzt in seinem Beitrag die gegenseitige Bedingtheit des karnevalistischen Zukunftsmuts und der natürlichen Katastrophen, die New Orleans immer wieder einholten zueinander in Bezug. Ingrid Neumann-Holzschuh setzt sich mit den Besonderheiten und dem Wandel der Sprache, des “créole” in Louisiana auseinander. Philipp Krämer untersucht, wie das “créole” der Region die enge Bindung nach Frankreich beeinflusst. Gesine Müller liest Texte von “freien Schwarzen” im Louisiana des 19. Jahrhundertsund untersucht sie auf ihr transkulturelles Bewusstsein hin – sowohl in Richtung früheres “französisches Mutterland” wie auch in Richtung der anderen amerikanischen Rehionen. Owen Robinson findet in Baron Ludwig von Reizensteins Roman “The Mysteries of New Orleans” eine fiktionalisierte Zeitzeugenbeschreibung der schon Mitte des 19. Jahrhunderts recht freizügigen Hafenstadt.
Aurélie Godet untersucht die Sprache des Mardi Gras auf Aspekte von “creolization” und damit auch die Funktion kreolischer Prozesse innerhalb der Community/Communities von Louisiana. Rosary O’Neill beleuchtet die geschichte der Carnival Krewes in New Orleans und die Evolution dieser Tradition aus europäischen Vorbildern heraus. Wolfram Knauer untersucht den Einfluss eines “kreolischen Konzepts” in der Musik von New Orleans bis in die globale Gegenwart hinein. William Boelhower untersucht die Topologie innerhalb dessen der Jazz sich in new Orleans entwickelte. Hans-Jürgen Lüsebrink weist auf Verbindungen zwischen den frankophonen Regionen Nordamerikas hin, die über die Sprache hinausgehen. Tobias Kraft fragt, was es bedeutet, dass eine farbige Kreolin, Aveline, seit 2012 im Videospiel “Assassin’s Creed III: Liberation”, das in New Orleans spielt, eine der Hauptprotagonisten ist. Berndt Ostendorf argumentiert, dass die Stadt ihre Diversität an Straßenkultur, ethnischer Mischung, Finanzkraft, Cuisine, Klang-, Wasser- und Landschaften als eigene Identität in der Vielfalt angenommen hat. Sona Arnold betrachtet die Reisebeschreibungen von Friedrich Gerstäcker über New Orleans und Brasilien als ein frühes Beispiel des Bewusstseins einer Verbindung zwischen Louisiana und Latein- bzw. Südamerika. Bill Marshall verweist auf die Bedeutung des “French Atlantic”, also der politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen New Orleans und Frankreich, als Erklärhilfen für die spezifische Mischung der Kulturen, die in Lousiana möglich war. Michael Zeuske vergleicht Havanna, Kuba und New Orleans als historische Zentren des Sklavenhandels. Und Eugenio Matibag verweist auf die Cajun Filipinos und das Phänomen der asiatisch-amerikanischen Kreolisierung in Louisiana.
So ist das ganze Buch (also die ganze Konferenz, die 2015 in Köln stattfand) eine lebendige Annäherung an die verschiedenen Aspekte von “creolity” oder “creolization”. Gerade, weil sich die Musik und all die anderen Subthemen hier in den Kanon der verschiedenen Kreolisierungstheorien eingereiht finden, handelt es sich damit um eine Perspektivbereicherung, die allen Teilnehmern und damit auch dem Leser dieses Bandes neue Erkenntnisse bringen kann.
Wolfram Knauer (März 2017)
Jazz As Visual Language. Film, Television and the Dissonant Image
von Nicolas Pillai
London 2017 (I.B. Tauris)
176 Seiten, 64 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78453-344-1
 Jazz, beginnt Nicolas Pillai sein Buch, war nie nur Musik. Als kommunikative Kunstform war Jazz auch immer immens visuell. Bildende Künstler haben immer wieder ihre Faszination mit dem Jazz betont, Tatsächlich entwickelte sich der Jazz etwa parallel zum Film, und so macht es Sinn, die Interaktionen zwischen beiden Genres zu untersuchen. Statt sich dabei auf Geschichten über Jazz zu konzentrieren, interessiert Pillai sich insbesondere für formale und strukturelle Parallelen zwischen den Künsten, analysiert dafür Bildsequenzen, Erzählstrategien mehr als die Story selbst. Dabei entdeckt er Kamerablicke genauso wie ikonische Motive und fragt sowohl, welche Gründe der Regisseur für seine filmischen Entscheidungen gehabt haben mag, als auch, welche Aussagen diese über die Zeit zulassen und wie sie auf das Publikum wirken.
Jazz, beginnt Nicolas Pillai sein Buch, war nie nur Musik. Als kommunikative Kunstform war Jazz auch immer immens visuell. Bildende Künstler haben immer wieder ihre Faszination mit dem Jazz betont, Tatsächlich entwickelte sich der Jazz etwa parallel zum Film, und so macht es Sinn, die Interaktionen zwischen beiden Genres zu untersuchen. Statt sich dabei auf Geschichten über Jazz zu konzentrieren, interessiert Pillai sich insbesondere für formale und strukturelle Parallelen zwischen den Künsten, analysiert dafür Bildsequenzen, Erzählstrategien mehr als die Story selbst. Dabei entdeckt er Kamerablicke genauso wie ikonische Motive und fragt sowohl, welche Gründe der Regisseur für seine filmischen Entscheidungen gehabt haben mag, als auch, welche Aussagen diese über die Zeit zulassen und wie sie auf das Publikum wirken.
Pillai wählt drei konkrete Fälle für seine Hauptkapitel. Len Lyes dreiminütiger Film “A Colour Box” ist ein Klassiker der filmischen Abstraktion. Für neun seiner elf abstrakten Filme zwischen 1934 und 1940 wählte Lye Jazzaufnahmen, die klar den Verlaub der filmischen Abstraktion strukturieren. Für “Colour Box” entschied er sich nach dem Durchhören hunderter Platten für Don Barretos Aufnahme “La Belle Creole”. Lye, der aus Neuseeland stammt, verweist in einzelnen seiner Bilder, die er direkt auf das Zelluloid malte oder kratzte, auf die Kunst der Aboriginees. Lye hatte seiner Erfahrungen in der Werbebranche gesammelt, für die er Animationsfilme machte, und Pillai vergleicht seine Technik mit Werbestrategien, die in den 1930er Jahren aufkamen, nicht so sehr das Produkt als vielmehr die Firma oder Marke zu bewerben. Hintergrund war, dass man damit umgehen wollte, dem Mittelklasse-Publikum, an das sich die Werbung richtete, zu offen die Rolle des Konsumenten zuzuschieben. Also fragt Pillai, wie das Publikum wohl die erkennbaren textlichen Inhalte von “A Colour Box” dechiffriert haben mag, Hinweise auf Postwertzeichen und –gewichte, oder auf den aus verschiedenen kommerziell erhältlichen Versionen des “Lambeth Walk” zusammengeschnittenen Soundtrack des Films “Swinging the Lambeth Walk” von 1938. In Len Lyes Kunst, schlussfolgert Pillai, gehe es zuvorderst um Kino als Technologie, um die Besonderheit des projizierten Bildes, all das aber vor dem Hintergrund klarer gesellschaftlicher Vorstellungen und mit dem Bewusstsein der Wirkung seiner Filme auf ihr zeitgenössisches Publikum.
Im zweiten Kapitel beleuchtet Pillai Gjon Milis legendären Film “Jammin’ the Blues” von 1944, der sich von anderen Kurzfilmen mit amerikanischem Jazz in jenen Jahren insbesondere dadurch unterscheidet, dass er die Jazzszenen (etwa mit Lester Young und Harry Edison) als bewusste Reaktion auf den aktuellen künstlerischen Diskurs der Zeit setzt. In der Einleitung des Films sagt ein Erzähler, dies sei eine Jam Session, tatsächlich aber handelt es sich bei dem Kurzfilm um eine Hollywood-Produktion, und bewegen die Musiker ihre Finger zum vorab aufgenommenen Soundtrack. Und so interessieren Pillai hier vor allem Kompetenzen wie “Ehrlichkeit” und “Ernsthaftigkeit”, verweist auf der ähnliche Kameraführungen wie jene ikonische, in der Lester Youngs Pork Pie Hat zu Beginn von “Jammin’ the Blues” als geometrische Kreise von oben gezeigt wird, um sich dann mit der Kamerafahrt und Youngs Erheben seines Kopfes als materielles Objekt zu entpuppen. Pillai berichtet kurz über Milis Karriere, sein Interesse am Film als eines künstlerischen Mediums, seine fotografischen Aktivitäten fürs LIFE-Magazin, die immer wieder auch Szenen aus der Jazzwelt beinhalteten, betrachtet einzelne Szenen als Reflex der Fotografenerfahrung Milis, und endet mit einem Aside über ein ähnliches Projekt aus dem Jahr 1950, bei dem Musiker aus Norman Granzs Jazz at the Philharmonic-Truppe zu sehen waren, unter ihnen Coleman Hawkins, Buddy Rich und Charlie Parker, die aber, da der vor-aufgenommene Soundtrack, zu dem die Musiker ihr Spiel mimen musste, verloren ging, nicht zu hören sind.
Pillais drittes Kapitel widmet sich der britischen Fernsehreihe “Jazz 625”, bei der durchreisende amerikanische Stars oft mit britischen Musikern zusammenwirkten und im Zusammenhang mit dem ihn insbesondere die Fernsehästhetik interessiert, einschließlich der Präsentation der Musiker durch Ansager wie Steve Race und Humphrey Lyttelton. Er beschreibt die Kamera als Sympathisanten der Musiker und schussfolgert, dass musikalische Bedeutung und musikalischer Effekt hier genauso der Crew hinter der Kamera zu verdanken sind wie den Musikern an ihren Instrumenten. Pillai holt kurz aus und beschreibt, wie Live-Jazz vor “Jazz 625” im britischen Fernsehen präsentiert wurde, vergleicht dies auch mit Produktionen aus den USA, die wie ein Vorbild zur britischen Reihe wirken mögen, insbesondere “Jazz Casual” und “Jazz Scene USA”. Er beschreibt, wie die Sendung eine überhöhte Form von Live-Atmosphäre kreierte und diskutiert schließlich, wie sich die daraus abgeleitete Ästhetik mit Musik im Fernsehen bis heute vergleichen ließe.
Pillai versteht seine eigene Forschung zum Jazz als Teil der interdisziplinären New Jazz Studies, die sehr bewusst darauf Rücksicht nehmen, dass jede Beschreibung oder Analyse eines künstlerischen Gegenstandes des Bewusstseins der jeweils eingenommenen Perspektive bedarf. Und so ist “Jazz as Visual Language” denn auch nicht als umfassende Geschichte der Verwendung von Jazz im Film zu verstehen, sondern vielmehr als eine Versammlung von Fallbeispielen, die zeigen, dass die Darstellung von Jazz im Film Einfluss auf die Rezeption der Musik genauso haben wie die gespielte Musik Einfluss auf die Dramaturgie des Films haben wird.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)[:]