AAMOA REPORTS – P-465
(Afro-American Music Opportunities Association, Inc.)
USA
1974: Vol. 6/4 (Jul/Aug) |
ABUNDANT SOUNDS – P-1005
USA
1964: Vol. 2/2-3 (Apr/May-Jul) |
ACTUEL – P 1078
Jazz / Pop Music / Théatre / Poésie
France
1968: #1-2 (Oct-Nov) [only digi.copy]
1969: #3-4 (Jan/Feb-Mar) [only digi.copy]
#6 (Mai) [missing] |
AD LIB – P-556
Rikskonserter informerar om
Sweden
1979: #3 (Dec) |
AKTUELLER NEUHEITENDIENST – P-1
der Jazz-Diskothek Münster/Westfalen
Germany
1961: #1, 4/5, 6/7, 8, # Anf. 60er ohne No., ? |
AKUSTIK GITARRE – P-708
Germany
1996: #1-4 (Mar/May-Dec/Feb)
1997: #1-5 (Mar/May-Dec/Jan)
1998: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1999: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2000: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2001: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2002: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2003: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2004: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2005: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2006: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2007: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2008: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2009: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2010: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2011: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2012: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2013: #1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
2014: #1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
2015: #1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
2016: #1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
2017: #1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
2018: #1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
2019: #2-6 (Feb/Mar-Oct/Nov) (Sonderheft: Acoustic-Player #1)
2020: #1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
2021: #2-4 (Feb/Mar-Jun/Jul) |
ALL ABOUT JAZZ / NEW YORK
[see under “The New York City Jazz Record”] |
ALL ABOUT JAZZ / BAY AREA – P-1008
USA, Bay Area
2004: #1 (Feb), #8 (Sep)
2009. #84 (April), #92 (Dez) |
ALL ABOUT JAZZ / LOS ANGELES – P-1007
USA, Los Angeles
2003: #5 (Jul), #7-10 (Sep-Dec)
2004: #11-12 (Jan-Feb)/Vol. 2/9 (Oct) |
ALL JAZZ – P-971
Portugal
2001: (1 issue)
2002: Mar/Apr (?) Vol. 2-4 (Jun/Jul-Oct/Nov)
2003: Vol.5-7 (Jan-Apr/May) |
ALL THAT JAZZ – P-836
Germany
1998: #1-2 (Fall-Winter)
1999: #3 (Spring) |
ALLEN’S POOP SHEET – P-2
USA
1958: Vol. 1/1-2
1959: Vol. 1/3-4
1960: Vol. 1/5
1972: Vol. 1/12
1973/74: Vol. 1/13
1974/75: Vol. 1/14
1978: Vol. 2-1/2 |
ALLES AUS DER WELT – P-3
Germany
1951: Vol. 3/3 (Mar) [Joachim-Ernst Berendt: Wird Elefanten-Tanz die neue Mode?] |
LES ALLUMES DU JAZZ – P-933
France
2000: #4
2001: #6
2002: #7
2003: #9
2004: #10-11
2005: #12-13
2006: #14-17
2007: #18-20
2008: #21-23
2009: #24-25
2010: #26-28
2013: #32
2015: #33-36
2018: #37 (Oct), |
ALTA FEDELTA – P-507
Italy
1981: #9-11 (Sep-Nov)
1982: #1-12 (Jan-Dec)
1983: #1-12 (Jan-Dec)
1984: #1-2 (Jan-Feb) |
AMERICAN FOLK MUSIC OCCASIONAL – P-1133
USA
1964: #1 |
AMERICAN JAZZ ANNUAL – P-4
USA
1956: Newport Edition |
AMERICAN JAZZ PHILHARMONIC NEWSLETTER – P-604
USA
1985: #1-2
1986: #1-2
1987: #1
1988: #1-3
1989: #1
1990: #1
1991: #1
1992: #1
1993: #1-2
1994: Vol. 8/2;
Vol. 9/1 (Winter)
1996: Vol. 10/1
1997: Vol. 11/1-2 (Spring-Summer);
Vol. 12/1 (Fall)
2000: Vol. 25 (April) |
AMERICAN JAZZ REVIEW – P-922
(American Jazz Club)
USA
1946: Vol. 2/6 (Apr); Vol. 3/2 (Dec) |
AMERICAN MUSIC – P-675
USA
1987: Vol. 5/1 (Spring)
1990: Vol. 8/3 (Fall)2014-2019 [alle digi.copy] |
AMJAZZIN – P-1026
The American Jazz Institute Newsletter
USA
2004: Vol.11 (Winter) |
AMJ – P-684
Bolletino Dell’Associazione Nazionale Musicisti Di JazzItaly
1995: Vol.5/7 (May), 9 (Nov/Dec)
1997: #12 (Sep) |
ANALOG AKTUELL – P-608
Forum für analoge Musikwiedergabe
Germany
1994: #1 |
AND ALL THAT JAZZ – P-719
New Sacramento Traditional Jazz Society
USA
1970: Vol. 1/5-6 (May-Jun), 1/8-9 (Sep-Oct)
1971: Vol. 2/2 (Feb), 2/4-5 (Apr-May), 2/7 (Jul), 2/9 (Sep), 2/12 (Dec)
1972: Vol. 3/1 (Jan), 3/4 (Apr), 11 (Nov)
1973: Vol. 4/4-5
1974: Vol. 5/3-4 (Mar-Apr), 6-8 (Jul-Oct)
1975: Vol. 6/7
1976: Vol. 7/7-8
1977: Vol. 8/5 (May), 12 (Dec)
1978: Vol. 9/1 (Jan), 5 (Spring), 6 |
ANGLO GERMAN SWING CLUB NEWS – P-5
(British Forces Network)
Germany
1949: #2-4 (Sep-Nov) [#1-5 also in Reprint]
1950: #6-11 (Apr-Sep) [#6-11 also in Reprint]
[continued as “Rhythm Club News”] |
ANNUAL REVIEW OF JAZZ STUDIES – P-6
[continuation of “Journal of Jazz Studies”]
USA
1982: #1
1983: #2
1985: #3
1988: #4
1991: #5
1993: #6
1994/95: #7
1996: #8
1997/98 #9
1999: #10
2000/2001: #11
2002: #12
2003: #13
2009: #14 [last issue; re-continued as Journal of Jazz Studies, only available online] |
ANUARIO DE JAZZ CALIENTE – P-7
Argentina
1971 |
AQUARIAN ARTS WEEKLY – P-502
USA
1984: #542 (26.Sep) |
ARHOOLIE OCCASIONAL – P-597
USA
1971: #1
1973: #2 |
ARPÔGE – P-837
L’actualit’ musicale mondiale
France
[no date; 1 issue] |
ARSC JOURNAL – P-824
Association for Recorded Sound Collections
USA
1998: Vol. 29/1-2 (Spring, Fall)
1999: Vol. 30/1-2 (Spring, Fall)
2000: Vol. 31/1-2 (Spring, Fall)
2001: Vol. 32/1-2 (Spring, Fall)
2002: Vol. 33/1-2 (Spring, Fall)
2003: Vol. 34/1-2 (Spring, Fall)
2004: Vol. 35/1-2 (Spring, Fall)
2005: Vol. 36/1-2 (Spring, Fall)
2006: Vol. 37/1-2 (Spring, Fall)
2007: Vol. 38/1-2 (Spring, Fall)
2008: Vol. 39/1-2 (Spring, Fall)
2009: Vol. 40/1-2 (Spring, Fall)
2010: Vol. 41/1-2 (Spring, Fall)
2011: Vol. 42/1-2 (Spring, Fall)
2012: Vol.43/1 (Spring) |
ARSC NEWSLETTER – P-825
Association for Recorded Sound Collections
USA
1998: #83-85 (Spring-Fall)
1999: #86-89 (Winter-Fall)
2000: #90-93 (Winter-Fall)
2001: #94-97 (Winter-Fall)
2002: #98-100 (Spring-Fall)
2003: #101-103 (Winter-Fall)
2004: #104-106 (Winter-Fall)
2005: #107-109 (Winter-Fall)
2006: #110-112 (Winter-Fall)
2007: #113-115 (Winter-Fall)
2008: #116-118 (Winter-Fall)
2009: #119-121 (Winter-Fall)
2010: #122-124 (Winter-Fall)
2011: #125-127 (Winter-Fall)
2012: #128 (Winter) |
ART POSITION – P-8
Germany
1992: Vol. 4, #19/20 (May/Aug) [Helmut Weihsmann: Jazz ‘n’ Movies. Jazzdarstellungen im Film. Historische und Stilistische Anmerkungen (1. Teil)]
Vol. 4, #21 (Sep/Oct) [Helmut Weihsmann: Jazz ‘n’ Movies. Jazzdarstellungen im Film. Historische und stilistische Anmerkungen (2.Teil)]
1993: Vol. 5, #22 [Helmut Weihsmann: Cover-Art. Jazz-Schallplattenhüllen und deren Gestaltung] |
DER ARTIST – P-759
Central-Organ der Circus, Variet’-Bühnen und Reisenden Theater
Germany
1901: diverse Hefte (ca. Jun-Aug) als Mikrofilm
1973: Vol. 91/20 (17.Oct.)
1979: Vol. 97/6 (21.Mar)
1986: Vol.104/6 (15.Jun) |
ARTIST REVY – P-1099
Special Tidningen för Nöjesvärlden
Norway
1963: Vol, 2/1 (Dec) |
Arts Midwest Jazzletter – P-984
USA
1990: Vol. 8/3 (Summer) |
Arttourist.com gazette – P-1184
Germany
2017: #Jazz | Neue Musik (ELLA)2018: #Jazz | Neue Musik | Elektro (OSCAR) |
ASCAP IN ACTION – P-9
USA
1991: Spring |
ASCAP TODAY – P-494
USA
1967: Vol. 1/3 (Autumn) |
AUDITORIUM, THE – P-860
Italy
1988: #12
1994: #13
1998: #2 |
AUSTIN TRADITONELL JAZZ CLUB – P-698 (Newsletter)
USA
1978: #6 (Mar) |
AUSTRALIAN JAZZ QUARTERLY – P-654
Australia1946: #1 (May)
1949: #8 (Dec)
1950: #10 (Apr) |
AUSTRALIAN RECORD AND MUSIC REVIEW P-1131
A Quarterly Discographical Magazine for Record and Music Collectors
Australia
1993: #16-17 (Jan,Apr) |
AVANT – P-796
Jazz, Improvised and Contemporary Classical Music
England
1997: #1-4 (Spring-Winter)
1998: #5-9 (Winter-Autumn)
1999: #10-13 (Winter-Autumn)
2000: #14-17 (Winter-Autumn)
2001: #18 (Spring) |
B.A.D. – P-1141
Black Arts & Dance
Germany
1990: #1-4 (May/Jun-Nov/Dec)
1991: #5-15 (Jan-Dec)
1992: #1/2-12/1 (Jan/Feb-Jan/Dec)1993: #2-12 (Feb-Dec) |
BADENER NEUJAHRSBLÄTTER – P-1030
Switzerland
2006: #81 [Einzelheft] |
BAJS NEWSLETTER – P-894
(Bay Area Jazz Society)
USA
1982: #1 (Sep) |
BALLROOM AND BAND – P-1144
England
1934: Nov-Dec
1935: Jan-Mar |
BAMBOLEO – P-935
Zeitschrift für Salsa und mehr …
Germany
2000: #12 (Dec/Jan)
2001: #13-15 (Feb/Mar-Jun/Jul) |
BAND LEADERS – P-989
USA
1946: Vol.3/4-5 (Mar,Jun) |
BANJO PODIUM – P-810
Germany
1988: #19 (Winter)
1990: #23-25 (Winter-Spring)
1992: #34 (Fall)
1993: #37 (Summer)
1994: #42-43 (Fall-Winter)
1995: #44 (Spring), #46 (Fall)
1996/97 #51 (Winter)
1998: #57, (Sommer), #58 (Herbst)
1999: #60 (Spring)
2000: #66-67 (Herbst-Winter)
2001: #68 |
BASLER JAZZ-ROUNDTABLE NOTES – P-650
Switzerland
1977: #10/11 (Aug/Sep) |
BBC MUSIC MAGAZIN – P-986
Austria
1994: Vol. 3/2 (Oct) |
THE BEAT – P-806
Mitteilungen des Jazz-Clubs Rheda
Germany
1959: May |
BEAU CHICAGO AND BEYOND… – P-1034
USA:
2005: #1 (Fall/Winter) |
The BECHET BULLETIN / The BECHET QUARTERLY – P-999
An Official Publication of The Sidney Bechet Society, Ltd.
USA
1997: Vol. 1/1 (Sep)
1998: Vol. 1/2-4 (Feb,May,Sep), Vol. 2/1 (Dec)
1999: Vol. 2/2-4 (Mar,Jun,Aug,Nov)
2000: Vol: 3/1-2 (May,Sep)
2001: Vol. 4/2-3 (Jun,Sep)
2002: Vol. 5/1-3 (Feb,Jun,Dec)
2003: Vol. 6/1-3 (Mar,May,Jun)
2004: Vol. 7/1-3 (Jan,Mar,Aug)
2005: Vol. 8/1-3 (Feb,Jun,Dec)
2006: Vol. 9/1-2 (Feb,Oct)
2007: Vol. 10/1-4 (Jan,Apr,Sep,Nov)
2008: Vol. 11/1-3 (Jan,Jun,Aug) |
BEITRÄGE ZUR POPULARMUSIKFORSCHUNG – P-593
Germany
1987: #3/4 [Rock/Pop/Jazz. Vom Amateur zum Profi]
1988: #5/6 [Musikalische Werdegänge]
1989: #7/8 [Rock, Pop, Jazz – musikimmanent durchleuchtet]
1990: #9/10 [Zwischen “Jesus Christ Superstar” und “Sympathy for the Devil”. Rock/Pop/Jazz und christliche Religion]
1993: #11 [Aspekte zur Geschichte populärer Musik]
#12 [Stationen populärer Musik: Vom Rock’n’Roll zum Techno]
1994: #13 [Musik der Skinheads und ein egenpart: Die “Heile Welt” der volkstümlichen Musik]
#14 [Grundlagen – Theorien – Perspektiven]
1995: #15/16 [”Es liegt in der Luft was Idiotisches” – Populäre Musik zur Zeit der Weimarer Republik]
1996: #17 [Regionale Stile und Volksmusikalische Traditionen]
#18 [Mainstream, Underground, Avantgarde]
1997: #19/20; Nachtrag [Step Across the Border. Neue musikalische Trends – neue massenmediale
Kontexte]
1998: #21/22 [Populäre Musik, Politik und mehr…]
#23 [Neues zum Umgang mit Rock- und Popmusik]
1999: #24 [Erkenntniszuwachs durch Analyse – Populäre Musik auf dem Prüfstand]
2000: #25/26 [Populäre Musik im kulturwissenschaftlichen Diskurs]
2001: #27/28 [Populäre Musik im kulturwissenschaftlichen Diskurs II]
2002: #29/30 [Heimatlose Klänge? Regionale Musiklandschaften – heute -]
2003: #31 [Clipped Differences –Geschlechterrepräsentationen im Musikvideo]
2005: #33 [Keiner wird gewinnen – Populäre Musik im Wettbewerb]
2006: #34 [Cut and paste – Schnittmuster populärer Musik der Gegenwart]
2007: #35 [Sound and the city – Populäre Musik im urbanen Kontext]
2008: #36 [No Time for Losers – Charts, Listen und andere Kanonisierungen in der populären Musik]
2011: #37 [Thema Nr.1 – Sex und populäre Musik]
2012: #38 [Black Box Pop – Analysen populärer Musik]
2013: #39 [Ware Inszenierungen – Performance, Vermarktung und Autentizität in der populären Musik]
2014: #40 [Geschichte wird gemacht – Zur Historiographie populärer Musik]
2014: #41 [Typisch Deutsch – (Eigen-)Sichten auf populäre Musik in diesem unseren Land] |
BELLAPHON – P-1157 (DE)
(Import Dienst)
1978: Facts New Februar |
BELLS – P-432
A newsletter of opinion, news and reviews of improvised music
USA
1976: #20 (Oct)
1978: #25/26-29/30 (Dec/Jan-Nov/Dec)
1979: #31/32 (Sep) |
BERKLEE COLLEGE OF MUSIC BULLETIN – P-598
USA
1973: May |
BERKLEE TODAY – P-1058
USA
2008: Vol. 19/3 (Winter) |
BERLINER JAZZBLATT – P-561
East Germany
1983: #4 (Apr)
1990: #30 (Jan/Mar) |
BERLIN-JAZZ – P-470
Mitteilungsblatt des Jazz-Club Berlin
Germany
1956: #5 (Mar/Apr)[*Fehlbestand]
1957: Jan, Dec/Jan
1958: Feb/Mar |
BERLIN MAGAZIN – P-10
Germany
1972: Vol. (7) (Sep) [Joachim-Ernst Berendt: Jazz als Spiegel der Probleme und Krisen. Joachim-Ernst Berendt über die Berliner Jazztage 1972] |
BERLINER JAZZPROGRAMM – P-1017
Germany
1959: Sep/Oct |
BESTÄNDE – P-11
Texte und Bilder für Kulturabhängige
Austria
1990: #16/17 (Winter) [special jazz issue: “Notenblätter”]
2000: #52 (Jun/Jul) [special jazz issue] |
BILLIE HOLIDAY CIRCLE NEWSLETTER – P-964
England
Undated issues
Page 1-309 |
BIGBAND! -P-809
Netherlands
1997: Vol. 1/2 (Jan/Feb), Vol.1/1 (Nov/Dec)
1998: Vol. 1/3-7 (Mar/Apr-Nov/Dec)
1999: Vol. 2/8-13 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2000: Vol. 2/14 (Jan/Feb) |
BIG BANDS INTERNATIONAL – P-546
England
1992: #59 (May) |
THE BIG BANDWAGON – P-892
USA
1979: Vol. 2/10 (Sep) |
BILD DER FRAU – P-12
Germany
1991: #24 (10.Jun) [Hannelore Schütz: Das intime Wörterbuch der Frau (Stichwort “Jazz”: Photo der ODJB aus dem Photoarchiv des Jazz-Instituts Darmstadt)] |
BILD DER ZEIT – P-13
Germany
1971: #12 (Dec) [Gerhard Kühn: Jazztime in New Orleans (Claxton photos)] |
BILD UND FUNK – P-14
Germany
1953: #48 (29.Nov) [NN: Schwarz und Weiß in Baden Baden (Lionel Hampton & Joachim-Ernst Berendt)]
1954: #1 (3.Jan) [NN: Starlese aus USA. Amerikas beliebteste Schlagersängerinnen (Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Gisele Mackenzie, Rosemary Clooney, Dinah Shore)]
1960: #49 (4.Dec) [Joachim-Ernst Berendt: Das größte Jazzfestival der Welt. Joachim-Ernst Berendt berichtet aus Monterey/USA] |
BILLBOARD – P-456
USA
1983: Vol. 95/4 (29.Jan)
1989: Vol. 101/1-2,4-14,16-19,21-23,25-34,37-48,50
1990: Vol. 102/48 (1.Dec)
1991: Vol. 103/1 (5.Jan), 3-4 (19.-26.Jan), 13 (30.Mar), 45 (9.Nov)-49 (7.Dec)
1992: Vol. 104/1 (4.Jan), 40 (3.Oct)-43 24.Oct) |
BILLY TAYLOR SOUNDPOST – P-641
USA
1994: Vol. 1/7-8 (May, Aug)
1995: Vol. 2/1 (Jan/Jul), 2/3 (Dec) |
BIRDS’S VOICE / JOE ZAWINULS BIRDLAND – P-1010
Austria
2004: #5/6-11/12 (May/Jun-Nov/Dec)
2005: #1/2 (Jan/Feb) |
BJAZZ – P-893
(Organ for Bergen Jazz Forum)
Norway
1982: #2-3 (May-Sep) |
BLACK MUSIC & JAZZ REVIEW – P-466
England
1978: Vol. 1/1-9 (Apr-Dec)
1979: Vol. 1/***-11 (Feb-Dec)
1980: Vol. 2/9-11 (Jan-Mar)
1982: Vol. 5/1 (May), 5/8 (Dec)
1983: Vol. 6/3 (Aug)
1984: Vol. 7/3-8 (Mar-Aug) |
BLACK MUSIC RESEARCH JOURNAL – P-15
(BMR JOURNAL)
USA
1983: Vol. 3
1984: Vol. 4
1986: Vol. 6
1988: Vol. 8/1-2 (Spring, Fall)
1989: Vol. 9/1-2 (Spring, Fall)
1990: Vol. 10/1-2 (Spring, Fall)
1991: Vol. 11/1-2 (Spring, Fall)
1992: Vol. 12/1-2 (Spring, Fall)
1993: Vol. 13/1-2 (Spring, Fall)
1994: Vol. 14/1-2 (Spring, Fall)
1995: Vol. 15/1-2 (Spring, Fall)
1996: Vol. 16/1-2 (Spring, Fall)
1997: Vol. 17/1-2 (Spring, Fall)
1998: Vol. 18/1-2 (Spring, Fall)
1999: Vol. 19/1 (Spring)
2000: Vol. 20/1-2 (Spring, Fall)
2001: Vol. 21/1-2 (Spring, Fall)
2002: Vol. 22/1-2 (Spring, Fall)
2003: Vol. 23/1-2 (Spring, Fall)
2004: Vol. 24/1-2 (Spring, Fall)
2005: Vol. 25/1-2 (Spring, Fall)
2006: Vol. 26/1-2 (Spring, Fall)
2007: Vol. 27/1-2 (Spring; Fall)
2008: Vol. 28/1 (Spring) |
BLACK MUSIC RESEARCH NEWSLETTER – P-464
USA
1977: Vol. 1/1-2 (Summer-Fall)
1978: Vol. 1/3-4 (Winter-Spring); Vol. 2/1-2 (Summer-Fall)
1979: Vol. 2/3-4 (Winter-Spring); Vol. 3/1-2 (Summer-Fall)
1980: Vol. 4/1-2 (Spring, Fall)
1981: Vol. 4/3 (Spring); Vol. 5/1 (Fall)
1984: Vol. 6/2 (Spring); Vol. 7/1 (Fall) |
BLACK PERSPECTIVE IN MUSIC – P-676
USA
1977: Vol. 5/1-2 (Spring-Fall)
1978: Vol. 6/1-2 (Spring-Fall)
1980: Vol. 8/1 (Spring)
1981: Vol. 9/1-2 (Spring-Fall) |
BLASNOST-JOURNAL – P-16
Germany
1991: May |
BLEU BANANE – P-835
Belgium
1997: #1 (Fall)
1998: #2-3 (Spring-Fall)
2000: #4 (Spring) |
BLOCK -P-744
Tijdschrift voor Blues
Netherlands
1983: #47 (Jul/Sep)
1996: #100 (Oct/Nov/Dec) |
BLOW UP – P-862
Italy
1998: #8 (Nov/Dec) |
BLU JAZZ – P-444
Italy
(continues as Jazz / Mensile)
1989: (Beilage zu Blu) Vol. 4/27-28, (Blu Jazz) Vol. 1/1-3
1990: Vol. 2/4-10
1991: Vol. 3/11-19
1992: Vol. 4/20-28
1993: Vol. 5/29-39[continued as “JAZZ”]
1994: Vol. 1/1-5 (Jun-Dec)
1995: Vol. 2/6-13 (Jan-Nov/Dec)
1996: Vol. 3/14-19 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1997: Vol. 4/20-24 (Jan/Feb-Nov/Dec) |
BLUE ANCHOR BULLETIN – P-17
Schweden
1992: Vol. 17/1 (Apr)
1993: Vol. 18/1 (Mar)
1994: Vol. 19/1 (Feb)
1995: Vol. 20/1 (May) |
BLUE NOTE, THE – P-592
South Bay New Orleans Jazz Club
USA
1962: Nov-Dec
1963: Jan-Mar,May-Jun,Sep
1964: Jan-Mar,May,Aug-Sep,Dec
1965: Jan-Feb,Apr-Dec
1966: Jul
1967: Apr,Jun,Aug-Sep
1968: May,Sep,Nov
1969: ca. Jun,Aug.
1970: ca. Jan, ca. May – ca Jul, ca. Nov
1971: Jan,Mar-Apr,Sep
1972: Feb,Apr
1973: Oct
1974: May,Oct |
BLUE RHYTHM – P-693
präsentiert von Jazz Thing
Deutschland
1995: #1 (winter)
1996: #2-3 (summer-winter)
1997: #4-5 (summer-winter)
1998: #6-8 (spring-fall)
1999: #9-11 (spring-fall)
2000: #12-14 (spring-fall)
2001: #15-17 (spring-fall)
2002: #18-20 (spring-fall)
2003: #21-23 (spring-fall)
2004: #24-26 (spring-fall)
2005: #27-29 (spring-fall)
2006: #30-32 (spring-fall)
2007: #33-35 (spring-fall)
2008: #36, #38 (spring, fall)
2009: #39-40 (spring-summer) |
Blues at the Foundation – P-939
USA
2001: Vol. 3/1 (Winter) |
BLUES & RHYTHM – P-1092
The Gospel Truth
England
1984: #5 (Dec) |
BLUES & SOUL – P-18
England
1972: #81
1973: #117
1977: #227
1984: #407-411,412-416,418
1985: #427,431-435, 436, 437-448
1986: #449-450, 452-453, 456, 471
1992: #604
1995: #702-706
1996: #712 |
BLUES FORUM – P-19
Germany
1980: #1
1981: #2-4
1982: #5-8
1983: #9-12
1984: #13-16
1985: #17/18
1986: #19
1987: #20 |
BLUES LIFE – P-20
Austria
1979: Vol. 2/6-8
1980: Vol. 3/9-12
1981: Vol. 4/13-16
1982: Vol. 5/17-20
1983: Vol. 6/21-24
1984: Vol. 7/25-28
1985: Vol. 8/29-31
1990: Vol. 13/50-52
1991: Vol. 14/53-56
1992: Vol. 15/57-60
1993: Vol. 16/61, 64
1994: Vol. 17/65 |
BLUES MUSIC MAGAZINE – P-1124 (formerly Blues Revue Quarterly)
USA
2013: 1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec) |
BLUES NEWS – P-685
Germany
1995: Vol. 1/1-2 (Mar-Sep)
1996: Vol. 2/3-6 (Jan-Oct/Dec)
1997: Vol. 3/7-10 (Jan/Mar-Oct/Dec)
1998: Vol. 4/11-15 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1999: Vol. 5/16-19 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2000: Vol. 6/20-23 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2001: Vol. 7/24-27 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2002: Vol. 8/28-31 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2003: Vol. 9/32-35 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2004: Vol. 10/36-39 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2005: Vol. 11/40-43(Jan/Mar-Oct-Dec)
2006: Vol. 12/44-47(Jan/Mar-Oct-Dec)
2007: Vol. 13/48-51 (Jan/Mar-Oct-Dec)
2008: Vol. 14/52-55 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2009: Vol. 15/56-59 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2010: Vol. 16/60-63 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2011: Vol. 17/64-67 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2012: Vol. 18/68-71 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2013: Vol. 19/72-76 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2014: Vol. 20/77-80 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2015: Vol. 21/81-84 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2016: Vol. 22/85-88 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2017: Vol. 23/89-91 (Apr/Jun-Oct/Dec)
2018: Vol. 24/92-95 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2019: Vol. 25/96-99 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2020: Vol. 26/100-103 (Dec/Mar-Oct/Dec)2021: Vol. 27/104 (Dec/Mar) |
BLUES NOTES – P-21
Belgium
1990: #2-3 (Jul, Nov)
1991: #4-6 (Feb, Jul, Nov)
1992: #7-9 (Feb/Mar, Jul, Nov)
1993: #10 (Apr) |
BLUES NOTES – P-538
Germany
1971: Vol. 3, 10/11-12
1972: Vol. 4, 13-15/16
1973: Vol. 5, 17-19/20
1974: Vol. 6, 21-23
1975: Vol. 7, 24/25-26/27
1976: Vol. 8, 28/29
1977: Vol. 9, 30-31
1978: Vol. 10, 32/33-34
1979: Vol. 11, 35/35-37 |
BLUES POWER – P-775
Italy
1973: Vol. 1/1 (Nov)
1974: Vol. 1/4 |
BLUES POWER MAGAZINE – P-525
Germany
1992: #1-2
1993: #3-5
1994: #6 |
BLUES RESEARCH P-1081
(Record Research presents)
USA
no date (ca. 1960s): #13 -16 |
BLUES REVUE (QUARTERLY) (BRQ) – An Acoustic & Traditional Blues Digest – P-22
USA
1991: #1-2 (Jul, Oct)
1992: #3-6 (Jan, Spring, Summer, Fall)
1993: #7-10 (Winter, Spring, Summer, Fall)
1994: #11-15 (Winter, Spring, Summer, Fall, Winter)
1995: #16-20 (Mar/Apr-Dec/Jan)
1996: #21-26 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1997: #27-33 (Feb/Mar-Dec)
1998: #34-43 (Jan/Feb-Dec)
1999: #44-53 (Jan/Feb-Dec)
2000: #54-63 (Jan-Dec)
2001: #64-73 (Jan/Feb-Dec)
2002: #74-79 (Jan/Mar-Dec/Jan)
2003: #80-85 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2004: #86-91 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2005: #92-97 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2006: #98-103 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2007: #104-109 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2008: #110-115 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2009: #116-121 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2010: #122-126 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2011: #127-132 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2012: #133-136 (Mar/Apr-Sep/Oct)
2013: #137 (Mar/Apr) |
BLUES UNLIMITED – P-23
England
1963: #7 (Dec)
1964: #8-10 (Jan-Mar), 12-17 (Jun-Nov/Dec), B1 [special issue on Muddy Waters], B2 [special issue on John Lee Hooker]
1965: #19-28
1966: #29-35, 36-39
1967: #40, 42, 45-48
1968: #49-55, 56-58
1968: Collector Classics, #12-13; Beale Street
1969: #59-68
1970: #69-78
1971: #79-87
1972: #88-97
1973: #98-105
1974: #106-111
1975: #112-116
1976: #117-122
1977: #123-127
1978: #128-132
1979: #133-136
1980: #137-139
1981: #140-141
1982: #142-143
1983: #144-145
1984: #146
1986: #147 (Spring)
1987: #148/149 (Winter) |
BLUES WORLD – P-24
England
1965: #1
1966: #9-11
1967: #12-16
1968: #18-22
1969: #23-25
1970: #26-37
1971: #38-41
1973: #45, 46/49
1974: #50 |
BLUES WORLD BOOKLET – P-25
England
#1 [Robert Johnson] |
BLUESER RUNDBRIEF -P-745
Germany
1995: #4-7 (Jun, Sep-Dec)
1996: #8-18 (Jan-Dec)
1997: 19-21 (Jan-Mar) |
BMI – P-568
The Many Worlds of Music
USA
1969: summer
1973: #1
1987: #1 |
BODY & SOUL – P-26
Germany (Polygram)
1992: #2-3
1993: #4-6
1994: #7-8
1995: #9-10 |
BOLETIN GM – P-1072
Spain
2008: #12 |
BOOGIE NEWS – P-27
Germany (trade newsletter)
1992: #1, Sep/Dec
1993: Apr/Jul |
BOOGIE WOOGIE & BLUES COLLECTOR – P-28
Netherlands
1971: #2 (Feb) |
BORDERLINE – P-29
USA
#1 (Rich Boy, Poor Boy)
#2 (Feb/Mar 1989: One Day Close to Hell)
#5 (KC Jazz)
#6 (Fall 1991: Why I Live Where I Live) |
BOUNDARY – P-705
USA
1995: Vol.22/2 (Summer) |
BOZ – P-601
(England)
1994: #1-9 (Mar-Dec/Jan)
1995: #10-20 (Feb-Dec)
1996: #21-32 (Jan-Dec)
1997: #33-44 (J+an-Dec)
1998: #45-55 (Jan-Nov)
1999: #57-67 (Feb-Dec/Jan)
2000: #68, 70-73 (May,Aug-Dec)
2001: #74-81 (Jan-Dec) |
The Brass Group – P-1112
Italy
1981: #4-5 (Jan-Feb) |
BRILLIANT CORNERS – P-847
USA
1997: Vol. 1/2, Vol. 2/1
1998: Vol. 2/2, Vol. 3/1
1999: Vol. 3/2, Vol. 4/1
2000: Vol. 4/2, Vol. 5/1
2001: Vol. 5/2, Vol. 6/1
2002: Vol. 6/2, Vol. 7/1
2003: Vol. 7/2, Vol. 8/1
2004: Vol. 8/2, Vol. 9/1
2005: Vol. 9/2, Vol. 10/1
2006: Vol. 10/2, Vol. 11/1
2007: Vol. 11/2, Vol. 12/1
2008: Vol. 12/2, Vol. 13/1
2010: Vol. 15/1-2
2011: Vol. 16/1
2012: Vol. 16/2, Vol. 17/1
2013: Vol. 17/2, Vol. 18/1
2014: Vol. 18/2, Vol. 19/1
2015: Vol. 19/2; Vol. 20/1
2016: Vol. 20/2; Vol. 21/1
2017: Vol. 21/2; Vol. 22/1
2018: Vol. 22/2; Vol. 23/1
2019: Vol. 23/2; Vol. 24/1
2020: Vol. 24/2; Vol. 25/1
2021: Vol. 25/2 |
BRITISH INSTITUTE OF JAZZ STUDIES NEWSLETTER – P-30
England
1967: #4
1969: #21, 24/25
1970: #29-34 |
BRONX CHEER – P-261
USA
1997: #3
1998: #4 |
BROW BEAT – P-852
USA
1993: #1 (Fall) |
BRUTUS – P-540
Japan
1985: #104 (Feb) |
BUDDY DEFRANCO NEWSLETTER – P-605
USA
1984: Vol. 1/2 (Dec)
1985: Vol. 1/3-4 (Mar,Jun); Vol. 2/1-2 (Sep,Dec)
1986: Vol. 2/3-4 (Mar,Jun); Vol. 3/1-2 (Sep,Dec)
1987: Vol. 3/3-4 (Mar,Jun); Vol. 4/1 (Sep)
1988: Vol. 4/2-4 (Jan,Mar,Jun); Vol. 5/1-2 (Sep,Dec)
1989: Vol. 5/3 (Mar); Vol. 6/1 (Oct)
1990: Vol. 6/2 (Jun)
1993: Vol. 7/1 (Summer) |
The BUGLE CALL RAG – P-1014
The Newsletter of the Harry Roy Appreciation Society
England
1992: #58 (Christmas)
1993: #59-60 (Spring-Summer)
1994: #63 (Summer)
1996: #69 (Sommer)
1997: #70, #72 (Summer),
1999: #77-79 (Spring-Winter)
2000: #80 (Spring)
2001: #84-85 (Summer-Winter)
2002: #88 (Christmas)
2003: #91 (Winter)
2005: #95 (May) |
BULLETIN DU HOT CLUB DE FRANCE (hcf) – P-31
France
1945: #1-3
1953: #24-31 (Jan-Oct)
1954: #36-39 (Mar-Jul), 41-43 (Oct-Dec)
1955: #44-53 (Aug-Dec)
1956: #54 (Jan); 59 (Jul/Aug)
1957: #73 (Dec)
1958: #74-75 (Jan-Feb), 78-79 (May-Aug), 81-83 (Oct-Dec)
1959: #88 (May/Jun), 93 (Dec)
1960: #94-102 (Jan-Nov)
1961: #104-107 (Jan-Apr)
1962: #114-116 (Jan-Mar), 118 (May/Jun), 120-123 (Sep-Dec)
1963: #125-129 (Feb-Aug), 132 (Nov)
1964: #134-136 (Jan-Mar), 142-143 (Nov-Dec)
1965: #145-149 (Feb-Aug), 151-153 (Oct-Dec)
1966: #154-163 (Jan-Dec)
1967: #164 (Jan), 166 (Mar), 168-173 (May-Dec)
1968: #174-183 (Jan-Dec)
1969: #184-189 (Jan-Aug), 191 (Oct)
1970: #194-197 (Jan-Apr)
1971: #206 (Mar), 208 (May/Jun), 212-213 (Nov/Dec)
1972: #214 (Jan), 216-223 (Mar-Dec)
1973: #224-233 (Jan-Dec)
1974: #234-243 (Jan-Dec)
1975: #244-250 (Jan-Dec)
1976: #251-257 (Jan-Dec)
1977: #259 (Mar/Apr), 261 (Sep/Oct)
1978: #262-267 (Apr-Dec)
1979: #273-274 (Aug/SepOct/Nov)
1980: #276 (Jan)
1981: #289 (Jun)
1983: #309 (Jul/Aug)
1985: #325 (Mar)
1989: #366-367 (Feb-Mar), 372-373 (Aug/Sep-Oct)
1990: #380 (May)
1991: #393 (Jul)
1992: #406 (Aug/Sep), 408-409 (Nov-Dec)
1993: #410-420 (Jan-Dec)
1994: #421-431 (Jan-Dec)
1995: #432-441 (Jan-Nov)
1996: #443-453 (Jan-Dec)
1997: #454-465 (Jan-Dec)
1998: #466-477 (Jan-Dec)
1999: #478-487 (Jan-Dec)
2000: #488-498 (Jan-Dec)
2001: #499-508 (Jan-Dec)
2002: #509-518 (Jan-Dec)
2003: #519-528 (Jan-Dec)
2004: #529-538 (Jan/Feb-Dec)
2005: #539-548 (Jan-Dec)
2006: #549-558 (Jan-Dec)
2007: #559-566 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2008: #567-576 (Jan-Dec)
2009: #577-586 (Jan-Dec)
2010: #587-596 (Jan-Dec)
2011: #597-606 (Jan-Dec)
2012: #607-615 (Jan-Nov)
2013: #617-626 (Jan-Dec)
2014: #627-636 (Jan-Dec)
2015: #637-646 (Jan-Dec)
2016: #647-656 (Jan-Dec)
2017: #657-666 (Jan-Dec)
2018: #667-675 (Jan/Dec)
2019: #676-685 (Jan-Dec)
2020: #686-693 (Jan-Nov/Dec)
2021: #694-695 (Jan-Feb) |
BULLETIN FROM JAZZ INFORMATION – P-32
England
1936: #5-6, 12-19, 21-24
1940: #20,22
1941: #7 |
BULLETIN SOUCASN HUDBA – P-33
CSFR
1980: #27/28 [special jazz issue] |
BULLETIN DU HCF – P-1175
1993: #411 (Februar) |
BUNTE PLATTE, Die – P-34
Germany
1951: #5 [Joachim-Ernst Berendt: Jazz in Hollywood]
#8 [NN: Europas Bigband Nr. 1: Ted Heath; Peter Bopp: Zwei hatten eine Idee. Aus der Geschichte der Capitol-Schallplatte; Joachim-Ernst Berendt: Der Swing ist wieder da]
#9 [NN: Ted Heath auf Tournee; Peter Bopp: Zwei hatten eine Idee. Aus der Geschichte der Capitol-Schallplatte (II)]
#11 [Joachim-Ernst Berendt: Das Vibraphon im Jazz]
#12 [Joachim-Ernst Berendt: Jazz made in Germany]
1952: #1 [Joachim-Ernst Berendt: Vom Stilkrieg im Jazz] |
BUTT RAG – P-978
USA
#6 |
CADENCE – P-35
USA
1976: Vol. 1/1-12 (Jan-Oct); Vol. 2/1-2 (Nov-Dec)
1977: Vol. 2/3-12 (Jan-Jul); Vol. 3/1-8 (Aug-Dec) [suppl. Index 1977]
1978: Vol. 3/9-12 (Jan-Mar); Vol. 4/1-12 (Apr-Dec) [suppl. Index 1978]
1979: Vol. 5/1-12 (Jan-Dec) [suppl. Index 1979]
1980: Vol. 6/1-12 (Jan-Dec) [suppl. Index 1980]
1981: Vol. 7/1-12 (Jan-Dec) [suppl. Index 1981]
1982: Vol. 8/1-12 (Jan-Dec) [suppl. Index 1982]
1983: Vol. 9/1-12 (Jan-Dec) [suppl. Index 1983]
1984: Vol. 10/1-12 (Jan-Dec) [suppl. Index 1984]
1985: Vol. 11/1-12 (Jan-Dec) [suppl. Index 1985]
1986: Vol. 12/1-12 (Jan-Dec) [suppl. Index 1986]
1987: Vol. 13/1-12 (Jan-Dec) [suppl. Index 1987]
1988: Vol. 14/1-12 (Jan-Dec) [suppl. Index 1988]
1989: Vol. 15/1-12 (Jan-Dec) [suppl. Index 1989]
1990: Vol. 16/1-12 (Jan-Dec)
1991: Vol. 17/1-12 (Jan-Dec)
1992: Vol. 18/1-12 (Jan-Dec)
1993: Vol. 19/1-12 (Jan-Dec)
1994: Vol. 20/1-12 (Jan-Dec)
1995: Vol. 21/1-12 (Jan-Dec)
1996: Vol. 22/1-12 (Jan-Dec)
1997: Vol. 23/1-12 (Jan-Dec)
1998: Vol. 24/1-12 (Jan-Dec)
1999: Vol. 25/1-12 (Jan-Dec)
2000: Vol. 26/1-11 (Jan-Dec)
2001: Vol. 27/1-12 (Jan-Dec)
2002: Vol. 28/1-12 (Jan-Dec)
2003: Vol. 29/1-12 (Jan-Dec)
2004: Vol. 30/1-12 (Jan-Dec)
2005: Vol. 31/1-12 (Jan-Dec)
2006: Vol. 32/1-12 (Jan-Dec)
2007: Vol. 33/1-10/12 (Jan-Oct/Dec)
2008: Vol. 34/1/3-10/12 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2009: Vol. 35/1/3 -10/12 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2010: Vol. 36/1/3-10/12 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2011: Vol. 37/1/3-10/12 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2012: [magazine changed to Online / pdf format; only one print edition per year]
2013: Vol. 39 (Annual Eddition) |
CADENZAS – P-601
Quarterly Newsletter of Trumpeter Marvin Stamm
USA
1993: Vol. 1/1 (Fall)
1994: Vol. 1/2-4 (Winter, Spring, Summer); Vol. 2/1 (Fall)
1995: Vol. 2/2-4 (Winter-Summer); Vol. 3/1 (Fall), 3/2 (Winter)
1996: Vol. ¾ (Spring); Vol. 4/1-2 (Summer/Fall)
1997: Vol. 4/4 (Spring); Vol. 5/1 (Fall)
1998: Vol. 5/4 (Fall)
1999: Vol. 6/1 (Winter) |
CAHIERS DU JAZZ, Les – P-36
France
1960’s: #1, 2, 4, 6, 8-10, 11-17 [no year]
1994: #1-4 (new series)
1995: #5-6
1996: #7-9
1997: #10-12
2001: #1 (new series)
2004: #1 (new series)
2005: #2 (new series)
2006: #3 (new series)
2007: #4 (new series)
2008: #5 (new series)
2009: #6 (new series)
2010: #7 (new series)
2011: #8 (new series)
2012: #9 (new series)
2013: #10 (new series) |
(CALIFORNIA) JAZZ NOW – P-37
USA
1991: Vol. 1/1-7 (May-Dec)
1992: Vol. 1/8-10 (Feb-Apr); Vol. 2/1-8 (May-Dec)
1993: Vol. 2/9-11 (Jan-Mar); Vol. 3/1-8 (Apr-Dec)
1994: Vol. 3/9-11 (Feb-May); Vol. 4/1-8 (Jun-Dec)
1995: Vol. 4/9-11 (Feb-Apr); Vol. 5/1-4 (May-Aug), 6-8 (Oct-Dec/Jan) [complete]
1996: Vol. 5/9 (Feb); Vol. 6/1 (May), 7-8 (Nov/Jan) [complete]
1997: Vol. 6/9-11 (Feb-Apr); Vol.7/1-2 (May-Jun), 4-8 (Jul/Aug-Dec/Jan) [complete]
1998: Vol. 7/9-11 (Feb-Apr); Vol. 8/1-8 (May-Dec/Jan)
1999: Vol. 8/9-11 (Feb-Apr); Vol. 9/1-8 (May-Dec/Jan)
2000: Vol. 9/9-10 (Feb-Mar) |
CALL BOY, The – P-747
England
1968: Vol. 5/2-4 (Mar-Dec)
1969: Vol. 6/1 (Mar), 3 (Sep) |
CAPITOLIUM – P-628
Mitteilungen rund um das Sammeln von Schallplatten, Phonographen und anderen Musikapparaten
Switzerland
1992: #1 (Sep)
1993: #2 (Jun)
1994: #3 (Jun)
1995: #4 (Jun)
1996: #5 (Jun)
1997: #6 (Jun) |
CAPITOL NEWS – P-38
(from Hollywood)
USA
1945: Vol 3/5 (May)
1946: Vol 4/2-5 (Feb-May), 10 (Oct)
1947: Vol. 5/11 (Nov)
1948: Vol. 6/3 (Mar), 9 (Sep), 11 (Nov)
1949: Vol. 7/1-2 (Jan-Feb), 8 (Aug), 12 (Dec)
1950: Vol. 8/4 (Apr) |
CASH BOX – P-979
USA
1990: Vol. LIII #40 (Apr 28) |
CAT’S MEOW, THE – P-591
Columbia Jazz Club
USA
[falsche Jahrgangsangaben aus dem Original übernommen]
1966: Vol. 9/1-3 (Jan-Mar), Vol. 10/8 (Sep)
1967: Vol. 11/1 (Mar, 5 (3.Nov)
1968: Vol. 10/2 (Feb), Vol. 12/11 (Nov)
1969: Dec
1974: Mar
1977: Jul, Oct-Nov
1978: Jan-Apr, Nov-Dec
1979: Jan-Mar |
CBMR DIGEST – P-39
USA
1990: Vol. 3/3 (Fall)
1991: Vol. 4/1-2 (Spring-Fall)
1992: Vol. 5/1-2 (Spring-Fall)
1993: Vol. 6/1-3 (Winter-Fall)
2005: Vol. 18/1 (Spring) |
CENTRALSTATION DARMSTADT – P-932
Programmzeitung
Germany
1999: #10-12 (Oct-Dec)
2000: #13-19 (Jan-Dec/Jan)
2001: #20-29 (Feb-Dec/Jan)
2002: #30-38 (Feb-Dec/Jan)
2003: #40-49 (Feb-Dec/Jan)
2004: #50-55 (Feb-Dec/Jan)
2005: #56-60 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2006: #61-65 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2007: #66-71 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2008: #72-76 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2009: #78-80, 82-83 (Jan/Feb-May/Jun,Sep/Oct-Nov/Dec)
2010: #84-89 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2011: #90-95 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2012: #96-100 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2013: #101-107 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2014: #108-112 (Jan/Feb-Nov/Dec)2015: #113-117 (Jan/Feb-Sep/Oct)
2016: #120-124 (Mar/Apr-Nov/Dec)2017: #127 (Mai/Juni)
2018: #136 (Nov)
2019: #138 (Mar/Apr), 142 (Nov/Dec)
2020: #2 (Sep/Oct) |
CENTURY OF JAZZ, The – P-40
An Observer Publication
(Jazz fm)
England
parts 1-8 |
CHANGE INTO JAZZ – P-1004
Germany
1975: Apr |
CHET’S CHOICE – P-41
USA
1991: Vol. 1/0 (premiere issue), 1-3, Special edition 1
1992: Vol. 1/4; Vol. 2/1-3
1993: Vol. 2/4; Vol. 3/1-3
1994: Special edition; Vol. 4/1-3
1995: Special Edition; Vol. 4/4, 5/1-2
1996: Special Edition; Vol. 5/3-4 [periodical ceased publication after Vol. 5/4] |
CHICAGO BLUES ANNUAL – P-42
USA
1992: #4
1994: #6
1995: #7 |
CHICAGO JAZZ MAGAZINE – P-1035
USA
2006: Vol: 5/2 (Mar/Apr) |
CLARE-VOYANCE – P-631
Dedicated to the Music of Clare Fischer
USA
1991: #1-2 (Aug)
1992: #3 (May)
1993: #4-5 (Feb,Dec)
1995: #6 (Mar)
1996: #7 (Feb) |
| CLARINO.PRINT – P-1002
Bläsermusik/ windmusik international
Germany
2003: Vol. 1/1-12
2004: Vol. 2/1-12
2005: Vol. 3/1-12 (Jan-Dec)
2006: Vol. 4/1-12 (Jan-Dec)
2007: Vol. 5/1-12 (Jan-Dec)
2008: Vol. 6/1-12 (Jan-Dec)
2009: Vol. 7/1-12 (Jan-Dec)
2010: Vol. 8/1-12 (Jan-Dec)
2011: Vol. 9/1-12 (Jan-Dec)
2012: Vol. 10/1-12 (Jan-Dec)
2013: Vol. 11/1-12 (Jan-Dec)
2014: Vol. 12/1-12 (Jan-Dec)
2015: Vol. 13/1-12 (Jan-Dec) [supp. Mar: Kohlberg – Standards für Percussion&Ausstattung; supp. September: Jubiläumsausgabe 2015)
2016: Vol. 14/1-12 (Jan-Dec)
2017: Vol. 15/1-12 (Jan-Dec)
2018: Vol. 16/1-12 (Jan-Dec)
2019: Vol. 17/1-11 (Jan-Dec)
Clarino.print fortgesetzt als
BRAWOO – P-1002
Brass | Wood | Orchestra
2020: Vol. 1/1/2-12 (Jan/Feb-Dec)
2021: Vol. 2/1/2-6 (Jan/Feb-Jun) |
CLASSIC RAG, The – P-590
Classic Rag Society of South Western Ohio
USA
1976: Mar-Apr
1977: Nov
1978: Apr
1982: Oct |
CLASSIC WAX – P-567
For Music Lovers Everywhere
USA
1981: #2 (Jan), 4-5 (Aug, Nov) |
CLEF (The Record Collector‘s Guide) – P-923
USA
1946: Vol. 1/6 (Aug) |
CLEVELAND TRADITIONAL JAZZ SOCIETY – P-690
USA
1978: Mar |
CLUB DER SCHELLCKFREUNDE HESSEN
– P-1176
1989 |
CLIMAX MUSIC LTD – P-691
USA
1978: Jan |
COBBLESTONE – P-582
The History Magazine for Young People
USA
1983: Oct (The Jazz Sensation)
1993: May (Duke Ellington. A Musical Genius) |
COBI’S MUSIC NEWS – P-951
News from Universal Jazz Coalition and Jazz Center of New York
USA
2001: Sep |
CODA MAGAZINE – P-43
Canada
1959: Vol. 2/2-3 (Jun-Jul), 2/5-2/8 (Sep-Dec)
1960: Vol. 2/9-11 (Jan-Mar); Vol. 3/1-8 (May-Dec)
1961: Vol. 3/9-12 (Jan-Apr); Vol. 4/1-8 (May-Dec)
1962: Vol. 4/9-12 (Apr-Jul); Vol. 5/1-5 (Aug-Dec)
1963: Vol. 5/6-12 (Jan-Jul); 6/1-5 (Aug-Dec/Jan)
1964: Vol. 6/6-8 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1965: Vol. 6/12 (Feb/Mar); 7/1-5 (Apr-Dec/Jan)
1966: Vol. 7/6-11 (Feb-Dec/Jan)
1967: Vol. 7/12 (Mar); 8/1-4 (May-Nov)
1968: Vol. 8/5-10 (Jan-Dec)
1969: Vol. 8/11-12 (Jan-Mar); 9/1-4 (Jun-Dec)
1970: Vol. 9/5-10 (Feb-Dec)
1971: complete
1972: complete
1973: complete
1974: complete
1975: complete
1976: complete
1977: complete
1978: complete
1979: complete
1980: complete
1981: complete
1982: complete
1983: #188-193
1984: #194-200
1985: complete
1986: complete
1987: #212-217
1988: #218-223
1989: #224-229
1990: #230-235
1991: #236-240
1992: #241-246
1993: #247-252 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1994: #253-258 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1995: #259-264 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1996: #265-270 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1997: #271-276 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1998: #277-282 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1999: #283-288 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2000: #289-294 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2001: #295-300/301 (Jan/Feb-Dec)
2002: #302-306 (Mar/Apr-Nov/Dec)
2003: #307-309 (Jan/Feb-May/Jun)
2004: #315-318 (May/Jun-Nov/Dec)
2005: #319-324 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2006: #325-330 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2007: #331-336 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2008: #337-341 (Jan/Feb-Nov) |
CODA… – P-751
Germany
1997: Vol. 1/1 (Jun) |
COLLECTA, The – P-44
England
1969: #5 (May/Jun)1970: #8-10 (Jan-May/Jun)
1971: #16 (Dez)
1972: #17 (May)
1973: # 19 (Jan), 20 (Juli)
1974: #21-22(Feb, Jul)
1975: #23-24 (Jan-Dec)
1976: #25 (Sep) |
COLLECTOR – P-45
Italy
1967: #3/6 (Mar)
1968: #13-16
1970: #24-26
1974: #36-38
1975/76: #39-40
1981: #46/47 (Dec)
1985: #48/49 (Dec) |
COLLECTORS ITEMS – P-46
England
1980: #1-3 (Aug,Oct,Dec)
1981: #4-9 (Feb,Apr,Jun,Aug,Oct, Dec)
1982: #10-11 (Feb,Apr), #14-15 (Oct,Dec)
1983: #16-20 (Feb,Apr,Jun,Aug,Oct), index
1984: #23 (April) #26-27 (Oct,Dec)
1985: #28-33 (Feb,Apr,Jun,Aug,Oct,Dec)
1986: #34,(?) #35 (April) 36 (Feb,Jun?), #37 (Aug)
#38 (Okt),
1987: #40-43 (Feb,Apr,Jun,Oct)
1988: #45 (Apr/Jun)
1989: #48-51 (Jun-Nov/Dec)
1990: #54-56 (Summer-Dec)
1991: #57-58 (Spring-Summer)
1992: #59 (Jan), 60 (Mar),(62 (Dec)
1993: #63 (Mar)
1994: #66 (Spring), #67 (Sommer), #68 (Fall)
1995: #69 (Frühjahr) |
COLLOQUIUM – P-47
Zeitschrift der freien Studenten Berlins
Germany
1955: Vol. 9/4 [Joachim-Ernst Berendt: Jazz in Deutschland] |
COMBO – P-48
Der aktuelle Nachrichtendienst für den Berufsmusiker
Germany
1949: #7 (6.Jul) [Karl Heiderich: Kurt Edelhagen: “Wer übt, hat’s nötig?”]
#11 (6.Sep) [Hawe: Was ist Bebop?]
#12 (21.Sep) [Hawe: Die Combo – hüben und drüben; Hera: Die Combo-
Orchesterschau stellt vor: Ernst Jäger] |
| Combo – P-1182
Das Musikmagazin
Austria
2017: #1 |
COMMODORE – P-1082
Light music on 78s
England
1972: #7-8 (Fall-Winter)
1973: #9-10 (Spring-Summer) |
CONCERT – P-974
Jazz Special
Germany
1980: #7-8 (Apr/Jun-Herbst)
1981: #9,11
1982: #9 (Sep)
1985: Summer |
CONCERTO -P-994
Austria
1990: #1-4
1991: #1-4
1992: #1-4
1993: #1-4
1994: #1-4
1995: #1-6
1996: #1-6 (Mar/Apr-Dec/Feb)
1997: #2-6 (Apr/May-Dec/Jan)
1998: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1999: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2000: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2001: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2002: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2003: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2004: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2005: #1-6 (Jan/Feb-Dec/Jan)
2006: #1-6 (Jan/Feb-Dec/Jan)
2007: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2008: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2009: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2010: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2011: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2012: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2013: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2014: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2015: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2016: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2017: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2018: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2019: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2020: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2021: #1-2 (Feb/Mar-Apr/May) |
CONNECTICUT JAZZ NEWS – P-718
Connecticut Traditional Jazz Club
USA
1969: Dec
1970: Spring-Summer |
CONSTANZE – P-49
Germany
1953: Vol. 6/3 (Feb) [NN: Hören auch Sie schräge Musik?]
Vol. 6/5 (Mar) [NN: Hier wird auch Ihnen: Heiß und kalt!] |
CONTEMPORARY MUSIC REVIEW – P-998
England
2001: Vol.20 (1) |
CORNET – P-50
Germany
1972: Vol. 1, #1-7
1973: Vol. 2, #8-13
1974: Vol. 3, #14-17
1975: Vol. 4, #18-22
1976: Vol. 5, #23-27
1977: Vol. 6, #28-31
1978: Vol. 7, #32-35
1979: Vol. 8, #36-39
1980: Vol. 9, #40-43/44
1981: Vol. 10, #45-47
1982: Vol. 11, #48-51
1983: Vol. 12, #52-55
1984: Vol. 13, #56-58
1985: Vol. 14, #59-60 |
COS Radicalism in Music – P-988
Japan
1988: #1 (Nov)
1998: #2 (May) |
CRACKLE, THE – P-51
Improvised Music in Transition
USA
1976: #3 (autumn)
1977-78: #4
1979: #5 |
CRC Jazz Journal – P1076
USA
1988: Vol. 14/4 (Sep/Dec)
1989: Vol. 15/1-2 (Jan/Mar-Apr/Jul) |
CRC NEWSLETTER – P-52
USA
1975: Vol. 1/1-4
1976: Vol. 2/1-4
1977: Vol. 3/3-4
1978: Vol. 4/1-4
1979: Vol. 5/1-3
1980: Vol. 6/1, 3, 4
1981: Vol. 7/3
1982: Vol. 8/1, 3, 4
1983: Vol. 9/1-2, 3, 4
1984: Vol. 10/1-2, 3, 4
1985: Vol. 11/3, 4
1986: Vol. 12/1-2, 3,
1987: Vol. 13/1-2, 3, 4
1988: Vol. 14/1, 2, 3 |
CREATIVE WORLD – P-547
The Creative World of Stan Kenton
USA
1970: Vol. 1/1-2 [als “The Kenton Era” bzw. “Creative World News”]
1971: Vol. 2/1 (Nov) [als “Creative World Bulletin and Catalogue”]
1972: Vol. 2/2-6 (Feb, May, Jul, Sep, Jul-Sep, Nov, Dec) [als “Creative World Bulletin and Catalogue”, z.T. mehrfache Nummernvergabe]
1973: Vol. 3/1-4 (Feb, Feb-May, May, Jul, Jul, Oct) [als “Creative World Bulletin and Catalogue” bzw. “Creative World”, z.T. mehrfache Nummernvergabe]
1974: Vol. 4/1-4
1975: Vol. 5/1,4
1976: Vol. 6/1-2
1977: Vol. 7/1
1978: Vol. 8/1 |
CRESCENDO & JAZZ MUSIC – P-53
England1962: komplett (Jul.1962-Jun/Jul.2005 als
[digi.copy])
1964: Vol. 3/3-5 (Oct-Dec)
1965: Vol. 3/1-7 (Jan-Juli), 3/9-12 (Apr-Jul),
Vol. 4/8-9 (Aug-Sep), Vol. 4/9-12 (Sep-Dez)
1966: Vol. 5/4 (Nov)
1967: Vol. 5/6 (Jan), 5/1, 5/2, 5/7 Febr), 6/3-5 (Oct-Nov)
1968: Vol. 6/6 (Jan), 6/6 (Jan), 6/6 (Febr), 6/10 (May),
1969: Vol. 7/9 (Apr)
1975: Vol. 14/5 (Jul)
1982: Vol. 21/3 (Nov)
1983: Apr, May, Jun-Nov
1984: Feb/Mar
1985: Jun/Jul-Dec/Jan
1994: Vol. 31/4 (Aug/Sep)
1996: Vol. 33/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1997: Vol. 34/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1998: Vol. 35/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1999: Vol. 36/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2000: Vol. 37/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2001: Vol. 38/1-2 (Feb/Mar-Apr/May), 4-6 (Aug/Sep-Dec/Jan)
2002: Vol. 39/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2003: Vol. 40/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2004: Vol. 41/1-4,6 (Feb/Mar-Aug/Sep,Dec/Jan)
2005: Vol. 42/1,3,5 (Feb/Mar,Jun/Jul,Oct/Nov) |
CRESCENDO, The – P-54
USA
1927: Vol. 20/1 (Jul)
1928: Vol. 20/11 (May)
1929: Vol. 21/10 (Apr), 12 (Jun); Vol. 22/3-4 (Sep-Oct)
1933: Vol. 25/10 (Oct) |
Critical Inquiry – P-992
USA
2002: Vol. 28/3 (Spring) |
CRESCENDO INTERNATIONAL the Musicia’s viewpoint) – P-1158
1967: Nov.
1968: Jan/Febr1970: März |
CROSBY COLLECTOR, The – P-55
England
1970: Vol. 5/1 (#53), 5 (#57)
1971: Vol. 6/1 (#63), 5 (#60)
1972: Vol. 6/2 (#64), 5 (#67) |
CUADERNOS DE JAZZ – P-56
Spain
1990: Vol. 1/1-2
1991: Vol. 1/3-6, Vol. 2/1 (Nov-Dec)
1992: Vol. 2/8-13 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1993: Vol. 3/14-19 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1994: Vol. 4/20-25 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1995: Vol. 5/26-28 (Jan/Feb-Jul/Aug), 30-31 (Sep/Oct-Nov/Dec)
1996: Vol. 6/32-37 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1997: Vol. 7/38-43 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1998: Vol. 8/44-49 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1999: Vol. 9/50-55 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2000: Vol. 10/56-61 (Jan/Feb-Nov/Dec), suppl. Index 1999-2000
2001: Vol. 11/62-67 (Jan/Feb-Nov/Dec), suppl. Record Review Index 1990-2000
2002: Vol. 12/68-73 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2003: Vol. 13/74-79 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2004: Vol. 14/80-85 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2005: Vol. 15/86-91 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2006: Vol. 17/92-97 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2007: Vol. 18/98-103 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2008: Vol. 19/104-109 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2009: Vol. 20/110-115 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2010: Vol. 21/116-117 (Jan/Feb-Mar/Apr) |
CURRENT MUSICOLOGY – P-975
USA
2000: #69 (Spring)
2001-2002: #71-74 (Spring 2001 – fall 2002) |
CUT – P-512
Magazin für Wohlklang
Switzerland
1983: #10 (Oct) |
DANCE MUSIC ANNUAL – P-57
England
1951 |
DANCING USA – P-58
USA
1992: Vol. 10/1 (Jan/Feb) |
DANISH MUSIC REVIEW – P-633
Danmark
1994: #1 |
DARMSTÄDTER KULTURANNUAL – P-59
Germany
1991: #1 [Wolfram Knauer: Größte europäische Jazzsammlung im Internationalen Jazz-Institut Darmstadt; Wolfram Knauer: Spontaneität und Komposition. 2. Darmstädter Jazzforum im September]
1992: 5.Feb [Wolfram Knauer: Jazz – live in Darmstadt]
1993: #3 [Wolfram Knauer: Jazz in Europa – europäischer Jazz] |
DAVE BRUBECK QUARTET NEWSLETTER – P-610
USA
1994: Vol. 12/1 (Summer/Fall)
1995: Vol. 12/2-3 (Winter/Spring-Summer/Winter)
1996: Vol. 13/1-4 (Winter/Summer-Winter)
1997: Vol. 14/1 (Spring/Summer), 14/4 (Winter/Spring)
1998: Vol. 15/1 (Spring/Fall)
1999: Vol. 16/1-2 (Winter/Spring-Summer/Fall) |
DAYBREAK EXPRESS – P-755
(Archives Center, National Museum of American History)
USA
1995: Vol. 1/2 (Fall)
1996: Vol. 2/1-2 (Spring-Fall)
1997: Vol. 3/1 (Spring) |
DAY IN DAY OUT – P-60
Germany
1989: #1-3
1990: #4-6 (complete) |
DELAWARE VALLEY JAZZ FRATERNITY – P-689
USA
Newsletter:
1978: Mar, Apr |
DEMS BULLETIN – P-441
(Duke Ellington Music Society)
Sweden
1979: #1-5
1980: #1-4
1981: #1-5
1982: #1-5
1983: #1-4
1984: #1-5
1985: #1-4
1986: #1-4
1987: #1-4
1988: #1-5
1989: #1-4
1990: #1-4
1991: #1-5
1992: #1-4
1993: #1-4
1994: #1-4
1995: #1-3 (Jun-Dec)
1996: #1-2 (Dec-Feb)
1997: #1-4 (Mar/May-Dec/Feb)
1998: #1-4 (Mar/May-Dec/Feb)
1999: #2-5 (Mar/May-Dec/Feb)
2000: #1-4 (Mar/May-Dec/Feb)
2001: #1,3 (Apr/Jul, Dec/Feb)
2002: #1-3 (Apr/Jul-Dec/Mar)
2003: #1-3 (Apr/Jul-Dec/Mar) [2003/03 (Dec/Mar) is the last issue in print; DEMS is continued on internet] |
DENVER JAZZ CLUB NEWS, THE – P-588
USA
1970: Feb-Apr
1971: Apr
1973: Nov
1974: Jan, Feb
1976: Apr |
DESCARGA NEWSLETTER – P-793
A Publication for and by Latin Music Listeners
USA
1997: #29 |
DE STEM – P-717
Extra Festival Bulletin
Oude Stijl s Jazz Festival Breda
Netherlands
1979: May |
DER JAZZ CLUB
Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft westdeutsche Jauu-Culbs e.V. (AWJ)
Germany
1967: Vol.?/ 6-7 [Sammlung Pecherstorfer] |
DEUTSCHE ILLUSTRIERTE – P-61
Germany
1958: #39 (27.Sep) [NN: Jazz für Soldaten? Bundesverteidigungsminister Strauß: Diktatoren hassen freie Rhythmen…] |
DIFFERENT DRUMMER – P-1123
The Magazine for Jazz Listeners
USA
1974: Vol. 1/9 (Jul) |
DIG MUSIC – P-1022
Sweden
2004: 1
2005: 2 |
DING, Das – P-484
Internationales Musikmagazin
Deutschland
1980: Vol. 4/7-8 (Jul-Aug) |
The DIPPERMOUTH NEWS – P-1061
The Official Newsletter of the Louis Armstrong House Museum
2004/2005: Vol. 5/1-2 (Fall-Spring) |
DISC – P-629
The Record Magazine
USA
1946: Vol. 1/1-2 (Aug-Sep) |
DISCOGRAPHER, The – P-62
1967: Vol. 1/1
1969: Vol. 1/4 |
DISCOGRAPHICAL AND MICROGRAPHICAL BASICS – P-559
Netherlands
1988: #1 (Sep)
1989: #2-3 (Mar, Jul)
1990: #4 (Feb) |
DISCOGRAPHICAL FORUM – P-63
England
1960: #1-3
1961: #4
1968: #5-9
1969: #10-15
1970: #16-21
1971: #22-27
1972: #28-29
Ohne Jahresangaben: #30-54
2010: #55
2011: #56
2013: #57
2014: #58
2015: #59-602016: #61-62 |
DISCOGRAPHICAL SOCIETY JAZZ BOOKLET – P-332
England
1944: [J.C. Higginbotham]
1945: [Hot Jazz]
1946: [Black and White, Part Two]; July [Eye Witness Jazz, Part Two]
mid-1940s: [New Orleans & Chicago Jazz]
[Eye Witness Jazz]
[Jazz in New York]
late 1940s: [Cream of the White Clarinets] |
DISCO GRAPHIE – P-855
Belgium
1996: #20-21
1997: #22-23 (Jun,Aug)
1998: #24 |
DISCOGRAPHIE – P-1125 Germany
1982: #2 |
DISCOPHILE, The – P-64
England
1948: #1
1949: #5-9
1950: #12-15
1951: #16-19, 21
1952: #22, 24-27
1953: #28-33
1954: #34-39
1955: #40
1956: #46-511957: #52-58
1958: #59-61 |
DISK – P-65
Netherlands
1961: #2 (Oct) |
DISK IN THE WORLD – P-497
Japan
1981: #2-3 (Jan, Jun) |
DISKUSSIONSFORUM JAZZ BONN – P-462
Germany
1975: #1 (May)
1977: #4 (Sep)
1978: #5 (Jan), 6 (May) |
DIVERSE NEWS – P-696
England
1995: Autumn |
DIXIE-BEAT – P-589
Valley Dixieland Jazz Club
USA
1970: Vol. 1/9-11 |
DIXIE FLYER – P-623
The Society for the Preservation of Dixieland Jazz
USA
1968: Jul
1969: Jul, Sep-Dec
1970: Jan, May-Jul, Sep-Oct
1971: Vol. 9/1-2 (Jan-Feb), 9/4-5 (Apr-May), 9/10 (Oct), 9/12 (Dec)
1972: Vol. 10/1-2 (Jan-Feb), 10/6 (Jun), 10/9 (Sep)
1973: Vol. 11/4 (Apr), 11/6 (Jun), 11/7 (Jul), 11/10 (Oct), 11/12 (Dec)
1978: Vol. 17/3 (Mar), Aug, Vol. 17/1 (Nov) |
|
DIXIELAND HALL – P-702
Deutschland
Newsletter
1993: Oct, Nov, Dec
1994: # 1-12 (Jan-Dec)
1995: # 1-12 (Jan-Dec)
1996: # 2-7 (Feb-Jul), Oct-Nov/Dec
|
DMR INTERN -P-1012
Verbandsinformationen des Deutschen Musikrats
Germany
2004: #01(Jan-Mar)-02 (Jul)
2005: #01 (Mar) |
DOBELL’S BOOK CATALOGUE – P-66
England
ca. 1960 |
DOBELL’S BULLETIN – P-67
England
1960: #2-3 (Apr-May), 5 (Jul), 8 (Oct), 10 (Dec)
1961: #11-12 (Jan-Feb) |
DOBELL’S NEWS – P-68
England
1958: Vol. 1/2-7
1959: Vol. 1/8-9, 11 |
DOCTOR JAZZ (Dr. Jazz) – P-72
[als Fotokopie vorhanden: #77, #79-82, #85, #87-88, #96, #100, #105]
1963: #1-5
1964: #7-10
1965: #11-14
1966: #17-22
1967: #23-29
1968: #30-33
1969: #34-39
1970: #40-45
1971: #46-51
1972: #52-57
1973: #58-63
1974: #64-69
1975: #70-74/75
1976: #76-78
1977: #79-82
1978: #83-84
1980: #92 (Jun)
1985: #108 (Apr)
1987: #116-119 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1988: #120-123 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1989: #124-127 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1990: #128-131 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1991: #132-134 (Mar,Jun,Sep)
1992: #136-139 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1993: #140-143 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1994: #144-147 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1995: #148-151 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1996: #152-155 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1997: #156-159 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1998: #160-163 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1999: #164-167 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2000: #168-171 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2001: #172-175 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2002: #176-179 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2003: #180-183 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2004: #184-187 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2005: #188-191 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2006: #192-195 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2007: #196-199 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2008: #200-203 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2009: #204-207 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2010: #208-211 (Jan,Jun,Sep,Dec)
2011: #212-215 (Jan,Jun,Sep,Dec)
2012: #216-219 (Jan,Jun,Sep,Dec)
2013: #220-223 (Jan,Jun,Sep,Dec)
2014: #224-227 (Jan,Jun,Sep,Dec)
2015: #228-231 (Jan,Jun,Sep,Dec)
2016: #232-235 (Jan,Jun,Sep,Dec)
2017: #236-239 (Jan,Jun,Sep,Dec)
2018: #240-243 (Jan,Jun,Sep,Dec)
2019: #244 (Jan), 245 (Jun), 246 (Sep), 247 (Winter)
2020: #248-251 (Spring-Winter)
2021: #252 (Spring) |
DOSIERTE LEBEN, DAS -P-1128
Das Avant-Avantgarde-Magazin
Germany
2014: #19/105 (May) |
DOWN BEAT – P-69
USA
1935: Vol. 2/8 (Aug), 11 (Nov)
1936: Vol. 3/1 (Dec/Jan)
1937: Vol. 4/8-10 (Aug-Oct), 12 (Dec)
1938: Vol. 5/1-10 (Jan-Oct), 12 (Dec) [Xerox-Sicherung: Sep, Sep]
1939: Vol. 6/1-9 (Jan-Sep), 10-15 (1.Oct-15.Dec) [Xerox-Sicherung: Jun, Sep, 1.Nov]
1940: Vol. 7/1-20 (1.Jan-15.Oct) [Xerox-Sicherung: 15.Feb, 1.May, 1.Aug]
1941: Vol. 8/1-9 (1.Jan-1.May), 11-24 (1.Jun-15.Dec) [Xerox-Sicherung: 15.Mar, 1. May, 1.Jul, 15.Jul, 1.Aug]
1942: Vol. 9/1 (1.Jan), 4-6 (15.Feb-15.Mar), 8-14 (15.Apr-15.Jul), 16-24 (15.Aug-15.Dec)
1943: Vol. 10/1-15 (1.Jan-1.Aug), 16-21 (15.Aug- 1.Nov), 23-24 (1.-15. Dec) [Xerox-Sicherung: 1.Aug.]
1944: Vol. 11/1-24 [complete volume]
1945: Vol. 12/1-24 [except #3 (1.Feb), 17 (1.Sep), 19 (1.Oct); Overseas Edition: Vol. 12/13 (1.Jul), 12/16 (Aug), 20-21 (15.Oct-1.Nov), 24 (15.Dec)
1946: Vol. 13/1-2 (1.-14.Jan), 13/4-7 (11.Feb-25.Mar), 13/9 (22.Apr), 13/11-13 (20.May-17.Jun), 13/16-23 (29.Jul-4.Nov), 25 (2.Dec); Overseas Edition: Vol. 13/2 (14.Jan), 7 (25.Mar), 21 (7.Oct), 23 (Nov), 24(15.Dec) [Xerox-Sicherung: 1.Jan, 25.Feb]
1947: Vol. 14/1 (1.Jan),14/8 (9. Apr), 13-14 (18.Jun-2.Jul), 16-17 (30.Jul-13.Aug), 22 (22.Oct), 24-25 (19.Nov-3.Dec), 28-29 (17.-31.Dec) [wrong numbering for last issue] [Xerox-Sicherung: 13.Aug]
1948: Vol. 15/1-26 (14.Jan-29.Dec)
1949: Vol. 16/1-25 (14.Jan-30.Dec)
1950: Vol. 17/1-26 (13.Jan-29.Dec)
1951: Vol. 18/1-26
1952: Vol. 19/1-26 [Xerox-Sicherung: 22.Feb, 4.Jun]
1953: Vol. 20/1-26 [Xerox-Sicherung: 23.Sep]
1954: Vol. 21/1-26
1955: Vol. 22/1-26
1956: Vol. 23/1-26
1957: Vol. 24/1-26
1958: Vol. 25/1-26
1959: Vol. 26/1-26
1960: Vol. 27/1-26
1961: Vol. 28/1-26
1962: Vol. 29/1-13 (21.Jun), 20 (5.Jul)-31 [wrong numbering, complete volume]; Vol. 29/26 (Okt)
1963: Vol. 30/1-32 [wrong numbering, complete volume]
1964: Vol. 31/1-33 [wrong numbering, complete volume]
1965: Vol. 32/1-27
1966: Vol. 33/1-26
1967: Vol. 34/1-26
1968: Vol. 35/1-26
1969: Vol. 36/1-26 [7.Aug: p. 9-10 missing]
1970: Vol. 37/1-26
1971: Vol. 38/1-22
1972: Vol. 39/1-21
1973: Vol. 40/1-21
1974: Vol. 41/1-21
1975: Vol. 42/1-21
1976: Vol. 43/1-21
1977: Vol. 44/1-21
1978: Vol. 45/1-21
1979: Vol. 46/1-18
1980: Vol. 47/1-12 (Jan-Dec)
1981: Vol. 48/1-12 (Jan-Dec)
1982: Vol. 49/1-12 (Jan-Dec)
1983: Vol. 50/1-12 (Jan-Dec)
1984: Vol. 51/1-12 (Jan-Dec)
1985: Vol. 52/1-12 (Jan-Dec)
1986: Vol. 53/1-12 (Jan-Dec)
1987: Vol. 54/1-12 (Jan-Dec)
1988: Vol. 55/1-12 (Jan-Dec)
1989: Vol. 56/1-12 (Jan-Dec)
1990: Vol. 57/1-12 (Jan-Dec)
1991: Vol. 58/1-12 (Jan-Dec)
1992: Vol. 59/1-12 (Jan-Dec)
1993: Vol. 60/1-12 (Jan-Dec)
1994: Vol. 61/02 (Feb), 61/09 (Sep), 61/12 (Dec)
1995: Vol. 62/2 (Feb), 62/4 (Apr)
1998: Vol. 65/1-12 (Jan-Dec)
1999: Vol. 66/1-12 (Jan-Dec)
2000: Vol. 67/1-12 (Jan-Dec)
2001: Vol. 68/1-12 (Jan-Dec)
2002: Vol. 69/1-12 (Jan-Dec)
2003: Vol. 70/1-12 (Jan-Dec)
2004: Vol. 71/1-12 (Jan-Dec)
2005: Vol. 72/1-12 (Jan-Dec)
2006: Vol. 73/1-12 (Jan-Dec)
2007: Vol. 74/1-12 (Jan-Dec)
2008: Vol. 75/1-12 (Jan-Dec)
2009: Vol. 76/1-12 (Jan-Dec)
2010: Vol. 77/1-12 (Jan-Dec)
2011: Vol. 78/1-12 (Jan-Dec)
2012: Vol. 79/1-12 (Jan-Dec)
2013: Vol. 80/1-12 (Jan-Dec)
2014: Vol. 81/1-12 (Jan-Dec)
2015: Vol. 82/1-12 (Jan-Dec)
2016: Vol. 83/1-12 (Jan-Dec)
2017: Vol. 84/1-12 (Jan-Dec)
2018: Vol. 85/1-12 (Jan-Dec)
2019: Vol. 86/1-12 (Jan-Dec)
2020: Vol. 87/1-12 (Jan-Dec)
2021: Vol. 88/1-5 (Jan-May) |
DOWN BEAT YEARBOOK – P-70
USA
1956: Vol. 1
1957: Vol. 2
1958: Vol. 3
1959: Vol. 4
1960: Vol. 5
1961: Vol. 6
1962: Vol. 7
1963: Vol. 8
1964: Vol. 9
1965: Vol. 10
1966: Vol. 11
1967: Vol. 12
1968: Vol. 13
1969: Vol. 14
1970: Vol. 15
1971: Vol. 16
1972: Vol. 17
1973: Vol. 18
1974: Vol. 19
1975: Vol. 20
1976: Vol. 21
1978: Vol. 23
1980: Vol. 25 |
DOWNBEAT’S YEARBOOK OF SWING – P-71
USA
1939 |
DRESDNER JAZZSZENE – P-562
East Germany
1981: #2 |
DRUMMER, Der – P-73
Germany
1953: #1-4
1954: #5-8
1955: #9-11
1956: #12
1957: #13-16
1958: #17-18 |
DRUMMER SCOPE – P-471
USA
1956: Vol. 1/1-3 (May-Jul), 5-8 (Sep-Dec)
1957: Vol. 1/9 (Jan), Vol. 2/2 (Feb) |
DRUMS AND PERCUSSION – P-74
USA
1975: Vol.1/12 (Autumn/Winter) |
DU – P-75
Switzerland
1989: #8 (Aug) [special issue on Miles Davis]
1991: #5 (May) [special issue on John Cage]
1992: #4 (Apr) [special issue: Body and Soul. Die großen Sängerinnen des Jazz]
1994: #3 (Mar) [special issue on Thelonious Monk]
1995: #5 (May) [special issue: Friedrike Mayröcker, Ernst Jandl: An den Rändern der Sprache]
1996: #5 (May) [special issue: Zeit für neue Musik],
#12 (Dec) [special issue on Max Roach]
1998: #7 (Jul) [special issue: Tenor Saxophon]
2002: #723 (Feb) [special issue on Charles Mingus],
2010: #808 (Jul/Aug) [special issue on Montreux Jazz Festiva] |
The DUKE ELLINGTON SOCIETY – P-1060
Celebrating the Music of Duke Ellington
2008: Feb |
DUKE ELLINGTON SOCIETY OF SWEDEN (DESS) – P1071
Sweden
2006: Vol. 13/1 (Mar), 3 (Sep) |
EAR – P-481
Magazine of New Music
USA
1980: Vol. 5/5 (Apr/May)
1985: Vol. 9/5+10/1 (Fall)
1986: Vol. 11/1-2 (Sep-Oct), 4 (Dec/Jan)
1987: Vol. 12/3 (May), 6 (Sep), 8 (Nov)
1988: Vol. 13/2 (Apr), 6-7 (Sep-Oct)
1989: Vol. 13/10 (Feb)
1991: Vol. 16/1-2 (Apr-May) |
EARSHOT – P-570
A Mirror and Focus for the Jazz Community
USA
1993: Vol. 9/7-8 (Aug-Sep) |
EAST VILLAGE EYE – P-505
USA
1984: Sep |
EBONY – P-434
USA
1959: Nov-Dec [digi.copy]
1960: Jan-Dec [digi.copy]
1961: Jan-Dec [digi.copy]
1962: Jan-Dec [digi.copy]
1963: Jan-Dec [digi.copy]
1964: Jan-Dec [digi.copy]
1965: Vol. 20/10 (Aug) [special issue: The White Problem in America]
1969: Jul [digi.copy] |
ECOUTER VOIR – P-959
l’information des professionnels de la diffusion musicale
France
1998: #98 (Feb) |
ELEGANTE WELT – P-76
Germany
1952: Vol. 41/7 (Jul) [K.W.: Karrieren begannen… bei Los Angeles (Yma Sumac)]
1955: Vol. 44/11 (Nov) [Joachim-Ernst Berendt: Der Swing ist wieder da] |
ELLE – P-77
Germany
1971: #4 (15.Feb) [Joachim-Ernst Berendt: Jazz] |
ELLINGTONIA – P-1055
(A Publication of The Duke Ellington Society)
USA
2007: Vol.15/8 (Nov)
2008: Vol. 16/2 (Feb) |
ELMORE – P-1032
Saving American Music
USA
2006: #6-7 (Jan/Feb-Mar/Apr) |
EMMA – P-77
Das Magazin von Frauen für Frauen
1989: #3 (Mar) [Viola Roggenkamp: Frauen im Jazz] |
ENSEMBLE – P-78
The Newsletter of International Jazz Friends
England
1967: #8 (Oct/Dec)
1968: #10-11 (Apr-Jun) |
EPOCA – P-789
(Die neue deutsche Zeitschrift)
Germany
1964: Vol. 2/1 (Jan)
1965: Vol. 7 (Jul)
1966: Vol. 5 (May) |
ER – P-79
Die Zeitschrift für den Herrn
Germany
1953: Vol. 4/12 (Dec) [book review on Laade, Ziefle, Zimmerle: “Jazzlexikon”]
1954: Vol. 5/11 (Nov) [Adrian Vellbert: Bei Jazz fällt alle Schwere ab] |
ESQUIRE – P-438
1959: Vol. 51/1 (Jan) [Sonderheft: The Golden Age of Jazz] |
ESQUIRE’S JAZZ BOOK – P-80
USA
1944
1945
1946 |
ESTRAD – P-1036
Tidskrift för den moderna dansmusiken
Sweden
1939: Vol. 1/1 (Jan), 3-12 (Mar-Dec)
1940: Vol. 2/1-8 (Jan-Aug), 10-12 (Oct-Dec)
1941: Vol. 3/1-7 (Jan-Jul), 10 (Oct), 12 (Dec)
1943: Vol. 5/1-12 (Jan-Dec)
1944: Vol. 6/1-3 (Jan-Mar), 6 (Juni), 9 (Sep), 11 (Nov)
1945: Vol. 7/1 (Jan), 3 (Mar), 7/5-10 (May-Oct)
1946: Vol. 8/3 (Mar), 7-9 (Jul-Sep), 11-12 (Nov-Dec)
1947: Vol. 9/5-6 (May-Jun), 9 (Sep)
1948: Vol. 10/9-10 (Sep-Oct)
1949: Vol. 11/2 (Feb), 11/5-6 (May-Jun), 11/8 (Aug), 10-11 (Oct-Nov)
1950: Vol. 12/1-12 (Jan-Dec)
1951: Vol. 13/2-5, 9 (Jan-May, Sep)
1952: Vol. 14/1, 10 (Jan, Oct)
1953: Vol. 15/1,3-4,7-8,11 (Jan, Mar-Apr,Jul-Aug,Nov)
1954: Vol. 16/4,10 (Apr,Oct)
1955: Vol. 17/1,3,6,9-10 (Jan, Mar, Jun, Sep-Oct)
1956: Vol. 18/2,5-9,11 (Feb, May-Sep,Nov)
1957: Vol. 19/2, 5-6,9 (Feb,May-Jun,Sep)
1958: Vol. 20/1-2,4,7/8,10-12
1959: Vol. 21/2-3,11
1962: Vol. 24/1-2, 4-12 (Jan-Feb, Apr-Dec)
1963: Vol. 25/1 |
ETUDE MUSIC MAGAZINE – P-734
USA1930: vol. 48/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1931: vol. 49/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1932: vol. 50/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1933: vol. 51/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1934: vol. 52/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1935: vol. 53/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1936: vol. 54/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1937: vol. 55/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1938: vol. 56/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1939: vol. 57/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1940: vol. 58/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1941: vol. 59/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1942: vol. 60/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1943: vol. 61/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1944: vol. 62/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1945: vol. 63/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1946: vol. 64/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1947: vol. 65/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1948: vol. 66/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1949: vol. 67/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1950: vol. 68/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1951: vol. 69/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1952: vol. 70/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1953: vol. 71/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1954: vol. 72/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1955: vol. 73/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1956: vol. 74/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy]
1957: vol. 75/1-12 (Jan-Dec) [digi.copy] |
EUROJAZZ REVIEW – P-635
England
1994: #1-2 (Aug, Nov) |
EUROPA-ARCHIV – P-472
Germany
1946: Vol. 1/2 (Aug) [NN: Die Geschichte des Jazz] |
EUROPEAN JAZZ FEDERATION,
Wien, Austria -P-1165 (Swinging Newsletter)
1972: #2 (Dez)
1976: #23 (Feb) |
EVANGELISCHER FILMBEOBACHTER – P-726
(Der Plattenteller)
Germany
1962: Vol. ¾,12, Register
1964: Vol. 5/3
1965: Vol. 17/ 29, 31, 33 |
EVANSVILLE AREA JAZZ CLUB, THE – P-688
USA
1973: 14.Mar |
EXAMINER MAGAZINE – P-731
San Francisco
1994: Oct (23.) |
EX LIBRIS – P-81
Germany
1967: #3 (Mar) [Joachim-Ernst Berendt: Die Avantgarde und das Chaos] |
EXPANSIONS – P-891
(The Collective Black Artists’ Newsletter)
USA
1975: Winter |
EXPRESSION – P-480
Das Internationale Magazin für American Express Mitglieder
Germany
1993: Vol. 9/1 (Feb/Mar) [Jos’phine Pannard: Jazz-Revival; kurze Festival-Liste] |
EXTEMPORE – P-1068
Australia
2008: #1 (Nov)
2009: #2-3 (May,Nov)
2010: #4-5 (May, Nov) [#5 = last issue] |
FABLE BULLETIN – P-850
Violin Improvisation Studies
England
1993: #1-2
1994: #3-4
1995: #5-7
1996: #8
1997: #9
1998: #10
1999: #11
2000: suppl. #1-11 |
FACHBLATT MUSIKMAGAZIN – P-82
Germany
1982: #11-12
1983: #1, 4, 7, 10
1984: #7
1985: #1, 5-7, 9-10, 12
1986: #1-12
1987: #4, 6
1988: #1, 12
1989: #1
1991: #2, 7 |
FANFARE – P-83
(Southern California Hot Jazz Society)
before 1969: info sheets
USA
1964: 1 issue (Apr)
1969: Vol. 1/1,4,5,7 (Jan, Apr, May, Jul), 1/8-12 (Aug-Dec)
1970: Vol. 2/2 (Feb), 4-10 (Apr-Oct)
1971: Vol. 3/1-2 (Jan-Feb), 4-10 (Apr-Oct)
1972: Vol. 4/1 (Jan), 3-4 (Mar-Apr)
1973: Vol. 5/3-5 (Mar-May), 5/7 (Jul), 5/11 (Nov) |
FAZ MAGAZIN – P-84
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Germany
1983: #196 (2.Dec) [Ulrich Olshausen: Miles Davis. Meister des Hardbop: Miles Davis, Trompeter wie
Boxer – unnahbar]
1985: #285 (16.Aug) [Ulrich Olshausen: Ein Orchester in der Kehle. Al Jarreau, der Jazzsänger in
Deutschland (Jarreau on cover)]
1988: #429 (20.May) [Wolfgang Sandner: Jazz (Jazz cover)]
#437 (15.Jul) [Wolfgang Sandner: Saxophone lachen nicht]
#445 (9.Sep) [Peter Kemper: Rückkehr zu den Quellen. Der Saxophonist Archie Shepp]
1990: #555 (19.Oct) [Peter Kemper: Pharoah Sanders. Auf der Suche nach dem wahren Ton]
#565 (28.Dec) [Andrian Kreye: Fester Rhythmus, bewegtes Leben: Ginger
Baker (Baker on cover)]
1991: #594 (19.Jul) [Wolfgang Sandner: Über die Einsamkeit des Posaunisten Albert Mangelsdorff
(Mangelsdorff on cover]
#598 (16.Aug) [Karl Steinorth: Gordon Parks. Meister der Fotografie, Kämpfer in der Bilderwelt
(photo of Louis Armstrong)]
1992: #645 (10.Jul) [Andrian Kreye: Der Mann, der dem Jazz die heißen Rhythmen
Kubas brachte (Mario Bauza on cover)]
1995: #793 (12.May) [Wolfgang Sandner: Dave Brubeck/Gerry Mulligan (Mulligan on cover)] |
FEDERATION JAZZ – P-85
USA
1990: Vol. 5/2-3 (May/Jun-Jul/Aug)
1992: Vol. 7/1 (spring/summer)
1993: Vol. 8/1-3 (spring-fall/winter)
1994: Vol. 9/1 (spring)
1995: Vol. 10/1 (spring), 10/2 (Sommer)
1996: Vol. 11/2 (spring), 11/4 (Fall)
1997: Vol. 12/1 (Winter/Spring), 12/3 (Fall) |
FEEDBACK – P-950
Germany
2001: Oct-Nov
2002: Feb-Sep,Nov |
FERNSEH-MAGAZIN – P-86
Germany
1959: Vol. 2/31 (11.-24.Jan) |
FILM – P-87
Germany
1967: Vol. 5/3 (Mar) [Joachim-Ernst Berendt: Plädoyer für den Jazz im Film] |
FILM – RADIO – JAZZ – P-802
Switzerland
1947: #4 (Nov/Dec) |
FILM DIENST – P-928
Germany
2000: 53/18 (29.Aug) |
FILMWOCHE, DIE – P-88
Germany
1951: Vol. 6/43 (27.Oct) [announcement of a report by Joachim-Ernst Berendt in “Hollywood – heute” for
Radio Bremen] |
FINNISH MUSIC QUARTERLY – P-89
Finland
1985: #3-4 [Matti Konttinen: Top Finish Big Bands]
1986: #1 [Jaako Tahkolahti: Oulunkylä Pop / Jazz Institute]2014: #1-3 |
FLIEGENDE HOLLÄNDER, Der – P-90
Zeitschrift für Freunde der KLM
Netherlands
1967: #12 (Summer) [photo of Ella Fitzgerald & Duke Ellington on KLM] |
FLORIDA – P-554
(The Orlando Sentinel)
USA
1993: Vol. 40/16 (18.Apr) [Matt Schudel: South Florida’s Jazz Elite (Ira Sullivan, Flip Phillips, Lonnie Liston
Smith, Red Rodney)] |
FOCUS MSG
England
1964: #1-2 (Feb.-Mar) |
FOLK MAGAZIN – P-1122
Germany
1976: #14 |
FOLKWANG HOCHSCHUL ZEITUNG – P-1040
Germany
1992/93: Vol.6 /13 (Wintersemester) |
FONGI – P-767
(Der wilde Jazzgeist)
Germany
1958: #1 (15.Mar), #2 (15.May), #3 (15.Jul), #4 (15.Sep), #5 (15.Nov)
1959: #1-2; Fongi Kalender
1970: Sonderausgabe (“Der schlaffe Jazzgeist”, zum 20-jährigen Bestehen des Hot Circle Darmstadt) |
FONO FORUM – P-91
Germany
1961: #3
1977: #1-12
1978: #1-12
1979: #1-12
1980: #1-12
1981: #1-12
1982: #1-12
1998: #1-12
1999: #1-12
2000: #1-12
2001: #1-12
2002: #1-12
2003: #1-12
2004: #1-12
2005: #1-12
2006: #1-12
2007: #1-12
2008: #1-12
2009: #1-12 (Fono Forum Special: Piano Festival 4/5 2009)
2010: #1-12
2011: #1-12
2012: #1-12
2013: #1-12
2014: #1-12
2015: #1-12
2016: #1-7 (Jan-Jul) |
FONTES ARTIS MUSICAE – P-92
1989: Vol. 36/3 (Jul-Sep) [special jazz issue] |
FOOTNOTE – P-92
England
1972: Vol. 3/6 (Aug), Vol. 4/2 (Dec)
1973: Vol. 4/3-5 (Feb-Jun), Vol. 5/1 (Oct)
1974: Vol. 5/2-6 (Dec/Jan-Aug/Sep), Vol. 6/1 (Oct/Nov)
1975: Vol. 6/2-5 (Dec/Jan-Jun/Jul), Vol. 7/1 (Oct/Nov)
1976: Vol. 7/3-4 (Feb/Mar-Apr/May)
1977: Vol. 8/3 (Feb/Mar)
1981: Vol. 12/6 (Aug/Sep)
1984: Vol. 16/1 (Oct/Nov)
1985: Vol. 16/2-6 (Dec/Jan-Aug/Sep); Vol. 17/1 (Oct/Nov)
1986: Vol. 17/2-6 (Dec/Jan-Aug/Sep); Vol. 18/1 (Oct/Nov)
1987: Vol. 18/2-5 (Dec/Jan-Jun/Jul)
1989: Vol. 20/6 (Aug/Sep);[continued as]NEW ORLEANS MUSIC
England
1989: Vol. 1/1-2 (Oct/Nov-Dec/Jan)
1990: Vol. 1/3-6 (Feb/Mar-Aug/Sep); Vol. 2/1-2 (Oct/Nov-Dec/Jan)
1991: Vol. 2/3-6 (Feb/Mar-Aug/Sep); Vol. 3/1-2 (Oct/Nov-Dec/Jan)
1992: Vol. 3/3-6 (Mar-Dec)
1993: Vol. 4/1-3 (Mar-Sep)
1994: Vol. 4/5-6 (Mar-Jun); Vol. 5/1-2 (Sep-Dec)
1995: Vol. 5/3-6 (Mar-Dec)
1996: Vol. 6/1-4 (Mar-Dec)
1997: Vol. 6/5-6 (Mar-Jun); 7/1-2 (Sep-Dec)
1998: Vol. 7/3-6 (Mar-Dec)
1999: Vol. 8/1 (Mar)
2000: Vol. 8/5-6 (Mar-Jun); Vol. 9/1 (Sep)
2003: Vol. 10/6 (Jun); 11/1-2 (Sep,Dec)
2004: Vol. 11/3-4 (Mar,Jun)
2006: Vol. 13/2 (Dec)
2007: Vol. 13/3-6 (Mar-Sep) |
FORCED EXPOSURE – P-545
USA
1988: #13 (Winter)
1989: #15 (Summer)
1990: #16
1993: #18 |
FORM – P-93
Internationale Revue
Germany
1958: #2 [Joachim-Ernst Berendt: Das Modern Jazz Quartet] |
FORSCHUNGSZENTRUM POPULÄRE MUSIK NEWS (FPM News) – P-94
Germany (Berlin)
1991: #1-2
1992: #1
1993: #1
1994: #1 |
FORSCHUNGSZENTRUM POPULÄRE MUSIK REPORT – P-95
Germany (Berlin)
1990 |
FORTE – P-96
(Belgium)
1990: Oct [no jazz content]
1992: Feb [no jazz content], Jun [Graham Collier: Schools of Jazz / Ecoles de Jazz]
1993: #1 [no jazz content] |
FORTISSIMO – P-677
Official Publication of the Musicians Society of San Antonio, Local No. 23
USA
1965: Vol. 13/2 (May) |
FOX AUF 78 – P-97
Ein Magazin rund um die gute alte Tanzmusik
Germany
1986: #1-2 (Aug-Dec)
1987: #3-4 (Spring-Fall)
1988: #5-6 (Spring-Fall)
1989: #7 (Summer)
1990: #8 (Spring)
1991: #9 (Winter)
1992: #10 (Herbst-Winter 1991/92), 11 (Herbst 1992)
1993: #12 (Summer)
1994: #13 (Summer)
1995: #14 (Summer)
1996: #15 (Winter/Spring)
1997: #16 (Spring)
1998: #17 (Spring)
1999: #18 (Spring)
2000: #19 (Spring)
2001: #20 (Summer)
2002: #21 (Fall)
2004: #22 (Spring)
2006: #23 (Winter)
2007: #24 (Summer)
2009: #25 (Winter)
2011: #26 (Winter)
2013: #27 (Winter)
2014/15: #28 (Winter)
2016: #29 (Herbst)
2018: #30 (Spring)2020: #31 (Winter 2019/20)
2021: #32 (winter 2020/21) |
FRANKFURTER HEFTE – P-98
Germany
1955: Vol. 10/7 (Jul) [Joachim-Ernst Berendt: Die Improvisation in der Jazzmusik] Vol. 10/11 (Nov) [Joachim-Ernst Berendt & Joachim Heydorn: Schwarz und Weiß in USA]
1970: Vol. 25/5 (May) [Joachim-Ernst Berendt: Den Schwarzen der USA fehlen die Politiker]
1971: Vol. 26/1 (Jan) [Joachim-Ernst Berendt: Die Melodisierung der Freiheit. Gedanken zur Jazz-Entwicklung in den siebziger Jahren]
Vol. 26/12 (Dec) [Joachim-Ernst Berendt: Miles Davis und seine Söhne (I). Zu neuen Jazz-Schallplatten]
1972: Vol. 27/1 (Jan) [Joachim-Ernst Berendt: Miles Davis und seine Söhne (II) ol. 27/7 (Jul) [Joachim-Ernst Berendt: Jazz Goes Europe. I. Die deutsche Szene]
Vol. 27/10 (Oct) [Joachim-Ernst Berendt: Jazz Goes Europe. II. Die englische Szene] |
FRANKFURTER JAZZ-ZEITUNG – P-781
Germany
1981: Vol. 1 (Oct) |
FRAU UND MUSIK – P-99
Germany
1991: #22 (Dec) |
FREEWAY – P-954
The More or Less Quarterly Voice of the Improvised Music Association
1992: Vol. 2/1 (Mar/May); Vol. 2/3 (Jul-Sep)
1993: Vol. 2/5 (Spring) |
FREIBORD – P-527
Literatur – Kunst – Kulturpolitik
Austria
1981: Vol. 6/23 (Sonderheft Jazz/Musik) |
FREIBURGER JAZZHAUS JOURNAL – P-100
Germany
1987: Vol. 1/1
1988: Vol. 2/4 (Apr)
1990: Vol. 3/10
1991: Vol. 5/3-8, 10-12
1992: Vol. 6/1-12
1993: Vol. 7/1-12
1994: Vol. 8/1-12
1995: Vol. 9/1-12
1996: Vol. 10/1-12
1997: Vol. 11/1-12
1998: Vol. 12/1-12 |
FREIBURGER ZEITSCHRIFT FÜR GESCHLECHTERSTUDIEN – P-1121
Germany
2013: Vol. 18/1 (special “Musik & Genderdiskurs”) |
FREISTIL – P-1023
Magazin für Musik und Umgebung
Austria
2005: # 4-5 (Sep,Dec)
2006: #6-8 (Feb,Apr,Jun) #9 (Aug) #10 (Oct) 11 (Dec)
2007: #12-15 (Mar,Mai,Jul,Sep)
2008: #17-20,22 (Feb,Apr,Jun,Aug,Dez)
2009: #23-28 (Feb-Dec/Jan)
2010: #29-32 (Feb/Mar-Aug/Sep)
2011: #35 (Apr/May)-36 (Feb/Mar), 39 (Oct/Nov)- 40 (Dec)
2012: #41-46 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2013: #47-51 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2014: #52-57 (Jan/Feb-Nov-Dec)
2015: #58-62 (Jan/Feb-Sep/Oct) |
FRENCH GUITAR – P-812
France
1997: #1-5 (Mar/Apr-Dec/Jan) |
FUGUE – P-900
USA
1996/1997: #14/15 (Fall/Spring) |
THE FULL SCORE – P-848
England
1999: Spring |
FUNK-FERNSEH-JOURNAL – P-101
Germany
1959: Vol. 6/64 (6.Sep) |
FUNK-ILLUSTRIERTE – P-102
Germany
1952: Vol. 20/18 (27.Apr) [NN: Jazz triumphierte in Paris (review of 2nd Salon International du Jazz)] |
FUNKSTUNDE – P-721
Germany
1937: Vol. 14/10-19 (7./13.Mar-9./15.May), 14/21-27 (23./29.May-4./10.Jul), 14/29-30 (18./24.Jul-25./31.Jul), 14/33-36 (15./21.Aug-5./11.Sep), 14/38-52 (19./25.Sep-26.Dec./1.Jan)
1940: Vol. ? |
FÜR DEN GOTTESDIENST – P-899
Germany
2000: #55 (Apr) |
FUSE – P-517
The Cultural Media & News Magazine
USA
1980: Vol. 4/5 (Jul/Aug) |
GARNER GEMS (ERROLL GARNER GEMS) – P-103
Scotland/USA
1991: Vol. 1/1 (Jan), 2 (Apr), 3 (Jul), 4 (Oct)
1992: Vol. 2/1 (Jan), 2 (Apr), 3 (Jul), 4 (Oct)
1993: Vol. 3/1 (Jan), 2 (Apr), 3 (Jul), 4 (Oct)
1994: #13
1995: #15 |
GAZETA JAZZOWA – P-1075
Poland
2009: #15 (Oct-Nov) |
GBC INFO – P-710
German Blues Circle
Germany
1976: #1-5 (Aug-Dec)
1977: #6-16 (Jan-Dec)
1978: #17-28 (Jan-Dec/Jan)
1979: #29-39 (Feb-Dec/Jan)
1980: #40-47 (Feb-Sep), 50 (Nov)
1981: #51-56 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1982: #57-62 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1983: #63-64 (Jan/Feb-Mar)
1984: #99-110 (Jan-Dec/Jan)
1985: #111-121 (Feb-Dec)
1986: #123-133 (Feb-Dec)
1987: #135-141 (Feb-Aug), 143-145 (Oct.Dec)
1988: #147-158 (Feb-Dec.1988)
1989: #160-170/171 (Feb-Dec/Jan)
1990: #172-182/183 (Feb-Dec/Jan)
1991: #184-194/195 (Feb-Dec/Jan)
1992: #196-206/207 (Feb-Dec/Jan)
1993: #208-218/219 (Feb-Dec/Jan)
1994: #220-230/231 (Feb-Dec/Jan)
1995: #232-242/243 (Feb-Dec/Jan)
1996: #244-254/255 (Feb-Dec/Jan)
1997: #256-266/267 (Feb-Dec/Jan)
1998: #268-278/279 (Feb-Dec/Jan)
1999: #280-290 (Feb-Jul, Sep-Dec/Jan)
2000: #292-302/303 (Feb-Dec)
2001: #304-313/314 (Feb-Dec)
2002: #315-325/326 (Feb-Dec/Jan)
2003: #327-336/337 (Feb-Dec/Jan)
2004: #338-347/48 (Feb-Dec/Jan)
2005: #349-358 (Feb-Dec/Jan)
Erscheinen ab Jan. 2006 eingestellt. |
GEHÖRT – GELESEN – P-104
Die Manuskripte der interessantesten Sendungen
Germany
1955: Vol. 2/8 (Aug) [Joachim-Ernst Berendt: Schwarz unter Weiß – Zur Situation des Negers in den USA] |
GEMA NACHRICHTEN – P-659
Germany
1994: #150 (Dec)
1996: #154 (Nov)
1997: #155-156 (Jul,Nov)
1998: #157-158 (Jun,Nov)
1999: #160 (Nov)
2002: #166 (Nov)
2004: #169,170 (Jun,Nov) |
GENE LEES NEWSLETTER – P-600
USA
1983: Vol: 2/5,8,11-12, Vol. 3/1-5
1984: Vol. 3/6-12, Vol. 4/1-5
1985: Vol. 4/6-12
1986: Vol. 5/1-12
1987: Vol. 6/1-12
1988: Vol. 7/1-9,10,12
1989: Vol. 8/1
1992: Vol. 11/8-9 (Aug-Sep) |
GEZZITALIANO, IL – P-846
Italy
1998: Vol. 2, #7
1999: Vol. 3, #10-11 (May/Jun-Jul/Aug) |
GITARRE AKTUELL – P-716
Germany
1992: Vol. 13/2
1993: Vol. 14/2
1995: Vol. 16/3-4 |
GITARRE & BASS – P-874
Germany
1999: Sep |
GM – P-499
Revija Glasbene Mladine Slovenije
Yugoslavia
1977/78: #1-2, 4 |
GOLDMINE – P-1029
The Collectors Record and Compact Disc Magazine
2005: Vol. 31/10 (13.May) |
GOLF REPORT KÖLN -P-1004
Germany
2003: #2
2004: #1
2005: #1,3
2006: # 4
2008: #1,3,4
2009: #1-2
2010: #4
2011: #3
2012: #3
2013: #32014: #42015: #2,3
[jazz articles scanned] |
GONDEL, Die – P-105
[including JAZZ ECHO]
Germany
1950: #6-12
1951: #1-12
1952: #1-12
1953: #1-12
1954: #1-12
1955: #1-12
1956: #1-12
1957: #1-12
1958: #1-12
1959: #1-12
1960: #1-12
1961: #1-12 (Jan, Apr-Nov komplett)
1962: #1-12 (komplett)
1963: #1-12 (komplett)
1964: #1-12 (komplett)
1965: #1-12 (Jan,Feb,Jul komplett)
1966: #1-5 (Jan-Mar,May komplett) |
GONG – P-106
Germany
1954: (31.Jan) [NN: Stars aus USA (Tommy Dorsey, Frank Sinatra, Johnnie Ray, Billy Eckstine, Lionel Hampton, Doris Day, Jo Stafford, Peggy Lee, Kay Starr)] |
GOOD NOISE, The – P-107
England
#1-250 (+ Index) |
GOODCHILD’S JAZZ BULLETIN – P-108
England
1959: #31-32 (Jan-Feb) |
GRAFFITI – P-854
Belgium
1996: #114 (Oct) |
GRÄNSLÖST – P-672
Sweden
1995: #1-3 (May,Sep,Dec)
1996: #1-4 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1997: #1-4 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1998: #1-4 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1999: #1-4 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2000: #1 (Mar) [eingestellt] |
GRAMOFON
CSSR
1946: #2, 4, 6 |
GRAMOPHONE – P-109
England
1923: Vol. 1/1 (Apr) [als Beilage zu Vol. 50/599 (Apr.1973)]
1928: Vol. 6/67 (Dec)
1930: Vol. 8/86-87 (Jul-Aug)
1931: Vol. 9/93-98 (Feb-Jul), 100 (Sep), 103 (Dec)
1932: Vol. 9/104-108 (Jan-May);
Vol. 10/111 (Aug), 113-115 (Oct-Nov)
1933: Vol. 10/116-119 (Jan-Apr), 121-123 (Jun-Aug);
Vol. 11/127 (Dec)
1934: Vol. 11/128-131 (Jan-Apr);
Vol. 12/133-136 (Jun-Sep), 139 (Dec)
1935: Vol. 13/151 (Dec)
1936: Vol. 13/152 (Jan);
Vol. 14/156-163 (May-Dec)
1937: Vol. 14/166 (Mar);
Vol. 15/172 (Sep)
1938: Vol. 15/176-177 (Jan-Feb);
Vol. 16/181-183 (Jul-Aug)
1973: Vol. 50/596-597 (Jan-Feb), 599-600 (Apr-May), 602 (Jul) |
GTJ & CR NEWS – P-1170 (Contemporary records)
1958: Vol.3 #1 (März)
1959: Vol.4 #1-4 (Jan, März, Juni, Nov)
1960: Vol.5 #1 (Feb), #2 (Sommer) |
GUIA DE JAZZ – P-110
Argentina
1987: Vol. 3/12 (Aug) |
GUIDER – P-798
New York Entertainment and Restaurant Guide
USA
1977: 15.Feb |
GUITAR – P-1155 GB
(Guitar the Magazine for all Guitarists)
1975: Vol.4 #4 (Nov) #5 (Dez)1976: Vol.4 #6-12 (Jan-Juli) Vol.5 #1 (Aug) Vol.5
#5 (Dez)
1977: Vol.5 #7 (Febr) Vol.5 #9 (April)1981: Vol.10 #4 (Nov) |
GUITAR EXTRA! – P-111
USA
1991: Vol. 2/1 (Spring) |
Guitar One – P-940
USA
The Magazine You Can Play
2001: #3 (Mar) |
GUITAR PLAYER – P-112
USA
1974: Vol. 8/11-12 (Nov-Dec)
1975: Vol. 9/1-8 (Jan-Aug), 10-11 (Oct-Nov)
1976: Vol. 10/4 (Apr), 6-7 (Jun-Jul), 12 (Dec)
1977: Vol. 11/1-2 (Jan-Feb), 6 (Jun), 10 (Oct)
1978: Vol. 12/1-2 (Jan-Feb), 4-5 (Apr-May), 8-9 (Aug-Sep)
1981: Vol. 15/4 (Apr), 15/8 (Aug), 15/10-11 (Oct-Nov)
1983: Vol. 17/5 (May)
1986: Vol. 20/8 (Aug)
1987: Vol. 21/1 (Jan) |
GUITAR WORLD – P-566
USA
1983: Vol. 4/1-2 (Jan-Mar) |
GUITARISTE MAGAZINE – P-533
France
1980: #1-2 (Nov-Dec)
1981: #3-10 (Jan-Sep) |
THE GUNN REPORT – P-886
England
1970: #23 (Oct), 25 (Dec)
1980: Sep/Dec
1986: #1
1992: (Dec) |
HAMBURGER MUSIK-MAGAZIN 78 – P-1085
Germany
1979: #10-11
1980: #12
1981: #13
1983: #14 |
HARMONIE-REVUE – P-113
Germany
1952: #2-3 (Jan-???) |
HARMONIKA-REVUE – P-781
Germany
1963: Vol.30, #1/2-11/12 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1968: Vol.35, #3
1970: Vol.37, #6 |
HENNESSY JAZZ NOTES – P-452
USA
1991: Spring
1992: Fall
1993: Spring-Winter
1994: Spring-Winter
1995: Spring-Winter
1996: Spring-Summer-Fall
1997: Spring, Fall |
HERDS, The – P-599
The Woody Herman Society
1993: Vol. 1 (Winter) |
HERREN-JOURNAL, Das – P-114
Germany
1953: #11 (Nov) [jazz article cut out]
1954: #4 (Apr) [Joachim-Ernst Berendt: Kühler Jazz im hohen Norden (Jazz in Sweden)]
#10 (Oct) [Joachim-Ernst Berendt: Jazz-Stars 1954] |
HESSEN PROFILE – P-115
Journal für Wissenschaft und Kunst
Germany
1989: #2 [NN: Jazz im Hof; NN: Jazz ist in (Landesjugendjazzorchester)] |
HIFI & MUSIK – P-521
Sweden
1977: Vol. 8/8 (Aug) |
HIFI STEREOPHONIE – P-116
Germany
1982: Vol. 21/10 (Oct)
1983: Vol. 22/7 (Jul) |
| HiFi-STEREO-PRAXIS (Zeitschrift für Schallplatte und Tonbandtechnik) – P-1136
Germany
1962: #3-11 (Mar-Nov)
1963: #1-3, 8 (Jan-Mar,Aug) |
HiFi SCENE – P-475
Switzerland
1992: #6 (Sep) |
HINDEMITH FORUM – P-902
2000: #1-2
2001: #3-5
2002: #6
2003: #7-8
2004: #9-11
2005: #12
2006: #13-14
2007: #15-16
2008: #17-18
2009: #19-21
2010: #22
2011: #23-24
2012: #25-26 |
HIP. THE JAZZ RECORD DIGEST – P-117
USA
1968: Vol. 4/5 (Nov)
1969: Vol. 6/3-6 (Sep-Dec)
1970: Vol. 7/1-5 (Jan-May); Vol. 8/2-6 (Aug-Dec)
1971: Vol. 9/1-7 (Jan-Jun), Vol. 10/1-6 (Aug-Dec) |
HÖRERLEBNIS – P-1180
Das Magazin für High Fidelity
Germany
2016: #96 (Summer)
2017: #102 (Winter) |
HOLLYWOOD NOTE – P-926
USA
1946: Vol 1/4-5 (Jun-Jul) |
HÖREN UND SEHEN – P-118
Germany
1954: 2.May [no jazz content] |
HÖR MIT MIR – P-722
Neue Funk-Stunde
Germany
1940: Vol.11/1-9 (31.Dec/6.Jan-25.Feb/2.Mar), 11/15-31 (7./13.Apr-29.Jul/3.Aug), 11/36-50 (1./7.Sep-8./14.Dec) |
HOT CLUB 51 Düren – P-458
Germany
[alle in Fotokopie]
1955: #65 (25.Jan), #70 (5. Apr), #81 (4.Oct), #85 (29.Nov)
1956: #91 (21.Jan), #96 (20.Jun) |
HOT CLUB FRANKFURT – P-740
Germany
1952: #28 (22.Sep) |
HOT CLUB JOURNAL – P-119
Germany
1948: Vol. 1/9-11 (Jun-Aug) |
HOT CLUB MAGAZINE – P-120
France
1946: #2-12
1947: #13-22
1948: #24, 26-27 |
HOT CLUB NEWS – P-121
Germany
1991: Vol. 1/1-2
1992: Vol. 2/1-4
1993: Vol. 3/1-4
1994: Vol. 4/1-4
1995: Vol. 5/1-4
1996: Vol. 6/1-4
1997: Vol. 7/1-4
1998: Vol. 8/1-4
1999: Vol. 9/1-4
2000: Vol. 10/1-4
2001: Vol. 11/1 [eingestellt] |
HOT HOUSE – P-122
(New York’s Jazz Bible)
USA
1986: Vol. 5/2 (Feb)
1987: Vol. 6/1 (Jan)
1991: Vol. 10/6-8 (Jun-Aug)
1992: Vol. 11/1-2 (Jan-Feb), 4 (Apr)
1996: Vol. 15/5 (May)
1997: Vol. 16/8-9 (Aug-Sep), 11 (Nov)
1998: Vol. 17/4,6-8 (Apr,Jun-Aug)
1999: Vol. 18/5-6 (May-Jun)
2008: Jan-May
2009: Feb, Sep
2010: Feb
2011: Mar
2012: Feb
2013: Feb
[complete as pdf files from Jan.2010] |
HOT HOUSE – P-875
Maison de Jazz de Liege
Belgium
1998: #1-9 (Feb-Nov)
1999: #10-19 (Jan-Nov)
2000: #20-29 (Jan-Nov)
2001: #30-32, 34/35-39 (Jan-Mar, May/Jun-Nov)
2002: #40-49 (Jan-Nov)
2003: #50-60 (Jan-Nov+Noel)
2004: #61-71 (Jan-Dec)
2005: #72-82(Jan-Dec)
2006: #83-93 (Jan-Dec)
2007: #94-103 (Jan-Dec)
2008: #105-114 (Feb-Dec)
2009: #115-125 (Jan-Dec)
2010: #126-135 (Jan-Dec)
2011: #136-144 (Jan-Sep)
2012: #155-158 (Sep-Dec) [digi.copy]
[pdf files from Jan.2008] |
HOT JAZZ (INFO) – P-123
Germany
1968; Vol. 4/3-4/4 (May,Oct) (+1 number)
1969: Vol. 5/1-2 (+ 1 number)
1970: Vol. 6/1-4
1971: Vol. 7/1-3
1972: Vol. 8/1-5
1973: Vol. 9/1-3
1974: #1-12
1975: #1-12
1976: #1-12
1977: #1-12
1978: #1-11
1979: #1-12
1980: #1-12
1981: #1-12
1982: #1-12
1983: #1-12
1984: #1-12
1985: #5-121986: #1-10
1987: #1-121988: #1/2, #5/6, #11/12 |
HOT NOTES – P-664
New York Hot Jazz Society
USA
1969: Vol. 1/7-8 (Jul-Aug)
1971: (press release) |
HRS SOCIETY RAG – P-925
USA
1940: (Oct) |
HUDBA PRO RADOST – P-124
(Musik zum Vergnügen)
CSSR
1964: Juli/Aug, Sept/Okt, Nov/Dez
1965: Jan/Feb, März/April, Mai-Juli, Aug-Okt,
1966: Jan/Feb, Mai-Juni, Aug-Okt, Nov/Dec
1967: Jan/Feb, 1 further issue |
HURLY BURLY – P-960
free improvised music magazine
Spain
1997: #1-3 (Apr-Oct)
1998: #4-7 (Jan-Oct)
1999: #8 (Jan) |
HURTA CONDEL – P-857
Spain
1997: #2 |
IAJE NEWSLETTER – P-442
(International Association of Jazz Educators)
USA
1992: Sep
1993: Mar, Sep
1994: Aug
1997: May, Jun
2006: International Conference Newsletter 2007
2007: International Conference Newsletter 2008 |
IAJRC JOURNAL – P-127
USA
1968: Vol. 1/1-2 (Jan,Apr)
1969: Vol. 2/2-3 (Jul,Oct)
1970: Vol. 3/1-4 (Jan,Apr,Jul,Oct)
1971: Vol. 4/1-4 (Jan,Apr,Jul,Oct)
1972: Vol. 5/1-2 (Jan,Apr), 4 (Oct)
1973: Vol. 6/1-4 (Jan,Spring,Summer,Fall)
1974: Vol. 7/1-4 (Winter-Fall)
1975: Vol. 8/1-4 (Winter-Fall)
1976: Vol. 9/1-4 (Winter-Fall)
1977: Vol. 10/1-4 (Winter-Fall)
1978: Vol. 11/1-4 (Winter-Fall)
1980: Vol. 13/1-4 (Jan,Apr,Jul,Oct)
1981: Vol. 14/1-4 (Jan-Oct)
1982: Vol. 15/1-3 (Jan,May,Oct)
1983: Vol. 16/1-2 (Jul,Oct)
1984: Vol. 17/1-4 (Jan,Apr,Jul,Oct
1985: Vol. 18/1-4 (Jan,Mar,Jul,Oct)
1986: Vol. 19/1-4 (Jan,Apr,JulOct)
1990: Vol. 23/2-3 (Spring-Summer)
1991: Vol. 24/2-4 (Spring-Fall)
1992: Vol. 25/1-4 (Winter-Fall)
1992: Mar (Directory of Members)
1993: Vol. 26/1-4 (Winter-Fall)
1994: Vol. 27/1-4 (Winter-Fall)
1995: Vol. 28/1-4 (Winter-Fall)
1996: Vol. 29/1-4 (Winter-Fall)
1997: Vol. 30/1-4 (Winter-Fall)
1998: Vol. 31/1-4 (Winter-Fall)
1999: Vol. 32/1-4 (Winter-Fall); Directory of Members
2000: Vol. 33/1-4 (Winter-Fall)
2001: Vol. 34/1-4 (Winter-Fall); Directory of Members
2002: Vol. 35/1-4 (Winter-Fall)
2003: Vol. 36/1-4 (Winter-Fall)
2004: Vol. 37/1-4 (Winter-Fall)
2005: Vol. 38/1-4 (Winter-Fall)
2006: Vol. 39/1-4 (Winter-Dec)
2007: Vol. 40/1-4 (Feb,May,Aug,Dec)
2008: Vol. 41/1-4 (Feb,May,Aug,Dec)
2009: Vol. 42/1-4 (Mar,Jun,Sep,Dec); Directory of Members
2010: Vol. 43/1-4 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2011: Vol. 44/1-4 (Mar,Jun,Sep,Dec); Directory of Members
2012: Vol. 45/1-4 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2013: Vol. 46/1-4 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2014: Vol. 47/1,3,4 (Mar,Sep,Dec); (Directory of Members)
2015: Vol. 48/1 (Mar) |
IASJ NEWSLETTER – P-125
(International Association of Schools of Jazz)
Netherlands
1991: #1 (Dec)
1992: #2-4 (May-Dec)
1993: #5 (May)
1994: #6-8 (Jan,Jun,Nov)
1995: #9 (Apr), 11 (Nov)
1996: #12-14 (May,Jun,Dec)
1997: #17 (Dec)
1998: #18 (Apr)
1999: #20-22 (May-Nov)
2000: #23-24, 26 (Jan-Apr,Oct)
2001: #27-29 (Feb-Oct)
2002: #30-32 (Jan-Oct), 34(Dec)
2003: #1,3 (Apr,Oct,Dec)
2004: Mar,Sep,Dec
2005: Apr,Dec
2009: Jun
2011: Dec
2012: Jun, Dec |
IJF BULLETIN – P-128
1987: #1 |
ILLUSTRIERTE WOCHE – P-129
Badische Illustrierte
Germany
1952: Vol. 7/18 (3.May) [NN: Wer gegen Jazz ist… ist gegen die Jugend – erklärte ein französischer Regierungssprecher auf dem “Salon du Jazz” in Paris (Photos by Jean-Pierre Leloir)] |
ILTA TÄHTI – P-130
Finland
1991: #87 (28.Jun) [Tuija Aalto: Jazzmuseo: vain tosi faneille (über das Jazz-Institut Darmstadt)] |
IMPETUS – P-468
England
1976: #1-3
ca. 1977: #4-6
1978: #7-8
1979: #9 |
IMPRINT – P-437
Germany
1977: Vol. 29/4 [Joachim-Ernst Berendt: Begegnungen mit Hermann Hesse] |
IMPROJAZZ – P-607
France
1993: #0 (Dec)
1994: #1-10 (Jan-Dec)
1995: #11-20 (Jan-Dec)
1996: #21-30 (Jan-Nov/Dec)
1997: #31-40 (Jan-Nov/Dec)
1998: #41-50 (Jan-Nov/Dec)
1999: #51-60 (Jan-Nov/Dec)
2000: #61-70 (Jan-Nov/Dec)
2001: #71-80 (Jan-Nov/Dec)
2002: #81-90 (Jan-Nov/Dec)
2003: #91-100 (Jan-Nov/Dec)
2004: #101-110 (Jan-Nov/Dec)
2005: #111-120 (Jan-Nov)
2006: #121-130 (Jan-Dec)
2007: #131-140 (Jan-Nov/Dec)
2008: #141-150 (Jan-Nov)
2009: #151-160 (Jan-Nov)
2010: #161-170 (Jan-Nov)
2011: #171-180 (Jan-Nov/Dec)
2012: #181-190 (Jan-Nov/Dec)
2013: #191-200 (Jan-Nov/Dec)
2014: #201-210 (Jan-Nov/Dec)
2015: #211-220 (Jan-Nov/Dec)
2016: #221-230 (Jan-Nov/Dec)
2017: #231-240 (Jan-Nov/Dec)
2018: #241-250 (Jan-Nov/Dec)
2019: #251-260 (Jan-Nov/Dec)2020: #261-270 (Jan-Nov/Dec) |
IMPROVISOR, The – P-131
USA
1982: Vol. 2/2 (Winter) + supplement
1991: Vol. 9 (autumn)
1993: Vol. 10 |
IN CONCERT – P-132
The Monthly Newsletter of the World Jazz Association
USA
1975: Vol. 1/2-5 (Aug/Sep-Dec)
1976: Vol. 2/1-2 (Spring-Jul/Aug) |
INDEPENDENT JAZZ LIST – P-746
England
1990: #1-3 (Jun,Sep,Nov)
1991: #4-7 (Jan,Mar,May,Jul), #9 (Dec) |
INDIGO NOTES – P-872
Germany
1993: #2-8
1994: #10-13, #15-18
1995: komplett
1996: komplett
1997: #39-46
1998: #50, #55-57
1999: #59-63, #65-68
2000: #69-76
2001: #77-84
2002: #85-92
2003: #93-99
2004: #100-108
2005: #109-118
2006: #119-128 (Feb-Dec/Jan)
2007: #129-138 (Feb-Dec/Jan)
2008: #139-148 (Feb-Dec/Jan)
2009: #149-158 (Feb-Dec/Jan) [last issue] |
INFORMATION – P-851
Germany (Karslruhe)
1963: Oct-Nov
1964: #1 |
INFORMATION FÜR DIE TRUPPE – P-133
Germany
1958: #14 [Interview mit Bundesverteidigungsminister Strauß: Die Bundeswehr und der Jazz; Joachim-Ernst Berendt: Was ist Jazz?] |
INFORMATIONEN – P-771
Studienkreis: Deutscher Widerstand
Germany
1991: Vol. 16/32-33 (Apr,Oct)
1992: Vol. 17/34-35 (Mar,Oct) |
INJAZZ – P-448
Germany
1992: #1 (Sep)
1993: #2-4 (Jan, …, Sep)
1994: #5-7 (Feb, Jul, Dec)
1995: #8-9 (Mar, Jul) |
INMUSIC – P-638
USA
1990: Vol. 1/1-6 (Jan-Jun), 10-12 (Oct-Dec)
1991: Vol. 2/1-3 (Jan-Mar) |
INNER VISIONS – P-887
(Black Music Association)
USA
1979: Vol. 1/2 (Oct) |
INTERMISSION – P-624
New Orleans Jazz Club of Southern California
USA
1968: Vol. 1/6 (Aug)
1969: Vol. 2/9-10 (Nov-Dec)
1970: Vol. 3/1-10 (Feb-Nov)
1971: Vol. 4/2-5 (Mar-Jul), 4/8 (Oct)
1972: Vol. 5/3 (Mar) |
International Blues Record Club Bulletin – P-1110
USA
1962: Vol. 2/1 (Winter 1962/1963) |
INTERNATIONAL JAZZ ARCHIVES JOURNAL – P-656
weitergeführt 2018 als Jazz & Culture Pittsburgh
USA
1993: Vol. 1/1 (Fall)
1994: Vol. 1/2 (Fall)
1995: Vol. 1/3 (Fall)
1996: Vol. 1/4 (Fall)
1998: Vol. 2/1 (Fall)
2012: Vol. 3/4 (Spring) |
INTERNATIONAL MUSICIAN – P-134
USA
1949: Feb, Apr, Jun
1950: Apr
1953: Mar
1955: Mar
1956: Jan-Sep, Nov
1957: Apr, Jun, Sep, Nov, DecS
1958: Jan-Feb, Apr, Jul, Dec
1959: Jan, Mar-Aug, Dec
1960: Mar-Apr, Nov
1961: Apr-Dec
1962: Jan-Dec
1963: Jan-Dec
1964: Jan-Oct
1966: Apr
1967: Feb, May-Sep, Nov-Dec
1968: Jan-Oct
1969: Jan-Feb, Apr-May, Jul-Aug, Oct-Nov
1970: Jan, Mar-Dec
1971: Jan-Aug, Dec
1972: Jan-Feb
1973: Vol. 71/11-12 (May-Jun), Vol. 72/1-3 Jul-Sep), 5-6 (Nov-Dec)
1974: Vol. 72/8-12 (Jan-Jun), Vol. 73/1-4 (Jul- Oct)
1975: Vol. 73/8-9 (Feb-Mar)
1991: Vol. 89/9 (Mar), Vol. 90/3-6 (Sep-Dec)
1992: Vol. 90/7-12 (Jan-Jun); Vol. 91/1-4 (Jul- Oct) |
INTERNATIONAL MUSICIAN AND RECORDING WORLD – P-782
Germany
1981: Vol. 3/11 (Nov) |
INTERNATIONALE RECORDS NEWS – P-1162
Italien
1982: Vol.1 #1 (Mai) bis #6 (Nov)
1983: Vol.2 #1 (Spring) |
INTERNATIONAL STORY, The – P-135
Delta Airlines
1991: Fall [Claire D. Hughes: Jazz It Up. You can hear jazz music, from traditional Dixieland to modern improvisation, no matter where you’re heading] |
INTERNATIONALE PODIUM, Das – P-136
Germany
1951: Vol. 3/45-49 (Jul-Dec)
1952: Vol. 4/50-53 (Feb-May), 55-61 (Jul-Dec) [fortgeführt als “Jazz Podium”, siehe dort]
1955: Vol. 8/85 (Jan) |
INTERVALS – P-606
The Newsletter of Soprano Saxophonist David Liebman
USA
1994: Vol. 1/3; Vol. 2/1 (Fall/Winter)
1995: Vol. 2/3 (Spring/Summer), Vol. 3/1 (Fall/Winter) |
INTERIEUR – P-1066
Andy Warhol’s Interieur
1986: Vol. 16/4 (Apr) |
IN THE GROOVE -P-924
USA
1946: Vol 1/9 (Nov) |
INTO JAZZ – P-137
England
1974: Vol. 1/1-7 (Feb-Aug) |
IN TUNE –P-1038
England
1993: #40 (Mar) |
IRC NEWS – P-***
(Switzerland)
ca. 1969: #27-75, Reminder 1-6 |
I.S.A.M. NEWSLETTER – P-126
USA
1971-1979: Vol. 1/1-9/1
1980-1989: Vol. 9/2-19/1
1990: Vol. 19/2 (May), Vol. 20/1 (Nov)
Neuere Ausgaben online unter:
http://www.brooklyn.cuny.edu/web/academics/centers/hitchcock/publications/amr/archive.php |
ISTAR NEWSLETTER – P-138
India
1985/86: #3-4 |
JAC -P-1057
La Revista des Jazz
Spain/Barcelona
2003: #3 |
JASSMAN, THE P-1054
South Africa
2007: Vol1/1 (Oct)
2008: Vol. 2/1-6
2009: Vol. 3/1-6
2010: Vol. 4/1-2 |
JATZER’s JOURNAL – P-1189
Germany
1986: #1 (May), #A (Nov)
1988: #2 (Sep)
1989: #3 (Aug) |
JAZZ – P-139
Australia
1981: Vol. 1/3 (May/Jun), 5 (Sep)
1982: Vol. 2/10-11 (Jul-Oct)
1983: Vol. 3/1-2 (Jan-Apr), 5 (Spring)
1985: #20
1986: #21-22 |
JAZZ – P-549
Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen
Belgium
1969/70: Oct/Mar
1972: Feb-Apr, Dec |
JAZZ – P-140
CSFR
1964: Vol. 10 (#98)
1965: Vol. 10/2 (#102) |
JAZZ – P-918
Belgium
1945: #1-11 |
JAZZ – P-141
Germany
1949: Vol. 1/1 (Dec) |
JAZZ – P-657
(fortgeführt als JAZZI MAGAZINE)
Poland
1994: #1 (May)
1995: #9
1996: #16
1997: #17-18, 20-21 (Jul/Aug-Sep/Oct)
1998: #23 (Jan/Feb)
2001: #41 |
JAZZ – P-142
Switzerland
1974: #1-6
1975: #1-6
1976: #1-6
1977: #1-6
1985: #3 (Japan), #4 zehn Portraits |
JAZZ. Das Schweizer Jazz-Magazin – P-792
Switzerland
1996: #1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
1997: #3-7 (Jan/Feb-Sep/Oct) |
JAZZ – P-636
Hungary
1976: #7 (Dec)
1977: #8-10 (Apr-Dec)
1978: #13 (Dec)
1979: #14-16 (Apr-Dec)
1980: #17-18 (Apr-Sep)
1981: #19-21 (Jan-Dec)
1984: #3 |
JAZZ – P-921
USA
1942: Vol 1/4 (Sep)
1943: Vol 1/7, 8 (May), 9 (Jul), 10 (Dec)
1944: Vol. 1/1 (15.Dec)
1945: Vol. 1/2 |
JAZZ – P-143
USA
1962: Vol. 1/1-2 (Oct-Dec)
1963: Vol. 2/3-9 (Jan-Dec)
1964: Vol. 3/1-6 (Feb-Dec),
1965: Vol. 4/1-11 (Jan-Dec)
1966: Vol. 5/1-12 (Jan-Dec)
1967: Vol. 6/1-4 (Jan-April), 6-7 (Juni-Juli) |
JAZZ – P-144
USA
1967: Vol. 6/1-7 (Jan-Jul) |
JAZZ – P-145
Miesiecznik Ilustrowany, later: Rytm i piosenka
Later: MM. Magzyn Muzyczny JAZZ [Musikmagazin JAZZ]
Poland
1956: Vol. 1/6 (#2-3), 11-12 (#5-6)
1957: Vol. 2/1-7 (#7-#13), 9-12 (#15-18)
1958: Vol. 3/1-4 (#19-22), 8/9
1959: Vol. 4/3 (#33), 8 (#38)
1960: Vol. 5/10 (#51)
1962: Vol. 7/1-12 (#65-76) komplett
1964: Vol. 9/12 (#100)
1965: Vol. 10/2 (#102), 5 (#104)
1966: Vol. 11/12 (#124)
1967: Vol. 12/1-12 (#125-136) komplett
1968: Vol. 13/1-3 (#137-139), 5-6 (#141-142), 11 (#147)
1969: Vol. 14/1-12 (#149-160) komplett
1970: Vol. 15/1-2, 4-5, 7/8-12 (#161-162, 164-165, 167/168-173)
1971: Vol. 16/1-12 (#173-184) komplett
1972: Vol. 17/1, 4, 9-10, 12 (#185, 188, 193-194, 196)
1973: Vol. 18/1-2, 10 (#206), 11-12 (#197-198, 207-208)
1974: Vol. 19/4 (#212), 6 (#214)
1975: Vol. 20/2-4 (#222-224), 6-12 (#226-232)
1976: Vol. 21/1-3 (#233-235), 7-11 (#239/240-243)
1977: Vol. 22/1-3 (#245-247), 5-6 (#269-250), 10 (#254)
1978: Vol. 23/5-6 (#261-262), 7 (#263), 9 (#265); 12 (#268),
1979: Vol. 24/8 (#276)
1981: Vol. 26/3 (#295), /4 (#296)
1982: #301
1983: (#305-308, 310) [#309 fehlt]
1984: (#311, #315-316)
1985: (#318-319) |
JAZZ – P-146
Switzerland (A3-Format)
1981: #0
1982: #1-2 [complete set]
1983: #1-5 [complete set]
1984: #1-6
1985: #1-6 |
JAZZ – P-1154
Tschechischen Republik , CZ
1947: 1. Jahrgang, #3
1948: 2. Jahrgang, #1, 2, 4 |
JAZZ. A QUARTERLY OF AMERICAN MUSIC – P-230
USA
1958: #1 (Oct)
1959: #2-4 (Spring, Summer, Fall)
1960: #5 (Winter) |
JAZZ AMBASSADOR MAGAZINE (Jam) – P-1138
USA
2013 Oct/Nov |
JAZZ AT RONNIE SCOTT’S – P-839
The House Magazine of Ronnie Scott’s Club
England
1981: Oct-Nov
1983: #21 (Jan)
1987: #46 (Aug)
1989: #55 (Jan/Feb)
1990: #65-66 (Oct-Dec)
1991: #67-70,72 (Jan/Feb-Jul/Aug,Nov/Dec)
1992: #73-77 (Jan/Feb-Sep/Oct)
1993: #79-81,83-84 (Jan/Feb-May/Jun,Sep/Oct-Nov/Dec)
1994: #85-89 (Jan/Feb-Sep/Oct)
1995: #91-92,94-95 (Jan/Feb-Mar/Apr,Jul/Aug-Sep/Oct)
1996: #97-98,100-102 (Jan/Feb-Mar/Apr,Jul/Aug-Nov/Dec)
1997: #103-109 (Jan/Feb-Nov/Dec) (21.01.2009: #104 vermisst)
1998: #110-115 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1999: #116-121(Jan/Feb-Nov/Dec)
2000: #122-127 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2001: #128-133 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2002: #134-138 (Jan/Feb-Sep/Oct)
2003: #140-144 (Jan/Feb-Sep/Oct)
2004: #146-148,151 (Jan/Feb-May/Jun,Nov/Dec)
2005: #152-154, 156-157 (Jan/Feb-May/Jun,Sep/Oct-Nov/Dec)
2006: #158-159 (Jan-Feb) |
JAZZ, BLUES AND CO. – P-518
France
1976: #3 (Oct)
1977: #11 (Aug/Sep)
1978: #15-16 (Mar-Apr), 21/22 (Oct)
1979: #25/26 (Jan), 28/29 (Spring), 32/33 (Aug/Sep)
1980: #36/37-44/45 (Jan/Feb-Oct/Dec), Sonderheft (Festivalheft)
1981: #47 (Jan-Feb)
1982: #59/60 (Christmas) |
JAZZ & BLUES – P-148
England
1971: Vol. 1/1-8 (Apr-Dec)
1972: Vol. 1/9-11, Vol. 2/1-9 (Jan-Dec)
1973: Vol. 1/10-12 (Jan-Mar),
Vol: 2/10, 2/12 (März),
Vol. 3/10 (Feb), 3/2 (Mai), 3/6 (Sept),
11-9 (Apr-Dec) ? |
JAZZ & CONTEMPORARY MUSIC PROGRAM NEWSLETTER – P-973
England
2002: Spring/Summer |
JAZZ & POP – P-149
USA
1967: Vol. 6/8-12 (Aug-Dec)
1968: Vol. 7/1-12 (Jan-Dec)
1969: Vol. 8/1-12 (Jan-Dec)
1970: Vol. 9/1-12 (Jan-Dec)
1971: Vol. 10/1-3, 5-8 (Jan-Mar, May-Aug) |
JAZZ (Bulletin) – P-150
CSSR
1972: #3
1973: #7 (Sep)
1974: #8-10 (Jan, Apr, Aug)
1975: #13-15 (Apr, Jul, Dec)
1977: #21/22 |
JAZZ (Just aquitaine) – P-548
France
1984: #13 (15.Sep) |
JAZZ (MAGAZINE) – P-189
USA
1976: Vol. 1/1 (Summer)
1977: Vol. 1/3-4 (Spring-Summer); Vol. 2/1 (Fall)
1978: Vol. 2/2 (Winter), 2/4 (Summer); Vol. 3, #1 (Fall)
1979: Vol. 3/2-4 (Spring-Fall); Vol. 4/1 (Winter)
1980: Vol. 4/2 (Spring) |
JAZZ + CLASSIC – P-151
Switzerland
1978: #1-6
1979: #1-6 |
JAZZ – RHYTHM & BLUES – P-147
Switzerland
1968: #1-8 |
JAZZ – The Magazine (Jazz Magazine) – P-171 (Nicht mehr existent ab 11/96)
(formerly Jazz fm)
England
1990: #1-4
1991: #5-9
1992: #10-16
1993: #17-22
1994: #23-27
1995: #28-30 (Jan/Feb-May/Jun) |
JAZZ 360° – P-152
France
1979: #14 (Jan), 20 (Sep), 23 (Dec)
1980: #24-30 (Jan-Sep),
1981: #36 (Mar), 39-42 (Jun-Nov)
1982: #43-47 (Jan-Apr), 49-54 (May-Dec)
1983: #55-64 (Jan-Dec)
1984: #65-74 (Jan-Dec)
1985: #75-76 (Jan-Dec) |
JAZZ ACTUEL – P-756
Le journal du Petit Faucheux
France
1995: #1
1996: #2-5
1997: #6-9
1998: #10-14 |
JAZZAMATAZZ – P-873
USA
1999: Vol. 2/6; Vol. 3/8 (Winter/Spring)
2000: Vol. 111/9 (Spring)
2004: Vol. 13/4 (Summer) |
JAZZ APPRECIATION SOCIETY BOOKLET – P-153
England
mid-1940s: [Jazz]
[Stanley F. Dance: Jazz Notebook]
[Jazz on Record]
[Jazz Writings]
[Jazz Today]
[American Jazz No. 1 / No. 2]
[Thoo’ Berry] |
JAZZ Årbogen – P-154
Denmark
1958: Vol. 2
1959: Vol. 3 |
JAZZ ARCHIVIST, The – P-155
USA
1986: Vol. 1/1-2 [digi.copy]
1987: Vol. 2/1-2 [digi.copy]
1988: Vol. 3/1-2 [digi.copy]
1989: Vol. 4/1-2 [digi.copy]
1990: Vol. 5/1-2 [digi.copy]
1991: Vol. 6/1-2 [digi.copy]
1992: Vol. 7/1-2 [digi.copy]
1993: Vol. 8/1-2 [digi.copy]
1994: Vol. 9/1-2 [digi.copy]
1995: Vol. 10/1-2 [digi.copy]
1996: Vol. 11/1 (May) [digi.copy]
1997: Vol. 12/1 (May) [digi.copy]
1998: Vol. 13 (1998/1999) [digi.copy]
2000: Vol. 14 (1Heft) [digi.copy]
2001: Vol. 15 (1Heft) [digi.copy]
2002: Vol. 16 (1Heft) [digi.copy]
2003: Vol. 17 (1Heft) [digi.copy]
2004: Vol. 18 [digi.copy]
2005/06: Vol. 19 [digi.copy]
2007: Vol. 20 [digi.copy]
2008: Vol. 21 [digi.copy]
2009: Vol. 22 [digi.copy]
2010: Vol. 23 [digi.copy]
2011: Vol. 24 |
JAZZ AROUND P-729
Belgien
1996: #5 (Jun/Jul/Aug)
1997: #11-12 (Sep/Oct-Nov/Dec)
1998: #13-17 (Jan-Nov/Dec)
1999: #18-22 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2001: #26-27 (Jan/Feb-May/Jun)
2002: #30-32 (Feb/Mar-Jul/Aug)
2003: Jul/Sep.2003 |
JAZZBAND – P-763
Argentina
Vol. 1/3 (Jul/Aug) |
JAZZ BAZAAR – P-157
Germany
1969: #1-4
1970: #5-8
1971: #9-11
1972: #12/13 |
JAZZ BEAT – P-158 (P-231)
England
1964: Vol. 1/3, 5, 11-12
1965: Vol. 2/2-3, 5, 7, 10-12
1966: Vol. 3/1, 3/2, 3/4, 3/10 |
JAZZ BEAT – P-159
USA
1989: Vol. 1/1 (Aug), 1/2 (Winter 1989/1990)
1990: Vol. 3&4; Vol. 2/1-2&3 (August-Winter)
1991: Vol. 2/4 (Spring); 3/1-2&3 (Summer-Fall/Winter)
1992: Vol. 3/4 (Spring); Vol. 4/1-3 (Aug, Winter)
1993: Vol. 4/4 (Spring); 5/1-2 (16.Aug, Fall)
1994: Vol. 5/3-4 (Winter-Spring); 6/1-2 (16.Aug-Fall)
1995: Vol. 6/3 (Winter); 6/4 (Spring), Vol. 7/1 (Aug), 7/2 (Fall)
1996: Vol. 7/3&4 (Winter/Spring), Vol. 8/1-3 (Summer-Winter)
1997: Vol. 8/4 (Spring); Vol. 9/1-2 (Summer-Fall)
1998: Vol. Vol. 9/3/4 (Winter/Spring); 10/1-3 (Summer, Fall, Winter)
1999: Vol. 10/4 (Spring), Vol. 11/1 (Summer)
2001: Vol. 13/1-2 (Summer-Fall)
2002: Vol. 13/3&4 (Winter/Spring)
2003: Vol. 15/1-2 (Summer-Fall)
2004: Vol. 15/3&4 (Winter/Spring); Vol. 16/1 (Summer)
2005: Vol. 17/1
2006: Vol. 18/1-4
2007: Vol. 19/1,
2008: Vol. 19/3&4; Vol. 20/1&2&3&4
2009: Vol. 21/1 |
JAZZ BLADET – P-1105
Denmark
1957: Vol. 1,1 (Oct-Nov)1961: Vol.4 (April) |
JAZZ BLAST, THE – P-586
Dedicated to the Preservation of Big Bands and Traditional Jazz
USA
1969: Jul,Dec
1970: Jan-Dec
1971: Jan,Mar-Apr,Jul-Aug
1972: Sep-Dec
1973: Jan-Feb,Sep |
JAZZBLÄTTCHE – P-773
Mitteilungsorgan des Jazzclub Rheingau e.V.
Germany
1987: Vol. 1/3 (Jul)
1988: Vol. 2/3-4 (Jul,Oct)
1989: Vol. ¾ (Oct)
1990: Vol. 4/1-3 (Jan,Apr,Jul)
1991: Vol. 5/1-4 (Feb,May,Jul,Oct)
1992: Vol. 6/1 (Feb), 3-4 (Jul,Oct)
1993: Vol. 7/2-4 (Apr,Jul,Oct) |
JAZZ BOOK CLUB YEARBOOK OF JAZZ – P-160
England
1945 |
JAZZBOOK – P-232
England
1955 |
JAZZBRIEF, DER – P-737
Germany
1997: #1-3 (Jan,Apr,Jul)
1998: #4-5 (Jan,Jun)
1999: #6-8 (Mar,Jun,Sep)
2000: #9 (Mar) |
JAZZ-BULLETIN – P-1091
DJF (Deutsche Jazz Föderation)
1973: #1 (Mar) |
JAZZ BULLETIN – P-1108
CSSR
1965: Sep/Oct |
JAZZ BULLETIN – P-161
Switzerland
1953: Vol. 2/4-7, 9, 12
1954: Vol. 3/3-12
1955: Vol. 4/1 |
JAZZ CENTRE SOCIETY NEWSLETTER – P-963
England
1979: Feb,Apr,Sep-Dec/Jan
1980: Feb/Mar,Jun/Jul-Aug/Sep
1981: Dec/Jan
1983: Dec/Jan |
JAZZ CHANGES – P-609
Netherlands/England
1994: Vol. 1/1-2 (Spring-Autumn)
1995: Vol. 2/1-3 (Spring-Autumn)
1996: Vol. 3/1-3 (Spring-Autumn)
1997: Vol. 4/1-3 (Spring-Autumn)
1998: Vol. 5/1-3 (Spring-Autumn)
1999: Vol. 6/1-2 (Spring-Summer)
2000: Vol. 7/1 (Spring) |
JAZZCHORD – P-658
News & Information from the National Jazz Co-ordinator
Australia
1993: #11-16 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1994: #17-22 (Jan/Feb-Winter)
1995: #23-27 (Feb/Mar-Oct/Nov)
1996: #28-32 (Summer 1995/96-Sep/Oct)
1997: #33-38 (Dec/Jan-Oct/Nov)
1998: #39-43 (Dec/Feb-Sep/Nov)
1999: #44-50 (Dec/Jan-Winter)
2000: #51-56 (Feb/Mar-Winter)
2001: #57-62 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2002: #63-64 (Feb/Mar-Apr/May) |
JAZZ CIRCLE BASEL Monatsbulletin – P-670
Switzerland
1994: #26-27 (Feb-Mar), #31-35 (Jul-Nov)
2002: #127-130 (Jul-Oct) |
JAZZ CIRCLE NEWS – P-565
England
1978: #2-11 (Mar-Dec)
1979: #12-15,17-18 (Jan-May,Aug-Oct) |
JAZZ CLASSIQUE – P-1143
France
2002: #20-23 (Apr,Jun,Sep,Nov)
2003: #24-28 (Jan,Apr,Jun,Sep,Nov)
2004: #29-33 (Jan,Apr,Jun,Sep,Nov)
2005: #34-38 (Jan,Apr,Jun,Sep,Nov)
2006: #39-43 (Jan,Apr,Jun,Sep,Nov)
2007: #44-48 (Jan,Apr,Jun,Sep,Nov)
2008: #49-53 (Jan,Apr,Jun,Sep,Nov)
2009: #54-56 (Jan,Apr,Jun) |
JAZZ CLUB – P-661
Jazzinfo für Clubmitglieder des Jazzclub Werne
Germany
1989: #15-16 (Sep-Oct)
1990: #18-24 (Feb-Nov)
1991: #25-30 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1992: #31-34 (Jan/Feb-Sep/Oct)
1993: #39 (May/Jun) |
JAZZ CLUB MAGAZIN – P-840
Jazzclub Karlsruhe e.V.
Germany1986: #2 (Dez/Jan)
1991: Vol. 6/1,3,5 (Jan/Feb,May/Jun,Sep/Oct)
1992: Vol. 7/1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1993: Vol. 8/1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1994: Vol. 9/1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)1995: Vol. 10/1 (Jan/Feb)
1996: Vol.11/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1997: Vol.12/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1998: Vol.13/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1999: Vol.14/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2000: Vol.15/1-5 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2001: Vol.16/1-5 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2002: Vol.17/1-5 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2003: Vol.18/1-5 (Feb/Mar-Nov/Dec)
[fortgesetzt als kleinformatiges Programmheft]
2004: Vol. 19/2-3 (Mar/Apr-May/Jun) |
Die JAZZ-CLUB NEWS – P-819
(Hot-Club Frankfurt)
Germany
1945: #2 (30.Sep), 3/4 (Oct/Nov), 5/6 (Dec/Jan)
1946: #7/8-15/16 (Mar/Apr-Nov/Dec) |
JAZZ CLUB NEWS – P-162
Minden, Germany
1990: Vol. 1/1
1991: Vol. 2/1-2 |
jazz column – P-965
For Members of the Jazz Book Club
England
1957: #3 (May/Jun)
1959: #13 (Feb)
1960: #21(Jun)
1961: #25-26,29-30 (Feb-Apr,Oct-Dec)
1962: #32,35-36 (Apr,Oct-Dec) |
JAZZ CONCERTO – P-797
Italy
1997: Vol. 3/16 |
JAZZ CONTAINER – P-163
Jahrbuch für improvisierte Musik
1986/87 |
JAZZ COURIER, Der – P-164
Germany
1955: #1-12
1956: #13-14 |
JAZZ CRISIS – P-914
Spain
1949: Vol. 1/1-3 (Oct-Dec)
1950: Vol. 1/4-9 (Jan-Jun/Jul) |
JAZZ CRITIQUE – P-981
Japan
1995: #83 |
JAZZ & CULTURE –P-1185
USA, Pittsburgh
Vorgänger: International Archives Journal
2018: Vol.1
2019: Vol.2
2020: Vol. 3/1 -3/2 (Spring/Summer – Fall/Winter) |
JAZZ DI IERI E DI OGGI – P-165
Italy
1959: Vol. 1/1-10
1960: Vol. 2/6-9 |
JAZZ DIGEST – P-166
USA
1972: Vol. 1/1-12
1973: Vol. 2/1-12
1974: Vol. 3/1-6 |
JAZZ DISCO – P-443
Schweden
1960: Vol. 1/2 (Jul) |
JAZZ DOWN UNDER – P-585
Australia
1977: #20 (Nov/Dec) |
JAZZ DÜNYASI – P-1016
Azerbaijan
2004: #1 (Autumn)
2005: #4 (Summer)
2006: #6 (Winter)
2012: #14 |
JAZZEAST NEWS – P-594
Canada
1993: Vol. 4/2 (Spring)
1994: Vol. 5/2-3 (Spring, Fall)
1995: Vol. 6/1 (Winter), 6/3 (Sep)
continued as JAZZ NOTES (JAZZEAST)
1997: Vol. 8/1 (Jan) |
JAZZ ECHO – P-167
USA
1979: Vol. 9/39-42 (Jan, Mar, Jun, Oct)
1980: Vol. 10/44 (Summer) |
JAZZ ECHO – P-834
Germany
1998: Vol. 1/2
1999: Vol. 2/1-4 (Spring-Winter)
2000: Vol. 3/1-4 (Spring-Winter) + special edition
(Feb)
2001: Vol. 4/1-4 (Spring-Winter)
2002: Vol. 5/1-4 (Spring-Winter)
2003: Vol. 6/1-4 (Spring-Winter)
2004: Vol. 7/1-4 (Spring-Winter)
2005: Vol. 8/1-4 (Spring-Winter)
2006: Vol. 9/1-4 (Spring-Winter)
2007: Vol. 10/1-4 (Spring-Winter)
2008: Vol. 11/1-2 (Spring-Fall)
2009: Vol. 12/1-3 (Spring-Fall)
2010: Vol. 13/1-2 (Spring-Fall) [magazine stopped print publication!] |
JAZZed – P-1047
The Jazz Educator’s Magazine
(USA)
2007: Vol. 1/2 (Jan) |
JAZZ EDUCATORS JOURNAL – P-168
(new name beginning Vol. 34/3: Jazz Education Journal)
USA
1984: Vol. 16/3 (Feb/Mar)
1990: Vol. 23/3 (Winter)
1991: Vol. 23/4 (Summer); Vol. 24/1-2 (Fall-Winter)
1992: Vol. 24/3-4 (Spring-Summer); Vol. 25/1 (Fall)
1993: Vol. 25/2-4 (Winter-Summer); Vol. 26/1-2 (Oct-Dec)
1994: Vol. 26/3-4 (Mar-May); Vol. 27/1-2 (Oct-Dec)
1995: Vol. 27/3-4 (Mar-May); Vol. 28/1-3 (Jul-Nov)
1996: Vol. 28/4-6 (Jan-May); Vol. 29/1-3 (Jul-Nov)
1997: Vol. 29/4-6 (Jan-May); Vol. 30/1-3 (Jul-Nov)
1998: Vol. 30/4-6 (Jan-May); Vol. 31/1-3 (Jul-Nov)
1999: Vol. 31/4-7 (Jan-May); Vol. 32/1-3 (Jul-Nov)
2000: Vol. 32/4-6 (Jan-May); Vol. 33/1-3 (Jul-Nov)
2001: Vol. 33/4-6 (Jan-May); Vol. 34/1-3 (Jul-Nov)
2002: Vol. 34/4-6 (Jan-May/Jun); 35/1-3 (Jul-Nov)
2003: Vol. 35/4-6 (Jan/Feb-May/Jun); 36/1-3 (Jul/Aug-Nov/Dec)
2004: Vol. 36/4-6 (Jan/Feb-May/Jun); 37/1-3 (Jul/Aug-Dec)
2005: Vol. 37/4-6 (Feb-Jun/Jul); 38/1-3 (Jul/Aug-Dec)
2006: Vol. 38/4-6 (Feb-Jun/Jul); 39/1-3 (Jul/Aug-Dec)
2007: Vol. 39/4-6 (Feb-Jun/Jul); 40/1-2/3 (Aug/Sep-Oct/Nov/Dec)
2008: Vol. 40/4 (Jan) |
JAZZ ENSUITE – P-169
France
1983/4: #1-2 (Oct-Dec/Jan)
1984: #5 (Summer) |
JAZZER – P-233
Germany
1960: Vol. 1/2-9 (Apr-Dec)
1961: Vol. 2/1, 3-12
1962: Vol. 3/1-8 |
JAZZETTE – P-909
USA
1944: Vol. 1/1 (Nov)
1945: Vol 1/2-4 (Jan-Mar/Apr) |
JAZZETTE – P-234
(MPS)
Germany1967: 15.Dez
1968: 15.Aug [special issue Jazz am Rhein ‘68]
1969: 1.Sep [special issue 10 years Clarke-Boland
Ensemble; 10 years Ronnie Scott’s Club]; 2.Nov [Jazz in the Opera]
1970: 15.Oct [special issue: Carmen, Dizzy and the
Band]; 26.Oct [special issue: The week of Jazz in Action1979: 15.Oct [special issue: Ein Livehouse für
Köln]
1981: 15.Nov [special issue: Music Unlimited,
Milano]
1987: 15.Oct [special issue: Il Salotto] |
JAZZ EXPRESS – P-170
England
1983: #44-45 (Jul-Aug/Sep), #47 (Nov)
1984: #50-57 (Mar-Oct), #59 (Dec/Jan)
1985: #60 (Feb), #62 (Apr), #64 (Jun)
1986: #68 (Jan), #75-78 (Aug-Nov)
1987: #84,86-87 (Jun,Aug-Sep)
1988: #96-97/98 (Jul-Aug/Sep)
1989: #111-113/114 (Oct-Dec/Jan)
1990: #115-124/125 (Feb-Dec/Jan)
1991: #126-136/137 (Feb- Dec/Jan)
1992: #138-148/149 (Feb-Dec/Jan)
1993: #150-160/161 (Feb-Dec/Jan) [fortgeführt als BOZ, siehe dort] |
JAZZFAX – P-714
Jazz Appreciation Society of Syracuse
USA
1982: Vol. 11/2-3 (Oct-Nov) |
JAZZFINDER, The – P-235
USA
1948: Vol 1/1-12 (Jan-Dec)
1949: ? |
JAZZFORSCHUNG/JAZZ RESEARCH – P-236
Austria
1969: Vol. 1
1970: Vol. 2
1971/72: Vol. 3/4
1973: Vol. 5
1974/75: Vol. 6/7
1976: Vol. 8
1977: Vol. 9
1978: Vol. 10
1979: Vol. 11
1980: Vol. 12
1981: Vol. 13
1982: Vol. 14
1983: Vol. 15
1984: Vol. 16
1985: Vol. 17
1986: Vol. 18
1987: Vol. 19
1988: Vol. 20
1989: Vol. 21
1990: Vol. 22
1991: Vol. 23
1992: Vol. 24
1993: Vol. 25
1994: Vol. 26
1995: Vol. 27
1996: Vol. 28
1997: Vol. 29
1998: Vol. 30
1999: Vol. 31
2000: Vol. 32
2001: Vol. 33
2002: Vol. 34
2003: Vol. 35
2004: Vol. 36
2005: Vol. 37
2006: Vol. 38
2007: Vol. 39
2008: Vol. 40
2009: Vol. 41
2010: Vol. 42
2011: Vol. 43
2012: Vol. 44
2013: Vol. 45
2014: Vol. 46
2015: Vol. 47 |
JAZZ FORUM – P-1160
The European Jazz Magazin, Polen
2005: #3
2017: #9 |
JAZZ FORUM – P-172
Poland
Die Zeitschrift erschien ab 1965 in polnischer Sprache als Jazz Forum. Biuletyn Polska Federacja Jazzowa [Jazz Forum. Bulletin der polnischen Jazz-Föderation]. Die Englische Ausgabe erschien parallel ab Herbst 1967. Die englischsprachige Version wurde 1992 eingestellt. Ab 1993 nur in Polnisch.Polnische Version:
1965: [#1 fehlt]
1966: (#2-5)
1967: (#6-7)
1968: (#8)
1969: (#9-10)
1971: #14[Ab 1973 erschien eine polnischsprachige Ausgabe, in der die wesentlichen Artikel der englischsprachigen Ausgabe in Übersetzung abgedruckt waren. Weiter enthielt sie Informationen der Polnischen Jazz Vereinigung (PSJ), die in der internationalen Ausgabe nicht abgedruckt wurden. Die Nummerirung orientierte sich an der englischsprachigen internationalen Ausgabe des JF.]
1973: (#21-26)
1974: (#27-30, 32) [#31 fehlt]
1975: (#33-38)
1976: (#39-42) [#43,#44 fehlen]
1977: (#45-50)
1978: (#51-56)
1979: (#57-62)
1980: (#63-68)
1981: (#69-73)
1982: (#74-79)
1983: (#80-85)
1984: (#86-91)
1985: (#92-97)
1986: (#98-103)
1987: (#104-109)
1988: (#110-115)
1989: (#116-120) [#121 fehlt]
[Erschien auch zwischen 1990 und 1993 in Polnisch. Vgl. Katalog der Nationalbibliothek Warschau http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/tJazz+Forum/tjazz+forum/1%2C4%2C6%2CB/frameset&FF=tjazz+forum+ed+polska&2%2C%2C2]
1993: Vol. 28/1-3,5-12 (#140-142,144-150)
1994: Vol. 29/1-12 (#151-158)
1995: Vol. 30/1-12 (#159-166)
1996: Vol. 31/1-12 (#167-174)
1997: Vol. 32/1-12 (#175-182)
1998: Vol. 33/1-12 (#183-190)
1999: Vol. 34/1-12 (#191-198)
2000: Vol. 35/1-12 (#199-206)
2001: Vol. 36/1-12 (#207-214)
2002: Vol. 37/1-12 (#215-222)
2003: Vol. 38/1-12 (#223-230)
2004: Vol. 39/1-2, 4-6 (#231, 233-238)
2005: Vol. 40/1-12 (#239-246)
2006: Vol. 41/1-4, 6-12 (247-249, 250-254)
2007: Vol. 42/1-12 (#255-262)
2008: Vol. 43/1-6 (#263-266), 9 (#268), 12 (#270)
2009: Vol. 44/4-5 (#273), 10-12 (#277-278)
2010: Vol. 45/1/2-7/8 (#279-283), 10/11-12 (#185-186)
2011: Vol. 46/1/2-3 (#187-188), 7/8-9, 12 (#291-292,294)
2012: Vol. 47/1/2-10/11 (#295-301)
2014: Vol. 49/10-11 (#317)
2015: Vol. 50/4-5 (#321)
2017: Vol. 52/1 (#335)
2018: Vol. 53/4 (#345; special english edition) |
Englische Version:
1967: Vol. 1/1 (#1)
1968: Vol. 1/2-3 (#2-3)
1969: Vol. 3/1-3 (#4-6)
1970: Vol. 4/1-4 (#7-10)
1971: Vol. 5/1-4 (#11-14)
1972: Vol. 6/1-6 (#15-20)
1973: Vol. 7/1-6 (#21-26)
1974: Vol. 8/1-6 (#27-32)
1975: Vol. 9/1-6 (#33-38)
1976: Vol. 10/1-6 (#39-44)
1977: Vol. 11/1-6 (#45-50)
1978: Vol. 12/1-6 (#51-56)
1979: Vol. 13/1-6 (#57-62)
1980: Vol. 14-15/1-6 (#63-68)
1981: Vol. 16/1-4 (#69-73)
1982: Vol. 17/1-6 (#74-79)
1983: Vol. 18/1-6 (#80-85)
1984: Vol. 19/1-6 (#86-91)
1985: Vol. 20/1-6 (#92-97)
1986: Vol. 21/1-6 (#98-103)
1987: Vol. 22/1-6 (#104-109)
1988: Vol. 23/1-6 (#110-115)
1989: Vol. 24/1-6 (#116-121)
1990: Vol. 25/1-6 (#122-127)
1991: Vol. 26/1-6 (#128-131)
1992: Vol. 27/1-6 (#133-137) [last English language issue; the following issues are in Polish] |
JAZZ FORUM – P-173
England
1946: #1-2
1947: #3-5 |
JAZZ FORUM – P-492
Germany
1959: Vol. 3/8 (Oct) |
JAZZFORUM – P-1100
Mitteilungsblatt der bayerischen jazz-Clubs
1958: Vol. 6/2 (May); Vol. 7/2 (Nov) |
JAZZFORUM – P-1152
The Magazin of the International Jazz Federation
1975/3 #35 englisch
1976/2 #40 englisch
1976/3 #41 englisch
1976/4 #44 englisch
1977/6 #50 deutsch 11. Jahrgang
1978/1 #51 internationale Edition, englisch
1978/2 #52 deutsch, 12. Jahrgang
1978/4 #54 deutsch
1978/6 #56 deutsch
1979/1 #57 deutsch
1979/3 #59 deutsch
1979/4 #60 deutsch
1979/5 #61 englisch
1979/5 #61 deutsch
1979/6 #62 deutsch
1980/1 #63 deutsch
1980/2 #64 deutsch
1980/4 #66 deutsch
1980/5 #67 englisch
1980/5 #67 deutsch
1981/2 #70 deutsch
1981/3 #71 deutsch
1981/5 #73 deutsch
1981/6 #74 deutsch
1982/2 #75 deutsch
1982/5 #78 englisch
1983/1 #80 englisch
1983/2 #81 englisch
1983/3 #82 englisch
1983/4 #83 englisch
1983/5 #84 englisch
1984/1 #86 englisch
1984/2 #87 englisch
1984/3 #88 englisch
1984/4 #89 englisch
1984/5 #90 englisch
1984/6 #91 englisch
1985/1 #92 englisch
1985/2 #93 englisch
1985/3 #94 englisch
1985/4 #95 englisch
1985/5 #96 englisch
1985/6 #97 englisch
1986/1 #98 englisch
1986/2 #99 englisch
1986/3 #100 englisch
1986/4 #101 englisch
1986/5 #102 englisch
1986/6 #103 englisch
1987/2 #105 englisch
1987/4 #107 englisch
1987/5 #108 englisch
1987/6 #109 englisch
1988/1 #110 englisch
1988/2 #111 englisch
1988/3 #112 englisch
1988/5 #114 englisch |
JAZZFORUM_VILNIUS – P-1171 ( Litauen)
1988: ? |
JAZZ FREAK – P-174
Netherlands
1979/80: Vol. 7/1-6
1980/81: Vol. 8/1-6
1981/82: Vol. 9/1-6
1982/83: Vol. 10/1-4, 6, Vol. 11/2 (Nov)
1984: Vol. 11/4-6 (Mar, May, Jul); Vol. 12/1-2 (Sep-Nov)
1985: Vol. 12/3-6 (Jan-Jul); Vol. 13/2 (Nov)
1986: Vol. 13/3 (Jan); Vol. 14/2 (Nov)
1987: Vol. 14/3 (Jan)
1988: Vol. 15/6 (Jul/Aug); Vol. 16/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
1989: Vol. 16/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); Vol. 17/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
1990: Vol. 17/3 (Jan/Feb)
1993: Vol. 21/1 (Sep/Oct); Vol. 21/2 (Nov/Dec)
1994: Vol. 21/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); Vol. 22/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
1995: Vol. 22/3-5/6 (Jan/Feb-Jul) |
JAZZFREUND, Der – P-237
Germany
1965: Vol. 7/3-4 (#39-40)
1966: Vol. 6/1 (#41), 3-4 (#43-44)
1967: Vol. 9/1 (#45), 3-4 (#47-48)
1968: Vol. 10/2 (#50), 12 (#52)
1969: Vol. 11/1-4 (#53-56)
1970: Vol. 12/1-4 (#57-60)
1971: Vol. 13/1-4 (#61-64)
1972: Vol. 14/1-4 (#65-68)
1973: Vol. 15/1-4 (#69-72)
1974: Vol. 16/1-4 (#73-76)
1975: Vol. 17/1-4 (#77-80)
1976: Vol. 18/1-4 (#81-84)
1977: Vol. 19/1-4 (#85-88)
1978: Vol. 20/1-4 (#89-92)
1979: Vol. 21/1-4 (#93-96)
1980: Vol. 22/1-4 (#97-100)
1981: Vol. 23/1-4 (#101-104)
1982: Vol. 24/1-4 (#105-108)
1983: Vol. 25/1-4 (#109-112)
1984: Vol. 26/1-4 (#113-116)
1985: Vol. 27/1-4 (#117-120)
1986: Vol. 28/1-4 (#121-124)
1987: Vol. 29/1-4 (#125-128)
1988: Vol. 30/1-4, #129-132 (Mar, Jun, Sep, Dec)
1989: Vol. 31/1-4, #133-136 (Mar, Jun, Sep, Dec)
1990: Vol. 32/1-4, #137-140
1991: Vol. 33/1-4, #141-144 (Mar, Jun, Sep, Dec)
1992: Vol. 34/2-3, #146-148 (Jun, Sep, Dec)
1993: Vol. 35/1-4, #149-152 (Mar, Jun, Sep, Dec)
1994: Vol. 36/1-4, #153-156 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1995: Vol. 37/1-4, #157-160 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1996: Vol. 38/1-4, #161-164 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1997: Vol. 39/1-4, #165-168 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1998: Vol. 40/1-4, #169-172 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1999: Vol. 41/1-4, #173-176 (Mar,Jun,Sep,Dec) |
JAZZ GUIDE, The – P-943
England
1966: Vol. 2/10-12
1967: Vol. 3/1-5 |
JAZZ’ HALO – P-741
Belgien
1997: Vol. 1/1-4 (Jan-Oct)
1998: Vol. 2/1-4 (Jan-Dec)
1999: Vol. 3/1-3 (Apr-Oct), 12 (Dec) [new numbering]
2000: Vol. 4/13-16 (Jul,Sep,Nov,Dec)
2001: Vol. 5/17-19 (May,Aug,Dec), 20 (special issue)
2002: Vol. 6/21-22 (May-Oct)
2003: Vol. 6/23-24 |
JAZZHIRADà – P-898
Hungary
1971: Vol. 1/1-2
1972: Vol. 2/1-9
1973: Vol. 3/1-3
1974: Vol. 4/1-2
1975: Vol. 5 (Sep) |
JAZZ HIP
(Revue d’information)
France
1962: Vol. 5/31
1963: Vol. 6/32-34
1960s: #36-38 |
JAZZ HOME – P-175
Germany
1949: Vol. 1/1-5
1950: Vol. 2/1 [last issue; one further issue continued as part of Anglo German Swing Club News Sheet, #5 (Feb.1950)] |
JAZZ HOT – P-176
France
1935: Vol. 1/1-5
1936: Vol. 2, #6-13
1937: Vol. 3, #14-21
1938: Vol. 4, #22-28
1939: Vol. 5, #29-32
1943: (as “Circulaire du Hot Club de France”: Vol. 9, #7-8 (Oct-Nov [Nov-no mis-identified as #7 (Oct)])
1944: (as “Circulaire du Hot Club de France”: Vol. 10, May
1945: Vol. 11, #1-2 (Oct-Dec)
1946: Vol. 12, #4-11 (Jan/Feb-Dec)
1947: Vol. 13, #12-19
1948: Vol. 14, #Special, #20-28
1949: Vol. 15, #Special, #29-31, 33-39
1950: Vol. 16, #Special, #40-50
1951: Vol. 17, #51-61
1952: Vol. 18, #62-72
1953: Vol. 19, #73-83
1954: Vol. 20, #84-94
1955: Vol. 21, #95-105
1956: Vol. 22, #106-116
1957: Vol. 23, #117-127
1958: Vol. 24, #128-138
1959: Vol. 25, #139-149
1960: Vol. 26, #150-160
1961: Vol. 27, #161-171
1962: Vol. 28, #172-182
1963: Vol. 29, #183-193
1964: Vol. 30, #194-204
1965: Vol. 31, #205-215
1966: Vol. 32, #216-226
1967: Vol. 33, #227-237
1968: Vol. 34, #238-245
1969: Vol. 35, #246-256
1970: Vol. 36, #257-267
1971: Vol. 37, #268-278
1972: Vol. 38, #279-289
1973: Vol. 39, #290-300
1974: Vol. 40, #301-311
1975: Vol. 41, #312-322
1976: Vol. 42, #323-333
1977: Vol. 43, #334-344
1978: Vol. 44, #345/346-355 (Dec/Jan-Nov)
1979: Vol. 45, #356/357-367 (Dec/Jan-Nov)
1980: Vol. 46, #368/369-378 (Dec/Jan-Nov)
1981: Vol. 47, #379/380-390 (Dec/Jan-Dec)
1982: Vol. 48, #391/392-396 (Jan/Feb-Sep/Oct)
1983: Vol. 49, #397-406 (Jan/Feb-Dec)
1984: Vol. 50, #407-416 (Jan/Feb-Dec)
1985: Vol. 51, #417-427 (Jan -Dec)
1986: Vol. 52, #428-436 (Jan-Dec)
1987: Vol. 53, #437-447 (Jan-Dec)
1988: Vol. 54, #448-458 (Jan-Dec)
1989: Vol. 55, #459-469 (Jan-Dec)
1990: Vol. 56, #470-480 (Jan-Dec)(8 month interception)
1991: Vol. 57, #481-484 (Sep-Dec)
1992: Vol. 58, #485-495 (Jan-Dec)
1993: Vol. 59, #495-506 (Jan-Dec/Jan)
1994: Vol. 60, #507-516 (Feb-Dec/Jan)
1995: Vol. 61, no. special, #517-526 (Feb-Dec/Jan)
1996: Vol. 62, no. special, #527-536 (Feb-Dec/Jan)
1997: Vol. 63, no. special, #537-545 (Feb-Dec/Jan)
1998: Vol. 64, no. special, #547-556 (Feb-Dec/Jan)
1999: Vol. 65, no. special, #557-566 (Feb-Dec/Jan)
2000: Vol. 66, no. special, #567-576 (suppl.) (Feb-Dec/Jan)
2001: Vol. 61, no. special, #577-586 (suppl.) (Feb-Dec/Jan)
2002: Vol. 62, no. special, #587-594, 596 (suppl.) (Feb-Oct, Dec)
2003: Vol. 63, no. special #597-606 (suppl.) (Feb-Dec)
2004: Vol. 64, no. special, #607-616 (Feb-Dec)
2005: Vol. 65, no. special, #617-626 (suppl.) (Feb-Dec)
2006: Vol. 66, no. special, #627-635 (Feb-Dec)
2007: Vol. 67, no. special, #636-644 (Feb-Nov) |
JAZZ IMPROV – P-844
Timeless Music Motivation & Ideas for Jazz Lovers
USA
1998: Vol. 1/1-4
1999: Vol. 2/1-3
2000: Vol. 2/4
2001: Vol. 3/1-3 |
JAZZ IMPROV NY – P-1062
The Ultimate Directory of NY Area Jazz Club, Concert & Event Listings
2008: Vol. 3/7 (Jan); Vol. 3/9-10 (Mar-Apr)
[complete as pdf files from Jul.2005 to Jul.2009; continued as “Jazz Inside NY”] |
JAZZ IN ARKANSAS – P-387
Newsletter
USA
1966: Mar-Apr, Jul-Sep
1967: Jun, Dec/Jan
1968: Feb, 13.Dec
1969: 19.Feb, 3.Apr, 1.May, Jun, Jul, 19.Aug, 3.Sep, 2.Oct
1970: 29.Jul, 3.Sep, 1.Oct, 3.Dec, 30.Dec
1971: 3.Feb, 3.Mar, 1.Apr, 29.Apr, 3.Jun, 24.Jun, 28.Jul, 1.Sep |
JAZZ IN BERLIN – P-177
Germany
1987: May-Jul, Sep-Dec
1988: Jan, Mar-May |
JAZZ IN DUISBURG – P-683
Germany
1995: #2 |
JAZZ INFO – P-478
Programm des Jazzclub Darmstadt e.V.
Germany
1993: 1. Halbjahr |
JAZZ INFORMATION – P-725
USA
1939: Vol. 1/3 (26.Sep), 5-6 (10.-17.Oct), 9 (7.Nov), 13 (8.Dec) [1/2-1/16 (19.Sep-29.Dec.1939) as typed xerox/digi.copy]
1940: Vol. 1/18 (12.Jan), 23 (23.Feb), 25 (8.Mar), 27 (29.Mar), 30 (26.Apr), 32 (10.May)
Vol. 2/1 (26.Jul), 3 (23.Aug), 5-7 (20. Sep, 4.Oct, 25.Oct), 9 (22.Nov) [1/17-1/24 (5.Jan-1.Mar) as typed xerox/digi.copy]
1941: Vol. 2/13 (7.Feb), 15-16 (21.Mar,Nov) |
JAZZ INFORMATION – P-762
Denmark
1950: Vol. 1/1-5 (Feb-Jun/Jul) |
JAZZ-INFORMATIONEN – P-1086
Germany
1959: #8 (Feb) |
JAZZ INSIDE NY – P-1073
The Ultimate Directory of NY Area Jazz Club, Concert & Event Listings
USA
2009: Vol.1/2 (Sep)
2011: Vol. 2/7 (Feb)
2012: Vol. 3/7 (Feb)
[complete issues from Aug.2009 as pdf-Files] |
JAZZ IN TIME – P-178
Belgium
1989: #1-9 (Mar-Dec)
1990: #10-19 (Jan-Dec/Jan)
1991: #20/21-29 (Jan-Dec)
1992: #30-38 (Jan-Dec); Festival-Supplement
1993: #39-48 (Jan-Nov)
1994: #49-58 (Feb-Dec)
1995: #59-61 (Feb-Apr) |
JAZZ IN UND UM DARMSTADT – P-179
Germany
1983: Oct, Dec
1984: Jan-Mar, May-Dec
1985: Jan-Oct
1986: Mar-Dec
1987: Jan-Feb, Apr-Dec
1988: Jan-Sep, Nov-Dec
1989: Feb-Dec
1990: Jan-Dec
1991: Jan-Dec
1992: Jan-Dec [last issue] |
JAZZISM – P-1088
Netherlands
(formerly “Jazz Nu”)
2011: #2-6 (Mar/Apr-Nov/Dec)
2012: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2013: #1-7 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2014: #1-7 (Jan/Feb-Dec)
2015: #1-7 (Jan/Feb-Dec)
2016: #1-7 (Jan/Feb-Dec/Jan)
2017: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2018: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2019: #1-5 (Mar/Apr-Nov/Dec)2020: #6 (Winter) #1-5 (Mar/Apr-Nov/Dec)
2021: #6 (Winter) #1-2 (Mar/Apr-May/Jun) |
JAZZIT – P-905
Italy
2000: Vol. 2/1,3 (Jan/Feb,Jul/Aug)
2001: Vol. 3/2,4,6 (Jan/Feb,May/Jun,Sep/Oct)
2002: Vol. 3/8-9 (Jan/Feb-Mar/Apr), 4/12-13 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2003: Vol. 5/14 (Jan/Feb)
2009: Vol. 11/51-55 (Mar/Apr-Nov/Dec)
2010: Vol. 12/56-58 (Jan/Feb-May/Jun), 60-61 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2011: Vol. 13/62-66 (Jan/Feb-Sep/Oct)
2012: Vol. 14/70-72 (May/Jun-Sep/Oct) |
JAZZIZ – P-238
USA
1984: Vol. 1/1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1985: Vol. 2/1-4 (Jan/Feb-Jul/Aug)
1986: Vol. 3/1-2 (Dec/Jan-Feb/Mar), 4-6 (Jun/Jul-Oct/Nov)
1987: Vol. 4/1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
1988: Vol. 5/1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
1989: Vol. 6/1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
1990: Vol. 7/1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
1991: Vol. 8/1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
1992: Vol. 9/1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
1993: Vol. 10/1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
1994: Vol. 11/1-8 (Jan/Feb-Dec)
1995: Vol. 12/1-12 (Jan-Dec)
1996: Vol. 13/1-12 (Jan/Feb-Dec)
1997: Vol. 14/1-8 (Jan-Aug), 10-12 (Oct-Dec)
1998: Vol. 15/1-12 (Jan-Dec)
1999: Vol. 16/1-12 (Jan-Dec)
2000: Vol. 17/1-12 (Jan-Dec)
2001: Vol. 18/1-12 (Jan-Dec)
2002: Vol. 19/1-12 (Jan-Dec)
2003: Vol. 20/1-12 (Jan-Dec)
2004: Vol. 21/1-12 (Jan-Dec)
2005: Vol. 22/1-12 (Jan-Dec)
2006: Vol. 23/3-5, 7-12 (Mar-May, Jul-Dec)
2007: Vol. 24/2-6, 8, 11-12 (Jan/Feb-Jun, Aug, Nov-Dec)
2008: Vol. 25/2, 9-12 (Mar, Sep-Dec)
2009: Vol. 26/1, 3, 5, 8 (Jan/Feb, Summer, Fall, Winter
2010: Vol. 27/2-3, 6, 9, 12 (Mar/Apr, Spring, Summer, Fall, Winter)
2011: Vol. 28/3 (Spring)
2013: Vol. 30/3 (Spring), 9 (Fall), 12 (Winter)
2014: Vol. 31/3, 6, 9 (Spring-Summer-Fall)
2015: Vol. 31/12 (Winter),
Vol. 32/3 (Spring), 6 (Summer), 9 (Fall)
2016: Vol. 32/12 (Winter),
Vol. 33/3 (Spring), 6 (Summer), 9 (Fall)
2017: Vol. 33/12 (Winter);
34/3 (Spring), 6 (Summer), 9 (Fall),
2018: 34/12 (Winter); 35/3 (Spring), 35/6 (Summer), 35/9 (Fall)
2019: 36/3 (Spring); 36/6 (Summer); 36/9 (Fall)
2020: 36/12 (Winter); 37/3 (Spring), 37/6 (Jun), 37/9 (Fall)
2021: 37/12 (Winter), 38/3 (Spring) |
JAZZJAARBOEK – P-669
Netherlands
1982: Vol. 1
1983: Vol. 2
1984: Vol. 3
1985: Vol. 4
1986: Vol. 5
1987: Vol. 6
1988: Vol. 7 |
JAZZ JAMBOREE -P-1163
(Intern. Jazzfestival Warschau, Polen)
1971: #14
1974: #17
1976: #19
1977: #20
1978: #21
1979: #22
1980: #23
1981: #24
1983: #25
1984: #26
1985: #27
1986: #28
1987: #29 |
JAZZ JOURNAL – P-180
England
1949: Vol. 2/6 (Jun), 8 (Aug) [Vol. 2/1-2/12 = digi.copy]
1950: Vol. 3/3 (Mar), 5 (May), 9 (Sep), 11 (Nov) [Vol. 3/1-3/12 = digi.copy]
1951: Vol. 4/3-8 (Mar-Aug), 12 (Dec) [Vol. 4/1-4/12 = digi.copy]
1952: Vol. 5/1-12 (Jan-Dec)
1953: Vol. 6/1-12 (Jan-Dec) [Jul-Aug: some pages cut] (können ausgetauscht werden, Rolf)
1954: Vol. 8/1-12 (Jan-Dec) [Dec 1954, p.19-26 cut]
1955: Vol. 8/1-12 (Jan-Dec)
1956: Vol. 9/1-12 (Jan-Dec)
1957: Vol. 10/1-12 (Jan-Dec)
1958: Vol. 11/1-12 (Jan-Dec)
1959: Vol. 12/1-12 (Jan-Dec)
1960: Vol. 13/1-12 (Jan-Dec)
1961: Vol. 14/1 (Jan), 3-12 (März-Dec) [Vol. 4/2-4/3 = digi.copy]
1962: Vol. 15/1-12 (Jan-Dec)
1963: Vol. 16/1-12 (Jan-Dec)
1964: Vol. 17/1-12 (Jan-Dec)
1965: Vol. 18/1-12 (Jan-Dec)
1966: Vol. 19/1-12 (Jan-Dec)
1967: Vol. 20/1-12 (Jan-Dec)
1968: Vol. 21/1-12 (Jan-Dec)
1969: Vol. 22/1-12 (Jan-Dec)
1970: Vol. 23/1-12 (Jan-Dec)
1971: Vol. 24/1-12 (Jan-Dec)
1972: Vol. 25/1-12 (Jan-Dec)
1973: Vol. 26/1-12 (Jan-Dec)
1974: Vol. 27/1-12 (Jan-Dec)
1975: Vol. 28/1-12 (Jan-Dec)
1976: Vol. 29/1-12 (Jan-Dec)
1977: Vol. 30/1-12 (Jan-Dec)
1978: Vol. 31/1-12 (Jan-Dec)
1979: Vol. 32/1-12 (Jan-Dec)
1980: Vol. 33/1-12 (Jan-Dec)
1981: Vol. 34/1-12 (Jan-Dec)
1982: Vol. 35/1-12 (Jan-Dec)
1983: Vol. 36/1-12 (Jan-Dec)
1984: Vol. 37/1-12 (Jan-Dec)
1985: Vol. 38/1-12 (Jan-Dec)
1986: Vol. 39/1-12 (Jan-Dec)
1987: Vol. 40/1-12 (Jan-Dec)
1988: Vol. 41/1-12 (Jan-Dec)
1989: Vol. 42/1-12 (Jan-Dec)
1990: Vol. 43/1-12 (Jan-Dec)
1991: Vol. 44/1-12 (Jan-Dec)
1992: Vol. 45/1-12 (Jan-Dec)
1993: Vol. 46/1-12 (Jan-Dec)
1994: Vol. 47/1-12 (Jan-Dec)
1995: Vol. 48/1-12 (Jan-Dec)
1996: Vol. 49/1-12 (Jan-Dec)
1997: Vol. 50/1-12 (Jan-Dec)
1998: Vol. 51/1-12 (Jan-Dec)
1999: Vol. 52/1-12 (Jan-Dec)
2000: Vol. 53/1-12 (Jan-Dec)
2001: Vol. 54/1-12 (Jan-Dec)
2002: Vol. 55/1-12 (Jan-Dec)
2003: Vol. 56/1-12 (Jan-Dec)
2004: Vol. 57/1-12 (Jan-Dec)
2005: Vol. 58/1-12 (Jan-Dec)
2006: Vol. 59/1-12 (Jan-Dec)
2007: Vol. 60/1-12 (Jan-Dec)
2009: Vol. 62/3-10 (May-Dec) [complete year; Jazz Journal folded for some issues, then changed owners]
2010: Vol. 63/1-12 (Jan-Dec)
2011: Vol. 64/1-12 (Jan-Dec)
2012: Vol. 65/1-12 (Jan-Dec)
2013: Vol. 66/1-12 (Jan-Dec)
2014: Vol. 67/1-12 (Jan-Dec)
2015: Vol. 68/1-12 (Jan-Dec)
2016: Vol. 69/1-12 (Jan-Dec)
2017: Vol. 70/1-12 (Jan-Dec)
2018: Vol. 71/1-12 (Jan-Dec) |
JAZZ JUBILEE BUGLE – P-617
Sacramento Traditional Jazz Society
USA
Newsletter:
1971: Vol. 2/5 (May)
1972: Vol. 3/11 (Nov)
1973: Mar, May
1974: 22.Jan, 23.Jan, 8.Mar, Vol. 5/8 (Oct),
1975: Jul
1976: Jul, Aug
1978: Jun |
JAZZLAND – P-1169 Italien, Mailand
1965 #3/4 (März/April) |
JAZZ LIFE BRASS & WOODWIND CATALOG – P-182
Japan
1987: #1 (Jan) |
JAZZ LIFE DISC REVIEW/Catalog – P-183
Japan
1987: #11-12 (Nov-Dec)
1988: #1-2 (Jan-Feb), 4-8 (Apr-Aug), 10-12 (Oct-Dec)
1989: #1-12 (Jan-Dec)
1990: #1-12 (Jan-Dec)
1991: #1-10 (Jan-Oct)
1993: [1 Heft] |
JAZZ LIFE VIDEO CATALOG – P-184
Japan
1989: #7 (Jul) |
JAZZ LINE – P-829
Australia
1974: Vol. 7: #3 |
JAZZLINE NEWS – P-239
LAG Jazz Schleswig-Holstein
Germany
1991: #1-4
1992: #1-2 |
JAZZ LINK MAGAZINE – P-185
USA
1988: Vol. 1/7 (Nov)
1991: Vol. 4/36-40 (Jun-Oct) |
JAZZ LIVE – P-186
Austria
1983: Vol. 1, #1 (Jul), Vol.2, #3-6/7 (Aug/Sep-Dec/Jan)
1984: Vol. 2, #8-13 (Feb-Jul/Aug), 15-17 (Oct-Dec/Jan)
1985: Vol. 2, #19-27 (Mar-Dec)
1986: Vol. 3, #28-32 (Jan-Jun); Vol.4, #33-37 (Jul-Dec)
1987: Vol. 4, #38-47 (Jan-Dec)
1988: Vol. 5, #48-57 (Jan-Dec)
1989: Vol. 6, #60-65 (Jan-Jun); Vol.7, #66-71 (Jul-Dec)
1990: Vol. 7, #72-78 (Jan-Jul); Vol.8, #79 (Aug), 81-83 (Oct-Dec)
1991: Vol. 8, #84-95 (Jan-Dec)
1992: Vol. 9, #96-97, Vol. 10, #98-99
1993: Vol. 10, #100-103, Jazz Live Extra (Herbst ï93)
1994: Vol. 10, #104 (Jazzfest Wien); Vol. 11, #105-106,
1995: Vol. 11, #107; Vol. 12, #108; Vol.12, #109
1996: Vol. 13, #110-114
1997: Vol. 15, #114-117
1998: Vol. 15, #118-121
1999: Vol. 16, #122-125
2000: Vol. 17, #126-129
2001: Vol. 18, #130-134
2002: Vol. 19, #135-136
2003: Vol. 20, #137-138 |
JAZZ SOCIETY / JAZZ MAGASINET – P-1106
Organ for Norsk Jazzforbund
[”Jazz Society” up to Dec.1958; “Jazz Magasinet” from Jan.1959]
Norwayy
1958: Vol. 2/9 (Sept), 12 (Dec)
1959: Vol. 3/1-2/3 (Jan-Feb/Mar) |
JAZZ MAGAZINE – P-761
Argentina
1945: Vol. 1/2 (Oct), 1/4 (Dec)
1946: Vol. 1/5-10 (Jan-Jul), Vol. 2/12-13 (Sep-Oct)
1954: #44 (Jan/Feb) |
JAZZ MAGAZINE – P-187
England
1946: Vol. 3/1-3 |
JAZZ MAGAZINE – P-188
France
1954: Vol. 1, #1 (Dec)
1955: Vol. 1, #2-11 (Jan-Nov); Vol. 2, #12 (Dec)
1956: Vol. 2, #13-21 (Jan-Nov); Vol. 3, #22(Dec)
1957: Vol. 3, #23-32 (Jan-Nov); Vol. 4, #33(Dec)
1958: Vol. 4, #34-42 (Jan-Nov); Vol. 5, #43(Dec)
1959: Vol. 5, #44-53 (Jan-Nov); Vol. 6, #54(Dec)
1960: Vol. 6, #55-65 (Jan-Dec)
1961: Vol. 7, #66-77 (Jan-Dec)
1962: Vol. 8, #78-89 (Jan-Dec)
1963: Vol. 9, #90-101(Jan-Dec)
1964: Vol. 10, #102-113(Jan-Dec)
1965: Vol. 11, #114-125(Jan-Dec)
1966: Vol. 12, #126-137(Jan-Dec)
1967: Vol. 13, #138-149 (Jan-Dec)
1968: Vol. 14, #150-161 (Jan-Dec)
1969: Vol. 15, #162-173 (Jan-Dec)
1970: Vol. 16, #174-184 (Jan-Dec)
1971: Vol. 17, #185-195 (Jan-Dec)
1972: Vol. 18, #196-206 (Jan-Dec)
1973: Vol. 19, #207-214 (Jan-Sep), #216-217 (Oct/Nov-Dec)
1974: Vol. 20, #218-228 (Jan-Dec)
1975: Vol. 21, #229-238 (Jan-Nov)
1976: Vol. 22, #240-242 (Jan-Mar), #244-250 (May-Dec)
1977: Vol. 23, #251-260 (Jan-Dec)
1978: Vol. 24, #261-270 (Jan-Dec)
1979: Vol. 25, #271-281 (Jan-Dec)
1980: Vol. 26, #282-292 (Jan-Dec)
1981: Vol. 27, #293-302 (Jan-Dec)
1982: Vol. 28, #303-313 (Jan-Dec)
1983: Vol. 29, #314-324 (Jan-Dec)
1984: Vol. 30, #325-334 (Jan-Dec)
1985: Vol. 31, #335-345 (Jan-Dec)
1986: Vol. 32, #346-356 (Jan-Dec)
1987: Vol. 33, #357-367 (Jan-Dec/Jan)
1988: Vol. 34, #368-377 (Feb-Dec)
1989: Vol. 35, #378-388 (Jan-Dec)
1990: Vol. 36, #389-399 (Jan-Dec)
1991: Vol. 37, #400-410 (Jan-Dec)
1992: Vol. 38, #411-421 (Jan-Dec)
1993: Vol. 39, #422-432 (Jan-Dec)
1994: Vol. 40, #433-443 (Jan-Dec)
1995: Vol. 41, #444-447 (Jan-Dec)
1996: Vol. 42, #455-465 (Jan-Dec)
1997: Vol. 43, #466-476 (Jan-Dec)
1998: Vol. 44, #477-487 (Jan-Dec)
1999: Vol. 45, #488-499 (Jan-Dec)
2000: Vol. 46, #500-510 (Jan-Dec)
2001: Vol. 47, #511-521 (Jan-Dec) (suppl.: #519, Miles Davis special)
2002: Vol. 48, #522-531 (Jan-Dec) (suppl.: CDs 2001 ranking of the critics) (suppl.: 532, CD:Hommage à Henri Renaud et Guide 2002 Les Meilleurs CDs)
2003: Vol. 49, #533-543 (Jan-Dec)
2004: Vol. 50, #544-554 (Jan-Dec)
2005: Vol. 51, #555-565 (Jan-Dec)
2006: Vol. 52, #566-576 (Jan-Dec)
2007: Vol. 53, #577 (Jan)
2009: Vol. 55, #606-609 (Sep-Dec) [ab September zusammengeführt mit Jazzman als “Jazzmagazine/Jazzman”]
2010: Vol. 56, #610-620 (Jan-Dec)
2011: Vol. 57, #621-632 (Jan-Dec) ) [+ special Jun.2011, “Jazz à Vienne”]
2012: Vol. 58, #633-644 (Jan-Dec) [+ special Jun.2012, “Jazz à Vienne”]
2013: Vol. 59, #645-656 (Jan-Dec) [+ special Jun.2013, “Jazz à Vienne”]
2014: Vol. 60, #657-668 (Jan-Dec) [+ special Jun/Jul.2014]
2015: Vol. 61, #669-679 (Feb-Dec)
2016: Vol. 62, #680-690 (Feb-Dec) [+ special “Portfolio J.-P. Leloir“)
2017: Vol. 63 #691-701 (Feb-Dec) [+special Aug 2017 “Jazz, pop et soul”]
2018: Vol. 63 #702-712 (Feb-Dec) [special Guide Festivals del’ete]
2019: #713-723 (Feb-Dec)
2020: #724-733 (Feb-Dec) [#727 (May) digital only!]
2021: #734-737 (Feb-May) |
JAZZ MAGAZINE – P-821
Netherlands
1993: Vol. 1/1-4 (Jun/Jul-Dec/Jan) |
JAZZ MAGAZINE – P-941
USA
1976: Vol. 1/1-2 (Summer-Fall)
1977: Vol. 1/3-4 (Spring-Summer)
1978: Vol. 2/3-4 (Spring-Summer), 3/1-2 (Fall-Winter)
1979 Vol: 3, #4
1980: Vol. 4/2 (Spring) |
JAZZMÁL – P-897
Iceland
1967: Vol. 1/1 |
P-453
(Beilage zu La Monde du Musique)
France
1992: #160-161 (Nov-Dec)
1993: #163-164 (Jan-Feb)
1996: #13 (Apr)
1997: #23 (Mars) |
JAZZMAN – P-944
France
1995: #1-9 (Mar-Dec)
1996: #10-20 (Jan-Dec)
1997: #21-31 (Jan-Dec)
1998: #32-42 (Jan-Dec)1999: #43-53 (Jan-Dec)
2000: #54-64 (Jan-Dec)
2001: #65-75 (Jan-Dec)
2002: #76-86 (Jan-Dec)
2003: #87-97 (Jan-Dec)
2004: #98-108 (Jan-Dec)
2005: #109-119 (Jan-Dec)
2006: #120-130 (Jan-Dec)
2007: #131-141 (Jan-Dec)
2008: #142-152 (Jan-Dec)
2009: #153-159 (Jan-Jul/Aug) [ab September fortgeführt als “Jazz Magazine/Jazzman”] |
JAZZ MODERNE – P-801
Austria
1953: #2 (Oct/Dec) |
JAZZ MONTHLY – P-190
England
1955: Vol. 1/2 (Apr), 4 (Jun), 8-10 (Oct-Dec)
1956: Vol. 1/11-12 (Jan-Feb);
Vol. 2/1-10 (Mar-Dec)
1957: Vol. 2/11-12 (Jan-Feb);
Vol. 3/1-10 (Mar-Dec)
1958: Vol. 3/11-12 (Jan-Feb);
Vol. 4/1-10 (Mar-Dec)
1959: Vol. 4/11-12 (Jan-Feb);
Vol. 5/1-10 (Mar-Dec)
1960: Vol. 5/11-12 (Jan-Feb);
Vol. 6/1-10 (Mar-Dec)
1961: Vol. 6/11-12 (Jan-Feb);
Vol. 7/1-10 (Mar-Dec)
1962: Vol. 7/11-12 (Jan-Feb);
Vol. 8/1-10 (Mar-Dec)
1963: Vol. 8/11-12 (Jan-Feb);
Vol. 9/1-4 (Mar-Jun), 6-10 (Aug-Dec)
1964: Vol. 9/11-12 (Jan-Feb);
Vol. 10/1-2 (Mar-Apr), 4-10 (Jun-Sep-Dec)
1965: Vol. 10/12 (Feb);
Vol. 11/1-10 (Mar-Dec)
1966: Vol. 11/11-12 (Jan-Feb);
Vol. 12/1-10 (Mar-Dec)
1967: Vol. 12/11-12 (Jan-Feb);
Vol. 13, #2-10 (Mar-Dec)
1968: Vol. 13-14/155-166 (Jan-Dec)
1969: Vol. 14-15/167-178 (Jan-Dec; May & Jun both have the same no. [#171])
1970: Vol. 15-16/179-190 (Jan-Dec)
1971: Vol. 16-17/191-192 (Jan-Feb) |
JAZZMOZAIEK – P-1025
Belgian
2005: Vol. 3 (Sep/Oct/Nov) |
JAZZ MUSIC – P-191
England
1943: Vol. 1/4, 1/7; Vol. 2/1-4 (#4, #7, #11-14; ca.Apr, ca.Jul, Sep-Dec)
1944: Vol. 2/5-8 (#15-18; Jan-Apr)
1946: Vol. 3/1-4
1947: Vol. 3/5-6
1948: Vol. 3/7-10
1949: Vol. 4/1-3
1950: Vol. 4/4
1951: Vol. 4/5-7
1952: Vol. 4/8
1954: Vol. 5/1-2, 4-8
1955: Vol. 6/1-6
1956: Vol. 7/1-6
1957: Vol. 8/1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1958: Vol. 9/1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1959: Vol. 10/1-4 (Jan/Feb-Jul/Aug)
1960: Vol. 11/1-7/8 (Jan-Jul/Aug) |
JAZZ MUSIC BOOKS – P-192
England
1943: [Rudi Blesh: This Is Jazz]
1944: [Frederic Ramsey Jr.: Chicago Documentary]
[Jazz Folio]
[Jazz Miscellany]
1945: [Piano Jazz No.1 / No. 2] [Jazz Review]
1946: Apr [A Tribute to Huddie Ledbetter] |
JAZZ MUSIC TODAY – P-193
Japan
1990: Vol. 1 (PR-Newsletter) |
JAZZMUSIK – P-1188
Germany
1958: Vol. 1/12 (Dec) |
JAZZ ‘N’ BLUES ‘N’ AROUND – P-832
Italy
1998: Vol. 5/3-7 (Aug/Sep-Dec) |
JAZZ ‘N’ MORE – P-880
(Das Schweizer Jazzmagazin)
Switzerland
1999: #4 (Dec)
2000: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2001: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2002: #1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2003: #1-3, 5-6 (Feb/Mar-Jun/Jul, Oct/Nov-Dec/Jan)
2004: #1-6 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2005: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2006: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2007: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2008: #2-6 (Mar/Apr-Nov/Dec)
2009: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2010: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2011: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2012: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2013: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2014: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2015: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2016: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec), special edition
2017: #1-6 (Jan-Nov/Dec)
2018: #2-6 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2019: #1-5 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2020: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2021: #1-3 (Jan/Feb-May/Jun) |
JAZZ NAD ODRA – P-1164
Polen1976: #1
1977: #1-3 |
JAZZ NACHRICHTEN – P-596
East Germany (DDR)
1984: Jan/Feb.1984 |
JAZZ NEW ENGLAND – P-194
USA
1974: Vol. 1/1-3 (Oct-Dec)
1975: Vol. 1/4-8 (Jan-Nov)
1983: #1-2 (fall-winter) |
JAZZ NEW ENGLAND NEWSLETTER – P-431
USA
1984: spring |
JAZZ NEWS – P-1109
International Jazz Festival Prague
1967: Oct |
JAZZ NEWS – P-195
France
1948: #1 (Christmas)
1949: #2-6 (Jan-Jun), 7-10 (Oct-Nov)
1950: #9-11 (Mar,Apr,Jun) |
JAZZ NEWS – P-1129
France
2012: #17 (Dez)
2013: #19-21 (Mar-Mai), 27 (Dec)
2014: #28-33 (Jan/Feb-Jul), 35-37 (Sep-Dec)
2015: #38 (Jan/Feb) |
JAZZ NEWS – P-196
England
1957: Aug
1960: Vol. 4/31-32 (17.-24. Sep)
1961: Vol. 5/8 (25.Feb), 10 (8.Mar)
1962: Vol. 6/6 (7. Feb), 17 (25. Apr), 21-22 (30. May-6. Jun), 23 (13.Jun), 38 (26. Sep) |
JAZZ NEWS – P-197
Ireland
1987: Vol. 1/3, 5, 6 (May/Jun, Sept/Okt, Nov/Dec)
1988: Vol. 2/1-5 (Mar-Nov/Dec)
1989: Vol. 3/3-5 (May/Jun-Sep/Oct) |
JAZZ NEWS – P-498
Austria
1971: #1, 5-6 |
JAZZ NEWS – P-1095
Publikationsorgan der Interessengemeinschaft der Zürcher Jazz-Clubs
Switzerland
1952: unnumbered |
JAZZ NEWS FROM SWEDEN – P-686
Sweden
1993: #1-2
1994: #3 |
JAZZ NEWSLETTER (#0 als JID Newsletter) – P-447
Jazz-Institut Darmstadt
Germany
1992: #0 (Sep), special number [Wynton Marsalis Discography]
1993: #1 (Jan), #2 (May), #3 (Aug), #4 (Sep)
1994: #5 (Nov), #6 (Dec) |
JAZZNEWSLETTER – P-634
(DRS) Switzerland
1991: #4-5 (Aug-Sep), #8 (Dec)
1992: #9-10 (Jan-Feb)
1993: #21 (Jan), #24-26 (Apr-Jun), #31-32 (Nov-Dec)
1994: #33 (Jan), #35-44 (Mar-Dec)
1995: #45-53, 55-56 (Jan-Sep, Nov-Dec)
1996: #57-62, 64-66 (Jan-Jun, Oct) |
JAZZ NZ – P-881
New Zealand
1981: Vol. 1/2 (Apr/Jun) |
JAZZNOCRACY – P-1174 (Wavendon, England)
(?) #5 |
JAZZ NOTES – P-198
A Newsletter of the Jazz Journalists Association
USA
1989: Vol. 1/2-4 (Summer-Winter)
1990: Vol. 2/1-4 (Spring-Winter)
1991: Vol. 3/2-4 (Spring-Winter)
1992: Vol. 4/1-4 (Spring-Winter); “The Best of 1992”
1993: Vol. 5/1-2
1994: Vol. 6/1-3
1995: Vol. 7/1-4
1996: Vol. 8/1-4
1997: Vol. 9/1-4
1998: Vol. 10/1-2
1999: Vol. 10/3-4, 11/1
2000: Vol. 11/2-4
2001: Vol. 12/1-4
2002: Vol. 13/1-4
2003: Vol. 14/1,3-4
2004: Vol. 15/1-4
2005: Vol. 16/1-4
2006: Vol. 17/1-4
2007: Vol. 18/1-3 (Spring-Autumn)
[discontinued as printed magazine; contined as web pdf files] |
JAZZ NOTES – P-571
France
1989: #1, #3-6 (Jan,May-Dec)
1990: #7-10/11 (Feb/Mar-Oct/Nov)
1991: #12-16 (Jan/Feb-Oct/Nov)
1992: #17-21 (Jan/Feb-Dec)
1993: #22-26 (Feb/Mar-Dec)
1994: #27-31 (Feb-Dec)
1995: #32-36 (Mar-Dec)
1996: #37-41 (Mar-Dec)
1997: #42-46 (Mar-Dec)
1998: #47-51 (Mar-Dec)
1999: #52-56 (Mar-Dec)
2000: #57-61 (Mar-Dec)
2001: #62-66 (Mar-Dec)
2002: #67-71 (Mar-Dec)
2003: #72-76 (Mar-Dec)
2004: #77-81 (Mar-Dec)
2005: #82-86 (Mar-Dec)
2006: #87-89 (Mar-Jul) |
JAZZ NOTES – P-655
Australien
1946: #63 (Apr), #67-69 (Sep,Nov,Dec)
1947: #70-79 (Jan-Dec)
1948: #80 (Jan), #82-86 (Mar- Aug), #88-89 (Oct/Nov-Dec)
1949: #90-96 (Jan/Feb-Sep)
1950: #99-103 (Jan/Feb-Oct)
1960: #104 (Jul) |
JAZZ NOTES – P-682
Indianapolis Jazz Club Newsletter
USA
1959: Vol. 4/4-12 (Apr-Dec/Jan)
1960: Vol. 5/1-4 (Dec/Jan-Apr), 6/7-12 (Jun/Jul-Dec/Jan)
1961: Vol. 6/1-2/3 (Jan-Feb/Mar)
1962: Vol. 7/2-5
1963: Vol. 8/6-7
1964: Summer, Fall, Winter
1965: Spring-Fall
1968: Spring
1975: May-Jun
1978: Feb-Jun/Jul |
JAZZ NOTES – P-625
***
1979: Spring |
JAZZ (Jazz NU) – P-199
Netherlands
1978: Vol. 1/0,1-3 (Feb,Oct-Dec)
1979: Vol. 1/4-12 (Jan-Sep); Vol. 2/1-3 (Oct-Dec)
1980: Vol. 2/4-10 (Jan-Sep); Vol. 3/1-3 (Oct-Dec)
1981: Vol. 3/4-12 (Jan-Sep); Vol. 4/1-3 (Oct-Dec)
1982: Vol. 4/4-12 (Jan-Sep); Vol. 5, #48-50 (Oct-Dec)
1983: Vol. 5, #51-59 (Jan-Sep); Vol. 6, #60-62 (Oct-Dec)
1984: Vol. 6, #63-71 (Jan-Sep); Vol. 7, #72-74 (Oct-Dec)
1985: Vol. 7, #75-83 (Jan-Sep); Vol. 8, #84-86 (Oct-Dec)
1986: Vol. 8, #87-95 (Feb-Sep); Vol. 9, #96-99 (Oct-Dec)
1987: Vol. 9, #99 (Jan)-107 (Sep); Vol. 10, #108-110 (Oct-Dec)
1988: Vol. 10, #111-118 (Jan-Sep); Vol. 11, #119-121 (Oct-Dec)
1989: Vol. 11, #122-130 (Jan-Sep); Vol. 12, #131-133 (Oct-Dec)
1990: Vol. 12, #134-145
1991: Vol. 13, #146-156
1992: Vol. 14, #157-164 (Jan-Sep); Vol. 15, #165-167 (Oct-Dec)
1993: Vol. 16, #168-178
1994: Vol. 17, #179-189
1995: Vol. 18, #190-200
1996: Vol. 18, #201-211
1997: Vol. 19, #212-222
1998: Vol. 20, #223-233
1999: Vol. 21, #234-244
2000: Vol. 22, #245-246; Vol. 22, #1-5 (Mar/Apr-Winter) [changes name to “JAZZ” in 2000]
2001: Vol. 23, #1(Winter) –
2001: Vol. 24 #2-6 (Winter)
2002: Vol. 25 #1-6 (Winter-Winter)
2003: Vol. 26 #1-6 (Winter-Winter)
2004: Vol. 27 #1-6 (Winter-Winter)
2005: Vol. 28 #2-6 (Spring-Winter)
2006: Vol. 29 #1-6 (Spring-Winter)
2007: Vol. 30 #1-6 (Winter-Winter)
2008: Vol. 31 #1-6 (Winter-Winter)
2009: Vol. 32 #1-6 (Winter-Winter)
2010: Vol. 33 #1-6 (Spring-Winter) [changes name to “JAZZISM” and starts with new numbering in 2011] |
JAZZ NYTT – P-240
Norway
1965: Vol. 1: Jul
1966: Vol. 2: Mar
1967: Vol. 3: Apr,Jun,Oct,Dec
1968: Vol. 4: Mar,Jun,Nov
1969: Vol. 5: Mar,May,Jul,Nov
1970: Vol. 6/1-4 (?,May,Jul,Nov)
1971: Vol. 7/1-3 (Mar,Jun,Oct)
1972: Vol. 8: Jun
1973: Vol. 9/2-4 (Apr,Jun)
1974: Vol. 10/1
1975: Vol. 11/1-2
1976: Vol. 12/1-5/6
1977: Vol. 13/5
1978: Vol. 14/1-5
1979: Vol. 15/1-5
1980: Vol. 16/1-5
1981: Vol. 17/1-5
1982: Vol. 18/1-2,4
1984: Vol. 20/1-6
1985: Vol. 21/1-6
1986: Vol. 22/1-6
1987: Vol. 23/2-6
1988: Vol. 24/1-5
1989: Vol. 25/1-5
1990: Vol. 26/1,4
1991: Vol. 27/1-5
1992: Vol. 28/1-5
1993: Vol. 29/1-5
1994: Vol. 30/1-5
1995: Vol. 31/1-4/5
1996: Vol. 32/1-4
1997: Vol. 33/1-4
1998: Vol. 34/1-4
1999: Vol. 35/1-2
2008: Vol. 44/1,5-6
2009: Vol. 45/1,3-6
2010: Vol. 46/1-6
2011: Vol. 47/1-5
2012: Vol. 48/2-3,5-6
2013: Vol. 49/1-2 |
JAZZOLOGIST, THE – P-584
USA
1964: Vol. 2 [no dates] (23.Jul, 28.Aug)
1965: Vol. 3 (1.Feb, 1.Mar, 29.Apr, 1.Jul, 1.Sep, 7. Nov, 5.Dec)
1966: Vol. 3/9 (Jan), 3/12 (1.Apr); Vol. 4/2 (1.Jun), 4/6 (Oct), 4/8 (4.Dec)
1967: Vol. 4/9-11 (1.Jan-1.Mar); Vol. 5/1 (May), 5/3-6 (1.Jul-30.Sep), Vol. 5/8 (3.Dec)
1968: Vol. 5/9 (Jan), 5/11-12; Vol. 6/1-4 (May/Jun-Jul/Aug), 6/6-7 (Oct/Nov)
1969: Vol. 7/2-5 (Jun/Jul-Aug/Sep)
1970: Vol. 7/9-10 (Jan/Feb); Vol. 8/1-8 (May/Dec)
1971: Vol. 7/9-12 (Jan/Feb-Mar/Apr); Vol. 8/1-3 (May/Jul); special issue (24.Apr); Vol. 9/4-5,8-11 (Aug/Sep, Dec 71/Jan-Mar 72)
1972: Vol. 10/7-9 (Nov/Dec)
1973: Vol. 10/10-12 (Feb-Apr),Vol. 11/1-3 (May/Jul) 11/4-6 (Aug-Oct)
1974: Vol. 11/11-12; Vol. 12/1-2 (Mar-Jun), 12/7-8 (Nov-Dec)
1975: Vol. 12/7-10 (Nov-Feb); Vol. 13/2-8 (Jun-Dec)
1976: Vol. 13/12; Vol. 14/1-2 (Apr/Jun)
1977: Vol. 14/9-12 (Jan-Apr); Vol. 15/1-7 (May-Nov); special issue #103-A (Jan)
1978: Vol. 16/7-9 (Nov-Dec/Jan)
1979: Vol. 17/4-8 (Aug/Sep-Oct/Dec)
1980: Vol. 17/12 (Apr); Vol. 18/1-2 (May/Jun), 6-9 (Oct-Dec/Jan)
1982: Vol. 20/3-4 (Jul/Aug) |
JAZZOLOGY – P-241
USA
1967/68 Vol.18, #2 (Nov/Dez/Jan)
1968: Vol.18, #3 (Feb/März/Apri),
#4 (Mai/Juni/Juli),
Vol.19 #1 (Aug/Sep/Okt),
#2 (Nov/Dez/Jan)
1969: Vol. 19/3-4 (Feb/Mar/Apr-May/Jun/Jul)
1970: Vol. 20/2, (Nov 69, Dec 69, Jan 70),
20/3 (Feb/Mar/Apr)
1974: Vol. 24/1 (May-Oct) |
JAZZOLOGY – P-242
American Jazz Society Booklets
England
ca. 1945: one issue |
JAZZOLOGY – P-713
Publicacio dels Amics del Jazz de Lleida
Spain
1994: #6 (Jun)
1995: #7-8 (Jan,Jun)
1996: #9-10 (Jan,Jun)
1997: #11-12 (Mar,Dec) |
JAZZOMANIA – P-678
Literary Organ of the Sierra Jazz Club
USA
1978: Vol. 1/4-9 (Mar-Aug) |
JAZZ ON CD – P-668
England
1993: #1-5 (May-Oct)
1994: #6-11 (Jun-Dec
1995: #12-18 (Jan-Nov)
1996: #19 (Jan) [last issue] |
JAZZ ON THE RIVER – P-626
St. Louis Jazz Club
USA
1977: Sep
1978: Feb, Apr-Jul, Sep-Oct
1979: Mar
1982: Nov-Dec |
JAZZ PARADE – P-1119
Denmark
1952: Vol. 3/8 (Nov)
1953: Vol. 4/4 (Apr/May), 6-7 (Nov-Dec)
1955: Vol. 5/1-6 (Jan,Feb,Mar,Apr/May,May,Aug,Sep), 8A-9 (Nov-Dec) |
JAZZPATORS INSIDE INFORMATION – P-1116
Germany
1959: #1 (Summer) |
JAZZOPHONE – P-500
France
1978: #1
1983: #14 (Jan), #16 (Nov) |
JAZZ ORCHESTRAS – P-1027
England
1946: #1 (Feb) |
JAZZ PANORAMA – P-919
France
1960: #2 (Sep/Oct) |
JAZZ PERSPECTIVE –P-1139
Japan
2014: #8 (Jun), #9 (Dec) |
JAZZ PERSPECTIVES – P-1044
USA
2007: Vol. 1/1-2 (May,Nov)
2008: Vol. 2/1-2 (May,Nov)
2009: Vol. 3/1-3 (April,Aug,Dec)
2010: Vol. 4/1-3 (Apr,Aug,Dec)
2011: Vol. 5/1-3 (Apr,Aug,Dec)
2012: Vol. 6/1-3 (Apr,Aug,Dec)
2014: Vol. 8/2-3 (Aug,Dec)
2015: Vol. 9/1-3 (Apr,Aug,Dec)
2017: Vol. 10/1-2/3 (Apr,Aug/Dec) |
JAZZ PLAYER – P-578
USA
1993: Vol. 1/1 (Dec)
1994: Vol. 1/2-6 (Feb/Mar-Oct/Nov); 2/1 (Dec/Jan)
1995: Vol. 2/2-6 (Feb/Mar-Oct/Nov)
1996: Vol. 3/1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
1997: Vol. 4/1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
1998: Vol. 5/1-6 (Dec/Jan-Oct/Nov)
1999: Vol. 6/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2000: Vol. 7/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2001: Vol. 8/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan) [eingestellt] |
JAZZ PODIUM – P-200
Germany
[zuvor “Das internationale Podium”, siehe dort]
1953: Vol. 2/1-11 (Jan-Dec)
1954: Vol. 3/1-12
1955: Vol. 4/1-12
1956: Vol. 5/1-12
1957: Vol. 6/1-12
1958: Vol. 7/1-12
1959: Vol. 8/1-12
1960: Vol. 9/1-12
1961: Vol. 10/1-12
1962: Vol. 11/1-12
1963: Vol. 12/1-12
1964: Vol. 13/1-12
1965: Vol. 14/1-12
1966: Vol. 15/1-12
1967: Vol. 16/1-12
1968: Vol. 17/1-12
1969: Vol. 18/1-12
1970: Vol. 19/1-12 [Oct einzeln vorhanden]
1971: Vol. 20/1-12
1972: Vol. 21/1-12
1973: Vol. 22/1-12
1974: Vol. 23/1-12
1975: Vol. 24/1-12
1976: Vol. 25/1-12
1977: Vol. 26/1-12
1978: Vol. 27/1-12
1979: Vol. 28/1-12
1980: Vol. 29/1-12
1981: Vol. 30/1-12
1982: Vol. 31/1-12
1983: Vol. 32/1-12
1984: Vol. 33/1-12
1985: Vol. 34/1-12
1986: Vol. 35/1-12
1987: Vol. 36/1-12
1988: Vol. 37/1-12
1989: Vol. 38/1-12
1990: Vol. 39/1-12
1991: Vol. 40/1-12
1992: Vol. 41/1-12
1993: Vol. 42/1-12
1994: Vol. 43/1-12
1995: Vol. 44/1-12
1996: Vol. 45/1-12
1997: Vol. 46/1-12
1998: Vol. 47/1-12
1999: Vol. 48/1-12
2000: Vol. 49/1-12
2001: Vol. 50/1-12
2002: Vol. 51/1-12
2003: Vol. 52/1-12
2004: Vol. 53/1-12
2005: Vol. 54/1-12
2006: Vol. 55/2-12
2007: Vol. 56/2-12
2008: Vol. 57/2-12
2009: Vol. 58/2-12
2010: Vol. 59/2-12
2011: Vol. 60/1-12
2012: Vol. 61/2-12
2013: Vol. 62/2-12
2014: Vol. 63/2-12
2015: Vol. 64/2-12
2016: Vol. 65/2-12
2017: Vol. 66/2-12
2018: Vol. 67/2-12
2019: Vol. 68/2-12
2020: Vol. 69/2-12
2021: Vol. 70/2-6/7 |
JAZZPRESS – P-800
Germany
1958: Vol.1/1-12 (13.Oct-29.Dec)
1959: Vol.2/1-4 (12.Jan-2.Feb), 6-9 (16.Feb-9.Mar), 11-20 (23.Mar-15.Jun) |
JAZZ PRESS – P-201
Netherlands
1975: #5-8 (Nov-Dec)
1976: #9-28 (Jan-Dec)
1977: #29-46 (Jan-Dec)
1978: #47-53/54 (Jan-Sep) |
JAZZ PRESS HAMBURG – P-752
Germany
1996: #8,10-12
1997: #1-12
1998: #1-6
1999: #3,9-12
2000: #1-6,9-10,12
2001: #3-4, 6-7, 10-12
2002: #2-11
2003: #2, 5, 6 [7/2003: eingestellt] |
JAZZ QUAD – P-845
Belorussia
1998: #3,5-11/12
1999: #1-7,11-12
2000: #1/2-9 |
JAZZ QUARTERLY – P-733
USA
1942: Summer-Fall
1943: Spring
1944: Vol. 2/1 (Spring)
1945: Vol. 2/3 (Spring),Vol. 2/4 (Summer) |
JAZZ QUIZ – P-202
England
1945: Jun
1946: Aug |
JAZZ RAG, The – P-477
England
1987: #2 (Spring), 4 (Winter)
1988: #5-7 (Spring-Winter)
1989: #8-10 (Spring, Jun, Sep)
1990: #11-13 (Winter, Summer, Autumn)
1991: #14-18
1992: #19-23
1993: #24-28
1994: #29-32
1995: #33-36
1996: #37-41
1997: #42-47
1998: #48-53
1999: #54-59 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2000: #60-65 (Jan/Feb-Dec/Jan)
2001: #66-70 (Jan/Feb-Dec/Jan)
2002: #71-74 (Spring-Winter)
2003: #75-79 (Spring-Winter)
2004: #80-84 (Spring-Winter)
2005: #85-89 (Spring-Winter)
2006: #90-94 (Spring-Winter)
2007: #95-99 (Winter-Winter)
2008: #100-104 (Winter-Summer, Winter)
2009: #105-109 (Winter-Summer/Autumn)
2010: #110-114 (Spring-Winter)
2011: #115-119 (Spring-Winter)
2012: #120-124 (Spring-Winter)
2013: #125-129 (Winter-Winter) |
2014: #130-134 (Winter-Winter)
2015: #135-139 (Winter-Winter) |
JAZZRAG – P-572
The “Traditional” Jazz Quarterly
New Zealand
1989: Vol.1/3 (Nov)
1990: Vol. 2/3 (Nov)
1991: #10 (Aug)
1992: #15 (Nov)
1993: #16-18 (Mar-Sep)
1994: #22 (Sep)1995. #24 (März) |
JAZZ REALITIES – P-203
Germany
1982: #1 (Aug)
1983: #2 (Jan), #3 (Nov)
1984: #4 (Feb), #5 (Apr-May), #6 (Nov)
1985: #7 (Summer)
1986: #8 (Summer)
1987: #9 (Summer)
1989: #10 (Summer)
1992: #11 (Summer)
1999: #12 (Fall)
2000: #13 (Winter)
2003: #14 (Summer) |
JAZZ RECORD – P-760
England
1943: #1, #3, #7 |
JAZZ RECORD, The – P-204
USA
1943: #1 (15.Feb), 5 (15.Apr), 10 (Jul), 12 (1.Sep), 15 (Dec)
1944: #16,21-27 (Jan,Jun-Dec)
1945: #28-39 (Jan-Dec)
1946: #40-50 (Jan-Nov)
1947: #51-54 (Jan-Apr), 56 (Jun), 57 (Aug), 59-60 (Oct-Nov) |
JAZZ RECORDS (JAZZ, FOLK & BLUES) – P-205
England
1962: Oct-Dec
1963: Jan-Dec
1964: Jan-Dec
1965: Jan-Dec
1966: Jan-Feb |
JAZZ REGISTER – P-662
England
1965: Vol.1/2 (Apr/May/June), Vol. 1/3 (Juli/Aug/Sep), Vol.1/4 (Oct/Dec)
1966: Vol. 2/1 (Jan/Mar) |
JAZZREPORT – P-560
East Germany
1981: #9 (Mar)
1984: #25 (May)
1985: #32 (Nov) |
JAZZ REPORT – P-930
(Ventura/CA)
USA
1960: Vol. 1/1 (Sep), 1/3-1/4 (Nov-Dec)
1961: Vol. 1/6-12 (Feb-Aug), Vol. 2/1-4 (Sep-Dec) |
JAZZ REPORT – P-206
The Record Collector’s Magazine; USA (irregular)
1962: Vol. 2/5,7-10, Vol. 3/1-3
1963: Vol. 3/3-4 (Jan-Feb)
ca. 1964-1974: Vol. 4/4,6
Vol. 5/3-6
Vol. 6/1(1968) -6
Vol. 7/2-6
Vol. 8/1-6
Vol. 9/1-3, 5-6 |
JAZZ REPORT – P-539
USA
1978: #51 (May), 53/54 (Jul/Aug) |
JAZZ REPORT – P-1087
(published by Robert G. Koester / Seymour’s Records)
USA
1956: Vl. 6/2 (May)
1958: Vol. 6/6 (Jul)
1959: Vol. 7/1 (Jan)
1960: Vol. 8/1-2 (Feb,May) |
JAZZ REPORT, The – P-207
Voice of the Artist
Canada
1987: Vol. 1/1 (Aug/Sep), 3 (Dec/Jan)
1988: Vol. 1/5-6 (Apr/May-Jun/Jul); Vol. 2/1-3 (Aug/Sep-Dec/Jan)
1989: Vol. 2/4-6 (Feb/Mar-Jun/Jul); Vol. 3/1-3 (Aug/Sep-Dec/Jan)
1990: Vol. ¾-6 (Feb/Mar-Jun/Jul); Vol. 4/1-3 (Aug/Sep-Dec/Jan)
1991: Vol. 4/4-5 (Spring-Summer); Vol. 5/1-2 (Fall-Winter)
1992: Vol. 5/3-4 (Spring-Summer); Vol. 6/1-2 (Fall-Winter)
1993: Vol. 6/3-4 (Spring-Summer); Vol. 7/1-2 (Fall-Winter)
1994: Vol. 7/3-4 (Spring-Summer); Vol. 8/1 (Fall)
1995: Vol. 8/2-4 (Winter-Summer); Vol. 9/1 Fall)
1996: Vol. 9/2-4 (Winter-Summer); Vol. 10/1 (Fall)
1997: Vol. 10/2-4 (Winter-Summer); Vol. 11/1 (Fall)
1998: Vol. 11/2-4 (Winter-Summer); Vol. 12/1 (Fall)
1999: Vol. 12/2-4 (Winter-Summer); Vol. 13/1 (Fall)
2000: Vol. 13/2-4 (Winter-Summer); Vol. 14/1 (Fall)
2001: Vol. 14/2-4 (Winter-Summer); Vol. 15/1 (Fall)
2002: Vol. 15/2-4 (Winter-Sep/Oct/Nov)
2003: Vol. 16/1 (Winter) |
JAZZ REPORTS – P-720
Organ for “Swing-Fans” i Danmark
Denmark
1943: ¾ (Sep) |
JAZZ RESEARCH JOURNAL – P-1052
England
2007: Vol. 1/1, 1/2 |
JAZZ RESEARCH NEWS – P-937
Austria
2000: #1 (Nov)
2001: #2-5 (Feb-Nov)
2002: #6-9 (Mar-Sep)
2003: #10 (Mar)
2004: #11-16 (Apr-Dec)
2005: #17-20 (Mar,Oct,Nov,Dec)
2006: #21-24
2007: #25-27
2008: #28-30
2009: #31-33
2010: #34-36
2011: #37-39
2012: #40-42
2013: #43-44
2014: #45-46
2015: #47-48
2017: #49-52 |
JAZZ RESEARCH PAPERS – P-208
(continued as “Jazz Research Proceedings Yearbook”)
USA
1981: Vol. 1
1982: Vol. 2
1983: Vol. 3
1984: Vol. 4
1985: Vol. 5
1986: Vol. 6
1987: Vol. 7
1988: Vol. 8
1989: Vol. 9
1990: Vol. 10
1991: Vol. 11
1992: Vol. 12
1993: Vol. 13
1994: Vol. 14
1995: Vol. 15
1996: Vol. 16
1997: Vol. 17
1998: Vol. 18
1999: Vol. 19
2000: Vol. 20
2001: Vol. 21
2002: Vol. 22
2003: Jan
2004: Jan
2005: Jan |
JAZZ REVIEW – P-957
England
1959. Vol:2, #6 (Juli), #8 (Sept)
1960: Vol.3, #3 (März/April)
1999: #2 (Nov)
2000: #4-15 (Jan-Dec)
2001: #16-27 (Jan-Dec)
2002: #28-39 (Jan-Dec)
2003: #40-51 (Jan-Dec)
2004: #52-63 (Jan-Dec)
2005: #64-73 (Jan-Dec/Jan)
2006: #74-79 (Feb/Dec/Jan)
2007: #80-85 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2008: #86-91 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2009: #92 (Feb/Mar) |
JAZZ REVIEW – P-1050
(Jazz Music Books)
England
1945: [no number] |
JAZZ REVIEW, The – P-209
USA
1958: Vol. 1/1-2 (complete)
1959: Vol. 2/1-11 (complete)
1960: Vol. 3/1-8 [except Vol. 3/9 (Nov/Dec) missing]
1961: Vol. 4/1 (complete)
[all issues complete as reprint] |
JAZZ REVIEW, THE – P-210
USA
1991: Vol. 1/1-6 (Jan-Jul), Sep, Nov
1992: Jan-Mar |
JAZZ REVISTA- P-1018
Spain
1980: 1 (Oct) |
JAZZ REVUE – P-211
MONATSZEITSCHRIFT DER INTERESSENGEMEINSCHAFT GERMAN JAZZ COLLECTORS
Germany
1952: Vol. 3/1-12 (Jan-Dec)
1953: Vol. 4/1-12 (Jan-Dec)
1954: Vol. 5/1-12 |
JAZZ REVY – P-1094
Denmark
1965: #4 (Dec) |
JAZZ RING AUSTRIA JAZZ NEWS – P-1103
Austria
1972: #7 (Jul)
1973: #1 (Jan) |
JAZZ ROCK POP INDEX (früher: Jazz-, Rock- Und Popmusik-Register) – P-212
Germany
1992: Vol. 5/1-12
1993: Vol. 6/1-12
1994: Vol. 7/1-12
1995: Vol. 8/1-12
1996: Vol. 9/1-12
1997: Vol. 10/1-12
1998: Vol. 11/1-12
1999: Vol. 12/1-12
[publication stopped with Dec.1999] |
JAZZ RYTMIT – P-842
Finland
1997: #6 (16.Oct.)
1998: #7 (10.Dec.)
2000: #5 (2.Nov.)
2007: #5-6 (14. Sep, 16. Nov)
2008: #1-5/6 |
JAZZ.RU (P-1190)
Russia
2007: #1-8/9
2008: #10-17/18
2009: #19-24/25
2010: #26-27, #30-31/32
2011: #33, #35-38/39
2012: #40-45/46
2013: #47-53
2014: #54-57/58
2015: #59
2000: #61 |
JAZZ SCENE, The – P-215
England
1962: Vol. 1/2 (Jun)
1963: Vol. 2/2 (Feb), 2/4-6 (Mar-Jul/Aug) |
JAZZSCENE – P-213
Jazz Society of Oregon
USA
1991: Nov-Dec
1992: Jan-Nov |
JAZZ SCENE – P-993
Melbourne
2002: Vol. 2 /10 (Jun) |
JAZZSCOPE – P-214
N.C. Jazz Network
USA
1992: Vol. 3/3 (Winter) |
JAZZ SESSION – P-828
USA
1944: Vol. 1/1 (1.Sep)
1945: May/Jun, Jul/Aug, Sep/Oct, Nov/Dec
1946: Jan, Jul |
JAZZ SHEET, The – P-216
Published by the Jazz Institute of Chicago
USA
1970: one issue |
JAZZ SOCIETY OF PENSACOLA – P-217
USA
1991: Vol. 9/3-4 (Aug-Sep) |
JAZZ SOUNDINGS – P-627
Puget Sound Traditional Jazz Society
USA
1978: Sep-Oct
1979: Jan-Mar |
JAZZ SOUTH – P-451
Southern Arts Federation
USA
1992: Vol. 3/3-4, Vol. 4/2
1993: Vol. 4/2.5-4
1995: Vol. 5/2-4
1996: Vol. 6/1-2 |
JAZZ SPECIAL – P-218
Denmark
1991: #1 (Dec)
1992: #2-7 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1993: #8-13 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1994: #14-19 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1995: #20-25 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1996: #26-31 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1997: #32-37 (Feb/Mar-Oct/Dec)
1998: #38-43 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1999: #44-49 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2000: #50-55 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2001: #56-61 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2002: #62-67 (Feb/Mar-Dec/Jan) [International Edition #1]
2003: #68-70 (Feb/Apr-Jun/Jul) [International Edition #2]
2004: #74-79 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2005: #80-86 (Feb/Mar-Dec/Jan) [Festival 2005]
2006: #87-93 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2007: #94-100 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2008: #101-106 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2009: #107-112 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2010: #113-118 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2011: #119-124 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2012: #125-130 (Feb/Mar- Dec/Jan)
2013: #131-136 (Feb/Mar-Dec/Jan) [suppl. Lira Festival Guide 2013]
2014: #137-142 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2015: #143-148 (Feb/Mar-Dec/Jan) [Festival 2015]
2016: #149-153 (Feb/Mar-Dec/Jan) [Festival 2016]
2017: #154-158 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2018: #159-163 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2019: #164-168 (Feb/Apr-Nov/Jan)
2020: #169-173 (Feb/Apr-Nov/Feb)
2021: #174-175 (Feb/Apr-Apr/Jun) |
JAZZSPIEGEL – P-1049
Belgium
1967: #3 (Apr) |
JAZZ SPOT -P-709
Germany
1996: 1-2 |
JAZZ STATISTICS – P-575
Switzerland
1960: #15 (Mar)
1962: #25 (Mar) + Beilage, 26 (Dec) |
JAZZ STRING NEWSLETTER – P-577
USA
1982: Vol. 1/2-1/3 [xerox copies only]
1983: Vol. 2/1-2/2 [xerox copies only] |
JAZZ STUDIES – P-219
British Institute of Jazz Studies
England
1968: Vol. 2/1-3
1970: Vol. 3/1 |
JAZZ STUDIUM – P-637
Hungary
1984: #7 |
JAZZ SWING JOURNAL – P-912
France
1988: #9 (Jul/Aug)
1990: #17 (Jul/Aug) |
JAZZ TALK – P-220
England
1991: #1 (Summer) |
JAZZ TEMPO – P-221
Germany
1951: Vol. 1/1-2 (Apr-May) |
JAZZ TEMPO – P-1009
England
1944: #16-19 |
JAZZTHETIK – P-243
Germany
1987: Vol. 1/0, 1-8 (May-Dec)
1988: Vol. 2/1-12
1989: Vol. 3/1-12
1990: Vol. 4/1-12
1991: Vol. 5/1-12
1992: Vol. 6/1-12
1993: Vol. 7/1-12
1994: Vol. 8/1-12
1995: Vol. 9/1-12 (Dec/Jan)
1996: Vol. 10/2-12 (Dec/Jan)
1997: Vol. 11/2-12 (Dec/Jan)
1998: Vol. 12/2-12 (Dec/Jan)
1999: Vol. 13/2-12 (Dec/Jan)
2000: Vol. 14/2-12 (Dec/Jan)
2001: Vol. 15/2-12 (Dec/Jan)
2002: Vol. 16/2-12 (Dec/Jan)
2003: Vol. 17/2-12 (Dec/Jan)
2004: Vol. 18/2-12 (Dec/Jan)
2005: Vol. 19/2-12 (Dec/Jan)
2006: Vol. 20/2-12 (Feb-Dec/Jan)
2007: Vol. 21/2-12 (Feb-Dec/Jan)
2008: Vol. 22/2-12 (Feb-Dec/Jan)
2009: Vol. 23/2-12 (Feb-Dec/Jan)
2010: Vol. 24/1-11/12 (Feb-Nov/Dec)
2011: Vol. 25/1/2-11/12 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2012: Vol. 26/1/2-11/12 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2013: Vol. 27/1/2-11/12 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2014: Vol. 28/1/2-11/12 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2015: Vol. 29/1/2-11/12 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2016: Vol. 30/1/2-11/12 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2017: Vol. 31/1/2-11/12 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2018: Vol. 32/1/2-11/12 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2019: Vol. 33/1/2-11/12 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2020: Vol. 34/1/2-11/12 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2021: Vol. 35/1/2-5/6 (Jan/Feb-May/Jun) |
JAZZ THING – P-573
Germany
1993: #0 (Fall), #1 (Winter)
1994: #2-6 (Feb/Mar-Nov/Jan)
1995: #7-11, (Feb/Mar-Nov/Jan)
1996: #12-16 (Feb/Mar-Nov/Jan)
1997: #17-21 (Feb/Mar-Nov/Dec)
1998: #22-26 (Feb/Mar-Nov/Dec)
1999: #27-31 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2000: #32-36 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2001: #37-41 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2002: #42-46 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2003: #47-51 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2004: #52-56 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2005: #57-61 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2006: #62-66 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2007: #67-71 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2008: #72-76 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2009: #77-81 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2010: #82-86 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2011: #87-91 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2012: #92-96 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2013: #97-101 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2014: #102-106 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2015: #107-111 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2016: #112-116 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2017: # 117-121 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2018: #122-126 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2019: #127-131 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2020: #132-136 (Feb/Mar-Nov/Jan)
2021: #137-139 (Feb/Mar-Jun/Aug) |
JAZZ TICKER – P-799
Jazz- und Live-Veranstaltungen Rhein-Main
Germany
1997: Dec |
JAZZTIME – P-222
Switzerland
1984: Feb-Dez
1985: Jan-April
1986: Aug
1988: Nov
1989: Jun
1991: Jun-Jul
1992: Oct-Dec
1993: Jan-Dec
1994: Jan-Dec
1995: Jan-Dec
1996: Jan-Dez, +
special issues (Jan/Feb/Mar), (Jul/Aug/Sep)
1997: Jan/Feb/Mar-Oct/Dec
1998: Jan, Apr, Jun
1999: Oct
2000: Feb
2001: Oct-Dec
2002: Jan-Dec
2003: Jan-Dec
2004: Jan-Dec
2005: Jan-Dec
2006: Jan-Dec
2007: Jan-Dec
2008: Jan-Dec
2009: Jan-Dec
2010: Jan-Dec
2011: Jan-Dec
2012: Jan-Dec
2013: Jan-Dec
2014: Jan-Dec
2015: Jan-Dec
2016: Jan-Dec
2017: Jan-Dec
2018: Jan-Dec
2019: Jan-Oct,Dec
2020: Jan-Mar,May,Jul,Sep,Oct,Nov,Dez
2021: Feb –Mar/Apr(Jan nicht erschienen wg Corona); Jun |
JAZZTIME – P-244
Germany, Frankfurt
1991: Spring; #1-3 (Oct-Dec)
1992: #4-8 (Jan-May) [nach #8 eingestellt] |
JAZZ TIDSSKRIFTET – P-1095
Denmark
1980: #1 |
JAZZ TIMES – P-223
USA
1980: Vol. 10/6, 8-12
1981: Vol. 11 (Jan-Dec)
1982: Vol. 12 (Jan-Dec)
1983: Vol. 13 (Jan-Dec)
1984: Vol. 14 (Jan-Dec)
1985: Vol. 15 (Jan-Dec)
1986: Vol. 16 (Jan-Dec)
1987: Vol. 17 (Jan-Dec)
1988: Vol. 18 (Jan-Jun, Aug-Dec)
1989: Vol. 19 (Jan-Dec)
1990: Vol. 20 (Jan-Dec)
1991: Vol. 21 (Feb-Dec)
1992: Vol. 22 (Feb-Dec)
1993: Vol. 23 (Feb-Dec)
1994: Vol. 24 (Feb-Dec)
1995: Vol. 25 (Feb-Dec)
1996: Vol. 26 (Feb-Dec)
1997: Vol. 27 (Feb-Dec)
1998: Vol. 28 (Feb-Dec); [special: “1998/1999 Jazz Education Guide”]
1999: Vol. 29 (Feb-Dec); [special: “1999/2000 Jazz Education Guide”]
2000: Vol. 30 (Feb-Dec); [special: “2000/2001 Jazz Education Guide”]
2001: Vol. 31 (Feb-Dec); [special: “2001/2002 Jazz Education Guide”]
2002: Vol. 32 (Feb-Dec); [special: “2002/2003 Jazz Education Guide”]
2003: Vol. 33 (Feb-Dec)
2004: Vol. 34 (Feb-Dec); [special: “2004/2005 Jazz Education Guide”]
2005: Vol. 35/1-10 (Feb-Dec); [special: “2005/2006 Jazz Education Guide”]
2006: Vol. 36/1-10 (Feb-Dec)
2007: Vol. 37/1-10 (Feb-Dec); [special: “2007/2008 Jazz Education Guide”]
2008: Vol. 38/1-10 (Feb-Dec); [special: “2008/2009 Jazz Education Guide”]
2009: Vol. 39/1-3,5-8 (Feb-Apr,Aug/Sep-Dec) [magazine folded temporarily with the April 2009 issue]; [special “2009/2010 Jazz Education Guide”]
2010: Vol. 40/1-6,8-10 (Feb-Jun, Aug-Dec); [special “2010/2011 Jazz Education Guide”]
[other numbers are online issues]
2011: Vol. 41/2-10 (Mar-Dec) [special: “2011/2012 Jazz Education Guide”]
2012: Vol. 42/3-10 (Mar/Apr-Dec)
2013: Vol. 43/1-12 (Feb-Dec)
2014: Vol. 44/1-5, 7-10 (Jan/Feb-Jun, Sep-Dec)
2015: Vol. 45/1-10 (Jan-Dec)
2016: Vol. 46/1-12 (Feb-Dec)
2017: Vol. 47/1-12 (Feb-Dec)
2018: Vol. 48/1-10(Feb-Dec)
2019: Vol. 49/1-10 (Feb-Dec)
2020: Vol. 50/1-12 (Jan-Dec)
2021: Vol.51/1/2,4 (Jan/Feb,Apr) |
JAZZ TIMES [GB] – P-648
England
1964: Vol. 1/1-1.2 (Sep-Oct)
1966: Vol. 3/8, 11 (Aug, Nov)
1967: Vol. 4/1 (Jan)
1969: Vol. 6/12 (Dec)
1970: Vol. 7/1-10 (Jan-Oct) |
(BRITISH) JAZZ TIMES – P-553
England
1986: #2 (Aug), #5 (Nov)
1987: #7-8 (Jan-Feb), #10 (Apr), #12 (Jun), #15-16 (Sep-Oct), #18 (Dec)
1988: #20 (Feb), #22 (Apr), #24-26 (Jun-Aug), #29-30 (Nov-Dec)
1989: #31-37 (Jan-Jul), #39-42 (Sep-Dec)
1990: #43-54 (Jan-Dec)
1991: #55-57 (Jan-Mar), #59-66 (May-Dec)
1992: #67-78 (Jan-Dec)
1993: #80-87 (Feb-Nov/Dec)
1994: #88-93 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1995: #94-97 (Jan/Feb-Jul/Aug)
Mit #97 eingestellt |
JAZZ TODAY – P-750
USA
1956: Vol. 1/1-3 (Oct-Dec)
1957: Vol. 2/1-10 (Jan-Nov) |
JAZZ-TON – P-715
Austria
1996: Spring/Summer |
JAZZTOWN CRIER – P-694
Louisiana Jazz Federation
USA
1995: Fall |
JAZZ TRUMPET JOURNAL – P-224
USA
1991: Vol. 1/6 (Aug), 8-10 (Oct-Dec)
1992: Vol. 1/11-12 (Jan-Feb), 2/1-10 (Mar-Dec)
1993: Vol. 2/11-12 (Jan-Feb), 3/1-10 (Mar-Dec)
1994: Vol. 3/11-12 (Jan-Feb); 4/1-9 (Mar-Oct) |
JAZZ & TZAZ – P-853
Greece
1995: # 31 (Oct) |
JAZZUITZENDINGEN – P-1132
Netherlands
1970: Feb |
JAZZ UK – P-838
England
1995: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1996: #7-11 (Jan/Feb-Sep/Oct)
1997: #13-18 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1998: #19-24 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1999: #25-30 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2000: #31-35 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2001: #36-42 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2002: #43-48 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2003: #49-54 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2004: #55-60 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2005: #61-66 (Jan/Feb-Nov/Dec) [digi.copy]
2006: #67-72 (Jan/Feb-Nov/Dec) [digi.copy]
2007: #73-78 (Jan/Feb-Dec/Jan) [digi.copy]
2008: #79-84 (Feb/Mar-Dec/Jan) [digi.copy]
2009: #85-90 (Feb/Mar-Dec/Jan) [digi.copy]
2010: #91-96 (Feb/Mar-Dec/Jan) [digi.copy]
2011: #97-102 (Feb/Mar-Dec/Jan) [digi.copy]
2012: #103-108 (Feb/Mar-Dec/Jan) [digi.copy]
2013: #104-113 (Feb/Mar-Dec/Jan) [digi.copy]
2014: #114-118 (Feb/Mar-Aug/Sep) [digi.copy] |
JAZZWAYS – P-245
A Yearbook of Hot Music
England
1946: Vol. 1/1 |
JAZZ WERELD – P-225
Netherlands
1965: #1-3
1966: #4-9
1967: #10-15
1968: #16-21
1969: #22-27
1970: #28-32
1971: #33-36
1972: #37-41
1973: #42-43 |
JAZZWISE – P-754
England
1997: #1-8 (Apr-Dec/Jan)
1998: #9-18 (Feb-Dec/Jan), direct 12/98
1999: #19-28 (Feb-Dec/Jan)
2000: #29-38 (Feb-Dec/Jan)
2001: #39-49 (Feb-Dec/Jan)
2002: #50-60 (Feb-Dec/Jan)
2003: #61-71 (Feb-Dec/Jan)
2004: #72-82 (Feb-Dec/Jan)
2005: #83-93 (Feb-Dec/Jan)
2006: #94-104 (Feb-Dec/Jan)
2007: #105-115 (Feb-Dec/Jan)
2008: #116-126 (Feb-Dec/Jan)
2009: #127-137 (Feb-Dec/Jan)
2010: #138-148 (Feb-Dec/Jan)
2011: #149-159 (Feb-Dec/Jan)
2012: #160-170 (Feb-Dec/Jan)
2013: #171-181 (Feb-Dec/Jan)
2014: #182-192 (Feb-Dec/Jan)
2015: #193-203 (Jan-Dec/Jan)
2016: #204-213 (Feb-Dec/Jan)
2017: #214-225 (Feb-Dec/Jan)
2018: #226-236 (Feb-Dec/Jan)
2019: #237-247 (Feb-Dec/Jan)
2020: #248-258 (Feb-Dec/Jan)
2021: #259-263 (Feb-Jun) |
JAZ DIRECT – P-841
England
1998: December
1999: December |
JAZZ WORLD INDEX – P-226
USA
1982: Vol. 12, #55 (Sep/Oct)
1983: Vol. 13, #56-57
1984: Vol. 14, #58-62
1985: Vol. 15, #63-67
1986: Vol. 16, #68-69, 71
1987: Vol. 17, #72 |
JAZZ WORLD – P-227
USA
1957: Vol. 1/1 (Mar) |
JAZZ WORLD INDEX – P-228
USA
1981: Vol. 11/46 (Aug)
1982: Vol. 12, #50-51 (Jan-Feb), 63 (May/Jun), 55 (Sep/Oct)
1983: Vol. 13, #57 (Jan) |
JAZZZEIT – P-878
Austria
1999: #1-6 (May-Dec)
2000: #7-16 (Feb-Dec)
2001: #17-25 (Mar-Dec)
2002: #26-34 (Mar-Dec) [special issue: jazz.atlas.2002; summer-festivals, schedule for Austria]
2003: #35-43 (Mar-Dec) [special issue: jazz.atlas.2003; summer-festivals] winter
2004: #44-52 (Mar-Dec)
2005: #53-57 (Mar/Apr-Nov/Dec)
2006: #58-63 (Jan/Feb-Nov/Dec) [special issue: jazz.atlas.2006; summer-festivals], #59 (März-April)
2007: #64-69 (Jan/Feb-Nov/Dec) [special issue: jazz.atlas.2007; summer-festivals]
2008: #70-75 (Jan/Feb-Nov/Dec) [special issue: jazzzeit.reise Feb 2008; jazz.austria 4/2008; jazz.atlas.2008]
2009: #76-78 [magazine folded with issue no. 78] |
JAZZ ZEITUNG – P-229
Germany
1976: #2-6, 8, 10
1978: #10, 12
1979: #5-6 (May-Jun), 11 (Nov)
1980: #1 (Jan), 4-5 (Apr-May), 7-11 (Jul-Nov)
1981: #2-12 (Feb-Dec)
1982: #1-12 (Jan-Dec)
1983: #1-3 (Jan-Mar)
1984: Vol. 9/1-12 (Jan-Dec)
1985: Vol. 10/1-12 (Jan-Dec)
1986: Vol. 11/1-12 (Jan-Dec)
1987: Vol. 12/1-8 (Feb-Aug), 11-12/12 (Nov-Dec)
1988: Vol. 13/1-11 (Jan-Dez)
1989: Vol. 14/1-12 (Jan-Dec)
1990: Vol. 15/1-12 (Jan-Dec)
1991: Vol. 16/1-12 (Jan-Dec)
1992: Vol. 17/1-12 (Jan-Dec)
1993: Vol. 18/1-12 (Jan-Dec)
1994: Vol. 19/1-12 (Jan-Dec)
1995: Vol. 20/1-12 (Jan-Dec)
1996: Vol. 21/1-12 (Jan-Dec)
1997: Vol. 22/1-5 (Jan-May), 9-12 (Sep-Dec) [complete volume]
1998: Vol. 23/1-12 (Jan-Dec)
1999: Vol. 24/1-12 (Jan-Dec)
2000: Vol. 25/1-12 (Jan-Dec)
2001: Vol. 26/1-12 (Jan-Dec)
2002: Vol. 27/2-12 (1/03) (Feb-Dec/Jan)
2003: Vol. 28/2-12 (Feb-Dec)
2004: Vol. 29/1-12 (Jan-Dec/Jan)
2005: Vol. 30/2-12 (Feb-Dec/Jan)
2006: Vol. 31/2-12 (Feb-Dec)
2007: Vol. 32/1-4 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2008: Vol. 33/1-5 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2009: Vol. 34/1-5 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2010: Vol. 35/1-5 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2011: Vol. 36/1-5 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2012: Vol. 37/1-5 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2013: Vol. 38/1-5 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2014: Vol. 39/1-5 (Feb/Mar-Nov/Dec) [last print edition] |
JAZZ 58 – P-1048
(Mensuel pour la connaissance et la diffusion de la véritable musique de jazz)
Belgium
1958: Vol. 2/3 (Feb) |
JEFFERSON – P-246
Sweden
1976: Vol. 8/#72
1992: Vol. 24/#95
1999: Vol. 31/#119 |
JEMF QUARTERLY – P-564
John Edwards Memorial Foundation
USA
1979: Vol. 15/54 (Summer) |
JERRY’S RHYTHM RAG – P-551
Sweden
1993: #1-4 (Winter-Fall)
1995: #5 |
JERSEY JAZZ – P-247
Dedicated to the Performance, Promotion and Preservation of Jazz
USA
1974: Vol. 2/1 (Jan), 2/3-8 (Mar-Aug)
1975: Vol. 3/7-8 (Jul-Aug), 3/11 (Dec)
1976: Vol. 3/12 (Jan), Vol. 4/1-10 (Feb-Dec)
1977: Vol. 4/12 (Jan), Vol. 5/1-10 (Feb-Dec)
1978: Vol. 5/12 (Jan); Vol. 6/1-10 (Feb-Dec)
1979: Vol. 6/11 (Jan); Vol. 7/1-10 (Feb-Dec)
1980: Vol. 7/11 (Jan); Vol. 8/1-10 (Feb-Dec)
1981: Vol. 9/1-11 (Jan-Dec)
1982: Vol. 10/1-10 (Jan-Dec)
1983: Vol. 11/1-11 (Jan-Dec)
1984: Vol. 11/12 (Jan); Vol. 12/1-10 (Feb-Dec)
1985: Vol. 12/11 (Jan); Vol. 13/1-10 (Feb-Dec)
1986: Vol. 13/11 (Jan); Vol. 14/1-10 (Feb-Dec)
1987: Vol. 14/11 (Jan); Vol. 15/1-10 (Feb-Dec)
1988: Vol. 15/11 (Jan); Vol. 16/1-10 (Feb-Dec)
1989: Vol. 16/11 (Jan); Vol. 17/1-10 (Feb- Dec)
1990: Vol. 17/11 (Jan); Vol. 18/1-10 (Feb-Dec)
1991: Vol. 18/11 (Jan); Vol. 19/1-10 (Feb-Dec)
1992: Vol. 19/11 (Jan); Vol. 20/1-10 (Feb-Dec)
1993: Vol. 20/11 (Jan); Vol. 21/1-10 (Feb-Dec)
1994: Vol. 21/11 (Jan); 22/1-10 (Feb-Dec)
1995: Vol. 22/11 (Jan); 23/1-10 (Feb-Dec)
1996: Vol. 24/1-11 (Jan-Dec)
1997: Vol. 25/1-11 (Jan-Dec)
1998: Vol. 26/1-11 (Jan-Dec)
1999: Vol. 27/1-11 (Jan-Dec)
2000: Vol. 28/1-11 (Jan-Dec)
2001: Vol. 29/1-11 (Jan-Dec)
2002: Vol. 30/1-11 (Jan-Dec)
2003: Vol. 31/1-2, 4-11 (Jan-Feb, Apr-Dec)
2004: Vol. 32/1-12 (Jan-Dec)
2005: Jan-Feb
2007: Vol. 35/7 (Jul/Aug) |
JET – P***
(USA)
1969: Vol. 36/1 (10.Apr) [Special über Martin Luther King] |
JOSLIN’s JAZZ JOURNAL – P-248
Dedicated to the Glory of Record Collecting
USA
1982: Vol. 3/1 (Aug)
1984: Vol. 3/2 (Mai)
1985: Vol. 3/2 (Aug)
1986: Vol. 5/1 (Feb)
1992: Vol. 11/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
1993: Vol. 12/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
1994: Vol. 13/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
1995: Vol. 14/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
1996: Vol. 15/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
1997: Vol. 16/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
1998: Vol. 17/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
1999: Vol. 18/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
2000: Vol. 19/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
2001: Vol. 20/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
2002: Vol. 21/1-4 (Mar,May,Aug,Nov)
2003: Vol. 22/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
2004: Vol. 23/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
2005: Vol. 24/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
2006: Vol. 25/1-4 (Feb,May,Aug,Nov)
2007: Vol. 26/1 (Feb), 26/3 (Aug) [last issue; periodical folded] |
JOURNAL OF JAZZ DISCOGRAPHY – P-879
USA
1976: #1 (Nov)
1977: #2 (Jun)
1978: #3 (Mar)
1979: #4-5 (Jan,Sep) |
JOURNAL OF JAZZ STUDIES – P-249
USA
1973: Vol. 1/1 (Oct)
1974: Vol. 1/2 (Jun); Vol. 2/1 (Dec)
1975: Vol. 2/2 (Jun)
1976: Vol. 3/2 (Spring); Vol. 4/1 (Fall)
1977: Vol. 4/2 (Spring/Summer)
1978: Vol. 5/1 (Fall/Winter)
1979: Vol. 5/2 (Spring/Summer)
Vol. 6/1 (Fall/Winter)
[continued as “Annual Review of Jazz Studies]
2011: Vol. 7/1 [digi.copy] |
Journal of world Popular Music – P-1135
England
2014: Vol. 1/1 |
JUBILATION NEWS – P-614
Official Newsletter of the Montreal Jubilation Gospel Choir
USA
1994: Spring/Summer |
JUNGE DAME, Die – P-250
Germany
1951: Vol. 13/7 (4. Apr) [Joachim-Ernst Berendt: Geburtstag beim jüngsten Jazzmusiker der Welt (Sugar Chile Robinson)]
Vol. 13/14 (11.Jul) [Joachim-Ernst Berendt: Jazz-Lady Nr. Eins (Mary Lou Williams)]
Vol. 13/15 (25. Jul), 16 (8. Aug), 17 (22. Aug), 18 (5. Sep) [Peter Bopp: Kleines Jazz-Lexikon] |
JUST JAZZ GUITAR – P-811
The Publication for the Archtop and Jazz Guitar Enthusiast
England
1996: #7-8 (May,Aug)
1997: #10-11 (Feb,May), #13 (Nov); Collectors Edition #2 (Sep; special issue on Barney Kessel)
1998: #14-17 (Feb,May,Aug,Nov)
1999: #18-21 (Feb,May,Aug,Nov)
2000: #22-25 (Feb,May,Aug,Nov)
2001: #26-29 (Feb,May,Aug,Nov)
2002: #30-33 (Feb,May,Aug,Nov) |
JUST JAZZ MAGAZINE – P-867
The Traditional Jazz Magazine
England
1999: #16-20 (Aug-Dec)
2000: #21-32 (Jan-Dec)
2001: #33-44 (Jan-Dec)
2002: #45-56 (Jan-Dec)
2003: #57-68 (Jan-Dec)
2004: #69 (Jan), #73-74 (May-Jun), #79(Nov)
2005: #87-88, 90-91 (Jul-Aug, Oct-Nov)
2006: #103-104 (Nov-Dec)
2007: #105-116 (Jan-Dec)
2008: #117-128 (Jan-Dec)
2009: #130-140 (Jan-Dec)
2010: #141-152 (Jan-Dec)
2011: #153-164 (Jan-Dec)
2012: #165-176 (Jan-Dec)
2013: #177-188 (Jan-Dec)
2014: #188-200 (Jan-Dec)
2015: #201-212 (Jan-Dec)
2016: #213-224 (Jan-Dec)
2017: #225-236 (Jan-Dec)
2018: #237-248 (Jan-Dec)
2019: #249-260 (Jan-Dec)
2020: #261-272 (Jan-Dec)
2021: #273-278 (Jan-Jun) |
JUKE BLUES – P-1053
England
1985: #1-3 (Jul,Oct,Dec)
1986: #4-7 (Spring-Winter)
1987: #8-11 (Spring-Winter)
1988: #12-14 (Spring-Winter)
1989: #15-18
1990: #19-22
1991: #23-24
1992: #25-26 |
JUUL’S HALO – P-877
Netherlands
1999: Vol. 1/4 (Sep/Oct) |
KATAKOMBINATIONEN – P-807
Mitteilungsblatt des studentischen “club priv’” Katakombe für Literatur, Malerei, Musik Mainz
Germany
1958: #25 (Jun)
1959: Jun |
KELLER-KUNST-KELLER – P-790
Germany
1982: Mar/Jun |
KEN COLYER TRUST NEWSLETTER & MEMORABLILIA – P-598
England
1992: March
1993: Sep
1995: Dez
1996: März
1996: Juni
1996: Sept
1996: Dez
1997: März
1997: Juni
1997: Sept
1997: Dez
1998: Febr
1998: Juni
1998: Sept
1998: Dez
1999: März
1999: Juni
1999: Herbst
1999: Winter
2000: Frühjahr
2000: Sommer
2000: Herbst
2000: Winter
2001: Frühjahr
2001: Sommer
2001: Herbst
2001: Winter
2002: Frühjahr
2002: Sommer
2002: Herbst
2002: Winter
2003: Frühjahr
2003: Sommer
2003: Herbst
2003: Winter
2004: Frühjahr
2004: Sommer
2004: Herbst
2004: Winter
2005: Frühjahr
2005: Sommer
2005: Herbst
2005: Winter
2006: Frühjahr
2006: Sommer
2006: Herbst
2006: Winter
2007: Frühjahr
2007: Sommer
2007: Herbst
2007: Winter
2008: Frühjahr
2008: Sommer
2008: Herbst
2008: Winter
2009: Frühjahr
2009: Sommer
2009: Herbst
2009: Winter |
KEY – P-622
This Week in St.Louis
USA
1974: 6.-13.Jul |
KEYBOARD – P-251
(Contemporary Keyboard)
USA
1975: Vol. 1/1 (Sep/Oct), (Nov/Dec)
1976: Vol. 2/1 (Jan/Feb), 2/2 (Mar/Apr), 2/3
(May/Jun), 2/4 (Aug), 2/5 (Oct), 2/6 (Dec)
1977: Vol. 3/2 (Feb), 3/3 März, 3/5 May, 3/6 Jun,
3/7 Juli, 3/8 Aug, 3/11 Nov, 3/12 Dec
1978: 4/1-12 (Jan-Dec)
1979: Vol. 5/2-12 (Feb-Dez)
1980: Vol. 6/1-4 (Jan-Apr), 6/11-12 (Nov-Dec)
1981: Vol. 7/1-5 (Jan-May), 7/7-11 (Jul-Nov)
1982: Vol. 8/1 (Jan), 8/3-12 (Mar-Dec)
1983: Vol. 9/1-2 (Jan-Feb) 9/10 (Oct)
1984: Vol. 10/8 (Aug)
1986: Vol. 12/9 (#125/Sep)
1992: Vol. 18/1 (#189/Jan), 4 (#192/Apr), 6 (#194/Jun), 8-10 (#196-198)
1993: Vol. 19/1 (#201/Jan), 6 (#206/Jun), 10-12 (#210-212/Oct-Dec)
1994: Vol. 20/1-7 (#213-219/Jan-Jul)
1997: Vol. 23/1 (#249/Jan), 3-9 (#251-257/Mar-Sep), 11-12 (#259-260/Nov-Dec)
2000: Vol. 26/9-12 (#294-297/Sep-Dec)
2001: Vol. 27/1-7 (#298-304)
2002: Vol. 28/4-9 (#313-318,Apr-Sep) |
KEYBOARD CLASSICS & Piano Stylist – P-1069
USA
1993: Vol. 13/2-6 (Mar/Apr-Nov/Dec)
1994: Vol. 14/1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1995: Vol. 15/2 (Mar/Apr) |
KEYBOARDS – P-870
Germany
1998: #12 (Dec)
2008: #2 (Feb) |
KEY NOTES – P-252
Netherlands
1975/1: #1
1976/1: #3
1980/2: #12
1982/2: #16
1983/1: #17
1984/1: #19
1986: #23 |
KEYS – P-883
Belgium
1979: [one issue] |
KIRCHENMUSIKALISCHE NACHRICHTEN – P-876
Germany
1999: Vol. 50/4 (Oct/Dec) |
KIRCHENMUSIKER, Der – P-253
Mitteilungen der Zentralstelle für evangelische Kirchenmusik
Germany
1965: Vol. 16/5 (Sep/Oct) [Joachim-Ernst Berendt: Ekstase im Gottesdienst. Der Spiritual in seiner und in unserer Welt] |
KLASSIK HEUTE – P- 903
(Germany)
1999: Vol. 2/11 (Nov) |
KLON JAZZ GUIDE – P-254
(ab 7/2003 fortgeführt als KJazz 88.1 FM)
USA
1992: Vol. 12/1-2 (Jan/Mar, Apr/Jun)
1993: Vol. 13/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
1994: Vol. 14/2 (Apr/Jun) [Sonderheft Jazz West Coast], 14/4 (Nov/Dec)
1995: Vol. 15/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
1996: Vol. 16/1 (Jan/Mar), 16/3 (Jul/Sep), 16/4 (Oct/Dec)
1997: Vol. 17/1 (Jan/Mar), 17/3 (Jul/Sep), 17/4 (Oct/Dec)
1998: Vol. 18/1-2, (Jan/Mar-Apr/Jun), 19/4 (Oct/Dec)
2000: Vol. 20/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2001: Vol. 21/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2002: Vol. 22/1-3 (Jan/Mar-Jul/Sep)
2003: Vol. 23/2-3 (fortgeführt als KJazz 88.1 FM) (Apr/Jun- Jul/Aug/Sep)
2004: Vol.24/1-4(Jan/Mar-Oct-Dec)
2005: Vol. 25/1(Jan/Mar) |
KNIT KNEWS – P-813
USA
1998: Jan |
KNOTES – P-255
USA
1991: Vol. 1/1-5 (Jan/Feb-Nov/Dec) |
KONKRET – P-256
Germany
1967: #9 (Sep) [Joachim-Ernst Berendt: Joachim-Ernst Berendts Jazz-Magazin] |
KONTAKTE – P-1096
Germany
1964: Oct |
KONTRA – P-1064
(Zeitschrift für Klang, Bewegung und Sprache)
Austria
2006: #8 (Apr) |
KONTRASTE – P-257
Germany
1965: #18 [Joachim-Ernst Berendt: Jazz] |
DER KREIS – P-778
(Zeitschrift für künstlerische Kultur)
Germany
1929: Vol. 6/4 (Apr) |
KUNST & KULTUR – P-1150
Kulturpolitische Zeitschrift der IG Medien
Germany
1994: Vol. 1, #1-2 (Feb-Mar)
1995: Vol. 2, #4-5 (May-Jun/Aug) |
KUNSTFORUM – P-728
Germany
1996: #134 (May/Sep) |
KURT WEILL NEWSLETTER – P-258
USA
1986: Vol. 4/1-2 (Spring, Fall)
1987: Vol. 5/1 (Spring)
1988: Vol. 6/1-2 (Spring, Fall)
1989: Vol. 7/1-2 (Spring, Fall)
1990: Vol. 8/1-2 (Spring, Fall)
1991: Vol. 9/1-2 (Spring, Fall)
1992: Vol. 10/1-2 (Spring, Fall)
1993: Vol. 11/1-2 (Spring, Fall)
1994: Vol. 12/1-2 (Spring, Fall)
1995: Vol. 13/1-2 (Spring, Fall)
1996: Vol. 14/1-2 (Spring, Fall)
1997: Vol. 15/1-2 (Spring, Fall)
1998: Vol. 16/1-2 (Spring, Fall)
1999: Vol. 17/1-2 (Fall)
2000: Vol. 18/1-2 (Fall)
2001: Vol. 19/1-2 (Spring-Fall)
2002: Vol. 20/1-2 (Spring-Fall)
2003: Vol. 21/1-2 (Spring-Fall)
2004: Vol. 22/1-2 (Spring-Fall)
2005: Vol. 23/1 (Spring)
2006: Vol. 24/1-2 (Spring-Fall)
2007: Vol. 25/1-2 (Spring-Fall)
2008: Vol. 26/1-2 (Spring-Fall)
2009: Vol. 27/1-2 (Spring-Fall)
2010: Vol. 28/1-2 (Spring-Fall)
2011: Vol. 29/1-2 (Spring-Fall)
2012: Vol. 30/1-2 (Spring-Fall)
2013: Vol. 31/1-2 (Spring-Fall)
2014: Vol. 32/1-2 (Spring-Fall)
2015: Vol.33/1-2 (Spring-Fall)
2016: Vol. 34/1-2 (Spring-Fall)
2017: Vol.35/1-2 (Spring-Fall)
2018: Vol.36/1-2 (Spring-Fall)
2019: Vol.37/1-2 (Spring-Fall)2020: Vol. 38 (Spring Edition postponed to Fall)
38/1 (Fall) |
KWICK DRUM TIPS – P-259
USA
1991: #8 |
L’INDEPENDANT DU JAZZ – P-265
France
1975: #3-5 (Apr-Oct)
1976: #6-9 (Jan-Oct)
1977: #10-13 (Apr-Oct)
1978: #14-16 (Jan-May)
1979: #17-19 (Jan-Oct), 17bis
1980: #21 (May) |
L’UMJ EN CHANTIER (LA GAZETTE) – P-450
(Union des Musiciens de Jazz)
France
1992: #2-3 (Summer-Winter)
1993: #4-5 (Spring-Winter)
1994: #6-7 (Summer-Winter)
1995: #8 (Summer)
1996: #9 (Summer)
2000: #12 (Jan) |
L.A. JAZZ SCENE – P-457
USA
1992: #58 (Jun) |
LABORATORIO MUSICA – P-486
Italy
1979: Vol. 1/4-7/8 (Sep-Dec/Jan)
1980: Vol. 2/9 (Feb + Dossier Musica, istituzioni e legislazione), 11 (Apr) |
LABEL JAZZ – P-260
France
1991: #4-6 (Apr/May/Jun-Oct/Nov/Dec)
1992: #7
1993: #8 |
LATIN BEAT – P-261
Salsa, Afro-Antillana, Latin Jazz and More
USA
1991: Vol. 1/1-11 (Jan-Dec/Jan)
1992: Vol. 2/1-10 (Feb-Dec/Jan)
1993: Vol. 3/1-10 (Feb-Dec/Jan)
1994: Vol. 4/1-10 (Feb-Dec/Jan)
1995: Vol. 5/1-10 (Feb-Dec/Jan)
1996: Vol. 6/1-10 (Feb-Dec/Jan)
1997: Vol. 7/1-10 (Feb-Dec/Jan)
1998: Vol. 8/1-10 (Feb-Dec/Jan)
1999: Vol. 9/1-10 (Feb-Dec/Jan)
2000: Vol. 10/1-10 (Feb-Dec/Jan)
2001: Vol. 11/1-10 (Feb-Dec/Jan)
2002: Vol. 12/2-10 (Mar-Dec/Jan)
2003: Vol. 13/1-10 (Feb-Dec/Jan)
2004: Vol. 14/1-10 (Feb-Dec/Jan)
2005: Vol. 15/1-10 (Feb-Dec/Jan)
2006: Vol. 16/1-10 (Feb-Dec/Jan)
2007: Vol. 17/1-10 (Feb-Dec/Jan)
2008: Vol. 18/1 (Feb) |
LEAD BELLY NEWSLETTER – P-704
USA
1990: Vol. 1/1 (Autumn)
1991: Vol. 1/2-4 (Winter-Fall)
1992: Vol. 2/1-4 (Winter-Fall)
1993: Vol. 3/1-4 (Winter-Fall)
1994: Vol. 4/1-4 (Winter-Fall)
1995: Vol. 5/1-4 (Winter-Fall)
1996: Vol. 6/1-4 (Winter-Fall) |
DAS LEBEN – P-769
Germany
1927: Vol. 5/1 (Jul)
1928: Vol. 6/6 (Dec) |
LEE LO’S JAZZ NEWSLETTER – P-262
USA (New York)
1992: Vol. ¾-5 (Apr-May) |
LEG AUF UND SIEH FERN – P-1149
Germany
1965: #1-2 (Jan-Feb), 5-12 (May-Dec)
1966: #1-6 (Jan-Jun), 8 (Aug), 10 (Oct), 12 (Dec)
1967: #3 (Mar), 11 (Nov)
1968: #1 (Jan), 8-9 (Aug.Sep) |
LETTER FROM EVANS – P-263
USA
1989: Vol. 1/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
1990: Vol. 1/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); Vol. 2/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
1991: Vol. 2/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); Vol. 3/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
1992: Vol. 3/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); Vol. 4/1 (Sep/Oct)
1993: Vol. 4/2-4/4 (winter-summer); 5/1 (Fall)
1994: Vol. 5/2-4 (Winter-Summer) [eingestellt] |
LETTRE INTERNATIONAL – P-541
Germany
1989: #6
1993: #20 [Gary Giddins: Listig wie ein Fuchs. Dizzy Gillespie]
1994: #24 [Peter Niklas Wilson: Improvisation. 16 Stichworte zu einer flüchtigen Kunst] |
LE POINT DU JAZZ – P-1159
France
1973. #09 (Dez)
1974: #10 (Okt)
1981: #17 (Juli)
1982: #18 (Nov)
1984: #19 (Juni) |
LIBERTY – P-1156 (USA)
(The Nostalgia Magazin)
1973: Vol.1 #8 (Spring) |
LIFE – P-264
USA
1955: Vol. 18/3 (7.Feb)
1966: Vol. 60/15 (15.Apr) [Richard Meryman: Louis Armstrong. An Authentic American Genius; Armstrong-Cover] |
LIGNE 8 -P-1045
Le Journal de L’Opera National de Paris
France
2005: Vol. 7 (Nov/Dec) |
The LIGNTNING EXPRESS – P-1102
An Occasional Newspaper Devoted to American Music
USA
1976: #3 |
LINERNOTES – P-266
Stateline Jazz Society
USA
1992: Vol. 2/1 (Jan) |
LIRA –P-1145
Musikmagasin
Sweden
2010: #2
2011: #1-2
2012: #2 (Mar), 4 (Sept) |
LIST UDRUZENJA JAZZ MUZICARA – P-765
Bulgaria
1953: #1 (Aug)
1954: #2 (Feb) |
LISTEN TO NORWAY – P-550
Norway
1993: Vol. 1/1-2
1994: Vol. 2/1-3
1995: Vol. 3/1-3
1996: Vol. 4/1 [complete volume]
1997: Vol. 5/1-3
1998: Vol. 6/1-3
1999: Vol. 7/1-3
2000: Vol. 8/1-3
2001: Vol. 9/1 [eingestellt] |
LIVING BLUES – P-267
USA
1970: Vol. 1, #1-4 (Spring-Winter)
1971: Vol. 2, #5-7 (Spring-Winter)
1972: Vol. 3, #8-11 (Spring-Winter)
1973: Vol. 4, #12-15 (Spring-Winter)
1974: Vol. 5, #16-18 (Spring-Fall)
1975: Vol. 6, #19-24 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1976: Vol. 7, #25-30 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1977: Vol. 8, #31-35 (Mar/Apr-Nov/Dec)
1978: Vol. 9, #36-41 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1979: Vol. 10, #42-44 (Jan/Feb-Fall)
1980: Vol. 11, #45/46-49 (Spring-Winter)
1981: Vol. 12, #50-51 (Spring-Summer)
1982: Vol. 13, #52-55 (Spring, Summer/Fall, Fall/Winter, Winter)
1983: Vol. 14, #56-58 (Spring-Winter)
1984: Vol. 15, #59-62 (Spring-Winter)
1985: Vol. 16, #63-66 (Jan/Feb-Jul/Aug)
1986: Vol. 17, #67-72 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1987: Vol. 18, #73-77 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1988: Vol. 19, #78-83 (Jan/Feb -Nov/Dec)
1989: Vol. 20, #84-89 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1990: Vol. 21, #90 (Mar/Apr)
1991: Vol. 22, #95-100 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1992: Vol. 23, #101-106 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1993: Vol. 24, #107-112 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1994: Vol. 25, #113-118 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1995: Vol. 26, #119-124 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1996: Vol. 27, #125-130 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1997: Vol. 28, #131-136 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1998: Vol. 29, #137-142 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1999: Vol. 30, #143-148 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2000: Vol. 31, #149-154 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2001: Vol. 32, #155-157,159 (Jan/Feb-May/Jun,Oct)
2002: Vol. 33, #161-165 (Feb-Aug) |
LIVING BLUESLETTER – P-268
USA
1983: Vol. 1/1 (Jan), 6-9 (Jun-Sep), 11-12 (Nov-Dec)
1984: Vol. 2/1-3 (Jan-Mar), 5&6-12 (May/Jun-Dec) |
LONDONS MUSICIANS COLLECTIVE NEWS (LMC News) – P-269
England
1991: Dec
1992: Feb, Apr-Dec (Oct-issue part of RESONANCE)
1993: Jan,Mar,Apr,May,Aug
1996: Feb/Mar |
LOOKING AHEAD – P-270
Coastal Jazz & Blues Society’s Newsletter
Canada
1989: Vol.1/2 (Mar/Apr)
1993: Apr/May, Aug/Sep, Oct/Nov, Dec/Jan
1994: Feb/Mar-Apr/May, Aug/Sep-Dec/Jan
1995: Feb/Mar-Apr/May-Aug/Sep-Oct/Nov-Dec/Feb
1996: Spring-Winter
1997: Spring
1998: Fall,Winter |
LOOP P-1148
USA (New York)
2016: #1 (Fall) |
LOUISIANA RENAISSANCE – P-563
A Publication of the Louisiana Educational and Cultural Foundation
USA
1978: Vol. 1/2 (Fall) |
LUI – P-271
Germany
1978: #11 (Nov) [Joachim-Ernst Berendt, Friedrich Gulda, Klaus Doldinger, Claus Schreiner, George Gruntz: Jazz in Deutschland. Eine Bilanz] |
MAGASIN DU SPECTACLE, Le – P-272
France
1946: #2 (Jun) [Hugues Panassie: Fats Waller … Paris] |
MAGAZINE LITTERAIRE – P-273
France
1974: #87 (Apr) [special issue on Boris Vian] |
MAGNUM – P-274
Germany
1954: Vol. 1/2 [no jazz content], 3 [Joachim-Ernst Berendt: Jazz – wie weiter?]
1955: Vol. 2/7 (Joachim-Ernst Berendt: Jazz in Europa]
1957: Vol. 4/15 [Joachim-Ernst Berendt: Warum Jazz in Donaueschingen?]
1958: Vol. 5/16 [no jazz content], 19 [Olaf Hudtwalker: Zur Situation des Jazz in Deutschland; Joachim-Ernst Berendt: Deutsches Jazz-Festival 1958] |
MAINSTREAM – P-275
England
1974: Vol. 1/1 |
MARGE HOFACRE’S JAZZ NEWS – P-826
USA
(as “No Name Jazz Newsletter”; after Vol. 5/7
as “Marge Hofacre’s Jazz News”; after #76 as
“Marge Hofacre’s Jazz News”:)
1984: Vol. 1/1-2 (Nov-Dec)
1985: Vol. 1/3-12 (Jan-Oct); Vol. 2/1-2 (Nov-Dec)
1986: Vol. 2/3-11 (Jan-Oct); Vol. 3/1-2 (Nov-Dec)
1987: Vol. 3/3-11 (Jan-Oct); Vol. 4/1-2 (Nov-Dec/Jan)
1988: Vol. 4/3-8 (Feb-Oct); Vol. 5/1-2 (Nov-Dec/Jan)
1989: Vol. 5/3-8 (Feb-Oct/Nov); Vol. 6/1 (Dec/Jan)
1990: Vol. 6/2-6 (Feb/Mar-Oct/Nov); Vol. 7/1 (Dec/Jan)
1991: Vol. 7/2-5 (Mar/Apr-25.Sep), #62 (Dec)
1992: Vol. 8, #63-58 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1993: Vol. 9, #69-74 (Jan/Feb-Dec)
1994: Vol. 10, #75-79 (Jan/Feb-Dec)
1995: Vol. 11, #80-84 (Mar/Apr-Nov/Dec)
1996: Vol. 12, #85-89 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1997: Vol. 13, #90-94 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1998: Vol. 14, #95-99 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1999: Vol. 15, #100-102 (Mar/Apr-Winter)
2000: Vol. 16, #103-106 (Mar/Apr-Winter)
2001: Vol. 17, #107 (Spring) |
MARGEN – P-901
Spain
1995: #3
1996: #6
1996/97: #8 (Winter)
1997: #10 |
MARKETING FOR MUSICIANS – P-611
USA
1993: #1-2 (Jul,Oct)
1994: #3 (Winter) |
MASTERBAG – P-520
The News Magazine of the Independent Wholesalers
England
1982: #12 (24.Jun-7.Jul) |
MATRIX – P-276
England
1956: #11/12
1958: #18-20
1959: #21-26
1960: #28-31
1961: #32-38
1962: #39-44
1963: #45-50
1964: #51-56
1965: #57-62
1966: #63-68
1967: #69-74
1968: #75-80
1969: #81-86
1970: #87-90
1971: #91-95
1972: #96-103
1973: #104-108 (? Rolf)
1974: #102-105
1975: #106-108 |
MAX – P-488
Germany
1993: #4-7 (Apr-Jul) [NN: Jazz Extra (Fotos aus dem JID)] |
MEDIUM – P-436
Germany
1980: Vol. 10/7 (Jul) [Joachim-Ernst Berendt: Über die Zurückweisung des Möglichen. Ein Beitrag zur Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk]
1992: Vol. 22/special [Thema: Volkstümliche Unterhaltung im Fernsehen. Wie harmlos ist die deutsche Gemütlichkeit?] |
MELODIE – P-562
Czechoslovakia
1964: #2, 5, 7-12
1965: #1-2, 4-6, 8, 10-12
1966: #2, 5-7, 8-9
1970: #3 (includes supp.)
1971: #8-12
1972: #1-12
1973: #1-12
1974: #1-12
1975: #10, (komplett gebunden #1-12)
1977: #1-12
1978: #1-12
1979: #1-12
1980: #1-12
1981: #1-12
1982: #1-12
1983: Vol. 21 #1-9
1986. Vol. 24 #5, #6, #8-12,
1988: Vol. 26/10, 12
1989: Vol. 27/1-6, 8
1990: Vol. 28/1-2, 6-9, 10, 11-12 |
MELODIE – P-1126
Germany
1947: Vol. 2/1 (Jan), 5 (May), 8-9 (Aug-Sep)
1948: Vol. 3/3-5 (Mar-May), 11-12 (Nov-Dec)
1949: Vol. 4/1 (Jan), 6 (May) |
MELODIE UND RHYTHMUS – P-277
East Germany / Germany
1960: Vol.04/1-24
1961: Vol.05/1-24
1962: Vol.06/1-24
1963: Vol.07/1-24
1966. Vol.10/1-24
1967: Vol.11/1-24
1968: Vol.12/1-24
1969: Vol 13/1-24
1970: Vol. 14/1-14/24
1971: Vol. 15/1-15
1972: Vol. 16/1-12
1973: Vol. 17/1-12
1974: Vol. 18/1-12
1975: Vol. 19/1-12
1976: Vol. 20/1-12
1977: Vol. 21/1-12
1978: Vol. 22/1-12
1979: Vol. 23/1-12
1980: Vol. 24/1-12
1981: Vol. 25/1-12
1982: Vol. 26/1-12
1983: Vol. 27/1-12
1984: Vol. 28/1-12
1985: Vol. 29/1-12
1986: Vol. 30/1-12
1987: Vol. 31/1-12
1988: Vol. 32/1-12
1989: Vol. 33/1-12
1990: Vol. 34/1-4, 6-12
1991: Vol. 35/1-3
2015: Jul/Aug-Nov/Dec
2016: Jan/Feb-Nov/Dec
2017: Jan/Mar-Oct/Dec
2018: Jan/Mar
2019: Jan/Mar-Oct/Dec
2020: Jan/Mar-Jul/Sep
2021: Jan/Mar-Apr/Jun |
MELODIVA – P-712
Germany
(Frauen Musik Journal)
1996: 1/96 (Mar-Jun)
1998: #8 (Jan-Mar) |
MELODY MAKER – P-278
England
1937: #202 (3.Apr)
1938: #246 (5.Feb), 248 (19.Feb), 251 (12.Mar)
1952: #967-968 (29.Mar-5.Apr)
1953: #1017-1023 (14.Mar-25.Apr), #1025-1037 (9.May-1.Aug), #1039-1058 (15.Aug-26.Dec)
1954: #1059-1069 (2.Jan-13.Mar), #1071-1075 (27.Mar-24.Apr), #1077-1110 (8.May-25.Dec)
1955: 1.Jan-19.Mar, 2.Apr-25.Jun, 9.Jul-31.Dec
1956: 7.Jan-11.Feb, 7.Apr-29.Dec
1957: 5.Jan-28.Dec
1958: 4.-18.Jan, 1.Feb-27.Dec
1959: 3.Jan-20.Jun, 8.Aug-10.Oct, 24.Oct-26.Dec
1960: 7.Jan-9.Apr, 23.Apr-10.Dec, 24.-31.Dec
1961: 7.Jan-18.Feb, 4.Mar-24.Jun, 8.Jul-30.Dec
1962: 13.Jan-11.Aug, 1.Sep-10.Nov, 24.Nov-8.Dec, 29.Dec
1963: 5.Jan-16.Feb, 2.-9.Mar, 6.-27.Apr, 11.May, 21.Sep, 19.Oct, 2.Nov
1964: 21.Mar, 4.Apr-26.Sep, 2.-17.Oct, 31.Oct-26.Dec
1965: 2.Jan-27.Feb, 13.-20.Mar, 3.Apr, 1.-8.May, 22.May, 5.Jun-10.Jul, 24.Jul-18.Sep, 9.Oct-20.Nov, 4.-25.Dec
1966: 25.Feb, 9.Apr-21.May, 4.-25.Jun, 9.Jul, 23.Jul, 8.-20.Aug, 17.-24.Sep, 8.Oct-5.Nov, 19.Nov, 31.Dec
1967: 14.Jan-4.Feb, 8.Apr, 22.Apr, 27.May-7.Oct, 2.-16.Dec
1968: 13.-20.Jan, 3.Feb-9.Mar, 13.Apr-1.Jun, 15.-29.Jun, 13.-27.Jul, 7.-14.Sep, 5.Oct-28.Dec
1969: 4.Jan-1.Mar, 22.Mar-12.Apr, 10.May-26.Jul, 6.Sep, 20.Sep-27.Dec
1970: 3.Jan-7.Mar, 21.Mar-26.Dec
1971: 2.Jan-13.Mar, 27.Mar-2.Oct, 16.Oct, 30.Oct-11.Dec
1972: 15.Jan-6.May, 20.May-29.Jul, 12.Aug, 2.Sep, 14.-21.Oct, 4.Nov, 25.Nov-30.Dec
1973: 6.Jan-17.Mar, 31.Mar, 14.Apr, 2.Jun, 16.Jun, 7.Jul, 25.Aug, 15.Sep,
29.Sep, 3.-10.Nov, 24.Nov
1974: 2.Feb, 23.Feb, 9.-30.Mar, 18.May-15.Jun, 29.Jun-17.Aug, 14.Sep-28.Dec
1975: 4.Jan-1.Feb, 29.Mar-5.Apr, 12.Apr-10.May, 24.May.-7.Jun, 2.Aug, 27.Sep, 29.Nov
1976: 24.-31.Jan, 6.-20.Mar, 1.-8.May, 29.May-10.Jul, 24.Jul-7.Aug, 4.Sep, 9.Oct, 13.Nov-11.Dec, Special (50 Years of Music)
1977: 8.-15.Jan, 5.Feb, 7.May, 28.May-4.Jun, 6.Aug
1978: 22.Apr
1979: 16.Jun
1982: 24.Jul, 16.Oct-18.Dec
1983: 1.Jan-17.Dec
1984: 7.Jan-9.Jun, 28.Jul-8.Dec
1985: 5.-12.Jan, 26.Jan-7.Dec, 21./28.Dec
1986: 4.Jan-1.Mar, 22.Mar-19.Apr, 3.May-14.Jun, 28.Jun-11.Oct, 8.Nov-27.Dec
1987: 3.Jan-4.Apr, 26.Apr, 21.Jun, 25.Oct-1.Nov, 14.Dec
1992: 25.Jan, 16.May, 8.Aug, 26.Sep, 5.Dec |
MELODY MAKER YEARBOOK – P-279
England
1969
1971 |
MELOS – P-280
Germany
1947: Vol. 14/5 (Mar) [Joachim-Ernst Berendt: Vom Choral zum Swing]
1949: Vol. 16/12 (Dec) [Joachim-Ernst Berendt: Das Radio oder die Musik]
1951: Vol. 18/3 (Mar) [Joachim-Ernst Berendt: Americana]
1952: Vol. 19/4 (Apr) [Special issue on jazz; articles by Sidney Finckelstein, Joachim-Ernst Berendt, Olaf Hudtwalker, Peter S. Bopp, Kurt Westphal]; Vol. 19/7 (Jun/Jul) [Joachim-Ernst Berendt: Salon du Jazz]
1954: Vol. 21/2 (Feb) [Walter Harth: Ein Kompendium der Jazzmusik (book review on Berendt’s Jazzbuch)]
1955: Vol. 22/11 (Nov) [G.W.B.: Ein Jahr in Jazz]
1967: Vol. 34/10 (Oct) [Joachim-Ernst Berendt: Free Jazz – der neue Jazz der sechziger Jahre]
1970: Vol. 37/10 (Oct)
1974: Vol. 41/2 (Mar/Apr) [Joachim-Ernst Berendt: Der neue Jazz der siebziger Jahre]
1984: Vol. 46/3 [kein Jazzgehalt] |
MEMORY LANE – P-814
England
1969: Vol.2 #1-4 (Febr., Mai, Aug., Nov.)
1970: Vol.2 #2-4 (Febr, Mai, Aug)
1971: Vol.3 #2 (Febr)
1971/2: Vol.3 #3&4 kombiniert (Winter)
1972: Vol.4 #1-3
1974: Vol.6 #24
1975: Vol.7 #25 bis #32
1977: Vol.9 #33 bis #36
1977/8 Vol.10 #37 bis #40
1978/9 Vol.11 #41 bis #45
1980: Vol.12 #46 bis #48
1980/1 Vol.13 #49 bis #52
1981/2 Vol.14 #53 bis #56
1982/3 Vol.15 #57 bis #60
1983. Vol.16 #4
1984: #62 bis #65 (Spring – Autumn)
1985: #66 bis #69 (Spring – Autumn)
1986: #70 bis #73 (Spring – Autumn)
1987: #74, #75, #77 (#76 fehlt)
1988: #78 bis #80
1989: #81 Spring, #82 Summer
1990: #85, #87, #88 (#86 fehlt)
1991: #89 bis #92
1992: #94 (Summer)
1993: #98, #99, #100 (Winter)
1994: #102, #103, #104
1995: #105 bis #108 (Winter)
1996: #109, #110, #112 (#108 fehlt)
1997: #113-116 (Spring-Winter)
1998: #117-121 (Spring-Winter)
1999: #122-125 (Spring-Winter)
2000: #126-129 (Spring-Winter)
2001: #130-133 (Spring-Winter)
2002: #134-137 (Spring-Winter)
2003: #138-141 (Spring-Winter)
2004: #142-145 (Spring-Winter)
2005: #146-149 (Spring-Winter)
2006: #150-153 (Spring-Winter)
2007: #154-157 (Spring-Winter)
2008: #158-161 (Spring-Winter)
2009: #162-165 (Spring-Winter)
2010: #166-169 (Spring-Winter)
2011: #170-173 (Spring-Winter)
2012: #174-177 (Spring-Winter)
2013: #178-181 (Spring-Winter)
2014: #182-185 (Spring- Winter)
2015: #186-189 (Spring-Winter)
2016: #190-193 (Spring-Winter)
2017: #194-197 (Spring-Winter)
2018: #198-201 (Spring-Winter)
2019: #202-205 (Spring-Winter)
2020: #206-208 (Spring-Fall) |
MEMORY MAIL – P-884
England
1973: #35 (Nov) |
MERIAN – P-439
Germany
1979: Vol. 32/2 (Feb) |
MERKUR – P-281
Deutsche Zeitschrift für Europäisches Denken
Germany
1952: Vol. 6/2 (#48) [Joachim-Ernst Berendt: Vom “schwarzen” Amerika]
1953: Vol. 7/9 (#67) [Joachim-Ernst Berendt: Theodor W. Adorno – Für und wider den Jazz]
1964: Vol. 18/4 (#194) [Joachim-Ernst Berendt: Nekrolog auf die Jazzliteratur] |
METIER, Le – P-282
France
1969: #15 (Jul) [Philippe Paringaux: Interview de George Wein, maitre de Newport] |
METRONOME – P-283
USA
1936: Vol. 52/10 (Oct)
1937: Vol. 53/5 (May); 54/6 (Jun), 8 (Aug)
1939: Vol. (56)/9 (Sep)
1940: Vol. (57)/6 (Jun)
1941: Vol. (58)/3 (Mar), 5 (May), 12 (Dec)
1944: Vol. (61)/8, (62)/11-12
1945: Vol. (62)/1 (Jan), 5-6 (May-Jun), 8-10, (63)/11-12
1946: Vol. (64)/1-10, 12
1947: Vol. 63/1-12
1948: Vol. 64/1-3, 5-12
1949: Vol. 65/1-12
1950: Vol. 66/1-11 (complete)
1951: Vol. 67/1-12
1952: Vol. 58/1-12
1953: Vol. 69/1-12
1954: Vol. 70/1-12
1955: Vol. 71/1-12
1956: Vol. 72/1-12
1957: Vol. 74/1-8, 10-11
1958: Vol. 75/1-12
1959: Vol. 76/1-10, 12
1960: Vol. 77/6-12
1961: Vol. 78/1-12 |
METRONOME YEARBOOK, The – P-284
USA
1950
1951
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959 |
MI – Músicas improvisadas – P-956
Spain
1995: #4-6 |
MICROGRAPHY – P-285
Netherlands
1969: #1-7
1970: #8-11
1971: #12-16
1972: #17-22
1973: #23-29
1974: #30-34
1975: #35-38
1976: #39-42
1977: #43-45
1978: #46-49
1979: #50-51
1980: #52-54
1981: #55-57
1982: #58-60
1983: #61-63
1984: #63-66
1985: #67-68
1986: #69-71
1987: #72-73
1988: #74-76 |
MISSISSIPPI COAST SOCIETY NEWSLETTER – P-681
USA
1978: 20.Apr |
MISSISSIPPI RAG – P-286
The Voice of Traditional Jazz and Ragtime
USA
1973: Nov
1974: Feb, Sept,
1975: Apr,Jun,Sep,Dec
1977: Jun,Aug,Nov
1978: Apr,Jul,Dec
1979: Jan,Feb,Apr
1980: Dec
1981: May-Jun,Sep,Dec
1982: Jan
1983: Oct-Dec
1984: Jan
1985: Jan-Mar,Jun,Nov
1986: Feb,May,Dec
1987: Nov
1988: Jan,May-Jun,Nov,Dec
1989: Feb,Jun
1990: Jan,May
1991: Jun,Aug-Dec
1992: Jan-Dec
1993: Jan-Dec
1994: Jan-Dec
1995: Jan-Dec
1996: Jan-Dec
1997: Jan-Dec
1998: Jan-Dec
1999: Jan-Dec
2000: Jan-Dec
2001: Jan-Dec
2002: Jan-Dec
2003: Jan-Dec
2004: Jan-Dec
2005: Jan-Dec
2006: Jan-Oct |
MITTEILUNGSBLATT DER DEUTSCHEN JAZZ-FÖDERATION – P-820
Germany
1952: Apr, #4 (Jun) |
MODERN DRUMMER – P-287
USA
1977: Vol. 1/1-4 (Jan-Oct)
1978: Vol. 2/1 (Jan), 3 (Jul)
1979: Vol. 3/1-2 (Jan/Feb-Mar/Apr), 6 (Dec/Jan)
1980: Vol. 4/1-5 (Feb/Mar-Oct/Nov)
1981: Vol. 5/2-4 (Apr-Jun)
1982: Vol. 6/5 (Jul), 7 (Oct)
1983: Vol. 7/3 (Mar), 5-6 (May-Jun), 12 (Dec)
1984: Vol. 8/1 (Jan), 6 (Jun)
1985: Vol. 9/3-5,7-10,12 (Mar-May,Jul-Oct,Dec
1986: Vol. 10/1-7,9-12 (Jan-Jul, Sep-Dec)
1987: Vol. 11/6-7 (Jun-Jul), 9 (Sep), 10-11 (Oct-Nov)
1988: Vol. 12/1, 3-5, 8, 10-12 (Jan,Mar-May,Aug, Oct-Dec)
1989: Vol. 13/1-12 (Jan-Dec)
1990: Vol. 14/1-2,5-9,11-12 (Jan-Feb,May-Sep,Nov-Dec)
1991: Vol. 15/1-12 (Jan-Dec)
1992: Vol. 16/1-12 (Jan-Dec)
1993: Vol. 17/1-12 (Jan-Dec)
1994: Vol. 18/1-12 (Jan-Dec)
1995: Vol. 19/1-12 (Jan-Dec)
1996: Vol. 20/1,3-12 (Jan,Mar-Dec)
1997: Vol. 21/1-12 (Jan-Dec)
1998: Vol. 22/1-12 (Jan-Dec)
1999: Vol. 23/1-12 (Jan-Dec)
2000: Vol. 24/1-12 (Jan-Dec)
2001: Vol. 25/1-12 (Jan-Dec)
2002: Vol. 26/1-12 (Jan-Dec)
2003: Vol. 27/1-12 (Jan-Dec)
2004: Vol. 28/1-12 (Jan-Dec)
2005: Vol. 29/1-12 (Jan-Dec)
2006: Vol. 30/1-12 (Jan-Dec)
2007: Vol. 31/1-11 (Jan-Dec)
2008: Vol. 32/1-9 (Jan-Sep) |
MODERN JAZZ BREDA – P-288
Netherlands
1974/75: Vol. 2/3
1977: Vol. 4/4-5
1978/79: Vol. 5/1, 5-6 |
MODERN KEYBOARD REVIEW – P-647
USA
1970: Vol. 2/6 (Sep) |
DER MONAT – P-772
Germany
1963: Vol.15/179 (Aug) [Norbert Muhlen: Die schwarzen Amerikaner] |
MONDE DE LA MUSIQUE, Le – P-487
France
1979: #12 (Jun)
1980: #23-26 (May-Sep), 28 (Nov)
1982: #43 (Mar)
1984: #64 (Feb) |
MONITOR – P-985
Portugal
1994: Vol. 2/3-4 (Aug-Sep) |
MONK MINK PINK PUNK – P-863
USA
1997: #4 (Summer) |
MOUNTAIN FOLD – P-1142
Australia
2010: Vol.2/1 |
MUMBO JUMBO – P-936
3D Family’s News Letter
2000: #2 (Nov)
2001: #3 (Sep)
2002/2003: #4 (Nov) |
MÜNCHNER JAZZ NACHRICHTEN – P-289
Germany
1974: Vol. 3/1 (Jan), 11 (Nov)
1975: Vol. 4/3 (Mar), 5 (May), 9 (Sep)
1976: Vol. 5/1-4 (Jan-Apr) |
MULLIGAN’S INTERNATIONAL STEW – P-730
France
1994: Mar,Jun,Sep,Dec
1995: Jun
1996: Dec/Jun |
MUSIC (Magazine International du Jazz / Le Magazine du Jazz) – P-927
Belgium
1933: Vol. 9/88 (Jan), 90-92 (Mar-May) [covers missing]
1934: Vol. 10/101-106/107 (Feb-Jul/Aug)
1935: Vol. 11/114 (Mar), 118 (Jul) [cover missing], 121 (Oct) [cover only], 122 (Nov) [cover missing]
1936: Vol. 12/124 (Jan) [cover missing], 125 (Feb) [cover only]; 132-133 (Sep-Oct)
1937: Vol. 13/136 (Jan), 139 (Apr), 141-147 (Jun-Dec)
1938: Vol. 14/148-149 (Jan-Feb), 151-158/159 (Apr-Nov/Dec)
1939: Vol. 15/161(Feb),165 (Jun) [cover only], 166/167-168-171 (Jul/Aug-Sep/Dec) |
MUSIC – P-920
Le magasine du Jazz
France
1939: Vol 15/166/167 (Jun/Jul) |
MUSIC – P-546
Das Shopping Magazin
Germany
1989/90: Winter |
MUSIC AMERICA MAGAZINE – P-430
(USA)
1976: Vol. 1/2-3 (Nov-Dec)
1977: Vol. 1/4-7 (Jan-May/Jun) |
MUSIC AND RHYTHM – P-630
USA
1941: Vol. 2/13 (Dec)
1942: Vol. 3/8 (Aug) |
MUSIC BOX, The – P-290
A Journal of Independent Reviews of Jazz and Classical Music
USA
1991: Vol. 1/1-5 (Mar/Apr-Nov/Dec)
1992: Vol. 1/6 (Jan/Feb) |
MUSICCLUB – P-632
I Ritmi del Messico
Italy
1994: #31, 33-34 |
MUSIC IN SWEDEN – P-291
Sweden
1979: #2 (May) [special jazz issue] |
MUSIC MAGAZINE, the – P-969
Musical Courier
USA
1961: Nov |
MUSIC MAKER – P-941
Australia
1967: Vol. 35/9 (Feb)
1972: Vol. 41/11 (Apr) |
MUSIC MAKER – P-292
England
1966: Vol. 1/1-4 (Sep-Dec)
1967: Vol. 1/6-12 (Feb-Aug); Vol. 2/1-4 (Sep-Dec)
1968: Vol. 2/5-6 (Jan-Feb) |
MUSIC MAKER (THE) – P-665
USA
1969: Vol. 37 (Apr) |
MUSIC MANAGEMENT – P-508
The Magazine Behind the Business News
USA
1983: #1 (May/Jun) |
MUSIC MEMORIES AND JAZZ REPORT – P-621
covering all phases of music collecting
USA
1963: Vol. 3/5-6 (Fall,Winter)
1964: Vol. 4/1-2 (Spring,Summer)
1965: Vol. 4/3 (Spring) |
MUSIC PERCEPTION – P-991
an interdisciplinary journal
USA
2002: Vol. 19/3 (Spring) |
MUSIC SCENE – P-293
Germany (Berlin)
1979: Mar
1980: May
1982: Jul, Sep-Dec
1983: Jan, Apr-Jun, Nov-Dec
1984: Feb-Apr, Nov-Dec
1985: Mar-Apr, Jun-Jul, Nov
1986: Feb, May, Nov-Dec/Jan
1987: Jul |
MUSIC SCENE – P-514
Switzerland
1972: 23.Nov
1972: 1.Feb-15.Feb, 4.May; #1-13
1980: #15 (Oct)
1983: #10 (Oct) |
MUSIC TODAY – P-294
Italy
1986: Vol. 1/1 (Nov)
1987: Vol. 2/3 (Jun)
1988: Vol. 3/5-6 |
MUSICA – P-295
Germany
1951: Vol. 5/12 (Dec) [Joachim-Ernst Berendt:Von Musikern und Musikanten]
1963: Vol. 17/5 (Sep/Oct) [Joachim-Ernst Berendt: Musik im Fernsehen] |
MUSICA JAZZ – P-296
Italy
1964: Vol. 20/1 (#203)
1966: Vol. 22/1-12 (#225-235) [Pecherstorfer]
1967: Vol. 23/1-12 (#236-246)
1968: Vol. 24/1-12 (#247-257)
1969: Vol. 25/1-12 (#258-268)
1970: Vol. 26/1-12 (#269-279)
1971: Vol. 27/1-6,8/9 (#280-285, 287)
1972: Vol. 28/3 (#293)
1973: Vol. 29/12 (#307,#312)
1974: Vol. 30/4 (#316), 30/10 (#321)
1975: Vol. 31/1 (#324), 31/6 (Jun), 31/10-12 (Oct-Dec)
1976: Vol. 32/1-2, 4-12
1977: Vol. 33/1-12 (#346-356)
1978: Vol. 34/1-12 (#357-367)
1979: Vol. 35/1-12 (#368-378)
1980: Vol. 36/1-12 (#379-389)
1981: Vol. 37/1-12 (#390-400)
1982: Vol. 38/1-12 (#401-411)
1983: Vol. 39/1-12 (#412-422)
1984: Vol. 40/1-12 (#423-433)
1985: Vol. 41/1-12 (#434-444)
1986: Vol. 42/1-12
1987: Vol. 43/1-12
1988: Vol. 44/1-12
1989: Vol. 45/1-12
1990: Vol. 46/1-12
1991: Vol. 47/1-12
1992: Vol. 48/1-11 [Dec fehlt]
1993: Vol. 49/1-10,12 [Nov fehlt]
1994: Vol. 50/1-12
1995: Vol. 51/1-12
1996: Vol. 52/1-12
1997: Vol. 53/1-12
1998: Vol. 54/1-12
1999: Vol. 55/1-12
2000: Vol. 56/1-12
2001: Vol. 57/1-12
2002: Vol. 58/1-12
2003: Vol. 59/1-3 (Jan-Mar)
2004: Vol. 60/1-4 (Jan-Apr), 60/6-8/9 (Jun-Aug/Sep), 60/11-12 (Nov-Dec)
2005: Vol. 61/1-12
2006: Vol. 62/3-4 (Mar-Apr)
2009: Vol. 65/3-8,10-12 (Mar-Aug, Oct-Dec) [Musica Jazz speciale suppl.8/9]
2010: Vol. 66/1-12 (Feb-Dec) [Musica Jazz „Speciale Latin“]
2011: Vol. 67/1-12
2012: Vol. 68/1-12
2013: Vol. 69/1-10 (Jan-Oct)
2014: Vol. 70/3 (Mar)
2017: Vol. 72/7 (Jul) |
MUSICA NEWS – P-742
Italy
1996: #4 (Jazz in Regia) |
MUSICA OGGI – P-787
Italy
1997: #17
1998: #18
1999: #19
2000: #20
2001: #21
2002: #22
2003/04: #23
2005/06: #24 |
MUSICA VIVA – P-537
Italy
1978: Vol. 2/6-7 (Jul-Aug)
1979: Vol. 3/1 (Jan) |
MUSICAL – P-774
France
1987: #4 (Jun) |
MUSICAL COURIER – P-297
USA
1925: Vol. 90/7 (12.Feb)
1925: Vol. 90/10 (30.Apr), 17-20 (23.Apr-14.May), 22-23 (28.May-4.Jun), 25 (18.Jun); Vol. 91/15-16 (8.Oct-15.Oct), 21-22 (19.Nov-26.Nov), 25 (17.Dec)
1926: Vol. 92/5 (4.Feb), 7 (18.Feb), 15 (15.Apr)
1931: Vol. 103/13 (26.Sep), 18 (31.Oct), 22 (28.Nov)
1935: Vol. 111/10 (9.Nov) |
MUSICAL DENMARK – P-298
Danmark
1978/79: #30
1979/80: #31
1980/81: #32
1981/82: #33
1982/83: #34
1983/84: #35
1985: #36
1986: #37
1987: #38
1988: #39 [Paul Brasso: Danish Rock and Jazz for Export]
1989: #40-41
1990: #42-43
1991: #44-45
1992: #46
1994: #48 |
MUSICAL OBSERVER, The – P-299
USA
1922: Vol. 21/10 (Oct)
1923: Vol. 22/11 (Nov)
1924: Vol. 23/5-6 (May-Jun), 9 (Sep), 12 (Dec)
1925: Vol. 24/1 (Jan), 7 (Jul)
1926: Vol. 25/8 (Aug)
1927: Vol. 26/1 (Jan), 9 (Sep), 11 (Nov)
1928: Vol. 27/1 (Jan), 3(Mar), 5 (May)
1929: Vol. 27/4 |
MUSICHE PRIMAVERA – P-300
Italy
1988: #1 (Mar)
1989: #5 (Summer), 6 (Fall/Winter)
1990: #7-8 (Spring-Fall)
1991: #9-11 (Spring-Winter)
1992: #12-13 (Spring-Fall)
1993: #14 (Spring)
1994: #15-16 (Spring-Fall)
1996: #17-18 (Spring)1997: #18 |
MUSICIAN – P-301
USA
1977: Vol. 1/8-9 (15.Sep-15.Dec)
1978: Vol. 1/10-15 (15.Dec.1977-Dec.1978)
1979: #16-21 (Feb-Nov)
1980: #22-29 (Jan-Dec)
1981: #30-38 (Feb-Dec)
1982: #39-50 (Jan-Dec)
1983: #51-62 (Jan-Dec)
1984: #63-74 (Jan-Dec)
1985: #75-86 (Jan-Dec)
1986: #87-98 (Jan-Dec)
1987: #99-110 (Jan-Dec)
1988: #111-122 (Jan-Dec)
1989: #123-134 (Jan-Dec)
1990: #135-146 (Jan-Dec)
1991: #147-150 (Jan-Apr) |
MUSICS – P-469
England
1975: #2 (Juni/Juli), #4 (Okt/Nov)
1977: #15 (Dec)
1978: #16-20 (Feb, May, Jul, Sep, Dec)
1979: #21-23 (Mar, Jun, Nov) |
MUSICWORKS – P-642
The Journal of Sound Exploration
Canada
1993: #55
1994: #58-60; Index to #1-59
1995: #61 |
DIE MUSIK – P-757
Germany
1903: Vol. 2/10 (Feb), 12 (Mar); Vol. ¾ (Nov)
1928: Vol. 20/10 (Jul)
1929: Vol. 21
1932: Vol. 25/2 (Nov) |
MUSIKFORUM – P-827
Germany
(Ab 2004 fortgeführt als vierteljähl. Zeitung)
1998: #88-89 (Jun,Dec)
1999: #90-91 (Jun,Dec) + Bibliographie 1965-1998
2000: #92-93 (Jun,Dec)
2001: #94-95 (Jun,Dec)
2002: #96
2004: Vol. 2/2-4 (Apr/Jun-Oct/Dec)
2005: Vol. 3/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2006: Vol. 4/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2007: Vol. 5/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2008: Vol. 6/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2009: Vol. 7/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec) + Sonderheft “Richard Jacoby” (Oktober)
2010: Vol. 8/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2011: Vol. 9/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2012: Vol. 10/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2013: Vol. 11/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2014: Vol. 12/1-4 (Jan/Mar-Oct-Dec)
2015: Vol. 13/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2016: Vol. 14/1-4 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2017: Vol. 15/1-4 (Jan-Apr) |
MUSIK IN SCHWEDEN – P-302
Sweden
1979: #2 (May) [special issue on jazz; English and German language issues]
1984: Jun [special issue: “Jazz & Improvisierte Musik”; English and German language issues] |
MUSIKNYTT – P-785
(Dans och Konsert)
Sweden
1937: Jul-Aug, Nov-Dec
1938: Jan-Feb, Apr, Jul |
MUSIKREVUE – P-1101
Jazz Pop Klassik
Denmark
1957: Vol. 4/9 (Nov) |
MUSIKTEXTE – P-1006
(Zeitschrift für neue Musik)
Germany
2003: #99 (Dec) |
MUSIK UND BILDUNG – P-303
Germany
1983: Vol. 15/3 (Mar) [special on jazz education in school and university]
1994: Vol. 26/1 (Jan/Feb) [special on jazz education]
1996: Vol. 5 (Sep/Oct) |
MUSIK UND GESUNDSEIN – P-945
Halbjahreszeitung für Musik und Therapie, Medizin und Beratung
Germany
2001: #1 |
MUSIK UND KIRCHE – P-304
Germany
1962: Vol. 32/3 (May/Jun) [Herbert Haag: Jazzgottesdienst?]
1963: Vol. 33/1 (Jan/Feb) [review of Erhard Kayser’s book Mahalia Jackson]
1965: Vol. 35/3 (May/Jun) [review of Joachim-Ernst Berendt’s essay “Ekstase im Gottesdienst – Das Spiritual in seiner und in unserer Welt”] |
MUSIK UND LEBEN – P-1115
Germany
1959: #7 (Jul) |
MUSIK UND MEDIZIN – P-435
Germany
1977: #1-2 (Jan-Feb) [Joachim-Ernst Berendt: Jazz und die Neue Religiosität. Wo der Gebetsteppich ausgebreitet wird] |
MUSIK & THEATER – P-530
Die aktuelle schweizerische Kulturzeitschrift
Switzerland
1983: #10 (Oct) |
MUSIKBLATT – P-519
Germany
1981: Vol. 8/62 (Feb)
1984: Vol. 11/98 (Oct) |
MUSIKBLÄTTER DES ANBRUCHS – P-305
Germany
1925: Vol. 7/4 [special jazz issue] |
MUSIKBULLETIN – P-306
Poland
1974: #6/7 |
MUSIKER -P-1166
Fachzeitschrift für Popmusiker
1999: #4 |
MUSIKER MUSIC NEWS – P-555
Germany
1981: #1 (Jan) |
MUSIKERN – P-307
Sweden
1985: #11
1987: #2-3, 5-7
1988: #1-2, 5-7, 10-11
1989: #1-5, 10-12
1990: #2-7, 11-12
1991: #1, 3-12
1992: #1-12
1993: #1-5, 8/9-10
1994: #1-8/9
1995: #1 |
MUSIKERTREFF – P-536
Germany
1980: Jul
1981: Feb
1982: Feb |
MUSIKMARKT, Der – P-308
Germany
1959: Vol. 1/3 (Sep) [Joachim-Ernst Berendt: Die Situation des Jazz in Deutschland 1959]
1968: Vol. 10/10 (Oct) |
MUSIKREVY – P-309
Nordisk Tidskript för Musik och Grammofon
Sweden
1959: Vol. 14/3 [Olle Helander: Schwedischer Jazz] |
MUSIKSZENE – P-310
Germany
1984: Vol. 3/2 (Feb), 3/7-8 (Jul/Aug), 10 (Oct) [no jazz content] |
MUSIKTIDNINGEN – P-311
Sweden
1974: Vol. 2/3 [Erik Centerwall: Han spelar för att p†minna oss im v†r mänsklighet (on Red Mitchell)] |
MUSIQUE EN QUESTIONS – P-312
France
1983: #5 (Mar/Apr) [special jazz issue] |
MUZIEK & BEELD INFO – P-534
Netherlands
1984: #8 (22.Feb), #10 (7.Mar), #13
(28.Mar) |
MUZIEK & DANS – P-313
Netherlands
1988: #3 (Apr) [Frits Lagerwerff: Swingt er nog iets in het pluche? Frits Lagerwerff over jazz en pop in het Concertgebouw] |
MUZIEK EXPRES – P-804
Netherlands
1957: Vol. 2/19 (Jul)
1958: Vol. 3/28-36 (April-Dec)
1959: Vol. 4/38-42 (Feb-Jun), 44 (Aug) |
MUZIEKKRANT – P-510
Netherlands
1983: #17 (Jan-Mar) |
NAJE NEWSLETTER – P-314
USA
1986: Jul |
NAMES & NUMBERS – P-831
Netherlands
1985: #1 (Apr), 2 (Sep)
1986: #3-5 (Jan-Sep)
1987: #6 (Jan)
1998: #7 (Oct)
1999: #8-11 (Jan,Mar,Jun,Sep)
2000: #12-15 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2001: #16-19 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2002: #20-23 (Jan,Apr,Jul,Oct)
INDEX OF MUSICIANS ISSUES 1-25
2003: #24-27 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2004: #28-31 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2005: #32-35 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2006: #36-39 (Jan,Apr,Jul,Oct)
CONTENTS OF ISSUES 31-40
2007: #40-43 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2008: #44-47 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2009: #48-51 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2010: #52-54 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2011: #55-59 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2012: #60-63 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2013: #64-67 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2014: #68-71 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2015: #72-75 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2016: #76-79 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2017: #80-83 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2018: #84-87 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2019: #88-91 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2020: #92-95 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2021: #96-97 (Jan,Apr) |
NATIONAL JAZZ FOUNDATION ARCHIVE NEWSLETTER – P-724
England
1996: #1-2 (Spring,Autumn)
1997: #3-4 (Spring,Autumn)
1998: #5-6 (Spring,Autumn)
1999: #7 (Summer)
2000: #8 Summer)
2001: #10 (Summer); forgeführt als “National Jazz Archive Newsletter)
2002: #10 (Summer) |
Neděle – P-1113
CSSR
1968: Dec |
NEDERLANDS JAZZ ARCHIEF BULLETIN (NJA Bulletin) – P-315
Netherlands
1991: #1 (Sep), #2 (Dec)
1992: #3 (Mar), #4 (Jun), #5 (Sep), #6 (Dec)
1993: #7 (Mar), #8 (Jun), #9 (Sep), #10 (Dec)
1994: #11 (Mar), #12 (Jun), 13 (Sep), 14 (Dec)
Index Nr. 1-12
1995: #15-18 (Mar,Jun,Sep,Dec); suppl.
1996: #19-22 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1997: #23-26 (Mar,Jun,Sep,Dec); Index #1-24
1998: #27-30 (Mar,Jun,Sep,Dec); Index #25-28
1999: #31-34 (Mar,Jun,Sep,Dec); Index #29-32
2000: #35-38 (Mar,Jun,Sep,Dec); Index #33-36
2001: #39-42 (Mar,Jun,Sep,Dec); Index #37-40
2002: #43-46 (Mar,Jun,Sep,Dec); Index #41-44
2003: #47-50 (Mar,Jun,Sep,Dec); Index # 1-48
2004: #51-54 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2005: #55-57 (Mar,Jun,Oct) [changes name to
“Jazz Bulletin” with no. 58]
2006: #58-61 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2007: #62-65 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2008: #66-69 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2009: #70-73 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2010: #74-77 (Jan,Apr,Jul,Oct)
2011: #78-81 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2012: #82-84 (Mar,Jun,Sep) (Dec fehlt)
2013: #86-89 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2014: #90-93 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2015: #94-97 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2016: #98-101 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2017: #102-105 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2018: #106-109 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2019: #110-113 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2020: #114-117 (Mar,Jun,Sep,Dec)
2021: #118-119 (Mar,Jun) |
NDR MAGAZIN – P-316
Germany
1990: Apr [Michael Naura: King of Swing (Benny Goodman)] |
NEEDLE, The – P-640
Record Collectors’ Guide
USA
1944: Jun-Jul,Oct-Dec
1945: Vol. 2/1 |
NEEDLE TIME – P-317
England
1985: #1 (Nov/Dec)
1986: #2-7 (Jan,Mar,May,Jul,Sep,Nov)
1987: #8-13 (Jan,Mar,May,Jul,Sep,Nov)
1988: #14-19 (Jan-Nov)
1989: #20-21,23 (Jan-Mar, Jul)
1990: #26, 28-30 (Jan, May-Sep) |
NEROSUBIANCO – P-727-
SISMA – Società Italiana della Musica Afroamericana
Italy
1994: Vol. 2/3 (Apr) |
NEUE BERLINISCHE MUSIKZEITUNG – P-1187
Germany East
1989: #3 (Nov/Dec)
1991: #1; #9 Sonderheft [Berliner Jazztreff] |
NEUE MUSIKZEITUNG (NMZ) – P-674
Germany
1995: 44/3 (Jun/Jul)
2000: 49/9 (Sep)
2002: 51/11 (Nov)
2003: 52/11 (Nov)
2007: 56/1 (Feb/Mar); 56/6
2008: Beilage “Netzwerk Neue Musik, 1’33“ (Feb), 2’33“ (Oct)
2009: Beilage “Netzwerk Neue Musik, 3’33“ (Feb), 4’33“ (Sep)
2010: 59/11 (Nov)
2010: Beilage „Netzwerk Neue Musik“ 5’33’ (May), 59/11 (Nov)
2011: Beilage „Netzwerk Neue Musik“, 6’33 (May)
2014: 63/12
2015: 64/1, 4 (Dec/Jan, Apr)
2017: 66/4 (Apr) |
DAS NEUE PODIUM – P-1024
Germany
1946: Vol. 1/2 (25.Mar) |
NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK (NZ) – P-319
Germany
1979: #1 (Jan/Feb), 3 (May/Jun), 5 (Sep/Oct)
1980: #1 (Jan)
1981: #3 (May/Jun), 5-6 (Sep/Oct-Nov/Dec), Inhaltsverzeichnis
1982: #1 (Jan), 5 (May)
1983: #10 (Oct)
1984: #9 (Sep)
1985: #10 (Oct)
1989: #7/8 (Jul/Aug)
1990: #7/8 (Jul/Aug), 9 (Sep), 10 (Oct)
1991: #1 (Jan), 5 (May), 6 (Jun)
1992: #7/8 (Jul/Aug), 11 (Nov), 12 (Dec)
1993: #1 (Jan), 9 (Sep)
1994: #1 (Jan), 3 (May), 5 (Sep)
1997: #1 (Jan-Feb)
1998: #1-3 (Jan/Feb-May/Jun), 6 (Nov/Dec)
1999: #3-4 (May/Jun-Jul/Aug)
2000: #3 (May/Jun)
2001: #6 (Nov/Dec)
2011: #4 (Jul/Aug)
2015: #1 (Jan)
2019: #5 (Oct) |
NEW AMBEROLA GRAPHIC, THE – P-1065
(USA)
Vol. 28/4 |
NEW BOURBON STREET JAZZ SOCIETY – P-680
USA
1973: May
1974: Apr
1978: Feb |
NEW DEPARTURES – P-320
England
1962: #4 [Jazz & Poetry Special] |
NEW ORLEANS JAZZ CLUB OF CALIFORNIA – P-663
USA
1963: Jun,Sep-Dec
1964: Jan-Apr,28.Aug,Sep,Oct
1965: Feb,Mar,Apr,29.Apr |
NEW ORLEANS JAZZ – NATIONAL HISTORICAL PARK – P-738
USA
1996: Vol. 1/2 (Dec)
1997: Vol. 1/4 (Dec) |
NEW ORLEANS JAZZ RECORD SOCIETY – P-649
USA
????: Index of Jazz + Supplements:
1966: #1 (Nov)
1968: #3-4 (Jul, Dec)
1969: #5-6 (Jun, Dec)
1970: #2 (Feb)
1971: #7 |
THE NEW YORK CITY JAZZ RECORD -P-995
[formerly “All About Jazz, New York”]
USA, New York
2002: #1-8 (May-Dec)
2003: #9-20 (Jan-Dec)
2004: #21-29 (Jan-Sep)
2005: #41(Sep)
2006: #45-56 (Jan-Dec)
2007: #57-68 (Jan-Dec)
2008: #70-80 (Feb-Dec)
2009: #81-92 (Jan-Dec)
2010: #93-104 (Jan-Dec)
2011: #105-106 (Jan-Feb) [last issue under this name. new name: The New York City Jazz Record]
2011: #107-116 (Mar-Dec)
2012: #117-128 (Jan-Dec)
2013: #129-140 (Jan-Dec)
2014: #141-152 (Jan-Dec)
2015: #153-164 (Jan-Dec)
2016: #165-177 (Jan-Dec)
2017: #178-185 (Jan-Sep)
[kein Re-Abo, da Zeitschrift komplett online als PDF-Download verfügbar] |
NEW YORKER, The – P-583
USA
1966: 11.Jun. [Whitney Balliett: Our Footloose Correspondents, Mecca, LA. über New Orleans damals und heute]
1996: Jan-Dez
1997: Jan-Dez
1998: Jan-Dez
1999: Jan-Dez
2000: Jan-Dez
2001: Jan-Feb |
NEWSLETTER – JASS, INCORPORATED – P-666
Minneapolis/MN
USA
1963: Vol. 1/1-2 (May/Jun, Jul/Aug)
1964: Vol. 2/1-2 (Jan/Feb-Mar/Apr)
1965: Vol. 3/1 (Jan/Feb)
1967: Vol. 6/2-3 (May/Jun, Nov/Dec)
1968: Vol. 7/1-2 (Feb/Mar, 23.Jul)
1969: Vol. 9/2 (May/Jun)
1970: Vol. 10/1 (Jun/Jul) |
NIT & WIT – P-321
USA
1987: Vol. 8/2 (Apr) [photo of Herbie Hancock; record review of a release by Richard Pierce Milner] |
NITE LITES (THE) – P-667
USA
1968: Vol. 1/4 (May) |
NJCB-REPORT – P-1041
(Mitteilungen des New Jazz-Circle Berlin e.V.)
Germany
1958: Vol.3/5 (May) |
NJSO JOURNAL – P-322
USA
1990: Vol. 1/4 (Fall)
1991: Vol. 2/2-3 (Spring-Summer)
1992: Vol. 3/2
1993: Vol. 4/3
1995: Fall |
NOISE GATE – P-864
England
1996: #5 |
NO NAME JAZZ NEWS – P-489
USA
completely filed under “MARGE HOFACRE’S JAZZ NEWS”
1990/91: Vol. 7/1-2 (Dec/Jan/Feb-Mar/Apr) |
NON STOP -P-1167 (Music Entertainment, Polen, Warschau)
1974: Vol.12, #29 |
NORDIC SOUNDS – P-323
Norway
1985: Jun [Ib Skovgaard: Marilyn Mazur: A Musical Multi-Personality]
1988: Sep [Jostein Simble: Atlantic Jazz]
1989: Jun [Poul Bratbjerg: Norwegian Jazz. Tradition and Experiment]
1990: #1 [Marit Lauten: The Oslo Jazz House]
1991: #3-4
1992: #1-4
1993: #1-4
1994: #1-4
1995: #1-4
1996: #1-4
1997: #1-4
1998: #1-4
1999: #1-4
2000: #1-4
2001: #1-4
2002: #1-4
2003: #1-4
2004: #1-3
2005: #1-4 (Mar,May,Aug,Dec)
2006: #1-4 (Feb, May, Sep, Dec) |
NOTA NOTE – P-859
France
1996: #3 (Apr) |
The NOTE – P-446
(Al Cohn Memorial Jazz Collection)
USA
1990: Vol. 2/1-3
1991: Vol. 3/1-3
1992: Vol. 4/1-3
1993: Vol. 5/1-3
1994: Vol. 6/1-3
1995: Vol. 7/1-3
1996: Vol. 8/1-3
1997: Vol. 9/1-2
1998: Vol. 10/1-2
1999: Vol. 11/1-3
2000: Vol. 12/1-3
2001: Vol. 13/1-2
2005: Vol. 14/1-3
2006: Vol. 15/1-3
2007: Vol. 16/1-3
2008: Vol. 18/1-3 (Winter/Spring-Fall)
2009: Vol. 19/1-3 (Winter/Spring-Fall)
2010: Vol. 20/1-3 (Winter/Spring-Fall)
2011: Vol. 21/1-2 (Winter/Spring-Fall)
2012: Vol. 22/1-2 (Winter/Spring-Fall)
2013: Vol. 23/1-2 (Winter/Spring-Summer/Fall)
2014: Vol. 24/1 (Summer/Fall)
2015: Vol. 25/1-2 (Fall/Winter-Spring/Summer)
2016: Vol. 26/1-2 (Winter-Spring/Summer)
2017: Vol. 27/1-2 (Fall/Winter-Spring/Summer)
2018: Vol. 28/1-2 (Fall/Winter-Spring/Summer)
2019: Vol. 29/1 (Winter/Spring) |
NOTES – P-324
Le magazine des autres musiques
France
1983: #11
1985: [no number: discographie du jazz anglais]
1990: #36 (Oct)
1991: #37 (Mar), 38/39 (Oct)
1993: #44 (May) |
NOTES JAZZOWY – P-557
Poland
1980: Vol. 1/1 (ca. Oct)
1981: Vol. 2/1-2 (#2-3)
1983: Vol. 3/1-3
1984: Vol. 4/1-3 |
NOTES TO YOU – P-700
(Illiana Club of Traditional Jazz Newsletter)
USA
1978: Feb, Mar, May, Jul, Aug |
NOTIZEN – P-1120
(Zeitschrift für junge Menschen)
Germany
1962: #4
1963: #1 |
NOTTINGHAM FRENCH STUDIES – P-1011
England
2004: Vol. 43/1 (Spring) [”Jazz Adventures in French Culture] |
NOUVEAU DIRE – P-325
France
1974: #2 (Jan) [Jean MoriÜres: Odette au Free Jazz] |
NOW’S THE TIME – P-938
Porgy & Bess
Austria
2000: Dec |
NUGGET – P-326
USA
1965: Vol. 9/4 (Feb) [James Adrian: Last Jam (Short Story)] |
NUR MUSIK – P-327
Germany (Berlin)
1976: #4, 9-11 (Sep-Nov) |
NYJO – P-1089
National Youth Jazz Orchestra
England
1995: Summer
1996: Summer
1997: Spring
1998: Spring
1999: 1 (Jan)
2002: 1; 4; 7; 10 (Jan; Apr; Jul; Oct)
2003: 1 (Jan)
2004: 1 (Jan)
2005: 4; 10 (Apr; Oct)
2006: 1; 10 (Jan; Autumn
2007: 1; 10 (Jan; Oct)
2008: 10 (Oct)
2009: 1;10 (Jan; Oct) |
NYU TODAY – P-569
A Newspaper for the New York University Community
USA
1983: Vol. 6/10 (23.Mar) [Craig Smith: SCE Professor Crawford takes jazz students into the venues where the music is born] |
O PAPEL DO JAZZ – P-815
Portugal
1997: #2
1998: #3,#4 |
OBOE/FAGOTT – P-907
Germany
2000: #59-61
2001: #62-65
2002: #66-69
2003: #70-76
2004: #77-78
2005: #79-81
2006: #82-85
2007: #86-90
2008: #91-93
2009: #94-97
2010: #98-101
2011: #102-105
2012: #106-109
2013: #110-113
2014: #114-117
2015: #118-121 [gescannte Digitalkopien]
2016: #122-125 [gescannte Digitalkopien]
2017: #126-129 [gescannte Digitalkopien]
2018: #130-133
2019: #135-137
2020: #138-139 |
OBSERVER – P-328
England
1969: 27. Jul (Special Blues Issue) |
OCCIDENT – P-1114
USA
1950: spring |
OCTOPUS – P-958
France
1995: #3 (fall)
1996: #4 (spring) |
OFFBEAT – P-695
New Orleans’ and Lousiana’s Music & Entertainment Magazine
USA
1988: Vol. 1/1 (Summer)
1989: Vol. 2/2-4,6-12 (Feb-Apr,Jun-Dec)
1990: Vol. 3/1-9,11-12 (Jan-Sep,Nov-Dec
1991: Vol. 4/1-5,7-12 (Jan-May,Jul/Aug-Dec)
1992: Vol. 5/1-12 (Jan-Dec)
1993: Vol. 6/1-12 (Jan-Dec)
1994: Vol. 7/1-12 (Jan-Dec)
1995: Vol. 8/1-12 (Jan-Dec)
1996: Vol. 9/1-9 (Jan-Dec)
1997: Vol. 10/1-12 (Jan-Dec)
1998: Vol. 11/1-12 (Jan-Dec)
1999: Vol. 12/1-12 (Jan-Dec)
2000: Vol. 13/1-12 (Jan-Dec)
2001: Vol. 14/1-12 (Jan-Dec)
2002: Vol. 15/1-12 (Jan-Dec)
2003: Vol. 16/1-12 (Jan-Dec)
2004: Vol. 17/1-12 (Jan-Dec)
2005: Vol. 18/1-10 (Jan-Sep,Dec) [complete; missing issues caused by Hurricane Katrina]
2006: Vol. 19/1-12 (Jan-Dec)
2007: Vol. 20/1-12 (Jan-Dec)
2008: Vol. 21/1-12 (Jan-Dec)
2009: Vol. 22/1-12 (Jan-Dec)
2010: Vol. 23/1-12 (Jan-Dec)
2011: Vol. 24/1-12 (Jan-Dec)
2012: Vol. 25/1-12 (Jan-Dec)
2013: Vol. 26/1-12 (Jan-Dec)
2014: Vol. 27/1-7 (Jan-Jul) |
OFFBEAT – P-701
(Central Coast Hot Jazz Society Newsletter)
USA
1977: Vol. 14/12-14 (Jul-Sep)
1978: Vol. 14/20, (Mar), 22-24 (May-Jul) |
OFF BEAT JAZZ – P-882
(Overseas Jazz Club)
USA
1983: Vol. 2/2 |
OH PLAY THAT THING – P-910
USA
1953? |
DAS OHR – P-1179
Zeitschrift für high-fideles Hören
Germany
1987: #18 (Mar) |
OKEY! – P-1000
Magazin für Orgel und Keyboard
Germany
1995: #7 (Sep/Oct)
1996: #13-14 (Oct/Nov-Dec/Jan1997)
1997: #16-18 (Apr/May-Aug/Sep)
1998: #22 (Apr/May), #24 (Aug/Sep)
1999: #28 (Apr/May), #30 (Aug/Sep)
2000: #33-37 (Feb/Mar-Oct/Nov)
2001: #38-41, 43 (Dec2000/Feb-Jul/Aug, Nov/Dec)
2002: #45-49 (Mar/Apr-Nov/Dec)
2003: #50-55 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2004: #56-61 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2005: #62-67 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2006: #68-73 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2007: #74-79 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2008: #80-85 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2009: #86-91 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2010: #92-97 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2011: #98-103 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2012: #104-109 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2013: #110-115 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2014: #116-121 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2015: #122-127 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2016: #128-133 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2017: #134-139 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2018: #140-146 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2019: #147-151 (Mar/Apr-Nov/Dec)
2020: #152-157 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2021: #158-161 (Jan/Feb-Jul/Aug) |
OLD TIME MUSIC – P-1079
England
1971: #1 (Sep) |
ON THE ONE – P-671
Jazzmopolitan Magazine
USA
1994: Vol. 1/3 (Winter)
1995: Vol. 1/4 (Spring); Vol. 2/1-3 (Summer-Winter)
1996: Vol. 2/4 (Spring)
1997: Vol. 3/2 (Winter) |
ON THE RECORD – P-868
IAJRC Newsletter
USA
1999: Vol. 1/1 (Jul)
2000: Vol. 2/1,3 (Jun,Dec)
2001: Vol. 3/1-2 (Mar,Jun), 4 (Dec) |
OOR – P-504
Netherlands
1982: #9 (5.May)
1983: #3 (9.Feb)
1984: #6 (24.Mar), #11 (2.Jun), #14 (14.Jul) |
OP – P-511
USA
1983: #T (Nov/Dec) |
OPPROBRIUM – P-856
New Zealand
1996: #3 (Nov)
1997: #4 (Dec)
1998: #5 (Jul) |
OPTION – P-329
Music Alternatives
USA
1986: Jul/Aug
1989: #24 (Jan/Feb)
1992: #42-47 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1993: #48-53 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1994: #54-59 (Jan/Feb-Nov/Dec) [+ U.H.F. Supplement]
1995: #60-65 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1996: #66-71 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1997: #72-77 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1998: #78-80 (Jan/Feb-May/Jun) |
OREGON JAZZ SOCIETY – P-697
(Newsletter)
USA
1973: Vol. 1/7 (Nov) |
ORAL HISTORY ASSOCIATION NEWSLETTER – P-330
(OHA Newsletter)
USA
1991: 25/3 (Fall) |
ORCHESTER, Das – P-331
Germany
1953: Vol. 1/2 (Jun) [Joachim-Ernst Berendt: Zur Problematik der Unterhaltungsmusik]
1982: Vol. 30/11 (Nov) |
OREGON CITY TRADITIONAL JAZZ SOCIETY NEWSLETTER – P-679
USA
???: 3 issues |
ORGAN SHOWBUSINESS – P-791
Germany
1986: #6 (Jun) |
ORKESTER JOURNALEN – P-332
[Jazz / Orkester Journalen]
Sweden
1938: Jun, Oct
1939: Feb-Mar, May-Sep
1940: Dec
1941: Jun
1943: Jan, Aug, Dec
1944: Jan-Mar, May-Jun, Oct, Dec
1945: Jan-Feb, Apr-Sep, Dec
1949: Jun, Dec
1950: Jan
1951: Mar-Jun, Aug, Oct-Nov
1952: Apr-May, Jul-Sep
1953: Jul, Aug
1954: Jan-Dec
1955: Mar-Apr, Jun-Dec
1956: Jan-Dec
1957: Jan-Dec
1958: Vol. 26/1-12 (Jan-Dec)
1959: Vol. 27/1-12 (Jan-Dec)
1960: Vol. 28/1-12 (Jan-Dec)
1961: Vol. 29/1-12 (Jan-Dec)
1962: Vol. 30/2 (Feb), 4-9 (Apr-Sep)
1963: Vol. 31/5 (May), 8 (Jul/Aug), 12 (Dec)
1964: Vol. 32/1-12 (Jan-Dec)
1965: Vol. 33/1-12 (Jan-Dec)
1966: Vol. 34/1-12 (Jan-Dec)
1967: Vol. 35/2-12 (Feb-Dec)
1968: Vol. 36/1-12 (Jan-Dec)
1969: Vol. 37/1-12 (Jan-Dec)
1970: Vol. 38/1-12 (Jan-Dec)
1971: Vol. 39/1-12 (Jan-Dec)
1972: Vol. 40/1-12 (Jan-Dec)
1973: Vol. 41/1-12 (Jan-Dec)
1974: Vol. 42/1-12 (Jan-Dec)
1975: Vol. 43/1-12 (Jan-Dec)
1976: Vol. 44/1-3 (Jan-Mar), 5-8 (May-Aug)
1977: Vol. 45/1-12 (Jan-Dec)
1978: Vol. 46/1-12 (Jan-Dec)
1979: Vol. 47/1-12 (Jan-Dec)
1980: Vol. 48/1-12 (Jan-Dec)
1981: Vol. 49/1-12 (Jan-Dec)
1982: Vol. 50/1-12 (Jan-Dec)
1983: Vol. 51/1-12 (Jan-Dec)
1984: Vol. 52/1-12 (Jan-Dec)
1985: Vol. 53/1-12 (Jan-Dec)
1986: Vol. 54/1-12 (Jan- Dec)
1987: Vol. 55/1-5 (Jan-May), 11-12 (Nov-Dec)
1988: Vol. 56/1-10 (Jan.Oct), 12 (Dec
1989: Vol. 57/1-4 (Jan-Apr), 6 (Jun), 9-10 (Sep-Oct), 11 (Nov),
1990: Vol. 58/2-3 (Feb, März), 6-9 (Jun-Jul/Aug, Sept), 10 (Oct), 12 (Dec)
1991: Vol. 59/1-4 (Jan-Apr), 6 (Juni), 7/8-10 (Jul/Aug-Oct)
1992: Vol. 60/1-12 (Jan-Dec)
1993: Vol. 61/1-12 (Jan-Dec)
1994: Vol. 62/1-12 (Jan-Dec)
1995: Vol. 63/1-12 (Jan-Dec)
1996: Vol. 64/1-12 (Jan-Dec)
1997: Vol. 65/1-6 (Jan-Jun), 9-10 (Sep-Oct)
1998: Vol. 66/1-12 (Jan-Dec)
1999: Vol. 67/1-12 (Jan-Dec)
2000: Vol. 68/1-12 (Jan-Dec)
2001: Vol. 69/1-12 (Jan-Dec)
2002: Vol. 70/1-12 (Jan-Dec)
2003: Vol. 71/1-12 (Jan-Dec)
2004: Vol. 72/1-12 (Jan-Dec)
2005: Vol. 73/1-12 (Jan-Dec)
2006: Vol. 74/1-12 (Jan-Dec)
2007: Vol. 75/1-12 (Jan/Feb-Dec/Jan)
2008: Vol. 76/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2009: Vol. 77/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2010: Vol. 78/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2011: Vol. 79/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2012: Vol. 80/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2013: Vol. 81/1-5 (Feb/Mar-Nov/Dec)
2014: Vol. 82/1-6 (Feb/Mar-May/Jun, Sep/Oct, Dec/Jan)
2015: Vol. 83/1-3, 5-6 (Feb/Apr-Jul/Aug, Nov/Dec)
2016: Vol. 84/1-6 (Mar/Apr-Dec/Jan)
2017: Vol. 85/1-5 (Feb/Apr-Nov)
2018: Vol. 86/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2019: Vol. 87/2-5 (Apr/May-Nov/Dec) [since Seo/Oct.2019 as “Jazz / Orkester Journalen”] |
OSTEUROPA – P-1028
2005: Vol. 55/11 (Nov) [Einzelheft] |
OSTINATO – P-479
England
1990: #2-3
1993: #4/5 |
OUTLOOK – P-506
USA
1979: Vol. 1/2 (Sep-Dec) |
PAN – P-332
Performing Arts Network. Supplement to “Il Nuovo Ravennate”/
Supplement to “Euromail”
Italy
1991: #5 (8.Feb), #12 (29.Mar), #137 (8.Jul)
1992: #54 (7.Mar), #199 (26.Jun)
1993: #45 (24.Feb), #119 (16.Jun)
1994: Vol. 4/1-2 (Feb,Jun)
1995: Vol. 5/1-3 (Feb,Jun,Sep)
1996: Vol. 6/1-3 (Feb,Jun,Oct)
1997: Vol. 7/1-3 (Mar,Jun,Oct)
1998: Vol. 8/1-3 (Feb,Jun,Oct)
1999: Vol. 9/1-3 (Mar,Jun,Oct)
2000: Vol. 10/1-3 (Mar,Jun,Oct)
2001: Vol. 11/1-3 (Mar,Jun,Oct)
2002: Vol. 12/1-3 (Mar,Jun,Nov)
2003: Vol. 13/1-2 (Feb-Jun)
2004: Vol. 14/1-3 (Feb,Jun,Oct)
2005: Vol. 15/1-3 (Feb,Jun,Sep)
2006: Vol. 16/1-3 (Feb,Jun,Sep)
2007: Vol. 17/1-3 (Feb,Jun,Sep)
2008: Vol. 18/1-3 (Feb,Jun,Oct)
2009: Vol. 19/ 1,3 (Feb, Sep)
2010: Vol. 1 (Feb) |
PAERNU JAZZ – P-1172 (Paernu, Estland)
1988: Paernu Jazz |
PANORAMADE – P-595
Le magazine de fans de John Zorn
France
1993: #1
1994: #2 |
PAPA JAZZ – P-333
Germany
1972: #1
1973: #2-3
1974: #4
1975: #5
1976: #6
1977, #7
1978: #8-9
1979: #10
1980: #11-12
1981: #13
1982: #14
1983: #15
1984: #16
1985: #17 |
PAPA JOE’s KUNST & BIER BLATT – P-783
Germany
1983: #50 (Jun) |
The PARIS REVIEW – P-1067
USA
2008: #184 (Spring 2008) |
PARKETT, Das – P-334
Monatszeitschrift zur Kultivierung des Gesellschaftstanzes
Germany
1955: Vol. 85 (May) [Peter Bopp: Was man vom Jazz wissen sollte…] |
PARLAMENT, Das – P-335
Germany
1988: Vol. 38/2 (8.Jan) [special pop issue] |
PASTORALTHEOLOGIE – P-613
Monatsschrift für Wissenschaft und Praxis in Kirche und Gesellschaft
Germany
1994: Vol.83/6 (Jun) [Hans-Martin Gutmann: Popularmusik – vernachlässigtes Thema der Religionspädagogik] |
PC & MUSIK – P-869
Germany
1999: #4 (Jun/Jul) |
PEACE WARRIORS – P-976
France
1997: #5 (Spring), 6 (Fall)
1998: #7 (Jan), 9 (Oct)
1999: #10 (Jan), 11 (Apr) |
PENGUIN MUSIC MAGAZINE – P-336
England
1947: #2, 4 |
PERCUSSION CREATIV – P-843
(Newsletter)
Germany
1999: #1-3
2000: #1 |
PERCUSSION NEWS – P-337
USA
1992: Mar |
PERCUSSIVE NOTES – P-338
USA
1991: Vol. 30/1 (Oct) |
PERSPEKTIVEN – P-339
Germany
1953: #5 (Nov) [Otis Ferguson: Der junge Mann mit der Trompete]
1954: #9 (Fall) [Joachim-Ernst Berendt: Der Jazz in Europa]
1956: #14-15 (Winter-Spring) |
PETITE QUINZAINE, Le – P-485
France
1978: #29-30 (19.Apr-26.Apr) |
PFMENTUM – P-794
“to advocate and promote the creation and performance of new music in Ventura”
USA
1997: fall |
PHONO – P-340
Germany
1954: #1-3 |
PHOTO – P-341
Die Zeitschrift für Fotografie und Film
Germany
1973: #3 [some jazz photos by Art Kane]
1974: #20 [no jazz content] |
PIANO & KEYBOARD – P-749
up to #159: “THE PIANO QUARTERLY”
USA
1981: #115 (Fall)
1988: #141 (Spring)
1989: #148 (Winter)
1993: #160-165 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1994: #166-171 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1995: #172-173 (Jan/Feb-Mar/Apr, 175-177 (Jul/Aug-Nov/Dec)
1996: #178-183 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1997: #186-189 (May/Jun-Nov/Dec)
1998: #190-195 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1999: #196-201 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2000: #202-207 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2001: #208 (Jan/Feb) |
PIANOFORTE – P-342
Germany
1991: Vol. 1/1 [Albrecht Piltz: Bill Evans] |
PIANO NEWS – P-871
Magazin für Klavier und Flügel
Germany
1999: #4 (Jul/Aug)
2018: #3-6 ((May/Jun-Nov/Dec)
2019: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2020: #1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2021: #1-3 (Jan/Feb-May/Jun) |
PIANO STYLIST – P-723
& Jazz Workshop
USA
1988: Jan-Feb, Jun/Jul-Aug/Sep [Jazz & Keyboard Workshop]; Oct/Nov
1989: Dec/Jan-Oct/Nov
1990: Apr/May-Oct/Nov
1991: Feb/Mar, Aug/Sep |
PIANO TODAY – P-1051
(formerly Keyboard Classics & Piano Stylist)
1995: Vol. 15/3-6 (May/Jun-Nov/Dec)
1996: Vol. 16/1 (Jan/Feb), 3-5 (May/Jun-Fall), Vol. 17/1 (Winter)
1997: Vol. 17/3-4 (Summer-Fall), 18/1 (Winter)
1998: Vol. 18/2-4 (Spring-Fall)
1999: Vol. 19/2-4 (Spring-Fall)
2000: Vol. 20/1-2 (Winter-Spring), 4 (Fall)
2001: Vol. 21/2-4 (Spring-Fall)
2002: Vol. 22/1-2 (Winter-Spring), 4 (Fall)
2003: Vol. 23/1-2 (Winter-Spring) |
RECORD COLLECTOR – P-1181
Serious About Music
England
2015: #446-448 (Nov-Dec)
2016: #449-453 (Jan-May) |
PICKUP – P-343
The Record Collector’s Guide
1946: Vol. 1/1 (Jan), 3-5 (Mar-May), 7 (Jul), 9-12 (Sep-Dec)
1947: Vol. 2/1-12 (Jan-Dec) |
PIECES OF JAZZ – P-1080
England
1968: #2
1969: #5-6
1970: #1 |
PITT – P-344
USA
1988: Sep |
PJS-INFOBLATT – P-449
(Pro Jazz Schweiz)
Switzerland
#1-3
1989: #4 (Dec)
1990: #5 (Mar), 6 (Jun), 7/8 (Monographie: Bill Mantovani)
1991: #9 (Mar), 10 (Oct), 11/12 (Sieben Jahrzehnte afro-amerikanische Musik in der Schweiz)
1992: #13 (May), 14 (Jul), 15 (Aug), 16/17 (Oct: Spezialausstellung Big Bands: Fred Böhler – George Gruntz)
1993: #18 (Mar), 19 (Aug), 20 (Dec)
1994: #21 (Mar)
1995: #23 (Jan), 24 (Nov: Jazz im Umbruch 1940-1960) |
PL YEARBOOK OF JAZZ – P-345
USA
1946
1947 [as PL Jazzbook] |
PLAKATJOURNAL – P-1077
Germany
1995: #1 (Spring) |
PLANET JAZZ – P-753
Canada
1997: Vol. 1 (Spring,Fall)
1998: Vol. 2 (Spring,Fall/Winter)
1999: Vol. 3 (Spring,Fall/Winter)
2000: Vol. 4 (Spring/Summer-Fall/Winter)
2001: Vol. 5 (Spring/Summer-Fall/Winter)
2002: Vol. 6 (Summer/Fall-Winter/Spring)
2003: Vol. 7 (Summer/Fall-Winter/Spring)
2004: Vol. 8 (Summer/Fall) [last issue; magazine folded] |
PLAY BLACK – P-347
Germany
1980s: no year given, one issue
1987: Apr |
PLAYBACK – P-639
USA
1949: Jan-Dec
1950: Jan-Mar
1952: Jan-Mar/Apr |
PLAYBACK – P-346
The Bulletin of the National Sound Archive
England
1992: #1 (Spring) |
POINT DU JAZZ, Le – P-348
France
1969: #1
1971: #4-5
1972: #6-7
1973: #8-9
1974: #10
1975: #11
1976: #12
1977: #13
1978: #14
1979: #15
1980: #16
1981: #17
1982: #18
1984: #19
1986: #20 |
POLISH MUSIC FORUM – P-461
Poland
1968/69: Vol. 1
1969/70: Vol. 2
1970/71: Vol. 3 |
POMPI – P-349
Popular Music Periodicals Index
England
1984-86: #1-2
1986-88: #3-4
1988-89: #5 |
POPSCRIPTUM – P-350
Beiträge zur populären Musik
Germany
1992: #1 |
POPÜLER MELODI – P-1098
Turkey
1961: #13 (23.Aug) |
POPULAR MUSIC – P-351
England
1987: Vol. 6/1-3
1988: Vol. 7/1-3
1989: Vol. 8/1-3
1990: Vol. 9/1-3
1991: Vol. 10/1-3
1992: Vol. 11/1-3
1993: Vol. 12/1-3 [+ special issue: cummulative index vol. 6-10]
1994: Vol. 13/1-3
1995: Vol. 14/1-3
1996: Vol. 15/1-3
1997: Vol. 16/1-3
1998: Vol. 17/1-3
1999: Vol. 18/1-3
2000: Vol. 19/1-3
2001: Vol. 20/1-3
2002: Vol. 21/1-3
2003: Vol. 22/1-3
2004: Vol. 23/1-3
2005: Vol. 24/1-3
2006: Vol. 25/1-3
2007: Vol. 26/1-3
2008: Vol. 27/1-3
2009: Vol. 28/1-3
2010: Vol. 29/1-3
2011: Vol. 30/1-3
2012: Vol. 31/1-3
2013: Vol. 32/1-3
2014: Vol. 33/1-3
2015: Vol. 34/1-3
2016: Vol. 35/1-3
2017: Vol. 36/1-3
2018: Vol. 37/1-3
2019: Vol. 38/1-3
2020: Vol. 39/1-3/4 |
POPULAR MUSIC AND SOCIETY – P-1001
USA
2003: Vol. 26/1 |
POSAUNE, Die – P-352
Germany
1962: Aug
1971: #9 (Jun)
1974: #10 (Sep)
1975: #11 (Dec)
1977: #12 (Jun)
1983: #13 (Feb) |
PRELUDE, FUGUE & RIFFS – P-353
News for friends of Leonard Bernstein
USA
1992: Summer,Fall
1993: Winter,Spring, Summer
1994: Winter,Spring, Fall
1995: Winter,Spring/Summer, Fall
1996: Winter,Spring/Summer, Fall
1997: Winter,Spring/Summer, Fall
1998: Winter,Spring/Summer,Fall
1999: Winter,Fall
2000: Winter,Spring/Summer/Fall
2001: Winter, Spring/Summer, Fall/Winter
2002: Spring/Summer/Fall/Winter
2003: Spring/Summer, Fall/Winter
2004: Spring/Summer/Fall/Winter
2005: Spring/Summer-Fall/Winter
2006: Spring/Summer-Fall/Winter
2007: Spring/Summer-Fall/Winter
2008: Spring/Summer-Fall/Winter
2009: Spring/Summer-Fall/Winter
2010: Spring/Summer-Fall/Winter
2011: Spring/Summer-Fall/Winter
2012: Spring/Summer-Fall/Winter
2013: Fall/Winter
2014: Spring/Summer-Fall/Winter
2015: Spring/Summer-Fall/Winter
2016: Spring/Summer-Fall/Winter
2017: Spring/Summer-Fall/Winter
2018: Fall/Winter
2019: Spring/Summer-Fall/Winter
2020: Summer |
PROFESSIONAL, The – P-354
England
1974: #2-12 |
PROFIL – P-779
Methodik zur Tanzmusik (East Germany)
1986: #7
1987: #7(?) |
P.T.M. – P-619
Pacific Telephone Magazine
USA
1963: Jun [Pat Davis: Jazzman (über Bill Bacin)]
1965: Nov [Jim Barner: Jazz at Monterey] |
PULSE! – P-544
USA
1989: Mar
1994: Sep
1995: #142 (Oct), 143 (Nov)
1997: #159 (May), 173 (Aug) |
PULSUS – P-889
Italy
1981: Vol. 1/1 |
PURE JAZZ – P-1062
African-American Classical Music
2000: Vol.1/2
2011: Vol. 4/1 (Spring) |
QUARTERLY RAG – P-618
Sydney Jazz Club
Australia
1966: Mar, Jun
1967: #1
1976: Apr
1977: Jan, Apr
1978: Apr |
QUARTICA JAZZ – P-766
Spain
1981: Vol.1/1-6 (Apr-Oct)
1982: Vol.2/7/8-9 (Jul-Sep)
1983: Vol.3/11-15/16 (Jan-May,Aug)
1984: Vol.4/17-18 (Jan-May)
1985: Vol.5/4-6 (Sep-Nov)
1986: Vol.6/8, 13-14 (Feb, Jul/Aug-Sep)
1987: Vol.7/17-21 (Mar-Jul/Aug) |
DER QUERSCHNITT – P-768
Germany
1924: Vol. 4/5 (Nov)
1927: Vol. 7/9 (Sep)
1929: Vol. 9/12 (Dec)
1930: Vol. 10/2-3 (Feb-Mar) |
RADIO FREE JAZZ – P-355
USA
1976: May
1977: Jan-Dec
1978: Jan-Dec
1979: Jan-Dec
1980: Jan-Mar, May |
RAGTIMER, The – P-620
The Ragtime Society
Canada
1972: Sep/Oct
1981: May/Aug-Sep/Dec |
RAG TIMES – P-463
USA
1970: Vol. ¾ (Sep); Vol. 4/1 (May), 4/4 (Nov) [sic]
1971: Vol. 5/2 (Jul), 5/4 (Nov)
1972: Vol. 6/2 (Jul, 6/4 (Nov)
1983: Vol. 17/2-4 (Jul,Sep,Nov)
1984: Vol. 17/5-6 (Jan,Mar); Vol. 18/2-4 (Jul,Sep,Nov)
1985: Vol. 19/4 (Nov)
1986: Vol. 19/5-6 (Jan,Mar)
1990: Vol. 23/5-6 (Jan,Mar); Vol. 24/1-4 (May,Jun,Sep,Nov)
1991: Vol. 24/5-6 (Jan,Mar); Vol. 25/1-4 (May,Jul,Sep,Nov)
1992: Vol. 25/5-6 (Jan,Mar); Vol.26/1-4 (May,Jul,Sep,Nov)
1993: Vol. 26/5-6 (Jan,Mar); Vol. 27/1-4 (May,Jul,Sep,Nov)
1994: Vol. 27/5-6 (Jan,Mar); Vol. 28/1-4 (May,Jul,Sep,Nov)
1995: Vol. 28/5-6 (Jan,Mar); Vol. 29/1-4 (May,Jul,Sep,Nov)
1996: Vol. 29/5-6 (Jan,Mar); Vol. 30/1-4 (May,Jul,Sep,Nov)
1997: Vol. 30/5-6 (Jan,Mar); Vol. 31/1-4 (May,Jul,Sep,Nov)
1998: Vol. 31/5-6 (Jan,Mar); Vol. 32/1-4 (May,Jul,Sep,Nov)
1999: Vol. 32/5-6 (Jan,Mar); Vol. 33/1-4 (May,Jul,Sep,Nov)
2000: Vol. 33/5-6 (Jan-Mar); Vol. 34/1-3 (May,Jul,Sep)
2001: [no issues published between Sep.2000 and Nov.2002]
2002: Vol. 34/4 (Nov)
2003: Vol. 34/5-6 (Jan-Mar); Vol. 35/1-2 (May,Jul) |
RE-RECORDS QUARTERLY, The – P-362
England
1985: Vol. 1/1-2
1986: Vol. 1/3-4
1987: Vol. 2/1-2
1988: Vol. 2/3
1989: Vol. 2/4
1990: Vol. 3/1-2
1991: Vol. 3/3 |
READER’S DIGEST – P-356
Canada
1971: Vol. 99, #596 (Dec) [Tyree Glenn: Unforgettable Satchmo] |
RECORD CHANGER – P-357
USA
1943: Vol.? ( Aug), (Sep), 4/8 (Oct 2x), Nov
1944: Vol. 3/2 (May), (Jun), ? (Sep), ? (Oct), (Nov)
1945: Vol. 4/1-5,7,8,10 (Jan-May,Jul-Sep,Dec)
1946: Vol. 4/11-12 (Jan-Feb); Vol. 5/1-10 (Mar-Dec)
1947: Vol. 5/11-12 (Jan-Feb); Vol. 6/1-10 (Mar-Dec)
1948: Vol. 7/2-12 (Feb-Dec)
1949: Vol. 8/1-12 (Jan-Dec)
1950: Vol. 9/1-11 (Jan-Dec)
1951: Vol. 10/1-12 (Jan-Dec)
1952: Vol. 11/1-11 (Jan-Dec)
1953: Vol. 12/1-10 (Jan-Oct), 12 (Dec)
1954: Vol. 13/1-2 (Jan-Feb), 4-7 (Apr-Jul), Summer, 11-12 (Nov-Dec)
1955: Vol. 14/1-6
1956: Vol. 14/7-9
1957: Vol. 14/10 (Jan); Vol. 15/1 (Feb), Vol. 15/2 (Feb), ? (Fall) |
RECORD FINDER, The –
USA
1993: #104 Dec)
1981: #140 (Oct) |
RECORD INFORMATION – P-358
England
mid-1940s: one issue |
RECORD INFORMATION – P-558
England
1985: #5 (Sep)
1986: #6 (Oct) |
RECORD MEMORY CLUB MAGAZINE – P-739
(formerly: 78 Memory Magazine)
Belgium
1984: #1-3
1985: Special
1985/86: #1-3
1987: Apr,
1988: Oct, Dec
1989: #1-3
1990: #1-4
1991: #1-4
1992: #1-4
1993: #1-4
1994: #1-4
1995: #1-4
1996: #1-2, 40-41
1997: #42-45
1998: #46-48
2000: #49-51 |
RECORD PARADE – P-359
Germany
1973: #1-4
1974: #5-6
1975: #7-10
1976: #11
1977: #12
1978: #13-14
1979: #15
1981: #16-17
1982: #18
1983: #19 |
RECORD RESEARCH – P-360
USA
1955: Vol. 1/3 (Jun), 1/5 (Oct)
1956: Vol. 2/2 (May/Jun), 2/4, #10 (Nov/Dec)
1957: #13 (Jun/Jul), 14-15 (Aug/Sep-Oct/Nov)
1958: #16-17 (Jan/Feb-Mar/Apr), 19-20 (Sep/Oct-Nov/Dec)
1959: #21-23 (Jan/Feb, Apr/May, Jun/Jul), 25 (Nov/Dec)
1960: #26-31
1961: #32-39
1962: #40-47
1963: #48-56
1964: #57-65
1965: #66-72
1966: #73-80
1967: #81-87
1968: #88-94
1969: #95-102
1970: #103-108
1971: #109-114
1972: #115-120
1973: #121-124
1974: #125-130
1975: #131-136
1976: #137-143
1977: #144/145-149/150
1978: #151/152-159/160
1979: #161/162-167/168
1980: #169/170-177/178
1981: #179/180-187/188
1982: #189/190-193/194
1983: #195/196-203/204
1984: #205/206-209/210
1985: #211/212-217/218
1986: #219/220-225/226
1987: #227/228-231/232
1988: #233/234-237/238
1989: #239/240-241/242
1990: #243/244
1991: #245/246-247/248
1992: #249/250
1993: #251/252 |
RECORD RESEARCH BULLETIN – P-361
USA
1958: #3
ca.1959: #11 |
RECORD WORLD – P-501
USA
1981: 31-Jan |
RECORDED AMERICANA BULLETIN – P-895
USA
1958: #1-6
1959: #7-10
1960: #11-12 |
RED BANK SPECIAL – P-1056
(Official Journal of the Count Basie Society)
1986: Vol. 4/1 (Nov)
1987: Vol. 4/2 (Feb); Vol. 5/1
1994: Vol. 11/1-3 (Mar,Aug,Nov) |
RESONANCE – P-445
England
1992: #0
1993: Vol. 1/2; Vol. 2/1
1994: Vol. 2/2; Vol. 3/1; review supplement
1995: Vol. 4/1
1996: Vol. 4/2; Vol. 5/1
1997: Vol. 5/2; Vol. 6/1
1998: Vol. 6/2; Vol. 7/1
1999: Vol. 7/2
2000: Vol. 8/1; Vol. 8/2-9/1 [double issue]
2002: Vol. 9/2 |
REVUE & CORRIGEE – P-467
France
1989: #1-4
1990: #5-7
1991: #8-10
1992: #11-14
1993: #15-18
1994: #19-22 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1995: #23-26 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1996: #27-30 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1997: #31-34 (Mar,Jun,Sep,Dec) |
REVUE DU JAZZ, LA – P-363
France
1949: Jan-Dec
1950: Jan/Feb, Apr
1952: Jul |
REVUE FRANCAISE D’ETUDES AMERICAINES – P-962
France
2001: hors-série (Dec) |
RHYTHM – P-364
England
1935: Dec
1936: Jan-Jun, Sep, Nov-Dec
1937: Feb, Apr, Dec
1938: Jan |
RHYTHM AND BLUES – P-808
USA
1957: Vol. 5/30 (Jul) |
RHYTHM & NEWS – P-1033
published by the Jazz Record Mart
USA
2006: #704 |
RHYTHM CLUB NEWS – P-365
British Forces Network
Germany (Hamburg)
[continued from Anglo German Swing Club News]
1950: #10-12 [#10-12 also in Reprint]
1951: #1-3/4, 10/11 [volume complete, numbers in between never published] [#1-3/4, 10/11 also in Reprint] |
RHYTHME – P-1039
Maandblad voor Jazz, Dansmuziek en Televisie
Netherlands
1954: Vol. 6, #63 (15.Dec)
1961: Vol. 12, #136-144 (Jan-Sep) |
RHYTHMS – P-1059
The Ellington Fund Newsletter
2008: #21 (Winter) |
RHYTHMUS 78 – P-788
(Fachzeitschrift der JGAS)
Germany
#17 |
RHYTHM RAG – P-885
England
1976: #1-3 (Spring-Winter)
1977: #4-5 (Spring-Winter) |
RICH REPORT, The – P-366
The International Buddy Rich Fan Club
USA
1991: #2 (Jul) |
RING SHOUT – P-1031
Rivista di Studi Musicali Afroamericani
Italy
2002: Vol.1
2003: Vol.2
2004: Vol.3
2005: Vol.4 |
RITMO – P-711
amici del jazz
Italy
1995: #687/688 (Dec/Jan), #690 (Mar), #695 (Sep)
1996: #700-701 (Feb-Mar), 703-709/710 (May-Dec/Jan)
1997: #711-720/721 (Feb-Dec/Jan)
1998: #722-731/732 (Feb-Dec/Jan)
1999: #733-742/743 (Feb-Dec/Jan)
2000: #744-753/754 (Feb-Dec/Jan)
2001: #755-763/764 (Feb-Dec/Jan)
2002: #765-774/775 (Jan-Nov/Dec)
2003: #776-785/786 (Jan-Nov/Dec)
2004: #787-792 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2005: #793-798 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2006: #799 (Jan/Feb) |
RITMO Y MELODIA
Spain
1947: Vol.3/20-25 (May,Jun,Jul,Sep,Nov)
1949: Vol.5/33-35 (Feb,Mar/Apr,May) |
ROCK & FOLK – P-509
France
1982: #182 (Mar) |
ROCK DREAMS – P-367
Germany
1973: #1-11 (complete) |
ROCKERILLA – P-977
Italy
1990: #116 (Apr) |
ROCK JAZZ – P-561
Poland
1983: #9 |
ROCKMUSIKER / MUSIKER MAGAZIN – P-513
Kulturzeitung für Rock & Popmusiker
Germany
1992: Jun
1993: #2-4
1994: #1-4
1995: #1-4
1996: #1-4
1997: #1-4
1998: #1-4
1999: #1-4
2000: #1-3 [complete]
2001: #1-3 [complete]
2002: #1-4
2003: #1-4
2004: #1-4
2005: #1-4
2006: #1-4
2007: #1-3
2008: #1, 3-4
2009: #1-4
2010: #1-4
2011: #1-4
2012: #1-4
2013: #1-3
2014: #1-3
2015: #1-2 |
ROCKY – P-368
Germany
1979: #8 (15.Feb) [Hubert Skolud: All We Need Is Rock (Geschichte der Rockmusik] |
ROHRBLATT – P-929
Magazin für Oboe, Klarinette, Fagott und Saxophon
Germany
1994: 9/4 (Dec)
1995: 1 (Mar)
1996: 10/4 (Dec)
1997: 12/2 (Jun), 4 (Dec)
1998: 13/2-4 (Jun,Sep,Dez))
1999: 14/1-3 (März,Jun,Sep)
2000: 15/2 (Jun) 3 (Sept)
2001: 16/1 (Mar), 2 (Jun), 3 (Sept) 4 (Dec)
2002: 17/1, (Mar), 17/3 (Sep) 17/4 (Dec)
2004: 19/1 (Mar), 3 (Sep
2005: 20/1 (Mar), 20/2 (Jun)
2006: 21/4 (Dec)2011: 26/1 (März)2012: 27/2 (Juni)
2013: 28/1 (März) |
ROLLING STONE – P-369
USA
1969: #40 (23.Aug)
1970: #55 (2.Apr), 58 (14.May), 60 (11.Jun), 62 (9.Jul), 63 (23.Jul), 64 (6.Aug), 66 (17.Sep), 68 (15.Oct), 69 (29.Oct), 70 (12.Nov), 71 (26.Nov), 73 (24.Dec).
1971: #76 (18.Feb), 77 (4.Mar),80 (15.Apr), 81(29.Apr),82 (13.May), 84-91,92(30.Sep),93 (14.Oct), (10 –
Jun-16.Sep), #94-95 (28.Oct-11.Nov),96 (25.Nov),97 (9.Dec), #98 (23.Dec)
1972: #99-100 (6.-20.Jan), #102-114 (17.Feb- 3.Aug), #116 -124 (31.Aug-21.Dec)
1973: #125-150 (4.Jan – 20.Dec)
1974: #151-158 (3.Jan – 11.Apr), #160-165 (9.May – 18.Jul), #167-168 (15.-29.Aug), #170 (26.Sep), #174-176 (21.Nov-19.Dec)
1975: #180-185 (13.Feb-24.Apr), #187-189 (22.May-19.Jun), #193-195 (14.Aug-11.Sep), #200 (20.Nov)
1976: #208 (11.Mar), #212 (6.May), #214-216 (3.Jun-1.Jul), #218 (29.Jul), #226 (18.Nov)
1982: #378-380 (16.Sep-14.Oct)
1984: #431 (27-Sep) |
RONDO – P-455
Germany
1992: #1-3 [complete set]
1993: #1-4 [complete set]
1994: #1-4 [complete set]
1995: #2-6 [complete set]
1996: #1-6 [complete set]
1997: Vol. 6/1-6 [complete set]
1998: Vol. 7/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1999: Vol. 8/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2000: Vol. 9/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2001: Vol. 10/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2002: Vol. 11/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2003: Vol. 11/1-6 (Feb/Mar-Dec/Jan)
2004: Vol. 12/1; Vol. 13/2-6
2005: Vol. 13/1; Vol. 14/2-6
2006: Vol. 15/1-6
2007: Vol. 16/1-6
2008: Vol. 17/1 |
ROUTE – P-1118
Quartalschrift des Jazz Circle Coesfeld
1956: #1-2 (Feb-May/Jul)
1959: #9 (spring) |
RSVP – P-370
Record Sales Various Prices
England
1965: #6-7 (Nov-Dec)
1966: #8-14 (Jan-Jul), #16-19 (Sep-Dec)
1967: #20-31 (Jan-Dec)
1968: #32-43 (Jan-Dec)
1969: #44-51 (Jan-Dec)
1970: #52-57 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1971: #58-65 (Jan/Feb-Dec)
1972: #66-72 (Jan/Feb-Dec)
1973: #73-75 (Jan/Feb-Apr-May)
1974: #76 (Jan/Feb) |
RUBBERNECK – P-371
England
1989: #4-6
1990: #7
1991: #8-9
1992: #10/11-12
1993: #13-15
1994: #16-17
1995: #18-20
1996: #21-23
1997: #24-25 |
RUNDBRIEF FRAUEN MACHEN MUSIK – P-660
Germany
1994: #25-26 (Jul/Sep-Oct/Dec)
1995: #27-28 (Jan/Mar-Apr/Jun) |
RYTHMES
(Revue fondée pour la diffusion de la véritable musique de jazz)
1942: #6 |
RYTHMES – P-911
France
1962: Vol. 5/31
1963: Vol.6/32-34
1964: Vol.7/36
1965: Vol.8/37-38 |
RYTMI – P-372
Finland
1967: #1, 3
1968: #3-41969: #1, #3 (Pori Special)
1983: #2-4, 6
1985: #1-10
1986: #1-10
1988: #1-3 |
SACRAMENTO NEW ORLEANS & HOT JAZZ SOCIETY – P-687
USA
1978: Mar |
SAGA – P-373
USA
1954: Vol. 9/2 (Nov) [Louis Armstrong: Satchmo – My Life in New Orleans (excerpt from book)] |
SATURDAY REVIEW – P-374
USA
1957: (16.Nov) [Joachim-Ernst Berendt: Jazz in West Germany; Wilder Hobson: Homage Here and There; Martin Williams: Recordings Reports: Jazz LPs; I.K.: Recordings Reports: Jazz and Pop. Vocals]
1970: (4.Jul.) [the man who revolutionaized jazz. A symposium on Louis Armstrong] |
SAXOPHONE JOURNAL – P-375
USA
1985: Vol. 10/2-3 (Summer-Fall)
1986: Vol. 10/4 (Winter), Vol. 11/1-3 (Spring-Fall)
1987: Vol. 11/4 (Winter), Vol. 12/1-3 (Spring-Fall)
1988: Vol. 13/1 (Spring), 3 (Nov/Dec)
1989: Vol. 14/3 (Nov/Dec)
1990: Vol. 14/4-6 (Jan/Feb-May/Jun), 15/1-3 (Jul/Aug-Nov/Dec)
1991: Vol. 15/4-6 (Jan/Feb-May/Jun), 16/1-3 (Jul/Aug-Nov/Dec)
1992: Vol. 16/4-6 (Jan/Feb-May/Jun), 17/1-3 (Jul/Aug-Nov/Dec)
1993: Vol. 17/4-6 (Jan/Feb-May/Jun), 18/1-3 (Jul/Aug-Nov/Dec)
1994: Vol. 18/4-6 (Jan/Feb-May/Jun); 19/1-3 (Jul/Aug-Nov/Dec)
1995: Vol. 19/4-6 (Jan/Feb-May/Jun); 20/1-3 (Jul/Aug-Nov/Dec)
1996: Vol. 20/4-6 (Jan/Feb-May/Jun); 21/1-3 (Jul/Aug-Nov/Dec)
1997: Vol. 21/4-6 (Jan/Feb-May/Jun); 22/1-3 (Jul/Aug-Nov/Dec)
1998: Vol. 22/4-6 (Jan/Feb-May/Jun); 23/1-2 (Jul/Aug-Sep/Oct)
1999: Vol. 23/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 24/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2000: Vol. 24/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 25/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2001: Vol. 25/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 26/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2002: Vol. 26/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 27/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2003: Vol. 27/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 28/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2004: Vol. 28/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 29/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2005: Vol. 29/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 30/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2006: Vol. 30/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 31/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2007: Vol. 31/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 32/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2008: Vol. 32/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 33/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2009: Vol. 33/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 34/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2010: Vol. 34/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 35/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2011: Vol. 35/4-6 (Mar/Apr-Jul/Aug); 36/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2012: Vol. 36/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 37/1-2 (Sep/Oct-Nov/Dec)
2013: Vol. 37/3-6 (Jan/Feb-Jul/Aug); 38/1 (Sep-Dec) |
SCALA – P-904
Germany
1999: 2/6 (Nov/Dec)
2000: 3/1-3 (Jan/Feb-Jun), 5 (Sep/Oct) |
SCHALLDOSE INTERNATIONAL -P-1151
Schellacksammler-Verein Wien
Austria
1992: 9. Jahrgang, #45
1997: 14. Jahrgang. #68 |
SCHALL UND RAUCH – P-758
Germany
1919: Vol. 0/1 (Dec)
1920: Vol. 0/2-7 (Jan-Jun); Vol. 1/1-4 (Sep-Dec)
1921: Vol. 1/5-6 (Jan-Feb) |
SCHALL & RAUCH – P-817
Organ der IASA-Ländergruppe Deutschland/Deutschschweiz e.V.
Germany/Switzerland
1999: #2
2000: #3
2001: #4
2002: #5
2003: #6
2004: #7
2005: #8
2006: #9
2007: #10
2009: #11/12
2010: #13 (Aug)
2014: #14/15 (Mar)
2019: #16/17 |
SCHALLPLATTE, DIE – P-376
Germany
1952: #9, 11-12
1953: #1-5, 8
1954: #1, 3-4, 6-12
1955: #1-8, 10
1956: #1-5, 12
1958: #3 |
SCHALLPLATTENRING ILLUSTRIERTE – P-947
Germany
1961: Jul/Aug/Sep-Oct/Nov/Dec
1962: Jan/Feb/Mar |
SCHALLTRICHTER, Der – P-968
Germany
1988: #4 |
SCHEINWERFER – P-822
Germany
1949: Vol. 2/7 (Apr) |
SCHLAGZEUG – P-377
Germany
1958: Vol. 3/8-16 (Apr-Dec)
1959: Vol. 4/1-12
1960: Vol. 5/1-2 |
SCHRITTE – P-784
Magazin für Christen
Germany
1981: Oct |
SCHWEIZER JOURNAL – P-378
Switzerland
1954: Vol. 20/2 (Feb) [Jan Slawe: Jazz. Ein musikalisches Generationenproblem; book review on Joachim-Ernst Berendt’s Jazzbuch |
SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG – P-379
Switzerland
1947: Vol. 87/12 (Sep) [Joachim-Ernst Berendt on Boris Blacher’s “Der Großinquisator”]
1948: Vol. 88/8/9 (Sep) [Joachim-Ernst Berendt: Musik im deutschen Rundfunk]
Vol. 88/11 (Nov) [Joachim-Ernst Berendt: classical concert review, Baden-Baden]
Vol. 88/12 (Dec) [Joachim-Ernst Berendt: Neue Musik und deutsche Jugend]
1949: Vol. 89/1 (Jan) [Joachim-Ernst Berendt: classical concert review, Baden-Baden]
Vol. 89/4 (Apr) [Joachim-Ernst Berendt: classical concert review, Baden-Baden]
Vol. 89/6 (Jun) [Joachim-Ernst Berendt: classical concert review, Baden-Baden]
1950: Vol. 90/2 (Feb) [Joachim-Ernst Berendt: Musik im deutschen Rundfunk]
Vol. 90/3 (Mar) [Joachim-Ernst Berendt: classical concert review, Baden-Baden]
Vol. 90/4 (Apr) [Joachim-Ernst Berendt: classical concert review, Baden-Baden]
1951: Vol. 91/3 (Mar) [Joachim-Ernst Berendt: classical concert review, Baden-Baden]
Vol. 91/4 (Apr) [Joachim-Ernst Berendt: classical concert review, Baden-Baden] |
SICIENCE ET VIE , P-1178 Frankreich
1956: Vol. 89 #465 (Juni) |
The SCORE – P-1107
Berklee School of Music
USA
1958: Vol. 10/5 (Mar) |
SDR MAGAZIN – P-380
Germany
1989: #7 (Jul) [Dizzy Gillespie on cover] |
SECOND LINE, The – P-381
USA
1950: Vol. 1/9 (Dec)
1951: Vol. 2/1-11 (Jan-Dec)
1952: Vol. 3/1-12 (Jan-Dec)
1953: Vol. 4/1-12 (Jan-Dec)
1954: Vol. 5/1-12 (Jan-Dec)
1955: Vol. 6/1-12 (Jan-Dec)
1956: Vol. 7/1-12 (Jan-Dec)
1957: Vol. 8/1-12 (Jan-Dec)
1958: Vol. 9/1-12 (Jan-Dec)
1959: Vol. 10/1-12 (Jan-Dec)
1960: Vol. 11/1-12 (Jan-Dec)
1961: Vol. 12/1-12 (Jan-Dec)
1962: Vol. 13/1-12 (Jan-Dec)
1963: Vol. 14/1-12 (Jan-Dec)
1964: Vol. 15/1-12 (Jan-Dec)
1965: Vol. 16/1-12 (Jan-Dec)
1966: Vol. 17/1-12 (Jan-Dec)
1967: Vol. 18/1-12 (Jan-Dec)
1968: Vol. 19/1-12 (Jan-Jun)
1968: Vol. 20 (Jul-Nov/Dec)
1969: Vol. 21 (Jan/Feb-Nov/Dec) [Mar/Apr never issued]
1969: Vol. 22 (Sep-Dec)
1970: Vol. 23 (Jan-Dec)
1971: Vol. 25 (Jan-Feb) [wrong numbering/24];
Vol. 22 (Spring);
Vol. 23 (Summer-Fall)[wrong numbering/24]
1972: Vol. 23 (Spring,Spring Special Edition,Summer,Fall);
Vol. 24 (Winter)
1973: Vol. 25 (Spring,Summer,Winter)
1974: Vol. 26 (Spring-Winter)
1975: Vol. 27 (Spring-Winter)
1976: Vol. 28 (Spring-Winter)
1977: Vol. 29 (Spring-Winter)
1978: Vol. 30 (Spring-Winter)
1979: Vol. 31 (Spring-Winter)
1980: Vol. 32 (Spring-Winter)
1981: Vol. 33 (Spring-Winter)
1982: Vol. 33 (Spring-Winter)
1983: Vol. 35 (Spring-Winter)
1984: Vol. 36 (Spring-Winter)
1985: Vol. 37 (Spring-Winter)
1986: Vol. 38 (Spring-Fall/Winter)
1987: Vol. 39 (Spring-Fall)
1988: Vol. 40 (Spring-Winter)
1989: Vol. 41 (Spring-Winter)
1990: Vol. 42 (Spring-Winter)
1991: Vol. 43 (Spring-Winter)
1992: Vol. 44 (Spring-Winter)
1993: Vol. 45 (Jazz Year Review)
1994: Vol. 46 (Jazz Year Review)
1995: Vol. 47 (Jazz Year Review) |
SELECCION DE HOT JAZZ – P-764
(Organo del Hot Club de Buenos Aires)
Argentina
1952: Vol.2/5 (Nov)
1957: Vol.2 (#16-17) |
SESSION! – P-699
(Dixieland Jazz Incorporated of California Newsletter)
USA
1978: Vol. 10/2 (Feb) |
SEVEN – P-861
Germany
1996: #1-2
1997: #3 (Apr) |
78 QUARTERLY – P-643
USA
1967: Vol. 1/1-2
1988: Vol. 1/3
1989: Vol. 1/4
1990: Vol. 1/5
1991: Vol. 1/6
1992: Vol. 1/7
1993: Vol. 1/8
1994: Vol. 1/9 |
SHEET MUSIC MAGAZINE – P-1070
USA
1987: Vol:11/6 (Aug/Sept), 11/8 (Nov),11/9 (Dez)
1988: Vol.12/1 (Jan) 12/2 (Febr) 12/3 (März) 12/8 (Nov)
1989: Vol. 13/1 (Jan/Febr) 13/2 März/April) 13/3 (Mai/Juni) 13/4 (Juli/Aug)
1990: 14/1 (Jan/Febr) 14/2 (März/April) 14/3 (Mai/Juni) 14/4 (Jluli/Aug)
1991: 15/4 (Jul/Aug) 15/6 (Nov/Dez)
1992: 16/1 (Jan/Febr) 16/2 (März/April) 16/3 (Mai/Juni) 16/5 (Sep/Okt)
1993: Vol.17/2 (März/April) 17/4 (Juli/Aug)
1994: Vol.18/1 (Jan/Febr) 18/2 (März/April) 18/3 (Mai/Juni) 18/4 (Juli/Aug) 18/5 (Sept/Okt) 18/6 (Nov/Dez)
1995: Vol. 19/1 (Jan/Febr) 19/2 März/April) 19/4 (Juli/Aug)19/6 (Nov/Dez)
1996: Vol. 20/1 (Jan/Febr) 20/2 (März/April) 20/3 (Mai/Juni) 20/4 (Juli/Aug) 20/5 (Sept/Okt)
1997: Vol. 21/1 (Jan/Febr) 21/2 (März/April) 21/4 (Juli/Aug) 21/5 (Sept/Okt) 21/6 (Nov/Dez)
1998: 22/1 (Jan/Febr) 22/3 (Mai/Juni) 22/5 (Sept/Okt) 22/6 (Nov/Dez)
1999: 23/6 (Nov/Dez)
2000: 24/1 (Jan/Febr) 24/2 (März/April) 24/3 (Mai/Juni) 24/4 (juli/Aug)
2001: 25/3 (Mai/Juni) 25/4 (Juli/Aug)
2002: 26/2 (März/April) 26/5 (Sept/Okt)
2003: 27/2 (März/April) 27/3 (Mai/Juni) 27/4 (Juli/Aug) 27/5 (Sept/Okt)
2004: Vol. 28/3 (Sommer) 28/4 (Fall)
2005: Vol. 29/1 (Winter) |
SHOUT – P-1111
England
1975: #102 (Apr) |
SHOWBUSINESS – P-1042
Internationales Journal für Musik
Germany
1961: Vol. 1/2 (Dec)
1962: Vol. 2/1-8 (Jan-Nov); Vol. 3/1 (Dec)
1963: Vol. 3/2-6 (Feb-Dec)
[changes name to “musikwelt”]
1964: Vol. 4/1 (Jul/Sep)
1965: Vol. /1 (15.Dec) |
SHOWTIME – P-531
Unterhaltungs- und Freizeit-Zeitschrift
Switzerland
1983: #1 (Oct) |
SIDEWINDER – P-673
England
1995: Vol. 3 |
SIERRA JAZZ CLUB NEWS – P-646
USA
1974: Feb, Apr-Aug |
SIGHT AND SOUND (Wire) – P-574
England
1993: first issue |
SIGNAL TO NOISE – P-949
USA
1997: #1-2 (Sep/Oct-Noc/Dec) [all as “Soundboard]
1998: #3-8 (Jan/Feb-Nov/Dec) [as “Soundboard” until #7]
1999: #9-14 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2000: #15 (Jan/Feb), #19 (fall)
2001: #22-23 (Summer-Fall)
2002: #25-27 (Spring-Fall)
2003: #28-31 (Winter-Fall)
2006: #40 (Winter) |
SILBERHORN – P-1137
Deutschland
[Nachfolge der Jazzzeitung]
2015: #1-4 (Feb,May,Sep,Nov)
2016: #1-4 (Feb,May,Sep,Nov) |
SINATRA SOCIETY OF AUSTRALIA NEWSLETTER – P-888
Australia
1978: #17 (Mar/Apr) |
SISMOGRAFO – P-786
(Bollettino della S.I.S.M.A.)
Italy
1997: Vol. 6/20-23 (Jan,Apr,Jul,Oct)
1998: Vol. 7/25 (Jan, Apr) |
SIXTY CYCLE HUM – P-987
USA
1994: Vol. 7/1 (Winter) |
SKUG – Journal für Musik – P-1177
Austria
2010: #82/ 4-6
2011: #88/ 10-12 |
SLAGWERKKRANT – P-996
Netherlands
2002: #112 (Nov/Dec) |
SMATTERBOOKS – P-382
England
1948: #4 [special jazz issue] |
SMITH’S ACADEMY INFORMER – P-496
England
1985: #1-2 (Jun,Sep)
1986: #3-6 (Feb,Jul,Oct,Dec)
1987: #7-10 (May,Jul,Sep,Winter)
1988: #11-13 (Apr,Jul,Oct)
1989: #14-17 (Feb,Apr,Aug,Nov)
1990: #18-21 (Jan,May,Aug,Oct)
1991: #22-26 (Feb,Apr,Jul,Oct,Dec)
1992: #27-29 (May,Aug,Oct)
1993: #30-34 (Jan,Apr,Summer,Oct,Dec)
1994: #35-38
1995: #39-42 (Mar,May,Sep,Dec)
1996: #43-46 (Mar,Oct,Dec)
1997: #47-50 (Mar,Jun,Oct,Dec)
1998: #51-53 (Mar,Jun,Oct)
1999: #54-57 (Jan,Apr,Aug,Oct)
2000: #58-60 (Feb,May,Sep)
2001: #61-63 (Jan,May,Sep)
2002: #64-67 (Jan,Apr,Aug,Nov)
2003: #68-70 (Mar,Jul, Nov)
2004: #71-72 (Mar,Jul)
2005: #73-74 (May,Nov)
2006: #75-77 (Mar,Jun,Oct)
2007: #78-79 (Feb,Aug,Oct) |
LA SOLUTION – P-997
La gazette française de Moscou
Russia
#8 (Jul.2000) |
SO JAZZ – P-1130
Switzerland
2012: #23 (Mar), #29 (Oct)
2013: #32-34 (Feb-Apr) |
SONIC-P-1020
Magazin fuer Holz- und Blechblasinstrumente
Germany
2005: #1 (Jan/Feb)
2016: #3 (May/Jun) |
SONO – P-1090
Musik für erwachsene Hörer
Germany
2011: Nov/Dec |
SOUND – P-1117
Mitteilungsblatt des Jazzclub Köln
Germany
1955: #2 (Nov) |
SOUND BLAST – P-970
Australia
1973: May |
SOUND NOTES – P-383
An Independent Review of New Music in Canada
Canada
1991: Vol. 1/1 (Fall/Winter) |
SOUNDS – P-384
Germany
1967: #1-4
1968: #5-9 (Mar-Nov)
1969: #10-14 (Jan-Sep)
1970: #16-17 (Mar-Apr), 20-21 (Jul/Aug-Sep), 23-24 (Nov-Dec)
1971: #28-31 (Apr-Aug)
1972: #1, 6, 8-10 (= #35,40,42-44)
1973: Vol. 5/1 (Jan), 3-12 (Mar-Dec)
1974: Vol. 6/1-12 (Jan-Dec)
1975: Vol. 7/1-12 (Jan-Dec)
1976: Vol. 8/1-12 (Jan-Dec)
1977: Vol. 9/1-7 (Jan-Jul), 9 (Sep), 11-12 (Nov-Dec)
1982: #12
1983: #1 |
SOUNDS & FURY – P-385
USA
1965: Vol. 1/4 (Feb), 7-10 (Jul/Aug-Oct), 12 (Dec)
1965: #? (Juli/Aug), #2 (Sept/Okt),
1966: Vol. 2/1-3 (Feb,Apr,Aug)
1966. Vol. 1 #4 (Febr), April, Vol. 2 #2 (April), #3 (Aug) |
SOUNDS ON CAMPUS – P-1093
USA
1966: #3 |
SOUNDS VINTAGE – P-777
England
1979: Vol. 1/1-6 (Jan/Feb-Nov/Dec) |
THE SOURCE -P-1013
Challenging Jazz Criticism
England
2004: Vol.1
2005: Vol. 2 |
SOUTH P-1153
publié per le jazz-club d’ Aix – Marseille
1969: SOUTH 1 |
SOUTH BAY BEAT – P-616
Bulletin of the South Bay Traditional Jazz Society
USA
1978: Vol. 6/13 (Jan), 6/16 (Apr), 6/18 (Jun), 6/19 (Jul), Vol. 7/20 (Aug), 7/21 (Oct), 7/22 (Nov) |
SOUTHERN REGISTER, The – P-644
The Newsletter for the Center for the Study of Southern Culture
USA
1987: Vol. 5/1 |
SO WHAT – P-706
Mensuel gratuit distribu’ par l’association Le Journal de Jazz
France
1995: #1-2 (Oct-Dec)
1996: #3-11 (Feb-Dec)
1997: #13-20 (Jan-Nov)
1998: #21-29 (Jan-Dec)
1999: #30-37 (Jan-Dec)
2000: #38-40 (Jan-May) [eingestellt] |
SOZIALISTISCHE ZEITSCHRIFT FÜR KUNST UND GESELLSCHAFT – P-386
Germany
1971: #5-6 [special issues on pop music] |
SPEX – P-543
Germany
1988: #4 (Apr) |
DER SPIEGEL – P-387
Germany
1949: Vol. 3/52 (22.Dec) [NN: Die Null fühlend. Mit Leib und Seele (reviewv of Coleman Hawkins concert)]
1949: Vol. 3/46 (10.Nov) [Louis Armstrong]
Vol. 3/51 (15.Dec) [”Jazz” Journal from Frankfurt]
1950: Vol. 4/19 (11.May) [NN: Milhaud: Gute reife Olive; NN: Ellington. Schwarze Musik]
Vol. 4/20 (18.May) [NN: Goodman. Es ist sein Stück]
Vol. 4/25 (22.Jun) [NN: Psychose. Jedermann tanzt (jazz as dance music)]
Vol. 4/28 (13.Jul) [NN: Cocktail. Alles schon einmal gehört (Oscar Peterson)]
Vol. 4/30 (27.Jul) [NN: Miller. In seinem Geiste (Glenn Miller)]
Vol. 4/33 (17.Aug) [NN: Gillespie. Jetzt spielt er wieder]
Vol. 4/36 (6.Sep) [NN: Kollektiv. Mit Bach fing es an (jazz education at State College, San Francisco); letter on Gillespie re article in Vol. 4/33]
Vol. 4/39 (27.Sep) [NN: Kenton. Nichts, als die Tür schließen]
Vol. 4/44 (1.Nov) [NN: Cesana. Auf jeden Fall laut (Otto Cesana); Helmut Zacharias/Personalien]
Vol. 4/51 (20.Dec) [NN: Kombination. Be-bop mit Orgel (Billy Taylor)
1951: Vol. 5/2 (10.Jan) [NN: Weltrekord. Mit sieben Trompeten (Bob Crosby’s “All Dixie Show”)]
Vol. 5/6 (7.Feb) [NN: Geige. Viele Pesos herausstreichen (violin in jazz; cover: violinist Ray Nance)]
Vol. 5/10 (7.Mar) [NN: Goodman. Auf Welle Dabbljuänidabblju]
Vol. 5/13 (27.Mar) [NN. Flanagan. Geschäft mit der Army (Ralph Flanagan)]
Vol. 5/15 (11.Apr) [NN: Tristano. Mit Bach fing es an]
Vol. 5/19 (9.May) [NN: Toscanini. Du bist ein Wilder (cover: Toscanini)]
Vol. 5/21 (23.May) [no jazz content]
Vol. 5/24 (13.June) [Oscar (Pettiford) zupft besser]
Vol. 5/26 (27.Jun) [NN: Kritik. Wie eine Dreschmaschine (Stan Kenton)]
Vol. 5/28 (11.Jun) [NN: Swing. Zu verkaufen (Les Brown)]
Vol. 5/35 (29.Aug) [NN: Ellington. Tee für zwei]
Vol. 5/36 (5.Sep) [letter on jazz in Der Spiegel]
Vol. 5/41 (10.Oct) [3 letters on jazz in Der Spiegel]
Vol. 5/43 (24.Oct) [NN: Strawinsky. Dies is Apolls Gebot (Strawinsky on cover)]
Vol. 5/45 (7.-Nov) [NN: Andrews-Sisters. Chop, Chop, Chop (Patty Andrews on cover)]
Vol. 5/48 (28.Nov) [NN: Armstrong. Baby, jetzt kommt die Krone (Louis Armstrong on cover)]
1952: Vol. 6/5 (30.Jan) [NN: Phänomen. Lady mit Trick-Kehle (Yma Sumac, also on cover)]
Vol. 6/9 (27.Feb) [letter about the cover with Yma Sumac]
Vol. 6/10 (5.Mar) [NN: Kreuder. Oesterreich im Herzen (Peter Kreuder on cover)]
Vol. 6/15 (9. Apr) [NN: Ein-Mann-Orchester. Echo vom andern Stern (Les Paul)]
Vol. 6/16 (16.Apr) [no jazz content]
Vol. 6/17 (23.Apr) [NN: Sowjetzone. War in Sosa auch dabei (jazz in East Germany)]
Vol. 6/22 (28.May) [letters on the Peter Kreuder article; one letter from Kreuder; NN: Schlager-Geschäft. Boogie des dicken Mannes (Billy May, Ray Anthony, Jimmy Lunceford]
Vol. 6/24 (11.Jun) [NN: Gefühle. Weinen wie ein Baby (Johnnie Ray, Al Jolson, Frank Sinatra, Billie Holiday)]
Vol. 6/25 (18.Jun) [letters on jazz in Der Spiegel]
Vol. 6/28 (9.Jul) [NN: Lena Horne. Die Story von Jim Crow (Lena Horne on cover)]
Vol. 6/43 (22.Oct) [NN: Edelhagen. Präzis wie die Preußen (Kurt Edelhagen on cover)]
Vol. 6/45 (5.Nov) [NN: Armstrong-Tournee. Künstlerisch sehr wertvoll]
Vol. 6/52 (24.Dec) [NN: Gesang. Songs in Bethlehem (Mahalia Jackson)]
1953: Vol. 7/6 (4.Feb) [NN: Tonband-Schmuggel. Klassiker zu Vorzugspreisen (Black Bootleg Market with classical music)]
Vol. 7/9 (25.Feb) [letter on article from Vol. 7/6; NN: Jazz. In der Philharmonie (JatP)]
Vol. 7/12 (18.Mar) [NN: Charmaine. Wie gut bei ihm gegeigt wird (Mantovani, Kostelanetz); NN: Madame. Gardez vos illusions (Josephine Baker)]
Vol. 7/17 (22.Apr) [Ella Fitzgerald]
Vol. 7/38 (14.Sep) [NN: Kenton. Musik im Niemandsland (Stan Kenton on cover)
Vol. 7/46 (11.Nov.) [Die Groschen-Troubadoure (also Tin Pan Alley)]
1954: Vol. 8/46 (10. Nov) [Jazz-Platten]
1955: Vol. 9/5 (26.Jan) [Eartha Kitt]
Vol. 9/14 (30.Mar) [Joachim-Ernst Berendt letter on cooperation between Toscanini and Ellington]
Vol. 9/15 (6.Apr) [NN: Valente. Stimme wie ein Instrument (Catherina Valente on cover)]
Vol. 9/16 (13.Apr) [Charlie Parker]
1956: Vol. 10/9 (29.Feb) [Louis Armstrong]
Vol. 10/31 (1.Aug) [no jazz content]
Vol. 10/39 (26.Sep) [NN: Rock ‘N’ Roll. Der Über-Rhythmus]
Vol. 10/50 (12.Dec) [NN: Presley. Elvis, the Pelvis (Elvis Presley on cover)]
1957: Vol. 11/3 (16.Jan) [ad of Star Revue on Berendt-article: “Vom ‘Rag’ zum ‘Cool’ – der Jazz-Professor doziert”]
1985: Vol. 39/11 (11.Mar) [Karl-Heinz Krüger: “Oh, Baby. Scheiße. Wie ist das alles gekommen?” SPIEGEL-Redakteur Karl-Heinz Krüger über Blüte, Zerfall und Sanierung des New Yorker Schwarzenviertels Harlem]
1990: Vol. 45/1 (31.Dec) [NN: Entertainment. Young Blue Eyes (Harry Connick Jr.)]
1991: Vol. 45/29 (15.Jul) [Peter Bölke & Claudius Seidl: “Manchmal muß es Big Mäc sein”. Pianist Herbie Hancock über Jazz, Rock, Religion und seinen kommerziellen Erfolg (Interview)]
Vol. 45/31 (29.Jul) [NN: Jazz: Zwei Stunden Achterbahn (über Quincy Jones)]
Vol. 45/41 (7.Oct) [Jürg Laederer: Fahrstuhl zum Erfolg. Zum Tod des Jazz-Trompeters Miles Davis]
1992: Vol. 46/7 (10.Feb) [Peter Bölke & Helmut Sorge: “Ich mach’ einfach so weiter”. Jazztrompeter Dizzy Gillespie über das Alter, seine Freunde und den Bebop (Interview)] |
SPIEGEL SPECIAL – P-703
Germany
1995: #12 (“Musik-Lust fürs Ohr”) |
SPINNING CIRCLE – P-906
Germany
2000: #1 |
SPOTLIGHT – P-503
Germany
1978: #5 (Mar), 7 (May), 9 (Aug)
1979: Nov |
SPYRO GYRA NEWSLETTER – P-580
USA
1993: Vol. 1 |
DAS STACHELSCHWEIN – P-770
Germany
1927: Oct |
STAR REVUE – P-388
Germany
1957: Vol. 2 (Jan) [NN: Der Jazz-Professor aus Baden-Baden (von Joachim-Ernst Berendt)] |
STEAUA – P-612
Revista de literatura, cultura si spiritualitate romaneasca
Rumania
1994: #1/2-3 (Jan/Feb-Mar) |
STEREO – P-389
Germany
1973: #4
1974: #5-16
1975: #17-18, 20-27
1976: #29, 31, 33, 35, 37-39
1977: #41-43, 45, 48, 50
1978: Vol. 5/1
1979: Vol. 6/10
1980: Vol. 7/5, 8
1981: Vol. 8/2-3, 6
1982: Vol. 9/1, 10-11
1983: Vol. 10/1-5
1984: Vol. 11/10
1985: Vol. 12/3, 9-10, 12
1986: Vol. 13/1-2, 8-12
1987: Vol. 14/2
1991: Vol. 18/8-9
2011: Vol. 6, 8, 11, 12 (Jun, Aug, Nov, Dez)
2012: Vol.1, 4-5 (Jan, Apr-Mai) [nicht weiter aufnehmen: nur Jazzseiten scannen, z.B. Instrumentenakustik!] |
STEREOPLAY – P-390
Germany
1982: #12
1983: #1, 7
1984: #7, 10
1985: #7-10, 12
1986: #2-3, 5-56, 8-11
1987: #1, 3-4 |
STEREOPLAY – P-524
France
1982: #24 (Mar) |
STEREOPLAY – P-516
Italy
1978: Vol. 7/60 (Nov) |
STERN, Der – P-391
Germany
1950: Vol. 3/23 (4.Jun) [NN: Duke ist da. Duke Ellington in Deutschland]
1953: Vol. 6/10 (8. Mar) [NN: Das Publikum raste Beifall. Namen, die den Jazzfreund in Ehrfurcht erbleichen lassen (JatP)] |
STERN-WHEELER, The – P-615
Automotive Booster Club
USA
1968: May |
STORYVILLE – P-392
England
1965: #1-2 (???, Dec)
1966: #3-8 (Feb-Dec/Jan)
1967: #9-14 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1968: #15-20 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1969: #21-26 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1970: #27-32 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1971: #33-38 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1972: #39-44 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1973: #45-50 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1974: #51-56 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1975: #57-62 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1976: #63-68 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1977: #69-74 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1978: #75-80 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1979: #81-86 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1980: #87-92 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1981: #93-98 (Feb/Mar-,Dec/Jan)
1982: #99 -104 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1983: #105-110 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1984: #111-116 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1985: #117-122 (Feb/Mar-Dec/Jan)
1986: #123-128 (Feb/Mar-Dec)
1987: #129-132 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1988: #133-136 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1989: #137-140 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1990: #141-144 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1991: #145-148 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1992: #149-152 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1993: #153-156 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1994: #157-160 (Mar,Jun,Sep,Dec)
1995: #161 (Mar)
1996-97: book edition
1998-99: book edition
2000-01: book edition |
STRAIGHT NO CHASER – P-393
England
1988: #2 (Autumn)
1989: #3-6 (Spring-Winter)
1990: #7-10 (Spring-Winter)
1991: #11-14 (Spring-Winter)
1992: #15-19 (Spring-Winter)
1993: #21-22 (Spring/Summer-Summer), 24 (Winter)
1994: #25-29 (Spring-Winter)
1995: #30-34 (Spring-Winter)
1996: #35-39 (Spring-Winter)
1997: #40-44 (Spring-Winter)
1998: #45-48 (Spring-Winter)
1999: Vol. 2/5-8 (Spring-Winter)
2000: Vol. 2/9-13 (Spring-Winter)
2001: Vol. 2/14-18 (Spring-Winter)
2002: Vol. 2/19-23 (Spring-Winter)
2003: Vol. 2/24-25 (Spring-Summer) |
STREET SINGER, The – P-394
England
1968: #6-7 (Sep/Oct-Nov/Dec)
1969: #8-11 (Jan/Feb-Jul/Aug)
1971: #24-25 (Sep/Oct-Nov/Dec)
1973: #32-33 (Jul/Aug/Sep-Oct/Nov/Dec) |
STRICTLY JAZZ – P-707
Your Total Jazz Source
USA
1996: 3/8 (Mar), 4/1 (Nov) |
STRIDER NEWS – P-865
Universal Zine of All Music
USA
1998: #5-10 |
STRINGS – P-395
USA
1992: Vol. 6/4 (Jan/Feb), 6/6 (May/Jun), 7/1-3 (Jul/Aug-Nov/Dec)
1993: Vol. 7/4-6 (Jan/Feb-May/Jun), 8/1-3 (Jul/Aug-Nov/Dec); Supplement
[1994 Resource Guide]
1994: Vol. 8/4-5 (Jan/Feb-Mar/Apr) |
STUDIENKREIS RUNDFUNK UND GESCHICHTE – P-396
Germany
1975: Vol. 1/5 (Oct) [Joachim-Ernst Berendt: Der Jazz als Indiz. Beiträge zu einer Geschichte des Jazz am deutschen Rundfunk] |
SÜDWESTFUNK INTERN – P-397
Germany
1972: #1 [Reinhard Oehlschlägel: Sinfonieorchester morgen: Reform durch Streik?]
1974: #1 [NN: Aus Baden-Baden kommt der neue Sound. New Jazz Meeting. Ein Jahr in Jazz]
fortgeführt als
SÜDWESTFUNK JOURNAL
1991: Jun |
SÜRAG, Die – P-398
Süddeutsche Illustrierte
Germany
1950: #25 (18.Jun) [photo and short notice on meeting between Benny Goodman and Joachim-Ernst Berendt]
#27 (23.Jul) [no jazz content]
#32 (6.Aug) [no jazz content]
#33 (13.Aug [no jazz content]
#48 (26.Nov) [no jazz content]
1951: #4 (21.Jan) [NN: Jazz im Funk] |
SUN RA QUARTERLY – P-732
USA
1996: #1-3 (Jun,Sep,Dec)
1997: #4-5 (Mar,Jun) |
SUN RA ARKIVE – P-1003
USA
2002: #1 (Dec)
2003: #2-4 (Jan-Mar) |
SUN RA RESEARCH – P-736
USA
1995: #1-4 (May,Jul,Sep,Dec)
1996: #5-9 (Feb,Apr,Jul,Sep,Dec)
1997: #10-14 (Jan,Mar,Jul,Sep,Dec)
1998: #15 (Feb), #16 (Apr), #17 (Jun), #18 (Aug), Index, |
SUONO STEREO HI-FI – P-982
Italy
1993: Vol. 22/9 (Sep) |
SUPER STEREO – P-522
Italy
1980: Vol. 2/11 (May) |
SVENSK MUSIK – P-399
Sweden
1991: #1-4
1992: #1-4
1993: #1-4
1994: #1-4
1995: #1-4
1996: #1-4
1997: #1-4
1998: #1-4
1999: #1-4
2000: #1-4
2001: #1-4
2002: #1-4
2003: #1-4
2004: #1-4
2005: #1-4
2006: #1-4
2007: #1-4
2008: #1-4
2009: #1-4
2010: #1-3 |
SWF MAGAZIN – P-400
Germany
1988: #11 (Nov) [Klaus Mümpfer: New Jazz Meeting] |
SWING – P-401
USA
1938: Vol. 1/2-8 (Jul-Dec)
1939: Vol. 1/9-12 (Jan-Apr); Vol. 2/2-4 (Jun-Aug)
1940: Vol. 2/8 (Jan), 11-12 (May-Jun); Vol. 3/1-3 (Jul-Sep), 5-6 (Nov-Dec) |
SWING – P-952
Landelijke Stichting Promotie Muziekimprovisatie
Netherlands
2001: Vol. 11/3 (Oct/Dec) |
SWINGING HAMBURG JOURNAL – P-967
Germany
2002: Vol. 1/1-3 (Apr/Jun-Oct/Nov); Sonderheft 1 (25.Apr.)
2003: Vol. 2/4-7 (Jan /Mar-Oct/Dec)
2004: Vol. 3/8-11 (Jan/Mar-Sep/Dec)
2005: Vol. 4/12-15 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2006: Vol. 5/16-20 (Jan/Mar-Oct/Dec)
2007: Vol. 6/21-23 (Apr-Dec)
2008: Vol. 7/24-27
2009: Vol. 8/28-31
2010: Vol. 9/32-35
2011: Vol. 10/36-39
2012: Vol. 11/40-43
2013: Vol. 12/44-47
2014: Vol. 13/48-51
2015: Vol. 14/52-55
2016: Vol. 15/56-59
2016: Vol. 16/60
2017: Vol. 16/61-63
2018: Vol. 17/64-68
2019: Vol. 18/69-71
2020: Vol. 19/72-75
2021: Vol. 20/76-78 |
SWINGING HAMURG MITTEILUNGEN – P-972
Germany
2002: 2. Quartal
2008: 1. Quartal, 4. Quartal
2013: 1. Quartal, 2. Quartal
2015: 3. Quartal
2017: 2. Quartal, 4. Quartal
2018: 1. Quartal, 3. Quartal
2019: 3. Quartal2020: 1. Quartal, 4. Quartal2021: 2. Quartal |
SWING JOURNAL – P-402
Japan
1968: #4,12
1975: #1 (copy excerpt)
1983: #3
1985: #6, 11
1986: #1-10, 12
1987: #1-12
1988: #1-12
1989: #1-12
1990: #1-12
1991: #1-12
1992: #1-8 |
SWING JOURNAL – P-403
Jazz CD/Record/Video
Japan
1978
1991 |
SWING MUSIC – P-404
England
1935: Apr-Sep
1936: Jan-Jun |
SWINGING NEWSLETTER – P-405
Poland/USA (IJF)
1972: Vol. 1/1-2 (Oct-Dec)
1973: Vol. 2/3-6 (Feb-Sep)
1974: Vol. 3/9-10 (May-Nov)
1975: Vol. 4/12/13-20/21 (Feb/Mar-Oct/Nov)
1976: Vol. 5/24-29 (Mar-Aug)
1977: Vol. 6/31-34 (Jan-Dec)
1978: Vol. 8/35-37 (Feb-Jul) |
SWING SHEET – P-908
The Newsletter of Jazz at Lincoln Center
USA
2000: Vol. 1/2 (Spring/Summer) |
SWINGTIME – P-406
Belgium
1955: #35 (Apr) |
SWINGTIME – P-532
Maandblad voor Jazz en Blues
Belgium
1977: #21 (May)
1979: #42 (Aug/Sep) |
SWISSJAZZORAMA – P-931
Jazzletter
Switzerland
2000: #1 (Nov)
2001: #2-4 (Mar,Jul,Nov)
2002: #5-6 (Mar,Aug)
2003: #7-8,10 (Jan-Aug) [#9 gibt es nicht; falsche Nummerierung]
2004: Mar, Sep
2006: #15
2007: #16
2008: #17-20
2010: #22 (Aug)
2011: #23-24 (Mar,Aug)
2012: #26 (Aug)
2015: #34 (Dec)2016: #36 (Sep)
2017: #37-40 (Jan,Apr,Aug,Dec)
2018: #41-42 (Mar,Aug)
2019: #43-44 (Apr,Aug)2020: #45-47 (Apr,Aug,Dez)
2021: #48 (Apr) |
SWISS MUSIC DIAL – P-651
Switzerland
1978: #13/0 (Apr) |
SYNCOPATED TIMES, THE –P1147
2016: Vol.1 #6 (Jul) |
TAGES-ANZEIGER/BERNER ZEITUNG – DAS MAGAZIN – P-407
Switzerland
1990: #16 (20./21.Apr) [Ueli Balsiger: Hans Koch Jazzmusiker. Ästhet mit schrägen Tönen] |
TAILGATE RAMBLINGS – P-645
Atlanta Dixieland Jazz Society
USA
1973: Jun-Jul,Sep-Oct,Dec
1974: Feb,Nov
1975: Nov |
TALK! – P-476
(Sony Music Magazin)
Germany
1993: #1-10 (Feb-Dec)
1994: #1-11 (Feb-Dec/Jan) [Sonderausgabe: Selig]
1995: #1-6 (Feb-Jul), #8-11 (Sep-Dec); [Sonderausgabe: Popkomm 1995]
1996: #2-4 (Feb-Apr) |
TALKING BLUES – P-776
England
1976: #1-3 (Apr/Jun-Oct/Dec)
1977: #5 (Apr/Jun) |
TALKING DRUMS – P-803
England
#56 |
TALKING MACHINE INTERNATIONAL (The) – P-946
England
1970: #4,6-7 (Jun, Oct-Dec)
1971: #8-10 (Feb,Apr,Jun)
1972: #17-19 (Aug-Dec)
1973: #20-25 (Feb/Apr-Dec)
1974: #26 (Feb)
1978: #50/51-54/55 (Feb/Apr-Oct/Dec)
1979: #56/57-60/61 (Feb/Apr-Oct-Dec)
1980: #62
1981: #63/64 (Autumn)
1983: #65/66 (Feb), #67 (Nov)
1984: #68 (Jun), #69 (Dec)
1985: #70 (Dec)
1986: #70 (Nov)
1987: #72 (Apr)
1988: #75 (Autumn) |
TANECNI HUDBA A JAZZ – P-408
CSSR
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966/67 |
TANGO – P-603
naujoji muzika
Litauen
1991: #2
1992: #3 |
TANZ IN DER MODERNEN GESELLSCHAFT, Der – P-409
Germany
???: ??? [NN?: Tanz als Ausbruch. Zur Problematik der modernen Tanzmusik (Sonderdruck)] |
TEMPO – P 830
USA
1937: Vol. 4/8 (Feb), 11 (May)
1938: Vol. 6/1-3 (Jul-Sep) |
TEXAS JAZZ – P-890
USA
1980: Vol. 4/5-6 (May-Jun) |
TEXAS MUSIC HISTORY P-1183
USA
2017: Vol.17 |
TEXTE UND ZEICHEN – P-410
Germany
1957: Vol. 3/1 (#11) [Joachim-Ernst Berendt: Mittsommernachts-Jazz (Jazz in Sweden)]
Vol. 3/5 (#15) [Joachim-Ernst Berendt: Komplex und Sprache des Jazz (on Mezz Mezzrow)] |
THE RECORD CHANGER -P-1167 (USA, NY)
1951: Mai |
THEME – P-917
Music news from Hollywood
USA
1953: Vol. 1/1-4 (Jul,Aug,Oct,Dec/Jan)
1954: Vol. 1/5 (Mar), 2/1 (Nov)
1955: Vol. 2/2-4 (Jan,Mar,NN)
1956: Vol. 3/1
1957: Vol. 4/1-2 (Jan, Fall) |
THINK JAZZ! – P-493
USA
1981: Vol. 6/2 (Feb) |
THIRD LINE – P-411
Germany
1965: Vol. 1/4 (Sep)
1966: Vol. 2/1-3/4
1967: Vol. 3/5-10 (complete) |
THOUGHT – P-412
A Review of Culture and Idea
USA
1969: Summer [Neil P. Hurley: Toward A Sociology of Jazz] |
TIME – P-1019
The weekly newsmagazine
USA
1954: Vol. 64/12 (8.Nov)
1956: Vol. 68/8 (20.Aug)
1964: Vol. 83/9 (28.Feb)
1990: Vol. 136/17 (22.Oct) |
TIBIA – P-833
Magazin für Holzbläser
1998: #4 |
TIJD, DE – P-413
Netherlands
1987: #27 (3.Jul) [special jazz issue] |
TIJDSCHRIFT OVER CULTUUR & CRIMINALITEIT – P-1127
Netherlands
2013: Vol. 3/3 |
TIJDSCHRIFT VOOR MUZIEKTHEORIE – P-948
Netherlands
1998: Vol. 3/1-2 (Feb,May)
2000: Vol. 5/1-3 (Feb,May,Nov)
2001: Vol. 6/1-2 (Feb,May)
2003: Vol. 8/1 (Feb)
2004: Vol. 9/3 (Nov) |
TONART – Das Musikmagazin für Ärzte – P-1140
Germany
2014: Winter |
TRANSYLVANIAN REVIEW – P-1026
Romania
2005: Vol. 14/1 (Spring) [Einzelheft] |
TRESEN MAGAZIN – P-414
Germany (Berlin)
1991: #20 (Oct) |
TRIBE -P-748
USA (New Orleans)
1997: #17 |
TROPICAL TIMES – P-415
Germany
1990: Summer
1991: Summer, Fall |
TSCHIN BUMM – P-528
1. Österreichisches Fachblatt für Musiker und Studiotechnik
Austria
1983: #8
1987: #55 |
TT – P-896
tonlistart¡maritio
Iceland
1981: Vol. 1/1-2 (Jul-Oct)
1982: Vol. 1/3 (Feb) |
TWEN – P-416
Germany
1959: Vol. 1/ No. 4 (Dec)
1960: Vol. 2/ No. 5 (Feb), 6 (Apr), 7 (Jun), 8 (Aug), 9 (Oct)- 10 (Nov)
1961: Vol. 3 / No.1(Jan), 2 (Apr/May), 3 (Jun/Jul), 4 (Aug/Sep), 5 (Oct), 6 (Nov), 7(Dec)
1962: Vol. 4/ No.2 (Feb), 3 (Mar), 4 (Apr), 5(May), 6 (Jun), 7 (Jul), 8 (Aug), 9 (Sep), 10 (Oct), 11 (Nov), 12 (Dec)
1963: Vol. 5 (Jan-Nov)
1964: Vol. 6/ No.1(Jan), 2 (Feb), 4(Apr), 5(May), 9 (Sep) -12 Dec)
1965: Vol. 7 (Jan-Dec)
1966: Vol. 8 (Jan-Dec)
1967: Vol. 9/ No. 1(Jan) -3 (Mar), 5 (May) – 10 (Oct), 12 (Dec)
1968: Vol. 10/No. 1(Jan), 2 (Feb), 4 (Apr) -12 (Dec)
1969: Vol. 11/No. 1(Jan) -5 (May), 7 (Jul) – 12(Dec)
1970: Vol. 12 (Jan-Nov)
1971: Vol. 13/ No. 3(Mar) -5 (May) |
TZAZ – P-482
Griechenland
1977: #1 (Dec)
1978: #2-5 (Mar-Dec)
1979: #6-8 (Mar-Sep)
1980: #9-11 (Apr-Dec)
1981: #12-15 (Mar-Dec) |
UDJ Info – P-653
Germany
1977: Jul, Dec |
UDJ Rundbrief – P-474
Germany
1985: #1 (Nov)
1986: #2 (May), 3 (Oct)
1987: #4 (Feb), 4 (Aug)
1988: #6 (Mar), 7 (Sep)
1989: #8 (May), 9 (Oct), 10 (Dec)
1990: #11 (May), 12 (Aug), 13 (Oct), 14(Dec)
1991: #15 (Jul), 16 (Nov)
1992: #17 (Apr), 18 (Nov)
1993: #19 (Jan), 20 (Dec)
1994: #21 (Dec)
1996: 1/96
1997: 1/97 |
ÜBERMUSIK – P-652
Germany
late 80’s/early 90’s: Übersoul #1-3
late 80’s/early 90’s: Überbeat #1 |
UNGARN REVUE – P-990
Ungarn
2002: Vol. 2/1 (Feb) |
UNION DES MUSICIENS DE JAZZ LETTRE D’INFORMATION – P-816
France
1997: Nov
1998: Mar,Nov |
UNISON – P-535
Mensuel du club socialiste du disque
France
1977: #1-2 (Mar-Apr) |
UNITED JAZZ SOCIETY – P-579
Live-Veranstaltungen in NRW
Germany
1993: Vol. 4/3-5 (Mai/Jun-Nov/Dec)
1994: Vol. 5/2 (Jan/Feb), 5/5-6 (Sep/Oct-
Nov/Dec)
1995: Vol. 6/1-5 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1996: Vol. 7/1-4 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1997: Vol. 8/1-5 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1998: Vol. 9/1-5 (Jan/Feb-Nov/Dec)
1999: Vol. 10/1-5 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2000: Vol. 11/1-5 (Jan/Feb-Nov/Dec)
2001: Vol. 12/1 (Jan/Feb) |
UNKNOWN PUBLIC – P-692
Creative Music Quarterly
England
1992: Vol. 01
1993: Vol. 02-03
1994: Vol. 04-05
1995: Vol. 06-07
1996: Vol. 08
1997: Vol. 09
1998: Vol. 10
2000: Vol. 11
2001: Vol. 12
2002: Vol. 13
2003: Vol. 14
2004: Vol. 15
2005: Vol. 16
[Abo durch Norbert Ruecker eingestellt, 5/2006] |
UNTERHALTUNGSKUNST – P-980
Germany (DDR)
1979: #2 (Beilage)
1982: #7 |
UPTOWN STRUT – P-1074
Soul Funk Jazz
Germany
2008: #01-02 (Spring/Summer-Fall/Winter)
2009: #03-04 (Spring/Summer-Fall/Winter)
2010: #05-06 (Spring/Summer-Fall/Winter)
2011: #07-09 (Spring-Fall) |
VARIACIONES – P-849
Cuadernos de musica contempor nea
Spain
1992: #1 (May)
1992: #2 (Nov)
1995: #3 (Feb)
1996: #4 (Apr) |
VICTORY REVIEW – P-490
USA
1993: Vol. 18/1 (Jan) |
VIERVIERTEL – P-576
Germany
1951: Vol. 5/7-12 (Jul-Dec)
1952: Vol. 6/1-11 (Jan-Nov)
1953: Vol. 7/1-12 (Jan-Dec)
1954: Vol. 8/1-9 (Jan-Sep), 11-12 (Nov-Dec)
1955: Vol. 9/1-2 (Jan-Feb), 4-12 (Apr-Dec)
1956: Vol. 10/1 (Jan), 3 (Mar) |
VJM’S JAZZ & BLUES MARKT – P-1161
(The ORIGINAL jazz and blues trading magazine)
USA
1994: #93 (Spring), 94 (Summer), #95 (Autumn), #96 (Winter)
1995: #97 (Spring), 98 (Summer), 99 (Autumn), 100 (Winter)
1996: #101 (Spring), 102 (Summer), 103 (Autumn), #104 (Winter)
1997: #105 (Spring), 106 (Summer), 107 (Autumn), 108 (Winter)
1998: #109 (Spring), 110 (Summer), 111 (Autumn), 112 (Winter)
2000: #117 (Spring), #118 (Summer), #119 (Autumn), #120 (Winter)
2001: #121 (Spring), #122 (Summer), #123 (Autumn), 125 (Winter)
2002: #126-129
2003: #130-132
2004: #133 (Spring), #134 (Summer), #135 (Autumn), #136 (Winter)
2005: #137(Spring), #138 (Summer), #139 (Autumn), #140 (Winter)
2006: #141 (Spring), #142 (Summer), #143 (Autumn), #144 (Winter)
2007: #145(Spring), #146 (Summer), #147 (Autumn), #148 (Winter)
2008: #149 (Spring), #150 (Summer), #151 (Autumn), #152 (Winter)
2009: #153 (Spring), #154 (Summer), #155 (Autumn), #156 (Winter/Spring)
2010: #157 (Summer), #158 (Autumn), #159 (Winter/Spring)
2011: #160 (Summer), #161 (Autumn)
2012: #162 (Winter), #163 (Summer), #164 (Autumn)
2013: #165 (Winter), #166 (Summer), #167 (Autumn)
2014: #168 (Winter), #169 (Spring), #170 (Autumn)
2015: #171 (Winter/Sping), #172 (Summer), #173 (Autumn)
2016: #174 (Winter/spring), #175 (Summer), #176 (Autumn)
2017: #177 (Winter/Spring), #178 (Summer), #179 (Autumn)
2018: #180 (Spring), #181 (Summer), #182 (Autumn)
2019: #183 (Spring), #184 ((Summer), #185 (Autumn)
2020: #186 (Spring) |
VIGO – P-953
USA
1995: #1 (Feb/Apr) |
VILLAGE VOICE – P-417
(Jazz Supplement)
USA
1988: June |
VINTAGE JAZZ MART (VJM’s Jazz and Blues Mart) – P-418
England
1954: Vol. 1/3-5 (Feb-May), 7 (Jul), 9-10 (Oct-Nov)
1955: Vol. 1/12 (Jan); Vol. 2/1 (Feb), 3-11 (Apr-Dec)
1956: Vol. 2/12 (Jan); Vol. 3/1-11 (Feb-Dec)
1957: Vol. 3/12 (Jan); Vol. 4/1-10 (Feb-Nov)
1958: Vol. 4/12 (Jan); Vol. 5/1-11 (Feb-Dec)
1959: Vol. 5/12 (Jan); Vol. 6/1-10 (Feb-Dec)
1960: Vol. 6/11-12 (Jan-Mar); Vol. 7/3-4 (Sep-Nov)
1961: Feb, Apr-May, Jul, Sep
1962: Jan, Mar-Apr/May, Jul, Sep, Nov
1963: Jan, Mar, May/Jun, Aug, Nov
1964: Jan, Apr, Jul, Oct, Dec
1965: Apr, Jul, Sep, Nov
1966: Mar, Jun, Sep, Nov
1967: Feb, Apr, Jul, Oct, Dec
1968: Apr, Jul, Nov, Dec
1969: Mar, Jun, Oct
1970: Jan, Apr, Jul, Oct
1971: Mar/Apr, Jun/Jul, Sep/Oct
1972: Jan, Apr, Jul, Nov
1973: Feb/Mar, May/Jun, Oct
1974: Feb, Jun, Oct
1975: Mar, Jul, Dec
1976: Apr/May, Oct
1977: Mar, Aug, Sep
1978: Mar, Oct
1979: May
1980: May, Nov
1981: May, Oct
1982: Apr, Oct
1983: Apr, Sep/Oct
1984: Mar/Apr, Sep/Oct
1985: Apr, Oct
1986: May, Oct/Nov
1987: May, Nov
1988: Jun
1989: Jan, Jul/Aug,
1990: Jan, Jul/Aug, #80 (Oct/Nov)
1991: #81-84 (Jan/Feb-Dec)
1992: #85-88 (Spring-Winter)
1993: #89-92 (Spring-Winter)
1994: #93-96 (Spring-Winter)
1995: #97-100 (Spring-Winter)
1996: #101-104 (Spring-Winter)
1997: #105-108 (Spring-Winter)
1998: #109-112 (Spring-Winter)
1999: #113-116 (Spring-Winter)
2000: #117-120 (Spring-Winter)
2001: #121-124 (Spring-Winter)
2002: #125-128 (Spring-Winter)
2003: #129-132 (Spring-Winter)
2004: #133-136 (Spring-Winter)
2005: #137-140 (Spring-Winter)
2006: #141-144 (Spring-Winter)
2007: #145-148 (Spring-Winter)
2008: #149-152 (Spring-Winter)
2009: #153-156 (Spring-Winter/Spring)
2010: #157-159 (Summer-Winter/Spring)
2011: #160-161 (Summer-Fall)
2013: #166-167 (Summer-Fall)
2014: #168-170 (Winter, Spring, Fall)
2015: #171-173 (Winter, Spring, Fall)
2016: #174-176 (Winter, Summer, Fall)
2017: #177-179 (Winter/Spring. Summer, Fall)
2018: #180-182 (Spring, Summer, Fall)
2019: #183-185 (Spring, Summer, Fall)
2020: #186-188 (Spring, Summer,Fall)
2021: #189 (Spring) |
VINTAGE LIGHT MUSIC –P-1037
England
1975: Spring
1984: Summer-Winter
1985: Winter |
VINYL – P-482
Niederlande
1982: Vol. 2/16 (Jul)
1983: Vol. 3/23 (Mar)
1984: Vol. 4/4-6 (Apr-Jun) |
VIVA LA MUSICA – P-419
Switzerland
1982: #45-48 (Sep-Dec)
1983: #49-57 (Jan-Dec)
1984: #58-66 (Jan-Dec)
1985: #67-76 (Jan-Dec), special festival issue
1986: #77-83 (Jan-Summer), 85-87 (Oct-Dec)
1987: #88-93 (Jan-Jun), 95-97 (Oct-Dec)
1988: #98-107 (Jan-Dec)
1989: #108-117 (Jan-Dec)
1990: #118-127 (Jan-Dec)
1991: #128-137 (Jan-Dec)
1992: #138-147 (Jan-Dec)
1993: #148-157 (Jan-Dec)
1994: #158-167 (Jan-Dec)
1995: #168-177 (Jan-Dec)
1996: #178-187 (Jan-Dec)
1997: #188-197 (Jan-Dec)
1998: #198-206 (Jan-Dec)
1999: #208-217 (Jan-Dec)
2000: #218-227 (Jan-Dec)
2001: #228-236 (Jan-Dec) |
VOX – P-529
Musik – Hifi – Video
Germany
1983: #3-7 (Mar-Apr), 7 (Jul) |
WAVELENGTH –P-1146
New Orleans Music Magazine
USA
1981: #4, (Febr); #7-9 (Mai, Juni, Juli) #13 (Nov)
1982: #15 (Jan), #16 (Febr), 18-26 (Apr-Dez)
1983: #27-32 (Jan-Jun), 34 (Aug), 37 (Nov)
1984: #39-50 (Jan-Dec)
1985: #51-62 (Jan-Dec)
1986: #63-74 (Jan-Dec)
1987: #75-86 (Jan-Dec)
1988: #87-98 (Jan-Dec)
1989: #99-110 (Jan-Dec)
1990: #111-122 (Jan-Dec)
1991. #123-125 (Jan-Mar), #127 (May), #128 (Juni), #129-131 (Jul-Sep) |
WDR RADIO – P-420
Informationen zum Radioprogramm
1991: Nov |
WE JAZZ MAGAZINE – P-1186
Finland
2019: #07 (Sep) |
WELTBÜEHNE, Die – P-473
Germany (East)
1975: 70/48 (2. Dec) [Lothar Kusche: Was ist Jazz?]
1977: 5.July [Lothar Kusche: Vier Jazzblaeser]
1988: 5.July [Jan Eik: Eisler und schwarze Klassik] |
WENDE, DIE – P-421
Zeitung der katholischen Landjugend Österreichs
Austria
1959: Vol. 14/1 (4.Jan) [Kurt Vorhofer: Warum fasziniert Jazz die heutige Jugend (review of Berendt-lecture in Linz, Austria)] |
WERKSTATT INFO – P-1187
DDR
1976: #1-2
1977: #1
1978: #1
1979: #1 |
WESPENNEST – P-735
Austria
1996: #1 (Sonderheft Musik: Wiener Musik Galerie), #105/96
1997: #108 |
WEST COAST RAG – P-422
(continued as THE AMERICAN RAG)
USA
1988: Vol. 3/7 (als “Fresno Ragtimer”)
1989: Vol. 4/1-2 (Jan-Feb), 6 (Jun)
1990: Vol. 2/3 (Jan), 5 (Mar), 7-12 (May-Oct); Vol. 3/1-2 (Nov-Dec/Jan)
1991: Vol. 3/3-5 (Feb-Apr), 7-8 (Jun-Jul), 10-12 (Sep-Nov); Vol. 4/1 (Dec/Jan)
1992: Vol. 4/2-4/5 (Feb-Jun), 7-11 (Aug-Dec)
1993: Vol. 5/1-6 (Feb-Jul), 9-11 (Oct-Dec)
1994: Vol. 6/1-11 (Feb-Dec)
1995: Vol. 7/1-11 (Feb-Dec)
1996: Vol. 8/1-11 (Feb-Dec)
1997: Vol. 9/1-11 (Feb-Dec)
1998: Vol. 10/1-11 (Feb-Dec)
1999: Vol. 11/1-11 (Feb-Dec/Jan)
2000: Vol. 12/1-11 (Feb-Dec/Jan)
2001: Vol. 13/1-11 (Feb-Dec/Jan)
2002: Vol. 14/1-11 (Feb- Dec/Jan)
2003: Vol. 15/1-10 (Feb-Nov) |
WESTDEUTSCHE SCHULZEITUNG – P-423
Germany
1961: Vol.70/10 (25.May) [Joachim-Ernst Berendt: Kinder dichten zu Jazzmusik] |
WESTERMANNS MONATSHEFTE – P-440
Germany
1979: #3 (Mar) [Joachim-Ernst Berendt: Jenseits von Beton und Hula-Hula: Hawaii]
#10 (Oct) [Joachim-Ernst Berendt: Zen und das moderne Japan]
1981: #1 (Jan) [Joachim-Ernst Berendt: Avantgarde im Aquarium, oder: Ist die Avantgarde am Ende?]
1982: #1 (Jan) [Joachim-Ernst Berendt: Cataract Canyon. Eine Wasser-Erfahrung auf dem Colorado-River] |
WESTJAZZ – P-805
Das deutsche Jazz-Nachrichtenblatt
1958: Vol. 4/32-37 (Apr-Sep), 39 (Nov)
1959: Vol. 4/41-42 (Mar-Apr) |
THE WHEEL – P-915
(A Record Collector‘s Rag)
USA
1948: Vol. 1/2 (Jun) |
WHISKEY, WOMEN, AND… P-916
USA
1982: #9 (Jul)
1984: #14 (Jun) |
WINDPLAYER – P-795
(For Woodwind and Brass Musicians)
USA
1992: Vol. 9/4 |
THE WIRE – P-424
England
1982: #1-2 (Summer, Winter)
1983: #3-5 (Spring-Autumn)
1984: #6-10 (Spring-Dec)
1985: #11-16 (Jan-Jun), 18-22 (Aug-Dec)
1986: #23-34/35 (Jan-Dec/Jan)
1987: #36-46/47 (Feb-Dec/Jan)
1988: #48-58/59 (Feb-Dec/Jan)
1989: #60-70/71 (Feb-Dec/Jan)
1990: #72-82/83 (Feb-Dec/Jan)
1991: #84-94/95 (Feb-Dec/Jan)
1992: #96-106/107 (Feb-Dec/Jan)
1993: #108-118/119 (Feb-Dec/Jan)
1994: #118-130 (Feb-Dec)
1995: #131-142 (Jan-Nov); Sonderheft “Sonic Youth and the Noise of New York”
1996: #143-154 (Jan-Dec)
1997: #155-166 (Jan-Dec)
1998: #167-178 (Jan-Dec)
1999: #179-191 (Jan-Dec)
2000: #192-202 (Jan-Dec)
2001: #203-214 (Jan-Dec)
2002: #215-226 (Jan-Dec)
2003: #227-238 (Jan-Dec)
2004: #239-250 (Jan-Dec)
2005: #251-262 (Jan-Dec)
2006: #263-274 (Jan-Dec)
2007: #275-286 (Jan-Dec)
2008: #287-298 (Jan-Dec)
2009: #299-310 (Jan-Dec)
2010: #311-322 (Jan-Dec)
2011: #323-334 (Jan-Dec)
2012: #335-346 (Jan-Dec)
2013: #347-358 (Jan-Dec)
2014: #359-370 (Jan-Dec)
2015: #371-382 (Jan-Dec)
2016: #383-394 (Jan-Dec)
2017: #395-406 (Jan-Dec)
2018: #407-418 (Jan-Dec)
2019: #419-430 (Jan-Dec)2020: #431-442 (Jan-Dec)
2021: #443-448 (Jan-Jun) |
WOM Journal – P-743
(Germany)
1996: #1-12 (Jan-Dec)
1997: #1-4,6-10,12 (Jan-Apr, Jun-Dec)
1998: #1-12 (Jan-Dec)
1999: #1-12 (Jan-Dec)
2000: #1-12 (Jan-Dec)
2001: #1-12 (Jan-Dec)
2002: #1-11 (Jan-Dec)
2003: #1-11 (Jan-Dec)
2004: #1 (Jan) |
WOMEN’S JAZZ ARCHIVE NEWSLETTER – P-934
England
1995: Spring/Summer |
WORDS ABOUT MUSIC – P-495
Newsletter of the National Academy of Popular Music
USA
1991: Summer/Fall
1992: Winter/Spring |
WORLD MUSIC – P-491
Italy
1991: Vol. 1/1-3 (Jan/Feb-May/Jun)
1992: Vol. 2/8 (Mar/Apr) |
WORLD OF MUSIC, The – P-425
Germany
1967: Vol. 9/1-4
1968: Vol. 10/1-4
1969: Vol. 11/1-4
1970: Vol. 12/1-4
1971: Vol. 13/1-4
1972: Vol. 14/1-4 |
WOZ – P-1134
Switzerland
2003: #1 (Music) |
XSOUND – P-1021
Germany
2005: #3 |
ZEIT MAGAZIN – P-426
Germany
1973: #48 (23.Nov)
1983: #46-47 (11.Nov-18.Nov)
1990: #36 (31.Aug)
1991: #18 (26.Apr)
1992: #43 (16.Oct) |
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK – P-780
Germany
1940: Vol. 107/8 (Aug)
1942: Vol. 109/1 (Jan) |
ZEITWENDE – P-427
Die neue Furche
Germany
1957: Vol. 28/1 (Jan) [Joachim-Ernst Berendt: Der Einbruch des Technischen in die Musik]
1963: Vol. 34/7 (Jul) [Joachim-Ernst Berendt: Das Spiritual in seiner und in unserer Welt] |
ZfMP – P-428
Zeitschrift für Musikpädagogik
Germany
1981: Vol. 6/13 (Mar) [Walter Gieseler/Bernd Hoffmann: Interview mit Musikern des “Le Nouveau Salon”. Salonmusik – Vom Tabu bedrohtes Musikgenre; Ekkehard Kreft: Interview mit Hugo Strasser]
1987: Vol. 12/38 (Jan) [Bernd Hoffmann: Zur Frühgeschichte afro-amerikanischer Musik in Deutschland. “Jazz” am Frankfurter Sender] |
ZIGZAG – P-429
England
1974: Vol. 4/2 (Feb)
1980: #103
1981: #1 |
ZOUNDS – P-454
Germany
1992: #4 (Apr) |
ZPRAVODAJ PRO CLENY JAZZKLUBU BRNO – P-1043
Czech Republic
1959: 1 issue (unnumbered)
1960: 1 issue (unnumbered) |
ZPRAVODAJ – P-552
Czech Republic
list of content for #41-60
1993: #67 (16.Apr), #70 (21.Sep)
1994: #75 (14.Nov.) |
5/4 Magazine – P-955
Exploring Jazz from Mainstream to Offbeat
USA
1996: Jun |
217 PLUS –P-1046
Sal. Oppenheim
Germany
2006: Vol. 8 (Sep) |

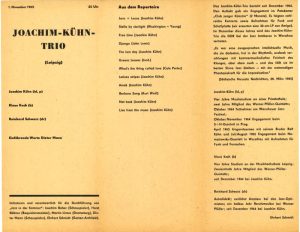
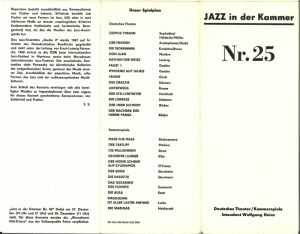

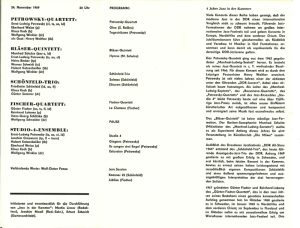








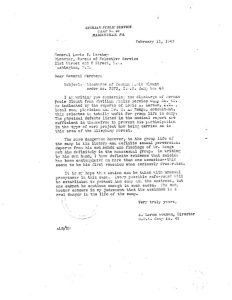




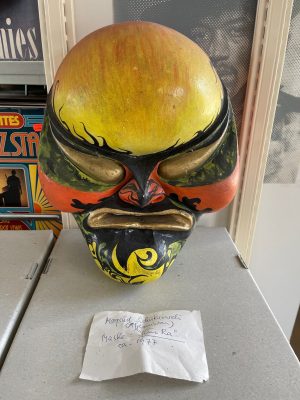
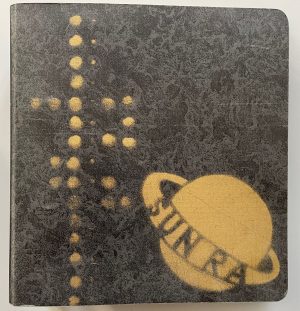







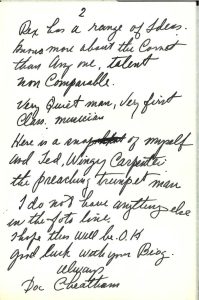
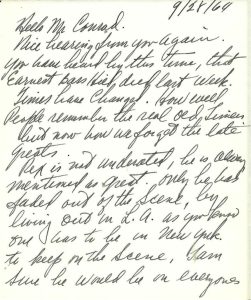
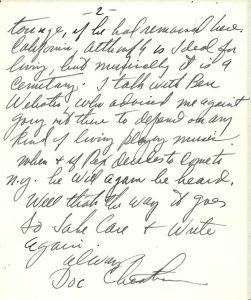


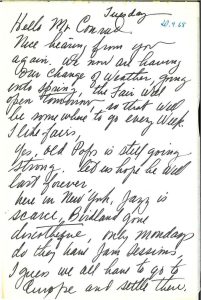
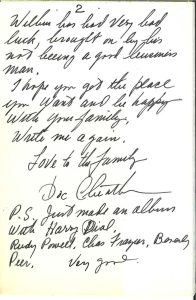


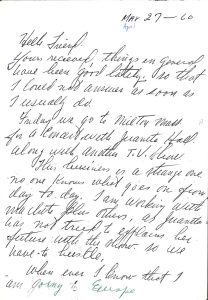

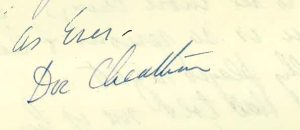
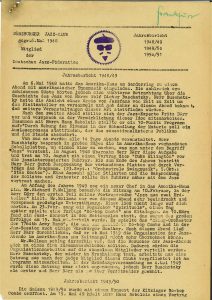
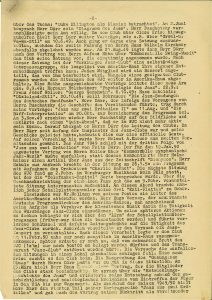
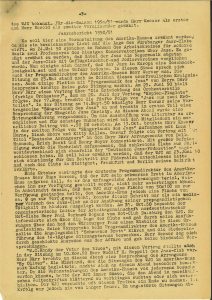
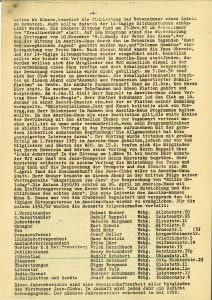
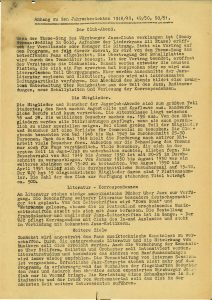

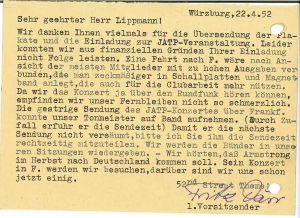
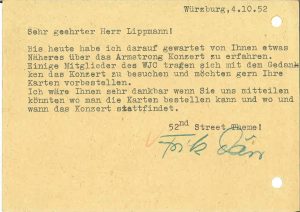
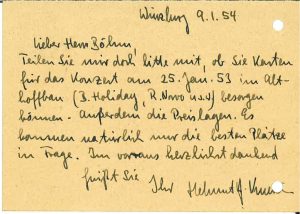


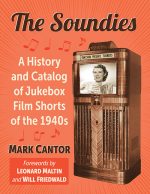 Es gibt im Bereich der populären Musik eine Art Grundlagenforschung, die sich erheblich von der Klassifikation klassische Musik unterscheidet. Diskographen haben über Jahrzehnte hinweg die Aufnahmen von Jazzmusikern kartiert, Datum, Ort, Studio, Zeit, Besetzungen, Besetzungswechsel, einzelne Takes (mit Nummern), veröffentlichte Takes (mit Nummern) und vieles mehr recherchiert. All das ist (neben der Musik, neben Interviews, neben Analysen, neben Kontextbeschreibungen) eine wichtige Basis dafür, was wir über die Geschichte der populären Musik wissen. Eine ähnliche Grundlagenforschung gibt es auch für den Film, und im Bereich des Musikfilms gilt Mark Cantor als einer der größten Kenner. Jetzt hat er einen Teil seines Wissens in einem opulenten Band zusammengefasst, “The Soundies”, der sich einer speziellen Art von Kurzfilmen widmet, die in den 1940er Jahren populär wurden. 1940 nämlich wurde in New York die erste Video-Jukebox vorgestellt, ein Gerät, das auf Münzeinwurf ausgewählte musikalische Kurzfilme zeigte, Drei-Minuten-Filmchen, die eigens für diese Geräte produziert worden waren mit oft populären Namen des damaligen Musikgeschäfts.
Es gibt im Bereich der populären Musik eine Art Grundlagenforschung, die sich erheblich von der Klassifikation klassische Musik unterscheidet. Diskographen haben über Jahrzehnte hinweg die Aufnahmen von Jazzmusikern kartiert, Datum, Ort, Studio, Zeit, Besetzungen, Besetzungswechsel, einzelne Takes (mit Nummern), veröffentlichte Takes (mit Nummern) und vieles mehr recherchiert. All das ist (neben der Musik, neben Interviews, neben Analysen, neben Kontextbeschreibungen) eine wichtige Basis dafür, was wir über die Geschichte der populären Musik wissen. Eine ähnliche Grundlagenforschung gibt es auch für den Film, und im Bereich des Musikfilms gilt Mark Cantor als einer der größten Kenner. Jetzt hat er einen Teil seines Wissens in einem opulenten Band zusammengefasst, “The Soundies”, der sich einer speziellen Art von Kurzfilmen widmet, die in den 1940er Jahren populär wurden. 1940 nämlich wurde in New York die erste Video-Jukebox vorgestellt, ein Gerät, das auf Münzeinwurf ausgewählte musikalische Kurzfilme zeigte, Drei-Minuten-Filmchen, die eigens für diese Geräte produziert worden waren mit oft populären Namen des damaligen Musikgeschäfts. Hans Reichel, ein Name, der in Jazzkreisen irgendwie nachhalt – Wuppertaler Free-Jazz-Szene, FMP, Instrumentenerfinder, Daxophon ¬–, ohne dass man dabei viel von der Musik im Ohr hat. Klangabenteuer, sound research, genremäßig oder stilistisch schwer zuordbar. Seine Musik werde schon mal in die “New-Age-Kiste” gesteckt, lacht Reichel im Gespräch mit Markus Müller 1991, er sei innerhalb der FMP “immer ein Kuckuksei” gewesen.
Hans Reichel, ein Name, der in Jazzkreisen irgendwie nachhalt – Wuppertaler Free-Jazz-Szene, FMP, Instrumentenerfinder, Daxophon ¬–, ohne dass man dabei viel von der Musik im Ohr hat. Klangabenteuer, sound research, genremäßig oder stilistisch schwer zuordbar. Seine Musik werde schon mal in die “New-Age-Kiste” gesteckt, lacht Reichel im Gespräch mit Markus Müller 1991, er sei innerhalb der FMP “immer ein Kuckuksei” gewesen. Mit 53 Jahren die eigene Autobiographie veröffentlichen? Macht Sinn, wenn man viel zu erzählen hat. Und Brad Mehldau, der seit Mitte der 1990er Jahre weit über die Jazzszene hinaus erfolgreich war, hat viel zu erzählen. Seine Autobiographie (erster Teil!) ist dabei weit mehr geworden als eine Musikererinnerung. Mehldau selbst, der deutsche Literatur und Philosophie liebt, beschreibt seine Herangehensweise lieber als “Bildungsroman”; stellenweise mag maan allerdings auch an eine Therapiesitzung denken: so ehrlich wie möglich, so schonungslos wie möglich, immer reflektierend, welche Auswirkungen die Entscheidungen, die er zu verschiedenen Zeiten trifft, auf sein weiteres Leben hatten.
Mit 53 Jahren die eigene Autobiographie veröffentlichen? Macht Sinn, wenn man viel zu erzählen hat. Und Brad Mehldau, der seit Mitte der 1990er Jahre weit über die Jazzszene hinaus erfolgreich war, hat viel zu erzählen. Seine Autobiographie (erster Teil!) ist dabei weit mehr geworden als eine Musikererinnerung. Mehldau selbst, der deutsche Literatur und Philosophie liebt, beschreibt seine Herangehensweise lieber als “Bildungsroman”; stellenweise mag maan allerdings auch an eine Therapiesitzung denken: so ehrlich wie möglich, so schonungslos wie möglich, immer reflektierend, welche Auswirkungen die Entscheidungen, die er zu verschiedenen Zeiten trifft, auf sein weiteres Leben hatten. Es gibt mittlerweile einige Lokalgeschichten des Jazz, Publikationen, die sich etwa den Aktivitäten eines Clubs oder einer lokalen bzw. regionalen Szene widmen. Für Viersen am Niederrhein haben jetzt Paul Eßer und Torsten Eßer ein Buch vorgelegt, das zwar nicht die Jazzgeschichte der Stadt beschreibt, aber Persönlichkeiten, die das gesellschaftliche und kulturelle Leben Viersens prägten. Als Jazzer und Nicht-Viersener fallen einem vielleicht vor allem zwei ein, die es natürlich auch ins Buch geschafft haben: der Bassist, Moderator und Konzertveranstalter Ali Haurand sowie der Trompeter Till Brönner. Zwei weitere, nämlich Thomas Kessler und Monika Linges, sorgen für einen dann doch ganz guten Jazzer-Schnitt bei insgesamt knapp über 40 Portrait-Kapiteln.
Es gibt mittlerweile einige Lokalgeschichten des Jazz, Publikationen, die sich etwa den Aktivitäten eines Clubs oder einer lokalen bzw. regionalen Szene widmen. Für Viersen am Niederrhein haben jetzt Paul Eßer und Torsten Eßer ein Buch vorgelegt, das zwar nicht die Jazzgeschichte der Stadt beschreibt, aber Persönlichkeiten, die das gesellschaftliche und kulturelle Leben Viersens prägten. Als Jazzer und Nicht-Viersener fallen einem vielleicht vor allem zwei ein, die es natürlich auch ins Buch geschafft haben: der Bassist, Moderator und Konzertveranstalter Ali Haurand sowie der Trompeter Till Brönner. Zwei weitere, nämlich Thomas Kessler und Monika Linges, sorgen für einen dann doch ganz guten Jazzer-Schnitt bei insgesamt knapp über 40 Portrait-Kapiteln.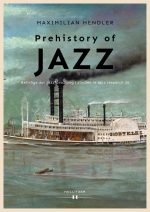 This groundbreaking monograph analyses the prehistory of jazz, from Portuguese exploration of the New World in the 15th century to the 1920s. It’s one of the Studies in Jazz Research – most of them not translated into English – published since 1969 by the International Society for Jazz Research, based at the Institute for Jazz Research at Graz’s University of Music and Performing Arts. Maximilian Hendler, born 1939, is an expert in Byzantine and Slavic Studies, and Indo-European languages, and was a member of the Graz Institute until 2002. The development of jazz has become his primary area of research.
This groundbreaking monograph analyses the prehistory of jazz, from Portuguese exploration of the New World in the 15th century to the 1920s. It’s one of the Studies in Jazz Research – most of them not translated into English – published since 1969 by the International Society for Jazz Research, based at the Institute for Jazz Research at Graz’s University of Music and Performing Arts. Maximilian Hendler, born 1939, is an expert in Byzantine and Slavic Studies, and Indo-European languages, and was a member of the Graz Institute until 2002. The development of jazz has become his primary area of research. “Die DDR war sozusagen ein Jazzklubland”, beginnt Martin Breternitz sein aus einer Dissertation an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar entstandenes Buch. Etwa 60 solcher Clubs gab es in den 1980er Jahren, erklärt er, sie alle drückten letzten Endes ein Bedürfnis danach aus, “(…) sich mit Jazzkultur individuell und zeitgleich in selbstgewählter Gemeinschaft in bezug zu eigenen Lebensvorstellungen in der DDR zu beschäftigen”. Klingt kompliziert? Der Fokus auf die Region erleichtert das Verständnis ganz enorm.
“Die DDR war sozusagen ein Jazzklubland”, beginnt Martin Breternitz sein aus einer Dissertation an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar entstandenes Buch. Etwa 60 solcher Clubs gab es in den 1980er Jahren, erklärt er, sie alle drückten letzten Endes ein Bedürfnis danach aus, “(…) sich mit Jazzkultur individuell und zeitgleich in selbstgewählter Gemeinschaft in bezug zu eigenen Lebensvorstellungen in der DDR zu beschäftigen”. Klingt kompliziert? Der Fokus auf die Region erleichtert das Verständnis ganz enorm. John Coltrane spielt an jedem 17. des Monats von 18 bis 21 Uhr!
John Coltrane spielt an jedem 17. des Monats von 18 bis 21 Uhr!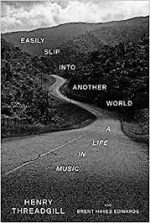 “Easily Slip Into Another World” war der Titel eines Albums, das Saxophonist Henry Threadgill mit seinem Sextett 1986 einspielte. Es zeigt einen Musiker, dessen Arbeit von improvisatorischer Risikobereitschaft genauso geprägt ist wie von einer klaren kompositorischen Vorstellung. Threadgill ist nicht unbedingt ein Household-Name des Jazz, obwohl er jede Menge bedeutender Preise erhalten hat, darunter den Jazz Master des National Endowment for the Arts und den Pulitzer Preis für Musik. Musiker:innen bewundern ihn unter anderem als ideenreichen Komponisten und klaren Konzeptionalisten. Nun also hat Threadgill seine Autobiographie vorgelegt, und diese ist weit mehr als ein Buch über Musik.
“Easily Slip Into Another World” war der Titel eines Albums, das Saxophonist Henry Threadgill mit seinem Sextett 1986 einspielte. Es zeigt einen Musiker, dessen Arbeit von improvisatorischer Risikobereitschaft genauso geprägt ist wie von einer klaren kompositorischen Vorstellung. Threadgill ist nicht unbedingt ein Household-Name des Jazz, obwohl er jede Menge bedeutender Preise erhalten hat, darunter den Jazz Master des National Endowment for the Arts und den Pulitzer Preis für Musik. Musiker:innen bewundern ihn unter anderem als ideenreichen Komponisten und klaren Konzeptionalisten. Nun also hat Threadgill seine Autobiographie vorgelegt, und diese ist weit mehr als ein Buch über Musik. Im Wolke Verlag ist soeben “Serendipity. Jürgen Wuchners Kompositionen” erschienen, ein großformatiges Buch, das die Kompositionen des im Mai 2000 verstorbenen Darmstädter Bassisten und Komponisten Jürgen Wuchner würdigt. Wuchners Witwe Monika Schießer-Wuchner hat den Band herausgegeben, dessen erste Hälfte Erinnerungen von Musikerkollegen wie Rudi Mahall, Uli Partheil, Ole Heiland, Valentin Garvie, Christopher Dell, Bob Degen, Karl Berger, Wollie Kaiser, Thomas Cremer, Wolfgang Puschnig, Bülent Ates, Jörg Fischer und Christof Thewes enthält.
Im Wolke Verlag ist soeben “Serendipity. Jürgen Wuchners Kompositionen” erschienen, ein großformatiges Buch, das die Kompositionen des im Mai 2000 verstorbenen Darmstädter Bassisten und Komponisten Jürgen Wuchner würdigt. Wuchners Witwe Monika Schießer-Wuchner hat den Band herausgegeben, dessen erste Hälfte Erinnerungen von Musikerkollegen wie Rudi Mahall, Uli Partheil, Ole Heiland, Valentin Garvie, Christopher Dell, Bob Degen, Karl Berger, Wollie Kaiser, Thomas Cremer, Wolfgang Puschnig, Bülent Ates, Jörg Fischer und Christof Thewes enthält. Lena Rudecks Studie über westalliierte Offiziers- und Soldatenclubs in Deutschland in den Jahren 1945-1955 füllt eine Lücke. Konkreter und ganz persönlich: Ich klage oft genug in Gesprächen über die westdeutsche Nachkriegsgeschichte des Jazz, dass bislang niemand sich eingehend mit den “Amiclubs” auseinandergesetzt hat, also dokumentiert hat, zu welchen Konditionen, unter welchen Bedingungen deutsche Musiker:innen nach dem Krieg in den GI-Clubs Süddeutschlands arbeiteten. Was es ihnen brachte, ist gut dokumentiert: Jeder Musiker, jede Musikerin, die in den 1940er bis 1960er Jahren sozialisiert wurde, berichtet ja von seinen (ihren) GI-Club-Erfahrungen. Aber wie diese Arbeit tatsächlich aussah, warum überhaupt so viele deutsche Musiker:innen in diesen Orten auftraten, wie die amerikanische (oder britische oder französische) Besatzung dazu stand und was sie überhaupt mit der Unterhaltung ihrer Truppen bezweckte, darüber gab es bislang vor allem verstreute Berichte, Vermutungen, Hinweise.
Lena Rudecks Studie über westalliierte Offiziers- und Soldatenclubs in Deutschland in den Jahren 1945-1955 füllt eine Lücke. Konkreter und ganz persönlich: Ich klage oft genug in Gesprächen über die westdeutsche Nachkriegsgeschichte des Jazz, dass bislang niemand sich eingehend mit den “Amiclubs” auseinandergesetzt hat, also dokumentiert hat, zu welchen Konditionen, unter welchen Bedingungen deutsche Musiker:innen nach dem Krieg in den GI-Clubs Süddeutschlands arbeiteten. Was es ihnen brachte, ist gut dokumentiert: Jeder Musiker, jede Musikerin, die in den 1940er bis 1960er Jahren sozialisiert wurde, berichtet ja von seinen (ihren) GI-Club-Erfahrungen. Aber wie diese Arbeit tatsächlich aussah, warum überhaupt so viele deutsche Musiker:innen in diesen Orten auftraten, wie die amerikanische (oder britische oder französische) Besatzung dazu stand und was sie überhaupt mit der Unterhaltung ihrer Truppen bezweckte, darüber gab es bislang vor allem verstreute Berichte, Vermutungen, Hinweise.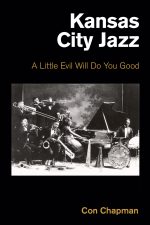 Eines Morgens, beginnt Con Chapman sein Buch über Jazz in Kansas City, hörte Bill Basie, der gerade mit einer Revuetruppe in Tulsa, Oklahoma, war, Musik, von der er dachte, sie käme von einer Schallplatte. Aber nein, es war eine Band, die auf einem Lastwagen spielte, um Werbung für ihren Gig am selben Abend zu machen. Es waren die Blue Devils, und sie waren sein erster Kontakt nach Kansas City.
Eines Morgens, beginnt Con Chapman sein Buch über Jazz in Kansas City, hörte Bill Basie, der gerade mit einer Revuetruppe in Tulsa, Oklahoma, war, Musik, von der er dachte, sie käme von einer Schallplatte. Aber nein, es war eine Band, die auf einem Lastwagen spielte, um Werbung für ihren Gig am selben Abend zu machen. Es waren die Blue Devils, und sie waren sein erster Kontakt nach Kansas City. Sie versuche Konferenzen zu vermeiden, bei denen sie eingeladen werde, um über “Frauen im Jazz” zu sprechen, sagte die amerikanische Musikwissenschaftlerin Sherrie Tucker einmal in Darmstadt. Wann immer sie auf das Thema angesprochen werde, betone sie, dass, wer auch immer sich mit Frauen im Jazz befasse, sich mindestens gleichermaßen mit Diversität im Jazz befassen müsse. Nach Darmstadt brachte Tucker damals, im Jahr 2015, eine Konferenz, die das Jazzinstitut unter dem Titel “Gender and Identity” abgehalten hatte und deren Buchpublikation durchaus wegweisend war, weil sie eben über das reine “Frauenthema” hinausblickte. Zuvor hatte es zwar einige Bücher gegeben, die sich “women in jazz” widmeten, auch immerhin eines, dass sich dem Thema der Homosexualität annahm – dann aber gleich in der gesamten populären Musik. Jetzt haben James Reddan, Monika Herzig und Michael Kahr ein dickes Kompendium herausgebracht, dass sich zumindest ansatzweise an die gesamte Bandbreite von “Jazz and Gender” heranwagt.
Sie versuche Konferenzen zu vermeiden, bei denen sie eingeladen werde, um über “Frauen im Jazz” zu sprechen, sagte die amerikanische Musikwissenschaftlerin Sherrie Tucker einmal in Darmstadt. Wann immer sie auf das Thema angesprochen werde, betone sie, dass, wer auch immer sich mit Frauen im Jazz befasse, sich mindestens gleichermaßen mit Diversität im Jazz befassen müsse. Nach Darmstadt brachte Tucker damals, im Jahr 2015, eine Konferenz, die das Jazzinstitut unter dem Titel “Gender and Identity” abgehalten hatte und deren Buchpublikation durchaus wegweisend war, weil sie eben über das reine “Frauenthema” hinausblickte. Zuvor hatte es zwar einige Bücher gegeben, die sich “women in jazz” widmeten, auch immerhin eines, dass sich dem Thema der Homosexualität annahm – dann aber gleich in der gesamten populären Musik. Jetzt haben James Reddan, Monika Herzig und Michael Kahr ein dickes Kompendium herausgebracht, dass sich zumindest ansatzweise an die gesamte Bandbreite von “Jazz and Gender” heranwagt. This is a listing of jazz periodicals in our collection. Our extensive periodical collection comprises more than 80,000 issues of some 1,100 jazz periodicals. A major part of these periodicals have been indexed in our
This is a listing of jazz periodicals in our collection. Our extensive periodical collection comprises more than 80,000 issues of some 1,100 jazz periodicals. A major part of these periodicals have been indexed in our