[:de]The Sound of a City? New York und Bebop 1941-1949
von Jan Bäumer
Münster 2014 (Waxmann)
384 Seiten, 39,90 Euro
ISBN: 978-3-8309-2963-5
 Der Jazz war von Anbeginn an eine Musik der Stadt. Zentren wie New Orleans, Chicago, Kansas City, vor allem aber New York prägten seine Entwicklung; zugleich prägte aber auch der Jazz die Erfahrung solcher Städte. Jan Bäumer hat für seine Dissertation ein Musterbeispiel dieser Wechselwirkung herausgegriffen und untersucht, wie der Bebop gerade in New York entstehen konnte, wie er zugleich in den 1940er Jahren (und darüber hinaus) das kulturelle Erlebnis dieser Stadt maßgeblich prägte.
Der Jazz war von Anbeginn an eine Musik der Stadt. Zentren wie New Orleans, Chicago, Kansas City, vor allem aber New York prägten seine Entwicklung; zugleich prägte aber auch der Jazz die Erfahrung solcher Städte. Jan Bäumer hat für seine Dissertation ein Musterbeispiel dieser Wechselwirkung herausgegriffen und untersucht, wie der Bebop gerade in New York entstehen konnte, wie er zugleich in den 1940er Jahren (und darüber hinaus) das kulturelle Erlebnis dieser Stadt maßgeblich prägte.
Im Vorwort erklärt Bäumer die Komplexität des Forschungsgegenstands, da man Jazz nicht nur als musikalische, sondern auch als kulturelle und soziale Praxis begreifen müsse und es daher die Aufgabe seines musikgeographischen Ansatzes sei, diese verschiedenen Sichtweisen herauszuarbeiten und miteinander zu verknüpfen. Er thematisiert die zur Verfügung stehenden Quellen, mündliche Zeitzeugenberichte, Musikaufnahmen und zeitgenössische Presseberichte. Dann beschreibt er die Vorbedingungen für die Entstehung des Bebop, wobei er bereits hier die Funktion von Ort als geographische, soziale und damit auch ästhetische Dimension diskutiert. Er unterscheidet zwischen “hearth” und “stages”, also weitgehend isolierten bzw. privaten Experimentier- und öffentlichen Aufführungsräumen, und erklärt die Attraktivität einer so diversen Metropole wie New York für Musiker ganz allgemein. New York war Anfang der 1940er Jahre bereits Medienhauptstadt, besaß in Harlem eine kreative afro-amerikanische Community, zugleich ein großes Netz von Veranstaltungsorten, war außerdem im 20sten Jahrhundert im wahrsten Sinne des Wortes die “Stadt, die niemals schläft”.
Im nächsten Kapitel legt Bäumer die Lupe an seinen Untersuchungsgegenstand. Er beschreibt die “hearths”, die Experimentierorte für Jazz, beleuchtet beispielsweise die Gemeinde um Minton’s Playhouse, fragt nach der Funktion dieses Clubs für die Bebop-Musiker und beschreibt die in Aufnahmen dokumentierte Musik dieser Zeit, rhythmische, harmonische und improvisatorische Neuerungen, die sich aus ihnen ablesen lassen. Dieselbe Abfolge an Fragen und Beschreibungen lässt er Monroe’s Uptown House angedeihen, aber auch anderen Experimentierorten wie der privaten Wohnung oder der Bigband.
Im dritten Kapitel beschreibt Bäumer die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Entwicklung des Jazz. Er nennt die Transportbeschränkungen, die Tourneen immer schwieriger machten, die Wehrpflicht, die den Bigbands ihre besten Musiker entriss, schreibt über die Auswirkungen des Kriegs auf die Wahrnehmung des amerikanischen Alltagsrassismus und nennt New York in diesem Zusammenhang einen “Karrierehelfer” für viele der Musiker.
Die öffentlichen Bühnen unterscheiden sich von den “hearths” durch ihre Sichtbarkeit auf dem Markt des Unterhaltungsgeschäfts. Bäumer blickt auf die 52nd Street, auf der vor allem kleine Ensembles zu hören waren, beschreibt die ersten organisierten Jam Sessions, die nicht so sehr als Experimentierplattform fungierten, sondern als besonderes Erlebnis fürs Publikum, schaut etwas näher auf den Onyx Club, in dem 1943 mit Dizzy Gillespies und Oscar Pettifords Band die “erste Bebop-Gruppe” auftrat und nimmt sich dann analytisch dem Repertoire und der Spielweise des Bebop an. Ein neues Selbstverständnis hätten sie alle entwickelt, schreibt er, quasi ein neues Kapitel des Jazz aufgeschlagen. Er nennt die Billy Eckstine Band “stage” und “hearth” in einem und fragt danach, wie schnell sich der “neue Sound” des Bebop in New York ausbreitete. Als besonders wichtigen öffentlichen Raum identifiziert er den Schallplattenmarkt, beschreibt den Aufnahmebann von 1942 bis 1944, erklärt, warum es Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre zur Gründung unabhängiger Plattenlabels kam und wie wichtig diese gerade für die Entwicklung des Bebop waren. Er vollzieht nach, wie Charlie Parker und Dizzy Gillespie im Three Deuces auftraten, das Konzerte in der New Yorker Town Hall den Schritt in den Konzertsaal bedeuteten und damit auch Symbol eines gesellschaftlichen Aufstiegs darstellten.
Kapitel 5 widmet sich den “musikalischen Konturen des Bebop”. Er beschreibt das Repertoire des Stils, formale Usancen, die Verwendung von originalen Kompositionen oder Kontrafakten, die Bedeutung des Blues für den Stil; er erklärt die Funktion knapper Arrangements, melodische Besonderheiten, Phrasierung und Virtuosität, fixiert sich auf die Aufgabe der einzelnen Instrumente in der Rhythmusgruppe und die Interaktion aller, und er beschreibt die harmonischen Neuerungen der Zeit.
Im sechsten Kapitel widmet Bäumer sich den “außermusikalischen Konturen” dieser Musik, fragt, ob die Bebopper sich denn tatsächlich als “Außenseiter” verstanden, verweist auf Mode, Sprache, die zur Identität des modernen Jazzmusikers beitrugen, aber auch auf den in der Szene nicht unüblichen Drogenkonsum. Er verweist kurz darauf, dass auch außerhalb New Yorks kreative Musik stattfand, diskutiert die Ausflüge New Yorker Musiker an die Westküste und was sie dort (musikalisch) vorfanden. Die Auftritte Charlie Parkers und Dizzy Gillespies in der Carnegie Hall mögen ein Karrierehöhepunkt für beide gewesen sein; parallel begann bereits der Niedergang der 52nd Street. Ab 1950 hielt eigentlich nur noch das Birdland die Fahne des Bebop hoch.
Zum Schluss geht Bäumer auf die Rezeption des Stils ein, diskutiert die Kontroversen zwischen Traditionalisten und Modernisten, untersucht die mediale Darstellung des Bebop, und fragt danach, inwieweit der Stil eher ein Minderheitenpublikum angesprochen hat bzw. wie er vom Massenpublikum wahrgenommen wurde. Tatsächlich habe sich in diesen Jahren eine Art neues Publikum herausgebildet, argumentiert er, und dieser “Insider”-Kreis sei der Urtyp des Jazzpublikums bis heute.
Jan Bäumers Studie ist gerade in der Verflechtung der verschiedenen Stränge, die in seinem Blickfeld liegen, bemerkenswert. Städtischer Raum und die Möglichkeiten die sich in ihm ergeben, Community als Initiator und zugleich Abnehmer künstlerischer Projekte, die Beschreibung der geografischen, sozialen und ästhetischen Diskurse, innerhalb derer diese Musik sich entwickeln konnte, all das bündelt er mit vielen Verweisen auf Primär- und Sekundärliteratur sowie analytischen Anmerkungen zur Besonderheit des Bebop. Ihm gelingt es dabei die Komplexität seines Themas ein wenig zu ordnen, den Fokus seiner Leser auf immer wieder andere Perspektiven zu lenken und damit die Entstehung und die Bedeutung dieses Stils in der und für die Jazzgeschichte ein wenig zu entmythologisieren.
Bäumers Buch ist eine musikwissenschaftliche Dissertation, aber auch für den musikalisch interessierten Laien gut zu lesen. Er verliert die verschiedenen Argumentationsstränge, die er über die Kapitel entwickelt, nicht aus den Augen und ermöglicht seinen Lesern an jeder Stelle mit frischem Blick auf die Musik und ihren Kontext zu blicken. “The Sound of a City?” beschreibt dabei am Ende tatsächlich den Sound einer Stadt und macht zugleich klar, dass “Sound” nie nur ein klangliches Phänomen ist, sondern immer aus dem Zusammenleben und Wirken von Menschen entsteht.
Wolfram Knauer (Juli 2018)
Jazz im Film. Beiträge zu Geschichte und Theorie eines intermedialen Phänomens
herausgegeben von Willem Strank & Claus Tieber
Münster 2014 (Lit Verlag)
246 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-643-50614-6
 Die Herausgeber dieses Bandes und Mitorganisatoren des Symposiums haben aus Referaten, die bei der Jahrestagung der Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung im Oktober 2011 gehalten wurden sowie weiterführenden Artikeln von Autoren, die in Kiel nicht dabei sein konnten, eine facettenreiche Dokumentation über die Funktion von Jazz im Film auf der einen Seite und seine Repräsentation auf der anderen Seite vorgelegt. In ihrer Einleitung verweisen sie auf die verschiedenen Situationen, in denen Jazz mit der Leinwand in Verbindung tritt, auf die Stummfilmbegleitung etwa, auf Musik-Kurz- und Animationsfilme, auf die Verbindung von Jazz und Experimentalfilmen, auf Dokumentar- und Konzertfilme, auf den Jazz im Live-Fernsehen, auf Jazz als Soundtrack, sowie auf Biopics und auf “Scenopics”, die die Jazzwelt als Thema nimmt.
Die Herausgeber dieses Bandes und Mitorganisatoren des Symposiums haben aus Referaten, die bei der Jahrestagung der Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung im Oktober 2011 gehalten wurden sowie weiterführenden Artikeln von Autoren, die in Kiel nicht dabei sein konnten, eine facettenreiche Dokumentation über die Funktion von Jazz im Film auf der einen Seite und seine Repräsentation auf der anderen Seite vorgelegt. In ihrer Einleitung verweisen sie auf die verschiedenen Situationen, in denen Jazz mit der Leinwand in Verbindung tritt, auf die Stummfilmbegleitung etwa, auf Musik-Kurz- und Animationsfilme, auf die Verbindung von Jazz und Experimentalfilmen, auf Dokumentar- und Konzertfilme, auf den Jazz im Live-Fernsehen, auf Jazz als Soundtrack, sowie auf Biopics und auf “Scenopics”, die die Jazzwelt als Thema nimmt.
Claus Tieber diskutiert das Phänomen der Improvisation in Jazz und Film und inwieweit sich diese aufeinander beziehen können. Andrea Oberheiden-Brent beleuchtet Al Jolsons Blackface-Maske in “The Jazz Singer” und anderen Filmen, die sie nicht allen als Bezug auf Black Minstrelsy sieht, sondern darin auch den Versuch erkennt jüdische Identität aufrecht zu erhalten. Lena Christolova untersucht, wie man rassistische Klischees, die sich in den Jazz-Cartoons mit Betty Boop finden, anders lesen könne, nämlich, wie sie schreibt, als ein Argument im Diskurs der Zeit, das “das Problem ethnischer Stereotypen längst spielerisch gelöst” habe.
Moritz Panning betrachtet den deutschen Revuefilm “Kora Terry” von 1940 und ordnet die Filmmusik Peter Kreuders in die ästhetische Diskussion des Nationalsozialismus über Jazz und eine vom System normierte deutsche Unterhaltungsmusik ein. Wolfgang Thiel sieht Spielfilme der DEFA aus den 1950er bis 1970er Jahren mit dem spezifischen Fokus auf Jazzszenen sowie die Verwendung von Jazzelementen in der Filmmusik an, beschreibt dabei auch, wie in den 1970ern die Beat- bzw. Rockmusik die Funktion des Jazz übernahm, eine “gewünschte optimistische Grundhaltung im sozialistischen Alltag zu ‘benennen’ und hierbei insbesondere das Lebensgefühl der Jugend anzusprechen”.
Hanna Walsdorf diskutiert Otto Premingers “Bonjour Tristesse” von 1957 mit einem speziellen Fokus auf mit Jazz eng verbundene Tanzszenen. Irene Kletschke beschreibt die Haltung etlicher Hollywood-Biopics am Beispiel der “Glenn Miller Story”. Max Annas diskutiert die Modellhaftigkeit des afro-amerikanischen Jazz für die südafrikanische Freiheitsbewegung, aber auch die Rolle, die dieser Musik etwa in Lionel Rogosins Film “Come Back, Africa” von 1959 oder im amerikanisch-südafrikanisch-deutschen Dokumentarfilm “Drum” von 1994 zukommt, in dem der Jazz mehr als “Soundtrack und Quelle bunter Bilder” verwandt, seine Funktion innerhalb der Freiheitsbewegung aber wenig Rechnung getragen werde. Andreas Münzmay beleuchtet die Interaktion zwischen Musik, Handlung und filmischer Dramaturgie in John Cassavetes’ “Shadows” von 1959, beschreibt, wie der Regisseur Musik als “‘musikalische’ Bild- oder Sprachmotive einsetzte”, und diskutiert improvisatorische Momente des Soundtracks, für den Cassavetes, bevor er Charles Mingus engagierte, eigentlich Miles Davis im Blick gehabt hatte.
Frank-Dietrich Neidel versucht Ähnlichkeiten in der Entwicklung des Bebop und Luc Godards Film “À bout de souffle” von 1959 aufzuzeigen, verweist dabei etwa auf dem “Sprung aus der Tradition und die ästhetischen Konsequenzen”, auf eine neue Rhythmik sowie auf Themen wie melodische Kompexität oder Nachvollziehbarkeit. Konstantin Jahn untersucht den legendären Sun Ra-Film “Space Is the Place” von 1974 auf das Spiel mit den Film-Genres (Biopic, Blaxploitation, Science Fiction), aber auch auf musikalischen Momente (Call and Response, Riff, Inside-Outside etc.), die direkten Einfluss auf die filmische Umsetzung hatten. Willem Strank betrachtet die Filme “Ornette: Made in America” von 1985, “Cecil Taylor – All the Notes” von 2004 sowie “Brötzmann” von 2011 und diskutiert zu welchen filmischen Umsetzungen die freie Improvisation der Protagonisten die jeweiligen Regisseure veranlasst hat.
Guido Heldt sieht “Step Across the Border” als einen Dokumentarfilm über Fred Frith, zugleich aber auch als einen Film “durch” Fred Frith, “der sich seine Strukturen und Muster (…) ausleiht und versucht, seinem Gegenstand nicht in der Draufsicht, sondern im Nachvollzug nahe zu kommen”. Sarah Greifenstein sieht Parallelen in den “episodischen Bewegungsmustern” in Woody Allens “You Will Meet a Tall Dark Stranger” und diskutiert die “Erfahrungsformen des Improvisierten” in der Musik und den Gesten des Films. Claudia Relota schließlich betrachtet die amerikanischen Fernsehserie “Treme” im Nachklang des Hurrikans Katrina und fragt dabei, inwieweit die Serie dem Anspruch “einer möglichst detaillierten und spezifischen Repräsentation der Musikkultur – dem Konzept des Authentischen in ‘Treme’ – im Format des Seriellen” gerecht wird, wie die Musik als “soziale Praxis zwischen musikalischen Traditionen” dargestellt wird und zugleich für eine “ungewöhnliche erzählerische Dichte” sorgt.
Als Tagungsband ist “Jazz im Film” sicher kein Einstiegsbuch über die unterschiedlichen Beziehungen zwischen den beiden vielleicht bedeutsamsten künstlerischen Entwicklungen des 20sten Jahrhunderts. Das Buch bietet aber gerade in der Verschiedenheit der Ansätze einen hervorragenden Einblick in die unterschiedlichen Facetten des Diskurses über Jazz im Film – ob als Soundtrack oder als Thema.
Wolfram Knauer (Dezember 2017)
Jackie McLean
von Guillaume Belhomme
Nantes 2014 (Lenka Lente)
117 Seiten, 11 Euro
ISBN: 978-2-9545845-4-6
 Jackie McLean war irgendwie zeitlebens ein “musicians’ musician”, ein Musiker, der unter Kollegen bekannt, beliebt und einflussreich war und doch außer einem Kennerpublikum eher mäßigen populären Erfolg hatte. In seiner Biographie spürt Guillaume Belhomme dem Leben und Schaffen des Saxophonisten nach, identifiziert Einflüsse auf ihn und erklärt die Bedeutung seines musikalischen Schaffens. Wie Sonny Rollins spielte McLean Ende der 1940er Jahre kurzzeitig mit dem Gedanken, vom Altsaxophon, das durch Charlie Parkers Wirken doch sehr vorbelastet war, auf ein anderes Instrument umzusteigen, und tatsächlich machte er, wie wir lernen, seine erste Aufnahme 1949 mit einer Rhythm-and-Blues-Band auf dem Baritonsaxophon.
Jackie McLean war irgendwie zeitlebens ein “musicians’ musician”, ein Musiker, der unter Kollegen bekannt, beliebt und einflussreich war und doch außer einem Kennerpublikum eher mäßigen populären Erfolg hatte. In seiner Biographie spürt Guillaume Belhomme dem Leben und Schaffen des Saxophonisten nach, identifiziert Einflüsse auf ihn und erklärt die Bedeutung seines musikalischen Schaffens. Wie Sonny Rollins spielte McLean Ende der 1940er Jahre kurzzeitig mit dem Gedanken, vom Altsaxophon, das durch Charlie Parkers Wirken doch sehr vorbelastet war, auf ein anderes Instrument umzusteigen, und tatsächlich machte er, wie wir lernen, seine erste Aufnahme 1949 mit einer Rhythm-and-Blues-Band auf dem Baritonsaxophon.
Belhomme erzählt von der Szene, in der McLean in jenen Jahren verkehrte, von McLeans Freundschaft zu den Brüdern Richie und Bud Powell, von der beängstigenden Präsenz Charlie Parkers und von der Tatsache, dass nicht nur McLean selbst sich laufend mit Bird vergleichen musste, sondern dass das auch die Kollegen um ihn herum taten. Er verfolgt Aufnahmen des Saxophonisten mit Miles Davis ab 1951, und er beleuchtet McLeans ersten Platten unter eigenem Namen seit 1955. 1959 wirkte McLean an der Theaterproduktion “The Connection” mit, für die Freddie Redd die Musik geschrieben hatte; daneben spielte er mit etlichen Größen des New Yorker Hardbop. Ab den Mitt-1960er Jahren engagierte er sich zudem in den ersten Bemühungen einer auf die breitere Bevölkerung gerichteten Jazzpädagogik, wirkte des weiteren auch bei politischen Aktivitäten der Bürgerrechtsbewegung mit. Er tat sich mit dem Trompeter Lee Morgan zusammen, hatte daneben aber auch ein Ohr für die freieren Spielformen der Zeit, wie er etwa im Album “New and Old Gospel” bewies, das er 1967 zusammen mit Ornette Coleman (an der Trompete) aufnahm. Er unterrichtete an der Hartford University und war in den 1970er Jahre immer wieder in Europa zu hören.
Belhommes Buch gibt in kurzen Kapitel die Fakten, nennt die Namen und Titel und ordnet McLeans Lebensstationen in die Entwicklungen der Zeit ein. Die Gründe, die für McLeans Engagement in der Jazzpädagogik eine Rolle spielten, werden höchstens gestreift und seine Heroinabhängigkeit gerade mal am Rande erwähnt. Nun mag man meinen, dass solche Aspekte nebensächlich seien, wo es doch in der Hauptsache um die Musik gehe, allerdings kommt Belhomme der Musik selbst auch nur selten wirklich nah. Und so bleibt sein Büchlein ein wenig an der Oberfläche. Für Liebhaber von McLeans Musik ist es allemal ein handliches Nachschlagewerk, dass es ermöglicht, die verschiedenen Alben des Saxophonisten einzuordnen – mehr aber auch nicht.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
An Unholy Row. Jazz in Britain and its Audience, 1945-1960
von Dave Gelly
Sheffield 2014 (equinox)
167 Seiten, 25 Britische Pfund
ISBN: 978-1-84563-712-8
 Dave Gelly ist Autor von Biographien etwa über Stan Getz und Lester Young, schreibt für britische Fachzeitschriften und Tageszeitungen und moderierte eine wöchentliche Rundfunksendung im BBC. Der Untertitel seines neuestes Buchs liest sich, als handele es sich dabei um eine soziologische Studie über “den Jazz in Großbritannien und sein Publikum” in der Nachkriegszeit. Tatsächlich besteht das Publikum, das Gelly meint, zu einem großen Teil auch aus britischen Musikern. Gelly berichtet von den unterschiedlichen Weisen, auf die diese mit dem Jazz in Berührung kamen, in Clubs und bei Tanzveranstaltungen, im Rundfunk, in der Armee, in halb-öffentlichen Expertenzirkeln oder bei Tourneen der amerikanischen Heroen, für die London allein der mangelnden Sprachbarriere wegen immer einer der ersten und wichtigsten Anlaufpunkte war.
Dave Gelly ist Autor von Biographien etwa über Stan Getz und Lester Young, schreibt für britische Fachzeitschriften und Tageszeitungen und moderierte eine wöchentliche Rundfunksendung im BBC. Der Untertitel seines neuestes Buchs liest sich, als handele es sich dabei um eine soziologische Studie über “den Jazz in Großbritannien und sein Publikum” in der Nachkriegszeit. Tatsächlich besteht das Publikum, das Gelly meint, zu einem großen Teil auch aus britischen Musikern. Gelly berichtet von den unterschiedlichen Weisen, auf die diese mit dem Jazz in Berührung kamen, in Clubs und bei Tanzveranstaltungen, im Rundfunk, in der Armee, in halb-öffentlichen Expertenzirkeln oder bei Tourneen der amerikanischen Heroen, für die London allein der mangelnden Sprachbarriere wegen immer einer der ersten und wichtigsten Anlaufpunkte war.
Dabei verfolgt Gelly etwa den Weg des jungen Humphrey Lyttelton zum Jazz, berichtet über Widerstände und Hingabe, über den Effekt von Louis Armstrongs Musik auch bei jenen Musikern, die ihn nicht 1931 bei seinen ersten Konzerten in London erlebt hatten, über die Vielfalt an Jazzsendungen im britischen Rundfunk der Nachkriegsjahre und über Repertoire und musikalische Ästhetik der ersten Bands, in denen Lyttelton mitwirkte. Jazz bedeutete damals vor allem Dixieland oder Swing; Bebop spielte in Lytteltons musikalischer Umgebung keine große Rolle.
Einen weiteren Blick wirft Gelly auf George Webb’s Dixielanders und auf Musiker, die unter traditionellem Jazz vor allem eine nicht-kommerzielle Musik verstanden. Gelly beschreibt, wie sich aus der Jazzszene der direkten Nachkriegszeit langsam eine Art Jugendkultur entwickelte, die zugleich die Klassenunterschiede der britischen Gesellschaft konterkarierte wie unterstrich. Viele der Konzerte fanden in Hinterzimmern von Gasthäusern oder Hotels statt, hatten einen Grassroots-Geschmack, den, wie Gelly schreibt, selbst noch die tourenden Jazzveteranen, die England in den 1960er Jahren heimsuchten, recht charmant fanden.
Mit dem Saxophonisten Johnny Dankworth stellt Gelly dieser Szene einen modernen Protagonisten gegenüber und beschreibt die kleine, verschworene Gemeinde von Bebop-Anhängern im Großbritannien der ausklingenden 1940er und 1950er Jahre. Dieser Stil, erklärt Gelly, war im Vergleich zum Jazz-Revival ein später Ankömmling, und der Kontrast zwischen beiden Stilen nicht nur musikalisch, sondern auch sozial. Für das Jazzrevival seien vor allem nicht-musizierende Fans verantwortlich gewesen, für den Bebop dagegen junge, eine musikalische Karriere anstrebende Musiker. Das breite Publikum stand beiden anfangs eher verständnislos gegenüber. Wo der Revival-Jazz in den Hinterzimmern der Pubs erklang, hörte man Bebop, gespielt von Instrumentalisten, die in professionellen Tanzkapellen spielten, meist in speziellen Musikerkneipen im Londoner Westend. Gelly beschreibt die Szene, irgendwo zwischen Konservatorium und Tanzkapellen, in der Dankworth und Ronnie Scott arbeiteten; er nennt Bands wie das Tito Burns Sextet oder das Ray Ellington Quartet, und er beschreibt die Atmosphäre des Club Eleven, der im Dezember 1948 seine Pforten öffnete, zwei Jahre später auf die Carnaby Street umzog, aber nach nur wenigen Monaten und einer Drogenrazzia der Polizei schließen musste.
Daneben kam es Anfang der 1950er Jahre zu einer neuen Form von Jazz-Traditionsaufbereitung im New-Orleans-Purismus. Gelly zeichnet das Wiederaufleben des archaischen New Orleans-Jazz in den Vereinigten Staaten nach, das Musiker wie Bunk Johnson und George Lewis in den Mittelpunkt stellte und fokussiert dann auf Johnsons englischen Jünger, den Kornettisten Ken Colyer, dessen Crane River Jazz Band ein starkes musikalisches wie ästhetisches Statement bot, das weit über den reinen Revival-Jazz hinaus zu hören war. Über kurz oder lang ging Colyer selbst nach New Orleans und beeindruckte etliche der dort lebenden Musikveteranen mit seinem Ton und seinem musikalischen Ansatz. Sein Posaunist Chris Barber gründete 1954 seine erste Band, deren erstes Album “New Orleans Joys” 60.000 Exemplare verkaufte. Wer, fragt Gelly, kaufte diese Platten?, und schlussfolgert, es seien vor allem Schüler gewesen, die sich durch die Musik abgrenzten. Damals sei der Begriff “Trad” geprägt worden, um eine besonders populäre Form des traditionellen Jazz zu bezeichnen. Jazz, fasst Gelly zusammen, sei eine Jugendkultur gewesen, die auf Livemusik gründete.
Der moderne Jazz um Dankworth und Scott wurde im Verlauf der 1950er Jahre populärer und nahm Einflüsse aus Hardbop, Cool Jazz oder afro-kubanischem Jazz auf. Zugleich bildete sich unter den Musikern ein Bewusstsein darüber, dass es vielleicht tatsächlich so etwas wie “britischen Jazz” gäbe, was zu ganz unterschiedlichen Streits darüber führte, wie die verschiedenen Stränge eines solchen nationalen Stils (Trad hier, modern dort) sich entwickeln sollten. Ein Middleground, auf dem sich viele trafen, war der Mainstream, der Elemente aus traditionelleren und moderneren Spielweisen in sich aufnahm und vermittelte.
Die Skiffle-Welle der späten 1950er Jahre bildet den Mittelpunkt eines eigenen Kapitels, in dem Gelly zugleich auf die Faszination britischer Musiker und Fans mit dem authentischen Blues in den Vereinigten Staaten blickt und vorausdeutet, wie all die Diskurse, die er zuvor dargestellt hatte, letzten Endes auch Grundstein für die Ausbildung einer eigenen britischen Art von Popmusik sein sollten. Gelly verfolgt den Niedergang der Bigbands und der konventioneller spielenden Tanzorchester, die ja insbesondere den modernen Musikern finanziellen Halt geboten hatten. Er erwähnt einige der herausragenden Figuren, Tubby Hayes etwa und Joe Harriott, und schildert die Gründung eines neuen Clubs, Ronnie Scott’s in Soho. Die letzten beiden Kapitel blicken auf die Entwicklung des Trad-Booms, der erst durch den Erfolg der Beatles beendet wurde, sowie auf eine moderne Szene, der es gelang eine eigene Stimme auszubilden, eine Stimme, für die Gelly Stan Traceys “Jazz Suite: Under Milk Wood” und Johnny Dankworths “What the Dickens!” als symptomatisch sieht.
Dave Gelly fragt in seinem Buch nach den Gründen für musikalische Moden, und seine Erklärungen kommen aus der Szene selbst. Dem Blick auf den Jazz “und sein Publikum” hätte stellenweise auch die Sicht auf den Rest des Publikums wohlgetan, also auf die Debatten, die nicht allein innerhalb der Szene, sondern darüber hinaus und insbesondere auch über den Jazz abliefen. Und so sehr auch die Eingrenzung seines Themas auf die Dualität zwischen traditionellen und modernen Stilrichtungen in den 1940er und 1950er Jahren verständlich ist, so wäre ein zumindest spekulativer Ausblick ganz hilfreich gewesen, welche Auswirkungen die Diskussionen, die er für die Jazzszene jener Jahre schildert, auf die britische Jazzentwicklung auch nach der von Gelly betrachteten Zeit hatten.
Alldem zum Trotz aber gelingt es Gelly etliche dieser Diskurse sorgfältig herauszuarbeiten und ihre Unterschiede etwa zu ähnlichen Diskursen in den Vereinigten Staaten deutlich zu machen. Vor allem macht die Lektüre einmal mehr deutlich, dass Jazzgeschichtsschreibung nicht einzig die Entwicklung des Experiments verfolgen sollte, sondern dass auch der Blick aufs Bewahrende, auf die Traditionsverbundenheit, auf die Konnotationen archaischer Stilrichtungen wichtig ist.
Wolfram Knauer (August 2016)
Black Popular Music in Britain Since 1945
herausgegeben von Jon Stratton & Nabeel Zuberi
Farnham, Surrey 2014 (Ashgate)
240 Seiten, 65 Britische Pfund
ISBN: 978-1-4094-6913-1
Black British Jazz. Routes, Ownership and Performance
herausgegeben von Jason Toynbee & Catherine Tackley & Mark Doffman
Farnham, Surrey 2014 (Ashgate)
230 Seiten , 65 Britische Pfund
ISBN: 978-1-4724-1756-5
Großbritannien hat die Nase vorn, wenn es um Jazz geht. In London waren es die ersten Jazzkonzerte zu hören, noch vor Paris oder Berlin, hier ließen sich – allein schon wegen der geringeren Sprachbarriere – amerikanische Musiker nieder, auch wenn sie eigentlich durch Europa touren wollten. Armstrong und Ellington waren Anfang der 1930er Jahre live zu erleben, und so ist es kein Wunder, das die britische Jazzszene bereits in den 1930er Jahren zu den avanciertesten Europas gehörte. In den 1940er Jahren entwickelten sich hier eine neue Art von traditionellem Jazz, daneben aber auch Mischformen aus Jazz und Blues wie der Skiffle, die allesamt von Einfluss auf die populäre Musik aus England waren.
Die Jazzszene Großbritanniens wird gern – wie die meisten Jazzszenen Europas – als eine weiße, europäische Jazzszene wahrgenommen, als eine Entwicklung der Re-Akkulturation afro-amerikanischer (also eigentlich afro-euro-amerikanischer) Musik nach Europa. Tatsächlich aber hatte die Kolonialmacht England genügend schwarze Musiker aus ihren (früheren) Kolonien, insbesondere der Karibik, die das kulturelle Leben der Hauptstadt belebten. Die beiden Bücher “Black British Jazz” und “Black Popular Music” widmen sich dieser oft vernachlässigten Seite der britischen Musikgeschichte.
Während “Black British Jazz” die verschiedenen Wege untersucht, auf denen – neben den Tourneen afro-amerikanischer Stars – schwarze Einflüsse in England bemerkbar wurden, die Aneignung einer afro-britischen Identität seit dem Avantgarde-Jazz der späten 1960er Jahre bis hin zu jungen Musikern der Gegenwart wie Soweto Kinch, sowie konkrete Beispiele eines ästhetischen Diskurses im Königreich, ist “Black Popular Music” sehr breiter angelegt, deckt Jazz vor allem im ersten Kapitel der Musikwissenschaftlerin Catherine Tackley ab, um dann populäre Stile wie Ska, “Afro-Trends”, Rock, Soul, Hip-Hop und vieles dazwischen zu untersuchen, immer mit der Frage, wie sich eine schwarze britische Identität in der Musik abbilde und welchen Widerhall die Musik im Publikum hat.
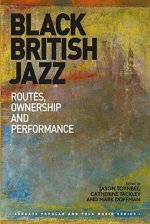 Im Vorwort zu “Black British Jazz” skizzieren die Herausgeber fünf prägende Momente in dieser Geschichte: (1.) die Tournee des Southern Syncopated Orchestra 1919 in England, das dem Land zum ersten Mal das Bewusstsein brachte, dass es da eine aus schwarzer Ästhetik geborene neue Musikrichtung gab; (2.) eine Musikszene um Musiker aus Jamaika und anderen karibischen Ländern, die oft genug ihre Instrumente in den Militärkapellen der Kolonialherren gelernt hatten; (3.) die Bebopszene im London der 1950er Jahre, die deutlich das schwarze Element der Improvisation in den Vordergrund stellte; (4.) die Anwesenheit südafrikanischer Expatriates in den 1960er Jahren, sowie (5.) das Erwachen eines auch politischen afro-britischen Bewusstseins spätestens in den 1980er Jahren.
Im Vorwort zu “Black British Jazz” skizzieren die Herausgeber fünf prägende Momente in dieser Geschichte: (1.) die Tournee des Southern Syncopated Orchestra 1919 in England, das dem Land zum ersten Mal das Bewusstsein brachte, dass es da eine aus schwarzer Ästhetik geborene neue Musikrichtung gab; (2.) eine Musikszene um Musiker aus Jamaika und anderen karibischen Ländern, die oft genug ihre Instrumente in den Militärkapellen der Kolonialherren gelernt hatten; (3.) die Bebopszene im London der 1950er Jahre, die deutlich das schwarze Element der Improvisation in den Vordergrund stellte; (4.) die Anwesenheit südafrikanischer Expatriates in den 1960er Jahren, sowie (5.) das Erwachen eines auch politischen afro-britischen Bewusstseins spätestens in den 1980er Jahren.
Howard Rye skizziert in seinem Kapitel die Akkulturation schwarzer Musik bis 1935, und verweist sowohl aufs Musiktheater (“In Dahomey”), auf Tourneen afro-amerikanischer Musiker und auf die ersten schwarzen britischen Bands. Catherine Tackley widmet sich dem Thema der Migration und fokussiert beispielsweise auf die “Tiger Bay”, ein Viertel in Cardiff, das insbesondere Musiker kolonialer Herkunft anzog. Kenneth Bilby fragt, ob Reggae und karibische Musik für den britischen Jazz das darstellten, was für den amerikanischen Jazz der Blues sei.
Mark Banks und Jason Toynbee befassen sich mit der öffentlichen Jazzförderung in Großbritannien seit 1968, die die Ausbildung einer britischen Avantgarde-Szene erst ermöglichte, fragen nach den Diskursen dieser Szene und der Beteiligung afro-britischer Musiker an ihr. Mark Doffman stellt dieselbe Frage noch allgemeiner, beschreibt, welcher Anstrengungen es bedürfe, den britischen Jazz als Teil einer schwarzen Diaspora zu verstehen. Justin A. Williams beschäftigt sich mit dem Beispiel des Saxophonisten Soweto Kinch, der Hybridität der Genres Jazz und Hip-Hop, und beschreibt das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein, das sich in Kinchs Projekten einer Verbindung der beiden Genres ableitet.
George McKay wirft einen Blick auf die aus Trinidad stammende Pianistin Winifred Atwell und fragt, warum sie in den Geschichtsbüchern zum britischen Jazz nicht vorkomme. George Burrows betrachtet den Modernismus in Reginald Foreysthes Musik vor dem Hintergrund der Adorno’schen Moderne-Diskussion. Byron Dueck schließlich fragt nach der sozialen Situation der britischen Jazzszene, die sich bis heute vor allem aus weißen, der Mittelklasse verbundenen Mitgliedern zusammensetzt, und er fragt nach den Gründen für die Faszination mit schwarzer Musik.
Ist also “schwarzer britischer Jazz” die Musik, die von schwarzen Musikern in Großbritannien gespielt wird? Oder handelt es sich vielmehr um eine ästhetische Größe, die sich in Musikern jedweder Hautfarbe wiederfinden kann? Die Antwort auf diese Frage ist komplex, denn die Vor- und Nachteile von schwarzer Authentizität oder weiß-dominierter Kulturszene geraden bei fast jedem Argument stark ins Kippen.
 “Black Popular Music in Britain since 1945” verfolgt einen stilistisch breiteren Ansatz. Hier fragt Catherine Tackley etwa nach der nationalen Identität west-indischer Musiker, die sich selbst als britische Jazzmusiker verstanden und wohl auch waren, weil die spezifische Art von Musik, die sie machten, nur in der Londoner Szene sich entwickeln konnte. Jon Stratton untersucht den Einfluss afrikanischer Musik sowie der Tourneen afro-amerikanischer Bluesmusiker in den 1950er und 1960er Jahre auf die britische Musikszene. Markus Coester hinterfragt die Klischees, die in der musikalischen Mode des “Afro Trend” der 1960er und 1970er Jahre zu finden sind, ästhetische Stereotype irgendwo zwischen Authentizität, Diversität und Happiness.
“Black Popular Music in Britain since 1945” verfolgt einen stilistisch breiteren Ansatz. Hier fragt Catherine Tackley etwa nach der nationalen Identität west-indischer Musiker, die sich selbst als britische Jazzmusiker verstanden und wohl auch waren, weil die spezifische Art von Musik, die sie machten, nur in der Londoner Szene sich entwickeln konnte. Jon Stratton untersucht den Einfluss afrikanischer Musik sowie der Tourneen afro-amerikanischer Bluesmusiker in den 1950er und 1960er Jahre auf die britische Musikszene. Markus Coester hinterfragt die Klischees, die in der musikalischen Mode des “Afro Trend” der 1960er und 1970er Jahre zu finden sind, ästhetische Stereotype irgendwo zwischen Authentizität, Diversität und Happiness.
Robert Strachan schaut auf die Britfunk-Welle der 1980er Jahre, stellt daneben Fragen nach Gender und Identität, wie sie sich in diesem Genre ausdrückten. Rehan Hyder fokussiert auf die Stadt Bristol, die durch Zuwanderung eine multiethnische Bevölkerung und eine starke schwarze Community besitzt, und stellt die Musik in den schwarzen Clubs der Stadt in den 1970er und 1980er Jahren vor, die durchaus eine Art eigenen Sound kreieren halfen. Mykaell Riley ist Gründungsmitglied der Reggae-Band Steel Pulse und berichtet damit aus eigener Erfahrung über die Reggae- und Bass-Culture-Szene der 1960er und 1970er Jahre.
Lisa Amanda Palmer fragt nach schwarzer Maskulinität und der Feminisierung des sogenannten “lovers rock”, des “soft reggae” der 1980er Jahre. Julian Henriques und Beatrice Ferrara werfen einen Blick auf das multikulturelle Londoner Straßenfest Notting Hill Carnival, in dem Musik Raum, Ort und Territorium markiere. Hillegonda C. Rietveld blickt auf HipHop-affine Stile, Electro-Funk, House, Acid-House, Madchester, Haçienda, Techno und andere. Jeremy Gilbert nimmt sich die elektronische Tanzmusik der 1990er bis 2000er Jahre vor. Nabeel Zuberi schließlich fragt nach den Stimmen der MC-Kultur, nach Sprache, Klangverfremdung, kultureller Identität, die sich in den Raps der Hip-Hop- und Grime-Künstler der jüngsten Generation ausdrückt.
Beide Bücher, die in derselben Reihe des Verlags erschienen sind, ergänzen sich dabei hervorragend. Sie sind beide keine historischen Abhandlungen, in denen die Geschichte schwarzer Musik in England chronologisch vorgeführt wird, sondern versammeln Aufsätze, die sich auf verschiedene Aspekte dieser Geschichte fokussieren und sind damit Teil eines kulturwissenschaftlichen Diskurses, der sehr bewusst über den Tellerrand der jeweiligen Genres hinausblickt. Bleibt anzumerken, dass beide Bücher Musik vor allem als kulturellen Ausdruck betrachten und dabei kaum einen Blick auf die Musik selbst werfen, auf den konkreten Ausdruck, der sich in Melodien, Rhythmen, Formen und Sounds widerspiegelt.
Wolfram Knauer (August 2016)
Canterbury Scene. Jazzrock in England
von Bernward Halbscheffel
Leipzig 2014 (Halbscheffel Verlag)
342 Seiten, 24,90 Euro
ISBN: 978-3-943483-00-0
 Eine besondere Facette des britischen Jazz stellt die Canterbury Scene der 1960er Jahre dar, eine musikalische Haltung, die sich aus einem Musikerkreis um Daevid Allen, Hugh Hopper und Robert Wyatt entwickelte, die ihrerseits mit der Verbindung experimenteller Rock- und experimenteller Jazzmusik experimentierten. Bands wie Soft Machine, Caravan, Henry Cow, Hatfield and the North und andere waren selbst in den 1970er Jahren nur Eingeweihten bekannt, sind aber für das Verständnis der Rock- und auch der Jazzentwicklung unverzichtbar, fügten sie doch, wie Bernward Halbscheffel im Vorwort seines Buchs zur “Canterbury Scene” schreibt, “dem Jazz der 1980er und 1990er Jahre einige europäische Farben hinzu”.
Eine besondere Facette des britischen Jazz stellt die Canterbury Scene der 1960er Jahre dar, eine musikalische Haltung, die sich aus einem Musikerkreis um Daevid Allen, Hugh Hopper und Robert Wyatt entwickelte, die ihrerseits mit der Verbindung experimenteller Rock- und experimenteller Jazzmusik experimentierten. Bands wie Soft Machine, Caravan, Henry Cow, Hatfield and the North und andere waren selbst in den 1970er Jahren nur Eingeweihten bekannt, sind aber für das Verständnis der Rock- und auch der Jazzentwicklung unverzichtbar, fügten sie doch, wie Bernward Halbscheffel im Vorwort seines Buchs zur “Canterbury Scene” schreibt, “dem Jazz der 1980er und 1990er Jahre einige europäische Farben hinzu”.
Halbscheffel, der im eigenen Verlag bereits ein zweiteiliges Sachlexikon Rockmusik sowie ein Lexikon Progressive Rock vorgelegt hat, hat auch sein Buch zur Canterbury Scene lexikalisch angelegt. Neben einer chronologischen Darstellung der historischen Entwicklung bebildert er diese dabei durch analytische Details oder Anekdoten, für die das Alphabet die Struktur vorgibt. Von “A” wie “Allen, Daevid Christopher” bis “Z” wie “Zeuhl”, einer “Spielart des Progressive Rock, initiiert von Christian Vander” finden sich Namen und Sachbegriffe, bündige Artikel zu einzelnen Bands und Biographien der wichtigsten Musiker.
Jedes Stichwort lädt den Leser zum Perspektivenwechsel ein, denn in jedem Eintrag wird aus anderer Warte auf das Thema des Buchs geschaut, auf den experimentellen Umgang mit Rockgeschichte und Improvisation. Dabei diskutiert Halbscheffel neben ästhetischen Haltungen auch genreübergreifende Begriffe wie “Avantgarde”, oder den britischen Unternehmer Richard Branson, der vor seinen Billigfliegern mit Virgin Records eine wichtige Plattenfirma gegründet hatte. Neben den mit der Canterbury-Szene verbundenen Bands und Musikern behandelt Halbscheffel auch die Auswirkungen etwa auf die deutsche Szene, wo mit dem Krautrock ein eigenes musikalisches Phänomen heranwuchs, wo Bands wie Cassiber enge Kontakte zu Canterbury-Musikern knüpften, oder wo oder das kurzlebige Plattenlabel “Hör Zu Black Label” in einer genreübergreifenden Veröffentlichungspolitik die Musik von Stockhausen und Albert Mangelsdorff genauso herausbrachte wie jene von Dagmar Krause oder Inga Rumpf.
Von Jazzseite sind neben den Artikeln über stilbildende Musiker etwa jene über den “Jazz” und über “Jazzrock” von Interesse, mit 16 Seiten immerhin einer der umfangreichten Einträge des Lexikons. Halbscheffel erzählt die Jazzgeschichte wie andere auch, von New Orleans bis Free Jazz und Fusion, interessiert sich aber naturgemäß vor allem für die jüngeren Entwicklungen, die Diskurse der 1970er bis 1990er Jahre. Er zeichnet die Geschichte des Genres in Europa nach, schildert die Entwicklung von Faszination über Nachahmung bis zur aktuellen insbesondere deutschen Szene, die, wie er schreibt, “spätestens seit den 1980er-Jahren zu einer Minderheitenmusik geworden” sei. In seinem “Jazzrock”-Eintrag versucht er zu unterscheiden, welche Einflüsse und welche Unterschiede für beide Seiten der Gleichung gelten (Rock wie Jazz), diskutiert den Jazzrock um 1970 als Stil und Stilmittel sowie die unterschiedliche Rezeption des Genres von Rock- und Jazzhörerseite.
In der abschließenden Abhandlung über die Canterbury Scene erzählt Halbscheffel, wie aus einer Anfang der 1960er Jahre gegründeten Schülerband eine “Szene” entstand, die ihre eigenen ästhetischen Vorstellungen entwickelte, wie nach und nach ein größeres Publikum die aus dieser Szene entstandenen Musik entdeckte, wie die Bands Soft Machine und Caravan auch kommerziellen Erfolg hatten, es daneben aber auch andere Konzepte gab, wie die Strömung Ende der 1970er Jahre verebbte, um in den 190er Jahren als eine einflussreiche Entwicklung wiederentdeckt zu werden. Er analysiert Aufnahmen der Bands Soft Machine, Caravan und Henry Cow und diskutiert das Element von Erfolg und mangelndem Erfolg und ihre Auswirkungen auf die Realität des Musikmachens am Beispiel der Canterbury Scene.
Halbscheffels “Canterbury Scene. Jazzrock in England” ist Fachbuch und Lexikon in einem, ein umfassender und vielschichtiger Überblick über eine wichtige Szene der europäischen Avantgarde zwischen Jazz und Popmusik, ein Buch für Liebhaber genauso wie ein Nachschlagewerk für den interessierten Laien.
Wolfram Knauer (August 2016)
Sidney Bechet in Switzerland / Sidney Bechet en Suisse
von Fabrice Zammarchi & Roland Hippenmeyer
Genf 2014 (United Music Foundation)
216 Seiten, 4 CDs, 179 Schweizer Franken
http://www.unitedmusic.ch
 Wenn ein Musiker den Weg des Jazz nach Europa symbolisiert, dann ist es Sidney Bechet. Der Klarinettist und Sopransaxophonist kam 1919 zum ersten Mal in die “Alte Welt”, als er mit dem Southern Syncopated Orchestra hier tourte. Bei einem Konzert in Lausanne beeindruckte sein Klarinettensolo über den Blues den klassischen Dirigenten Ernest Ansermet so sehr, dass dieser eine viel zitierte Kritik in der “Revue Romande” verfasste, die erste ernsthafte Würdigung eines Jazzsolisten überhaupt. Mit einem Faksimile dieser Kritik beginnt das Buch “Sidney Bechet in Switzerland”, das akribisch – und zweisprachig, also auf Englisch und Französisch – Bechets Besuche in der Schweiz von 1919 bis 1958 dokumentiert.
Wenn ein Musiker den Weg des Jazz nach Europa symbolisiert, dann ist es Sidney Bechet. Der Klarinettist und Sopransaxophonist kam 1919 zum ersten Mal in die “Alte Welt”, als er mit dem Southern Syncopated Orchestra hier tourte. Bei einem Konzert in Lausanne beeindruckte sein Klarinettensolo über den Blues den klassischen Dirigenten Ernest Ansermet so sehr, dass dieser eine viel zitierte Kritik in der “Revue Romande” verfasste, die erste ernsthafte Würdigung eines Jazzsolisten überhaupt. Mit einem Faksimile dieser Kritik beginnt das Buch “Sidney Bechet in Switzerland”, das akribisch – und zweisprachig, also auf Englisch und Französisch – Bechets Besuche in der Schweiz von 1919 bis 1958 dokumentiert.
In den 1920er Jahren lebte Bechet für längere Zeit in Europa; bereiste die Schweiz 1926 beispielsweise mit der Revue Négre” und der Show “Black People”. Seinen Wohnsitz hatte er damals in Paris, wurde allerdings 1929 nach einer Schießerei aus Frankreich ausgewiesen. Nach einem knapp zweijährigen Gastspiel in Berlin kehrte Bechet 1931 in die Vereinigten Staaten zurück.
Achtzehn Jahre später war Bechet dann wieder in Europa und ließ sich in Paris nieder. Man hörte ihn überall auf dem Kontinent, und in der Schweiz war er ein gern gesehener Gast, tourte das Land mit den Bands von Claude Luter, von André Reweliotty, mit Schweizer oder anderen europäischen Kollegen.
Fabrice Zammarci und Roland Hippenmeyer, die jeder für sich bereits fundierte Bücher über Sidney Bechet geschrieben haben, sammelten für dieses opulente Coffee-Table-Buch seltene Fotos, Zeitungsartikel, Programmhefte und zahlreiche andere Dokumente, die Bechets Auftritte in der Schweiz dokumentieren. Sie sprachen mit Zeitzeugen und noch lebenden Musikerkollegen, mit Bechets Sohn Daniel oder mit seinem ehemaligen Manager Claude Wolff. Das Ergebnis ist ein Schatz an spannenden Geschichten, an Erinnerungen und visuellen Dokumenten, denen es gelingt die Faszination für die Musik des Sopransaxophonisten lebendig werden zu lassen.
Richtig lebendig wird das alles dann allerdings insbesondere durch die vier dem Buch beiheftenden CDs, die Bechets Besuche in den 1950er Jahren dokumentieren. Hier finden sich Konzertmitschnitte zwischen Mai 1949 und April 1958, aus Genf, Lausanne, Zürich und Sion, die er Schweizer Rundfunk mitschnitt. Daneben enthalten die CDs aber auch mehrere Interviews, in denen sich Bechet in exzellentem Französisch vor allem an seine Jugend in New Orleans erinnert, daneben aber auch über seine Ballettmusik “La Nuit est une Sorcière” spricht und im Duo mit dem Pianisten Charles Lewis Auszüge daraus spielt. Gerade die Livekonzerte machen deutlich, welch begnadeter Solist Bechet war, mit einem Ton und einem Drive, dem sich seine Mitmusiker genauso wenig entziehen können wie sein Publikum.
“Sidney Bechet in Switzerland” ist eine großartige “labor of love”. Das Buch sei jedem Freund traditioneller Stilrichtungen dringend ans Herz gelegt, mag aber auch künftigen Forschern des Zusammenspiels amerikanischer und europäischer Musiker in der Nachkriegszeit als exzellente Quelle dienen, weil zwischen den Zeilen immer wieder Aspekte erwähnt werden, die in der Jazzgeschichtsschreibung sonst selten zur Sprache kommen. Wobei Sidney Bechet, und das ist vielleicht die überzeugendste Botschaft dieses Buchs, sich schon zu Beginn der 1950er Jahre keinesweigs als ein “American expatriate” empfand. Er war, wenn überhaupt, ein Franzose aus New Orleans, ein überzeugter Weltbürger.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
The View From The Back Of The Band. The Life and Music of Mel Lewis
von Chris Smith
Denton/TX 2014 (University of North Texas Press)
399 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-57441-574-2
 Im Vorwort zu dieser Biographie des Schlagzeugers Mel Lewis betont John Mosca, dass dem einen oder anderen vielleicht bewusst sein mag, wie wichtig ein Drummer für die Energie einer Bigband ist, dass er selbst allerdings, als er Lewis zum ersten Mal hörte, vor allem beeindruckt davon war, was Lewis entschied NICHT zu spielen. Mosca erwähnt auch, dass, wenn das vorliegende Buch zwar eine Biographie Mel Lewis’ sei, man die beiden Partner der Thad Jones / Mel Lewis Big Band immer zusammen denken müsse, weil sie beide das Talent des jeweils anderen so gut komplementierten, und dass man insbesondere an ihrer Zusammenarbeit die Größe eines jeden einzelnen erkenne.
Im Vorwort zu dieser Biographie des Schlagzeugers Mel Lewis betont John Mosca, dass dem einen oder anderen vielleicht bewusst sein mag, wie wichtig ein Drummer für die Energie einer Bigband ist, dass er selbst allerdings, als er Lewis zum ersten Mal hörte, vor allem beeindruckt davon war, was Lewis entschied NICHT zu spielen. Mosca erwähnt auch, dass, wenn das vorliegende Buch zwar eine Biographie Mel Lewis’ sei, man die beiden Partner der Thad Jones / Mel Lewis Big Band immer zusammen denken müsse, weil sie beide das Talent des jeweils anderen so gut komplementierten, und dass man insbesondere an ihrer Zusammenarbeit die Größe eines jeden einzelnen erkenne.
Chris Smith, selbst ein in New York lebender professioneller Schlagzeuger, beginnt sein Buch mit einem Auszug aus dem Manuskript für Lewis’ eigene, nie veröffentlichte Autobiographie, “The View from the Back of the Band”. Sein Vater, schreibt Mel darin, sei bereits Schlagzeuger gewesen. Im Kindergarten habe er die Becken bedient, bald darauf, in der ersten Klasse die Basstrommel. Irgendwann habe er seinen Vater bei einer jüdischen Hochzeit ersetzt und sich seit dem Zeitpunkt als professioneller Musiker verstanden.
Melvin Sokoloff (so sein richtiger Name) wurde 1929 in Buffalo, New York, geboren, und die Hochzeit, von der er hier sprach, fand 1935 statt. Bereits in den frühen 1940er Jahren war er ein gefragter Schlagzeuger in der Region um Buffalo, spielte in Swing- und Polka-Bands, für Hochzeiten oder Tanzveranstaltungen. Mit 14 wurde er Drummer für die Bob Seib Band, 1946 tourte er mit Bernie Burns’ Orchester durch den Mittleren Westen. Sein Schlagzeug-Kollege Frankie Dunlop erweckte sein Interesse für den Bebop, der auch die Musik der Lenny Lewis Big Band prägte, in der Mel in jenen Jahren spielte. Im Rückblick identifiziert Mel die frühen Einflüsse auf sein Spiel: ein bisschen Jo Jones, ein bisschen Gene Krupa, noch nicht wirklich Max Roach, sicher Shadow Wilson, besonders aber Big Sid Catlett.
1948 zog es Mel Lewis mit der Lennie Lewis Band dorthin, wo es jeden jungen Jazzmusiker zog, damals wie heute, nach New York City. Count Basie hörte ihn und entschied sich, Mel für sein eigenes Orchester zu sichern, dem er ein moderneres Gesicht verpassen wollte. Kurz vor dem Gig aber wurde er wieder ausgeladen, auch deshalb, weil Basies Management gerade eine Tournee durch die Südstaaten gebucht hatte, und es für einen jungen weißen Musiker nicht sicher gewesen wäre, mit einer schwarzen Band zu reisen. Mel folgte Tiny Kahn als Schlagzeuger des Boyd Raeburn Orchestra, spielte dann mit Alvino Reys Tanzkapelle. Ray Anthony, mit dem er als nächstes auftrat, gab ihm seinen künftigen Bühnennamen Mel Lewis. Anthony sei ein Despot gewesen, und ihre musikalischen Ansichten hätten weit auseinander gelegen, und doch habe er in seiner Zeit bei Anthony eine Menge gelernt, insbesondere Disziplin. Während er mit Tex Benekes Band spielte, traf er seine spätere Frau Doris, konnte den Bandleader daneben aber auch überzeugen, einen Freund, den Ventilposaunisten Bob Brookmeyer zu engagieren, den er 1949 in Chicago kennengelernt hatte. Basie bot ihm ein zweites Mal den Schlagzeugstuhl an, zahlte aber nicht genug, und Stan Kentons Angebot, mit dessen Band zu spielen, zog Kenton gleich darauf zurück, weil sein bisheriger Drummer zurückgekehrt war. 1954 allerdings rief Kenton ein zweites Mal an, und Lewis hatte zum ersten Mal die Möglichkeit mit einer der Top-Bands des Landes zu arbeiten.
Während seiner Zeit bei Stan Kenton traf Mel Lewis erstmals auf den jungen Trompeter Thad Jones, der damals noch bei Count Basie spielte. Lewis lebte damals in Los Angeles, wirkte bei Platten der West Coast Jazzszene mit, war mehr und mehr auch für kleiner besetzte Studioalben gefragt. 1959 erhielt der Vibraphonist Terry Gibbs einen Gig in einem Club in Hollywood und Lewis war mit von der Partie. Er machte Aufnahmen mit Art Pepper, Ben Webster und Gerry Mulligan, in dessen Concert Jazz Band er am Schlagzeug saß. Er reiste mit Dizzy Gillespie durch Europa und mit Benny Goodman in die Sowjetunion, trat regelmäßig in New York auf und hatte Studiogigs in Hollywood.
Nachdem er sich 1963 entschieden hatte, wieder ganz nach New York zu ziehen, zog er sofort viele Jobs an Land, Jazz-Engagements genauso wie Studiogigs etwa für die Jimmy Dean Show auf ABC. Mit Pepper Adams und Thad Jones, der Clark Terry in Gerry Mulligans Concert Jazz Band ersetzt hatte, trat er in kleiner Besetzung auf, und nachdem Mulligan sein Orchester aufgelöst hatte, entwickelten die beiden den Plan einer eigenen Big Band. Ende 1964 probten sie, suchten nach einem Auftrittsort und fanden diesen schließlich im Village Vanguard, das der Band den Montagabend zur Verfügung stellte, den finanziell für New Yorker Clubs erfahrungsgemäß schlechtesten Abend der Woche.
Am 7. Februar 1966 war das Orchester erstmals zu hören und hatte sofort großen Erfolg. Jeder der Musiker erhielt damals gerade mal 16 Dollar pro Abend, was nur deshalb ging, weil alle mit Herzblut dabei waren und außerdem andere Gigs, meist in den Studios oder am Broadway hatten. Smith berichtet von Alben für Solid State und von Tourneen, die nicht alle erfolgreich waren. So fest geschrieben die Arrangements auch waren, so behielten sie immer auch ein Moment des Improvisierten, wie Eddie Daniels berichtet, der sich erinnert, dass sich viele der schweren Arrangements von Thad Jones noch während des Auftritts veränderten, wenn Jones etwa dem Saxophonsatz Licks zusang und alle Musiker die Spannung der Live-Komposition spürten.
1971 hofften die beiden Bandleader auf einen Grammy für das “Best Large Jazz Ensemble”, der dann aber an Miles Davis’ “Bitches Brew” ging. Smith beschreibt personelle Wechsel in der Band, einen Wechsel der Plattenfirma, eine Konzertreise in die Sowjetunion 1972 und andere ausgedehnte Tourneen. Er nennt Höhepunkte und Streits und er schildert ausführlich die Entscheidung Thad Jones’, die Band zu verlassen und nach Kopenhagen zu ziehen, wo ihm ein Posten mit der Danish Radio Big Band angeboten worden war. Mel Lewis fühlte sich betrogen, künstlerisch, finanziell, persönlich, entschied dann aber nach langen Gesprächen mit Vertrauten, die Band fortzuführen.
Mel Lewis and The Jazz Orchestra, wie das Ensemble jetzt hieß, hatte das Repertoire von Thad Jones, hatte einen der wohl antreibendsten Schlagzeuger des Jazz, nämlich Mel Lewis, und fand nun in Bob Brookmeyer und einigen anderen Arrangeure, die das Repertoire mit neuen Stücken auffüllte. Der Besuch im Vanguard ging allerdings ohne Thad zurück, was sich erst änderte, als kein geringerer als Miles Davis die Band auch öffentlich lobte (und einmal sogar mit einstieg). Sein Geld verdiente Mel nach wie vor mit Studiogigs, mit Tourneen kleinerer Bands, ab den 1980er Jahren aber auch mit regelmäßigen Aufträgen durch die WDR Big Band.
Der Saxophonist Ted Nash erzählt, wie Cecil Taylor zu ihren größten Fans gehörte und vorschlug, sie sollten doch mal eine seiner Kompositionen spielen, dann aber ohne Noten kam, immer nur Schnipsel am Klavier vorspielte und die Band nach drei Stunden vielleicht mal 20 Takte zusammenhatte. 1985 trafen Thad und Mel sich noch einmal in Stuckholm und sprachen über mögliche gemeinsame Zukunftspläne. Dann aber starb Thad, und nicht lang danach streute der Hautkrebst, der bei Lewis 1985 diagnostiziert worden war, bis in die Lungen. Mel Lewis spielte bis zum seinem Ende, er starb am 2. Februar 1990.
Chris Smiths’ Buch verfolgt die Karriere von Melvin Sokoloff ausführlich, wenn er auch spätestens seit 1965 das Jones / Lewis Orchester und seine Nachfolger in den Vordergrund stellt. Im Anhang nähert sich Smith dem Schlagzeuger Lewis als Kollege, analysiert und transkribiert diverse Drum-Partien in Aufnahmen kleiner Besetzungen genauso wie in solchen mit Bigband. Eine ausgewählte Diskographie und ein Personen-Index beschließen das Buch.
“The View from the Back of the Band” ist eine Biographie des Schlagzeugers Mel Lewis, überzeugt aber letzten Endes insbesondere als Dokumentation über Lewis’ größtes Vermächtnis, die von ihm und Thad Jones gegründete Bigband, die dafür sorgte, dass der in den Mitt-1960er Jahren totgesagte Bigband-Jazz nicht starb.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Louis Armstrong. Master of Modernism
von Thomas Brothers
New York 2014 (W.W. Norton & Company)
594 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-393-66582-4
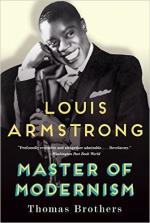 Dieses Buch ist bereits das dritte, das Thomas Brothers über Louis Armstrong geschrieben hat. In “Louis Armstrong. In His Own Words” legte er eine Dokumentation diverser Korrespondenzen und selbstverfasster Manuskripte des Vielschreibers und Trompeters vor, In “Louis Armstong’s New Orleans” portraitierte er Satchmos Jugendjahre in seiner Heimatstadt. Mit “Louis Armstrong. Master of Modernism” erfährt letzteres Buch nun eine Art Fortsetzung, in der Brothers vor allem Armstrongs Aktivitäten in den 1920er Jahren betrachtet. Er verfolgt dabei die Zusammenarbeit Armstrongs mit King Oliver’s Creole Jazz Band, die Ausbildung eines eigenen Stils, den Brothers als “modernen Stil” bezeichnet und Armstrong damit zu einem “Meister der Moderne” kürt und in eine Reihe mit anderen Ausprägungen der Moderne stellt, Erfindungen der frühen Unterhaltungsindustrie genauso wie einer wachsenden Distanz zum sittenstrengen Konventionen des Viktorianismus. Armstrong aber, so Brothers, erfand nicht nur einen, sondern gleich zwei moderne Kunstformen, von denen eine vor allem auf sein schwarzes Publikum, die andere an den Mainstream-Markt der weißen Fans gerichtet war. Er veränderte die traditionellen Herangehensweisen ans Zusammenspiel in der Band, und er wandte Methoden des Showbusiness auf die Musik an und beeinflusste damit den Jazz als Kunstrichtung, daneben aber auch die Musik ganz allgemein nachhaltig. Mit dieser Interpretation von Armstrongs Kunst als einem großen Beitrag zur intellektuellen Kulturgeschichte des 20sten Jahrhunderts will Brothers ganz bewusst von jenen im Rassismus der Vereinigten Staaten begründeten Lesarten abrücken, die das Bild eines ungelernten Musikers hochhalten, der nicht viel über das nachdenke, was er da spiele, sondern stattdessen einfach intuitiv Musik macht. Für Armstrongs Kunst, schreibt Brothers, war eine künstlerische Disziplin notwendig, die der eines Beethoven, Strawinsky usw. in nichts nachstünde. Zur Akzeptanz dieser Seite der Moderne gehöre aber auch zu verstehen, dass sich Armstrongs Kreativität zuallererst in seiner Kunst ausdrückte und damit einen nicht-verbalen Diskurs der Moderne wiedergebe.
Dieses Buch ist bereits das dritte, das Thomas Brothers über Louis Armstrong geschrieben hat. In “Louis Armstrong. In His Own Words” legte er eine Dokumentation diverser Korrespondenzen und selbstverfasster Manuskripte des Vielschreibers und Trompeters vor, In “Louis Armstong’s New Orleans” portraitierte er Satchmos Jugendjahre in seiner Heimatstadt. Mit “Louis Armstrong. Master of Modernism” erfährt letzteres Buch nun eine Art Fortsetzung, in der Brothers vor allem Armstrongs Aktivitäten in den 1920er Jahren betrachtet. Er verfolgt dabei die Zusammenarbeit Armstrongs mit King Oliver’s Creole Jazz Band, die Ausbildung eines eigenen Stils, den Brothers als “modernen Stil” bezeichnet und Armstrong damit zu einem “Meister der Moderne” kürt und in eine Reihe mit anderen Ausprägungen der Moderne stellt, Erfindungen der frühen Unterhaltungsindustrie genauso wie einer wachsenden Distanz zum sittenstrengen Konventionen des Viktorianismus. Armstrong aber, so Brothers, erfand nicht nur einen, sondern gleich zwei moderne Kunstformen, von denen eine vor allem auf sein schwarzes Publikum, die andere an den Mainstream-Markt der weißen Fans gerichtet war. Er veränderte die traditionellen Herangehensweisen ans Zusammenspiel in der Band, und er wandte Methoden des Showbusiness auf die Musik an und beeinflusste damit den Jazz als Kunstrichtung, daneben aber auch die Musik ganz allgemein nachhaltig. Mit dieser Interpretation von Armstrongs Kunst als einem großen Beitrag zur intellektuellen Kulturgeschichte des 20sten Jahrhunderts will Brothers ganz bewusst von jenen im Rassismus der Vereinigten Staaten begründeten Lesarten abrücken, die das Bild eines ungelernten Musikers hochhalten, der nicht viel über das nachdenke, was er da spiele, sondern stattdessen einfach intuitiv Musik macht. Für Armstrongs Kunst, schreibt Brothers, war eine künstlerische Disziplin notwendig, die der eines Beethoven, Strawinsky usw. in nichts nachstünde. Zur Akzeptanz dieser Seite der Moderne gehöre aber auch zu verstehen, dass sich Armstrongs Kreativität zuallererst in seiner Kunst ausdrückte und damit einen nicht-verbalen Diskurs der Moderne wiedergebe.
Brothers beginnt sein Buch am 8. August 1922, als der 21-jährige Louis Armstrong in New Orleans den Zug nach Chicago bestieg, wohin ihn Joe Oliver eingeladen hatte, um seine Creole Jazz Band zu verstärken. Er beschreibt die Arbeitsumgebung in der Stadt im Norden, die Tanzhallen, aber auch das schwarze Leben in Chicago, das durch viele der kulturellen Traditionen beeinflusst gewesen sei, die Afro-Amerikaner aus den Plantagen des Südens mitgebracht hätten. Solche Einflüsse fänden sich beispielsweise in der Bluesphrasierung, die damals ihren Weg von der Vokal- auch in die Instrumentalmusik fand, etwa jene ersten Aufnahmen, die Armstrong 1923 mit Oliver machte.
Brothers beschreibt Armstrongs Leben in Chicago, seine Beziehung zu Lil Hardin, die in Olivers Band als Pianistin mitwirkte und die er 1923 heiratete, und er beschreibt darüber hinaus Hardins Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung genauso wie auf seine populäre Karriere. 1924 brach die Band auseinander, und Brothers hat in seinem Buch genügend Platz die verschiedenen Versionen über die Gründe für die Auflösung zu diskutieren. Armstrong nahm die Einladung Fletcher Hendersons an, in seinem Orchester zu spielen, in dem er sich aber nie recht wohl und von dem er sich immer ein wenig von oben herab behandelt fühlte. New York aber, erklärt Brothers, war ein weiterer Meilenstein seiner Karriere, eine neue Herausforderung in einer Umgebung, in der es nicht wie in Chicago eine große Community anderer Musiker aus New Orleans gab.
Im New York der Harlem Renaissance, die die Stärke der schwarzen Kultur ein wenig nach eurozentrischen Kriterien darstellte, war das scheinbar Archaische des Blues eine wichtige Klangfarbe, die aber erst durch die künstlerische Bearbeitung erhöht werden sollte. Armstrong bei Henderson war also eine Art Zusammenbringen unterschiedlicher Welten. Brothers beleuchtet die Aufnahmen, die Satchmo als “hot soloist” mit dem Orchester machte, hört sich aber auch Aufnahmen mit kleineren Besetzungen an, an denen mit Sidney Bechet ein weiterer wichtiger Solist des frühen Jazz beteiligt war. Er begleitet Armstrong zurück nach Chicago, ins Dreamland Café, ins Vendome Theater, und hört schließlich die ersten Hot Five-Aufnahmen des Trompeters. Er greift sich einzelne Stücke heraus, “Heebie Jeebies” etwa, das die Plattenfirma OKeh versuchte zu einem populären Tanz hochzupushen. Die Studioaufnahmen, die Satchmo in Folge mit seinem Quintett und Septett vorlegte, wurden zu kunstvollen Statements, seine eigenen Soli – Brothers beschreibt Armstrong hier vor allem als Meister der Melodie – zu Musterbeispielen für eine virtuose tour-de-force im Jazz. In Chicago war der 27-jährige bereits eine Legende, “eine Art Gott” zumindest für sein schwarzes Publikum. Dann, Ende 1928, nahm Armstrong sich vor, auch das weiße Publikum zu erobern. Paul Whiteman war schließlich ein weit bekannterer Bandleader als er, und auch ein Musiker wie Guy Lombardo, den Satchmo durchaus bewunderte, erreichte mehr Menschen. Mit der Aufnahme von “I Can’t Give You Anything But Love” begann nicht nur eine weitere Erfolgsgeschichte in seiner Karriere, sondern daneben auch eine das Publikum überaus ansprechende Art der Interpretation populärer Schlager. Brothers beschreibt die verschiedenen Facetten, die zum Erfolg in der weißen Musikwelt beitrugen, die Bühnenshows am Broadway, die Aufnahmen populärer Schlager und schließlich die Filmwelt, die sich mehr und mehr auch der Musik öffnete.
Armstrongs Musik habe sich vier verschiedener Ansätze an die Melodie bedient, resümiert Brothers: dem Blues, dem Lead, dem Hot Solo und der Paraphrase. Alle hätten unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Formen, unterschiedliche Geschichten besessen. Alle seien in der Welt, in der Satchmo groß geworden war, in New Orleans, wichtig gewesen, und alle vier hülfen, Armstrongs künstlerische Entwicklung zu verstehen. Brothers gelingt das Nachzeichnen dieser melodischen Kraft in seinem Buch auch deshalb so gut, weil er sich nicht scheut, in die Aufnahmen hineinzuhören, in verständlicher Sprache über die melodische Innovation zu schreiben, die Einflüsse auseinanderzudröseln, Querbeziehungen zu nennen und die Wirkung auf zeitgenössische Hörer zu erklären. Dass die Reduzierung dieses Musikers der “Moderne” auf seine melodische Erfindungsgabe nicht ausreicht, ist auch Brothers klar. Seine Konzentration aber insbesondere auf dieses Merkmal in Satchmos Spiel hilft dem Leser sich auf eine vielleicht zu selten in den Mittelpunkt gestellte Perspektive seines Spiels zu konzentrieren.
Thomas Brothers Buch ist gut recherchiert und äußerst flüssig geschrieben. Ein umfangreicher Apparat an Anmerkungen und Literaturverweisen, ein ausführliches Register und viele Fotos runden das Buch ab, das einmal mehr beweist, dass auch über einen Künstler, über den bereits alles erforscht zu sein scheint, Neues zu schreiben ist. Vor allem die Einordnung Armstrongs in die amerikanische Musikindustrie der 1920er Jahre und die differenzierte Beschreibung der unterschiedlichen Szenen in Chicago und New York machen das Buch daneben zu einem wichtigen Beitrag zur Erforschung der frühen Jazzgeschichte.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
The New Orleans Scene, 1970-2000. A Personal Retrospective
von Thomas W. Jacobsen
Baton Rouge 2014 (Louisiana State University Press)
199 Seiten, 25 US-Dollar
ISBN: 978-0-8071-5698-8
 Der 1935 geborene Thomas Jacobson wuchs in einem kleinen Ort in Minnessota auf. Er spielte ein wenig Klarinette und wurde in seiner Jugend zum Jazzfan. Ihn interessierte der Swing, vor allem aber faszinierte ihn die authentische Musik, die er in einem Radiosender aus New Orleans hörte. Ende der 1980er Jahre verbrachte er ein Jahr lang als Gastprofessor in der Geburtsstadt des Jazz und entschied sich, nach seiner Pensionierung dorthin zu ziehen. Seither hat er in Fachblättern und seinem Buch “Traditional New Orleans Jazz” über die Szene der Stadt berichtet. Jetzt legte Jacobsen ein neues Buch vor, in dem er chronologisch die Jazzszene in New Orleans von 1970 bis 2000 beschreibt, Musiker, Bands, Veranstaltungsorte, Festivals, Ausbildungsmöglichkeiten und vieles mehr. Seine Entscheidung, diese Chronologie 1970 beginnen zu lassen, hängt mit einem anderen Buch zusammen, Charles Suhors “Jazz in New Orleans. The Postwar Years through 1970”, das genau in dem Jahr aufhörte und das er sich auch in seiner Darstellungsstruktur als Vorbild für sein Manuskript nahm. Wie Suhor war es Jacobsen dabei wichtig, alle Aspekte des Jazzlebens in der Crescent City zu dokumentieren und sich nicht auf die frühen Stile zu beschränken, wenn diese auch, wie er anmerkt, die Musik im French Quarter in der Zeit, die er betrachtet, überdurchschnittlich beherrscht habe.
Der 1935 geborene Thomas Jacobson wuchs in einem kleinen Ort in Minnessota auf. Er spielte ein wenig Klarinette und wurde in seiner Jugend zum Jazzfan. Ihn interessierte der Swing, vor allem aber faszinierte ihn die authentische Musik, die er in einem Radiosender aus New Orleans hörte. Ende der 1980er Jahre verbrachte er ein Jahr lang als Gastprofessor in der Geburtsstadt des Jazz und entschied sich, nach seiner Pensionierung dorthin zu ziehen. Seither hat er in Fachblättern und seinem Buch “Traditional New Orleans Jazz” über die Szene der Stadt berichtet. Jetzt legte Jacobsen ein neues Buch vor, in dem er chronologisch die Jazzszene in New Orleans von 1970 bis 2000 beschreibt, Musiker, Bands, Veranstaltungsorte, Festivals, Ausbildungsmöglichkeiten und vieles mehr. Seine Entscheidung, diese Chronologie 1970 beginnen zu lassen, hängt mit einem anderen Buch zusammen, Charles Suhors “Jazz in New Orleans. The Postwar Years through 1970”, das genau in dem Jahr aufhörte und das er sich auch in seiner Darstellungsstruktur als Vorbild für sein Manuskript nahm. Wie Suhor war es Jacobsen dabei wichtig, alle Aspekte des Jazzlebens in der Crescent City zu dokumentieren und sich nicht auf die frühen Stile zu beschränken, wenn diese auch, wie er anmerkt, die Musik im French Quarter in der Zeit, die er betrachtet, überdurchschnittlich beherrscht habe.
Jacobsen beginnt in den 1960er Jahren, als die “Beatlemania” die Popmusik prägte. Der Jazz sei damals quasi tot gewesen in der Stadt, die ihn einst hervorgebracht habe, klagten viele Journalisten, aber auch Jazzkenner. Tatsächlich brannte das Feuer des Jazz aber nur auf kleiner Flamme. Jacobsen nennt die Namen all der Musiker, die in diesem Jahrzehnt entweder wiederentdeckt wurden oder aber über kurz oder lang in ihre Heimatstadt zurückkamen und diese neu belebten. Vier Faktoren hätten in den 1960er Jahren ihren Ursprung gehabt, die für das Fortbestehen der Stadt als Jazzmekka sorgen sollten: die Eröffnung der Preservation Hall, die ab 1961 den älteren Musikern der Stadt Respekt zollte, die Gründung des Jazzmuseums, das später ins Louisiana State Museum übergeführt wurde, der Beginn des New Orleans Jazz and Heritage Festivals, sowie das wachsende Bewusstsein, dass auch die moderneren Spielarten ihren Ursprung in New Orleans hatten.
Jacobsens Buch handelt die dreißig Jahre jahrzehnteweise ab, und auch innerhalb dieser Großkapitel chronologisch. Er beginnt mit dem Tod Louis Armstrong 1971, der neben den Trauerfeierlichkeiten in New York auch mit einer Parade in New Orleans bedacht wurde. Jacobsen zählt die Clubs auf, bekannte wie Pete Fountain’s oder Al Hirt’s auf der Bourbon Street, und unbekanntere, kurzlebige genauso wie solche, die immer noch bestehen (darunter Fritzel’s European Jazz Pub”). Der Impresario George Wein machte das Jazz and Heritage Festival zu einem Publikumsmagneten; viele der hier lebenden Musiker sorgten in Repertoireorchestern wie dem New Orleans Ragtime Orchestra oder dem Louisiana Repertory Jazz Ensemble dafür, dass die musikalische Tradition der Stadt am Leben erhalten wurde. Jacobsen streicht die Bedeutung der Brassbands heraus und die Institutionalisierung von pädagogischen Programmen.
Die Struktur dieses Kapitels nehmen auch die folgenden Seiten auf. Für die 1980er Jahre erwähnt Jacobsen etwa das neue French Quarter Festival, schreibt über Brassbands, die den traditionellen Jazz mit Pop, Soul und modernem Jazz verbanden, über die Marsalis-Brüder, die anfingen weltweit von sich reden zu machen, und erwähnt eine neue Veröffentlichung für die städtische Musikszene, die Zeitschrift “OffBeat”. Für die 1990er Jahre berichtet er außerdem über das Bechet Centennial von 1997, über Doc Cheatham und Henry Butler, die das Musikleben der Stadt bereicherten, und endet mit der Beschreibung des Jazzdiskurses dieses Jahrzehnts, in dem es auch um die Deutungshoheit über die Jazzgeschichte ging und in dem Wynton Marsalis insbesondere die Stellung von New Orleans besonders zu betonen wusste.
Im Schlusskapitel macht sich Jacobsen Gedanken über das Alter des Publikums, aber auch über dessen Geschmack, die stärkere Akzeptanz mehrerer Genres bei jüngeren Hörern anstelle des alten Spartendenkens. Er regt eine demographische Untersuchung über das Jazzpublikum an, die etwa während des JazzFests durchgeführt werden könnte und von dessen Zahlen er sich erhofft, das sie die landesweite Studie zum Thema auf die Region herunterbrechen würden. Er reißt kurz die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Musikern an, die Tatsache, dass sich nur wenige von ihnen eine Krankenversicherung leisten können, und er betont die Bedeutung von Initiativen wie der New Orleans Musicians’ Clinic. Dabei bleibt er optimistisch, findet, dass die Musikszene in New Orleans nach wie vor ungemein kreativ ist und die Musiker selbst dafür sorgen, dass sie das auch bleibt.
Thomas Jacobsen bleibt in seinem Buch Chronist mit klaren Vorlieben. Er blickt nur sporadisch über die Jazzszene hinaus, obwohl der Jazz auch und gerade in New Orleans so eng mit der gesamten Kulturszene der Stadt verbunden ist. Blues oder Zydeco und andere in der Stadt mindestens genauso präsenten Spielformen kommen kaum vor. Nur in Nebensätzen spricht er die außerdem die Spannungen an, die sich aus dem Spagat zwischen Arm und Reich, aus dem in der Region nach wie vor herrschenden Rassismus ergeben. Jacobsen wollte Suhors Buch fortschreiben, vielleicht aber wäre es klug gewesen, statt der Zäsur der Jahrtausendwende noch zehn Jahre weiter zu gehen. Gerade in der Katrina-Katastrophe und dem Umgang der Stadt mit den Folgen nämlich erkennt man die Stärken der Communities, aus denen heraus einst auch der Jazz entstanden war. Ned Sublette hat in seinem Buch “The Year Before the Flood” (2009) gezeigt, wie hilfreich eine solch breitere Sicht sein kann.
Aber natürlich war das nicht Jacobsens Ansatz. Und so bleibt das Buch genau das, was der Titel verspricht: eine sehr persönliche Retrospektive über die Jazzszene in New Orleans über drei Jahrzehnte. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Für Freunde des New Orleans-Jazz ist es damit eine mehr als willkommene Übersicht über die Entwicklungen im letzten Viertel des 20sten Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (September 2015)
Verve. The Sound of America
von Richard Havers
München 2014 (Sieveking Verlag)
400 Seiten (78,00 Euro)
ISBN 978-3-944874-06-7
 Ein dicker Schinken… Man betrachtet die in jüngster Zeit gern publizierten Coffeetable-Books mit gemischten Gefühlen. In der Regel sind sie gut aufgemacht, reich an Fotos, ein wenig teuer, zumindest aber ein exzellentes Geschenk. Oft richten sich die Texte einfach deshalb, weil die Bücher sich verkaufen müssen, um sich zu finanzieren, an ein breiteres Publikum und sind damit für den Jazzfan, der bereits viel weiß, zwar ein nützliches, aber irgendwie auch überflüssiges Beiwerk. Für den Autor der vorliegenden dicken Schwarte über das Jazzlabel Verve war es also eine durchaus nicht einfache Aufgabe, die eingefleischten Fans genauso zu bedienen wie die bloß Interessierten, Wissen zu vermitteln über die verschiedenen Seiten der Plattengeschäfts von den 1940er Jahren bis in die Gegenwart, über die Künstler genauso zu berichten wie über ihre Produkte, über die Bedingungen der Aufnahme genauso wie über die Auswahl von Plattencovern, und das alles dann noch in den Kontext der Jazzgeschichte zu stellen.
Ein dicker Schinken… Man betrachtet die in jüngster Zeit gern publizierten Coffeetable-Books mit gemischten Gefühlen. In der Regel sind sie gut aufgemacht, reich an Fotos, ein wenig teuer, zumindest aber ein exzellentes Geschenk. Oft richten sich die Texte einfach deshalb, weil die Bücher sich verkaufen müssen, um sich zu finanzieren, an ein breiteres Publikum und sind damit für den Jazzfan, der bereits viel weiß, zwar ein nützliches, aber irgendwie auch überflüssiges Beiwerk. Für den Autor der vorliegenden dicken Schwarte über das Jazzlabel Verve war es also eine durchaus nicht einfache Aufgabe, die eingefleischten Fans genauso zu bedienen wie die bloß Interessierten, Wissen zu vermitteln über die verschiedenen Seiten der Plattengeschäfts von den 1940er Jahren bis in die Gegenwart, über die Künstler genauso zu berichten wie über ihre Produkte, über die Bedingungen der Aufnahme genauso wie über die Auswahl von Plattencovern, und das alles dann noch in den Kontext der Jazzgeschichte zu stellen.
Richard Havers hat diese Aufgabe mit seinem Buch über Norman Granz’ legendäres Verve-Label mustergültig bewältigt. Er zeichnet die Jazzentwicklung bis Swing und Bebop als eine Geschichte der Tonaufzeichnung und Plattenvermarktung nach. Drei der großen Namen seines Labels eröffnen die blockweise eingestreuten biographischen Kapitel: Louis Armstrong, Duke Ellington und Billie Holiday. Einen umfassenden Block nehmen die Tourneen und Plattenveröffentlichungen der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic ein, die Granz 1944 erstmals zusammenbrachte und die seine Karriere als Plattenboss über die Jahrzehnte begleiten sollte. Havers schreibt über das Konzept, den Erfolg, aber auch über Granz’s Einsatz gegen Rassismus in jenen Jahren, wenn er öffentlich und notfalls auch gerichtlich gegen jede Art der Diskriminierung gegen seine Künstler vorging.
Der Anfang von JatP lag noch vor Granz’s Arbeit als Plattenchef. Und vor Verve gab es erst einmal die Labels Clef und Norgran, von denen Havers im dritten Großkapitel erzählt. Er bildet die Seiten des 1949 erschienen Plattenalbums “The Jazz Scene” ab, eines einmaligen Projekts, in dem Granz die aktuellsten Strömungen im Jazz der Zeit dokumentieren wollte. Diese Veröffentlichung bestand aus 12 Schellackplatten, deren Cover in einem Album – ja, hier kommt der Begriff her – zusammengebunden waren. Erst mit dem Aufkommen der Langspielplatte Anfang der 1950er Jahre stieg Granz dann aber wirklich ins Plattengeschäft ein. Havers streift die Bedeutung David Stone Martins, der viele der frühen LP-Cover entwarf, und er bildet diese genauso wie die damals nicht weniger aufschlussreichen Labels selbst, also die runden Aufkleber auf der Vinylplatte, auf etlichen Seiten ab.
In den 1950er Jahren wurde das Label Verve zur wichtigsten Heimat des swingenden Mainstream. Mitschnitte vom Newport-Festival, Aufnahmen mit Charlie Parker, jede Menge Besetzungen um Meister wie Ella Fitzgerald Oscar Peterson, Ben Webster, Lester Young und viele andere schrieben Jazzgeschichte. Modernere Produktionen der 1960er Jahre mit Jimmy Smith, Stan Getz, Gerry Mulligan oder Gary McFarland hatte zum großen Teil schon nicht mehr Norman Granz zu verantworten, der sein Label 1960 für 2,5 Millionen Dollar an MGM verkauft hatte. In den 1970ern gründete Granz mit Pablo eine neue Plattenfirma, die an seinen alten Erfolg anknüpfte und viele der ihm wichtigen Künstler produzierte. Zugleich wurde sich Polygram, die inzwischen MGM und damit auch Verve geschluckt hatte, irgendwann bewusst, welch enormer Schatz da in den Archiven schlummerte und welch ikonische Bedeutung insbesondere auch der Labelname besaß. Junge Künstler wurden in den Katalog aufgenommen, auch nachdem Polygram 1999 in die Universal Music Group überführt wurde.
Richard Havers Buch ist ein beeindruckendes Werk. Der Text liest sich flüssig und bleibt dabei nicht in Details über einzelne Produktionen stecken, die man lieber in den dazugehörigen Plattentexten liest, sondern lässt den Leser an den programmatischen Entscheidungen des Labels teilhaben. Die kurzen Kapitel über die auf Verve produzierten Musiker sind vor allem biographische Einordnungen, bei denen man durchaus etwas mehr Labelbezug wünschen könnte. Dafür aber entschädigen die großartigen Fotos, sowohl Promo-Shots als auch seltene Bilder der Künstler auf der Bühne oder im Studio und die nach wie vor beeindruckenden Reproduktionen der Plattencover aus mehr als 60 Jahren Plattengeschichte.
Ein dicker Schinken… aber die Lektüre allemal wert!
Wolfram Knauer (August 2015)
Softly, with Feeling. Joe Wilder and the Breaking of Barriers in American Music
von Edward Berger
Philadelphia 2014 (Temple University Press)
400 Seiten, 35,00 US-Dollar
ISBN 978-1-43991-127-3
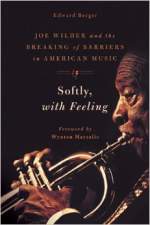 Joe Wilder war einer der stilleren Musiker der Jazzgeschichte, ein zuverlässiger Sectionman und Solist, immer Gentleman, keine Skandale, eine Karriere zwischen Jazz-Bigbands, Studioarbeit und klassischer Musik. Wilder war bei seinen Kollegen hoch angesehen, wegen seiner musikalischen Souveränität, aber auch, weil er wusste, was er wollte und seine Ansichten auch kundtat. 1953 tourte Wilder mit der Count Basie-Band und traf bei einem Konzert ein junges Mädchen. Sie sprach kaum Englisch, und er ließ ihr den Wunsch übersetzen, ob er ihre Adresse haben dürfe. Wilder begann eine Korrespondenz, erst auf Englisch, was sie sich übersetzen lassen musste, dann auf Schwedisch, das er eigens für sie lernte und dabei sogar darauf achtete, ihren regionalen Dialekt zu beherrschen. Sie schrieben einander täglich, und Wilder korrespondierte auch mit ihren Eltern. Per Post hielt er drei Jahre später um ihre Hand an. Sie reiste nach New York, und die beiden heirateten. Sie blieben ein Paar bis zu seinem Tod, kurz nach Fertigstellung dieses Buchs, seiner Biographie, die Edward Berger mit Hilfe der Wilder-Familie und ihrer Erinnerungen schrieb, für die er aber auch mit vielen der Kollegen Wilders sprach und deren Geschichten er immer wieder in die Zeitgeschehnisse einpasst.
Joe Wilder war einer der stilleren Musiker der Jazzgeschichte, ein zuverlässiger Sectionman und Solist, immer Gentleman, keine Skandale, eine Karriere zwischen Jazz-Bigbands, Studioarbeit und klassischer Musik. Wilder war bei seinen Kollegen hoch angesehen, wegen seiner musikalischen Souveränität, aber auch, weil er wusste, was er wollte und seine Ansichten auch kundtat. 1953 tourte Wilder mit der Count Basie-Band und traf bei einem Konzert ein junges Mädchen. Sie sprach kaum Englisch, und er ließ ihr den Wunsch übersetzen, ob er ihre Adresse haben dürfe. Wilder begann eine Korrespondenz, erst auf Englisch, was sie sich übersetzen lassen musste, dann auf Schwedisch, das er eigens für sie lernte und dabei sogar darauf achtete, ihren regionalen Dialekt zu beherrschen. Sie schrieben einander täglich, und Wilder korrespondierte auch mit ihren Eltern. Per Post hielt er drei Jahre später um ihre Hand an. Sie reiste nach New York, und die beiden heirateten. Sie blieben ein Paar bis zu seinem Tod, kurz nach Fertigstellung dieses Buchs, seiner Biographie, die Edward Berger mit Hilfe der Wilder-Familie und ihrer Erinnerungen schrieb, für die er aber auch mit vielen der Kollegen Wilders sprach und deren Geschichten er immer wieder in die Zeitgeschehnisse einpasst.
Wilder kam 1922 in Philadelphia zur Welt, in einer Familie, für die Musik wichtig war. Sein Vater verdiente war Lastwagenfahrer, spielte daneben anfangs Kornett, später Sousaphon und sogar Kontrabass. Joe lernte Kornett von einem Trompeter, der seinen Schülern vor allem einen klassischen Ansatz vermittelte. Wilder erzählt, wie er in den frühen 1930er Jahren Teil einer Radio-Jugendkapelle war, die regelmäßig von den namhaftesten Bands des Landes unterstützt – und angespornt – wurde. Wilder hatte das absolute Gehör und entwickelte schon früh den Ehrgeiz, auf seinem Instrument auch Stimmen zu spielen, die eigentlich für andere Instrumente geschrieben waren. Von der High School wechselte er auf eine Schule, deren Musikunterricht rein klassisch ausgerichtet war. Zu seinen Schulkameraden gehörten hier allerdings auch die späteren Jazzkollegen Red Rodney und Buddy DeFranco. Als seine Eltern sich scheiden ließen, war die Familie auf jeden Verdienst angewiesen, und Joe spielte mit verschiedenen Tanzorchestern der Stadt. 1941 wurde er Satztrompeter in der Les Hite Band, wechselte dann als erster Trompeter in Lionel Hamptons Band. Er trat seinen Wehrdienst bei den Black Marines an, kehrte zu Hampton zurück, spielte schließlich mit Jimmie Luncefords Band, mit Lucky Millinder, Sam Donahue und Herbie Fields. Zwischendurch saß er 1947 auch eine Weile in Dizzy Gillespies Bebop-Bigband, in der er, eher Swingspieler, sich etwas fremd fühlte, auch wenn er als versierter Musiker ein fester Anker des Trompetensatzes war.
Anfang der 1950er Jahre gehörte Wilder zu den ersten schwarzen Musikern, die in einer der Broadway-Show-Orchester spielen durften. Seit 1957 war er reguläres Mitglied des ABC Orchesters, spielte im Auftrag des Senders Jazz, Werbung, Livemusik zu Radioshows, aber auch klassische Konzerte. 1962 war er mit von der Partie, als Benny Goodman vom amerikanischen State Department auf eine Tournee in die Sowjetunion geschickt wurde. Die Reise machte später auch wegen der Art und Weise Furore, wie Goodman seine Musiker behandelte – und Wilder verklagte ihn am Ende vor dem Schiedsgericht der Musikergewerkschaft, weil der Klarinettist ihm die Gage gekürzt hatte.
Berger erklärt Wilders Stil anhand des Albums “Wilder ‘n’ Wilder” aus dem Jahr 1956 und insbesondere anhand Wilders Solo über “Cherokee”, das einen ungeheuren Einfluss auf nachfolgende Trompeter hatte, auch wenn Wilder selbst nie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Seine klassische Technik machte ihn zu einem beliebten Musiker für komplexere Third-Stream-Kompositionen, etwa von Gunther Schuller oder in Johnny Richards wenig bekannten “Annotations of the Muses”.
Wilder hatte mit klassischer Musik begonnen, sich dem Jazz dann gezwungenermaßen zugewandt, weil er wusste, dass er als Schwarzer in diesem Genre keine Chancen hatte. Edward Berger widmet diesem Phänomen des Rassismus in amerikanischen Sinfonieorchestern ein eigenes Kapitel. Wilder wurde 1964 Mitglied der Symphony of the New World, eines neuen Orchesters, in dem sich das ganze Amerika widerspiegeln können sollte. Berger erzählt, wie allein die Existenz eines solchen “integrierten Orchesters” zu einem geänderten Bewusstsein und auch dazu führte, dass zwei Musiker, nämlich der Bassist Art Davis und der Cellist Earl Madison, das New York Philharmonische Orchester vor der New York City Commission on Human Rights verklagten. Wilder war als Zeuge bei der Anhörung beteiligt. In den 1960er und frühen 1970er Jahren jedenfalls war Wilder in diversen klassischen Ensembles aktiv. Ein Höhepunkt dieser Arbeit war gewiss die “Sonate für Trompete und Piano”, die der Komponist Alec Wilder (nicht verwandt) ihm auf den Leib schrieb.
In den frühen 1970er Jahren begannen die Fernsehanstalten aus Kostengründen auf Livebands zu verzichten. Wilder saß in der Band der “Dick Cavett Show”, bis diese 1974 abgesetzt wurde; danach war er wieder Freiberufler. Er kehrte in Broadway-Bands zurück oder spielte mit dem Tanzorchester von Peter Duchin, nahm aber auch an jazz-haltigeren Aufnahmesessions von Kollegen wie Johnny Hartman, Helen Humes, Teresa Brewer oder Anita O’Day teil. Er trat mit einem Bruder-im-Geiste auf, dem Saxophonisten und Komponisten Benny Carter, und er wurde Mitglied in diversen Repertory-Bands, die in diesen Jahren aufkamen. 1992 tourte er mit dem Lincoln Center Jazz Orchestra, von 1991 bis 2002 gehörte er dem Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra an. Nebenbei begann er zu unterrichten, seit 2002 an der renommierten Juilliard School in New York.
Ed Bergers Biographie ist voller interessanter Facetten zwischen Jazz- und amerikanischer Kulturgeschichte. Persönliche Aspekte im Leben des Trompeters Joe Wilder bleiben – von der frühen Jugend und der Geschichte seiner zweiten schwedischen Frau einmal abgesehen – meist außen vor. Bergers Exkurse in die Welt der Studiobands New Yorks, der Broadway-Orchester, der Fernseh- und Plattenstudios und der sinfonischen Musik sind neben dem eigentlichen Thema (also: Wilder selbst) wertvolle Ergänzungen eines oft viel zu eingeengt betrachteten Jazzkontextes. Auch Jazzmusiker sind schließlich nicht nur auf einem Feld aktiv, und jeder Bereich, in dem sie sich tummeln, hat seine eigenen ästhetischen und wirtschaftlichen Regeln. Berger gelingt es genau diese Unterschiede deutlich zu machen, kaum wertend und damit wohl sehr im Sinne Wilders, für den im Vordergrund stand, sein technisches Können so einzusetzen, dass die Musik, die er gerade machte, möglichst gut wurde.
Manchmal scheint sich Berger in Details zu verlieren, allerdings verlangt die Vielseitigkeit seines Sujets nun mal ein Portrait auf verschiedenen Ebenen. Die Diskographie am Ende seines Buchs ist durchaus beispielhaft für das Problem seines Projekts: Sie listet eben nicht nur die Jazztitel auf, sondern auch Aufnahmen aus dem Pop und leichten klassischen Kontext. “Softly, with Feeling” ist ein würdiges Portrait eines der vielleicht würdigsten Musiker des Jazz, der bei Mitmusikern durch die Bank so beliebt war, dass die einzige annähernd kritische Bemerkung, die Berger einem Kollegen entlocken konnte, die Aussage Dick Hymans war: “Er zog sich immer ein bisschen förmlicher an als eigentlich nötig war.”
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Berlin / Berlin. Kunststücke aus Ost und West
herausgegeben von Ulli Blobel & Ulrich Steinmetzger
Berlin 2014 (jazzwerkstatt)
211 Seiten, 24,90 Euro
ISBN: 978-3-981-14852-6-4
 Rainer Bratfisch gab vor kurzem eine dicke Schwarte heraus, in der er der Jazzstadt Berlin ein würdiges Denkmal setzte. Ja, Berlin war bereits in den 1920er Jahren eine Metropole des Jazz in Europa gewesen und blieb dies bis ins 21ste Jahrhundert hinein. Die Faszination der Hauptstadt für Musiker und Künstler aber versteht man nicht mit der selektiven Lupe auf ein ausgewähltes Genre, sondern erst im Blick auf das kreative Ganze, das Berlin ausmachte. Ulli Blobel und Ulrich Steinmetzger haben in ihrem Buch genau diese Vielfalt im Blick, die Vielfalt in der doppelten Hauptstadt Berlin (Ost) und Berlin (West).
Rainer Bratfisch gab vor kurzem eine dicke Schwarte heraus, in der er der Jazzstadt Berlin ein würdiges Denkmal setzte. Ja, Berlin war bereits in den 1920er Jahren eine Metropole des Jazz in Europa gewesen und blieb dies bis ins 21ste Jahrhundert hinein. Die Faszination der Hauptstadt für Musiker und Künstler aber versteht man nicht mit der selektiven Lupe auf ein ausgewähltes Genre, sondern erst im Blick auf das kreative Ganze, das Berlin ausmachte. Ulli Blobel und Ulrich Steinmetzger haben in ihrem Buch genau diese Vielfalt im Blick, die Vielfalt in der doppelten Hauptstadt Berlin (Ost) und Berlin (West).
Ihr Buch beginnt mit der Teilung, mit Bertold Brechts Gedicht “O Deutschland, wie bist du zerrissen” und mit Georg-Albrecht Eckles Blick auf Brechts Hoffnungen für ein neues Deutschland. Karl Dietrich Gräwe betrachtet mit Boris Blacher und Paul Dessau zwei Komponisten, die sich beide in ihrem Leben für die Wahlheimat Berlin entschieden hatten, um sich dann aber in zwei unterschiedlichen Hälften der Stadt wiederzufinden. Friederike Wißmann geht ähnlich an Hanns Eisler und Hans Werner Henze heran, die sie insbesondere in ihren Vokalkompositionen miteinander vergleicht. Insa Wilke stellt den Dichter Thomas Brasch vor, der seine Lyrik mit der Rockmusik verglich. Judith Kuckart beleuchtet die DDR-Tournee des Tanztheaters Wuppertal unter Pina Bausch im Jahr 1987. Klaus Völker betrachtet die Theaterlandschaft in Ost und West zwischen 1945 und 1989. Andreas Öhler porträtiert Wolf Biermann, Andreas Tretner die freie Musik eines Anthony Braxton, Ronald Galenza den, wie er es nennt, “Kalten Krieg der Konzerte”, Rock- und Popevents der 1970er bis 1980er Jahre. Christoph Dieckmann betrachtet die DDR-Rockszene der späten 1980er Jahre, Rainer Bratfisch die Lebens- und Arbeitsreise des Saxophonisten Ernst-Ludwig Petrowsky und der Sängerin Uschi Brüning, Christian Broecking die Hingabe des Pianisten Alexander von Schlippenbach. Bert Noglik identifiziert Einflüsse auf und die musikalische Identität des Pianisten Ulrich Gumpert. Kapitel über die Berliner Festspiele (Torsten Maß), Die Untergangsfeiern der DDR (Christoph Funke) und die ersten Jahre nach 1989 (Helmut Böttiger) beschließen das reich bebilderte Buch, dem es damit tatsächlich gelingt, ein wenig der Spannung dieser Frontstadt zwischen Ost und West zu vermitteln, der lebendigen Kultur, der Diskurse, die von beiden Seiten angestachelt, aber nie richtig ausdiskutiert wurden.
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Tal Farlow. Un accord parfait. Une biographie illustré / A Life in Jazz Guitar. An Illustrated Biography
von Jean-Luc Katchoura mit Michele Hyk-Farlow
Paris 2014 (Paris Jazz Corner)
342 Seiten, 1 beigeheftete CD, 69 Euro
Zu bestellen über Paris Jazz Corner
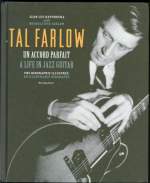 1983 half der junge Architekturstudent Jean-Luc Katchoura bei der Organisation eines Gitarrenfestivals in Frankreich, wo er zum ersten Mal den Gitarristen Tal Farlow hörte. Schon im folgenden Jahr begleitete er diesen auf seiner Sommertournee als sein europäischer Agent. Sie blieben in Kontakt, und nach Farlows Tod entwickelten seine Witwe und Katchoura die Idee, die vielen Erinnerungsstücke, die sich in ihrem Besitz befanden, in einem Buch zu präsentieren.
1983 half der junge Architekturstudent Jean-Luc Katchoura bei der Organisation eines Gitarrenfestivals in Frankreich, wo er zum ersten Mal den Gitarristen Tal Farlow hörte. Schon im folgenden Jahr begleitete er diesen auf seiner Sommertournee als sein europäischer Agent. Sie blieben in Kontakt, und nach Farlows Tod entwickelten seine Witwe und Katchoura die Idee, die vielen Erinnerungsstücke, die sich in ihrem Besitz befanden, in einem Buch zu präsentieren.
Es ist eine überaus dokumentenreiche Biographie geworden, zweisprachig auf Englisch und Französisch gehalten, mit Familienfotos, Postkarten und vielen anderen Dokumenten sowie einer lebendig erzählten Biographie des Gitarristen, der 1921 in North Carolina geboren wurde, sich mit neun Jahren selbst das Mandolinespiel beibrachte und schließlich durch Platten von Charlie Christian und Art Tatum zum Jazz kam. Der Pianist Jimmy Lyon überredete ihn, die Musik zum Beruf zu machen. Farlow spielte in der Band des Schlagzeugers Billy Bank, dann mit der Pianistin Dardanelle, mit der er unter anderem im Cove in Philadelphia auftrat, wo sich das Trio mit Art Tatum abwechselte. 1945 ging Farlow zurück in seine Heimatstadt und verdiente sich sein Geld mit Schildermalen, was er vor seiner musikalischen Laufbahn gelernt hatte. Er mischte in Jam Sessions mit, bis er 1948 Mundell Lowe im Trio der Vibraphonistin Marjorie Hyams ersetzte.
Farlow zog nach New York, und wurde 1949 Mitglied im Red Norvo Trio, erst mit Red Kelly, dann mit Charles Mingus am Kontrabass. 1953 machte er seine erste Aufnahme für Blue Note, spielte außerdem in der Gramercy Five des Klarinettisten Artie Shaw. All diese Erfahrungen ermöglichten es ihm 1954 selbst als Bandleader in Erscheinung zu treten, mit Alben erst auf Blue Note, dann auf Norman Granz’s Norgran-Label. Farlow machte sich einen Namen mit seinem Trio, dem der Pianist Eddie Costa angehörte, nahm aber auch an Aufnahmesessions etwa mit Oscar Pettiford oder den Metronome All Stars teil. Er zog nach Sea Bridge, einem Fischerstädtchen in New Jersey, ging fischen, malte Schilder, gab Gitarrenunterricht und trat ab und an in nahegelegenen Clubs auf. Erst 1967, fast zehn Jahre nach seinem Umzug nach Sea Bridge, kehrte er auf die New Yorker Jazzszene zurück. Er wurde für die Newport All-Stars engagiert, spielte Duos etwa mit Barney Kessel oder Joe Pass. In den Mitt-1970er Jahren profitierte er von dem wiedererstarkten Interesse an den Künstlern des Mainstream-Jazz, nahm etliche Platten für Concord und andere Labels auf und stand im Fokus eines 1980 gedrehten Dokumentarfilms über seine Kunst. Farlow ging auf Tournee durch Europa und Japan, mit eigenen Bands, als Solist in anderen Bands oder mit den Great Guitars, in dem Farlow anfangs Herb Ellis ersetzte, wann immer der anderweitig beschäftigt war, und schließlich Barney Kessel, als der nach einem Schlaganfall nicht mehr spielen konnte. In den 1990er Jahren gab es eine Neuausgabe dieser Band mit Farlow, Attila Zoller und Jimmy Raney. 1997 wurde ein Speiseröhrenkarzinom bei Farlow festgestellt, das bereits Metastasen gebildet hatte und an dessen Folgen er am 25. Juli 1998 verstarb.
Katchoura erzählt die Lebensgeschichte Tal Farlows vor allem anhand von Interviewauszügen und persönlichen Fotos und Dokumenten. Neben Biographischen erfahren wir dabei auch Details etwa über die verschiedenen Gitarren, die er über die Jahre spielte, oder über den Entwurf eines Amplifier-Stuhls, den Farlow in den 1960er Jahren tatsächlich baute. Eigene Kapitel befassen sich mit für Farlow wichtigen Kollegen, den Pianisten Jimmy Lyon und Dardanelle, dem Vibraphonisten Red Norvo und dem Bassisten Charles Mingus. Eine Diskographie und eine Bibliographie beschließen das Buch; doch ganz am Ende heftet dann auch noch eine Zugabe, eine CD mit elf Tracks, Interviewausschnitten einer Radiosendung mit Phil Schaap und unveröffentlichten Titeln etwa von Duos mit Gene Bertoncini, Red Mitchell oder Jack Wilkins.
“Tal Farlow. A Life in Jazz Guitar” ist eine labor of love, eine umfangreiche Dokumentation seines Lebens und kommt in der dabei eher unkritischen Herangehensweise einer subjektiven (aber nie geschriebenen) Autobiographie des Gitarristen vielleicht am nächsten.
Wolfram Knauer (Mai 2015)
Charlie Parker i Sverige – med en avstickare till Köpenhamn
von Martin Westin
Stockholm 2014 (Premium Publishing)
181 Seiten, 283 Schwedische Kronen
ISBN: 978-91-87581-05-2
 Im November 1950 besuchte Charlie Parker für 10 Tage Skandinavien. Seit 1947 wurden seine Platten bereits in Schweden rezipiert; 1948 hatte Dizzy Gillespies Bigband hier Konzerte gegeben, und als Parker 1949 zum Jazzfestival nach Paris eingeladen wurde, schloss er erste Kontakte zu schwedischen Musikern und Redakteuren. Der Journalist und Konzertveranstalter Nils Hellström hatte dabei die Idee, Parker im nächsten Jahr direkt nach Schweden einzuladen. Er verhandelte mit Parkers New Yorker Agenten Billy Shaw und einigte sich auf Gagen- und Reisekosten.
Im November 1950 besuchte Charlie Parker für 10 Tage Skandinavien. Seit 1947 wurden seine Platten bereits in Schweden rezipiert; 1948 hatte Dizzy Gillespies Bigband hier Konzerte gegeben, und als Parker 1949 zum Jazzfestival nach Paris eingeladen wurde, schloss er erste Kontakte zu schwedischen Musikern und Redakteuren. Der Journalist und Konzertveranstalter Nils Hellström hatte dabei die Idee, Parker im nächsten Jahr direkt nach Schweden einzuladen. Er verhandelte mit Parkers New Yorker Agenten Billy Shaw und einigte sich auf Gagen- und Reisekosten.
Parker reiste in ein Land, in dem erst im Monat zuvor ein neuer König gekrönt worden war. Mit ihm kam auch Roy Eldridge in Stockholm an, der aus Paris anreiste, wo er mit Benny Goodmans Band gespielt hatte. Sie wurden von Hellström sowie von jungen schwedischen Musikern und Fans empfangen. Im Doppelprogramm spielte Eldridge mit der Band des Pianisten Charles Norman und Parker mit jener des Trompeters Rolf Ericson und dem Saxophonisten Arne Domnérus, in der auch der Baritonsaxophonist Lars Gullin mitwirkte. Sie traten im renommierten Stockholmer Konserthuset auf, danach aber mischte Parker auch bei Jam Sessions mit. Am nächsten Tag fuhren alle gemeinsam mit dem Zug nach Göteborg, danach hatte Eldridge ein Konzert in Kopenhagen, während Parker nach Malmö weiterreiste. Am 3. November kam auch Parker nach Kopenhagen, wo sie das Doppelkonzert in den K.B. Hallen wiederholten. Parker spielte im Folkparken von Helsingborg und in Jönköping und kehrte dann über Gävle nach Stockholm zurück, wo er unter anderem mit Pute Wickman und Toots Thielemans in einer Session auftrat.
Auf dem Rückweg nach New York machte Parker schließlich noch in Paris Station, wurde dort von Charles Delaunay in Empfang genommen und besuchte den Schlagzeuger Kenny Clarke und seine damalige Lebensgefährtin, die hochschwangere Sängerin Annie Ross. Delaunay hatte eine Aufnahme mit Parker sowie einen Auftritt beim Paris Jazz Festival geplant, den Parker aber kurzfristig absagen musste, weil er sich nicht wohl fühlte und stattdessen über London zurück nach New York flog.
Martin Weston hat die Reise Parkers nach Skandinavien sorgfältig recherchiert. Er hat in alten Zeitschriften geblättert, fand zeitgenössische Konzerthinweise und Zeitungsrezensionen, den Vertrag, den Parker mit Hellström abgeschlossen hatte, vor allem aber jede Menge an Fotodokumenten, seltene, bisher kaum gesehene Bilder, die Bird auf der Bühne oder mit Kollegen und Fans zeigen. Er zitiert aus Interviews mit Zeitzeugen, und er listet die Aufnahmen auf, die Parker in diesen wenigen Tagen machte.
Für die schwedischen Musikerkollegen war Parkers Besuch ein Ohrenöffnen sondergleichen. Sein so völlig anderes rhythmisches Konzept schlug die einen in seinen Bann, während es andere eher abschreckte und in der Folge den stärker aufs Melodische fokussierten Cool Jazz als ihr Spielfeld wählen ließ.
“Charlie Parker i Sverige” ist eine spannende Detailstudie über einen Musiker, dessen Reise nach Schweden auch eine kurze Flucht aus der Realität seiner New Yorker Drogensucht war, sowie über eine junge schwedische Jazzszene, die durch diesen Besuch angespornt wurde, den modernen Jazz als Aufbruch zu verstehen.
Wolfram Knauer (April 2015)
Art. Why I Stuck with a Junkie Jazzman
von Laurie Pepper
Richmond/CA 2014 (Widow’s Taste / Art Pepper Music Corp.)
374 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1494297572
 In den 1970er Jahren erschien “Straight Life”, Art Peppers Lebensgeschichte, aufgezeichnet von seiner Frau, Laurie Pepper, in der sich der Saxophonist, wie sie im Vorwort ihres neuen Buchs schreibt, als “verlorenes, verzweifeltes Genie” darstellte und sie als seinen Schutzengel. “Während unserer Ehe gelang es uns erfolgreich diese Geschichte darzustellen”, schreibt sie. “Aber ich war kein Engel, und wir retteten uns gegenseitig.” Dieses neue Buch nun sei ihre eigene Geschichte.
In den 1970er Jahren erschien “Straight Life”, Art Peppers Lebensgeschichte, aufgezeichnet von seiner Frau, Laurie Pepper, in der sich der Saxophonist, wie sie im Vorwort ihres neuen Buchs schreibt, als “verlorenes, verzweifeltes Genie” darstellte und sie als seinen Schutzengel. “Während unserer Ehe gelang es uns erfolgreich diese Geschichte darzustellen”, schreibt sie. “Aber ich war kein Engel, und wir retteten uns gegenseitig.” Dieses neue Buch nun sei ihre eigene Geschichte.
Es beginnt düster, im August 1968, als Laurie nach einer langen Leidensgeschichte mit Depressionen und Drogenmissbrauch einen erfolglosen Selbstmordversuch unternahm und sich danach selbst in Kaliforniens erste Drogenklink Synanon einweisen ließ. Hier traf sie neun Monate später auf Art Pepper. Als Synanon Ende 1971 ein Rauchverbot einführte, hielt der es nicht mehr aus. Er verließ die Klinik. Laurie folgte ihm wenige Monate später.
Schon in Synanon fand Laurie, dass die vielen Geschichten, die Art ihr aus seinem Leben erzählt hatte, genügend Stoff für ein Buch böten. Beide waren Leseratten, Laurie hatte darüber hinaus ein wenig journalistische Erfahrung, als Fotografin, aber auch durch kleine Artikel, die sie für linke Zeitungen geschrieben hatte. Sie besorgte sich einen billigen Kassettenrecorder und stellte die erste Frage: “Art, sag mir, warum du dieses Buch machen willst.” – “Eigentlich ist das doch deine Idee gewesen”, antwortete Pepper, erinnerte sich dann aber auch gleich: Schon im Gefängnis von San Quentin habe man ihn darauf angesprochen, dass sein Leben genügend Stoff für ein Buch böte. Und da er ahne, dass er nicht mehr lange zu leben habe, fände er, dass es an der Zeit sei, damit zu beginnen.
So also entstand “Straight Life”. Laurie erinnert sich daran, wie Art seine Geschichten mit dramaturgischem Gespür für die Wendungen und den Verlauf erzählen konnte, ganz so als ob er ein Solo auf seinem Saxophon spielte. Die Arbeit am Buch habe auch ihm bewusst gemacht, wie groß sein Talent zum Geschichtenerzählen war. Sie stellte zugleich eine Art Therapie dar, die Neuinterpretation seines Lebens. Einige seiner Anekdoten ließ Laurie ihn wieder und wieder erzählen, um mehr zu erfahren und tiefer einzudringen. Sie berichtet, wie der Prozess des Schreibens teilweise zum Kampf wurde, wenn Art betrunken war oder high durch andere Substanzen. Er habe zwei Seiten gehabt, und die, die sie nicht mochte, nannte sie irgendwann “Ruthra” oder “Reppep”, also Arthur bzw. Pepper rückwärts gelesen. Laurie erzählt vom gemeinsamen Leben, nachdem der Saxophonist sich in ein Methadonprogramm eingeschrieben hatte, von den wenigen Freunden, die sie hatten und die alle irgendwie im Netzwerk der Drogen, von Synanon oder Methadon steckten.
Eines Tages wurde Art Pepper eingeladen einen Workshop an der Ostküste zu geben – ausgerechnet auf der Klarinette, einen Instrument, das er eigentlich nur ab und zu als Zweitinstrument gespielt hatte. Sie zogen in ein kleines Haus in Van Nuys, einem Vorort von Los Angeles, und Pepper trat häufiger auf, erst mit lokalen Musikern, dann mit dem experimentellen Don Ellis Orchestra, bald aber auch bei Festivals oder in namhaften Clubs.
Anschaulich berichtet Laurie von den zwei Seiten im Leben ihres Mannes: dem glamourösen der gefeierten Konzerte und dem des Drogenabsturzes, der an jeder Ecke lauerte. Sie berichtet von Arts erster Reise nach Japan und wie sie das Methadon für ihren Mann in einer Shampoo-Flasche schmuggelte, aber auch vom Misstrauen Peppers gegenüber seinen Mitmusikern.
Durch einen Fan kam Laurie in Kontakt zu einem Verlag für “Straight Life”. Im September 1978 schloss Pepper einen Vertrag mit der Plattenfirma Fantasy ab und ging bald darauf ins Studio. Im nächsten Jahr erschien das Buch und erhielt höchstes Lob in einigen der wichtigsten Gazetten des Landes. Das Buch gab Peppers Karriere einen neuen Schub, Tourneetermine überall in den USA und in Europa, die Chance für eine Aufnahme mit Streichern.
Laurie war inzwischen Managerin, Krankenschwester, Dealerin, Psychotherapeutin, und das alles in einem Zustand, in dem sie gut selbst Therapie vertragen hätte. Sie sorgte dafür, dass Art seine Zahnprothesen trug, dass sein Buch mit einem Gürtel fest umbunden war, der seine riesige Hernie im Platz hielt und ihm die Bauchmuskulatur gab, die er fürs Spielen benötigte, seit einem Milzriss Ende der 1960er Jahre aber nicht mehr hatte. Am 30. Mai 1982 trat der Saxophonist bei einem Festival in Washington auf, fand, dass die Zeit für seinen Set zu kurz war und konnte daher sein Schlussthema, “Straight Life” nicht mehr spielen. So kam es, erzählt Laurie Pepper, dass “When You’re Smiling” zum letzten Titel wurde, den Art Pepper in seinem Leben gespielt hatte. Er habe es auf der Klarinette gespielt, dem Instrument, auf dem er begonnen hatte. Neun Tage später lag er im Koma. Sechs Tage darauf war er tot.
Im Rest ihres Buchs erzählt Laurie Pepper, wie sie nach dem Tod Ihres Mannes ihr Leben meisterte, sich auf Tugenden und Talente besann, die sie zwar auch genutzt hatte, um Art am Leben zu halten, die jetzt aber ihr selbst helfen konnten. Sie befasste sich mit den juristischen Fallstricken des Musikgeschäfts und sorgte dafür, dass der Gewinn, den Arts Musik immer noch einfuhr, auch ihr zugute kam.
In ihrem Buch “Art. Why I Stuck With a Junkie Jazzman” wollte Laurie Peppers über sich selbst statt über Art Pepper erzählen. Der größte Teil ihres Buchs handelt allerdings von niemand anderem als Art Pepper, seiner Sucht, seiner Musik, seinen Problemen. Die Frage, warum sie es so lange mit einem Junkie erhält hat am Ende zwei Antworten: Gewiss war es vor allem Liebe, daneben aber hatte sie schnell erkannt, dass, indem sie sich um Art Pepper kümmerte, sie die Dämonen in sich selbst zähmen konnte. Und wenn man erkennt, dass Laurie Pepper sich irgendwann, nachdem sie einander in Synanon begegnet waren, durch ihn definierte, liest man ihre Darstellung der Beziehung, ihre Sicht auf seine Krankheit und seine Musik auch als einen Blick ins Innere der Autorin selbst.
Wie “Straight Life” ist auch “Art. Why I Stuck With a Junkie Jazzman” schonungslos, bietet stellenweise eine fast schon schmerzhafte Lektüre, und doch auch einen tiefem Einblick in die Realität eines Musikerlebens.
Wolfram Knauer (April 2015)
Benson. The Autobiography of a Jazz Legend
von George Benson (& Alan Goldsher)
Boston 2014 (Da Capo Press)
222 Seiten, 25,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-306-82229-2
 1982 nahm George Benson die Einladung an, mehrere Konzerte in Südafrika zu spielen, das damals noch vom Apartheid-Regime regiert wurde. Benson war naiv in die Angelegenheit hineingestolpert und musste nun sehen, wie er die Konzerte zu einem Erfolg brachte, der von Menschen aller Hautfarben genossen werden konnte. Irgendwie gelang es ihm, und beim Abschlusskonzert in Kapstadt sorgte er dafür, dass Schwarz und Weiß im ausverkauften Saal nebeneinander saßen und alle, Publikum wie Musiker, zu Tränen gerührt waren von der Macht der Musik. 23 Jahre später spielte er wieder in Südafrika und traf auf einen Mann, der ihn fragte, ob er sich noch an ihn erinnere. “Klar, du hast damals mit meinen Bodyguards herumgehangen”, antwortete Benson, worauf der Mann erklärte: “Das stimmt, nur waren das keine Bodyguards. Die Männer hätten dich umgebracht, wenn es einen Aufstand gegeben hätte. Man hätte gesagt, du wärst im Zuge der Unruhen ums Leben gekommen, und Südafrika hätte nie wieder ein gemischtes Konzert erlebt.” Wie zum Teufel, schließt George Benson diese Anekdote, hat es nur dazu kommen können, dass ein Kid aus ärmlichen Verhältnissen in Pittsburgh in die Lage geriet, mitten in Südafrika fast Ziel eines Attentats geworden zu sein?
1982 nahm George Benson die Einladung an, mehrere Konzerte in Südafrika zu spielen, das damals noch vom Apartheid-Regime regiert wurde. Benson war naiv in die Angelegenheit hineingestolpert und musste nun sehen, wie er die Konzerte zu einem Erfolg brachte, der von Menschen aller Hautfarben genossen werden konnte. Irgendwie gelang es ihm, und beim Abschlusskonzert in Kapstadt sorgte er dafür, dass Schwarz und Weiß im ausverkauften Saal nebeneinander saßen und alle, Publikum wie Musiker, zu Tränen gerührt waren von der Macht der Musik. 23 Jahre später spielte er wieder in Südafrika und traf auf einen Mann, der ihn fragte, ob er sich noch an ihn erinnere. “Klar, du hast damals mit meinen Bodyguards herumgehangen”, antwortete Benson, worauf der Mann erklärte: “Das stimmt, nur waren das keine Bodyguards. Die Männer hätten dich umgebracht, wenn es einen Aufstand gegeben hätte. Man hätte gesagt, du wärst im Zuge der Unruhen ums Leben gekommen, und Südafrika hätte nie wieder ein gemischtes Konzert erlebt.” Wie zum Teufel, schließt George Benson diese Anekdote, hat es nur dazu kommen können, dass ein Kid aus ärmlichen Verhältnissen in Pittsburgh in die Lage geriet, mitten in Südafrika fast Ziel eines Attentats geworden zu sein?
Pittsburgh also ist der Ausgangspunkt dieser Karriere, Industriestadt, Arbeiterstadt, Rassentrennung. Pittsburgh hatte eine Reihe wichtiger Jazzmusiker hervorgebracht, Earl Hines, Erroll Garner und Art Blakey unter ihnen… und George Benson, der hier 1943 geboren wurde. Die Kirche brachte ihn zur Musik; in der Schule fiel seine Stimme auf; er spielte ein wenig Klavier und Geige. Sein Stiefvater brachte eine Gitarre mit ins Haus, aber da die zu groß für ihn war, lernte er seine ersten Akkorde auf einer Ukulele. Er verkaufte Zeitungen und merkte eines Tages, dass er mit ein wenig Ukulele-Spiel und Gesang mehr verdienen konnte. Ein Nightclub-Besitzer entdeckte ihn und bot seiner Mutter an, ihn für 40 Dollar pro Abend am Wochenende bei sich auftreten zu lassen. Und so ging es weiter… nur in Amerika! Ein Friseur um die Ecke ließ ihn rufen, damit er seine Gibson-Gitarre spielen könne; dann der Besitzer einer Imbissstube, der ihn nach New York mitnahm, um eine Platte aufzunehmen. Damit wurde es nichts, doch sechs Monate später ging Benson für RCA ins Studio und spielte, gerade mal elf Jahre alt und noch nicht im Stimmbruch, seine ersten vier Titel ein.
Mit 15 gründete Benson mit seinem Cousin die Altairs, eine Doo-Wop-Gruppe. Die Leute mochten sein Gitarrenspiel, aber er selbst sah sich vor allem als Sänger. Er hörte Platten und fragte alle Instrumentalisten aus, die in die Stadt kamen. Ihm gefielen die Orgel-Combos, die in den späten 1950er, frühen 1960er Jahren populär waren; er begann sich für Jazzgeschichte zu interessieren, für Musiker wie Lester Young oder Charlie Parker, und er hörte Platten von Kenny Burrell, Grant Green und Wes Montgomery. Und plötzlich war er selbst, der sich nie als Jazzmusiker gesehen hatte, als Gitarrist in Brother Jack McDuffs Trio in New York aktiv. Der Organist war von Bensons Groove und Sound angetan, hätte ihn aber beinahe gleich wieder rausgeschmissen, als er entdeckte, dass Benson zwar Rhythm ‘n’ Blues spielen konnte, von Jazzimprovisation aber keine Ahnung zu haben schien. Benson erzählt, wie er die anderen Bands auscheckte, die in den Clubs des Big Apple zu hören waren, und wie er sich sein Jazz-Handwerkszeug nach und nach draufgeschafft habe, mal neugierig und begeistert, mal eher widerwillig. McDuff lehrte ihn, wie man mit Groove und Rhythmus das Publikum für sich gewinnen, ihnen mit Technik zeigen könne, dass man sein Instrument beherrsche, dass aber der Blues die Grundlage des Ganzen sei, weil er alles zusammenbinde.
Mitte der 1960er Jahre hatte Benson für sich akzeptiert wohl doch Jazzmusiker zu sein, doch Mitte der 1960er Jahre wurde es für Jazzmusiker zugleich immer schwerer, von ihrer Musik leben zu können. Benson, der 1964 für das Label Prestige sein erstes Album unter eigenem Namen aufgenommen hatte, spielte in Striptease-Clubs und billigen Kneipen, und in einer solchen wurde er von John Hammond angesprochen, dem legendären Produzenten, der ihm einen Vertrag bei Columbia Records anbot. Benson hatte schon zu diesem Zeitpunkt ein feines Gespür für die Balance zwischen Musikalität und Kommerz. Seine erste Columbia-Platte verband seine Liebe zum Jazz mit aktuellen Soul-Covern. Sein Crossover-Stil war erfolgreich, wurde von Jazzerseite aber auch kritisiert. Als nächstes unterschrieb er beim Label Verve, das damals von Creed Taylor geleitet wurde und Wes Montgomery einige seiner besten Platten beschert hatte. Taylor engagierte Herbie Hancock und Ron Carter für eine Platte, und kurz danach rief Miles Davis an und schlug Benson vor, gemeinsam ins Studio zu gehen. Die Erinnerungen des Gitarristen an die denkwürdige Aufnahmesitzung für “Miles in the Sky” ist ein besonders lesenswertes Kapitel des Buchs, über den Trompeter, sein Verhältnis zu Mitmusikern, und seinen allgemeinen Zorn, der aus der Stimmung der Zeit und den Spannungen zwischen Schwarz und Weiß heraus zu verstehen ist. In der Folge bot Miles Benson sogar einen Platz in seiner Band an, doch der wollte seine eigene Karriere forcieren.
Creed Taylor nahm Benson mit zum Label CTI Records, auf dem der Gitarrist seine Mischung aus Soul, Funk und Modern Jazz weiter entwickelte. Er war einer der wenigen Künstler, dem der Spagat zwischen Jazz und populärer Musik nachhaltig gelang. Seine Soulalben verkauften sich, seine Konzerte waren voll mit Fans, daneben aber war auch Benny Goodman von einer Fernseh-Jam Session, in der Benson Charlie Christians Repertoire spielte, so begeistert, dass er ihn am liebsten für seine Band verpflichtet hätte.
1976 erhielt Benson einen Vertrag bei Warner Brothers und landete mit “This Masquerade” auf dem Album “Breezin'” einen Riesenhit, gefolgt von “On Broadway”, das als obskure Doo-Wop-Nummer begonnen hatte und durch Bensons Version zu einem Jazz- und Popstandard wurde. Von hier an beginnt das Buch sich zu wiederholen. Die Anekdoten über Bensons erfolgreiche Jahre wirken entweder zu vorsichtig (bloß niemanden verletzen!) oder aber unzusammenhängend. Der Gitarrist lobt Kollegen; er gibt sich bescheiden; er fühlt sich geehrt, wenn Frank Sinatra ihn von der Bühne im Publikum grüßt; er verweist auf die großen Vorbilder; und immer wieder beteuert er, wie unglaublich es doch sei, dass er es tatsächlich so weit gebracht habe.
Vielleicht stimmt es ja, dass man erst mit einem gewissen Abstand die wichtigsten Ereignisse auch seines eigenen Lebens richtig bewerten kann. In Autobiographien jedenfalls – egal ob von Jazzmusikern oder anderen Personen des öffentlichen Lebens – fällt immer wieder auf, dass die prägenden Jahre die interessantere Geschichte ausmachen. Nicht anders also liest sich auch George Bensons Buch. Seine Erinnerungen an den Beginn seiner Karriere, daran, wie die Musik ihn letzten Endes immer wieder gerettet hatte, lesen sich flüssig und spannend. Die Geschichten des erfolgreichen Stars dagegen fallen deutlich ab, enthalten weit weniger Höhepunkte oder überraschende Wendungen. Und für eine bloße Verlaufsbeschreibung dieser zweiten Hälfte seiner Karriere hätte Bensons Mitautor ab und an eine Jahreszahl und gerne auch den Nachnamen der oft nur mit Vornamen benannten Freunde und Kollegen einfließen lassen können, um dem immer noch geneigten Leser das Zurückblättern zu ersparen.
Sein Buch zeigt George Benson als einen geübten Anekdotenerzähler, der sich bewusst ist, dass seine Karriere vielleicht kein Zufall, aber auch keine Selbstverständlichkeit war. Je näher der Autor allerdings der Gegenwart kommt, desto vorsichtiger wird er, Persönliches mitzuteilen. Wo wir zu Beginn jede Menge an Informationen über Familie und Freunde erhalten, sind es zum Schluss vor allem die eh bekannten Stars und Kollegen, über die Benson berichtet. Frau, Familie, Zuhause, Religion, politische Einstellung – all das findet sich, wenn überhaupt, höchstens zwischen den Zeilen. Aber das ist natürlich die Crux einer jeden Autobiographie, insbesondere von Künstlern, die nach wie vor im Geschäft sind: dass sie den Spagat wagen wollen, auf der einen Seite ihr Leben zu erklären, ohne auf der anderen Seite zu viel von sich preiszugeben. Was im Gedächtnis bleibt nach der Lektüre, ist die sympathische Selbsteinschätzung des Gitarristen und Gesangsstars George Benson, der, wie es scheint, bis heute kaum glauben mag, dass er, der kleine Junge aus Pittsburgh, der nie Noten lesen gelernt hatte, der seine eigene Stimme für zu dünn hielt und der sich sicher war, seinen großen Vorbildern, Charlie Christian und Wes Montgomery nie das Wasser reichen zu können, in der Jazzwelt ernst genommen wird und dass es ausgerechnet ihm gelingen konnte, den Jazz mit der Popindustrie zu vermählen.
Wolfram Knauer (März 2015)
The Original Guitar Hero and the Power of Music. The Legendary Lonnie Johnson, Music and Civil Rights
von Dean Alger
Denton/TX 2014 (University of North Texas Press)
366 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-57441-546-9
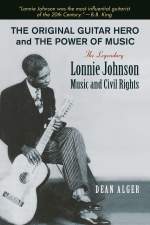 Die Bedeutung von Künstlern ist nicht immer an ihrer Bekanntheit abzulesen, sehr viel mehr wohl an ihrem künstlerischen Einfluss. Wenn es danach geht, gehört der Gitarrist Lonnie Johnson in den Olymp der Jazz- und Bluesgeschichte des 20sten Jahrhunderts. Das jedenfalls meint Dean Alger, dessen Buch das Leben und Wirken (und Nachwirken) Johnsons zum Thema hat.
Die Bedeutung von Künstlern ist nicht immer an ihrer Bekanntheit abzulesen, sehr viel mehr wohl an ihrem künstlerischen Einfluss. Wenn es danach geht, gehört der Gitarrist Lonnie Johnson in den Olymp der Jazz- und Bluesgeschichte des 20sten Jahrhunderts. Das jedenfalls meint Dean Alger, dessen Buch das Leben und Wirken (und Nachwirken) Johnsons zum Thema hat.
Lonnie Johnson wurde 1894 in New Orleans geboren. Alger schildert das bunte Musikleben in der Stadt am Mississippi-Delta, in dem der Jazz entstand, in dem aber auch der Blues eine wichtige Rolle spielte – nicht als zwölftaktiges, formal klar umrissenes Genre, als der er spätestens ab den 1920er Jahren bekannt wurde, sondern als eine Art Übergangsstil zwischen Field-Holler des 19ten und kunstvollem Volkslied des 20sten Jahrhunderts. Alger diskutiert die widersprüchlichen Quellen um die Geburt des Lonnie Johnsons und beschreibt die Nachbarschaft, in der er aufwuchs. Die ganze Familie habe aus Musikern bestanden, bezeugte Johnson später, sein erstes Instrument sei die Geige gewesen, bevor er zur Gitarre wechselte, mit er irgendwann zwischen 1912 und 1917 Johnson durch die Sümpfe Lousianas reiste, den Trompeter Punch Miller begleitend, um sich mit Musik sein Geld zu verdienen.
1917, liest man in mehreren Quellen, reiste Johnson nach London, um dort in einer nicht näher bekannten Revue aufzutreten. Alger entdeckt in einem Blues ein alternatives Narrativ für diese Jahre in Johnsons Leben: “1917 Uncle Sam called me”, heißt es darin, und so schlussfolgert der Autor, wahrscheinlich sei Johnson im I. Weltkrieg mit einer Theatertruppe zur Truppenbetreuung nach Europa gereist. Als er 1919 nach New Orleans zurückkehrte, waren die meisten seiner Verwandten an einer Grippeepidemie verstorben. Johnson verließ seine Heimatstadt und zog nach St. Louis. Dort habe der Blues ganz anders geklungen als in New Orleans; authentischer, mit stärkerem Bezug zum Leben der schwarzen Bevölkerung. Johnson trat auf den Riverboats auf, die in St. Louis anlegten, und er begann mit Varietétruppen zu reisen, in denen auch einige der “klassischen” Bluessängerinnen auftraten, Clara oder Mamie Smith etwa. 1925 heiratete er; die Ehe hielt allerdings nicht allzu lang, offenbar auch wegen der Affären, die er nebenbei hatte (unter anderem mit Bessie Smith). Es gab, je nach Lesart, einen Sohn oder sechs Töchter, wie Alger aus Zeitzeugenberichten und Interviews mit Kollegen und Freunden des Gitarristen recherchiert.
Im Oktober 1925 gewann Johnson einen Blues-Gesangswettbewerb; kurz darauf machte er seine ersten Plattenaufnahmen, auf denen er mal als Gitarrist, mal als Geiger und mal als Sänger zu hören ist. Gleich einer der ersten Titel, “Mr. Johnson’s Blues” vom 4. November 1925, wurde zu einem Verkaufsschlager. In der Folge tourte Johnson fleißig, seine Platten verkauften sich blendend, und 1928 war er einer der seltenen nicht dem Orchester angehörenden instrumentalen Gäste des Duke Ellington Orchestra, mit dem er vier Stücke einspielte, unter ihnen “The Mooch”. 1928 und 1929 ging er für mehrere Duettaufnahmen mit dem anderen großen Gitarrenvirtuosen der 1920er Jahre, Eddie Lang, ins Studio, der dafür unter dem Namen “Blind Willie Dunn” firmierte. In einigen der Aufnahmen spielte Johnson eine 12-saitige Gitarre, deren Machart und Stimmung Gitarrenexperten über Jahrzehnte Rätsel aufgab.
Lonnie Johnson war eine Art früher Fusion-Musiker, der sich in Bluesumgebung genauso wohl fühlte wie in Jazzaufnahmen etwa mit Ellington oder Louis Armstrong. Tatsächlich klingt seine Gitarrenbegleitung etwa in Armstrong’s “Hotter Than That” von 1927 moderner als das Spiel der meisten anderen Gitarristen jener Zeit, und so ist es sicher nicht ganz falsch, in ihm einen Vorläufer der Kunst Charlie Christians zu sehen.
In den 1930er Jahren lebte Johnson in Philadelphia, New York und Cleveland, ging als Solist ins Studio oder mit kleinen Besetzungen. Um Geld zu verdienen, verdingte er sich aber auch als Stahlarbeiter in East St. Louis. Ende der 1930er Jahre war er dann in Chicago, spielte mit Baby Dodds und anderen älteren Musikern aus New Orleans, entdeckte daneben die elektrische Gitarre für sich und war auf Aufnahmen früher Rhythm ‘n’ Blues-Künstler zu hören. Sein Einfluss auf den Rock ‘n’ Roll der 1950er Jahre sei enorm gewesen, betont Alger und zitiert B.B. King, Buddy Guy und andere. Konkret verweist er auf “Tomorrow Night”, einen Hit, den Johnson 1947 einspielte und dessen Coverversion 1954 von Elvis Presley deutliche Parallelen sowohl im Konzept der Aufnahme wie auch in Presleys Stimmbehandlung besitzt.
1952 machte Johnson eine Englangtournee, bei der ein junger Gitarrist namens Tony Donegan ihn als Vorbild für sich entdeckte und sich aus Verehrung für den älteren Meister künftig Lonnie Donegan nannte. Immer wieder musste Johnson aber auch Jobs annehmen, die nichts mit Musik zu tun hatten, arbeitete etwa als Hausmeister in einem Hotel in Philadelphia, wo Chris Albertson ihn 1959 entdeckte und ihn für mehrere LPs ins Studio brachte. Während einer Art dritten Comebacks wurde Johnson als Zeuge für die Anfänge des Blues gefeiert. 1963 war er einer der Künstler des von Horst Lippmann und Fritz Rau organisierten American Folk Blues Festivals, machte 1967 wichtige Einspielungen für das Folkways-Label, in denen man sehr gut hören kann, wie sich die Traditionen von Blues und Jazz vermischen. 1969 wurde er bei einem Autounfall schwer verletzt, trat danach zwar noch einige Male auf, erholte sich aber nie völlig und starb im Juni 1970 im Alter von 76 Jahren.
Der Autor des Buchs, Dean Alger, ist ein Fan Lonnie Johnsons, und so sehr seine Begeisterung ihn zu extensiven Recherchen antrieb, so sehr trübt sie leider auch ein wenig die Lesefreude. Schon in der Einleitung beklagt er sich, dass so viele Verlage sein Manuskript aus Unwissenheit über die Bedeutung seines Subjekts abgelehnt hätten, und im folgenden Text finden sich neben stark übertrieben wirkenden Superlativen zu Johnson immer wieder Seitenhiebe auf Musiker und Autoren, die dessen Bedeutung nicht erkannt hätten.
Alger lässt seine Leser an den Schwierigkeiten der Recherche teilhaben, präsentiert unterschiedliche Versionen für Stationen in Johnsons Karriere, um dann zu erklären, warum er meint, diese oder jene sei die wahrscheinlichste. So berichtet er beispielsweise von einem Antrag auf Sozialversicherung vom April 1937, auf dem Johnson eine Adresse in Nashville angegeben und seine Geburt auf Februar 1909 datiert habe – das eine nicht verifizierbar, das zweite glatt falsch. Damit bietet Alger auf der einen Seite einen spannenden Blick in die Rechercheprobleme über frühe afro-amerikanische Musikgeschichte, erschwert seinen Lesern auf der anderen Seite aber enorm die Lektüre. Zu oft verlässt er den Geschichtsfluss, um die spätere Rezeption zu erklären und nebenbei noch, wieso andere Autoren zu bestimmten Schlussfolgerungen gekommen seien und wieso er selbst diese nicht teile.
Für seine analytischen Beschreibungen verlässt Alger sich meist auf fremde Quellen statt auf die eigenen Ohren; seine eigenen Beschreibungen sind stattdessen mit Adjektiven wie “wonderful”, “appealing”, “memorable”, “perfect” durchzogen. Warum er Ellingtons “The Mooche” als “popmusikalischen Gegenpart zu Strawinskis ‘Le Sacré du printemps'” bezeichnet, bleibt ein Rätsel. Seine (eigene) Beschreibung von Johnsons Kazoo-Spiel im “Five O’Clock Blues” liest sich folgendermaßen: “Lonnie spielt in der ersten Hälfte des Stücks eine schöne, weinende Bluesgeige. Später steigt Lonnie aufs Kazoo um, und diesmal klingt das Kazoo wie eine sehr alte Katze, die gerade erwürgt wird, die aber kaum mehr genügend Energie hat sich zu beschweren.” Es sei doch ganz gut zu wissen, zitiert er dann einen Kollegen, dass auch Lonnie Johnson nur menschlich gewesen sei, “er war nicht auf jedem Instrument brillant.”
Immer wieder spricht er seine Leser direkt an, ist sich dabei aber offenbar nicht ganz sicher, um wen es sich dabei wohl handelt, erklärt Details afro-amerikanischer Musikgeschichte mal sehr detailliert und für Uneingeweihte, um an anderen Stellen die Geduld des Kenners mit dem Klein-Klein seiner Recherchen zu überfordern. Das Erbe Lonnie Johnsons bestehe, so die Überschriften seines letzten Kapitels, aus “dem nicht ausreichend gewürdigten Kaliber seines Gesangs”, einem “äußerst raren Fall von Großartigkeit”, der “nicht angemessenen Würdigung seiner exzellenten Texte”, der “exzeptionellen thematischen Stimmigkeit in seinem Gitarrenstil” – und diese Superlative klingen auch im englischen Original nicht viel sachlicher. Immer wieder zitiert er Loblieder auf andere Größen des Jazz, Ellington, Armstrong beispielsweise, um anschließend zu bemerken, genau dasselbe könne man aber auch über Johnson sagen.
Im Anhang findet sich schließlich noch eine völlig zusammenhangslose Besprechung einer Aufnahme von Sidney Bechet sowie ein Kapitel über die Beziehung von Jazz- und Bluesmusikern zur Bürgerrechtsbewegung, in dem Johnson kaum erwähnt wird, Wenn es dieses Kapitel ist, auf das sich der Untertitel des Buchs, “Music and Civil Rights” bezieht, so ist das zumindest irreführendes Marketing des Verlags. Denn darum geht es im Buch wirklich nur am Rande.
Alles in allem enthält Dean Algers Buch jede Menge wertvoller Information über einen weithin verkannten Künstler, wenn der Autor seinen Lesern auch viel Geduld und Nachsicht abverlangt und man sich über weite Strecken die hilfreiche Hand eines kritischen Lektorats gewünscht hätte, das ihm zu einer klareren Strukturierung seines Text und zum Streichen vieler der Asides geraten hätte und das alles damit besser lesbar gemacht hätte. Algers “labor of love” wird alleine der Fülle seiner Recherchen wegen ein Nachschlagewerk bleiben; für eine nächste Auflage wünscht man ihm und künftigen Lesern eine sorgfältige Überarbeitung.
Wolfram Knauer (Februar 2015)
Livejazz in München
von Christina Maria Bauer
München 2014 (München Verlag)
152 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-7630-4025-4
 Frankfurt war in den 1950er und 1960er Jahren die Jazzhauptstadt Deutschlands; heute gilt das wohl vor allem für Berlin und Köln. Aber die Metropolen dieser Republiken haben nach wie vor eine lebendige Szene und jede für sich eine eigene regionale Jazzidentität. Hamburg klingt anders als Stuttgart, anders als Dresden, anders als Hannover, anders als Dortmund, anders als Leipzig, anders als Darmstadt (!) und eben auch anders als München. Und auch die stilistischen Zuweisungen, die einst regionale Jazzszenen fixieren halfen, gelten nicht mehr. Das wegen seiner Traditionsliebe ehemals als “Freie und Barberstadt” bekannte Hamburg hat heute genauso eine zeitgenössische Jazzszene, in Berlin gibt es neben der Avantgarde auch eine reiche traditionelle Szene, Frankfurt besteht nicht nur aus der Moderne in der Nachfolge Albert Mangelsdorffs, sondern auch aus elektronischen Experimenten, und München ist genauso bunt wie jede andere Stadt dieser Größe.
Frankfurt war in den 1950er und 1960er Jahren die Jazzhauptstadt Deutschlands; heute gilt das wohl vor allem für Berlin und Köln. Aber die Metropolen dieser Republiken haben nach wie vor eine lebendige Szene und jede für sich eine eigene regionale Jazzidentität. Hamburg klingt anders als Stuttgart, anders als Dresden, anders als Hannover, anders als Dortmund, anders als Leipzig, anders als Darmstadt (!) und eben auch anders als München. Und auch die stilistischen Zuweisungen, die einst regionale Jazzszenen fixieren halfen, gelten nicht mehr. Das wegen seiner Traditionsliebe ehemals als “Freie und Barberstadt” bekannte Hamburg hat heute genauso eine zeitgenössische Jazzszene, in Berlin gibt es neben der Avantgarde auch eine reiche traditionelle Szene, Frankfurt besteht nicht nur aus der Moderne in der Nachfolge Albert Mangelsdorffs, sondern auch aus elektronischen Experimenten, und München ist genauso bunt wie jede andere Stadt dieser Größe.
Christina Maria Bauer hat die Vielfalt dieser Münchner Szene zu einer buchlangen Darstellung animiert, die sich vor allem die Spielorte vornimmt, meist intime Clubs, Cafés, Säle, deren Atmosphäre nicht nur im Liveerlebnis rüberkommt, sondern auch in den Fotos, von denen es in ihrem Buch nicht mangelt. Von der Unterfahrt über den Bayerischen Hof, die Jazzbar Vogler über die Waldwirtschaft und den Hirschau-Biergarten bis hin zum Ruffini und Veranstaltungen in der Circus Krone oder der Pasinger Fabrik beschreibt sie die Orte, die Macher und die Musiker, die an ausgewählten Tagen dort auftreten. Den gut lesbaren, an Einträge in einem guten Reiseführer erinnernden Texten folgt eine Zusammenfassung auf Englisch sowie die Kontaktdaten der Clubs.
Was fehlt, wäre vielleicht noch ein Sampler, der Aufnahmen insbesondere Münchner Ensembles enthalten könnte, aber dann soll man genau dafür ja in die Clubs gehen, um zu hören, worum es in diesem Buch geht: nämlich “Livejazz in München”.
Wolfram Knauer (Januar 2015)
Blue Note. The Finest in Jazz Since 1939
von Richard Havers
München 2014 (Sieveking Verlag)
400 Seiten, 78 Euro
ISBN: 978-3-944874-07-4
Talkin’ About Blue Note. Painted Jazz!
von Dietrich Rünger & Rainer Placke
Bad Oeynhausen 2014 (jazzprezzo)
236 Seiten, 2 CD, 75,00 Euro
ISBN: 978-3-9816642-0-1
 Das Plattenlabel Blue Note feierte letztes Jahr seinen 75sten Geburtstag, und gleich zwei Prachtbände feiern mit. Sie haben recht unterschiedliche Ansätze, ergänzen sich dabei aber so glänzend, dass man kaum zu entscheiden vermag, welches den Nerv des Labels am besten trifft, seine Geschichte am überzeugendsten erzählt.
Das Plattenlabel Blue Note feierte letztes Jahr seinen 75sten Geburtstag, und gleich zwei Prachtbände feiern mit. Sie haben recht unterschiedliche Ansätze, ergänzen sich dabei aber so glänzend, dass man kaum zu entscheiden vermag, welches den Nerv des Labels am besten trifft, seine Geschichte am überzeugendsten erzählt.
Richard Havers hatte vor kurzen bereits einen nicht weniger aufwändigen Band über das Label Verve herausgebracht. Sein 400 Seiten starkes Buch nimmt eher den historischen Weg. Havers beginnt mit einem kurzen Kapitel über die Jugend der Firmengründer Alfred Lion und Francis Wolff in ihrer Heimatstadt Berlin, leitet dann recht schnell ins New York der späten 1920er, frühen 1930er Jahre über, das Alfred Lion bereits 1928 zum ersten Mal besuchte, um dann, auf Umwegen – zurück nach Deutschland und dann nach Südamerika – 1936 endgültig in den USA zu landen.
Havers schildert die Umstände der ersten Aufnahmen, die der Jazzfan und Plattensammler Alfred Lion 1939 mit den beiden Pianisten Albert Ammons und Pete Johnson machte, weil er überzeugt war, dass diese Musik ein breiteres Publikum verdiene. Einspielungen mit Frankie Newton und Sidney Bechet folgten. Im Oktober 1939 stieß sein alter Freund Francis Wolff hinzu, der mit dem letzten Schiff kurz nach Kriegsbeginn aus Deutschland ausreisen konnte. Lion musste zwei Jahre mit seinem Geschäft pausieren, weil die amerikanische Musikergewerkschaft zum Streik der Plattenfirmen aufgerufen hatte. Als er 1944 wieder mit der Produktion loslegte, nahm er neben den älteren Namen zum ersten Mal auch jüngere Musiker in sein Programm auf, die eher dem neuen Bebop zuzurechnen waren. Tadd Dameron, Fats Navarro und Thelonious Monk, begründeten den Ruf des Labels als am Puls der Zeit.
Havers erzählt die Geschichte des Labels, beschreibt Veränderungen in der musikalischen Basis, auf der das Geschäft gründete, aber auch Veränderungen in der Aufnahmetechnik oder in der Gestaltung der Platten. Und er beschreibt den Niedergang von Blue Note durch den kommerziellen Erfolg der Rockmusik in den 1960er Jahren und schließlich und den Verkauf des Labels an Liberty Records. Danach führt er seine Leser in die Jetztzeit, berichtet über die diversen Wiederbelebungsversuche und über die immer wieder neuen Stars, die im Idealfall die Experimentierlust des ursprünglichen Blue-Note-Labels weiterleben lassen.
Havers Buch liest sich schnell und flüssig; es enthält jede Menge Einzeldarstellungen bedeutender Schallplatten, die die Musik sowohl in die Geschichte des Labels wie auch in die Jazzgeschichte einzuordnen versuchen. Und es bietet eine Unmenge wunderbarer Fotos, Bilder aus dem Archiv von Francis Wolff vor allem, daneben aber auch historische Aufnahmen aus Berlin und New York, die recht schnell die Atmosphäre der Erzählung nachempfinden lassen. Vereinzelt finden sich schließlich auch Faksimiles aus den Notizbüchern zu einzelnen Plattensitzungen oder ganze Kontaktbögen von Fotonegativen, die die Arbeit des Fotografen Francis Wolff nachvollziehen lassen.
 Das von Dietrich Rünger und Rainer Placke herausgegebene Buch über Blue Note hat in etwa dasselbe Gewicht, aber einen ganz anderen Ansatz. Über die Geschichte des Labels erfährt man in teilweise recht persönlichen Rückblicken von Fachleuten und Mitstreitern, etwa dem Produzenten Michael Cuscuna, der Historikern Theresia Giese, dem Filmemacher Julian Benedikt, dem Jazz-Experten Bert Noglik, und dem Journalisten (und Plattentextschreiber) Ira Gitler.
Das von Dietrich Rünger und Rainer Placke herausgegebene Buch über Blue Note hat in etwa dasselbe Gewicht, aber einen ganz anderen Ansatz. Über die Geschichte des Labels erfährt man in teilweise recht persönlichen Rückblicken von Fachleuten und Mitstreitern, etwa dem Produzenten Michael Cuscuna, der Historikern Theresia Giese, dem Filmemacher Julian Benedikt, dem Jazz-Experten Bert Noglik, und dem Journalisten (und Plattentextschreiber) Ira Gitler.
Neben dem Label wird in diesem Buch aber auch die Kunst des deutschen Malers Dietrich Rünger gefeiert, der sich seit langem von den Platten in seiner Blue-Note-Sammlung zu immer neuen, meist großformatigen Acrylbildern inspirieren lässt. Abbildungen dieser Bilder nehmen jeweils viele der rechten Seiten des Buchs ein, während auf den jeweils gegenüberliegenden Seiten Musiker, Experten, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens über ihre eigenen Blue-Note-Erfahrungen zu den betreffenden Alben berichten, so dass im Konzept des Buchs Persönliches (Rüngers visuelle Interpretation der Musik) mit Persönlichem (Reflexionen) konfrontiert wird.
Zu Wort kommen dabei Musiker wie Joe Lovano, José James, Till Brönner, Nils Landgren, Rolf und Joachim Kühn, Martin Tingvall, Udo Lindenberg oder Esperanza Spalding, Jazzexperten wie Josef Engels, Stefan Gerdes, Hans Hielscher, Karl Lippegaus (aber auch Arndt Weidler und Wolfram Knauer vom Jazzinstitut Darmstadt), Angehörige der “Szene”, also Produzenten, Veranstalter, Macher aller Art wie Siggi Loch, Sedal Sardan, Axel Stinshoff oder Rainer Haarmann, sowie schließlich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die den Jazz nicht nur als heimliche Liebe pflegen, etwa die Schauspieler August Zirner und Joachim Król, der Politiker Hans-Olaf Henkel oder der Journalist Roger Willemsen. Sie alle durften sich einzelne Platten aus dem großen Blue-Note-Katalog aussuchen und darüber berichten, wie diese sie berührt haben; und ihr Spektrum reicht tatsächlich von Sidney Bechet bis zu Cecil Taylor.
Und dann gibt es noch einen Zusatzbonus, der dem Leser die Blue-Note-Gründer direkt vor Ohren führt: zwei CDs, auf denen eine Rundfunkserie zu hören ist, die der Norddeutsche Rundfunk 1964 mit Alfred Lion und Frances Wolff produzierte und in denen die beiden die Geschichte ihrer Firma erzählen und einige der bedeutendsten Aufnahmen vorstellen.
Die Bedeutung des Labels Blue Note mag sich allein an der Tatsache zeigen, dass etwa zur selben Zeit zwei großformatige schwere Bücher erscheinen, die sich dennoch inhaltlich kaum überschneiden. Havers hat die schöneren historischen Fotos; Rünger/Placke zeigen dafür beispielsweise eine Seite aus der Kladde, in der Frances Wolffs Berliner Plattensammlung dokumentiert ist (aus dem Bestand des Jazzinstituts Darmstadt). Havers kann durch seinen narrativen Ansatz tiefer in die Geschichte des Labels eindringen; Rünger/Placke versammeln mit den zahlreichen einzelnen Reflexionen mehr Facetten. Havers’ Buch ist das traditionellere der beiden, und bei Rünger/Placke mag sich der eine oder andere über die kleine und, weil weiß auf schwarz, schwer lesbare Schrift der Gastbeiträge beschweren. Rünger/Placke ist auf der anderen Seite eher ein aus dem Heute auf das Label blickendes Werk, während Havers einzig der Darstellung der Geschichte verhaftet bleibt. Und Rünger/Placke haben natürlich die beiden wunderbaren CDs dabei, auf denen man die Blue-Note-Gründer selbst zu hören bekommt. Keines der Bücher liefert eine wirklich kritische Bestandsaufnahme, beide Bände richten sich vor allem an Fans. Durch die Vielseitigkeit der Aussagen und die Befragung insbesondere auch von Musikern gelingt es Rünger/Placke vielleicht, der Musik etwas näher zu kommen, für die das Label steht. Letzten Endes aber bleibt dem wahren Blue-Note-Fan nichts anderes übrig, als 7,5 cm im Bücherregal freizuräumen und sich gleich beide Bücher zu holen.
Wolfram Knauer (Januar 2015)
Blues Queens. 2013 Blues Calendar.
Rare Vintage Photographs by Martin Feldmann
Attendorn 2014 (Pixelbolide)
15,90 plus Versand (Wandkalender)
9,50 Euro plus Versand (Notizkalender)
23,95 Euro plus Versand (beide Kalender)
Zu bestellen über www.blueskalender.de
 In den 1970er und 1980er Jahren reiste der Frankfurter Journalist und Fotograf Martin Feldmann regelmäßig durch die USA, besuchte dort Jazz- und Bluesclubs, fotografierte aber auch auf den wichtigsten Bluesfestivals in Europa. Seine Berichte erschienen in der Frankfurter Rundschau sowie in diversen Fachzeitschriften. Zum wiederholten Mal hat Feldmann jetzt eine Auswahl seiner Bilder getroffen, um sie zu einem stimmungsvollen Wand- oder Notizkalender zusammenzustellen. Das Thema des Kalenders 2015 sind die “Blues Queens”, die Blues-Frauen, Sängerinnen und Instrumentalistinnen, die dieses Genre genauso prägten wie ihre männlichen Kollegen. Neben den zwölf Monats-Bildern von Lady B.J. Crosby, Koko Taylor, Honey Piazza, Big Time Sarah, Lady Bianca Thornton, Princess Patience Burton, Sylvia Embry, Carrie Smith, Rosay Wortham, Margie Evans, Tina Mayfield, Angela Brown finden sich im Vorwort des Kalenders noch eindringliche Bilder von Sippie Wallace, Katie Webster und Maxine Howard, Dottie Ivory sowie Beverly Stovall. Feldmann begleitet all diese Bilder mit kurzen Würdigungen der Künstlerinnen. Die Kalender sind direkt online zu beziehen.
In den 1970er und 1980er Jahren reiste der Frankfurter Journalist und Fotograf Martin Feldmann regelmäßig durch die USA, besuchte dort Jazz- und Bluesclubs, fotografierte aber auch auf den wichtigsten Bluesfestivals in Europa. Seine Berichte erschienen in der Frankfurter Rundschau sowie in diversen Fachzeitschriften. Zum wiederholten Mal hat Feldmann jetzt eine Auswahl seiner Bilder getroffen, um sie zu einem stimmungsvollen Wand- oder Notizkalender zusammenzustellen. Das Thema des Kalenders 2015 sind die “Blues Queens”, die Blues-Frauen, Sängerinnen und Instrumentalistinnen, die dieses Genre genauso prägten wie ihre männlichen Kollegen. Neben den zwölf Monats-Bildern von Lady B.J. Crosby, Koko Taylor, Honey Piazza, Big Time Sarah, Lady Bianca Thornton, Princess Patience Burton, Sylvia Embry, Carrie Smith, Rosay Wortham, Margie Evans, Tina Mayfield, Angela Brown finden sich im Vorwort des Kalenders noch eindringliche Bilder von Sippie Wallace, Katie Webster und Maxine Howard, Dottie Ivory sowie Beverly Stovall. Feldmann begleitet all diese Bilder mit kurzen Würdigungen der Künstlerinnen. Die Kalender sind direkt online zu beziehen.
Wolfram Knauer (Oktober 2014)
Jazz and Culture in a Global Age
von Stuart Nicholson
Boston 2014 (Northeastern University Press)
294 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-55553-844-6
 Stuart Nicholson ist als streitbarer Geist bekannt. In seinem letzten Buch, “Is Jazz Dead? (Or Has It Moved to a New Address?)” betrachtete er den Stand des aktuellen Jazz und befand, dass die alternativen Jazzszenen in Europa dem Status Quo des Jazz in den USA bisweilen den Rang abliefen. Sein neues Buch hat einen noch weiter gefassten Titel, beschäftigt sich nicht nur mit Jazz, sondern gleich mit “Jazz und Kultur in einem globalen Zeitalter” und knüpft doch dort an, wo sein voriges Buch aufgehört hatte.
Stuart Nicholson ist als streitbarer Geist bekannt. In seinem letzten Buch, “Is Jazz Dead? (Or Has It Moved to a New Address?)” betrachtete er den Stand des aktuellen Jazz und befand, dass die alternativen Jazzszenen in Europa dem Status Quo des Jazz in den USA bisweilen den Rang abliefen. Sein neues Buch hat einen noch weiter gefassten Titel, beschäftigt sich nicht nur mit Jazz, sondern gleich mit “Jazz und Kultur in einem globalen Zeitalter” und knüpft doch dort an, wo sein voriges Buch aufgehört hatte.
Wie also, lautet die Grundfrage seines Buchs, ist die Position des Jazz im Zeitalter der Globalisierung, und zwar an jedem einzelnen der verschiedenen Orte, die diese Globalisierung ja erst ausmachen und die jeder für sich eine andere Sicht auf die Sache an und für sich besitzen als der Ursprungsort, Amerika?
In seinem ersten Kapitel stellt Nicholson fest, dass der Jazz im Großen und Ganzen den wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg Amerikas im 20sten Jahrhundert widerspiegele. Zugleich habe sich er sich aber auch immer weiter von der populären Musik entfernt, und dabei erlebt, dass innerhalb dieser Entwicklung einzelne regionale oder nationale Szenen gar nicht mehr auf Amerika als Maß aller Dinge schauten. Die Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre habe dazu geführt, dass junge Musiker in den USA durch ihre Kunst kaum mehr genug zum Leben verdienen könnten. Selbst diejenigen, die halbwegs gut seien, würden bis zu 75 Prozent ihres Jahreseinkommens durch Tourneen in Europa erbringen. Gewiss, New York besitze immer noch eine der lebendigsten Jazzszenen der Welt; eine nationale amerikanische Jazzszene sei allerdings so gut wie nicht existent. In den USA baue man jetzt deshalb auf “education”, auf verschiedene Konzepte des “audience development”. Auch Pädagogik aber könne gegen den Erfolg des Konsums nicht ankämpfen. Jazz sei nun mal im schlechten wie im guten Sinne mit dem Klischee des Elitären behaftet. Die Diskurse, die in den 1990er Jahren um die Gestaltungshoheit des Jazz aufkamen, seien tatsächlich Diskurse um kulturelle Identität gewesen. In der heutigen Zeit müsse man mit einer durch den Konsum beförderten kürzeren Aufmerksamkeitsspanne der Hörer leben. Und da käme dem Jazz dann vor allem eine Erkenntnis zupass, die viele Musiker vergessen hätten, dass nämlich die Melodie wichtiger sei als Patterns, dass man seine Hörer durchs Geschichtenerzählen erreiche, dass neue Kompositionen den Zuhörer bewegen müssten. Der Jazz, stellt Nicholson fest, dürfe keine rein intellektuelle Übung bleiben, er müsse die Herzen der Zuhörer erreichen. Dafür müsse er sich seinen eigenen Platz in einer ihm eigentlich feindlich gegenüberstehenden Medienlandschaft zurückerobern. Jazz mag nicht länger populär sein, schreibt er, doch müsse er unbedingt für diejenigen relevant bleiben, die ihm folgen wollen.
Im zweiten Kapitel beschreibt Nicholson den internationalen Erfolg des Jazz seit seinen Anfangsjahren. Er stellt fest, dass Jazz zwar unter Musikern immer eine lingua franca gewesen sein mag, die Musik von Hörern verschiedener Länder und Kulturkreise allerdings durchaus unterschiedlich wahrgenommen werde. Musik sei nun mal eine Form von Kommunikation, und Urteile über Musik unterlägen deshalb immer gesellschaftlich bedingten Regeln, unterschiedlichen Konnotationen und Erwartungen, und damit, wie er an Beispielen aus England und Polen festmacht, eines reichlich unterschiedlichen Erlebens derselben Musik.
Im dritten Kapitel befasst sich Nicholson mit der Wahrnehmung von Jazz als Zeichen der “Moderne” im frühen 20sten Jahrhundert. Jazz habe sich immer in zwei Bedeutungsfeldern befunden, sei zum einen aus einer Kultur des Konsums heraus entstanden, zum anderen aber mehr und mehr mit unterschiedlichsten Diskursen um “Freiheit” assoziiert worden. Amerika habe Kultur bald als weichen Faktor erkannt, der nach innen wie nach außen amerikanische Identität vermitteln könne. Hollywood sei das erste erfolgreiche Beispiel dieser Erkenntnis gewesen, auch die Musik aber habe recht bald ihren Platz in diesem kulturpolitischen Geflecht gefunden. Nicholson dekliniert Beispiele durch, von James Reese Europe über Glenn Miller bis zu den State Department-Tourneen seit den 1950er Jahren. Aus welchen Gründen auch immer der Staat sich des Jazz bediene, habe das in der Regel zu einem Geben und Nehmen zwischen staatlicher Subvention und wirtschaftlicher Vermarktung geführt. Als konkretes Beispiel führt Nicholson Norwegen an, wo es durch staatliche Förderung tatsächlich gelungen sei, eine internationale Nachfrage zu schaffen. All solche internationalen Vermarktungsmechanismen lebten vom “Halo Effect”, bei dem der Ruf großer Musiker auf der einen sowie Werte wie Moderne, Zukunftsorientiertheit und Cringe-Aspekte auf der anderen Seite unbewusst auf das ganze Genre übertragen werden (und sich dabei als hervorragende Marketinginstrumente erweisen).
Im letzten Kapitel betrachtet Nicholson eine andere globalisierte Thematik, die nämlich der “klassischen” Moderne. Der Jazz, erklärt er, habe bereits im frühen 20sten Jahrhundert eine entscheidende Rolle für die Künstler der Moderne gespielt, Maler, Bildhauer, Schriftsteller, Komponisten und Filmemacher. In den USA habe die Wahrnehmung des Jazz als einer modernen Kunstform zur selben Zeit auch gesellschaftliche und rassistische Untertöne besessen. Nicholson hebt Paul Whitemans Rolle bei der Entwicklung des Jazz zu einer künstlerischen Aussage der Moderne hervor, dem etliche spätere weiße wie schwarze Musiker verpflichtet gewesen seien, nicht zuletzt auch Duke Ellington. Er betrachtet konkrete Kompositionen, von den durch Whiteman beauftragten Suiten über Ellington, James P. Johnson, Raymond Scott oder Reginald Foresythe bis zu Arrangeuren der 1940er Jahre, die mit einem weniger auf populären Erfolg ausgerichteten Ansatz arbeiteten, um schließlich festzustellen, dass in den USA der Jazz und die Moderne sich erst näher kommen konnten, als Charlie Parker und die jungen Bebopper die unterschiedlichen Ansätze in Komposition und Improvisation angleichen konnten. Über Brubeck und Tristano geht es noch kurz zu Wynton Marsalis’ “Majesty of the Blues” und Marsalis Ansicht, Jazz sei insgesamt eine Musik der Moderne.
Tja, und dann ist da noch Kapitel 4, überschrieben “The Globalization of Jazz”, das viele interessante Denkansätze enthält und trotzdem die problematischste Lektüre des Buchs darstellt. Die Finanzkrise 2007/2008, beginnt Nicholson, sei ein hervorragendes Beispiel dafür, wie heutzutage alles mit allem zusammenhänge. Der Terminus “Globalisierung” stünde dabei durchaus für unterschiedliche Aspekte: für freie Marktwirtschaft etwa, für westliche Dominanz (Amerikanisierung), aber auch für die Hoffnung auf eine globale Community. Die am wenigsten erwartete Nebenwirkung der Globalisierung sei der wachsende Nationalismus gewesen. Nicholson diskutiert unterschiedliche Modelle der Auswirkung von Globalisierung auf die Kultur, schaut, wie sich die kommerzielle Popmusik in diese Modelle einpassen lässt und blickt dann auf den Jazz und sein inzwischen gespaltenes Verhältnis zu amerikanischer Authentizität. Er stellt für den Jazz eine Hybridisierung fest, in der globalisierte kulturelle Praktiken lokal rezipiert werden und dabei neue, in die lokalen Kontexte eingepasste Bedeutungen erlangten. Für den Jazz betont Nicholson insbesondere, dass im Zuge dieser gern als Glocalization bezeichneten Entwicklung die Idee von “Eigentum” an einer kulturellen Tradition immer unwichtiger wurde, weil “Ursprung” durch lokale Aneignung inklusive hybrider Methoden, also dem gleichzeitigen Verweis auf Traditionen des Jazz und Traditionen der eigenen kulturellen Herkunft, wettgemacht wurde.
Einem Exkurs in die Erfahrungen mit Nationalismus in der klassischen Musikwelt folgt Nicholson mit dem Unterkapitel “Jazz und Relativismus”. Relativismus, erklärt er, ginge davon aus, dass es eine objektive Wahrheit nicht gäbe, weil immer verschiedene Sichtweisen vorherrschten, die alle ihre Berechtigung hätten. Die “Doktrin des kulturellen Relativismus” habe, wie Nicholson schreibt, dazu geführt, dass Wissenschaftler, die dem Relativismus anhingen, historische Fakten zugunsten unterschiedlicher Sichtweisen anzweifelten. Insbesondere in den New Jazz Studies, einem interdisziplinären Forschungsansatz, für den etwa der amerikanische Wissenschaftler Krin Gabbard oder der Brite Tony Whyton stehen, habe die scheinbare Erweiterung bisheriger Sichtweisen um neue Perspektiven, die außerhalb der formalistischen Musikwissenschaft liegen, für reichhaltige Erkenntnisse sorgen sollen. Tatsächlich allerdings, findet Nicholson, habe eine solche Sicht auf den Jazz mit Ungenauigkeiten, historischen genauso wie Denkfehlern gearbeitet und damit die Geschichte verfälscht. Er stellt Paul Gilroys Theorien zum Black Atlantic (sehr verkürzt) als Gegenmodell zum Weltverständnis aus der Sicht von Nationalstaaten vor, und betont, Gilroys Thesen läge zumindest Whytons Modell der New Jazz Studies und seiner Sicht des Jazz als einer transnationalen Musik zugrunde. Die New Jazz Studies plädierten dafür, schreibt Nicholson, dass man im Jazz nicht von nationalen Kulturen sprechen solle, weil, frei nach Gilroy, die Diaspora, also das Modell transnationaler Entwicklungen größere Bedeutung habe als der Druck zu nationaler Einmütigkeit.
Und dann holt Nicholson aus: Es sei doch nachweisbar falsch, dass nationale Charaktere keinen Einfluss auf die Musik hätten. Man müsse doch nur auf den Einfluss von Sprachen auf Rhythmik oder Melodik schauen. Und auch im Jazz gäbe es doch unzählige spezifische Codes, die Jazzmusiker benutzten und die klar ihre kulturelle Herkunft markierten. Whyton würde etwa die Idee eines nordischen Tons im Jazz herunterspielen und als bloße Marketingstrategie interpretieren, an der eben auch Musiker beteiligt seien. Dabei würde er völlig außer Acht lassen, dass es bereits lange Forschungen zum Phänomen des nordischen Tons gäbe, die zwar im Bereich der komponierten Musik angestellt wurden, sich aber ohne weiteres auch auf den Jazz übertragen ließen. Gerade der norwegische oder schwedische Jazz sei doch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie lokale, regionale, nationale Kultur den Jazz hin zu einem eigenständigen Idiom beeinflussen könne.
Nicholsons Scharmützel mit den New Jazz Studies sind für den Außenseiter etwas – nun: vielleicht ja nur britisch. Paul Gilroys Thesen seien schon lange widerlegt. Krin Gabbards Buch würde vor Fehlern nur so strotzen, und Tony Whyton würde sich nach wie vor fast schon ideologisch auf Gilroy beziehen. Die Wirklichkeit sei ihnen wohl, zitiert er Richard Dawkins’ Postmodernismus-Kritik, zu uncool. Nicht nur, dass Nicholsons Einengung der Diskussion auf Gabbard und vor allem Whyton den New Jazz Studies nicht gerecht wird, die viel weiter greifen und weit mehr Autoren umfassen, als Nicholson hier benennt, tatsächlich ist sein eigener Ansatz in diesem wie auch in seinem früheren Buch ja einer, der dem interdisziplinären Anspruch der New Jazz Studies durchaus entspricht. Nur gehört zu den New Jazz Studies eben auch das Hinterfragen der eigenen Meinung, was Nicholson, der im britischen Jazzwise Magazine eine Kolumne mit dem augenzwinkernden Titel “Putting the World to Rights” hat, offenbar nicht ganz leicht fällt. Seine Beispiele für Glocalization im Jazz sind mehr als hilfreich, viele seiner Denkansätze sind diskutabel, doch die Spiegelfechterei mit Gegnern, denen er letzten Endes auch ein wenig das Wort auf der Seite herumdreht, wäre nicht nur nicht nötig, liest sich auch ein wenig beckmesserisch.
Wie schon sein früheres Buch, so hat also auch “Jazz and Culture in a Global Age” etliche wertvolle Ansätze. Die fünf Kapitel stehen jedes für sich, wobei die ersten vier klar aufeinander bezogen sind, während das letzte sich ein wenig unglücklich abseits der früheren Argumente wiederfindet, obwohl die Ausführungen über unterschiedliche Auffassungen von Moderne durchaus in Nicholsons Argumentation gepasst hätten. Die Hauptthese des Autors ist jene, dass der Jazz als eine ur-amerikanische Musik entstanden sei, die zu Zeiten nationalstaatlicher Identität sowohl nach innen wie auch nach außen identitätsstiftende Wirkung besaß. Jazz konnte auf der einen Seite als amerikanischer Beitrag zur Moderne rezipiert werden, wie es vor allem in Europa geschah; er konnte aber auch als Abbild einer multi-ethnischen Gesellschaft in einem durch und durch demokratisch verfassten System gedeutet werden, wie es insbesondere die amerikanische Politik in den Zeiten des Kalten Kriegs tat. Nicht zuletzt war Jazz auch ein Werkzeug der amerikanischen Musikindustrie, die von Anfang an darauf ausgerichtet war, über die eigenen Grenzen hinaus zu agieren, musikalische Werte weltweit zu etablieren, um damit im selben Radius ihren kommerziellen Profit einfahren zu können. So war der Jazz quasi Teil einer künstlerischen Globalisierungsstrategie, die wirtschaftlich genauso wie politisch gewollt war, die der Musik im Effekt aber ihre Position als identitätsstiftende nationalstaatliche Kennziffer nahm. Hier setzt Nicholsons Argument der Glocalization ein, das beobachtet, dass eine Musik, die so sozial und kommunikativ ausgerichtet ist wie der Jazz, einer Verortung in der Community bedarf, dass man nämlich Kreativität nicht so gern nur konsumiert, sondern darum wissen möchte, dass sie im persönlichen Umfeld möglich ist. Glocalization bezeichnet nach dieser Interpretation die Balance zwischen dem Wissen um die Herkunft der kulturellen Tradition des Jazz und der Erfahrung, dass die spannendsten Momente in dieser Musik dort geschehen, wo Musiker oder Musikerinnen sich ihrer eigenen Herkunft besinnen. Der Jazz unserer Tage wird von Künstlern gemacht, die sich ihrer Position sowohl im Kontinuum der Jazz- wie auch der Musikgeschichte bewusst sind, die ihre sozialen und kulturellen Erfahrungen übereinanderlegen, um aus der Authentizität ihrer Herkunft die Sprache des Jazz voranzutreiben.
Nicholsons Buch nähert sich dieser Erkenntnis mit dem Anspruch, die These der Glocalization, der Verortung kultureller Entwicklung in der internationalen Community des Jazz einerseits und der regionalen Community des eigenen Lebens der Musiker andererseits, tauge als generelles Erklärungsmodell für vieles, was im Jazz unserer Tage geschieht. Vor allem erkläre sie die unterschiedlichen Richtungen, die die Entwicklung des Jazz in den letzten Jahrzehnten in Europa und den USA genommen habe.
So ist “Jazz and Culture in a Global Age”, ganz wie der Klappentext es ankündigt, durchaus ein Denkanstöße gebendes und zugleich klar Stellung beziehendes Buch geworden. Dieser Rezensent hätte sich statt des etwas abseits stehenden Moderne-Schlusskapitels eine knappe und verbindende Zusammenfassung der vorhergehenden Argumente gewünscht. Nicholsons Beobachtungen mögen nicht überall stimmig erscheinen, einige der Debatten die er eröffnet, wirken unnötig, insgesamt aber regt er seine Leser ganz gewiss zum Weiterdiskutieren an.
Wolfram Knauer (Dezember 2014)
Warum Jazz? 111 gute Gründe
von Kevin Whitehead
Stuttgart 2014 (Reclam)
209 Seiten, 9,95 Euro
ISBN: 978-3-15-020359-0
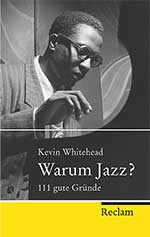 Warum Jazz? Das ist tatsächlich eine Frage, die diejenigen, die sich mit Jazz befassen – ob beruflich oder in ihrer Freizeit – immer wieder zu hören bekommen. Warum ausgerechnet Jazz? Was ist denn so schön an dieser Musik, die kaum mitsingbar ist, die manchmal zu altmodisch und dann wieder zu komplex oder avantgardistisch klingt. Warum eine Musik, die vom Hörer irgendwie Mitarbeit fordert?
Warum Jazz? Das ist tatsächlich eine Frage, die diejenigen, die sich mit Jazz befassen – ob beruflich oder in ihrer Freizeit – immer wieder zu hören bekommen. Warum ausgerechnet Jazz? Was ist denn so schön an dieser Musik, die kaum mitsingbar ist, die manchmal zu altmodisch und dann wieder zu komplex oder avantgardistisch klingt. Warum eine Musik, die vom Hörer irgendwie Mitarbeit fordert?
Kevin Whitehead findet 111 gute Gründe, aber mehr noch, er gibt 111 Antworten auf durchaus ernst gemeinte Fragen. Sein Buch “Warum Jazz?” wirkt damit auf den ersten Blick wie ein Vademecum für den Anfänger, der sich dem Jazz nähern möchte, sich aber unsicher fühlt, weil er nicht genau weiß, worauf er denn zu achten habe bei dieser Musikrichtung, bei der alle Konzertbesucher Experten zu sein scheinen. “Muss ich die Geschichte des Jazz kennen, um ihn schätzen zu können?” lautet gleich die zweite Frage, und Whiteheads korrekte Antwort ist: Nein, aber wie bei so vielem im Leben kann Erfahrung einem noch mehr Genuss bieten. “Erfahrene Hörer”, erklärt er also, “haben immer wieder Aha-Erlebnisse, das heißt, es gibt Momente, in denen sie erkennen, dass ein frischer oder neuer Klang auf alten Elementen gründet.” Vor allem kommt es auf Neugier an bei dieser Musik, auf die Fähigkeit, sich auf Überraschungen einlassen zu wollen. Dann erlebt man den Jazz vielleicht nicht länger als “altmodisch”, sondern als eine aktuelle Musik, eine musikalische Herangehensweise, die sich aus den Standards der Vergangenheit genauso nährt wie aus Einflüssen der Gegenwart.
Wie oft in Konversationen führen die Fragen auch Whitehead schnell dazu auszuholen. “Was ist Jazz?”, beginnt das Kapitel über “Grundlegendes”, in dem der Autor Improvisation und swing genauso abhandelt wie den Einfluss des Blues, das Repertoire des Jazz, Virtuosität oder die Bedeutung und Wirkung musikalischer Zitate.
“Konnte es nur in Amerika zur Vermischung afrikanischer und europäischer Elemente kommen?”, lautet eine der Fragen, die sein historisches Kapitel über den frühen Jazz einleitet, und seine Antwort versucht hier wie anderswo mit Legenden aufzuräumen. Die Kulturen, schreibt er, hätten sich bereits seit Jahrtausenden miteinander vermischt. Die Entstehung des Jazz im New Orleans des frühen 20sten Jahrhunderts sei höchstens ein Kulminationspunkt des Ganzen gewesen. Er erklärt den bandaufbau früher Jazzkapellen, beschreibt die Bedeutung von Musikern wie Buddy Bolden, Louis Armstrong oder Bix Beiderbecke und erwähnt die Rassentrennung in den USA, die dazu führte, dass schwarze und weiße Musiker nur selten miteinander spielten. Er betrachtet die Entwicklung des Jazzensembles hin zur Bigband, diskutiert die Bedeutung Duke Ellingtons und erklärt, warum der Jazz in den 1930er Jahren eine Art Popmusik war. Benny Goodman, Kansas City, Billie Holiday; die Fragen und Themen wechseln sich ab, und mit Django Reinhardt wird auch der Jazz in Europa kurz gestreift.
Whiteheads Fragestunde zum modernen Jazz beginnt sinnigerweise mit dem Dixieland-Revival der 1940er Jahre, dann erklärt er die harmonischen, rhythmischen und ästhetischen Neuerungen des Bebop, den Einfluss afro-kubanischer Elemente, aber auch die Frage, warum Jazzmusiker so gerne Aufnahmen mit Streichern machen. Cool Jazz, Hard Bop, Miles Davis, Bill Evans, Bürgerrechtsbewegung und Tourneen für das State-Department – viele der Fragen sind in diesen historischen Kapiteln so allgemein gehalten, dass sie Whitehead einfach nur zu knappen Zusammenfassungen von Jazzgeschichte animieren. Die Frage-Antwort-Struktur des Buchs erlaubt es ihm dabei allerdings, den Erzählfluss zu unterbrechen und das nächste Kapitel mit Ausrichtung auf die neue Frage jeweils aus einer anderen Perspektive zu beantworten.
“Was ist Avantgarde-Jazz”, beginnt eine weitere historische Abteilung, in der er bald über verschiedene Aspekte des Free Jazz, der Fusion, der 1970er und 1980er Jahre reflektiert. Und im letzten Kapitel nähert er sich sowohl Wynton Marsalis und den Young Lions als auch der aktuellen Jazzausbildung an Hochschulen. Steve Colemans Konzept der “M-Base” wird erklärt, aber auch die Conduction, also die Improvisationsdirigate etwa von Butch Morris. “Sind alle großen Jazzmusiker in New York zu Hause?” lautet eine Frage, und Whiteheads Antwort ist: Sicher nicht, aber vor allem in New York bekommen sie die größere Beachtung.
Die Frage der Fragen steht fast am Schluss des Buches: “Gibt es überhaupt noch eine Jazz-Avantgarde?” heißt sie, und Whitehead stellt klar, dass vieles, was unter diesem Label vermarktet wird, inzwischen eigentlich selbst als historisch bezeichnet werden müsste, weil die Parameter, nach denen sich die musikalische Ästhetik etwa freier Improvisationsmusik oder anderer sogenannter “cutting-edge”-Programme richtet, bereits vor Jahrzehnten festgelegt wurden.
“Warum Jazz? 111 gute Gründe” ersetzt keine Jazzgeschichte, aber in der häppchenartigen Weise, in der Kevin Whitehead sowohl allgemeine wie auch recht spezielle Fragen zum Jazz beantwortet, erfährt man nicht nur als Laie jede Menge über den Jazz, sondern wird auch als Kenner auf Facetten gestoßen, die einem Teile der Jazzgeschichte in neuem Licht erscheinen lassen. Dass der Autor die Entwicklungen in Europa bis auf wenige Seiten weitestgehend ausklammert, ist wohl vor allem der Tatsache zu verdanken, dass er sein Buch ursprünglich für ein amerikanisches Publikum geschrieben hat. Eine Erklärung hierzu – im Vorwort oder zumindest im Rahmen einer 112. Frage wäre ganz sinnvoll gewesen, zumal Whitehead selbst lange Zeit in Europa lebte und einen guten Einblick in die Entwicklungen hierzulande besitzt. Aber vielleicht ist es nicht die schlechteste Schlussfolgerung, wenn man sich nach 111 Fragen und Antworten dazu gedrängt fühlt, noch weitere zu stellen…
Wolfram Knauer (Juli 2014)
Jazz Me Blues. The Autobiography of Chris Barber
von Chris Barber (mit Alyn Shipton)
Sheffield 2014 (equinox)
172 Seiten, 19,999 Britische Pfund
ISBN: 978-1-84553-088-4
 Chris Barber hat auf seine eigene Art Jazzgeschichte geschrieben. Er hat den britischen Trad-Jazz, der lange Zeit recht puristisch auf New Orleans, auf kollektives Zusammenspiel, auf die Stilhaltung des Jazz der 1920er Jahre fokussiert war, in eine Gegenwart geholt, in der Skiffle, Blues und Rock ‘n’ Roll eine nicht minder wichtige Rolle spielten. Er entwickelte einen Stil, der auf der einen Seite die archaischen Seiten des frühen Jazz auf europäisches Ebenmaß glättete, verlor auf der anderen Seite nie den Respekt vor den Ursprüngen des Jazz aus den Augen und war sich durchaus auch der Entwicklungen dieser, “seiner” Musik bewusst, dessen Fans Barbers eigenen musikalischen Offenheit vielfach wohl nicht gefolgt wären.
Chris Barber hat auf seine eigene Art Jazzgeschichte geschrieben. Er hat den britischen Trad-Jazz, der lange Zeit recht puristisch auf New Orleans, auf kollektives Zusammenspiel, auf die Stilhaltung des Jazz der 1920er Jahre fokussiert war, in eine Gegenwart geholt, in der Skiffle, Blues und Rock ‘n’ Roll eine nicht minder wichtige Rolle spielten. Er entwickelte einen Stil, der auf der einen Seite die archaischen Seiten des frühen Jazz auf europäisches Ebenmaß glättete, verlor auf der anderen Seite nie den Respekt vor den Ursprüngen des Jazz aus den Augen und war sich durchaus auch der Entwicklungen dieser, “seiner” Musik bewusst, dessen Fans Barbers eigenen musikalischen Offenheit vielfach wohl nicht gefolgt wären.
In Zusammenarbeit mit Alyn Shipton hat Barber jetzt seine Autobiographie vorgelegt. In ihr erzählt er von seiner Kindheit in Londons Vorstädten, seiner Sozialisation in einem bewusst sozialistischen Haushalt und seiner ersten Begegnung mit dem Jazz durch den BBC. Er erhielt Geigenunterricht, kaufte sich seine ersten Jazzplatten, Louis Armstrong, Bessie Smith, Jelly Roll Morton, Duke Ellington, aber auch Blues von Sleepy John Estes oder Cow Cow Davenport. Nach dem Krieg zog seine Familie nach London, wo Barber Humphrey Lytteltons Band hörte und sich entschied, dass er Posaune spielen wollte. Er begann ein Mathematikstudium, dass er dann zugunsten der Musik aufgab. Er spielte mit verschiedenen Londoner Bands und erzählt, wie er und seine Musikfreunde verschiedenen Idolen des frühen Jazz anhingen, sie sich gegenseitig vorstellten und dabei immer tiefer in die Musik eindrangen.
Barber gründete eine Band zusammen mit dem Klarinettisten Monty Sunshine, der bald auch der Kornettist Ken Colyer und der Banjospieler und Gitarrist Lonnie Donegan angehörten und die 1953 und 1954, nachdem Colyer von einer längeren Reise nach New Orleans zurückgekehrt war, unter dem Namen Ken Colyer’s Jazzmen ihre ersten Aufnahmen vorlegte. Sie spielten Jazz ihrer Idole, daneben aber auch Trionummern mit Gesang und Banjo (Donegan), Gitarre (Colyer) und Bass (Barber), eine Besetzung, die die englische Tradition der Skiffle Musik begründete. Pat Halcox ersetzte Colyer, Donegan machte eine Solokarriere, Sunshine wurde Anfang der 1960er Jahre durch Ian Wheeler ersetzt, außerdem kam die die irische Sängerin Ottilie Patterson hinzu. Barbers Band aber war ab etwa 1953 ein Erfolgsmodell, tourte regelmäßig durch ganz Europa und beeinflusste mit ihrer Art eines weniger archaischen Dixieland eine ganze Generation von Jazzmusikern insbesondere in Skandinavien und Deutschland (wo nicht ganz ohne Grund die Hansestadt Hamburg unter traditionellen Jazzfreunden bald nur noch “Freie und Barberstadt Hamburg” hieß).
“Petite Fleur”, aufgenommen 1959, wurde ein Hit selbst in den USA, und Barber begründet die Tatsache, dass ihre Aufnahme sich besser verkaufte als das Original von Sidney Bechet mit der Tatsache, dass Monty Sunshine das Stück von einem Plattenspieler abgehört habe, der ein wenig zu schnell lief und es daher einen Halbton höher spielte als Bechet, was bestimmten Harmoniewechseln im Stück besonders gut getan hätte. In der Folge tourte Barber 1960 durch die Vereinigten Staaten, hörte jede Menge Jazz und Blues, traf auf traditionelle Kollegen, hörte aber auch die Musik der Zeit, etwa beim Monterey Jazz Festival, wo seine Band am selben Abend auftrat wie Ben Webster, Coleman Hawkins, J.J. Johnson und Ornette Coleman.
Zu seine großen Tourneen lud Barber sich immer amerikanische Stars ein, angefangen bei Bluesgrößen wie Sister Rosetta Tharpe, Sonny Terry, Brownie McGhee, Jimmy Witherspoon über Vertreter des klassischen Jazz wie Ed Hall, Albert Nicholas, Musiker des swingenden Mainstream wie Ray Nance oder Wild Bill Davis, R ‘n’ B-Musiker wie Louis Jordan, moderne Kollegen wie Joe Harriott oder John Lewis oder Musiker aus dem Poplager wie Van Morrison oder Paul McCartney.
Vielleicht ist es der Bescheidenheit Barbers zu verdanken, die ihn so liebenswert und unter Kollegen unterschiedlichster Stilrichtungen so beliebt gemacht hat, dass seine Autobiographie nicht selbst-erforschender ist, nicht weiter in die Tiefe dringt. Er nennt die Namen, viele Sessions, etliche Anekdoten. Über ihn selbst selbst aber erfahren wir leider recht wenig, auch seine musikalische Ästhetik scheint eher zwischen den Zeilen durch. Und so ist das Buch vor allem eine in Prosa gefasste Chronologie von Ereignissen, Plattenaufnahmen, Konzerten, wechselnden Besetzungen, mit dazwischen gestreuten, selbsterlebten oder von Kollegen gehörten Anekdoten. “Jazz Me Blues” ist damit ein stellenweise etwas namenslastiges, nicht überall flüssig zu lesendes Buch, das dennoch wichtige Facetten einer Spielart des europäischen Jazz beleuchtet. Und vielleicht ist es ja wirklich anderen überlassen, das alles etwas kritischer und mit Bezug auf die gesellschaftlichen wie musikalischen Veränderungen der Zeit, die Barber ja selbst mit geprägt hat, zu beschreiben.
Wolfram Knauer (August 2014)
Chet Baker. The Missing Years. A Memoir by Artt Frank
von Artt Frank
Charleston/SC 2014 (BooksEndependant)
215 Seiten, 19,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-9887687-4-1
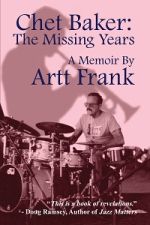 Artt Frank ist ein eher unbekannter Musiker des Jazz. In Tom Lords Diskographie sind gerade mal vier Sessions verzeichnet, die Frank ab 1997 als Schlagzeuger tätigte. Sein eigener “claim to fame” aber reicht zurück bis in die Mitt-1950er Jahre, als er zum ersten Mal Chet Baker im Bostoner Storyville Jazzclub hörte. Sie freundeten sich an, naja, sie sprachen anfangs des öfteren miteinander, und wann immer Frank in der Gegend war, in der Baker auftrat, stellte er sicher, dass er beim Konzert vorbeischaute. Ende der 1960er Jahre aber, als Baker nicht weit entfernt von Frank wohnte, der in Los Angeles als Maler arbeitete, wurde die Freundschaft enger, sie trafen sich immer wieder, und der Trompeter vertraute Frank viel Persönliches an, über seine Familie, über seine Drogensucht, über künstlerische und geschäftliche Entscheidungen.
Artt Frank ist ein eher unbekannter Musiker des Jazz. In Tom Lords Diskographie sind gerade mal vier Sessions verzeichnet, die Frank ab 1997 als Schlagzeuger tätigte. Sein eigener “claim to fame” aber reicht zurück bis in die Mitt-1950er Jahre, als er zum ersten Mal Chet Baker im Bostoner Storyville Jazzclub hörte. Sie freundeten sich an, naja, sie sprachen anfangs des öfteren miteinander, und wann immer Frank in der Gegend war, in der Baker auftrat, stellte er sicher, dass er beim Konzert vorbeischaute. Ende der 1960er Jahre aber, als Baker nicht weit entfernt von Frank wohnte, der in Los Angeles als Maler arbeitete, wurde die Freundschaft enger, sie trafen sich immer wieder, und der Trompeter vertraute Frank viel Persönliches an, über seine Familie, über seine Drogensucht, über künstlerische und geschäftliche Entscheidungen.
Franks Memoiren bilden diese Gespräche mit Baker ungemein lebendig erzählt ab, zum Teil mit erinnerten wortwörtlichen Zitaten. Ein wenig literarisch mutet das zum Teil an und man fragt sich, wie sehr man der Erinnerung des Autors trauen darf. Aber dann ist Geschichte nun mal immer die Sammlung von Erinnerungen, und Franks Erinnerung an Baker ist sicher weitaus tiefer als die selbst der meisten Biographen des Trompeters.
Mit dem Wissen also, dass man weder eine Biographie noch eine fundierte historische Studie vor sich hat, lässt sich aus Franks Buch eine Menge über Bakers Persönlichkeit herauslesen. Ein zweiter Band ist geplant.
Wolfram Knauer (August 2014)
Free Jazz and Improvisation on Vinyl 1965-1985. A Guide to 60 Independent Labels
von Johannes Rød
Oslo 2014 (Rune Grammofon)
110 Seiten, 299 Norwegische Kronen
ISBN: 82-92598-87-1
 Ornette Coleman brachte seine großen Quartettaufnahmen bei Atlantic heraus, Cecil Taylor nahm für Blue Note auf, John Coltrane für Impulse – zu Zeiten, als diese Labels bereits den Schritt von unabhängigen Plattenfirmen zu den Majors gegangen waren. Die meisten Entwicklungen des Free Jazz der Jahre 1965 bis 1985 aber wurden auf kleinen unabhängigen Labels veröffentlicht, oft genug Ein-Personen-Firmen, die mal weniger, mal mehr Produktionen pro Jahr herausbringen konnte und selten Mittel für aufwändige Produktionen besaßen. Und so waren die Platten in der Regel eine labor of love, aus dem Drang entstanden, eine Musik zu dokumentieren, die, weil der freien Improvisation verpflichtet, ansonsten verklungen wäre.
Ornette Coleman brachte seine großen Quartettaufnahmen bei Atlantic heraus, Cecil Taylor nahm für Blue Note auf, John Coltrane für Impulse – zu Zeiten, als diese Labels bereits den Schritt von unabhängigen Plattenfirmen zu den Majors gegangen waren. Die meisten Entwicklungen des Free Jazz der Jahre 1965 bis 1985 aber wurden auf kleinen unabhängigen Labels veröffentlicht, oft genug Ein-Personen-Firmen, die mal weniger, mal mehr Produktionen pro Jahr herausbringen konnte und selten Mittel für aufwändige Produktionen besaßen. Und so waren die Platten in der Regel eine labor of love, aus dem Drang entstanden, eine Musik zu dokumentieren, die, weil der freien Improvisation verpflichtet, ansonsten verklungen wäre.
Johannes Rød hat 60 dieser kleinen Labels in seinem Buch dokumentiert, von “A” wie dem Label About Time bis “V” wie der Firma Vinyl. Die Klassiker sind dabei, allen voran die deutschen FMP und Moers Music, das Schweizer HatHut Label, Black Saint und Soul Note aus Italien, ICP aus Holland, Incus aus Großbritannien, BYG Actuel aus Frankreich sowie die vielen amerikanischen Kleinstlabels wie Delmark, ESP, Flying Dutchman, Nessa, Strata-East oder Saturn. Rød beginnt jedes Kapitel mit einer Kurzdarstellung der Labelgeschichte, Hintergründen zur Entstehung, zu den Menschen, die die Musik produzierten, zur Programmpolitik. Dann folgt, wie auf Linienpapier eines altertümlichen Bestandsbuches die Diskographie im Bereich des Free Jazz bzw. der frei improvisierten Musik: Plattennummer, Künstler und Titel der Platte sowie Jahr der Veröffentlichung. Kurz und prägnant; weder Angaben zur Besetzung noch über eventuelle Wiederveröffentlichungen. Einige der großen, einflussreichen Labels erhalten einen ausführlicheren, bis zu einer Seite umfassenden Darstellungstext, ansonsten sind es meist nur wenige Zeilen. In der Mitte des Buchs finden sich sechzehn farbige Seiten, auf denen jeweils vier Plattencover abgebildet sind. Ein Epilog verweist auf weitere Veröffentlichungen, aber auch auf Entscheidungen des Autors, welche Labels er aufnehmen, welche er außer Acht lassen wollte. Schließlich findet sich noch ein Interview, dass der Journalist Rob Young mit dem norwegischen Labelchef Rune Kristoffersen führte, in dessen Verlag das Buch ja auch erschien und in dem dieser die Bedeutung der unabhängigen Labels für die Geschichte insbesondere des Free Jazz seit den 1960er Jahren erzählt. Er reflektiert darüber hinaus über Unterschiede zwischen europäischen und amerikanischen Produktionen und über die Veränderungen des Marktes während der 20 Jahre, die das Buch abdeckt sowie der Zeit danach.
Johannes Røds Buch ist ein wenig Dokumentation von Dokumentation, eine in ihrer Nüchternheit fast buchhalterische Darstellung des Free Jazz als einer Musik, die ihre historische Komponente auch dank der Leistung all dieser kleinen freien Labels erhielt. Das Buch wendet sich letzten Endes an Sammler, die mit ihm einen Katalog der wichtigsten Kleinauflagen des Genres an die Hand bekommen, edel gebunden, auf gutem Papier gedruckt und in einem Layout, das deutlich macht, dass nicht nur die Arbeit all dieser Labels, sondern auch die Leidenschaft der vielen Sammler eine labor of love ist.
Wolfram Knauer (August 2014)
Philosophie des Jazz
von Daniel Martin Feige
Frankfurt 2014 (Suhrkamp)
142 Seiten, 14,40 Euro
ISBN: 978-3-518-29696-7
 Was ist eigentlich Jazz? Diese Frage wird unterschiedlich beantwortet, je nachdem aus welcher Warte der Gefragte auf die Musik blickt. Der Musikwissenschaftler wird die harmonischen, rhythmischen, formalen, konzeptionellen Strukturen der Musik erklären können, der Historiker wird auf Entwicklungs- und Einflussstränge verweisen, der Soziologe wird sich vielleicht mit der Improvisation als einem gesellschaftlichen Modell befassen, der Linguist mit den musikalischen Äquivalenten von Vokabeln und Satzstrukturen, der Musiker wird einfach spielen, der Fan wird verzückt hören.
Was ist eigentlich Jazz? Diese Frage wird unterschiedlich beantwortet, je nachdem aus welcher Warte der Gefragte auf die Musik blickt. Der Musikwissenschaftler wird die harmonischen, rhythmischen, formalen, konzeptionellen Strukturen der Musik erklären können, der Historiker wird auf Entwicklungs- und Einflussstränge verweisen, der Soziologe wird sich vielleicht mit der Improvisation als einem gesellschaftlichen Modell befassen, der Linguist mit den musikalischen Äquivalenten von Vokabeln und Satzstrukturen, der Musiker wird einfach spielen, der Fan wird verzückt hören.
Was aber antwortet der Philosoph? Nun, Philosophen haben sich selten über Jazz geäußert, und wenn sie es taten, dann durchaus schon mal mit gehörigem Missverständnis wie im Fall Theodor W. Adornos, dessen Äußerungen zum Jazz eigentlich erst dann Sinn ergeben, wenn man sich die Musik vor Augen hält, die Adorno zur Zeit, als er diese Aufsätze schrieb, kennen konnte (oder kennen wollte). Ein großes Problem aller Auseinandersetzung mit dem Jazz nämlich ist ein terminologisches: Welchen Jazz meinen wir eigentlich? Sprechen wir von Jazz und denken dabei an eine im Volkstum von New Orleans verankerte Kunst, so haben wir eine grundsätzlich andere Situation als wenn wir von Jazz sprechen, aber die frei denkende und improvisierende Szene der europäischen 1960er und 1970er Jahre vor Augen haben.
Es ist also an der Zeit, dass sich ein veritabler Philosoph mit dieser Musik auseinandersetzt, und es ist angesichts der ausgeführten Probleme vielleicht ganz passend, dass Daniel Martin Feige seine Ausführungen nicht etwa mit der Frage nach dem Jazz beginnen lässt. Stattdessen beginnt er mit der Frage: “Was ist eine Philosophie des Jazz?”, und arbeitet erst einmal die Merkmale der Philosophie heraus, um dann auf Besonderheiten des Jazz einzugehen. “Man kann”, schreibt er, “über den Jazz nicht nachdenken, ohne zugleich kontrastiv über andere Arten von Musik und hier vor allem die Tradition der europäischen Kunstmusik nachzudenken.” Bei solch einem vergleichenden Ansatz bestünde die Gefahr falscher Maßstäbe, wenn man den Jazz aber kontrastiv zur europäischen Kunstmusik erläutere, ließe sich diesem Einwand trefflich begegnen.
In seinen einzelnen Kapiteln diskutiert Feige das improvisatorische Unterscheidungsmerkmal des Jazz (zur komponierten europäischen Kunstmusik), das Verhältnis zwischen improvisierten Performances und dem Werkverständnis (und der Bedeutung von Standards im Jazz), befasst sich mit den individuellen und kollektiven Aspekten in der musikalischen Praxis und hier insbesondere mit dem interaktiven Moment künstlerischen Handelns als verkörperter Tradition, um schließlich vom kontrastierenden Ansatz abzuweichen und eine generelle These aufzustellen, dass nämlich Jazz etwas explizit mache, was für Kunst als solche wesentlich sei. Somit gelangt Feige am Schluss seines Buchs von der Frage danach, was denn eine Philosophie des Jazz wohl ausmache, zu einer These über die philosophische Relevanz des Jazz über die rein musikalische Praxis hinaus.
Daniel Martin Feiges “Philosophie des Jazz” ist keine leichte Lektüre. Weder ersetzt das Buch eine Jazzgeschichte noch fasst es bisheriges ästhetisches oder philosophisches Nachdenken über Jazz konzis zusammen. Feige entwickelt seine Philosophie des Jazz aus dem intensiven Nachdenken über eine Musik, die ihm als mitteleuropäischer Philosoph natürlich auch die eigene Denkhaltung permanent vor Augen führt, und die schon von daher eine Kontrastierung mit der ästhetischen Wirklichkeit, aus der heraus er Musik erfährt, sinnvoll macht. Man möge daher vielleicht die Einschränkung erlauben, dass es sich bei Feiges Buch vor allem um eine “Europäische Philosophie des Jazz” handelt oder wenigstens um eine “Philosophie des Jazz aus europäischer Sicht”, denn die Kontrastierung mit der europäischen Kunstmusik, aus der heraus er seine Thesen entwickelt, kommt gewiss zu anderen Schlussfolgerungen als es eine Kontrastierung etwa mit afro-amerikanischen Traditionen tun würde. Westliche Philosophie, kritisiert Alison Baile, produziere immer noch Erkenntnisse über Wissen, Realität, Moral und die menschliche Natur, für die sie Aspekte wie Hautfarbe oder Geschlecht als nicht notwendige Kriterien erachte [“In its quest for certainty, Western philosophy continues to generate what it imagines to be colorless and genderless accounts of knowledge, reality, morality, and human nature” (Center on Democracy in a Multiracial Society. Towards a Bibliography of Critical Whiteness Studies, Urbana/IL 2006: p. 9)]. Eine Perspektivklärung aber ist von jeder Seite her notwendig, um eine Sache möglichst umfassend zu verstehen. Und so ist Daniel Martin Feiges Perspektive auf den Jazz aus europäischer philosophischer Sicht ein trefflicher, notwendiger und weiter-zu-diskutierender Beitrag zum Nachdenken über Jazz als universelle künstlerische Äußerung, ein Beitrag, wohlgemerkt, zu einer noch zu schreibenden umfassenderen Philosophie des Jazz.
Wolfram Knauer (September 2014)
Das zeitgenössische Jazzorchester in Europa. Einblick in Tendenzen, Strömungen und musikalische Einflüsse des großorchestralen Jazz
von Daniel Lindenblatt
München 2014 (Akademische Verlagsgemeinschaft)
117 Seiten, 34,90 Euro
ISBN: 978-3-86924-593-5
 Ist Bigband-Jazz nach wie vor eine aktuelle Musik? Neben großbesetzten Ensembles, die in der Tradition der klassischen Jazz-Bigband spielen, gibt es etliche Projekte, die den Sound dieser Instrumentierung erweitern und die Bigband damit ins 21ste Jahrhundert überführen. Eine Spurensuche der Möglichkeiten unternimmt Daniel Lindenblatt in seiner wissenschaftlichen Arbeit über Aspekte des aktuellen Bigbandjazz in Europa.
Ist Bigband-Jazz nach wie vor eine aktuelle Musik? Neben großbesetzten Ensembles, die in der Tradition der klassischen Jazz-Bigband spielen, gibt es etliche Projekte, die den Sound dieser Instrumentierung erweitern und die Bigband damit ins 21ste Jahrhundert überführen. Eine Spurensuche der Möglichkeiten unternimmt Daniel Lindenblatt in seiner wissenschaftlichen Arbeit über Aspekte des aktuellen Bigbandjazz in Europa.
Lindenblatt beginnt seine Darstellung mit dem Versuch einer terminologischen Unterscheidung zwischen “Bigband” und “Jazzorchester” (die so kategorial nicht ausfällt, wie es im Klappentext des Buchs behauptet wird), um dann über die Jahrzehnte seit der Swingära die Besetzungscharakteristika zu verfolgen und insbesondere die Besonderheiten des großorchestralen Jazz in Deutschland herauszustreichen, einem Land, dass nicht zuletzt durch seine Rundfunk-Bigbands eine besonders aktive und kreative Szene in diesem Bereich besitzt. Ein zweites Kapitel widmet sich Definitionsfragen im Jazz ganz allgemein, erläutert den Begriff des “ästhetischen Felds” des Jazz, das sich aus der Summe seiner Geschichte speist, und geht auf das Verständnis von Jazz als einer “grundsätzlichen Spielhaltung” ein, wie es insbesondere von europäischen Musikern gehegt wird. Ein Unterkapitel widmet sich dem für sein Thema besonders wichtigen Bereich der Komposition im Jazz, wobei Lindenblatt auch diskutiert, inwieweit die aus der klassischen Musik übernommene Idee eines Werkcharakters im Jazz funktioniere bzw. gegebenenfalls anders gefasst werden müsse.
Im praktisch-analytischen Teil seiner Arbeit greift Lindenblatt dann vier Fallbeispiele heraus, die er analysiert, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Tendenzen herauszuarbeiten. Für Geir Lysne etwa stellt er fest, dass dieser auch die improvisatorischen Teile seiner Kompositionen in dramaturgische Bögen einbinde, dass er bewusst folkloristische Elemente benutze, um “über das kompositorische Handwerk hinaus weitere charakterisierende Elemente” einzubringen, und dass er seine Stücke gern modal konzipiere. Diese Erkenntnisse baut er schließlich in eine Diskussion des “nordischen Tons” ein, der sicher nicht nur im Jazz, hier aber besonders geführt wird. Am Beispiel Rainer Tempels zeigt Lindenblatt, wie dieser sich sowohl einer traditionellen Bigband-Sprache als auch eher aus dem zeitgenössischen Kompositionsbereich abgeleiteter serieller Kompositionsprinzipien bediene. Monika Roscher wiederum benutze darüber hinaus auch “Einflüsse aus moderner Popularmusik und dessen Klangästhetik(en)” und erreiche dadurch eine bewusste Abwendung von “tradierten Konventionen des Bigband-Jazz”. Das Backyard Jazzorchestra schließlich arbeite insbesondere mit Elementen verschiedener folkloristischer Provenienz.
Die beiden Richtungen, die Lindenblatt in seinen Beispielen herausstreicht, beleuchten auf der einen Seite den Umgang der Bigband mit den Konventionen ihres eigenen Subgenres, auf der anderen Seite die Möglichkeiten dieser Besetzung, folkloristische Elemente aufzunehmen. Insbesondere in Europa gäbe es hier Entwicklungen, die weit von der jazz-spezifischen Traditionsbindung fortführten (wie sie in Amerika immer noch das Klangbild der Jazzorchester bestimmt).
Lindenblatts Arbeit entstand als wissenschaftliche Studie und liest sich entsprechend akademisch. Seinen Lesern kommt der Autor in kurzen Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel entgegen, lässt aber leider eine konzis formulierte Fragestellung vermissen. Seine im Vorwort des Buchs vorgetragenen Thesen haben stattdessen etwas Gemeinplatz-artiges (“Die ästhetischen Entwicklungen des zeitgenössischen Jazz spiegeln sich weiterhin in zeitgenössischen Großformationen des Jazz wi[e]der” / “Für das zeitgenössische Jazzorchester lassen sich Tendenzen und musikalische Einflüsse feststellen, deren Herkunft sich eindeutig auf eine europäische Musikkultur zurückführen lassen” / “Eine ‘Vielfalt der Stile’ kann in eine Vielfalt der Ästhetiken übersetzt werden”), und auch die lobenswerten Lupenblicke auf vier konkrete Beispiele führen nicht wirklich über das hinaus, was man bereits geahnt hat. Immerhin richtet Lindenblatt sein Augenmerk wirklich auf aktuelle Großformationen, bleibt aber auch hier zu musikimmanent, beschreibt und schlussfolgert, fragt jedoch nirgends nach dem Warum. Diese Frage allerdings bleibt dem Leser (zumindest diesem Leser) nach der Lektüre im Kopf. Warum schreiben Lysne, Tempel, Roscher oder Schultze so, wie sie schreiben, warum klingen die Bands so, wie sie klingen, welche konkreten Erkenntnisse lassen sich aus den zahlreichen analytischen Beobachtungen, die Lindenblatt anstellt, ziehen, und zwar mit klarem Bezug zu einer (zu welcher?) grundlegenden Fragestellung?
Wolfram Knauer (September 2014)
Piano Works
von Hank Jones
Santa Monica/CA ca. 2014 (Universal Music Publishing Group)
40 Seiten, 29,20 Euro
 Hank Jones war einer der bedeutendsten Pianisten des 20sten Jahrhunderts. Er ist ab den 1940er Jahren auf unzähligen Aufnahmen präsent als immer geschmackssicherer Begleiter und virtuoser Solist. Seit den 1950er Jahren hat er zudem viele Einspielungen mit eigenem Trio gemacht. In den 1970er Jahren machte insbesondere das Great Jazz Trio von sich Reden, in dem Jones mit Ron Carter und Tony Williams zusammenspielte. Auf solchen Einspielungen war Jones vor allem als Interpret von Standards zu hören; daneben aber war er immer auch als Komponist aktiv.
Hank Jones war einer der bedeutendsten Pianisten des 20sten Jahrhunderts. Er ist ab den 1940er Jahren auf unzähligen Aufnahmen präsent als immer geschmackssicherer Begleiter und virtuoser Solist. Seit den 1950er Jahren hat er zudem viele Einspielungen mit eigenem Trio gemacht. In den 1970er Jahren machte insbesondere das Great Jazz Trio von sich Reden, in dem Jones mit Ron Carter und Tony Williams zusammenspielte. Auf solchen Einspielungen war Jones vor allem als Interpret von Standards zu hören; daneben aber war er immer auch als Komponist aktiv.
Die in diesem Band enthaltenen Stücke stammen zumeist aus der Zeit nach 1970 und zeigen, wie Bob Blumenthal in seinem Vorwort betont, dass er die harmonischen Entwicklungen seines Bruders Thad, Oliver Nelsons und anderer Zeitgenossen wahrgenommen habe. Es gibt Blues (“Peedlum”) und harmonisch offenere Stücke (Passing Time”), Balladen (“Take a Good Look”) und Walzer (“Lullaby”). Die Lead-Sheets enthalten die themenmelodie, z.T. akkordisch gesetzt, sodass man einen kleinen Eindruck der typisch Jone’schen Voicings erhält, sowie die Harmoniegrundlagen der Improvisationschorusse, für einzelne Titel (“Alone & Blue”, “Good Night”) auch Texte. Weitere Titel sind “A Darker Hue of Blue”, “A Major Minor Contention”, “Ah Oui”, “Bangoon”, “Duplex”, “Good Night”, “Interface”, “Intimidation”, “Orientation” und “Sublime”.
Zwischen Bebop, Uptempo und Ballade finden sich in diesem Band wunderbare Piècen, die den Geist Hank Jones’ hervorrufen, zugleich aber auch jedes Repertoire bereichern können.
Wolfram Knauer (April 2014)
We Thought We Could Change the World. Conversations with Gérard Rouy
von Peter Brötzmann & Gérard Rouy
Hofheim 2014 (Wolke Verlag)
191 Seiten, 28 Euro
ISBN: 978-3-95593-047-9
 Gérard Rouy begleitete den Filmemacher Bernard Josse im November 2008 und im August 2009, als dieser seinen Film “Soldier of the Road” über Peter Brötzmann drehte. Rouy war dafür zuständig, den Saxophonisten zum Erzählen zu bringen, und Rouy berichtet, wie frustrierend es für ihn gewesen sei, dass der Film naturgemäß nur einen Bruchteil der Gespräche wiedergeben konnte. Im vorliegenden Buch werden diese Gespräche nun auf 100 Seiten gesammelt, daneben enthält es knapp 60 Seiten Fotos, die Gérard Rouy über die Jahrzehnte von Brötzmann machte, sowie Abbildungen diverser Kunstwerke des Saxophonisten, eine knappe Diskographie und einen Namensindex.
Gérard Rouy begleitete den Filmemacher Bernard Josse im November 2008 und im August 2009, als dieser seinen Film “Soldier of the Road” über Peter Brötzmann drehte. Rouy war dafür zuständig, den Saxophonisten zum Erzählen zu bringen, und Rouy berichtet, wie frustrierend es für ihn gewesen sei, dass der Film naturgemäß nur einen Bruchteil der Gespräche wiedergeben konnte. Im vorliegenden Buch werden diese Gespräche nun auf 100 Seiten gesammelt, daneben enthält es knapp 60 Seiten Fotos, die Gérard Rouy über die Jahrzehnte von Brötzmann machte, sowie Abbildungen diverser Kunstwerke des Saxophonisten, eine knappe Diskographie und einen Namensindex.
Die Gespräche drehen sich vor allem um Biographisches und Ästhetisches. Brötzmann erzählt über seine Kindheit in Schlawe im heutigen Polen, seine Jugend in Remscheid. Er erzählt vom Einfluss der Nachkriegszeit auf seine musikalische Haltung, vom Unterschied der ästhetischen Ansätze gleichaltriger europäischer Musiker, die durch ihre jeweiligen nationalen Erfahrungen geprägt waren. Brötzmann las Joachim Ernst Berendts Jazzbuch und hörte Willis Conovers Jazzsendung auf der Voice of America und war anfangs vor allem vom traditionellen Jazz fasziniert. Er spielte Klarinette zu den Platten, die er besaß und baute sich ein eigenes Schlagzeugset. Mit 17 Jahren entschloss er sich die Schule zu schmeißen und an der Kunstakademie in Wuppertal zu studieren. Auf dem Saxophon sei er reiner Autodidakt gewesen; seinen eigenen Sound sieht er als Resultat seines technisch “falschen” Ansatzes. In der Wuppertaler Galerie Parnass half er 1962 bei einer Ausstellung Nam June Paiks aus, der ihm die Welt John Cages öffnete.
Brötzmann erzählt vom deutschen Jazz der 1960er Jahre, von den ersten Schlagzeugern, mit denen er zusammenspielte, von Auftritten mit Alexander von Schlippenbachs Globe Unity Orchestra und ersten pan-europäischen Projekten. Er resümiert über die Weltveränderungsgedanken, die 1968 auch durch die Jazzszene schwappten, zeigt sich aber auch als Realist, der schnell erkannte, dass “wir vielleicht nicht die Welt nicht verändern können, dass wir aber sehr wohl von Zeit zu Zeit das Denken der Menschen beeinflussen können”. Ein eigenes Kapitel ist dem Projekt “Free Music Production” gewidmet, an deren Entstehung Brötzmann und Peter Kowald beteiligt waren. FMP schuf auch eine Verbindung zu Musikern aus dem Osten Deutschlands, und Brötzmann erzählt von Konzerten in der DDR und der Schwierigkeit, mit der Ostgage sinnvolle Dinge zu erstehen, da das Geld im Westen nur einen Bruchteil wert war. Er berichtet über sein Trio mit Fred van Hove und Han Bennink und über gemeinsame Projekte mit Albert Mangelsdorff, die halfen, dass einige der vehementen Kritiker seiner Musik ihm eine weitere Chance gaben.
Das Kapitel “Freundschaften” handelt von Misha Mengelberg, Frank Wright, Sonny Sharrock, geht aber auch auf gesellschaftspolitische Ansichten Brötzmanns ein. Er erzählt ausführlich von Parallelen zwischen seiner Musik und seinen bildenden Kunstwerken – der Unterschied der beiden Berufe sei vor allem, dass man als Maler allein arbeite – und identifiziert einzelne ikonographische Versatzstücke seiner Malerei. Er erzählt offen über seine Alkoholprobleme in der Vergangenheit und darüber, dass er Glück gehabt habe, den Absprung geschafft zu haben. Es gibt Leute, die meinen, im Alter sei Brötzmann melodischer geworden; er selbst aber findet, dass dieses Interesse an der Melodie immer dagewesen sei. Auch habe ihm bei allem Bemühen “sein eigenes Ding” zu machen, der amerikanische musikalische Ansatz in Bezug auf Songs oder den Blues immer gefallen. Improvisation sieht er größtenteils als Vergnügen, aber auch als Risiko, wobei sich diese beiden Seiten nicht ausschlössen. Er besäße sehr unterschiedliche Instrumente; seine Saxophonsammlung allein sei mittlerweile fast zu groß geworden.
Musiker zu sein, sei immer ein schweres Brot gewesen, die Zukunft der Musik aber sei in Gefahr, wenn selbst bei staatlich subventionierten Maßnahmen nur der breite Erfolg zähle. Es gäbe da sicher eine gehörige Überproduktion an Kunst, ihn selber eingeschlossen, im großen und ganzen aber seien vor allem die Strukturen, die noch in den 1970er und 1980er Jahren funktioniert hätten, den Bach runtergegangen. “Die jungen Leute kommunizieren nur noch über das Internet”, bedauert er und prophezeit: “Ich glaube, das ist sowieso das Ende aller Musik.” Bei allem Pessimismus müsse man als Musiker aber versuchen, das, was man selber mache, möglichst gut zu machen, um die Menschen zu erreichen und zu überzeugen.
“We Thought We Could Change the World” ist eine ausgesprochen lesenswerte Reflektion über Brötzmanns eigenen Lebensweg, seine Ideale und die Wirkung seiner Kunst. Die Musik ersetzt ein solches Buch nicht, aber sie bietet erhebliche zusätzliche Information. Rouys Fotos begleiten Brötzmann in diversen Projekten zwischen 1972 und 2009 und leiten sehr gelungen zu dem über, was auch nach der Lektüre dieses Buchs im Mittelpunkt stehen sollte: den Genuss einer Platte oder die Vorfreude aufs nächste Konzert.
Wolfram Knauer (April 2014)
Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall
von Gabriel Solis
New York 2014 (Oxford University Press)
183 Seiten, 16,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-974436-7
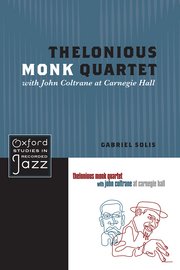 In 1957 John Coltrane followed Sonny Rollins as tenor saxophonist in Thelonious Monk’s band for half a year which resulted in one of the most important partnerships in jazz. The two made a couple of studio recordings, and later several bootlegs added to their discography. In 2005, Larry Appelbaum discovered tapes of a benefit concert played at Carnegie Hall, made for the Voice of America, but never broadcast. The recording was issued and celebrated by fans and critics alike. One main difference to bootlegs was that, unlike most other live recordings, this concert had originally been meant to be recorded and broadcast.
In 1957 John Coltrane followed Sonny Rollins as tenor saxophonist in Thelonious Monk’s band for half a year which resulted in one of the most important partnerships in jazz. The two made a couple of studio recordings, and later several bootlegs added to their discography. In 2005, Larry Appelbaum discovered tapes of a benefit concert played at Carnegie Hall, made for the Voice of America, but never broadcast. The recording was issued and celebrated by fans and critics alike. One main difference to bootlegs was that, unlike most other live recordings, this concert had originally been meant to be recorded and broadcast.
Gabriel Solis who is the author of one of the major studies of Thelonious Monk’s music, “Monk’s Music. Thelonious Monk and Jazz History in the Making” from 2008, examines the resulting album as a document of a crucial period in the musical development of both John Coltrane and Thelonious Monk, but he also asks “questions about changes in jazz over the course of the twentieth century, and critical questions about jazz’s place in American culture”.
In his introduction Solis places the recording within jazz history of its time, pointing out that the 1950s were “an exceptional moment for live jazz recordings”, introducing a different consciousness for the music both within the listener and the musicians. Solis then discusses the concepts of improvisation, composition, interaction, and repetition in jazz to lay ground for an understanding of his later analyses. Solis follows the concept of repetition from small to large, from motif, groove, and rhythm to chorus and repetition of pieces in a repertoire. He shortly touches upon aesthetic connotations of repetition in an African-American context. Solis then raises the question of composition and improvisation, terms which often are used too rigidly to do the music itself justice. Rather than view the two as antitheses, he refers to Bruno Nettl who described them as fundamentally part of the same idea. Solis focuses the reader’s attention on connotations of these and other terms so that they will read them with caution in his later text, that they will understand that whenever he speaks of composition there is an improvisational element present and vice versa. From small to big, Solis ends this part of his discussion with a reflection upon the “Werkbegriff” in jazz, a highly European concept that had an influence on jazz insofar as it has influenced all judgement of “established” music and kept jazz on the other side of the field for a long time. The result was, Solis concludes, that not Ellington, Parker, Coltrane, Monk earned the first Pulitzer for a jazz piece but Wynton Marsalis’ “semiclassical oratorio ‘Blood on the Fields'”. Solis ends his introduction with a short overview of the book’s chapter outline, part 1 looking at the careers of both protagonists up to the time of the concert as well as at the occasion of the concert, a benefit for the Morningside Heights Community Center, and the concert program aside from the Coltrane/Monk bill; part 2 analysing the eight tracks issued in four chapters, focusing on “the most compelling aspects of the particular performances”; and part 3 looking at the recording’s release in 2005 and its critical and aesthetic reception.
Chapter 1 looks at the musical partnership between Thelonious Monk and John Coltrane and how it affected both of their musical aesthetic and careers. Solis explains the different perception of the two artists, Monk as a composer, Coltrane as a performer/improviser. He discusses the various sidemen Monk hired for recordings since the 1940s and how their participation in and interpretation of his music affected his own style. Biographical asides are left at that, no explanation, for instance as to why Monk lost his cabaret card, but that is in line with the argument of his book which tries not to be biographical in the least and should be read alongside the biographies Solis lists in his bibliography (his own included). Solis mentions influences and experiences on John Coltrane’s much more recent career and his period working with Miles Davis. He explains how Coltrane and Monk got together in 1957 and then gives a short run-down of the existing studio recordings by the two musical partners. Monk’s influence on Coltrane is attested to, not the least by the saxophonist himself who acknowledged that he had learned “a lot, (…) little things” while working with Monk. The influence, Solis argues, was not merely musical, but aesthetic as well: “Monk gave Coltrane space and freedom”. And, he continues, Coltrane learned “a more sophisticated conception of form in solos”, he learned “musical direction”, he learned how to pay attention to “musical form”.
Chapter 2 starts with a discussion of the “‘jazz concert’ phenomenon” and how a concert on the stage of Carnegie Hall had to differ from a set in a New York night club. Solis looks at the idea of a jazz concert as a genre upon itself, discussing its history from the Clef Club through Benny Goodman’s and Duke Ellington’s Carnegie Hall concerts and Norman Granz’s Jazz at the Philharmonic events. He describes the specific story behind the benefit for the Morningside Heights Community Center and lists the other artists on the program, Sonny Rollins, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Austin Cromer, Chet Baker, and Zoot Sims. He looks at the admission fees and asks who the potential audience might have been, and he quotes from contemporary reviews of the concert.
Chapter 3 finally approaches the music itself, the two slow pieces of the first 30-minute set, “Monk’s Mood” and “Crepuscule with Nellie”, two interpretations with hardly any solo playing focused on “the formal structure of the compositions themselves”. Solis is both interested in the ballad approach of the two protagonists and in how Monk’s complex harmonic writing connects with the melodic direction of the pieces. Solis shows the orchestral qualities of “Monk’s Mood”. He describes the two melodies that form the piece, and he explains what he calls “a characteristically ‘Monkish’ ambiguity” in the harmonic approach. He runs down earlier interpretations of the piece by Monk and different bands, then analyses the Carnegie Hall performance, especially pointing out pianistic influences on Monk. Unlike “Monk’s Mood”, “Crepuscule with Nellie” was a new piece in Monk’s repertoire, which, as Solis explains, he continued to treat as “a more or less fixed composition”, never using it as a vehicle for extended improvisation. Solis points to possible influences from Debussy or Chopin and sees the piece’s concept as more pianistic or at least instrumental than that for “Monk’s Mood”. He compares the Carnegie Hall interpretation with later recordings and notices how all of them are similar.
Chapter 4 looks at the two up-tempo numbers from the first set, “Evidence” and “Nutty”. “Evidence”, based upon the harmonies of the standard “Just You, Just Me”, was a staple in Monk’s repertoire, likely to be recognized by the audience, and “Nutty” had a simple harmonic structure. In both pieces, Solis is interested in Coltrane’s solo language and in his reactions to Monk’s “idiosyncratic way of voicing chords”. With Monk, in these pieces, Solis is mostly interested in the way he works with the rhythm section and with the soloist. Solis calls “Evidence” “a study in dissonance”. He looks at the interaction between Monk and drummer Shadow Wilson who mostly keeps time, yet “adds a significant layer of complexity, keeping the head even more rhythmically unpredictable”. He points to changes in tension when Coltrane’s solo starts which he sees as “one large statement, rather than three self-contained choruses”. He also listens closely to Monk’s accompaniment heavily relying on material from the head of the composition. “Nutty” is taken a bit faster than in other recordings of the piece, and Solis compares’ Coltrane’s solo to a studio recording the two had done a bit earlier. Monk’s solo is based upon motivic references to the head.
Chapter 5 examines “Bye-Ya” and “Sweet and Lovely” from the second set, and the author’s interest lies in how the band treats “the songs holistically, approaching them melodically, harmonically, rhythmically, and motivically as complex entities, with musical challenges but also historical contexts and meanings to themselves and their audiences”. As to “Bye-Ya”, Solis discusses connotations of Latin influences in Monk’s life and music. He follows Coltrane through his solo and describes the interaction between the four musicians. “Sweet and Lovely” was the only standard of the evening, and Solis takes the chance to follow the song’s success through Monk’s youth and to ask about his possible interest in the tune which he first recorded in 1952. He examines the composition (“the head”) itself and discovers “Monkish” elements in it, then looks at the interpretation which starts “angular”. He discusses Monk’s approach to what Solis calls his “transitional” solo, points out how he plays with melodic and harmonic motifs and expectations, and how Coltrane follows with a “similarly organized chorus”. After the three choruses, the band pauses, then “jumps into a double time groove that is also at a significantly faster underlying tempo”.
Chapter 6 looks at the final “Blue Monk” and the band’s theme song “Epistrophy”. “Blue Monk” is a starting point for discussing the use of the blues with Monk and Coltrane. Short versions of “Epistrophy” ended both sets of the concert, and Solis asks about “how they placed Monk within the models of artistry and entertainment in the jazz world at the time”. The fact alone that the band had a theme song was unusual for a modern jazz combo. Solis describes the tune as “a cyclical, riff-driven piece, ideally suited to open-ended, vamp-like performances that build energy and can be extended or foreshortened in response to the energy in a room.”
Chapter 7 looks at the recording history of the never-broadcast Voice of America tapes and at the aesthetic context into which it was released in 2005. The release was celebrated by both the jazz and some mass media. Its success, Solis explains, has to be seen in context with the “Young Lions” movement of the 1990s which had revitalized a hardbop approach to jazz and given artists like Monk and Coltrane even more of a canonical status. Solis then focuses on the Blue Note label and its own role in the canonization of certain jazz musicians and asks about how the Carnegie Hall album fit into Blue Note’s catalogue of 2005. Finally he offers an aside about jazz education in the 2000s, the collegiate jazz scene and the university curriculum which jazz had entered by this time and which has “built a particular vision of the canon”.
Gabriel Solis’ book takes a single event, the Carnegie Hall concert by Thelonious Monk with John Coltrane, and uses it to explain what happens in the music itself, how it relates to the musical development of the two protagonists of the concert, how it fits into the context of the jazz aesthetic of the 1950s and how it fits into the context of the time of its release in 2005. The text is heavy on analytical aspects, yet manages to put these into context with the overall questions which the author never leaves out of his and his readers’ attention. It is an excellent addition to the scholarly literature on jazz, looking at details yet explaining so much more.
Wolfram Knauer (April 2014)
Ab Goldap. Rüdiger Carl im Gespräch mit Oliver Augst
Frankfurt/Main 2014 (weissbooks)
224 Seiten (208 Textseiten / 16 Seiten Bildtafel)
beiheftende CD mit 17 Liedern von Rüdiger Carl
30 Euro
ISBN: 978-86337-079-4
(Voraussichtlich im Handel ab 15. Mai 2014)
 Rüdiger Carl ist ein Multiinstrumentalist, der die Szene der frei improvisierten Musik in Deutschland seit den 1960er Jahren mitprägte, zugleich aber immer ein wenig zwischen den Stühlen der Avantgarde zu sitzen schien, die sich seit den frühen 1980er Jahren am liebsten von allen Genrefestschreibungen zu distanzieren versuchte. Nun hat Carl auf Anregung von und im Gespräch mit Oliver Augst eine Erzählbiographie vorgelegt, wie man solche Projekte vielleicht am besten nennen sollte, die in letzter Zeit immer öfter erscheinen und die subjektive Sicht ihrer Protagonisten auf ihre eigene Geschichte und die Welt überall durchscheinen lassen. Carls Erinnerungen sind dabei durchaus exemplarisch für den Versuch einer Generation, in einer wie auch immer zu definierenden Avantgarde auf gesellschaftliche Verhältnisse einerseits zu reagieren, sie andererseits zu spiegeln und künstlerisch zu kommentieren.
Rüdiger Carl ist ein Multiinstrumentalist, der die Szene der frei improvisierten Musik in Deutschland seit den 1960er Jahren mitprägte, zugleich aber immer ein wenig zwischen den Stühlen der Avantgarde zu sitzen schien, die sich seit den frühen 1980er Jahren am liebsten von allen Genrefestschreibungen zu distanzieren versuchte. Nun hat Carl auf Anregung von und im Gespräch mit Oliver Augst eine Erzählbiographie vorgelegt, wie man solche Projekte vielleicht am besten nennen sollte, die in letzter Zeit immer öfter erscheinen und die subjektive Sicht ihrer Protagonisten auf ihre eigene Geschichte und die Welt überall durchscheinen lassen. Carls Erinnerungen sind dabei durchaus exemplarisch für den Versuch einer Generation, in einer wie auch immer zu definierenden Avantgarde auf gesellschaftliche Verhältnisse einerseits zu reagieren, sie andererseits zu spiegeln und künstlerisch zu kommentieren.
Das Gespräch beginnt mit Carls Schulzeit in Kassel, einem Klassenlehrer, der politisches genauso wie menschliches Vorbild war. Nebenbei pflegte er Kontakte zum örtlichen Jazzclub. Zwischendrin Rückblenden in die “Urkindheit”, wie Augst sie nennt, die direkte Nachkriegszeit, Hunger, Armut, die Rückkehr des Vaters aus der Kriegsgefangenschaft, eine Welt, die in Carls nüchterner Erinnerung ein wenig an Arno Schmidts Erzählungen exakt derselben Lebenssituationen erinnert: das Schicksal einer Flüchtlingsfamilie – in Ostpreußen geboren kam Carl auf den Fluchtwirren der Zeit über Wien und andere Stationen nach Kassel –, das Schicksal von Spätheimkehrern, die aller Illusionen beraubt waren. Nach der mittleren Reife machte Carl eine Lehre als Schriftsetzer beim Bärenreiter Verlag, wo er Noten genauso wie Mozartbriefe setzte. Er erinnert sich an eine Jugend in den 1950er Jahren zwischen Literaturgesprächen, Konzertabenden und einer Lehre, die ihn einerseits unterforderte, andererseits jede Menge Inspiration für seine spätere künstlerische Arbeit in ihm weckte. Nach der Ausbildung ging er nach Berlin, bewarb sich an der Staatlichen Hochschule für bildende Künste, die ihn ablehnte, jobbte als Schriftsetzer und machte nebenbei Musik. Sein Akkordeon hatte ihm seine Großmutter bereits in Kassel geschenkt; bald tauschte er es gegen eine Querflöte ein, die er autodidaktisch erlernte. Er berichtet von seinen ersten Jazzerfahrungen in Kassel, Standards und Hardbop, von den seltsamen Verbindungen zwischen Grafikdesign und Jazz in jenen Jahren, vom Umstieg erst aufs Saxophon, dann auf die Klarinette.
“Jazz”. sagt Carl, “das ist ja ein alter Begriff und beschreibt auch ein altes Ding.” Er beklagt die Naivität in dem, was er heute so im Radio als Jazz hört, und er beschreibt, wie sich Europa in den 1960er Jahren freistrampelte von der amerikanischen Tradition, mehr Chaos einbrachte, “vor allem mehr Witz und Strapaze, das war etwas zeitversetzt der europäische Anteil, während die amerikanische 60er Jahre-Avantgarde manchmal fast den Ernst von Religionsgründern hatte”. Für ihn war irgendwann, als der Jazz mehr und mehr von Fusion durchdrängt wurde, die Luft raus. Jenen “grobkörnigen Typ von Musiker”, den er bevorzugt, gäbe es schon lange nicht mehr. An einer Stelle wagt er eine Selbstdefinition: “Als Dilettant war ich ja nun fast alles. Unterhaltungsmusiker und Querulant und Freejazzer und vielleicht sogar konzeptueller Komponist. Vielleicht sogar Minimal-Musiker.” Er habe versucht, keine Genregrenzen abzustecken, sondern offen zu bleiben, das Unerwartete, vielleicht auch das Unerhörte zu wagen. Das Wort “Musizieren” benutzt er oft spricht vom “Arbeiten” an der Musik, vom “Entdecken”, “Ausprobieren. Und was das “Freie” im Free Jazz anbelangt, so findet er, dieses müsse eben auch die Freiheit beinhalten, die Musik zu spielen, die einem just in dem Augenblick gerade so gefalle.
Carl erzählt von Kollegen und Freunden, von Musikern und Bildenden Künstlern, von ästhetischen Diskussionen und seiner heutigen Sicht über sie. Die Gespräche zwischen Augst und Carl wirken dabei selbst wie eine Art Improvisation, chronologisch angelegt aber mit weiten Exkursen: in Erinnerungen, in die Gegenwart, in die Interviewsituation, auch in Belange des Interviewers. Diese Verschobenheit in der Erzählung erlaubt tiefere Einblicke als es eine chronologische Erzählung täte: Carl erzählt aus dem Bauch heraus, und kein Redakteur presst dies in Kapitelüberschriften. Der Leser erfährt die Intensität des Gesprächs, hört quasi selbst mit zu.
Carmell Jones, Alexander von Schlippenbach, Peter Brötzmann, Sven-Åke Johansson, Jost Gebers: Carls Erzählung vermittelt eine lebendige Berliner Szene, schildert daneben auch die Realität des Überlebenmüssens und des Mixes verrückter Figuren. Er hatte Jobs in der Bundesdruckerei und als Bahnwärter, bevor er Anfang der 1970er Jahre nach Wuppertal zog, wo seine Profimusikerkarriere begann. Carl erzählt, wie er zum Akkordeon zurückkehrte, von seiner Zusammenarbeit mit Irène Schweizer, über das Globe Unity Orchestra, die Probleme des Frei-Spielens, über Pina Bausch, Joseph Beuys, Hans Reichel, der Faszination Thelonious Monks, über die Gefahr und die Chancen musikalischer Klischees und über die künstlerische Grundhaltung von “Verweigerung”. Er unternahm Tourneen durch die DDR, spielte beim legendären Festival in Peitz, trat mit dem Bergisch-Brandenburgischen Quartett mit Ernst Ludwig Petrowsky auf, erhielt Ost-Gagen, die man möglichst in Naturalien umtauschen musste, um einen brauchbaren Gegenwert zu erhalten.
Anfang der 1980er Jahre zog er nach Frankfurt, in eine damals äußerst lebendige und genreübergreifende Avantgardeszene. Er organisierte Konzerte im Porticus, wirkte in der FIM mit (Forum improvisierender Musiker), berichtet daneben auch über seine Kontakte (aber auch über die Nicht-Kontakte) zur örtlichen Jazzszene. Das berühmte Forsythe-Ballett habe ihm nie imponiert, der habe ja sicher auch nie einen Ton von ihm gehört; das Ensemble Modern sei brav, ordentlich, sauber, man müsse das aber nicht dauernd hören. Solche Passagen fallen zurück in den von den Weltläuften enttäuschten Anfangsduktus, der diesen Rezensenten die Lektüre dieses Buchs etwas skeptisch beginnen ließ. Da erwartet man dann Gegenwartspessimismus, romantisches wenn auch selbstkritisches Zurückerinnern an schwere Zeiten, die doch so viel inspirierter gewesen seien. Daneben aber swingt im Gespräch bald, ganz schnell eigentlich, noch etwas anderes dabei mit: eine nicht minder romantische Hoffnung darauf, nein ein Wissen darum, dass künstlerische Inspiration zu jeder Zeit möglich ist, dass gesellschaftliche Verhältnisse (auch Kunst-Verhältnisse) immer in Frage gestellt werden müssen, dass man seine Sache ernst nehmen muss, sich selbst aber nie zu ernst nehmen darf. Nach wenigen Seiten ist man gefangen vom lockeren Plaudern der beiden Freunde, die auf gemeinsame Bekannte rekurrieren, sich aufs Abendessen freuen oder aufs nächste Treffen.
Persönliche Fotos sowie ein Namensindex der im Text genannten Personen runden das Buch ab. Bastian Zimmermann lässt sich von der Lektüre zu einer zusammenfassenden Würdigung hinreißen (Nachwort); und Astrid Ihle beschreibt in ihrem Vorwort die Entstehungsgeschichte des Buchs, das mit einer CD kommt, die einen Liederzyklus mit 17 autobiographisch geprägten Stücken enthält, “komponiert, getextet, gesungen und am Klavier begleitet von Carl himself”. All das macht “Ab Goldap” zu einer überaus lesenswerten, mehr als runden Würdigung des Multiinstrumentalisten und – irgendwie – Avantgardephilosophen Rüdiger Carl.
Goldap, dies sei zum Schluss noch erläutert, ist der Ort in Ostpreußen, aus dem seine Familie kam, Ab Goldap also, über Kassel, Berlin bis Frankfurt…
Wolfram Knauer (Mai 2014)
Black Fire! New Spirits! Images of a Revolution. Radical Jazz in the USA 1960-75
herausgegeben von Stuart Baker
London 2014 (Soul Jazz Records)
189 Seiten, 30 Britische Pfund
ISBN: 978-09572600-1-6
 Black Music, Black Power: Die schwarze Musik begleitete die Bürgerrechtsbewegung in den USA als ein kongenialer Soundtrack. Vielleicht waren die Soulmusiker näher dran an der Bewegung, aus deren Reihen James Brown seine Hymne “Say It Loud: I’m Black and I’m Proud” einbrachte. Der Avantgardejazz der 1960er und 1970er Jahre aber hatte engste Berührungspunkte zur Bewegung, zu den friedlichen Protesten genauso wie zu den radikalen Wortführern ihrer Zeit, und die Musik vieler Free-Jazz-Musiker wurde nicht nur im Nachhinein als eine Reaktion auf die gesellschaftlichen Verhältnisse gelesen, als eine Rebellion gegen die Vorherrschaft weißer Wertesysteme. Etliche Künstler, die dem New Thing verbunden waren, betonten damals, ihre Musik sei eigentlich apolitisch, wann immer sie als schwarze Musiker aber in den amerikanischen Südstaaten spielten, wurden sie mit der politischen Realität des alltäglichen Rassismus konfrontiert, aus dem heraus ihre Musik genauso viel an Kraft und Widerstandspotential zog wie aus der langen und stolzen Tradition afro-amerikanischer Kultur.
Black Music, Black Power: Die schwarze Musik begleitete die Bürgerrechtsbewegung in den USA als ein kongenialer Soundtrack. Vielleicht waren die Soulmusiker näher dran an der Bewegung, aus deren Reihen James Brown seine Hymne “Say It Loud: I’m Black and I’m Proud” einbrachte. Der Avantgardejazz der 1960er und 1970er Jahre aber hatte engste Berührungspunkte zur Bewegung, zu den friedlichen Protesten genauso wie zu den radikalen Wortführern ihrer Zeit, und die Musik vieler Free-Jazz-Musiker wurde nicht nur im Nachhinein als eine Reaktion auf die gesellschaftlichen Verhältnisse gelesen, als eine Rebellion gegen die Vorherrschaft weißer Wertesysteme. Etliche Künstler, die dem New Thing verbunden waren, betonten damals, ihre Musik sei eigentlich apolitisch, wann immer sie als schwarze Musiker aber in den amerikanischen Südstaaten spielten, wurden sie mit der politischen Realität des alltäglichen Rassismus konfrontiert, aus dem heraus ihre Musik genauso viel an Kraft und Widerstandspotential zog wie aus der langen und stolzen Tradition afro-amerikanischer Kultur.
Stuart Baker dokumentiert in diesem Coffeetable-Buch die afro-amerikanische Avantgarde der 1960er und frühen 1970er Jahre als eine Musikszene, die im Auftreten, in der Selbstdarstellung, aber auch in Mode und Musik ein schwarzes Selbstbewusstsein vorlebte, das einmal mehr zeigt, dass Musik, egal unter welchen Umständen sie gemacht wird, gesellschaftliche Verhältnisse abbildet und oft genug Wege zu einer besseren Gesellschaft fordert oder gar aufzeigt. Bakers Einleitungstext schildert die Situation: Nachdem das Oberste Gericht in den Vereinigten Staaten die Gleichheit zwischen den Hautfarben noch einmal bekräftigt hatte, begannen schwarze Aktivisten die Umsetzung der Gerichtsurteile in der gesellschaftlichen Realität zu verlangen. Diskussionen jener Jahre drehten sich um Gewalt oder Gewaltlosigkeit, um die Stärkung der eigenen Community auch in ihrem Wissen um Wurzeln und eigene Geschichte, in der Musikergemeinschaft darüber hinaus auch um die Produktions- und Besitzverhältnisse an den von ihnen geschaffenen Werken.
Die von Baker ausgesuchten knapp 170 Fotos zeigen, wie er im Vorwort schreibt, vor allem eines: das unbedingte Selbstbewusstsein der Künstler, eine Selbstbestimmung, die sich deutlich darin äußert, wie sie sich der Kamera präsentieren. Jedem Künstler sind ein bis zwei Seiten gewidmet, aussagekräftige Fotos und ein kurzer biographischer Text. Baker hat darauf verzichtet, in diese kurzen Texte weitere politische Interpretationen zu packen, lässt stattdessen die Bilder für sich sprechen. Herbie Hancock in stolzer Pose vor dem Flügel, Nina Simone kämpferischem in die Kamera blickend, Famoudou Don Moye mit pseudo-afrikanischer Kriegsbemalung, Archie Shepp nachdenklich, Leon Thomas mit afrikanischer Trommel, AACM-Musiker vor einem Plakat des Improvisational Theatre, Jimmy Smith, der mit seinem eigenen Fotoapparat in die Kamera blickt, Tony Williams rauchend und am Arbeitsinstrument wartend, Stanley Cowell und Charles Tolliver in sympathischen Portraitfotos, die offenbar vor demselben Hintergrund und vom selben Fotografen geschossen wurden, Horace Silver vor der Blue-Note-Auslage eines Plattenladens, Cecil Taylor, in sich und in seine Musik vertieft, Thelonious Monk am heimischen, vollgepackten Flügel, George Benson im Cabriolet vor dem Village Vanguard, Pheeroan akLaff auf die Trommelstöcke konzentriert,.
Neben dem Blick, neben den Posen scheint auch die Mode der Zeit kämpferische Untertöne zu besitzen, sei es nun Elvin Jones’ lange Lederweste, Sun Ras außerweltliches Ornat, Gary Bartzs weite Schlaghose, Phil Upchurchs buntestem Bühnenkostüm oder in der Person von Miles Davis, der gleich in verschiedenen Modestilen gezeigt wird.
Mary Lou Williams ist neben Sun Ra die älteste der hier abgebildeten Musiker; weiße Kollegen muss man dagegen buchstäblich mit der Lupe suchen (fündig wurden wir auf Seite 92/93 im Ornette Coleman Quartett, in dem Charlie Haden aber fast vollständig von seinem Kontrabass verdeckt wird). Und so dokumentiert dieses Buch auch die Macht der Bilder, die den Jazz als eine ungemein kraftvolle, eine selbstbewusste (ja, dieses Wort muss noch einmal benutzt werden), als eine rebellierende und nach vorne blickende afro-amerikanische Musik darstellen.
Auf eine Identifizierung der Sidemen verzichtet der Herausgeber, und auch die Foto-Credits verweisen nur recht allgemein auf Getty Images, die Quelle der meisten der benutzten Bilder. Ein aussagekräftiges Buch ist dieser Bildband allemal und macht doppelt Lust aufs Hören der Musik, die ja nicht weniger kraftvoll und selbstbewusst daherkommt.
Wolfram Knauer (Juni 2014)
Jazz in Berlin
von Rainer Bratfisch
Berlin 2014 (Nicolai Verlag)
472 Seiten (im Schuber), 129 Euro
ISBN: 978-3-89479-802-4
 Rainer Bratfischs schwergewichtiges Buch “Jazz in Berlin” enthält weit mehr als jazzmusikalische Lokalgeschichten aus der Hauptstadt. Es ist in der Vernetzung der Berliner Jazzszene mit dem Rest Deutschlands (Ost wie West) eine eigentlich nur räumlich fokussierte Jazzgeschichte Deutschlands geworden, ein Steinbruch vielfältiger Informationen, die ausgewogen von den Anfängen der Jazzrezeption in den 1920er Jahren über die dunklen Kapitel des 3. Reichs, die geteilten Jazzszenen der 1950er bis 1980er Jahre in Ost und West bis in die wiedervereinigte Gegenwart einer der lebendigsten Jazzszenen Europas reicht. Ausführlich und aussagekräftig bebildert werden Musiker, Bands, Spielorte, Festivals beschrieb, die sogenannte Jazzszene(n) also, zwischen Tradition und Avantgarde, einschließlich ihres unterschiedlichen Publikums. Eine Geschichte des Jazz in Berlin ist dabei zwangsläufig auch eine Geschichte von Musik als Widerständigkeit, von Jazz als einer von Nazis und Stasi misstrauisch beäugten oder gar verbotenen Kunst, sowie eine Geschichte der Wege, Orte und Möglichkeiten, die seine Anhänger immer wieder fanden, die Musik trotzdem zu hören oder zu spielen.
Rainer Bratfischs schwergewichtiges Buch “Jazz in Berlin” enthält weit mehr als jazzmusikalische Lokalgeschichten aus der Hauptstadt. Es ist in der Vernetzung der Berliner Jazzszene mit dem Rest Deutschlands (Ost wie West) eine eigentlich nur räumlich fokussierte Jazzgeschichte Deutschlands geworden, ein Steinbruch vielfältiger Informationen, die ausgewogen von den Anfängen der Jazzrezeption in den 1920er Jahren über die dunklen Kapitel des 3. Reichs, die geteilten Jazzszenen der 1950er bis 1980er Jahre in Ost und West bis in die wiedervereinigte Gegenwart einer der lebendigsten Jazzszenen Europas reicht. Ausführlich und aussagekräftig bebildert werden Musiker, Bands, Spielorte, Festivals beschrieb, die sogenannte Jazzszene(n) also, zwischen Tradition und Avantgarde, einschließlich ihres unterschiedlichen Publikums. Eine Geschichte des Jazz in Berlin ist dabei zwangsläufig auch eine Geschichte von Musik als Widerständigkeit, von Jazz als einer von Nazis und Stasi misstrauisch beäugten oder gar verbotenen Kunst, sowie eine Geschichte der Wege, Orte und Möglichkeiten, die seine Anhänger immer wieder fanden, die Musik trotzdem zu hören oder zu spielen.
Bratfisch hatte 2005 den Band “Freie Szene. Die Jazzszene in der DDR” herausgegeben, der eine umfängliche Dokumentation der ostdeutschen Jazzgeschichte darstellt. In seinem Berlin-Buch hat er sich für kleine, thematisch fokussierte Kapitel entschieden, die einzelne Künstler oder Bands behandeln (Weintraub Syncopators, Charlie and his Orchestra, Zentralquartett, Coco Schumann), die Clubszene näher beleuchten, über den Jazz im Rundfunk berichten, über Initiativen, Festivals, Konzertreihen, über Jazzförderung oder über die Möglichkeit, Jazz zu studieren. Insbesondere im historischen Teil seines Buchs gelingen ihm dabei Schlaglichter auf eine Welt zwischen Faszination an der immer noch exotischen Musik des Jazz und Professionalisierung einer mehr und mehr selbstbewussten deutschen Jazzszene. Die Darstellung der aktuellen Szene versucht möglichst vollständig alle Aktivitäten zu erwähnen und dabei die Vielfältigkeit des Berliner Jazz zu berücksichtigen, der eben aus weit mehr als traditionellen und modernen Stilrichtungen besteht, über den Tellerrand blickt und mit Einflüssen aus anderen Genres experimentiert, so dass die Grenzen schon mal verschwimmen. Er reicht dabei tatsächlich bis kurz vor Drucklegung – die aktuellsten Informationen, die er verarbeitet, stammen vom Herbst 2013.
Bratfisch ist Journalist, seine Erzählung daher vor allem eine von Menschen und ihren Aktivitäten. In die Musik selbst steigt er kaum ein, hier verlässt er sich auf das Vorwissen seiner Leser über Stile, klangliche Klischees und alle mit ihnen verbundenen Befindsamkeiten. “Jazz in Berlin” ist in seiner Konzeption ein gelungenes Buch zum Blättern, zum Nachlesen, zur Referenz über Entwicklungen des deutschen (also nicht nur Berliner) Jazz. Der Anhang enthält biographische Notizen zu 85 wichtigen Musikerinnen und Musikern, quer durch alle geschichtlichen und stilistischen Epochen des Hauptstadtjazz. Der Preis des Buchs ist sicher erheblich, die Aufmachung jedoch, sorgfältig gebundenes Hardcover im Pappschuber, und die vielen Fotodokumente machen es zu einem wichtigen Dokument zur gesamtdeutschen Jazzgeschichte.
Wolfram Knauer (März 2014)
Charlie Parker
von Wolfram Knauer
Stuttgart 2014 (Reclam)
203 Seiten, 12,95 Euro
ISBN: 978-3-15-020342-2
Als die Nachricht vom Tod Charlie Parkers am 15. März 1955 die Runde machte, war die Betroffenheit groß. Charles Mingus fasste die Lücke vielleicht am besten zusammen, die der Altsaxophonist auf der Jazzszene hinterließ: “Die meisten der Solisten im Birdland mussten immer auf Parkers nächste Platte warten, um herauszufinden, was sie als nächstes spielen sollten. Was werden die wohl jetzt tun?”
Charlie Parker ist eine der prägenden Persönlichkeiten der Musik des 20sten Jahrhunderts. Er tauchte just zu dem Zeitpunkt auf, als der Jazz sich von einer reinen Unterhaltungsmusik hin zu einer Kunstform entwickelte, die neben gesellschaftlichem Vergnügen eine ästhetische Aussage in den Vordergrund stellte. Parker war ein instrumentaler Virtuose auf seinem Instrument, dem Altsaxophon; er war darüber hinaus ein musikalischer Innovator, dessen Neuerungen auf der Tradition basierten. Man hat ihn als Revolutionär des Jazz bezeichnet, und man hat ihn den größten Bluesmusiker dieser Musik genannt, ihn also mit der Avantgarde genauso wie mit der Tradition afro-amerikanischer Musik in Verbindung gebracht.
Parkers Musik hat den Jazz beeinflusst wie vor ihm nur die von Louis Armstrong, wie nach ihm die von John Coltrane und Miles Davis. Viele seiner musikalischen Phrasen wurden von so vielen Musikern aller Instrumentengattungen nachgespielt, dass sie quasi ins Standard-Improvisationsvokabular des Jazz übergingen. Aber Parker war noch mehr als ein großartiger Musiker. Er lebte ein Leben, das Dichtern und Philosophen als das Musterbeispiel des Künstlers erschien, weil es neben der künstlerischen Perfektion auch das Chaos und Scheitern beinhaltete. Musik, Alkohol, Drogen – Parker wurde zum Synonym für das bewunderte musikalische Genie, dem es nicht gelang, sein Privatleben in Ordnung zu bringen. Und sein früher Tod mit gerade mal 34 Jahren sorgte mit dafür, dass seine Legende weiterlebt bis in unsere Tage.
Parkers Musik ist in bald 1.000 Aufnahmen dokumentiert, in Studiositzungen für die Labels Dial, Savoy und Verve sowie in Livemitschnitten aus diversen Clubs in New York, Los Angeles und anderswo. Seine Musik ist seine Hinterlassenschaft, zugleich aber auch klingende Gegenwart, denn sein Einfluss im Jazz dauert, direkt oder über inzwischen mehrere Generationen gebrochen, bis heute an.
Die Literatur zu Parker ist auch ohne dieses Büchlein riesig. Der Saxophonist, sein Leben und seine Musik diente als Vorbild für Kurzgeschichten, Romane, Gedichte, Gemälde, Skulpturen, und er wurde in Clint Eastwoods Bird selbst zur Filmfigur. Kurz nach seinem Tod tauchten erste Graffiti an New Yorker Hauswänden auf, die behaupteten: “Bird Lives!” Wie kann ein Mann tot sein, dessen Musik so viel an Kreativität inspiriert hat und in Werken so vieler anderer Künstler – aller Kunstgattungen – weiterlebt? Was aber machte ihn zu einem so bewunderten Künstler? Was trieb ihn an und was hinderte ihn, neben der Musik auch sein Leben in den Griff zu kriegen? Oder: Was war, was blieb? Die Grundfrage jeder Lebenserzählung…
Wolfram Knauer (Februar 2014)[:en]The Sound of a City? New York und Bebop 1941-1949
von Jan Bäumer
Münster 2014 (Waxmann)
384 Seiten, 39,90 Euro
ISBN: 978-3-8309-2963-5
 Der Jazz war von Anbeginn an eine Musik der Stadt. Zentren wie New Orleans, Chicago, Kansas City, vor allem aber New York prägten seine Entwicklung; zugleich prägte aber auch der Jazz die Erfahrung solcher Städte. Jan Bäumer hat für seine Dissertation ein Musterbeispiel dieser Wechselwirkung herausgegriffen und untersucht, wie der Bebop gerade in New York entstehen konnte, wie er zugleich in den 1940er Jahren (und darüber hinaus) das kulturelle Erlebnis dieser Stadt maßgeblich prägte.
Der Jazz war von Anbeginn an eine Musik der Stadt. Zentren wie New Orleans, Chicago, Kansas City, vor allem aber New York prägten seine Entwicklung; zugleich prägte aber auch der Jazz die Erfahrung solcher Städte. Jan Bäumer hat für seine Dissertation ein Musterbeispiel dieser Wechselwirkung herausgegriffen und untersucht, wie der Bebop gerade in New York entstehen konnte, wie er zugleich in den 1940er Jahren (und darüber hinaus) das kulturelle Erlebnis dieser Stadt maßgeblich prägte.
Im Vorwort erklärt Bäumer die Komplexität des Forschungsgegenstands, da man Jazz nicht nur als musikalische, sondern auch als kulturelle und soziale Praxis begreifen müsse und es daher die Aufgabe seines musikgeographischen Ansatzes sei, diese verschiedenen Sichtweisen herauszuarbeiten und miteinander zu verknüpfen. Er thematisiert die zur Verfügung stehenden Quellen, mündliche Zeitzeugenberichte, Musikaufnahmen und zeitgenössische Presseberichte. Dann beschreibt er die Vorbedingungen für die Entstehung des Bebop, wobei er bereits hier die Funktion von Ort als geographische, soziale und damit auch ästhetische Dimension diskutiert. Er unterscheidet zwischen “hearth” und “stages”, also weitgehend isolierten bzw. privaten Experimentier- und öffentlichen Aufführungsräumen, und erklärt die Attraktivität einer so diversen Metropole wie New York für Musiker ganz allgemein. New York war Anfang der 1940er Jahre bereits Medienhauptstadt, besaß in Harlem eine kreative afro-amerikanische Community, zugleich ein großes Netz von Veranstaltungsorten, war außerdem im 20sten Jahrhundert im wahrsten Sinne des Wortes die “Stadt, die niemals schläft”.
Im nächsten Kapitel legt Bäumer die Lupe an seinen Untersuchungsgegenstand. Er beschreibt die “hearths”, die Experimentierorte für Jazz, beleuchtet beispielsweise die Gemeinde um Minton’s Playhouse, fragt nach der Funktion dieses Clubs für die Bebop-Musiker und beschreibt die in Aufnahmen dokumentierte Musik dieser Zeit, rhythmische, harmonische und improvisatorische Neuerungen, die sich aus ihnen ablesen lassen. Dieselbe Abfolge an Fragen und Beschreibungen lässt er Monroe’s Uptown House angedeihen, aber auch anderen Experimentierorten wie der privaten Wohnung oder der Bigband.
Im dritten Kapitel beschreibt Bäumer die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Entwicklung des Jazz. Er nennt die Transportbeschränkungen, die Tourneen immer schwieriger machten, die Wehrpflicht, die den Bigbands ihre besten Musiker entriss, schreibt über die Auswirkungen des Kriegs auf die Wahrnehmung des amerikanischen Alltagsrassismus und nennt New York in diesem Zusammenhang einen “Karrierehelfer” für viele der Musiker.
Die öffentlichen Bühnen unterscheiden sich von den “hearths” durch ihre Sichtbarkeit auf dem Markt des Unterhaltungsgeschäfts. Bäumer blickt auf die 52nd Street, auf der vor allem kleine Ensembles zu hören waren, beschreibt die ersten organisierten Jam Sessions, die nicht so sehr als Experimentierplattform fungierten, sondern als besonderes Erlebnis fürs Publikum, schaut etwas näher auf den Onyx Club, in dem 1943 mit Dizzy Gillespies und Oscar Pettifords Band die “erste Bebop-Gruppe” auftrat und nimmt sich dann analytisch dem Repertoire und der Spielweise des Bebop an. Ein neues Selbstverständnis hätten sie alle entwickelt, schreibt er, quasi ein neues Kapitel des Jazz aufgeschlagen. Er nennt die Billy Eckstine Band “stage” und “hearth” in einem und fragt danach, wie schnell sich der “neue Sound” des Bebop in New York ausbreitete. Als besonders wichtigen öffentlichen Raum identifiziert er den Schallplattenmarkt, beschreibt den Aufnahmebann von 1942 bis 1944, erklärt, warum es Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre zur Gründung unabhängiger Plattenlabels kam und wie wichtig diese gerade für die Entwicklung des Bebop waren. Er vollzieht nach, wie Charlie Parker und Dizzy Gillespie im Three Deuces auftraten, das Konzerte in der New Yorker Town Hall den Schritt in den Konzertsaal bedeuteten und damit auch Symbol eines gesellschaftlichen Aufstiegs darstellten.
Kapitel 5 widmet sich den “musikalischen Konturen des Bebop”. Er beschreibt das Repertoire des Stils, formale Usancen, die Verwendung von originalen Kompositionen oder Kontrafakten, die Bedeutung des Blues für den Stil; er erklärt die Funktion knapper Arrangements, melodische Besonderheiten, Phrasierung und Virtuosität, fixiert sich auf die Aufgabe der einzelnen Instrumente in der Rhythmusgruppe und die Interaktion aller, und er beschreibt die harmonischen Neuerungen der Zeit.
Im sechsten Kapitel widmet Bäumer sich den “außermusikalischen Konturen” dieser Musik, fragt, ob die Bebopper sich denn tatsächlich als “Außenseiter” verstanden, verweist auf Mode, Sprache, die zur Identität des modernen Jazzmusikers beitrugen, aber auch auf den in der Szene nicht unüblichen Drogenkonsum. Er verweist kurz darauf, dass auch außerhalb New Yorks kreative Musik stattfand, diskutiert die Ausflüge New Yorker Musiker an die Westküste und was sie dort (musikalisch) vorfanden. Die Auftritte Charlie Parkers und Dizzy Gillespies in der Carnegie Hall mögen ein Karrierehöhepunkt für beide gewesen sein; parallel begann bereits der Niedergang der 52nd Street. Ab 1950 hielt eigentlich nur noch das Birdland die Fahne des Bebop hoch.
Zum Schluss geht Bäumer auf die Rezeption des Stils ein, diskutiert die Kontroversen zwischen Traditionalisten und Modernisten, untersucht die mediale Darstellung des Bebop, und fragt danach, inwieweit der Stil eher ein Minderheitenpublikum angesprochen hat bzw. wie er vom Massenpublikum wahrgenommen wurde. Tatsächlich habe sich in diesen Jahren eine Art neues Publikum herausgebildet, argumentiert er, und dieser “Insider”-Kreis sei der Urtyp des Jazzpublikums bis heute.
Jan Bäumers Studie ist gerade in der Verflechtung der verschiedenen Stränge, die in seinem Blickfeld liegen, bemerkenswert. Städtischer Raum und die Möglichkeiten die sich in ihm ergeben, Community als Initiator und zugleich Abnehmer künstlerischer Projekte, die Beschreibung der geografischen, sozialen und ästhetischen Diskurse, innerhalb derer diese Musik sich entwickeln konnte, all das bündelt er mit vielen Verweisen auf Primär- und Sekundärliteratur sowie analytischen Anmerkungen zur Besonderheit des Bebop. Ihm gelingt es dabei die Komplexität seines Themas ein wenig zu ordnen, den Fokus seiner Leser auf immer wieder andere Perspektiven zu lenken und damit die Entstehung und die Bedeutung dieses Stils in der und für die Jazzgeschichte ein wenig zu entmythologisieren.
Bäumers Buch ist eine musikwissenschaftliche Dissertation, aber auch für den musikalisch interessierten Laien gut zu lesen. Er verliert die verschiedenen Argumentationsstränge, die er über die Kapitel entwickelt, nicht aus den Augen und ermöglicht seinen Lesern an jeder Stelle mit frischem Blick auf die Musik und ihren Kontext zu blicken. “The Sound of a City?” beschreibt dabei am Ende tatsächlich den Sound einer Stadt und macht zugleich klar, dass “Sound” nie nur ein klangliches Phänomen ist, sondern immer aus dem Zusammenleben und Wirken von Menschen entsteht.
Wolfram Knauer (Juli 2018)
Jazz im Film. Beiträge zu Geschichte und Theorie eines intermedialen Phänomens
herausgegeben von Willem Strank & Claus Tieber
Münster 2014 (Lit Verlag)
246 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-643-50614-6
 Die Herausgeber dieses Bandes und Mitorganisatoren des Symposiums haben aus Referaten, die bei der Jahrestagung der Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung im Oktober 2011 gehalten wurden sowie weiterführenden Artikeln von Autoren, die in Kiel nicht dabei sein konnten, eine facettenreiche Dokumentation über die Funktion von Jazz im Film auf der einen Seite und seine Repräsentation auf der anderen Seite vorgelegt. In ihrer Einleitung verweisen sie auf die verschiedenen Situationen, in denen Jazz mit der Leinwand in Verbindung tritt, auf die Stummfilmbegleitung etwa, auf Musik-Kurz- und Animationsfilme, auf die Verbindung von Jazz und Experimentalfilmen, auf Dokumentar- und Konzertfilme, auf den Jazz im Live-Fernsehen, auf Jazz als Soundtrack, sowie auf Biopics und auf “Scenopics”, die die Jazzwelt als Thema nimmt.
Die Herausgeber dieses Bandes und Mitorganisatoren des Symposiums haben aus Referaten, die bei der Jahrestagung der Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung im Oktober 2011 gehalten wurden sowie weiterführenden Artikeln von Autoren, die in Kiel nicht dabei sein konnten, eine facettenreiche Dokumentation über die Funktion von Jazz im Film auf der einen Seite und seine Repräsentation auf der anderen Seite vorgelegt. In ihrer Einleitung verweisen sie auf die verschiedenen Situationen, in denen Jazz mit der Leinwand in Verbindung tritt, auf die Stummfilmbegleitung etwa, auf Musik-Kurz- und Animationsfilme, auf die Verbindung von Jazz und Experimentalfilmen, auf Dokumentar- und Konzertfilme, auf den Jazz im Live-Fernsehen, auf Jazz als Soundtrack, sowie auf Biopics und auf “Scenopics”, die die Jazzwelt als Thema nimmt.
Claus Tieber diskutiert das Phänomen der Improvisation in Jazz und Film und inwieweit sich diese aufeinander beziehen können. Andrea Oberheiden-Brent beleuchtet Al Jolsons Blackface-Maske in “The Jazz Singer” und anderen Filmen, die sie nicht allen als Bezug auf Black Minstrelsy sieht, sondern darin auch den Versuch erkennt jüdische Identität aufrecht zu erhalten. Lena Christolova untersucht, wie man rassistische Klischees, die sich in den Jazz-Cartoons mit Betty Boop finden, anders lesen könne, nämlich, wie sie schreibt, als ein Argument im Diskurs der Zeit, das “das Problem ethnischer Stereotypen längst spielerisch gelöst” habe.
Moritz Panning betrachtet den deutschen Revuefilm “Kora Terry” von 1940 und ordnet die Filmmusik Peter Kreuders in die ästhetische Diskussion des Nationalsozialismus über Jazz und eine vom System normierte deutsche Unterhaltungsmusik ein. Wolfgang Thiel sieht Spielfilme der DEFA aus den 1950er bis 1970er Jahren mit dem spezifischen Fokus auf Jazzszenen sowie die Verwendung von Jazzelementen in der Filmmusik an, beschreibt dabei auch, wie in den 1970ern die Beat- bzw. Rockmusik die Funktion des Jazz übernahm, eine “gewünschte optimistische Grundhaltung im sozialistischen Alltag zu ‘benennen’ und hierbei insbesondere das Lebensgefühl der Jugend anzusprechen”.
Hanna Walsdorf diskutiert Otto Premingers “Bonjour Tristesse” von 1957 mit einem speziellen Fokus auf mit Jazz eng verbundene Tanzszenen. Irene Kletschke beschreibt die Haltung etlicher Hollywood-Biopics am Beispiel der “Glenn Miller Story”. Max Annas diskutiert die Modellhaftigkeit des afro-amerikanischen Jazz für die südafrikanische Freiheitsbewegung, aber auch die Rolle, die dieser Musik etwa in Lionel Rogosins Film “Come Back, Africa” von 1959 oder im amerikanisch-südafrikanisch-deutschen Dokumentarfilm “Drum” von 1994 zukommt, in dem der Jazz mehr als “Soundtrack und Quelle bunter Bilder” verwandt, seine Funktion innerhalb der Freiheitsbewegung aber wenig Rechnung getragen werde. Andreas Münzmay beleuchtet die Interaktion zwischen Musik, Handlung und filmischer Dramaturgie in John Cassavetes’ “Shadows” von 1959, beschreibt, wie der Regisseur Musik als “‘musikalische’ Bild- oder Sprachmotive einsetzte”, und diskutiert improvisatorische Momente des Soundtracks, für den Cassavetes, bevor er Charles Mingus engagierte, eigentlich Miles Davis im Blick gehabt hatte.
Frank-Dietrich Neidel versucht Ähnlichkeiten in der Entwicklung des Bebop und Luc Godards Film “À bout de souffle” von 1959 aufzuzeigen, verweist dabei etwa auf dem “Sprung aus der Tradition und die ästhetischen Konsequenzen”, auf eine neue Rhythmik sowie auf Themen wie melodische Kompexität oder Nachvollziehbarkeit. Konstantin Jahn untersucht den legendären Sun Ra-Film “Space Is the Place” von 1974 auf das Spiel mit den Film-Genres (Biopic, Blaxploitation, Science Fiction), aber auch auf musikalischen Momente (Call and Response, Riff, Inside-Outside etc.), die direkten Einfluss auf die filmische Umsetzung hatten. Willem Strank betrachtet die Filme “Ornette: Made in America” von 1985, “Cecil Taylor – All the Notes” von 2004 sowie “Brötzmann” von 2011 und diskutiert zu welchen filmischen Umsetzungen die freie Improvisation der Protagonisten die jeweiligen Regisseure veranlasst hat.
Guido Heldt sieht “Step Across the Border” als einen Dokumentarfilm über Fred Frith, zugleich aber auch als einen Film “durch” Fred Frith, “der sich seine Strukturen und Muster (…) ausleiht und versucht, seinem Gegenstand nicht in der Draufsicht, sondern im Nachvollzug nahe zu kommen”. Sarah Greifenstein sieht Parallelen in den “episodischen Bewegungsmustern” in Woody Allens “You Will Meet a Tall Dark Stranger” und diskutiert die “Erfahrungsformen des Improvisierten” in der Musik und den Gesten des Films. Claudia Relota schließlich betrachtet die amerikanischen Fernsehserie “Treme” im Nachklang des Hurrikans Katrina und fragt dabei, inwieweit die Serie dem Anspruch “einer möglichst detaillierten und spezifischen Repräsentation der Musikkultur – dem Konzept des Authentischen in ‘Treme’ – im Format des Seriellen” gerecht wird, wie die Musik als “soziale Praxis zwischen musikalischen Traditionen” dargestellt wird und zugleich für eine “ungewöhnliche erzählerische Dichte” sorgt.
Als Tagungsband ist “Jazz im Film” sicher kein Einstiegsbuch über die unterschiedlichen Beziehungen zwischen den beiden vielleicht bedeutsamsten künstlerischen Entwicklungen des 20sten Jahrhunderts. Das Buch bietet aber gerade in der Verschiedenheit der Ansätze einen hervorragenden Einblick in die unterschiedlichen Facetten des Diskurses über Jazz im Film – ob als Soundtrack oder als Thema.
Wolfram Knauer (Dezember 2017)
Jackie McLean
von Guillaume Belhomme
Nantes 2014 (Lenka Lente)
117 Seiten, 11 Euro
ISBN: 978-2-9545845-4-6
 Jackie McLean war irgendwie zeitlebens ein “musicians’ musician”, ein Musiker, der unter Kollegen bekannt, beliebt und einflussreich war und doch außer einem Kennerpublikum eher mäßigen populären Erfolg hatte. In seiner Biographie spürt Guillaume Belhomme dem Leben und Schaffen des Saxophonisten nach, identifiziert Einflüsse auf ihn und erklärt die Bedeutung seines musikalischen Schaffens. Wie Sonny Rollins spielte McLean Ende der 1940er Jahre kurzzeitig mit dem Gedanken, vom Altsaxophon, das durch Charlie Parkers Wirken doch sehr vorbelastet war, auf ein anderes Instrument umzusteigen, und tatsächlich machte er, wie wir lernen, seine erste Aufnahme 1949 mit einer Rhythm-and-Blues-Band auf dem Baritonsaxophon.
Jackie McLean war irgendwie zeitlebens ein “musicians’ musician”, ein Musiker, der unter Kollegen bekannt, beliebt und einflussreich war und doch außer einem Kennerpublikum eher mäßigen populären Erfolg hatte. In seiner Biographie spürt Guillaume Belhomme dem Leben und Schaffen des Saxophonisten nach, identifiziert Einflüsse auf ihn und erklärt die Bedeutung seines musikalischen Schaffens. Wie Sonny Rollins spielte McLean Ende der 1940er Jahre kurzzeitig mit dem Gedanken, vom Altsaxophon, das durch Charlie Parkers Wirken doch sehr vorbelastet war, auf ein anderes Instrument umzusteigen, und tatsächlich machte er, wie wir lernen, seine erste Aufnahme 1949 mit einer Rhythm-and-Blues-Band auf dem Baritonsaxophon.
Belhomme erzählt von der Szene, in der McLean in jenen Jahren verkehrte, von McLeans Freundschaft zu den Brüdern Richie und Bud Powell, von der beängstigenden Präsenz Charlie Parkers und von der Tatsache, dass nicht nur McLean selbst sich laufend mit Bird vergleichen musste, sondern dass das auch die Kollegen um ihn herum taten. Er verfolgt Aufnahmen des Saxophonisten mit Miles Davis ab 1951, und er beleuchtet McLeans ersten Platten unter eigenem Namen seit 1955. 1959 wirkte McLean an der Theaterproduktion “The Connection” mit, für die Freddie Redd die Musik geschrieben hatte; daneben spielte er mit etlichen Größen des New Yorker Hardbop. Ab den Mitt-1960er Jahren engagierte er sich zudem in den ersten Bemühungen einer auf die breitere Bevölkerung gerichteten Jazzpädagogik, wirkte des weiteren auch bei politischen Aktivitäten der Bürgerrechtsbewegung mit. Er tat sich mit dem Trompeter Lee Morgan zusammen, hatte daneben aber auch ein Ohr für die freieren Spielformen der Zeit, wie er etwa im Album “New and Old Gospel” bewies, das er 1967 zusammen mit Ornette Coleman (an der Trompete) aufnahm. Er unterrichtete an der Hartford University und war in den 1970er Jahre immer wieder in Europa zu hören.
Belhommes Buch gibt in kurzen Kapitel die Fakten, nennt die Namen und Titel und ordnet McLeans Lebensstationen in die Entwicklungen der Zeit ein. Die Gründe, die für McLeans Engagement in der Jazzpädagogik eine Rolle spielten, werden höchstens gestreift und seine Heroinabhängigkeit gerade mal am Rande erwähnt. Nun mag man meinen, dass solche Aspekte nebensächlich seien, wo es doch in der Hauptsache um die Musik gehe, allerdings kommt Belhomme der Musik selbst auch nur selten wirklich nah. Und so bleibt sein Büchlein ein wenig an der Oberfläche. Für Liebhaber von McLeans Musik ist es allemal ein handliches Nachschlagewerk, dass es ermöglicht, die verschiedenen Alben des Saxophonisten einzuordnen – mehr aber auch nicht.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
An Unholy Row. Jazz in Britain and its Audience, 1945-1960
von Dave Gelly
Sheffield 2014 (equinox)
167 Seiten, 25 Britische Pfund
ISBN: 978-1-84563-712-8
 Dave Gelly ist Autor von Biographien etwa über Stan Getz und Lester Young, schreibt für britische Fachzeitschriften und Tageszeitungen und moderierte eine wöchentliche Rundfunksendung im BBC. Der Untertitel seines neuestes Buchs liest sich, als handele es sich dabei um eine soziologische Studie über “den Jazz in Großbritannien und sein Publikum” in der Nachkriegszeit. Tatsächlich besteht das Publikum, das Gelly meint, zu einem großen Teil auch aus britischen Musikern. Gelly berichtet von den unterschiedlichen Weisen, auf die diese mit dem Jazz in Berührung kamen, in Clubs und bei Tanzveranstaltungen, im Rundfunk, in der Armee, in halb-öffentlichen Expertenzirkeln oder bei Tourneen der amerikanischen Heroen, für die London allein der mangelnden Sprachbarriere wegen immer einer der ersten und wichtigsten Anlaufpunkte war.
Dave Gelly ist Autor von Biographien etwa über Stan Getz und Lester Young, schreibt für britische Fachzeitschriften und Tageszeitungen und moderierte eine wöchentliche Rundfunksendung im BBC. Der Untertitel seines neuestes Buchs liest sich, als handele es sich dabei um eine soziologische Studie über “den Jazz in Großbritannien und sein Publikum” in der Nachkriegszeit. Tatsächlich besteht das Publikum, das Gelly meint, zu einem großen Teil auch aus britischen Musikern. Gelly berichtet von den unterschiedlichen Weisen, auf die diese mit dem Jazz in Berührung kamen, in Clubs und bei Tanzveranstaltungen, im Rundfunk, in der Armee, in halb-öffentlichen Expertenzirkeln oder bei Tourneen der amerikanischen Heroen, für die London allein der mangelnden Sprachbarriere wegen immer einer der ersten und wichtigsten Anlaufpunkte war.
Dabei verfolgt Gelly etwa den Weg des jungen Humphrey Lyttelton zum Jazz, berichtet über Widerstände und Hingabe, über den Effekt von Louis Armstrongs Musik auch bei jenen Musikern, die ihn nicht 1931 bei seinen ersten Konzerten in London erlebt hatten, über die Vielfalt an Jazzsendungen im britischen Rundfunk der Nachkriegsjahre und über Repertoire und musikalische Ästhetik der ersten Bands, in denen Lyttelton mitwirkte. Jazz bedeutete damals vor allem Dixieland oder Swing; Bebop spielte in Lytteltons musikalischer Umgebung keine große Rolle.
Einen weiteren Blick wirft Gelly auf George Webb’s Dixielanders und auf Musiker, die unter traditionellem Jazz vor allem eine nicht-kommerzielle Musik verstanden. Gelly beschreibt, wie sich aus der Jazzszene der direkten Nachkriegszeit langsam eine Art Jugendkultur entwickelte, die zugleich die Klassenunterschiede der britischen Gesellschaft konterkarierte wie unterstrich. Viele der Konzerte fanden in Hinterzimmern von Gasthäusern oder Hotels statt, hatten einen Grassroots-Geschmack, den, wie Gelly schreibt, selbst noch die tourenden Jazzveteranen, die England in den 1960er Jahren heimsuchten, recht charmant fanden.
Mit dem Saxophonisten Johnny Dankworth stellt Gelly dieser Szene einen modernen Protagonisten gegenüber und beschreibt die kleine, verschworene Gemeinde von Bebop-Anhängern im Großbritannien der ausklingenden 1940er und 1950er Jahre. Dieser Stil, erklärt Gelly, war im Vergleich zum Jazz-Revival ein später Ankömmling, und der Kontrast zwischen beiden Stilen nicht nur musikalisch, sondern auch sozial. Für das Jazzrevival seien vor allem nicht-musizierende Fans verantwortlich gewesen, für den Bebop dagegen junge, eine musikalische Karriere anstrebende Musiker. Das breite Publikum stand beiden anfangs eher verständnislos gegenüber. Wo der Revival-Jazz in den Hinterzimmern der Pubs erklang, hörte man Bebop, gespielt von Instrumentalisten, die in professionellen Tanzkapellen spielten, meist in speziellen Musikerkneipen im Londoner Westend. Gelly beschreibt die Szene, irgendwo zwischen Konservatorium und Tanzkapellen, in der Dankworth und Ronnie Scott arbeiteten; er nennt Bands wie das Tito Burns Sextet oder das Ray Ellington Quartet, und er beschreibt die Atmosphäre des Club Eleven, der im Dezember 1948 seine Pforten öffnete, zwei Jahre später auf die Carnaby Street umzog, aber nach nur wenigen Monaten und einer Drogenrazzia der Polizei schließen musste.
Daneben kam es Anfang der 1950er Jahre zu einer neuen Form von Jazz-Traditionsaufbereitung im New-Orleans-Purismus. Gelly zeichnet das Wiederaufleben des archaischen New Orleans-Jazz in den Vereinigten Staaten nach, das Musiker wie Bunk Johnson und George Lewis in den Mittelpunkt stellte und fokussiert dann auf Johnsons englischen Jünger, den Kornettisten Ken Colyer, dessen Crane River Jazz Band ein starkes musikalisches wie ästhetisches Statement bot, das weit über den reinen Revival-Jazz hinaus zu hören war. Über kurz oder lang ging Colyer selbst nach New Orleans und beeindruckte etliche der dort lebenden Musikveteranen mit seinem Ton und seinem musikalischen Ansatz. Sein Posaunist Chris Barber gründete 1954 seine erste Band, deren erstes Album “New Orleans Joys” 60.000 Exemplare verkaufte. Wer, fragt Gelly, kaufte diese Platten?, und schlussfolgert, es seien vor allem Schüler gewesen, die sich durch die Musik abgrenzten. Damals sei der Begriff “Trad” geprägt worden, um eine besonders populäre Form des traditionellen Jazz zu bezeichnen. Jazz, fasst Gelly zusammen, sei eine Jugendkultur gewesen, die auf Livemusik gründete.
Der moderne Jazz um Dankworth und Scott wurde im Verlauf der 1950er Jahre populärer und nahm Einflüsse aus Hardbop, Cool Jazz oder afro-kubanischem Jazz auf. Zugleich bildete sich unter den Musikern ein Bewusstsein darüber, dass es vielleicht tatsächlich so etwas wie “britischen Jazz” gäbe, was zu ganz unterschiedlichen Streits darüber führte, wie die verschiedenen Stränge eines solchen nationalen Stils (Trad hier, modern dort) sich entwickeln sollten. Ein Middleground, auf dem sich viele trafen, war der Mainstream, der Elemente aus traditionelleren und moderneren Spielweisen in sich aufnahm und vermittelte.
Die Skiffle-Welle der späten 1950er Jahre bildet den Mittelpunkt eines eigenen Kapitels, in dem Gelly zugleich auf die Faszination britischer Musiker und Fans mit dem authentischen Blues in den Vereinigten Staaten blickt und vorausdeutet, wie all die Diskurse, die er zuvor dargestellt hatte, letzten Endes auch Grundstein für die Ausbildung einer eigenen britischen Art von Popmusik sein sollten. Gelly verfolgt den Niedergang der Bigbands und der konventioneller spielenden Tanzorchester, die ja insbesondere den modernen Musikern finanziellen Halt geboten hatten. Er erwähnt einige der herausragenden Figuren, Tubby Hayes etwa und Joe Harriott, und schildert die Gründung eines neuen Clubs, Ronnie Scott’s in Soho. Die letzten beiden Kapitel blicken auf die Entwicklung des Trad-Booms, der erst durch den Erfolg der Beatles beendet wurde, sowie auf eine moderne Szene, der es gelang eine eigene Stimme auszubilden, eine Stimme, für die Gelly Stan Traceys “Jazz Suite: Under Milk Wood” und Johnny Dankworths “What the Dickens!” als symptomatisch sieht.
Dave Gelly fragt in seinem Buch nach den Gründen für musikalische Moden, und seine Erklärungen kommen aus der Szene selbst. Dem Blick auf den Jazz “und sein Publikum” hätte stellenweise auch die Sicht auf den Rest des Publikums wohlgetan, also auf die Debatten, die nicht allein innerhalb der Szene, sondern darüber hinaus und insbesondere auch über den Jazz abliefen. Und so sehr auch die Eingrenzung seines Themas auf die Dualität zwischen traditionellen und modernen Stilrichtungen in den 1940er und 1950er Jahren verständlich ist, so wäre ein zumindest spekulativer Ausblick ganz hilfreich gewesen, welche Auswirkungen die Diskussionen, die er für die Jazzszene jener Jahre schildert, auf die britische Jazzentwicklung auch nach der von Gelly betrachteten Zeit hatten.
Alldem zum Trotz aber gelingt es Gelly etliche dieser Diskurse sorgfältig herauszuarbeiten und ihre Unterschiede etwa zu ähnlichen Diskursen in den Vereinigten Staaten deutlich zu machen. Vor allem macht die Lektüre einmal mehr deutlich, dass Jazzgeschichtsschreibung nicht einzig die Entwicklung des Experiments verfolgen sollte, sondern dass auch der Blick aufs Bewahrende, auf die Traditionsverbundenheit, auf die Konnotationen archaischer Stilrichtungen wichtig ist.
Wolfram Knauer (August 2016)
Black Popular Music in Britain Since 1945
herausgegeben von Jon Stratton & Nabeel Zuberi
Farnham, Surrey 2014 (Ashgate)
240 Seiten, 65 Britische Pfund
ISBN: 978-1-4094-6913-1
Black British Jazz. Routes, Ownership and Performance
herausgegeben von Jason Toynbee & Catherine Tackley & Mark Doffman
Farnham, Surrey 2014 (Ashgate)
230 Seiten , 65 Britische Pfund
ISBN: 978-1-4724-1756-5
Großbritannien hat die Nase vorn, wenn es um Jazz geht. In London waren es die ersten Jazzkonzerte zu hören, noch vor Paris oder Berlin, hier ließen sich – allein schon wegen der geringeren Sprachbarriere – amerikanische Musiker nieder, auch wenn sie eigentlich durch Europa touren wollten. Armstrong und Ellington waren Anfang der 1930er Jahre live zu erleben, und so ist es kein Wunder, das die britische Jazzszene bereits in den 1930er Jahren zu den avanciertesten Europas gehörte. In den 1940er Jahren entwickelten sich hier eine neue Art von traditionellem Jazz, daneben aber auch Mischformen aus Jazz und Blues wie der Skiffle, die allesamt von Einfluss auf die populäre Musik aus England waren.
Die Jazzszene Großbritanniens wird gern – wie die meisten Jazzszenen Europas – als eine weiße, europäische Jazzszene wahrgenommen, als eine Entwicklung der Re-Akkulturation afro-amerikanischer (also eigentlich afro-euro-amerikanischer) Musik nach Europa. Tatsächlich aber hatte die Kolonialmacht England genügend schwarze Musiker aus ihren (früheren) Kolonien, insbesondere der Karibik, die das kulturelle Leben der Hauptstadt belebten. Die beiden Bücher “Black British Jazz” und “Black Popular Music” widmen sich dieser oft vernachlässigten Seite der britischen Musikgeschichte.
Während “Black British Jazz” die verschiedenen Wege untersucht, auf denen – neben den Tourneen afro-amerikanischer Stars – schwarze Einflüsse in England bemerkbar wurden, die Aneignung einer afro-britischen Identität seit dem Avantgarde-Jazz der späten 1960er Jahre bis hin zu jungen Musikern der Gegenwart wie Soweto Kinch, sowie konkrete Beispiele eines ästhetischen Diskurses im Königreich, ist “Black Popular Music” sehr breiter angelegt, deckt Jazz vor allem im ersten Kapitel der Musikwissenschaftlerin Catherine Tackley ab, um dann populäre Stile wie Ska, “Afro-Trends”, Rock, Soul, Hip-Hop und vieles dazwischen zu untersuchen, immer mit der Frage, wie sich eine schwarze britische Identität in der Musik abbilde und welchen Widerhall die Musik im Publikum hat.
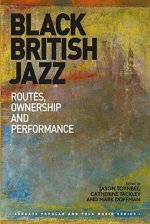 Im Vorwort zu “Black British Jazz” skizzieren die Herausgeber fünf prägende Momente in dieser Geschichte: (1.) die Tournee des Southern Syncopated Orchestra 1919 in England, das dem Land zum ersten Mal das Bewusstsein brachte, dass es da eine aus schwarzer Ästhetik geborene neue Musikrichtung gab; (2.) eine Musikszene um Musiker aus Jamaika und anderen karibischen Ländern, die oft genug ihre Instrumente in den Militärkapellen der Kolonialherren gelernt hatten; (3.) die Bebopszene im London der 1950er Jahre, die deutlich das schwarze Element der Improvisation in den Vordergrund stellte; (4.) die Anwesenheit südafrikanischer Expatriates in den 1960er Jahren, sowie (5.) das Erwachen eines auch politischen afro-britischen Bewusstseins spätestens in den 1980er Jahren.
Im Vorwort zu “Black British Jazz” skizzieren die Herausgeber fünf prägende Momente in dieser Geschichte: (1.) die Tournee des Southern Syncopated Orchestra 1919 in England, das dem Land zum ersten Mal das Bewusstsein brachte, dass es da eine aus schwarzer Ästhetik geborene neue Musikrichtung gab; (2.) eine Musikszene um Musiker aus Jamaika und anderen karibischen Ländern, die oft genug ihre Instrumente in den Militärkapellen der Kolonialherren gelernt hatten; (3.) die Bebopszene im London der 1950er Jahre, die deutlich das schwarze Element der Improvisation in den Vordergrund stellte; (4.) die Anwesenheit südafrikanischer Expatriates in den 1960er Jahren, sowie (5.) das Erwachen eines auch politischen afro-britischen Bewusstseins spätestens in den 1980er Jahren.
Howard Rye skizziert in seinem Kapitel die Akkulturation schwarzer Musik bis 1935, und verweist sowohl aufs Musiktheater (“In Dahomey”), auf Tourneen afro-amerikanischer Musiker und auf die ersten schwarzen britischen Bands. Catherine Tackley widmet sich dem Thema der Migration und fokussiert beispielsweise auf die “Tiger Bay”, ein Viertel in Cardiff, das insbesondere Musiker kolonialer Herkunft anzog. Kenneth Bilby fragt, ob Reggae und karibische Musik für den britischen Jazz das darstellten, was für den amerikanischen Jazz der Blues sei.
Mark Banks und Jason Toynbee befassen sich mit der öffentlichen Jazzförderung in Großbritannien seit 1968, die die Ausbildung einer britischen Avantgarde-Szene erst ermöglichte, fragen nach den Diskursen dieser Szene und der Beteiligung afro-britischer Musiker an ihr. Mark Doffman stellt dieselbe Frage noch allgemeiner, beschreibt, welcher Anstrengungen es bedürfe, den britischen Jazz als Teil einer schwarzen Diaspora zu verstehen. Justin A. Williams beschäftigt sich mit dem Beispiel des Saxophonisten Soweto Kinch, der Hybridität der Genres Jazz und Hip-Hop, und beschreibt das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein, das sich in Kinchs Projekten einer Verbindung der beiden Genres ableitet.
George McKay wirft einen Blick auf die aus Trinidad stammende Pianistin Winifred Atwell und fragt, warum sie in den Geschichtsbüchern zum britischen Jazz nicht vorkomme. George Burrows betrachtet den Modernismus in Reginald Foreysthes Musik vor dem Hintergrund der Adorno’schen Moderne-Diskussion. Byron Dueck schließlich fragt nach der sozialen Situation der britischen Jazzszene, die sich bis heute vor allem aus weißen, der Mittelklasse verbundenen Mitgliedern zusammensetzt, und er fragt nach den Gründen für die Faszination mit schwarzer Musik.
Ist also “schwarzer britischer Jazz” die Musik, die von schwarzen Musikern in Großbritannien gespielt wird? Oder handelt es sich vielmehr um eine ästhetische Größe, die sich in Musikern jedweder Hautfarbe wiederfinden kann? Die Antwort auf diese Frage ist komplex, denn die Vor- und Nachteile von schwarzer Authentizität oder weiß-dominierter Kulturszene geraden bei fast jedem Argument stark ins Kippen.
 “Black Popular Music in Britain since 1945” verfolgt einen stilistisch breiteren Ansatz. Hier fragt Catherine Tackley etwa nach der nationalen Identität west-indischer Musiker, die sich selbst als britische Jazzmusiker verstanden und wohl auch waren, weil die spezifische Art von Musik, die sie machten, nur in der Londoner Szene sich entwickeln konnte. Jon Stratton untersucht den Einfluss afrikanischer Musik sowie der Tourneen afro-amerikanischer Bluesmusiker in den 1950er und 1960er Jahre auf die britische Musikszene. Markus Coester hinterfragt die Klischees, die in der musikalischen Mode des “Afro Trend” der 1960er und 1970er Jahre zu finden sind, ästhetische Stereotype irgendwo zwischen Authentizität, Diversität und Happiness.
“Black Popular Music in Britain since 1945” verfolgt einen stilistisch breiteren Ansatz. Hier fragt Catherine Tackley etwa nach der nationalen Identität west-indischer Musiker, die sich selbst als britische Jazzmusiker verstanden und wohl auch waren, weil die spezifische Art von Musik, die sie machten, nur in der Londoner Szene sich entwickeln konnte. Jon Stratton untersucht den Einfluss afrikanischer Musik sowie der Tourneen afro-amerikanischer Bluesmusiker in den 1950er und 1960er Jahre auf die britische Musikszene. Markus Coester hinterfragt die Klischees, die in der musikalischen Mode des “Afro Trend” der 1960er und 1970er Jahre zu finden sind, ästhetische Stereotype irgendwo zwischen Authentizität, Diversität und Happiness.
Robert Strachan schaut auf die Britfunk-Welle der 1980er Jahre, stellt daneben Fragen nach Gender und Identität, wie sie sich in diesem Genre ausdrückten. Rehan Hyder fokussiert auf die Stadt Bristol, die durch Zuwanderung eine multiethnische Bevölkerung und eine starke schwarze Community besitzt, und stellt die Musik in den schwarzen Clubs der Stadt in den 1970er und 1980er Jahren vor, die durchaus eine Art eigenen Sound kreieren halfen. Mykaell Riley ist Gründungsmitglied der Reggae-Band Steel Pulse und berichtet damit aus eigener Erfahrung über die Reggae- und Bass-Culture-Szene der 1960er und 1970er Jahre.
Lisa Amanda Palmer fragt nach schwarzer Maskulinität und der Feminisierung des sogenannten “lovers rock”, des “soft reggae” der 1980er Jahre. Julian Henriques und Beatrice Ferrara werfen einen Blick auf das multikulturelle Londoner Straßenfest Notting Hill Carnival, in dem Musik Raum, Ort und Territorium markiere. Hillegonda C. Rietveld blickt auf HipHop-affine Stile, Electro-Funk, House, Acid-House, Madchester, Haçienda, Techno und andere. Jeremy Gilbert nimmt sich die elektronische Tanzmusik der 1990er bis 2000er Jahre vor. Nabeel Zuberi schließlich fragt nach den Stimmen der MC-Kultur, nach Sprache, Klangverfremdung, kultureller Identität, die sich in den Raps der Hip-Hop- und Grime-Künstler der jüngsten Generation ausdrückt.
Beide Bücher, die in derselben Reihe des Verlags erschienen sind, ergänzen sich dabei hervorragend. Sie sind beide keine historischen Abhandlungen, in denen die Geschichte schwarzer Musik in England chronologisch vorgeführt wird, sondern versammeln Aufsätze, die sich auf verschiedene Aspekte dieser Geschichte fokussieren und sind damit Teil eines kulturwissenschaftlichen Diskurses, der sehr bewusst über den Tellerrand der jeweiligen Genres hinausblickt. Bleibt anzumerken, dass beide Bücher Musik vor allem als kulturellen Ausdruck betrachten und dabei kaum einen Blick auf die Musik selbst werfen, auf den konkreten Ausdruck, der sich in Melodien, Rhythmen, Formen und Sounds widerspiegelt.
Wolfram Knauer (August 2016)
Canterbury Scene. Jazzrock in England
von Bernward Halbscheffel
Leipzig 2014 (Halbscheffel Verlag)
342 Seiten, 24,90 Euro
ISBN: 978-3-943483-00-0
 Eine besondere Facette des britischen Jazz stellt die Canterbury Scene der 1960er Jahre dar, eine musikalische Haltung, die sich aus einem Musikerkreis um Daevid Allen, Hugh Hopper und Robert Wyatt entwickelte, die ihrerseits mit der Verbindung experimenteller Rock- und experimenteller Jazzmusik experimentierten. Bands wie Soft Machine, Caravan, Henry Cow, Hatfield and the North und andere waren selbst in den 1970er Jahren nur Eingeweihten bekannt, sind aber für das Verständnis der Rock- und auch der Jazzentwicklung unverzichtbar, fügten sie doch, wie Bernward Halbscheffel im Vorwort seines Buchs zur “Canterbury Scene” schreibt, “dem Jazz der 1980er und 1990er Jahre einige europäische Farben hinzu”.
Eine besondere Facette des britischen Jazz stellt die Canterbury Scene der 1960er Jahre dar, eine musikalische Haltung, die sich aus einem Musikerkreis um Daevid Allen, Hugh Hopper und Robert Wyatt entwickelte, die ihrerseits mit der Verbindung experimenteller Rock- und experimenteller Jazzmusik experimentierten. Bands wie Soft Machine, Caravan, Henry Cow, Hatfield and the North und andere waren selbst in den 1970er Jahren nur Eingeweihten bekannt, sind aber für das Verständnis der Rock- und auch der Jazzentwicklung unverzichtbar, fügten sie doch, wie Bernward Halbscheffel im Vorwort seines Buchs zur “Canterbury Scene” schreibt, “dem Jazz der 1980er und 1990er Jahre einige europäische Farben hinzu”.
Halbscheffel, der im eigenen Verlag bereits ein zweiteiliges Sachlexikon Rockmusik sowie ein Lexikon Progressive Rock vorgelegt hat, hat auch sein Buch zur Canterbury Scene lexikalisch angelegt. Neben einer chronologischen Darstellung der historischen Entwicklung bebildert er diese dabei durch analytische Details oder Anekdoten, für die das Alphabet die Struktur vorgibt. Von “A” wie “Allen, Daevid Christopher” bis “Z” wie “Zeuhl”, einer “Spielart des Progressive Rock, initiiert von Christian Vander” finden sich Namen und Sachbegriffe, bündige Artikel zu einzelnen Bands und Biographien der wichtigsten Musiker.
Jedes Stichwort lädt den Leser zum Perspektivenwechsel ein, denn in jedem Eintrag wird aus anderer Warte auf das Thema des Buchs geschaut, auf den experimentellen Umgang mit Rockgeschichte und Improvisation. Dabei diskutiert Halbscheffel neben ästhetischen Haltungen auch genreübergreifende Begriffe wie “Avantgarde”, oder den britischen Unternehmer Richard Branson, der vor seinen Billigfliegern mit Virgin Records eine wichtige Plattenfirma gegründet hatte. Neben den mit der Canterbury-Szene verbundenen Bands und Musikern behandelt Halbscheffel auch die Auswirkungen etwa auf die deutsche Szene, wo mit dem Krautrock ein eigenes musikalisches Phänomen heranwuchs, wo Bands wie Cassiber enge Kontakte zu Canterbury-Musikern knüpften, oder wo oder das kurzlebige Plattenlabel “Hör Zu Black Label” in einer genreübergreifenden Veröffentlichungspolitik die Musik von Stockhausen und Albert Mangelsdorff genauso herausbrachte wie jene von Dagmar Krause oder Inga Rumpf.
Von Jazzseite sind neben den Artikeln über stilbildende Musiker etwa jene über den “Jazz” und über “Jazzrock” von Interesse, mit 16 Seiten immerhin einer der umfangreichten Einträge des Lexikons. Halbscheffel erzählt die Jazzgeschichte wie andere auch, von New Orleans bis Free Jazz und Fusion, interessiert sich aber naturgemäß vor allem für die jüngeren Entwicklungen, die Diskurse der 1970er bis 1990er Jahre. Er zeichnet die Geschichte des Genres in Europa nach, schildert die Entwicklung von Faszination über Nachahmung bis zur aktuellen insbesondere deutschen Szene, die, wie er schreibt, “spätestens seit den 1980er-Jahren zu einer Minderheitenmusik geworden” sei. In seinem “Jazzrock”-Eintrag versucht er zu unterscheiden, welche Einflüsse und welche Unterschiede für beide Seiten der Gleichung gelten (Rock wie Jazz), diskutiert den Jazzrock um 1970 als Stil und Stilmittel sowie die unterschiedliche Rezeption des Genres von Rock- und Jazzhörerseite.
In der abschließenden Abhandlung über die Canterbury Scene erzählt Halbscheffel, wie aus einer Anfang der 1960er Jahre gegründeten Schülerband eine “Szene” entstand, die ihre eigenen ästhetischen Vorstellungen entwickelte, wie nach und nach ein größeres Publikum die aus dieser Szene entstandenen Musik entdeckte, wie die Bands Soft Machine und Caravan auch kommerziellen Erfolg hatten, es daneben aber auch andere Konzepte gab, wie die Strömung Ende der 1970er Jahre verebbte, um in den 190er Jahren als eine einflussreiche Entwicklung wiederentdeckt zu werden. Er analysiert Aufnahmen der Bands Soft Machine, Caravan und Henry Cow und diskutiert das Element von Erfolg und mangelndem Erfolg und ihre Auswirkungen auf die Realität des Musikmachens am Beispiel der Canterbury Scene.
Halbscheffels “Canterbury Scene. Jazzrock in England” ist Fachbuch und Lexikon in einem, ein umfassender und vielschichtiger Überblick über eine wichtige Szene der europäischen Avantgarde zwischen Jazz und Popmusik, ein Buch für Liebhaber genauso wie ein Nachschlagewerk für den interessierten Laien.
Wolfram Knauer (August 2016)
Sidney Bechet in Switzerland / Sidney Bechet en Suisse
von Fabrice Zammarchi & Roland Hippenmeyer
Genf 2014 (United Music Foundation)
216 Seiten, 4 CDs, 179 Schweizer Franken
http://www.unitedmusic.ch
 Wenn ein Musiker den Weg des Jazz nach Europa symbolisiert, dann ist es Sidney Bechet. Der Klarinettist und Sopransaxophonist kam 1919 zum ersten Mal in die “Alte Welt”, als er mit dem Southern Syncopated Orchestra hier tourte. Bei einem Konzert in Lausanne beeindruckte sein Klarinettensolo über den Blues den klassischen Dirigenten Ernest Ansermet so sehr, dass dieser eine viel zitierte Kritik in der “Revue Romande” verfasste, die erste ernsthafte Würdigung eines Jazzsolisten überhaupt. Mit einem Faksimile dieser Kritik beginnt das Buch “Sidney Bechet in Switzerland”, das akribisch – und zweisprachig, also auf Englisch und Französisch – Bechets Besuche in der Schweiz von 1919 bis 1958 dokumentiert.
Wenn ein Musiker den Weg des Jazz nach Europa symbolisiert, dann ist es Sidney Bechet. Der Klarinettist und Sopransaxophonist kam 1919 zum ersten Mal in die “Alte Welt”, als er mit dem Southern Syncopated Orchestra hier tourte. Bei einem Konzert in Lausanne beeindruckte sein Klarinettensolo über den Blues den klassischen Dirigenten Ernest Ansermet so sehr, dass dieser eine viel zitierte Kritik in der “Revue Romande” verfasste, die erste ernsthafte Würdigung eines Jazzsolisten überhaupt. Mit einem Faksimile dieser Kritik beginnt das Buch “Sidney Bechet in Switzerland”, das akribisch – und zweisprachig, also auf Englisch und Französisch – Bechets Besuche in der Schweiz von 1919 bis 1958 dokumentiert.
In den 1920er Jahren lebte Bechet für längere Zeit in Europa; bereiste die Schweiz 1926 beispielsweise mit der Revue Négre” und der Show “Black People”. Seinen Wohnsitz hatte er damals in Paris, wurde allerdings 1929 nach einer Schießerei aus Frankreich ausgewiesen. Nach einem knapp zweijährigen Gastspiel in Berlin kehrte Bechet 1931 in die Vereinigten Staaten zurück.
Achtzehn Jahre später war Bechet dann wieder in Europa und ließ sich in Paris nieder. Man hörte ihn überall auf dem Kontinent, und in der Schweiz war er ein gern gesehener Gast, tourte das Land mit den Bands von Claude Luter, von André Reweliotty, mit Schweizer oder anderen europäischen Kollegen.
Fabrice Zammarci und Roland Hippenmeyer, die jeder für sich bereits fundierte Bücher über Sidney Bechet geschrieben haben, sammelten für dieses opulente Coffee-Table-Buch seltene Fotos, Zeitungsartikel, Programmhefte und zahlreiche andere Dokumente, die Bechets Auftritte in der Schweiz dokumentieren. Sie sprachen mit Zeitzeugen und noch lebenden Musikerkollegen, mit Bechets Sohn Daniel oder mit seinem ehemaligen Manager Claude Wolff. Das Ergebnis ist ein Schatz an spannenden Geschichten, an Erinnerungen und visuellen Dokumenten, denen es gelingt die Faszination für die Musik des Sopransaxophonisten lebendig werden zu lassen.
Richtig lebendig wird das alles dann allerdings insbesondere durch die vier dem Buch beiheftenden CDs, die Bechets Besuche in den 1950er Jahren dokumentieren. Hier finden sich Konzertmitschnitte zwischen Mai 1949 und April 1958, aus Genf, Lausanne, Zürich und Sion, die er Schweizer Rundfunk mitschnitt. Daneben enthalten die CDs aber auch mehrere Interviews, in denen sich Bechet in exzellentem Französisch vor allem an seine Jugend in New Orleans erinnert, daneben aber auch über seine Ballettmusik “La Nuit est une Sorcière” spricht und im Duo mit dem Pianisten Charles Lewis Auszüge daraus spielt. Gerade die Livekonzerte machen deutlich, welch begnadeter Solist Bechet war, mit einem Ton und einem Drive, dem sich seine Mitmusiker genauso wenig entziehen können wie sein Publikum.
“Sidney Bechet in Switzerland” ist eine großartige “labor of love”. Das Buch sei jedem Freund traditioneller Stilrichtungen dringend ans Herz gelegt, mag aber auch künftigen Forschern des Zusammenspiels amerikanischer und europäischer Musiker in der Nachkriegszeit als exzellente Quelle dienen, weil zwischen den Zeilen immer wieder Aspekte erwähnt werden, die in der Jazzgeschichtsschreibung sonst selten zur Sprache kommen. Wobei Sidney Bechet, und das ist vielleicht die überzeugendste Botschaft dieses Buchs, sich schon zu Beginn der 1950er Jahre keinesweigs als ein “American expatriate” empfand. Er war, wenn überhaupt, ein Franzose aus New Orleans, ein überzeugter Weltbürger.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
The View From The Back Of The Band. The Life and Music of Mel Lewis
von Chris Smith
Denton/TX 2014 (University of North Texas Press)
399 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-57441-574-2
 Im Vorwort zu dieser Biographie des Schlagzeugers Mel Lewis betont John Mosca, dass dem einen oder anderen vielleicht bewusst sein mag, wie wichtig ein Drummer für die Energie einer Bigband ist, dass er selbst allerdings, als er Lewis zum ersten Mal hörte, vor allem beeindruckt davon war, was Lewis entschied NICHT zu spielen. Mosca erwähnt auch, dass, wenn das vorliegende Buch zwar eine Biographie Mel Lewis’ sei, man die beiden Partner der Thad Jones / Mel Lewis Big Band immer zusammen denken müsse, weil sie beide das Talent des jeweils anderen so gut komplementierten, und dass man insbesondere an ihrer Zusammenarbeit die Größe eines jeden einzelnen erkenne.
Im Vorwort zu dieser Biographie des Schlagzeugers Mel Lewis betont John Mosca, dass dem einen oder anderen vielleicht bewusst sein mag, wie wichtig ein Drummer für die Energie einer Bigband ist, dass er selbst allerdings, als er Lewis zum ersten Mal hörte, vor allem beeindruckt davon war, was Lewis entschied NICHT zu spielen. Mosca erwähnt auch, dass, wenn das vorliegende Buch zwar eine Biographie Mel Lewis’ sei, man die beiden Partner der Thad Jones / Mel Lewis Big Band immer zusammen denken müsse, weil sie beide das Talent des jeweils anderen so gut komplementierten, und dass man insbesondere an ihrer Zusammenarbeit die Größe eines jeden einzelnen erkenne.
Chris Smith, selbst ein in New York lebender professioneller Schlagzeuger, beginnt sein Buch mit einem Auszug aus dem Manuskript für Lewis’ eigene, nie veröffentlichte Autobiographie, “The View from the Back of the Band”. Sein Vater, schreibt Mel darin, sei bereits Schlagzeuger gewesen. Im Kindergarten habe er die Becken bedient, bald darauf, in der ersten Klasse die Basstrommel. Irgendwann habe er seinen Vater bei einer jüdischen Hochzeit ersetzt und sich seit dem Zeitpunkt als professioneller Musiker verstanden.
Melvin Sokoloff (so sein richtiger Name) wurde 1929 in Buffalo, New York, geboren, und die Hochzeit, von der er hier sprach, fand 1935 statt. Bereits in den frühen 1940er Jahren war er ein gefragter Schlagzeuger in der Region um Buffalo, spielte in Swing- und Polka-Bands, für Hochzeiten oder Tanzveranstaltungen. Mit 14 wurde er Drummer für die Bob Seib Band, 1946 tourte er mit Bernie Burns’ Orchester durch den Mittleren Westen. Sein Schlagzeug-Kollege Frankie Dunlop erweckte sein Interesse für den Bebop, der auch die Musik der Lenny Lewis Big Band prägte, in der Mel in jenen Jahren spielte. Im Rückblick identifiziert Mel die frühen Einflüsse auf sein Spiel: ein bisschen Jo Jones, ein bisschen Gene Krupa, noch nicht wirklich Max Roach, sicher Shadow Wilson, besonders aber Big Sid Catlett.
1948 zog es Mel Lewis mit der Lennie Lewis Band dorthin, wo es jeden jungen Jazzmusiker zog, damals wie heute, nach New York City. Count Basie hörte ihn und entschied sich, Mel für sein eigenes Orchester zu sichern, dem er ein moderneres Gesicht verpassen wollte. Kurz vor dem Gig aber wurde er wieder ausgeladen, auch deshalb, weil Basies Management gerade eine Tournee durch die Südstaaten gebucht hatte, und es für einen jungen weißen Musiker nicht sicher gewesen wäre, mit einer schwarzen Band zu reisen. Mel folgte Tiny Kahn als Schlagzeuger des Boyd Raeburn Orchestra, spielte dann mit Alvino Reys Tanzkapelle. Ray Anthony, mit dem er als nächstes auftrat, gab ihm seinen künftigen Bühnennamen Mel Lewis. Anthony sei ein Despot gewesen, und ihre musikalischen Ansichten hätten weit auseinander gelegen, und doch habe er in seiner Zeit bei Anthony eine Menge gelernt, insbesondere Disziplin. Während er mit Tex Benekes Band spielte, traf er seine spätere Frau Doris, konnte den Bandleader daneben aber auch überzeugen, einen Freund, den Ventilposaunisten Bob Brookmeyer zu engagieren, den er 1949 in Chicago kennengelernt hatte. Basie bot ihm ein zweites Mal den Schlagzeugstuhl an, zahlte aber nicht genug, und Stan Kentons Angebot, mit dessen Band zu spielen, zog Kenton gleich darauf zurück, weil sein bisheriger Drummer zurückgekehrt war. 1954 allerdings rief Kenton ein zweites Mal an, und Lewis hatte zum ersten Mal die Möglichkeit mit einer der Top-Bands des Landes zu arbeiten.
Während seiner Zeit bei Stan Kenton traf Mel Lewis erstmals auf den jungen Trompeter Thad Jones, der damals noch bei Count Basie spielte. Lewis lebte damals in Los Angeles, wirkte bei Platten der West Coast Jazzszene mit, war mehr und mehr auch für kleiner besetzte Studioalben gefragt. 1959 erhielt der Vibraphonist Terry Gibbs einen Gig in einem Club in Hollywood und Lewis war mit von der Partie. Er machte Aufnahmen mit Art Pepper, Ben Webster und Gerry Mulligan, in dessen Concert Jazz Band er am Schlagzeug saß. Er reiste mit Dizzy Gillespie durch Europa und mit Benny Goodman in die Sowjetunion, trat regelmäßig in New York auf und hatte Studiogigs in Hollywood.
Nachdem er sich 1963 entschieden hatte, wieder ganz nach New York zu ziehen, zog er sofort viele Jobs an Land, Jazz-Engagements genauso wie Studiogigs etwa für die Jimmy Dean Show auf ABC. Mit Pepper Adams und Thad Jones, der Clark Terry in Gerry Mulligans Concert Jazz Band ersetzt hatte, trat er in kleiner Besetzung auf, und nachdem Mulligan sein Orchester aufgelöst hatte, entwickelten die beiden den Plan einer eigenen Big Band. Ende 1964 probten sie, suchten nach einem Auftrittsort und fanden diesen schließlich im Village Vanguard, das der Band den Montagabend zur Verfügung stellte, den finanziell für New Yorker Clubs erfahrungsgemäß schlechtesten Abend der Woche.
Am 7. Februar 1966 war das Orchester erstmals zu hören und hatte sofort großen Erfolg. Jeder der Musiker erhielt damals gerade mal 16 Dollar pro Abend, was nur deshalb ging, weil alle mit Herzblut dabei waren und außerdem andere Gigs, meist in den Studios oder am Broadway hatten. Smith berichtet von Alben für Solid State und von Tourneen, die nicht alle erfolgreich waren. So fest geschrieben die Arrangements auch waren, so behielten sie immer auch ein Moment des Improvisierten, wie Eddie Daniels berichtet, der sich erinnert, dass sich viele der schweren Arrangements von Thad Jones noch während des Auftritts veränderten, wenn Jones etwa dem Saxophonsatz Licks zusang und alle Musiker die Spannung der Live-Komposition spürten.
1971 hofften die beiden Bandleader auf einen Grammy für das “Best Large Jazz Ensemble”, der dann aber an Miles Davis’ “Bitches Brew” ging. Smith beschreibt personelle Wechsel in der Band, einen Wechsel der Plattenfirma, eine Konzertreise in die Sowjetunion 1972 und andere ausgedehnte Tourneen. Er nennt Höhepunkte und Streits und er schildert ausführlich die Entscheidung Thad Jones’, die Band zu verlassen und nach Kopenhagen zu ziehen, wo ihm ein Posten mit der Danish Radio Big Band angeboten worden war. Mel Lewis fühlte sich betrogen, künstlerisch, finanziell, persönlich, entschied dann aber nach langen Gesprächen mit Vertrauten, die Band fortzuführen.
Mel Lewis and The Jazz Orchestra, wie das Ensemble jetzt hieß, hatte das Repertoire von Thad Jones, hatte einen der wohl antreibendsten Schlagzeuger des Jazz, nämlich Mel Lewis, und fand nun in Bob Brookmeyer und einigen anderen Arrangeure, die das Repertoire mit neuen Stücken auffüllte. Der Besuch im Vanguard ging allerdings ohne Thad zurück, was sich erst änderte, als kein geringerer als Miles Davis die Band auch öffentlich lobte (und einmal sogar mit einstieg). Sein Geld verdiente Mel nach wie vor mit Studiogigs, mit Tourneen kleinerer Bands, ab den 1980er Jahren aber auch mit regelmäßigen Aufträgen durch die WDR Big Band.
Der Saxophonist Ted Nash erzählt, wie Cecil Taylor zu ihren größten Fans gehörte und vorschlug, sie sollten doch mal eine seiner Kompositionen spielen, dann aber ohne Noten kam, immer nur Schnipsel am Klavier vorspielte und die Band nach drei Stunden vielleicht mal 20 Takte zusammenhatte. 1985 trafen Thad und Mel sich noch einmal in Stuckholm und sprachen über mögliche gemeinsame Zukunftspläne. Dann aber starb Thad, und nicht lang danach streute der Hautkrebst, der bei Lewis 1985 diagnostiziert worden war, bis in die Lungen. Mel Lewis spielte bis zum seinem Ende, er starb am 2. Februar 1990.
Chris Smiths’ Buch verfolgt die Karriere von Melvin Sokoloff ausführlich, wenn er auch spätestens seit 1965 das Jones / Lewis Orchester und seine Nachfolger in den Vordergrund stellt. Im Anhang nähert sich Smith dem Schlagzeuger Lewis als Kollege, analysiert und transkribiert diverse Drum-Partien in Aufnahmen kleiner Besetzungen genauso wie in solchen mit Bigband. Eine ausgewählte Diskographie und ein Personen-Index beschließen das Buch.
“The View from the Back of the Band” ist eine Biographie des Schlagzeugers Mel Lewis, überzeugt aber letzten Endes insbesondere als Dokumentation über Lewis’ größtes Vermächtnis, die von ihm und Thad Jones gegründete Bigband, die dafür sorgte, dass der in den Mitt-1960er Jahren totgesagte Bigband-Jazz nicht starb.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Louis Armstrong. Master of Modernism
von Thomas Brothers
New York 2014 (W.W. Norton & Company)
594 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-393-66582-4
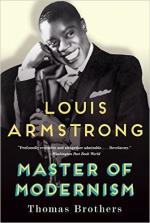 Dieses Buch ist bereits das dritte, das Thomas Brothers über Louis Armstrong geschrieben hat. In “Louis Armstrong. In His Own Words” legte er eine Dokumentation diverser Korrespondenzen und selbstverfasster Manuskripte des Vielschreibers und Trompeters vor, In “Louis Armstong’s New Orleans” portraitierte er Satchmos Jugendjahre in seiner Heimatstadt. Mit “Louis Armstrong. Master of Modernism” erfährt letzteres Buch nun eine Art Fortsetzung, in der Brothers vor allem Armstrongs Aktivitäten in den 1920er Jahren betrachtet. Er verfolgt dabei die Zusammenarbeit Armstrongs mit King Oliver’s Creole Jazz Band, die Ausbildung eines eigenen Stils, den Brothers als “modernen Stil” bezeichnet und Armstrong damit zu einem “Meister der Moderne” kürt und in eine Reihe mit anderen Ausprägungen der Moderne stellt, Erfindungen der frühen Unterhaltungsindustrie genauso wie einer wachsenden Distanz zum sittenstrengen Konventionen des Viktorianismus. Armstrong aber, so Brothers, erfand nicht nur einen, sondern gleich zwei moderne Kunstformen, von denen eine vor allem auf sein schwarzes Publikum, die andere an den Mainstream-Markt der weißen Fans gerichtet war. Er veränderte die traditionellen Herangehensweisen ans Zusammenspiel in der Band, und er wandte Methoden des Showbusiness auf die Musik an und beeinflusste damit den Jazz als Kunstrichtung, daneben aber auch die Musik ganz allgemein nachhaltig. Mit dieser Interpretation von Armstrongs Kunst als einem großen Beitrag zur intellektuellen Kulturgeschichte des 20sten Jahrhunderts will Brothers ganz bewusst von jenen im Rassismus der Vereinigten Staaten begründeten Lesarten abrücken, die das Bild eines ungelernten Musikers hochhalten, der nicht viel über das nachdenke, was er da spiele, sondern stattdessen einfach intuitiv Musik macht. Für Armstrongs Kunst, schreibt Brothers, war eine künstlerische Disziplin notwendig, die der eines Beethoven, Strawinsky usw. in nichts nachstünde. Zur Akzeptanz dieser Seite der Moderne gehöre aber auch zu verstehen, dass sich Armstrongs Kreativität zuallererst in seiner Kunst ausdrückte und damit einen nicht-verbalen Diskurs der Moderne wiedergebe.
Dieses Buch ist bereits das dritte, das Thomas Brothers über Louis Armstrong geschrieben hat. In “Louis Armstrong. In His Own Words” legte er eine Dokumentation diverser Korrespondenzen und selbstverfasster Manuskripte des Vielschreibers und Trompeters vor, In “Louis Armstong’s New Orleans” portraitierte er Satchmos Jugendjahre in seiner Heimatstadt. Mit “Louis Armstrong. Master of Modernism” erfährt letzteres Buch nun eine Art Fortsetzung, in der Brothers vor allem Armstrongs Aktivitäten in den 1920er Jahren betrachtet. Er verfolgt dabei die Zusammenarbeit Armstrongs mit King Oliver’s Creole Jazz Band, die Ausbildung eines eigenen Stils, den Brothers als “modernen Stil” bezeichnet und Armstrong damit zu einem “Meister der Moderne” kürt und in eine Reihe mit anderen Ausprägungen der Moderne stellt, Erfindungen der frühen Unterhaltungsindustrie genauso wie einer wachsenden Distanz zum sittenstrengen Konventionen des Viktorianismus. Armstrong aber, so Brothers, erfand nicht nur einen, sondern gleich zwei moderne Kunstformen, von denen eine vor allem auf sein schwarzes Publikum, die andere an den Mainstream-Markt der weißen Fans gerichtet war. Er veränderte die traditionellen Herangehensweisen ans Zusammenspiel in der Band, und er wandte Methoden des Showbusiness auf die Musik an und beeinflusste damit den Jazz als Kunstrichtung, daneben aber auch die Musik ganz allgemein nachhaltig. Mit dieser Interpretation von Armstrongs Kunst als einem großen Beitrag zur intellektuellen Kulturgeschichte des 20sten Jahrhunderts will Brothers ganz bewusst von jenen im Rassismus der Vereinigten Staaten begründeten Lesarten abrücken, die das Bild eines ungelernten Musikers hochhalten, der nicht viel über das nachdenke, was er da spiele, sondern stattdessen einfach intuitiv Musik macht. Für Armstrongs Kunst, schreibt Brothers, war eine künstlerische Disziplin notwendig, die der eines Beethoven, Strawinsky usw. in nichts nachstünde. Zur Akzeptanz dieser Seite der Moderne gehöre aber auch zu verstehen, dass sich Armstrongs Kreativität zuallererst in seiner Kunst ausdrückte und damit einen nicht-verbalen Diskurs der Moderne wiedergebe.
Brothers beginnt sein Buch am 8. August 1922, als der 21-jährige Louis Armstrong in New Orleans den Zug nach Chicago bestieg, wohin ihn Joe Oliver eingeladen hatte, um seine Creole Jazz Band zu verstärken. Er beschreibt die Arbeitsumgebung in der Stadt im Norden, die Tanzhallen, aber auch das schwarze Leben in Chicago, das durch viele der kulturellen Traditionen beeinflusst gewesen sei, die Afro-Amerikaner aus den Plantagen des Südens mitgebracht hätten. Solche Einflüsse fänden sich beispielsweise in der Bluesphrasierung, die damals ihren Weg von der Vokal- auch in die Instrumentalmusik fand, etwa jene ersten Aufnahmen, die Armstrong 1923 mit Oliver machte.
Brothers beschreibt Armstrongs Leben in Chicago, seine Beziehung zu Lil Hardin, die in Olivers Band als Pianistin mitwirkte und die er 1923 heiratete, und er beschreibt darüber hinaus Hardins Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung genauso wie auf seine populäre Karriere. 1924 brach die Band auseinander, und Brothers hat in seinem Buch genügend Platz die verschiedenen Versionen über die Gründe für die Auflösung zu diskutieren. Armstrong nahm die Einladung Fletcher Hendersons an, in seinem Orchester zu spielen, in dem er sich aber nie recht wohl und von dem er sich immer ein wenig von oben herab behandelt fühlte. New York aber, erklärt Brothers, war ein weiterer Meilenstein seiner Karriere, eine neue Herausforderung in einer Umgebung, in der es nicht wie in Chicago eine große Community anderer Musiker aus New Orleans gab.
Im New York der Harlem Renaissance, die die Stärke der schwarzen Kultur ein wenig nach eurozentrischen Kriterien darstellte, war das scheinbar Archaische des Blues eine wichtige Klangfarbe, die aber erst durch die künstlerische Bearbeitung erhöht werden sollte. Armstrong bei Henderson war also eine Art Zusammenbringen unterschiedlicher Welten. Brothers beleuchtet die Aufnahmen, die Satchmo als “hot soloist” mit dem Orchester machte, hört sich aber auch Aufnahmen mit kleineren Besetzungen an, an denen mit Sidney Bechet ein weiterer wichtiger Solist des frühen Jazz beteiligt war. Er begleitet Armstrong zurück nach Chicago, ins Dreamland Café, ins Vendome Theater, und hört schließlich die ersten Hot Five-Aufnahmen des Trompeters. Er greift sich einzelne Stücke heraus, “Heebie Jeebies” etwa, das die Plattenfirma OKeh versuchte zu einem populären Tanz hochzupushen. Die Studioaufnahmen, die Satchmo in Folge mit seinem Quintett und Septett vorlegte, wurden zu kunstvollen Statements, seine eigenen Soli – Brothers beschreibt Armstrong hier vor allem als Meister der Melodie – zu Musterbeispielen für eine virtuose tour-de-force im Jazz. In Chicago war der 27-jährige bereits eine Legende, “eine Art Gott” zumindest für sein schwarzes Publikum. Dann, Ende 1928, nahm Armstrong sich vor, auch das weiße Publikum zu erobern. Paul Whiteman war schließlich ein weit bekannterer Bandleader als er, und auch ein Musiker wie Guy Lombardo, den Satchmo durchaus bewunderte, erreichte mehr Menschen. Mit der Aufnahme von “I Can’t Give You Anything But Love” begann nicht nur eine weitere Erfolgsgeschichte in seiner Karriere, sondern daneben auch eine das Publikum überaus ansprechende Art der Interpretation populärer Schlager. Brothers beschreibt die verschiedenen Facetten, die zum Erfolg in der weißen Musikwelt beitrugen, die Bühnenshows am Broadway, die Aufnahmen populärer Schlager und schließlich die Filmwelt, die sich mehr und mehr auch der Musik öffnete.
Armstrongs Musik habe sich vier verschiedener Ansätze an die Melodie bedient, resümiert Brothers: dem Blues, dem Lead, dem Hot Solo und der Paraphrase. Alle hätten unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Formen, unterschiedliche Geschichten besessen. Alle seien in der Welt, in der Satchmo groß geworden war, in New Orleans, wichtig gewesen, und alle vier hülfen, Armstrongs künstlerische Entwicklung zu verstehen. Brothers gelingt das Nachzeichnen dieser melodischen Kraft in seinem Buch auch deshalb so gut, weil er sich nicht scheut, in die Aufnahmen hineinzuhören, in verständlicher Sprache über die melodische Innovation zu schreiben, die Einflüsse auseinanderzudröseln, Querbeziehungen zu nennen und die Wirkung auf zeitgenössische Hörer zu erklären. Dass die Reduzierung dieses Musikers der “Moderne” auf seine melodische Erfindungsgabe nicht ausreicht, ist auch Brothers klar. Seine Konzentration aber insbesondere auf dieses Merkmal in Satchmos Spiel hilft dem Leser sich auf eine vielleicht zu selten in den Mittelpunkt gestellte Perspektive seines Spiels zu konzentrieren.
Thomas Brothers Buch ist gut recherchiert und äußerst flüssig geschrieben. Ein umfangreicher Apparat an Anmerkungen und Literaturverweisen, ein ausführliches Register und viele Fotos runden das Buch ab, das einmal mehr beweist, dass auch über einen Künstler, über den bereits alles erforscht zu sein scheint, Neues zu schreiben ist. Vor allem die Einordnung Armstrongs in die amerikanische Musikindustrie der 1920er Jahre und die differenzierte Beschreibung der unterschiedlichen Szenen in Chicago und New York machen das Buch daneben zu einem wichtigen Beitrag zur Erforschung der frühen Jazzgeschichte.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
The New Orleans Scene, 1970-2000. A Personal Retrospective
von Thomas W. Jacobsen
Baton Rouge 2014 (Louisiana State University Press)
199 Seiten, 25 US-Dollar
ISBN: 978-0-8071-5698-8
 Der 1935 geborene Thomas Jacobson wuchs in einem kleinen Ort in Minnessota auf. Er spielte ein wenig Klarinette und wurde in seiner Jugend zum Jazzfan. Ihn interessierte der Swing, vor allem aber faszinierte ihn die authentische Musik, die er in einem Radiosender aus New Orleans hörte. Ende der 1980er Jahre verbrachte er ein Jahr lang als Gastprofessor in der Geburtsstadt des Jazz und entschied sich, nach seiner Pensionierung dorthin zu ziehen. Seither hat er in Fachblättern und seinem Buch “Traditional New Orleans Jazz” über die Szene der Stadt berichtet. Jetzt legte Jacobsen ein neues Buch vor, in dem er chronologisch die Jazzszene in New Orleans von 1970 bis 2000 beschreibt, Musiker, Bands, Veranstaltungsorte, Festivals, Ausbildungsmöglichkeiten und vieles mehr. Seine Entscheidung, diese Chronologie 1970 beginnen zu lassen, hängt mit einem anderen Buch zusammen, Charles Suhors “Jazz in New Orleans. The Postwar Years through 1970”, das genau in dem Jahr aufhörte und das er sich auch in seiner Darstellungsstruktur als Vorbild für sein Manuskript nahm. Wie Suhor war es Jacobsen dabei wichtig, alle Aspekte des Jazzlebens in der Crescent City zu dokumentieren und sich nicht auf die frühen Stile zu beschränken, wenn diese auch, wie er anmerkt, die Musik im French Quarter in der Zeit, die er betrachtet, überdurchschnittlich beherrscht habe.
Der 1935 geborene Thomas Jacobson wuchs in einem kleinen Ort in Minnessota auf. Er spielte ein wenig Klarinette und wurde in seiner Jugend zum Jazzfan. Ihn interessierte der Swing, vor allem aber faszinierte ihn die authentische Musik, die er in einem Radiosender aus New Orleans hörte. Ende der 1980er Jahre verbrachte er ein Jahr lang als Gastprofessor in der Geburtsstadt des Jazz und entschied sich, nach seiner Pensionierung dorthin zu ziehen. Seither hat er in Fachblättern und seinem Buch “Traditional New Orleans Jazz” über die Szene der Stadt berichtet. Jetzt legte Jacobsen ein neues Buch vor, in dem er chronologisch die Jazzszene in New Orleans von 1970 bis 2000 beschreibt, Musiker, Bands, Veranstaltungsorte, Festivals, Ausbildungsmöglichkeiten und vieles mehr. Seine Entscheidung, diese Chronologie 1970 beginnen zu lassen, hängt mit einem anderen Buch zusammen, Charles Suhors “Jazz in New Orleans. The Postwar Years through 1970”, das genau in dem Jahr aufhörte und das er sich auch in seiner Darstellungsstruktur als Vorbild für sein Manuskript nahm. Wie Suhor war es Jacobsen dabei wichtig, alle Aspekte des Jazzlebens in der Crescent City zu dokumentieren und sich nicht auf die frühen Stile zu beschränken, wenn diese auch, wie er anmerkt, die Musik im French Quarter in der Zeit, die er betrachtet, überdurchschnittlich beherrscht habe.
Jacobsen beginnt in den 1960er Jahren, als die “Beatlemania” die Popmusik prägte. Der Jazz sei damals quasi tot gewesen in der Stadt, die ihn einst hervorgebracht habe, klagten viele Journalisten, aber auch Jazzkenner. Tatsächlich brannte das Feuer des Jazz aber nur auf kleiner Flamme. Jacobsen nennt die Namen all der Musiker, die in diesem Jahrzehnt entweder wiederentdeckt wurden oder aber über kurz oder lang in ihre Heimatstadt zurückkamen und diese neu belebten. Vier Faktoren hätten in den 1960er Jahren ihren Ursprung gehabt, die für das Fortbestehen der Stadt als Jazzmekka sorgen sollten: die Eröffnung der Preservation Hall, die ab 1961 den älteren Musikern der Stadt Respekt zollte, die Gründung des Jazzmuseums, das später ins Louisiana State Museum übergeführt wurde, der Beginn des New Orleans Jazz and Heritage Festivals, sowie das wachsende Bewusstsein, dass auch die moderneren Spielarten ihren Ursprung in New Orleans hatten.
Jacobsens Buch handelt die dreißig Jahre jahrzehnteweise ab, und auch innerhalb dieser Großkapitel chronologisch. Er beginnt mit dem Tod Louis Armstrong 1971, der neben den Trauerfeierlichkeiten in New York auch mit einer Parade in New Orleans bedacht wurde. Jacobsen zählt die Clubs auf, bekannte wie Pete Fountain’s oder Al Hirt’s auf der Bourbon Street, und unbekanntere, kurzlebige genauso wie solche, die immer noch bestehen (darunter Fritzel’s European Jazz Pub”). Der Impresario George Wein machte das Jazz and Heritage Festival zu einem Publikumsmagneten; viele der hier lebenden Musiker sorgten in Repertoireorchestern wie dem New Orleans Ragtime Orchestra oder dem Louisiana Repertory Jazz Ensemble dafür, dass die musikalische Tradition der Stadt am Leben erhalten wurde. Jacobsen streicht die Bedeutung der Brassbands heraus und die Institutionalisierung von pädagogischen Programmen.
Die Struktur dieses Kapitels nehmen auch die folgenden Seiten auf. Für die 1980er Jahre erwähnt Jacobsen etwa das neue French Quarter Festival, schreibt über Brassbands, die den traditionellen Jazz mit Pop, Soul und modernem Jazz verbanden, über die Marsalis-Brüder, die anfingen weltweit von sich reden zu machen, und erwähnt eine neue Veröffentlichung für die städtische Musikszene, die Zeitschrift “OffBeat”. Für die 1990er Jahre berichtet er außerdem über das Bechet Centennial von 1997, über Doc Cheatham und Henry Butler, die das Musikleben der Stadt bereicherten, und endet mit der Beschreibung des Jazzdiskurses dieses Jahrzehnts, in dem es auch um die Deutungshoheit über die Jazzgeschichte ging und in dem Wynton Marsalis insbesondere die Stellung von New Orleans besonders zu betonen wusste.
Im Schlusskapitel macht sich Jacobsen Gedanken über das Alter des Publikums, aber auch über dessen Geschmack, die stärkere Akzeptanz mehrerer Genres bei jüngeren Hörern anstelle des alten Spartendenkens. Er regt eine demographische Untersuchung über das Jazzpublikum an, die etwa während des JazzFests durchgeführt werden könnte und von dessen Zahlen er sich erhofft, das sie die landesweite Studie zum Thema auf die Region herunterbrechen würden. Er reißt kurz die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Musikern an, die Tatsache, dass sich nur wenige von ihnen eine Krankenversicherung leisten können, und er betont die Bedeutung von Initiativen wie der New Orleans Musicians’ Clinic. Dabei bleibt er optimistisch, findet, dass die Musikszene in New Orleans nach wie vor ungemein kreativ ist und die Musiker selbst dafür sorgen, dass sie das auch bleibt.
Thomas Jacobsen bleibt in seinem Buch Chronist mit klaren Vorlieben. Er blickt nur sporadisch über die Jazzszene hinaus, obwohl der Jazz auch und gerade in New Orleans so eng mit der gesamten Kulturszene der Stadt verbunden ist. Blues oder Zydeco und andere in der Stadt mindestens genauso präsenten Spielformen kommen kaum vor. Nur in Nebensätzen spricht er die außerdem die Spannungen an, die sich aus dem Spagat zwischen Arm und Reich, aus dem in der Region nach wie vor herrschenden Rassismus ergeben. Jacobsen wollte Suhors Buch fortschreiben, vielleicht aber wäre es klug gewesen, statt der Zäsur der Jahrtausendwende noch zehn Jahre weiter zu gehen. Gerade in der Katrina-Katastrophe und dem Umgang der Stadt mit den Folgen nämlich erkennt man die Stärken der Communities, aus denen heraus einst auch der Jazz entstanden war. Ned Sublette hat in seinem Buch “The Year Before the Flood” (2009) gezeigt, wie hilfreich eine solch breitere Sicht sein kann.
Aber natürlich war das nicht Jacobsens Ansatz. Und so bleibt das Buch genau das, was der Titel verspricht: eine sehr persönliche Retrospektive über die Jazzszene in New Orleans über drei Jahrzehnte. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Für Freunde des New Orleans-Jazz ist es damit eine mehr als willkommene Übersicht über die Entwicklungen im letzten Viertel des 20sten Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (September 2015)
Verve. The Sound of America
von Richard Havers
München 2014 (Sieveking Verlag)
400 Seiten (78,00 Euro)
ISBN 978-3-944874-06-7
 Ein dicker Schinken… Man betrachtet die in jüngster Zeit gern publizierten Coffeetable-Books mit gemischten Gefühlen. In der Regel sind sie gut aufgemacht, reich an Fotos, ein wenig teuer, zumindest aber ein exzellentes Geschenk. Oft richten sich die Texte einfach deshalb, weil die Bücher sich verkaufen müssen, um sich zu finanzieren, an ein breiteres Publikum und sind damit für den Jazzfan, der bereits viel weiß, zwar ein nützliches, aber irgendwie auch überflüssiges Beiwerk. Für den Autor der vorliegenden dicken Schwarte über das Jazzlabel Verve war es also eine durchaus nicht einfache Aufgabe, die eingefleischten Fans genauso zu bedienen wie die bloß Interessierten, Wissen zu vermitteln über die verschiedenen Seiten der Plattengeschäfts von den 1940er Jahren bis in die Gegenwart, über die Künstler genauso zu berichten wie über ihre Produkte, über die Bedingungen der Aufnahme genauso wie über die Auswahl von Plattencovern, und das alles dann noch in den Kontext der Jazzgeschichte zu stellen.
Ein dicker Schinken… Man betrachtet die in jüngster Zeit gern publizierten Coffeetable-Books mit gemischten Gefühlen. In der Regel sind sie gut aufgemacht, reich an Fotos, ein wenig teuer, zumindest aber ein exzellentes Geschenk. Oft richten sich die Texte einfach deshalb, weil die Bücher sich verkaufen müssen, um sich zu finanzieren, an ein breiteres Publikum und sind damit für den Jazzfan, der bereits viel weiß, zwar ein nützliches, aber irgendwie auch überflüssiges Beiwerk. Für den Autor der vorliegenden dicken Schwarte über das Jazzlabel Verve war es also eine durchaus nicht einfache Aufgabe, die eingefleischten Fans genauso zu bedienen wie die bloß Interessierten, Wissen zu vermitteln über die verschiedenen Seiten der Plattengeschäfts von den 1940er Jahren bis in die Gegenwart, über die Künstler genauso zu berichten wie über ihre Produkte, über die Bedingungen der Aufnahme genauso wie über die Auswahl von Plattencovern, und das alles dann noch in den Kontext der Jazzgeschichte zu stellen.
Richard Havers hat diese Aufgabe mit seinem Buch über Norman Granz’ legendäres Verve-Label mustergültig bewältigt. Er zeichnet die Jazzentwicklung bis Swing und Bebop als eine Geschichte der Tonaufzeichnung und Plattenvermarktung nach. Drei der großen Namen seines Labels eröffnen die blockweise eingestreuten biographischen Kapitel: Louis Armstrong, Duke Ellington und Billie Holiday. Einen umfassenden Block nehmen die Tourneen und Plattenveröffentlichungen der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic ein, die Granz 1944 erstmals zusammenbrachte und die seine Karriere als Plattenboss über die Jahrzehnte begleiten sollte. Havers schreibt über das Konzept, den Erfolg, aber auch über Granz’s Einsatz gegen Rassismus in jenen Jahren, wenn er öffentlich und notfalls auch gerichtlich gegen jede Art der Diskriminierung gegen seine Künstler vorging.
Der Anfang von JatP lag noch vor Granz’s Arbeit als Plattenchef. Und vor Verve gab es erst einmal die Labels Clef und Norgran, von denen Havers im dritten Großkapitel erzählt. Er bildet die Seiten des 1949 erschienen Plattenalbums “The Jazz Scene” ab, eines einmaligen Projekts, in dem Granz die aktuellsten Strömungen im Jazz der Zeit dokumentieren wollte. Diese Veröffentlichung bestand aus 12 Schellackplatten, deren Cover in einem Album – ja, hier kommt der Begriff her – zusammengebunden waren. Erst mit dem Aufkommen der Langspielplatte Anfang der 1950er Jahre stieg Granz dann aber wirklich ins Plattengeschäft ein. Havers streift die Bedeutung David Stone Martins, der viele der frühen LP-Cover entwarf, und er bildet diese genauso wie die damals nicht weniger aufschlussreichen Labels selbst, also die runden Aufkleber auf der Vinylplatte, auf etlichen Seiten ab.
In den 1950er Jahren wurde das Label Verve zur wichtigsten Heimat des swingenden Mainstream. Mitschnitte vom Newport-Festival, Aufnahmen mit Charlie Parker, jede Menge Besetzungen um Meister wie Ella Fitzgerald Oscar Peterson, Ben Webster, Lester Young und viele andere schrieben Jazzgeschichte. Modernere Produktionen der 1960er Jahre mit Jimmy Smith, Stan Getz, Gerry Mulligan oder Gary McFarland hatte zum großen Teil schon nicht mehr Norman Granz zu verantworten, der sein Label 1960 für 2,5 Millionen Dollar an MGM verkauft hatte. In den 1970ern gründete Granz mit Pablo eine neue Plattenfirma, die an seinen alten Erfolg anknüpfte und viele der ihm wichtigen Künstler produzierte. Zugleich wurde sich Polygram, die inzwischen MGM und damit auch Verve geschluckt hatte, irgendwann bewusst, welch enormer Schatz da in den Archiven schlummerte und welch ikonische Bedeutung insbesondere auch der Labelname besaß. Junge Künstler wurden in den Katalog aufgenommen, auch nachdem Polygram 1999 in die Universal Music Group überführt wurde.
Richard Havers Buch ist ein beeindruckendes Werk. Der Text liest sich flüssig und bleibt dabei nicht in Details über einzelne Produktionen stecken, die man lieber in den dazugehörigen Plattentexten liest, sondern lässt den Leser an den programmatischen Entscheidungen des Labels teilhaben. Die kurzen Kapitel über die auf Verve produzierten Musiker sind vor allem biographische Einordnungen, bei denen man durchaus etwas mehr Labelbezug wünschen könnte. Dafür aber entschädigen die großartigen Fotos, sowohl Promo-Shots als auch seltene Bilder der Künstler auf der Bühne oder im Studio und die nach wie vor beeindruckenden Reproduktionen der Plattencover aus mehr als 60 Jahren Plattengeschichte.
Ein dicker Schinken… aber die Lektüre allemal wert!
Wolfram Knauer (August 2015)
Softly, with Feeling. Joe Wilder and the Breaking of Barriers in American Music
von Edward Berger
Philadelphia 2014 (Temple University Press)
400 Seiten, 35,00 US-Dollar
ISBN 978-1-43991-127-3
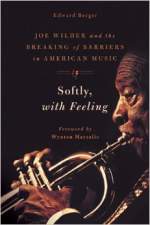 Joe Wilder war einer der stilleren Musiker der Jazzgeschichte, ein zuverlässiger Sectionman und Solist, immer Gentleman, keine Skandale, eine Karriere zwischen Jazz-Bigbands, Studioarbeit und klassischer Musik. Wilder war bei seinen Kollegen hoch angesehen, wegen seiner musikalischen Souveränität, aber auch, weil er wusste, was er wollte und seine Ansichten auch kundtat. 1953 tourte Wilder mit der Count Basie-Band und traf bei einem Konzert ein junges Mädchen. Sie sprach kaum Englisch, und er ließ ihr den Wunsch übersetzen, ob er ihre Adresse haben dürfe. Wilder begann eine Korrespondenz, erst auf Englisch, was sie sich übersetzen lassen musste, dann auf Schwedisch, das er eigens für sie lernte und dabei sogar darauf achtete, ihren regionalen Dialekt zu beherrschen. Sie schrieben einander täglich, und Wilder korrespondierte auch mit ihren Eltern. Per Post hielt er drei Jahre später um ihre Hand an. Sie reiste nach New York, und die beiden heirateten. Sie blieben ein Paar bis zu seinem Tod, kurz nach Fertigstellung dieses Buchs, seiner Biographie, die Edward Berger mit Hilfe der Wilder-Familie und ihrer Erinnerungen schrieb, für die er aber auch mit vielen der Kollegen Wilders sprach und deren Geschichten er immer wieder in die Zeitgeschehnisse einpasst.
Joe Wilder war einer der stilleren Musiker der Jazzgeschichte, ein zuverlässiger Sectionman und Solist, immer Gentleman, keine Skandale, eine Karriere zwischen Jazz-Bigbands, Studioarbeit und klassischer Musik. Wilder war bei seinen Kollegen hoch angesehen, wegen seiner musikalischen Souveränität, aber auch, weil er wusste, was er wollte und seine Ansichten auch kundtat. 1953 tourte Wilder mit der Count Basie-Band und traf bei einem Konzert ein junges Mädchen. Sie sprach kaum Englisch, und er ließ ihr den Wunsch übersetzen, ob er ihre Adresse haben dürfe. Wilder begann eine Korrespondenz, erst auf Englisch, was sie sich übersetzen lassen musste, dann auf Schwedisch, das er eigens für sie lernte und dabei sogar darauf achtete, ihren regionalen Dialekt zu beherrschen. Sie schrieben einander täglich, und Wilder korrespondierte auch mit ihren Eltern. Per Post hielt er drei Jahre später um ihre Hand an. Sie reiste nach New York, und die beiden heirateten. Sie blieben ein Paar bis zu seinem Tod, kurz nach Fertigstellung dieses Buchs, seiner Biographie, die Edward Berger mit Hilfe der Wilder-Familie und ihrer Erinnerungen schrieb, für die er aber auch mit vielen der Kollegen Wilders sprach und deren Geschichten er immer wieder in die Zeitgeschehnisse einpasst.
Wilder kam 1922 in Philadelphia zur Welt, in einer Familie, für die Musik wichtig war. Sein Vater verdiente war Lastwagenfahrer, spielte daneben anfangs Kornett, später Sousaphon und sogar Kontrabass. Joe lernte Kornett von einem Trompeter, der seinen Schülern vor allem einen klassischen Ansatz vermittelte. Wilder erzählt, wie er in den frühen 1930er Jahren Teil einer Radio-Jugendkapelle war, die regelmäßig von den namhaftesten Bands des Landes unterstützt – und angespornt – wurde. Wilder hatte das absolute Gehör und entwickelte schon früh den Ehrgeiz, auf seinem Instrument auch Stimmen zu spielen, die eigentlich für andere Instrumente geschrieben waren. Von der High School wechselte er auf eine Schule, deren Musikunterricht rein klassisch ausgerichtet war. Zu seinen Schulkameraden gehörten hier allerdings auch die späteren Jazzkollegen Red Rodney und Buddy DeFranco. Als seine Eltern sich scheiden ließen, war die Familie auf jeden Verdienst angewiesen, und Joe spielte mit verschiedenen Tanzorchestern der Stadt. 1941 wurde er Satztrompeter in der Les Hite Band, wechselte dann als erster Trompeter in Lionel Hamptons Band. Er trat seinen Wehrdienst bei den Black Marines an, kehrte zu Hampton zurück, spielte schließlich mit Jimmie Luncefords Band, mit Lucky Millinder, Sam Donahue und Herbie Fields. Zwischendurch saß er 1947 auch eine Weile in Dizzy Gillespies Bebop-Bigband, in der er, eher Swingspieler, sich etwas fremd fühlte, auch wenn er als versierter Musiker ein fester Anker des Trompetensatzes war.
Anfang der 1950er Jahre gehörte Wilder zu den ersten schwarzen Musikern, die in einer der Broadway-Show-Orchester spielen durften. Seit 1957 war er reguläres Mitglied des ABC Orchesters, spielte im Auftrag des Senders Jazz, Werbung, Livemusik zu Radioshows, aber auch klassische Konzerte. 1962 war er mit von der Partie, als Benny Goodman vom amerikanischen State Department auf eine Tournee in die Sowjetunion geschickt wurde. Die Reise machte später auch wegen der Art und Weise Furore, wie Goodman seine Musiker behandelte – und Wilder verklagte ihn am Ende vor dem Schiedsgericht der Musikergewerkschaft, weil der Klarinettist ihm die Gage gekürzt hatte.
Berger erklärt Wilders Stil anhand des Albums “Wilder ‘n’ Wilder” aus dem Jahr 1956 und insbesondere anhand Wilders Solo über “Cherokee”, das einen ungeheuren Einfluss auf nachfolgende Trompeter hatte, auch wenn Wilder selbst nie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Seine klassische Technik machte ihn zu einem beliebten Musiker für komplexere Third-Stream-Kompositionen, etwa von Gunther Schuller oder in Johnny Richards wenig bekannten “Annotations of the Muses”.
Wilder hatte mit klassischer Musik begonnen, sich dem Jazz dann gezwungenermaßen zugewandt, weil er wusste, dass er als Schwarzer in diesem Genre keine Chancen hatte. Edward Berger widmet diesem Phänomen des Rassismus in amerikanischen Sinfonieorchestern ein eigenes Kapitel. Wilder wurde 1964 Mitglied der Symphony of the New World, eines neuen Orchesters, in dem sich das ganze Amerika widerspiegeln können sollte. Berger erzählt, wie allein die Existenz eines solchen “integrierten Orchesters” zu einem geänderten Bewusstsein und auch dazu führte, dass zwei Musiker, nämlich der Bassist Art Davis und der Cellist Earl Madison, das New York Philharmonische Orchester vor der New York City Commission on Human Rights verklagten. Wilder war als Zeuge bei der Anhörung beteiligt. In den 1960er und frühen 1970er Jahren jedenfalls war Wilder in diversen klassischen Ensembles aktiv. Ein Höhepunkt dieser Arbeit war gewiss die “Sonate für Trompete und Piano”, die der Komponist Alec Wilder (nicht verwandt) ihm auf den Leib schrieb.
In den frühen 1970er Jahren begannen die Fernsehanstalten aus Kostengründen auf Livebands zu verzichten. Wilder saß in der Band der “Dick Cavett Show”, bis diese 1974 abgesetzt wurde; danach war er wieder Freiberufler. Er kehrte in Broadway-Bands zurück oder spielte mit dem Tanzorchester von Peter Duchin, nahm aber auch an jazz-haltigeren Aufnahmesessions von Kollegen wie Johnny Hartman, Helen Humes, Teresa Brewer oder Anita O’Day teil. Er trat mit einem Bruder-im-Geiste auf, dem Saxophonisten und Komponisten Benny Carter, und er wurde Mitglied in diversen Repertory-Bands, die in diesen Jahren aufkamen. 1992 tourte er mit dem Lincoln Center Jazz Orchestra, von 1991 bis 2002 gehörte er dem Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra an. Nebenbei begann er zu unterrichten, seit 2002 an der renommierten Juilliard School in New York.
Ed Bergers Biographie ist voller interessanter Facetten zwischen Jazz- und amerikanischer Kulturgeschichte. Persönliche Aspekte im Leben des Trompeters Joe Wilder bleiben – von der frühen Jugend und der Geschichte seiner zweiten schwedischen Frau einmal abgesehen – meist außen vor. Bergers Exkurse in die Welt der Studiobands New Yorks, der Broadway-Orchester, der Fernseh- und Plattenstudios und der sinfonischen Musik sind neben dem eigentlichen Thema (also: Wilder selbst) wertvolle Ergänzungen eines oft viel zu eingeengt betrachteten Jazzkontextes. Auch Jazzmusiker sind schließlich nicht nur auf einem Feld aktiv, und jeder Bereich, in dem sie sich tummeln, hat seine eigenen ästhetischen und wirtschaftlichen Regeln. Berger gelingt es genau diese Unterschiede deutlich zu machen, kaum wertend und damit wohl sehr im Sinne Wilders, für den im Vordergrund stand, sein technisches Können so einzusetzen, dass die Musik, die er gerade machte, möglichst gut wurde.
Manchmal scheint sich Berger in Details zu verlieren, allerdings verlangt die Vielseitigkeit seines Sujets nun mal ein Portrait auf verschiedenen Ebenen. Die Diskographie am Ende seines Buchs ist durchaus beispielhaft für das Problem seines Projekts: Sie listet eben nicht nur die Jazztitel auf, sondern auch Aufnahmen aus dem Pop und leichten klassischen Kontext. “Softly, with Feeling” ist ein würdiges Portrait eines der vielleicht würdigsten Musiker des Jazz, der bei Mitmusikern durch die Bank so beliebt war, dass die einzige annähernd kritische Bemerkung, die Berger einem Kollegen entlocken konnte, die Aussage Dick Hymans war: “Er zog sich immer ein bisschen förmlicher an als eigentlich nötig war.”
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Berlin / Berlin. Kunststücke aus Ost und West
herausgegeben von Ulli Blobel & Ulrich Steinmetzger
Berlin 2014 (jazzwerkstatt)
211 Seiten, 24,90 Euro
ISBN: 978-3-981-14852-6-4
 Rainer Bratfisch gab vor kurzem eine dicke Schwarte heraus, in der er der Jazzstadt Berlin ein würdiges Denkmal setzte. Ja, Berlin war bereits in den 1920er Jahren eine Metropole des Jazz in Europa gewesen und blieb dies bis ins 21ste Jahrhundert hinein. Die Faszination der Hauptstadt für Musiker und Künstler aber versteht man nicht mit der selektiven Lupe auf ein ausgewähltes Genre, sondern erst im Blick auf das kreative Ganze, das Berlin ausmachte. Ulli Blobel und Ulrich Steinmetzger haben in ihrem Buch genau diese Vielfalt im Blick, die Vielfalt in der doppelten Hauptstadt Berlin (Ost) und Berlin (West).
Rainer Bratfisch gab vor kurzem eine dicke Schwarte heraus, in der er der Jazzstadt Berlin ein würdiges Denkmal setzte. Ja, Berlin war bereits in den 1920er Jahren eine Metropole des Jazz in Europa gewesen und blieb dies bis ins 21ste Jahrhundert hinein. Die Faszination der Hauptstadt für Musiker und Künstler aber versteht man nicht mit der selektiven Lupe auf ein ausgewähltes Genre, sondern erst im Blick auf das kreative Ganze, das Berlin ausmachte. Ulli Blobel und Ulrich Steinmetzger haben in ihrem Buch genau diese Vielfalt im Blick, die Vielfalt in der doppelten Hauptstadt Berlin (Ost) und Berlin (West).
Ihr Buch beginnt mit der Teilung, mit Bertold Brechts Gedicht “O Deutschland, wie bist du zerrissen” und mit Georg-Albrecht Eckles Blick auf Brechts Hoffnungen für ein neues Deutschland. Karl Dietrich Gräwe betrachtet mit Boris Blacher und Paul Dessau zwei Komponisten, die sich beide in ihrem Leben für die Wahlheimat Berlin entschieden hatten, um sich dann aber in zwei unterschiedlichen Hälften der Stadt wiederzufinden. Friederike Wißmann geht ähnlich an Hanns Eisler und Hans Werner Henze heran, die sie insbesondere in ihren Vokalkompositionen miteinander vergleicht. Insa Wilke stellt den Dichter Thomas Brasch vor, der seine Lyrik mit der Rockmusik verglich. Judith Kuckart beleuchtet die DDR-Tournee des Tanztheaters Wuppertal unter Pina Bausch im Jahr 1987. Klaus Völker betrachtet die Theaterlandschaft in Ost und West zwischen 1945 und 1989. Andreas Öhler porträtiert Wolf Biermann, Andreas Tretner die freie Musik eines Anthony Braxton, Ronald Galenza den, wie er es nennt, “Kalten Krieg der Konzerte”, Rock- und Popevents der 1970er bis 1980er Jahre. Christoph Dieckmann betrachtet die DDR-Rockszene der späten 1980er Jahre, Rainer Bratfisch die Lebens- und Arbeitsreise des Saxophonisten Ernst-Ludwig Petrowsky und der Sängerin Uschi Brüning, Christian Broecking die Hingabe des Pianisten Alexander von Schlippenbach. Bert Noglik identifiziert Einflüsse auf und die musikalische Identität des Pianisten Ulrich Gumpert. Kapitel über die Berliner Festspiele (Torsten Maß), Die Untergangsfeiern der DDR (Christoph Funke) und die ersten Jahre nach 1989 (Helmut Böttiger) beschließen das reich bebilderte Buch, dem es damit tatsächlich gelingt, ein wenig der Spannung dieser Frontstadt zwischen Ost und West zu vermitteln, der lebendigen Kultur, der Diskurse, die von beiden Seiten angestachelt, aber nie richtig ausdiskutiert wurden.
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Tal Farlow. Un accord parfait. Une biographie illustré / A Life in Jazz Guitar. An Illustrated Biography
von Jean-Luc Katchoura mit Michele Hyk-Farlow
Paris 2014 (Paris Jazz Corner)
342 Seiten, 1 beigeheftete CD, 69 Euro
Zu bestellen über Paris Jazz Corner
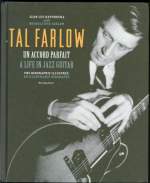 1983 half der junge Architekturstudent Jean-Luc Katchoura bei der Organisation eines Gitarrenfestivals in Frankreich, wo er zum ersten Mal den Gitarristen Tal Farlow hörte. Schon im folgenden Jahr begleitete er diesen auf seiner Sommertournee als sein europäischer Agent. Sie blieben in Kontakt, und nach Farlows Tod entwickelten seine Witwe und Katchoura die Idee, die vielen Erinnerungsstücke, die sich in ihrem Besitz befanden, in einem Buch zu präsentieren.
1983 half der junge Architekturstudent Jean-Luc Katchoura bei der Organisation eines Gitarrenfestivals in Frankreich, wo er zum ersten Mal den Gitarristen Tal Farlow hörte. Schon im folgenden Jahr begleitete er diesen auf seiner Sommertournee als sein europäischer Agent. Sie blieben in Kontakt, und nach Farlows Tod entwickelten seine Witwe und Katchoura die Idee, die vielen Erinnerungsstücke, die sich in ihrem Besitz befanden, in einem Buch zu präsentieren.
Es ist eine überaus dokumentenreiche Biographie geworden, zweisprachig auf Englisch und Französisch gehalten, mit Familienfotos, Postkarten und vielen anderen Dokumenten sowie einer lebendig erzählten Biographie des Gitarristen, der 1921 in North Carolina geboren wurde, sich mit neun Jahren selbst das Mandolinespiel beibrachte und schließlich durch Platten von Charlie Christian und Art Tatum zum Jazz kam. Der Pianist Jimmy Lyon überredete ihn, die Musik zum Beruf zu machen. Farlow spielte in der Band des Schlagzeugers Billy Bank, dann mit der Pianistin Dardanelle, mit der er unter anderem im Cove in Philadelphia auftrat, wo sich das Trio mit Art Tatum abwechselte. 1945 ging Farlow zurück in seine Heimatstadt und verdiente sich sein Geld mit Schildermalen, was er vor seiner musikalischen Laufbahn gelernt hatte. Er mischte in Jam Sessions mit, bis er 1948 Mundell Lowe im Trio der Vibraphonistin Marjorie Hyams ersetzte.
Farlow zog nach New York, und wurde 1949 Mitglied im Red Norvo Trio, erst mit Red Kelly, dann mit Charles Mingus am Kontrabass. 1953 machte er seine erste Aufnahme für Blue Note, spielte außerdem in der Gramercy Five des Klarinettisten Artie Shaw. All diese Erfahrungen ermöglichten es ihm 1954 selbst als Bandleader in Erscheinung zu treten, mit Alben erst auf Blue Note, dann auf Norman Granz’s Norgran-Label. Farlow machte sich einen Namen mit seinem Trio, dem der Pianist Eddie Costa angehörte, nahm aber auch an Aufnahmesessions etwa mit Oscar Pettiford oder den Metronome All Stars teil. Er zog nach Sea Bridge, einem Fischerstädtchen in New Jersey, ging fischen, malte Schilder, gab Gitarrenunterricht und trat ab und an in nahegelegenen Clubs auf. Erst 1967, fast zehn Jahre nach seinem Umzug nach Sea Bridge, kehrte er auf die New Yorker Jazzszene zurück. Er wurde für die Newport All-Stars engagiert, spielte Duos etwa mit Barney Kessel oder Joe Pass. In den Mitt-1970er Jahren profitierte er von dem wiedererstarkten Interesse an den Künstlern des Mainstream-Jazz, nahm etliche Platten für Concord und andere Labels auf und stand im Fokus eines 1980 gedrehten Dokumentarfilms über seine Kunst. Farlow ging auf Tournee durch Europa und Japan, mit eigenen Bands, als Solist in anderen Bands oder mit den Great Guitars, in dem Farlow anfangs Herb Ellis ersetzte, wann immer der anderweitig beschäftigt war, und schließlich Barney Kessel, als der nach einem Schlaganfall nicht mehr spielen konnte. In den 1990er Jahren gab es eine Neuausgabe dieser Band mit Farlow, Attila Zoller und Jimmy Raney. 1997 wurde ein Speiseröhrenkarzinom bei Farlow festgestellt, das bereits Metastasen gebildet hatte und an dessen Folgen er am 25. Juli 1998 verstarb.
Katchoura erzählt die Lebensgeschichte Tal Farlows vor allem anhand von Interviewauszügen und persönlichen Fotos und Dokumenten. Neben Biographischen erfahren wir dabei auch Details etwa über die verschiedenen Gitarren, die er über die Jahre spielte, oder über den Entwurf eines Amplifier-Stuhls, den Farlow in den 1960er Jahren tatsächlich baute. Eigene Kapitel befassen sich mit für Farlow wichtigen Kollegen, den Pianisten Jimmy Lyon und Dardanelle, dem Vibraphonisten Red Norvo und dem Bassisten Charles Mingus. Eine Diskographie und eine Bibliographie beschließen das Buch; doch ganz am Ende heftet dann auch noch eine Zugabe, eine CD mit elf Tracks, Interviewausschnitten einer Radiosendung mit Phil Schaap und unveröffentlichten Titeln etwa von Duos mit Gene Bertoncini, Red Mitchell oder Jack Wilkins.
“Tal Farlow. A Life in Jazz Guitar” ist eine labor of love, eine umfangreiche Dokumentation seines Lebens und kommt in der dabei eher unkritischen Herangehensweise einer subjektiven (aber nie geschriebenen) Autobiographie des Gitarristen vielleicht am nächsten.
Wolfram Knauer (Mai 2015)
Charlie Parker i Sverige – med en avstickare till Köpenhamn
von Martin Westin
Stockholm 2014 (Premium Publishing)
181 Seiten, 283 Schwedische Kronen
ISBN: 978-91-87581-05-2
 Im November 1950 besuchte Charlie Parker für 10 Tage Skandinavien. Seit 1947 wurden seine Platten bereits in Schweden rezipiert; 1948 hatte Dizzy Gillespies Bigband hier Konzerte gegeben, und als Parker 1949 zum Jazzfestival nach Paris eingeladen wurde, schloss er erste Kontakte zu schwedischen Musikern und Redakteuren. Der Journalist und Konzertveranstalter Nils Hellström hatte dabei die Idee, Parker im nächsten Jahr direkt nach Schweden einzuladen. Er verhandelte mit Parkers New Yorker Agenten Billy Shaw und einigte sich auf Gagen- und Reisekosten.
Im November 1950 besuchte Charlie Parker für 10 Tage Skandinavien. Seit 1947 wurden seine Platten bereits in Schweden rezipiert; 1948 hatte Dizzy Gillespies Bigband hier Konzerte gegeben, und als Parker 1949 zum Jazzfestival nach Paris eingeladen wurde, schloss er erste Kontakte zu schwedischen Musikern und Redakteuren. Der Journalist und Konzertveranstalter Nils Hellström hatte dabei die Idee, Parker im nächsten Jahr direkt nach Schweden einzuladen. Er verhandelte mit Parkers New Yorker Agenten Billy Shaw und einigte sich auf Gagen- und Reisekosten.
Parker reiste in ein Land, in dem erst im Monat zuvor ein neuer König gekrönt worden war. Mit ihm kam auch Roy Eldridge in Stockholm an, der aus Paris anreiste, wo er mit Benny Goodmans Band gespielt hatte. Sie wurden von Hellström sowie von jungen schwedischen Musikern und Fans empfangen. Im Doppelprogramm spielte Eldridge mit der Band des Pianisten Charles Norman und Parker mit jener des Trompeters Rolf Ericson und dem Saxophonisten Arne Domnérus, in der auch der Baritonsaxophonist Lars Gullin mitwirkte. Sie traten im renommierten Stockholmer Konserthuset auf, danach aber mischte Parker auch bei Jam Sessions mit. Am nächsten Tag fuhren alle gemeinsam mit dem Zug nach Göteborg, danach hatte Eldridge ein Konzert in Kopenhagen, während Parker nach Malmö weiterreiste. Am 3. November kam auch Parker nach Kopenhagen, wo sie das Doppelkonzert in den K.B. Hallen wiederholten. Parker spielte im Folkparken von Helsingborg und in Jönköping und kehrte dann über Gävle nach Stockholm zurück, wo er unter anderem mit Pute Wickman und Toots Thielemans in einer Session auftrat.
Auf dem Rückweg nach New York machte Parker schließlich noch in Paris Station, wurde dort von Charles Delaunay in Empfang genommen und besuchte den Schlagzeuger Kenny Clarke und seine damalige Lebensgefährtin, die hochschwangere Sängerin Annie Ross. Delaunay hatte eine Aufnahme mit Parker sowie einen Auftritt beim Paris Jazz Festival geplant, den Parker aber kurzfristig absagen musste, weil er sich nicht wohl fühlte und stattdessen über London zurück nach New York flog.
Martin Weston hat die Reise Parkers nach Skandinavien sorgfältig recherchiert. Er hat in alten Zeitschriften geblättert, fand zeitgenössische Konzerthinweise und Zeitungsrezensionen, den Vertrag, den Parker mit Hellström abgeschlossen hatte, vor allem aber jede Menge an Fotodokumenten, seltene, bisher kaum gesehene Bilder, die Bird auf der Bühne oder mit Kollegen und Fans zeigen. Er zitiert aus Interviews mit Zeitzeugen, und er listet die Aufnahmen auf, die Parker in diesen wenigen Tagen machte.
Für die schwedischen Musikerkollegen war Parkers Besuch ein Ohrenöffnen sondergleichen. Sein so völlig anderes rhythmisches Konzept schlug die einen in seinen Bann, während es andere eher abschreckte und in der Folge den stärker aufs Melodische fokussierten Cool Jazz als ihr Spielfeld wählen ließ.
“Charlie Parker i Sverige” ist eine spannende Detailstudie über einen Musiker, dessen Reise nach Schweden auch eine kurze Flucht aus der Realität seiner New Yorker Drogensucht war, sowie über eine junge schwedische Jazzszene, die durch diesen Besuch angespornt wurde, den modernen Jazz als Aufbruch zu verstehen.
Wolfram Knauer (April 2015)
Art. Why I Stuck with a Junkie Jazzman
von Laurie Pepper
Richmond/CA 2014 (Widow’s Taste / Art Pepper Music Corp.)
374 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1494297572
 In den 1970er Jahren erschien “Straight Life”, Art Peppers Lebensgeschichte, aufgezeichnet von seiner Frau, Laurie Pepper, in der sich der Saxophonist, wie sie im Vorwort ihres neuen Buchs schreibt, als “verlorenes, verzweifeltes Genie” darstellte und sie als seinen Schutzengel. “Während unserer Ehe gelang es uns erfolgreich diese Geschichte darzustellen”, schreibt sie. “Aber ich war kein Engel, und wir retteten uns gegenseitig.” Dieses neue Buch nun sei ihre eigene Geschichte.
In den 1970er Jahren erschien “Straight Life”, Art Peppers Lebensgeschichte, aufgezeichnet von seiner Frau, Laurie Pepper, in der sich der Saxophonist, wie sie im Vorwort ihres neuen Buchs schreibt, als “verlorenes, verzweifeltes Genie” darstellte und sie als seinen Schutzengel. “Während unserer Ehe gelang es uns erfolgreich diese Geschichte darzustellen”, schreibt sie. “Aber ich war kein Engel, und wir retteten uns gegenseitig.” Dieses neue Buch nun sei ihre eigene Geschichte.
Es beginnt düster, im August 1968, als Laurie nach einer langen Leidensgeschichte mit Depressionen und Drogenmissbrauch einen erfolglosen Selbstmordversuch unternahm und sich danach selbst in Kaliforniens erste Drogenklink Synanon einweisen ließ. Hier traf sie neun Monate später auf Art Pepper. Als Synanon Ende 1971 ein Rauchverbot einführte, hielt der es nicht mehr aus. Er verließ die Klinik. Laurie folgte ihm wenige Monate später.
Schon in Synanon fand Laurie, dass die vielen Geschichten, die Art ihr aus seinem Leben erzählt hatte, genügend Stoff für ein Buch böten. Beide waren Leseratten, Laurie hatte darüber hinaus ein wenig journalistische Erfahrung, als Fotografin, aber auch durch kleine Artikel, die sie für linke Zeitungen geschrieben hatte. Sie besorgte sich einen billigen Kassettenrecorder und stellte die erste Frage: “Art, sag mir, warum du dieses Buch machen willst.” – “Eigentlich ist das doch deine Idee gewesen”, antwortete Pepper, erinnerte sich dann aber auch gleich: Schon im Gefängnis von San Quentin habe man ihn darauf angesprochen, dass sein Leben genügend Stoff für ein Buch böte. Und da er ahne, dass er nicht mehr lange zu leben habe, fände er, dass es an der Zeit sei, damit zu beginnen.
So also entstand “Straight Life”. Laurie erinnert sich daran, wie Art seine Geschichten mit dramaturgischem Gespür für die Wendungen und den Verlauf erzählen konnte, ganz so als ob er ein Solo auf seinem Saxophon spielte. Die Arbeit am Buch habe auch ihm bewusst gemacht, wie groß sein Talent zum Geschichtenerzählen war. Sie stellte zugleich eine Art Therapie dar, die Neuinterpretation seines Lebens. Einige seiner Anekdoten ließ Laurie ihn wieder und wieder erzählen, um mehr zu erfahren und tiefer einzudringen. Sie berichtet, wie der Prozess des Schreibens teilweise zum Kampf wurde, wenn Art betrunken war oder high durch andere Substanzen. Er habe zwei Seiten gehabt, und die, die sie nicht mochte, nannte sie irgendwann “Ruthra” oder “Reppep”, also Arthur bzw. Pepper rückwärts gelesen. Laurie erzählt vom gemeinsamen Leben, nachdem der Saxophonist sich in ein Methadonprogramm eingeschrieben hatte, von den wenigen Freunden, die sie hatten und die alle irgendwie im Netzwerk der Drogen, von Synanon oder Methadon steckten.
Eines Tages wurde Art Pepper eingeladen einen Workshop an der Ostküste zu geben – ausgerechnet auf der Klarinette, einen Instrument, das er eigentlich nur ab und zu als Zweitinstrument gespielt hatte. Sie zogen in ein kleines Haus in Van Nuys, einem Vorort von Los Angeles, und Pepper trat häufiger auf, erst mit lokalen Musikern, dann mit dem experimentellen Don Ellis Orchestra, bald aber auch bei Festivals oder in namhaften Clubs.
Anschaulich berichtet Laurie von den zwei Seiten im Leben ihres Mannes: dem glamourösen der gefeierten Konzerte und dem des Drogenabsturzes, der an jeder Ecke lauerte. Sie berichtet von Arts erster Reise nach Japan und wie sie das Methadon für ihren Mann in einer Shampoo-Flasche schmuggelte, aber auch vom Misstrauen Peppers gegenüber seinen Mitmusikern.
Durch einen Fan kam Laurie in Kontakt zu einem Verlag für “Straight Life”. Im September 1978 schloss Pepper einen Vertrag mit der Plattenfirma Fantasy ab und ging bald darauf ins Studio. Im nächsten Jahr erschien das Buch und erhielt höchstes Lob in einigen der wichtigsten Gazetten des Landes. Das Buch gab Peppers Karriere einen neuen Schub, Tourneetermine überall in den USA und in Europa, die Chance für eine Aufnahme mit Streichern.
Laurie war inzwischen Managerin, Krankenschwester, Dealerin, Psychotherapeutin, und das alles in einem Zustand, in dem sie gut selbst Therapie vertragen hätte. Sie sorgte dafür, dass Art seine Zahnprothesen trug, dass sein Buch mit einem Gürtel fest umbunden war, der seine riesige Hernie im Platz hielt und ihm die Bauchmuskulatur gab, die er fürs Spielen benötigte, seit einem Milzriss Ende der 1960er Jahre aber nicht mehr hatte. Am 30. Mai 1982 trat der Saxophonist bei einem Festival in Washington auf, fand, dass die Zeit für seinen Set zu kurz war und konnte daher sein Schlussthema, “Straight Life” nicht mehr spielen. So kam es, erzählt Laurie Pepper, dass “When You’re Smiling” zum letzten Titel wurde, den Art Pepper in seinem Leben gespielt hatte. Er habe es auf der Klarinette gespielt, dem Instrument, auf dem er begonnen hatte. Neun Tage später lag er im Koma. Sechs Tage darauf war er tot.
Im Rest ihres Buchs erzählt Laurie Pepper, wie sie nach dem Tod Ihres Mannes ihr Leben meisterte, sich auf Tugenden und Talente besann, die sie zwar auch genutzt hatte, um Art am Leben zu halten, die jetzt aber ihr selbst helfen konnten. Sie befasste sich mit den juristischen Fallstricken des Musikgeschäfts und sorgte dafür, dass der Gewinn, den Arts Musik immer noch einfuhr, auch ihr zugute kam.
In ihrem Buch “Art. Why I Stuck With a Junkie Jazzman” wollte Laurie Peppers über sich selbst statt über Art Pepper erzählen. Der größte Teil ihres Buchs handelt allerdings von niemand anderem als Art Pepper, seiner Sucht, seiner Musik, seinen Problemen. Die Frage, warum sie es so lange mit einem Junkie erhält hat am Ende zwei Antworten: Gewiss war es vor allem Liebe, daneben aber hatte sie schnell erkannt, dass, indem sie sich um Art Pepper kümmerte, sie die Dämonen in sich selbst zähmen konnte. Und wenn man erkennt, dass Laurie Pepper sich irgendwann, nachdem sie einander in Synanon begegnet waren, durch ihn definierte, liest man ihre Darstellung der Beziehung, ihre Sicht auf seine Krankheit und seine Musik auch als einen Blick ins Innere der Autorin selbst.
Wie “Straight Life” ist auch “Art. Why I Stuck With a Junkie Jazzman” schonungslos, bietet stellenweise eine fast schon schmerzhafte Lektüre, und doch auch einen tiefem Einblick in die Realität eines Musikerlebens.
Wolfram Knauer (April 2015)
Benson. The Autobiography of a Jazz Legend
von George Benson (& Alan Goldsher)
Boston 2014 (Da Capo Press)
222 Seiten, 25,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-306-82229-2
 1982 nahm George Benson die Einladung an, mehrere Konzerte in Südafrika zu spielen, das damals noch vom Apartheid-Regime regiert wurde. Benson war naiv in die Angelegenheit hineingestolpert und musste nun sehen, wie er die Konzerte zu einem Erfolg brachte, der von Menschen aller Hautfarben genossen werden konnte. Irgendwie gelang es ihm, und beim Abschlusskonzert in Kapstadt sorgte er dafür, dass Schwarz und Weiß im ausverkauften Saal nebeneinander saßen und alle, Publikum wie Musiker, zu Tränen gerührt waren von der Macht der Musik. 23 Jahre später spielte er wieder in Südafrika und traf auf einen Mann, der ihn fragte, ob er sich noch an ihn erinnere. “Klar, du hast damals mit meinen Bodyguards herumgehangen”, antwortete Benson, worauf der Mann erklärte: “Das stimmt, nur waren das keine Bodyguards. Die Männer hätten dich umgebracht, wenn es einen Aufstand gegeben hätte. Man hätte gesagt, du wärst im Zuge der Unruhen ums Leben gekommen, und Südafrika hätte nie wieder ein gemischtes Konzert erlebt.” Wie zum Teufel, schließt George Benson diese Anekdote, hat es nur dazu kommen können, dass ein Kid aus ärmlichen Verhältnissen in Pittsburgh in die Lage geriet, mitten in Südafrika fast Ziel eines Attentats geworden zu sein?
1982 nahm George Benson die Einladung an, mehrere Konzerte in Südafrika zu spielen, das damals noch vom Apartheid-Regime regiert wurde. Benson war naiv in die Angelegenheit hineingestolpert und musste nun sehen, wie er die Konzerte zu einem Erfolg brachte, der von Menschen aller Hautfarben genossen werden konnte. Irgendwie gelang es ihm, und beim Abschlusskonzert in Kapstadt sorgte er dafür, dass Schwarz und Weiß im ausverkauften Saal nebeneinander saßen und alle, Publikum wie Musiker, zu Tränen gerührt waren von der Macht der Musik. 23 Jahre später spielte er wieder in Südafrika und traf auf einen Mann, der ihn fragte, ob er sich noch an ihn erinnere. “Klar, du hast damals mit meinen Bodyguards herumgehangen”, antwortete Benson, worauf der Mann erklärte: “Das stimmt, nur waren das keine Bodyguards. Die Männer hätten dich umgebracht, wenn es einen Aufstand gegeben hätte. Man hätte gesagt, du wärst im Zuge der Unruhen ums Leben gekommen, und Südafrika hätte nie wieder ein gemischtes Konzert erlebt.” Wie zum Teufel, schließt George Benson diese Anekdote, hat es nur dazu kommen können, dass ein Kid aus ärmlichen Verhältnissen in Pittsburgh in die Lage geriet, mitten in Südafrika fast Ziel eines Attentats geworden zu sein?
Pittsburgh also ist der Ausgangspunkt dieser Karriere, Industriestadt, Arbeiterstadt, Rassentrennung. Pittsburgh hatte eine Reihe wichtiger Jazzmusiker hervorgebracht, Earl Hines, Erroll Garner und Art Blakey unter ihnen… und George Benson, der hier 1943 geboren wurde. Die Kirche brachte ihn zur Musik; in der Schule fiel seine Stimme auf; er spielte ein wenig Klavier und Geige. Sein Stiefvater brachte eine Gitarre mit ins Haus, aber da die zu groß für ihn war, lernte er seine ersten Akkorde auf einer Ukulele. Er verkaufte Zeitungen und merkte eines Tages, dass er mit ein wenig Ukulele-Spiel und Gesang mehr verdienen konnte. Ein Nightclub-Besitzer entdeckte ihn und bot seiner Mutter an, ihn für 40 Dollar pro Abend am Wochenende bei sich auftreten zu lassen. Und so ging es weiter… nur in Amerika! Ein Friseur um die Ecke ließ ihn rufen, damit er seine Gibson-Gitarre spielen könne; dann der Besitzer einer Imbissstube, der ihn nach New York mitnahm, um eine Platte aufzunehmen. Damit wurde es nichts, doch sechs Monate später ging Benson für RCA ins Studio und spielte, gerade mal elf Jahre alt und noch nicht im Stimmbruch, seine ersten vier Titel ein.
Mit 15 gründete Benson mit seinem Cousin die Altairs, eine Doo-Wop-Gruppe. Die Leute mochten sein Gitarrenspiel, aber er selbst sah sich vor allem als Sänger. Er hörte Platten und fragte alle Instrumentalisten aus, die in die Stadt kamen. Ihm gefielen die Orgel-Combos, die in den späten 1950er, frühen 1960er Jahren populär waren; er begann sich für Jazzgeschichte zu interessieren, für Musiker wie Lester Young oder Charlie Parker, und er hörte Platten von Kenny Burrell, Grant Green und Wes Montgomery. Und plötzlich war er selbst, der sich nie als Jazzmusiker gesehen hatte, als Gitarrist in Brother Jack McDuffs Trio in New York aktiv. Der Organist war von Bensons Groove und Sound angetan, hätte ihn aber beinahe gleich wieder rausgeschmissen, als er entdeckte, dass Benson zwar Rhythm ‘n’ Blues spielen konnte, von Jazzimprovisation aber keine Ahnung zu haben schien. Benson erzählt, wie er die anderen Bands auscheckte, die in den Clubs des Big Apple zu hören waren, und wie er sich sein Jazz-Handwerkszeug nach und nach draufgeschafft habe, mal neugierig und begeistert, mal eher widerwillig. McDuff lehrte ihn, wie man mit Groove und Rhythmus das Publikum für sich gewinnen, ihnen mit Technik zeigen könne, dass man sein Instrument beherrsche, dass aber der Blues die Grundlage des Ganzen sei, weil er alles zusammenbinde.
Mitte der 1960er Jahre hatte Benson für sich akzeptiert wohl doch Jazzmusiker zu sein, doch Mitte der 1960er Jahre wurde es für Jazzmusiker zugleich immer schwerer, von ihrer Musik leben zu können. Benson, der 1964 für das Label Prestige sein erstes Album unter eigenem Namen aufgenommen hatte, spielte in Striptease-Clubs und billigen Kneipen, und in einer solchen wurde er von John Hammond angesprochen, dem legendären Produzenten, der ihm einen Vertrag bei Columbia Records anbot. Benson hatte schon zu diesem Zeitpunkt ein feines Gespür für die Balance zwischen Musikalität und Kommerz. Seine erste Columbia-Platte verband seine Liebe zum Jazz mit aktuellen Soul-Covern. Sein Crossover-Stil war erfolgreich, wurde von Jazzerseite aber auch kritisiert. Als nächstes unterschrieb er beim Label Verve, das damals von Creed Taylor geleitet wurde und Wes Montgomery einige seiner besten Platten beschert hatte. Taylor engagierte Herbie Hancock und Ron Carter für eine Platte, und kurz danach rief Miles Davis an und schlug Benson vor, gemeinsam ins Studio zu gehen. Die Erinnerungen des Gitarristen an die denkwürdige Aufnahmesitzung für “Miles in the Sky” ist ein besonders lesenswertes Kapitel des Buchs, über den Trompeter, sein Verhältnis zu Mitmusikern, und seinen allgemeinen Zorn, der aus der Stimmung der Zeit und den Spannungen zwischen Schwarz und Weiß heraus zu verstehen ist. In der Folge bot Miles Benson sogar einen Platz in seiner Band an, doch der wollte seine eigene Karriere forcieren.
Creed Taylor nahm Benson mit zum Label CTI Records, auf dem der Gitarrist seine Mischung aus Soul, Funk und Modern Jazz weiter entwickelte. Er war einer der wenigen Künstler, dem der Spagat zwischen Jazz und populärer Musik nachhaltig gelang. Seine Soulalben verkauften sich, seine Konzerte waren voll mit Fans, daneben aber war auch Benny Goodman von einer Fernseh-Jam Session, in der Benson Charlie Christians Repertoire spielte, so begeistert, dass er ihn am liebsten für seine Band verpflichtet hätte.
1976 erhielt Benson einen Vertrag bei Warner Brothers und landete mit “This Masquerade” auf dem Album “Breezin'” einen Riesenhit, gefolgt von “On Broadway”, das als obskure Doo-Wop-Nummer begonnen hatte und durch Bensons Version zu einem Jazz- und Popstandard wurde. Von hier an beginnt das Buch sich zu wiederholen. Die Anekdoten über Bensons erfolgreiche Jahre wirken entweder zu vorsichtig (bloß niemanden verletzen!) oder aber unzusammenhängend. Der Gitarrist lobt Kollegen; er gibt sich bescheiden; er fühlt sich geehrt, wenn Frank Sinatra ihn von der Bühne im Publikum grüßt; er verweist auf die großen Vorbilder; und immer wieder beteuert er, wie unglaublich es doch sei, dass er es tatsächlich so weit gebracht habe.
Vielleicht stimmt es ja, dass man erst mit einem gewissen Abstand die wichtigsten Ereignisse auch seines eigenen Lebens richtig bewerten kann. In Autobiographien jedenfalls – egal ob von Jazzmusikern oder anderen Personen des öffentlichen Lebens – fällt immer wieder auf, dass die prägenden Jahre die interessantere Geschichte ausmachen. Nicht anders also liest sich auch George Bensons Buch. Seine Erinnerungen an den Beginn seiner Karriere, daran, wie die Musik ihn letzten Endes immer wieder gerettet hatte, lesen sich flüssig und spannend. Die Geschichten des erfolgreichen Stars dagegen fallen deutlich ab, enthalten weit weniger Höhepunkte oder überraschende Wendungen. Und für eine bloße Verlaufsbeschreibung dieser zweiten Hälfte seiner Karriere hätte Bensons Mitautor ab und an eine Jahreszahl und gerne auch den Nachnamen der oft nur mit Vornamen benannten Freunde und Kollegen einfließen lassen können, um dem immer noch geneigten Leser das Zurückblättern zu ersparen.
Sein Buch zeigt George Benson als einen geübten Anekdotenerzähler, der sich bewusst ist, dass seine Karriere vielleicht kein Zufall, aber auch keine Selbstverständlichkeit war. Je näher der Autor allerdings der Gegenwart kommt, desto vorsichtiger wird er, Persönliches mitzuteilen. Wo wir zu Beginn jede Menge an Informationen über Familie und Freunde erhalten, sind es zum Schluss vor allem die eh bekannten Stars und Kollegen, über die Benson berichtet. Frau, Familie, Zuhause, Religion, politische Einstellung – all das findet sich, wenn überhaupt, höchstens zwischen den Zeilen. Aber das ist natürlich die Crux einer jeden Autobiographie, insbesondere von Künstlern, die nach wie vor im Geschäft sind: dass sie den Spagat wagen wollen, auf der einen Seite ihr Leben zu erklären, ohne auf der anderen Seite zu viel von sich preiszugeben. Was im Gedächtnis bleibt nach der Lektüre, ist die sympathische Selbsteinschätzung des Gitarristen und Gesangsstars George Benson, der, wie es scheint, bis heute kaum glauben mag, dass er, der kleine Junge aus Pittsburgh, der nie Noten lesen gelernt hatte, der seine eigene Stimme für zu dünn hielt und der sich sicher war, seinen großen Vorbildern, Charlie Christian und Wes Montgomery nie das Wasser reichen zu können, in der Jazzwelt ernst genommen wird und dass es ausgerechnet ihm gelingen konnte, den Jazz mit der Popindustrie zu vermählen.
Wolfram Knauer (März 2015)
The Original Guitar Hero and the Power of Music. The Legendary Lonnie Johnson, Music and Civil Rights
von Dean Alger
Denton/TX 2014 (University of North Texas Press)
366 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-57441-546-9
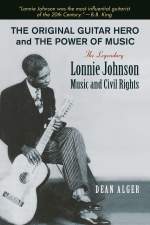 Die Bedeutung von Künstlern ist nicht immer an ihrer Bekanntheit abzulesen, sehr viel mehr wohl an ihrem künstlerischen Einfluss. Wenn es danach geht, gehört der Gitarrist Lonnie Johnson in den Olymp der Jazz- und Bluesgeschichte des 20sten Jahrhunderts. Das jedenfalls meint Dean Alger, dessen Buch das Leben und Wirken (und Nachwirken) Johnsons zum Thema hat.
Die Bedeutung von Künstlern ist nicht immer an ihrer Bekanntheit abzulesen, sehr viel mehr wohl an ihrem künstlerischen Einfluss. Wenn es danach geht, gehört der Gitarrist Lonnie Johnson in den Olymp der Jazz- und Bluesgeschichte des 20sten Jahrhunderts. Das jedenfalls meint Dean Alger, dessen Buch das Leben und Wirken (und Nachwirken) Johnsons zum Thema hat.
Lonnie Johnson wurde 1894 in New Orleans geboren. Alger schildert das bunte Musikleben in der Stadt am Mississippi-Delta, in dem der Jazz entstand, in dem aber auch der Blues eine wichtige Rolle spielte – nicht als zwölftaktiges, formal klar umrissenes Genre, als der er spätestens ab den 1920er Jahren bekannt wurde, sondern als eine Art Übergangsstil zwischen Field-Holler des 19ten und kunstvollem Volkslied des 20sten Jahrhunderts. Alger diskutiert die widersprüchlichen Quellen um die Geburt des Lonnie Johnsons und beschreibt die Nachbarschaft, in der er aufwuchs. Die ganze Familie habe aus Musikern bestanden, bezeugte Johnson später, sein erstes Instrument sei die Geige gewesen, bevor er zur Gitarre wechselte, mit er irgendwann zwischen 1912 und 1917 Johnson durch die Sümpfe Lousianas reiste, den Trompeter Punch Miller begleitend, um sich mit Musik sein Geld zu verdienen.
1917, liest man in mehreren Quellen, reiste Johnson nach London, um dort in einer nicht näher bekannten Revue aufzutreten. Alger entdeckt in einem Blues ein alternatives Narrativ für diese Jahre in Johnsons Leben: “1917 Uncle Sam called me”, heißt es darin, und so schlussfolgert der Autor, wahrscheinlich sei Johnson im I. Weltkrieg mit einer Theatertruppe zur Truppenbetreuung nach Europa gereist. Als er 1919 nach New Orleans zurückkehrte, waren die meisten seiner Verwandten an einer Grippeepidemie verstorben. Johnson verließ seine Heimatstadt und zog nach St. Louis. Dort habe der Blues ganz anders geklungen als in New Orleans; authentischer, mit stärkerem Bezug zum Leben der schwarzen Bevölkerung. Johnson trat auf den Riverboats auf, die in St. Louis anlegten, und er begann mit Varietétruppen zu reisen, in denen auch einige der “klassischen” Bluessängerinnen auftraten, Clara oder Mamie Smith etwa. 1925 heiratete er; die Ehe hielt allerdings nicht allzu lang, offenbar auch wegen der Affären, die er nebenbei hatte (unter anderem mit Bessie Smith). Es gab, je nach Lesart, einen Sohn oder sechs Töchter, wie Alger aus Zeitzeugenberichten und Interviews mit Kollegen und Freunden des Gitarristen recherchiert.
Im Oktober 1925 gewann Johnson einen Blues-Gesangswettbewerb; kurz darauf machte er seine ersten Plattenaufnahmen, auf denen er mal als Gitarrist, mal als Geiger und mal als Sänger zu hören ist. Gleich einer der ersten Titel, “Mr. Johnson’s Blues” vom 4. November 1925, wurde zu einem Verkaufsschlager. In der Folge tourte Johnson fleißig, seine Platten verkauften sich blendend, und 1928 war er einer der seltenen nicht dem Orchester angehörenden instrumentalen Gäste des Duke Ellington Orchestra, mit dem er vier Stücke einspielte, unter ihnen “The Mooch”. 1928 und 1929 ging er für mehrere Duettaufnahmen mit dem anderen großen Gitarrenvirtuosen der 1920er Jahre, Eddie Lang, ins Studio, der dafür unter dem Namen “Blind Willie Dunn” firmierte. In einigen der Aufnahmen spielte Johnson eine 12-saitige Gitarre, deren Machart und Stimmung Gitarrenexperten über Jahrzehnte Rätsel aufgab.
Lonnie Johnson war eine Art früher Fusion-Musiker, der sich in Bluesumgebung genauso wohl fühlte wie in Jazzaufnahmen etwa mit Ellington oder Louis Armstrong. Tatsächlich klingt seine Gitarrenbegleitung etwa in Armstrong’s “Hotter Than That” von 1927 moderner als das Spiel der meisten anderen Gitarristen jener Zeit, und so ist es sicher nicht ganz falsch, in ihm einen Vorläufer der Kunst Charlie Christians zu sehen.
In den 1930er Jahren lebte Johnson in Philadelphia, New York und Cleveland, ging als Solist ins Studio oder mit kleinen Besetzungen. Um Geld zu verdienen, verdingte er sich aber auch als Stahlarbeiter in East St. Louis. Ende der 1930er Jahre war er dann in Chicago, spielte mit Baby Dodds und anderen älteren Musikern aus New Orleans, entdeckte daneben die elektrische Gitarre für sich und war auf Aufnahmen früher Rhythm ‘n’ Blues-Künstler zu hören. Sein Einfluss auf den Rock ‘n’ Roll der 1950er Jahre sei enorm gewesen, betont Alger und zitiert B.B. King, Buddy Guy und andere. Konkret verweist er auf “Tomorrow Night”, einen Hit, den Johnson 1947 einspielte und dessen Coverversion 1954 von Elvis Presley deutliche Parallelen sowohl im Konzept der Aufnahme wie auch in Presleys Stimmbehandlung besitzt.
1952 machte Johnson eine Englangtournee, bei der ein junger Gitarrist namens Tony Donegan ihn als Vorbild für sich entdeckte und sich aus Verehrung für den älteren Meister künftig Lonnie Donegan nannte. Immer wieder musste Johnson aber auch Jobs annehmen, die nichts mit Musik zu tun hatten, arbeitete etwa als Hausmeister in einem Hotel in Philadelphia, wo Chris Albertson ihn 1959 entdeckte und ihn für mehrere LPs ins Studio brachte. Während einer Art dritten Comebacks wurde Johnson als Zeuge für die Anfänge des Blues gefeiert. 1963 war er einer der Künstler des von Horst Lippmann und Fritz Rau organisierten American Folk Blues Festivals, machte 1967 wichtige Einspielungen für das Folkways-Label, in denen man sehr gut hören kann, wie sich die Traditionen von Blues und Jazz vermischen. 1969 wurde er bei einem Autounfall schwer verletzt, trat danach zwar noch einige Male auf, erholte sich aber nie völlig und starb im Juni 1970 im Alter von 76 Jahren.
Der Autor des Buchs, Dean Alger, ist ein Fan Lonnie Johnsons, und so sehr seine Begeisterung ihn zu extensiven Recherchen antrieb, so sehr trübt sie leider auch ein wenig die Lesefreude. Schon in der Einleitung beklagt er sich, dass so viele Verlage sein Manuskript aus Unwissenheit über die Bedeutung seines Subjekts abgelehnt hätten, und im folgenden Text finden sich neben stark übertrieben wirkenden Superlativen zu Johnson immer wieder Seitenhiebe auf Musiker und Autoren, die dessen Bedeutung nicht erkannt hätten.
Alger lässt seine Leser an den Schwierigkeiten der Recherche teilhaben, präsentiert unterschiedliche Versionen für Stationen in Johnsons Karriere, um dann zu erklären, warum er meint, diese oder jene sei die wahrscheinlichste. So berichtet er beispielsweise von einem Antrag auf Sozialversicherung vom April 1937, auf dem Johnson eine Adresse in Nashville angegeben und seine Geburt auf Februar 1909 datiert habe – das eine nicht verifizierbar, das zweite glatt falsch. Damit bietet Alger auf der einen Seite einen spannenden Blick in die Rechercheprobleme über frühe afro-amerikanische Musikgeschichte, erschwert seinen Lesern auf der anderen Seite aber enorm die Lektüre. Zu oft verlässt er den Geschichtsfluss, um die spätere Rezeption zu erklären und nebenbei noch, wieso andere Autoren zu bestimmten Schlussfolgerungen gekommen seien und wieso er selbst diese nicht teile.
Für seine analytischen Beschreibungen verlässt Alger sich meist auf fremde Quellen statt auf die eigenen Ohren; seine eigenen Beschreibungen sind stattdessen mit Adjektiven wie “wonderful”, “appealing”, “memorable”, “perfect” durchzogen. Warum er Ellingtons “The Mooche” als “popmusikalischen Gegenpart zu Strawinskis ‘Le Sacré du printemps'” bezeichnet, bleibt ein Rätsel. Seine (eigene) Beschreibung von Johnsons Kazoo-Spiel im “Five O’Clock Blues” liest sich folgendermaßen: “Lonnie spielt in der ersten Hälfte des Stücks eine schöne, weinende Bluesgeige. Später steigt Lonnie aufs Kazoo um, und diesmal klingt das Kazoo wie eine sehr alte Katze, die gerade erwürgt wird, die aber kaum mehr genügend Energie hat sich zu beschweren.” Es sei doch ganz gut zu wissen, zitiert er dann einen Kollegen, dass auch Lonnie Johnson nur menschlich gewesen sei, “er war nicht auf jedem Instrument brillant.”
Immer wieder spricht er seine Leser direkt an, ist sich dabei aber offenbar nicht ganz sicher, um wen es sich dabei wohl handelt, erklärt Details afro-amerikanischer Musikgeschichte mal sehr detailliert und für Uneingeweihte, um an anderen Stellen die Geduld des Kenners mit dem Klein-Klein seiner Recherchen zu überfordern. Das Erbe Lonnie Johnsons bestehe, so die Überschriften seines letzten Kapitels, aus “dem nicht ausreichend gewürdigten Kaliber seines Gesangs”, einem “äußerst raren Fall von Großartigkeit”, der “nicht angemessenen Würdigung seiner exzellenten Texte”, der “exzeptionellen thematischen Stimmigkeit in seinem Gitarrenstil” – und diese Superlative klingen auch im englischen Original nicht viel sachlicher. Immer wieder zitiert er Loblieder auf andere Größen des Jazz, Ellington, Armstrong beispielsweise, um anschließend zu bemerken, genau dasselbe könne man aber auch über Johnson sagen.
Im Anhang findet sich schließlich noch eine völlig zusammenhangslose Besprechung einer Aufnahme von Sidney Bechet sowie ein Kapitel über die Beziehung von Jazz- und Bluesmusikern zur Bürgerrechtsbewegung, in dem Johnson kaum erwähnt wird, Wenn es dieses Kapitel ist, auf das sich der Untertitel des Buchs, “Music and Civil Rights” bezieht, so ist das zumindest irreführendes Marketing des Verlags. Denn darum geht es im Buch wirklich nur am Rande.
Alles in allem enthält Dean Algers Buch jede Menge wertvoller Information über einen weithin verkannten Künstler, wenn der Autor seinen Lesern auch viel Geduld und Nachsicht abverlangt und man sich über weite Strecken die hilfreiche Hand eines kritischen Lektorats gewünscht hätte, das ihm zu einer klareren Strukturierung seines Text und zum Streichen vieler der Asides geraten hätte und das alles damit besser lesbar gemacht hätte. Algers “labor of love” wird alleine der Fülle seiner Recherchen wegen ein Nachschlagewerk bleiben; für eine nächste Auflage wünscht man ihm und künftigen Lesern eine sorgfältige Überarbeitung.
Wolfram Knauer (Februar 2015)
Livejazz in München
von Christina Maria Bauer
München 2014 (München Verlag)
152 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-7630-4025-4
 Frankfurt war in den 1950er und 1960er Jahren die Jazzhauptstadt Deutschlands; heute gilt das wohl vor allem für Berlin und Köln. Aber die Metropolen dieser Republiken haben nach wie vor eine lebendige Szene und jede für sich eine eigene regionale Jazzidentität. Hamburg klingt anders als Stuttgart, anders als Dresden, anders als Hannover, anders als Dortmund, anders als Leipzig, anders als Darmstadt (!) und eben auch anders als München. Und auch die stilistischen Zuweisungen, die einst regionale Jazzszenen fixieren halfen, gelten nicht mehr. Das wegen seiner Traditionsliebe ehemals als “Freie und Barberstadt” bekannte Hamburg hat heute genauso eine zeitgenössische Jazzszene, in Berlin gibt es neben der Avantgarde auch eine reiche traditionelle Szene, Frankfurt besteht nicht nur aus der Moderne in der Nachfolge Albert Mangelsdorffs, sondern auch aus elektronischen Experimenten, und München ist genauso bunt wie jede andere Stadt dieser Größe.
Frankfurt war in den 1950er und 1960er Jahren die Jazzhauptstadt Deutschlands; heute gilt das wohl vor allem für Berlin und Köln. Aber die Metropolen dieser Republiken haben nach wie vor eine lebendige Szene und jede für sich eine eigene regionale Jazzidentität. Hamburg klingt anders als Stuttgart, anders als Dresden, anders als Hannover, anders als Dortmund, anders als Leipzig, anders als Darmstadt (!) und eben auch anders als München. Und auch die stilistischen Zuweisungen, die einst regionale Jazzszenen fixieren halfen, gelten nicht mehr. Das wegen seiner Traditionsliebe ehemals als “Freie und Barberstadt” bekannte Hamburg hat heute genauso eine zeitgenössische Jazzszene, in Berlin gibt es neben der Avantgarde auch eine reiche traditionelle Szene, Frankfurt besteht nicht nur aus der Moderne in der Nachfolge Albert Mangelsdorffs, sondern auch aus elektronischen Experimenten, und München ist genauso bunt wie jede andere Stadt dieser Größe.
Christina Maria Bauer hat die Vielfalt dieser Münchner Szene zu einer buchlangen Darstellung animiert, die sich vor allem die Spielorte vornimmt, meist intime Clubs, Cafés, Säle, deren Atmosphäre nicht nur im Liveerlebnis rüberkommt, sondern auch in den Fotos, von denen es in ihrem Buch nicht mangelt. Von der Unterfahrt über den Bayerischen Hof, die Jazzbar Vogler über die Waldwirtschaft und den Hirschau-Biergarten bis hin zum Ruffini und Veranstaltungen in der Circus Krone oder der Pasinger Fabrik beschreibt sie die Orte, die Macher und die Musiker, die an ausgewählten Tagen dort auftreten. Den gut lesbaren, an Einträge in einem guten Reiseführer erinnernden Texten folgt eine Zusammenfassung auf Englisch sowie die Kontaktdaten der Clubs.
Was fehlt, wäre vielleicht noch ein Sampler, der Aufnahmen insbesondere Münchner Ensembles enthalten könnte, aber dann soll man genau dafür ja in die Clubs gehen, um zu hören, worum es in diesem Buch geht: nämlich “Livejazz in München”.
Wolfram Knauer (Januar 2015)
Blue Note. The Finest in Jazz Since 1939
von Richard Havers
München 2014 (Sieveking Verlag)
400 Seiten, 78 Euro
ISBN: 978-3-944874-07-4
Talkin’ About Blue Note. Painted Jazz!
von Dietrich Rünger & Rainer Placke
Bad Oeynhausen 2014 (jazzprezzo)
236 Seiten, 2 CD, 75,00 Euro
ISBN: 978-3-9816642-0-1
 Das Plattenlabel Blue Note feierte letztes Jahr seinen 75sten Geburtstag, und gleich zwei Prachtbände feiern mit. Sie haben recht unterschiedliche Ansätze, ergänzen sich dabei aber so glänzend, dass man kaum zu entscheiden vermag, welches den Nerv des Labels am besten trifft, seine Geschichte am überzeugendsten erzählt.
Das Plattenlabel Blue Note feierte letztes Jahr seinen 75sten Geburtstag, und gleich zwei Prachtbände feiern mit. Sie haben recht unterschiedliche Ansätze, ergänzen sich dabei aber so glänzend, dass man kaum zu entscheiden vermag, welches den Nerv des Labels am besten trifft, seine Geschichte am überzeugendsten erzählt.
Richard Havers hatte vor kurzen bereits einen nicht weniger aufwändigen Band über das Label Verve herausgebracht. Sein 400 Seiten starkes Buch nimmt eher den historischen Weg. Havers beginnt mit einem kurzen Kapitel über die Jugend der Firmengründer Alfred Lion und Francis Wolff in ihrer Heimatstadt Berlin, leitet dann recht schnell ins New York der späten 1920er, frühen 1930er Jahre über, das Alfred Lion bereits 1928 zum ersten Mal besuchte, um dann, auf Umwegen – zurück nach Deutschland und dann nach Südamerika – 1936 endgültig in den USA zu landen.
Havers schildert die Umstände der ersten Aufnahmen, die der Jazzfan und Plattensammler Alfred Lion 1939 mit den beiden Pianisten Albert Ammons und Pete Johnson machte, weil er überzeugt war, dass diese Musik ein breiteres Publikum verdiene. Einspielungen mit Frankie Newton und Sidney Bechet folgten. Im Oktober 1939 stieß sein alter Freund Francis Wolff hinzu, der mit dem letzten Schiff kurz nach Kriegsbeginn aus Deutschland ausreisen konnte. Lion musste zwei Jahre mit seinem Geschäft pausieren, weil die amerikanische Musikergewerkschaft zum Streik der Plattenfirmen aufgerufen hatte. Als er 1944 wieder mit der Produktion loslegte, nahm er neben den älteren Namen zum ersten Mal auch jüngere Musiker in sein Programm auf, die eher dem neuen Bebop zuzurechnen waren. Tadd Dameron, Fats Navarro und Thelonious Monk, begründeten den Ruf des Labels als am Puls der Zeit.
Havers erzählt die Geschichte des Labels, beschreibt Veränderungen in der musikalischen Basis, auf der das Geschäft gründete, aber auch Veränderungen in der Aufnahmetechnik oder in der Gestaltung der Platten. Und er beschreibt den Niedergang von Blue Note durch den kommerziellen Erfolg der Rockmusik in den 1960er Jahren und schließlich und den Verkauf des Labels an Liberty Records. Danach führt er seine Leser in die Jetztzeit, berichtet über die diversen Wiederbelebungsversuche und über die immer wieder neuen Stars, die im Idealfall die Experimentierlust des ursprünglichen Blue-Note-Labels weiterleben lassen.
Havers Buch liest sich schnell und flüssig; es enthält jede Menge Einzeldarstellungen bedeutender Schallplatten, die die Musik sowohl in die Geschichte des Labels wie auch in die Jazzgeschichte einzuordnen versuchen. Und es bietet eine Unmenge wunderbarer Fotos, Bilder aus dem Archiv von Francis Wolff vor allem, daneben aber auch historische Aufnahmen aus Berlin und New York, die recht schnell die Atmosphäre der Erzählung nachempfinden lassen. Vereinzelt finden sich schließlich auch Faksimiles aus den Notizbüchern zu einzelnen Plattensitzungen oder ganze Kontaktbögen von Fotonegativen, die die Arbeit des Fotografen Francis Wolff nachvollziehen lassen.
 Das von Dietrich Rünger und Rainer Placke herausgegebene Buch über Blue Note hat in etwa dasselbe Gewicht, aber einen ganz anderen Ansatz. Über die Geschichte des Labels erfährt man in teilweise recht persönlichen Rückblicken von Fachleuten und Mitstreitern, etwa dem Produzenten Michael Cuscuna, der Historikern Theresia Giese, dem Filmemacher Julian Benedikt, dem Jazz-Experten Bert Noglik, und dem Journalisten (und Plattentextschreiber) Ira Gitler.
Das von Dietrich Rünger und Rainer Placke herausgegebene Buch über Blue Note hat in etwa dasselbe Gewicht, aber einen ganz anderen Ansatz. Über die Geschichte des Labels erfährt man in teilweise recht persönlichen Rückblicken von Fachleuten und Mitstreitern, etwa dem Produzenten Michael Cuscuna, der Historikern Theresia Giese, dem Filmemacher Julian Benedikt, dem Jazz-Experten Bert Noglik, und dem Journalisten (und Plattentextschreiber) Ira Gitler.
Neben dem Label wird in diesem Buch aber auch die Kunst des deutschen Malers Dietrich Rünger gefeiert, der sich seit langem von den Platten in seiner Blue-Note-Sammlung zu immer neuen, meist großformatigen Acrylbildern inspirieren lässt. Abbildungen dieser Bilder nehmen jeweils viele der rechten Seiten des Buchs ein, während auf den jeweils gegenüberliegenden Seiten Musiker, Experten, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens über ihre eigenen Blue-Note-Erfahrungen zu den betreffenden Alben berichten, so dass im Konzept des Buchs Persönliches (Rüngers visuelle Interpretation der Musik) mit Persönlichem (Reflexionen) konfrontiert wird.
Zu Wort kommen dabei Musiker wie Joe Lovano, José James, Till Brönner, Nils Landgren, Rolf und Joachim Kühn, Martin Tingvall, Udo Lindenberg oder Esperanza Spalding, Jazzexperten wie Josef Engels, Stefan Gerdes, Hans Hielscher, Karl Lippegaus (aber auch Arndt Weidler und Wolfram Knauer vom Jazzinstitut Darmstadt), Angehörige der “Szene”, also Produzenten, Veranstalter, Macher aller Art wie Siggi Loch, Sedal Sardan, Axel Stinshoff oder Rainer Haarmann, sowie schließlich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die den Jazz nicht nur als heimliche Liebe pflegen, etwa die Schauspieler August Zirner und Joachim Król, der Politiker Hans-Olaf Henkel oder der Journalist Roger Willemsen. Sie alle durften sich einzelne Platten aus dem großen Blue-Note-Katalog aussuchen und darüber berichten, wie diese sie berührt haben; und ihr Spektrum reicht tatsächlich von Sidney Bechet bis zu Cecil Taylor.
Und dann gibt es noch einen Zusatzbonus, der dem Leser die Blue-Note-Gründer direkt vor Ohren führt: zwei CDs, auf denen eine Rundfunkserie zu hören ist, die der Norddeutsche Rundfunk 1964 mit Alfred Lion und Frances Wolff produzierte und in denen die beiden die Geschichte ihrer Firma erzählen und einige der bedeutendsten Aufnahmen vorstellen.
Die Bedeutung des Labels Blue Note mag sich allein an der Tatsache zeigen, dass etwa zur selben Zeit zwei großformatige schwere Bücher erscheinen, die sich dennoch inhaltlich kaum überschneiden. Havers hat die schöneren historischen Fotos; Rünger/Placke zeigen dafür beispielsweise eine Seite aus der Kladde, in der Frances Wolffs Berliner Plattensammlung dokumentiert ist (aus dem Bestand des Jazzinstituts Darmstadt). Havers kann durch seinen narrativen Ansatz tiefer in die Geschichte des Labels eindringen; Rünger/Placke versammeln mit den zahlreichen einzelnen Reflexionen mehr Facetten. Havers’ Buch ist das traditionellere der beiden, und bei Rünger/Placke mag sich der eine oder andere über die kleine und, weil weiß auf schwarz, schwer lesbare Schrift der Gastbeiträge beschweren. Rünger/Placke ist auf der anderen Seite eher ein aus dem Heute auf das Label blickendes Werk, während Havers einzig der Darstellung der Geschichte verhaftet bleibt. Und Rünger/Placke haben natürlich die beiden wunderbaren CDs dabei, auf denen man die Blue-Note-Gründer selbst zu hören bekommt. Keines der Bücher liefert eine wirklich kritische Bestandsaufnahme, beide Bände richten sich vor allem an Fans. Durch die Vielseitigkeit der Aussagen und die Befragung insbesondere auch von Musikern gelingt es Rünger/Placke vielleicht, der Musik etwas näher zu kommen, für die das Label steht. Letzten Endes aber bleibt dem wahren Blue-Note-Fan nichts anderes übrig, als 7,5 cm im Bücherregal freizuräumen und sich gleich beide Bücher zu holen.
Wolfram Knauer (Januar 2015)
Blues Queens. 2013 Blues Calendar.
Rare Vintage Photographs by Martin Feldmann
Attendorn 2014 (Pixelbolide)
15,90 plus Versand (Wandkalender)
9,50 Euro plus Versand (Notizkalender)
23,95 Euro plus Versand (beide Kalender)
Zu bestellen über www.blueskalender.de
 In den 1970er und 1980er Jahren reiste der Frankfurter Journalist und Fotograf Martin Feldmann regelmäßig durch die USA, besuchte dort Jazz- und Bluesclubs, fotografierte aber auch auf den wichtigsten Bluesfestivals in Europa. Seine Berichte erschienen in der Frankfurter Rundschau sowie in diversen Fachzeitschriften. Zum wiederholten Mal hat Feldmann jetzt eine Auswahl seiner Bilder getroffen, um sie zu einem stimmungsvollen Wand- oder Notizkalender zusammenzustellen. Das Thema des Kalenders 2015 sind die “Blues Queens”, die Blues-Frauen, Sängerinnen und Instrumentalistinnen, die dieses Genre genauso prägten wie ihre männlichen Kollegen. Neben den zwölf Monats-Bildern von Lady B.J. Crosby, Koko Taylor, Honey Piazza, Big Time Sarah, Lady Bianca Thornton, Princess Patience Burton, Sylvia Embry, Carrie Smith, Rosay Wortham, Margie Evans, Tina Mayfield, Angela Brown finden sich im Vorwort des Kalenders noch eindringliche Bilder von Sippie Wallace, Katie Webster und Maxine Howard, Dottie Ivory sowie Beverly Stovall. Feldmann begleitet all diese Bilder mit kurzen Würdigungen der Künstlerinnen. Die Kalender sind direkt online zu beziehen.
In den 1970er und 1980er Jahren reiste der Frankfurter Journalist und Fotograf Martin Feldmann regelmäßig durch die USA, besuchte dort Jazz- und Bluesclubs, fotografierte aber auch auf den wichtigsten Bluesfestivals in Europa. Seine Berichte erschienen in der Frankfurter Rundschau sowie in diversen Fachzeitschriften. Zum wiederholten Mal hat Feldmann jetzt eine Auswahl seiner Bilder getroffen, um sie zu einem stimmungsvollen Wand- oder Notizkalender zusammenzustellen. Das Thema des Kalenders 2015 sind die “Blues Queens”, die Blues-Frauen, Sängerinnen und Instrumentalistinnen, die dieses Genre genauso prägten wie ihre männlichen Kollegen. Neben den zwölf Monats-Bildern von Lady B.J. Crosby, Koko Taylor, Honey Piazza, Big Time Sarah, Lady Bianca Thornton, Princess Patience Burton, Sylvia Embry, Carrie Smith, Rosay Wortham, Margie Evans, Tina Mayfield, Angela Brown finden sich im Vorwort des Kalenders noch eindringliche Bilder von Sippie Wallace, Katie Webster und Maxine Howard, Dottie Ivory sowie Beverly Stovall. Feldmann begleitet all diese Bilder mit kurzen Würdigungen der Künstlerinnen. Die Kalender sind direkt online zu beziehen.
Wolfram Knauer (Oktober 2014)
Jazz and Culture in a Global Age
von Stuart Nicholson
Boston 2014 (Northeastern University Press)
294 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-55553-844-6
 Stuart Nicholson ist als streitbarer Geist bekannt. In seinem letzten Buch, “Is Jazz Dead? (Or Has It Moved to a New Address?)” betrachtete er den Stand des aktuellen Jazz und befand, dass die alternativen Jazzszenen in Europa dem Status Quo des Jazz in den USA bisweilen den Rang abliefen. Sein neues Buch hat einen noch weiter gefassten Titel, beschäftigt sich nicht nur mit Jazz, sondern gleich mit “Jazz und Kultur in einem globalen Zeitalter” und knüpft doch dort an, wo sein voriges Buch aufgehört hatte.
Stuart Nicholson ist als streitbarer Geist bekannt. In seinem letzten Buch, “Is Jazz Dead? (Or Has It Moved to a New Address?)” betrachtete er den Stand des aktuellen Jazz und befand, dass die alternativen Jazzszenen in Europa dem Status Quo des Jazz in den USA bisweilen den Rang abliefen. Sein neues Buch hat einen noch weiter gefassten Titel, beschäftigt sich nicht nur mit Jazz, sondern gleich mit “Jazz und Kultur in einem globalen Zeitalter” und knüpft doch dort an, wo sein voriges Buch aufgehört hatte.
Wie also, lautet die Grundfrage seines Buchs, ist die Position des Jazz im Zeitalter der Globalisierung, und zwar an jedem einzelnen der verschiedenen Orte, die diese Globalisierung ja erst ausmachen und die jeder für sich eine andere Sicht auf die Sache an und für sich besitzen als der Ursprungsort, Amerika?
In seinem ersten Kapitel stellt Nicholson fest, dass der Jazz im Großen und Ganzen den wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg Amerikas im 20sten Jahrhundert widerspiegele. Zugleich habe sich er sich aber auch immer weiter von der populären Musik entfernt, und dabei erlebt, dass innerhalb dieser Entwicklung einzelne regionale oder nationale Szenen gar nicht mehr auf Amerika als Maß aller Dinge schauten. Die Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre habe dazu geführt, dass junge Musiker in den USA durch ihre Kunst kaum mehr genug zum Leben verdienen könnten. Selbst diejenigen, die halbwegs gut seien, würden bis zu 75 Prozent ihres Jahreseinkommens durch Tourneen in Europa erbringen. Gewiss, New York besitze immer noch eine der lebendigsten Jazzszenen der Welt; eine nationale amerikanische Jazzszene sei allerdings so gut wie nicht existent. In den USA baue man jetzt deshalb auf “education”, auf verschiedene Konzepte des “audience development”. Auch Pädagogik aber könne gegen den Erfolg des Konsums nicht ankämpfen. Jazz sei nun mal im schlechten wie im guten Sinne mit dem Klischee des Elitären behaftet. Die Diskurse, die in den 1990er Jahren um die Gestaltungshoheit des Jazz aufkamen, seien tatsächlich Diskurse um kulturelle Identität gewesen. In der heutigen Zeit müsse man mit einer durch den Konsum beförderten kürzeren Aufmerksamkeitsspanne der Hörer leben. Und da käme dem Jazz dann vor allem eine Erkenntnis zupass, die viele Musiker vergessen hätten, dass nämlich die Melodie wichtiger sei als Patterns, dass man seine Hörer durchs Geschichtenerzählen erreiche, dass neue Kompositionen den Zuhörer bewegen müssten. Der Jazz, stellt Nicholson fest, dürfe keine rein intellektuelle Übung bleiben, er müsse die Herzen der Zuhörer erreichen. Dafür müsse er sich seinen eigenen Platz in einer ihm eigentlich feindlich gegenüberstehenden Medienlandschaft zurückerobern. Jazz mag nicht länger populär sein, schreibt er, doch müsse er unbedingt für diejenigen relevant bleiben, die ihm folgen wollen.
Im zweiten Kapitel beschreibt Nicholson den internationalen Erfolg des Jazz seit seinen Anfangsjahren. Er stellt fest, dass Jazz zwar unter Musikern immer eine lingua franca gewesen sein mag, die Musik von Hörern verschiedener Länder und Kulturkreise allerdings durchaus unterschiedlich wahrgenommen werde. Musik sei nun mal eine Form von Kommunikation, und Urteile über Musik unterlägen deshalb immer gesellschaftlich bedingten Regeln, unterschiedlichen Konnotationen und Erwartungen, und damit, wie er an Beispielen aus England und Polen festmacht, eines reichlich unterschiedlichen Erlebens derselben Musik.
Im dritten Kapitel befasst sich Nicholson mit der Wahrnehmung von Jazz als Zeichen der “Moderne” im frühen 20sten Jahrhundert. Jazz habe sich immer in zwei Bedeutungsfeldern befunden, sei zum einen aus einer Kultur des Konsums heraus entstanden, zum anderen aber mehr und mehr mit unterschiedlichsten Diskursen um “Freiheit” assoziiert worden. Amerika habe Kultur bald als weichen Faktor erkannt, der nach innen wie nach außen amerikanische Identität vermitteln könne. Hollywood sei das erste erfolgreiche Beispiel dieser Erkenntnis gewesen, auch die Musik aber habe recht bald ihren Platz in diesem kulturpolitischen Geflecht gefunden. Nicholson dekliniert Beispiele durch, von James Reese Europe über Glenn Miller bis zu den State Department-Tourneen seit den 1950er Jahren. Aus welchen Gründen auch immer der Staat sich des Jazz bediene, habe das in der Regel zu einem Geben und Nehmen zwischen staatlicher Subvention und wirtschaftlicher Vermarktung geführt. Als konkretes Beispiel führt Nicholson Norwegen an, wo es durch staatliche Förderung tatsächlich gelungen sei, eine internationale Nachfrage zu schaffen. All solche internationalen Vermarktungsmechanismen lebten vom “Halo Effect”, bei dem der Ruf großer Musiker auf der einen sowie Werte wie Moderne, Zukunftsorientiertheit und Cringe-Aspekte auf der anderen Seite unbewusst auf das ganze Genre übertragen werden (und sich dabei als hervorragende Marketinginstrumente erweisen).
Im letzten Kapitel betrachtet Nicholson eine andere globalisierte Thematik, die nämlich der “klassischen” Moderne. Der Jazz, erklärt er, habe bereits im frühen 20sten Jahrhundert eine entscheidende Rolle für die Künstler der Moderne gespielt, Maler, Bildhauer, Schriftsteller, Komponisten und Filmemacher. In den USA habe die Wahrnehmung des Jazz als einer modernen Kunstform zur selben Zeit auch gesellschaftliche und rassistische Untertöne besessen. Nicholson hebt Paul Whitemans Rolle bei der Entwicklung des Jazz zu einer künstlerischen Aussage der Moderne hervor, dem etliche spätere weiße wie schwarze Musiker verpflichtet gewesen seien, nicht zuletzt auch Duke Ellington. Er betrachtet konkrete Kompositionen, von den durch Whiteman beauftragten Suiten über Ellington, James P. Johnson, Raymond Scott oder Reginald Foresythe bis zu Arrangeuren der 1940er Jahre, die mit einem weniger auf populären Erfolg ausgerichteten Ansatz arbeiteten, um schließlich festzustellen, dass in den USA der Jazz und die Moderne sich erst näher kommen konnten, als Charlie Parker und die jungen Bebopper die unterschiedlichen Ansätze in Komposition und Improvisation angleichen konnten. Über Brubeck und Tristano geht es noch kurz zu Wynton Marsalis’ “Majesty of the Blues” und Marsalis Ansicht, Jazz sei insgesamt eine Musik der Moderne.
Tja, und dann ist da noch Kapitel 4, überschrieben “The Globalization of Jazz”, das viele interessante Denkansätze enthält und trotzdem die problematischste Lektüre des Buchs darstellt. Die Finanzkrise 2007/2008, beginnt Nicholson, sei ein hervorragendes Beispiel dafür, wie heutzutage alles mit allem zusammenhänge. Der Terminus “Globalisierung” stünde dabei durchaus für unterschiedliche Aspekte: für freie Marktwirtschaft etwa, für westliche Dominanz (Amerikanisierung), aber auch für die Hoffnung auf eine globale Community. Die am wenigsten erwartete Nebenwirkung der Globalisierung sei der wachsende Nationalismus gewesen. Nicholson diskutiert unterschiedliche Modelle der Auswirkung von Globalisierung auf die Kultur, schaut, wie sich die kommerzielle Popmusik in diese Modelle einpassen lässt und blickt dann auf den Jazz und sein inzwischen gespaltenes Verhältnis zu amerikanischer Authentizität. Er stellt für den Jazz eine Hybridisierung fest, in der globalisierte kulturelle Praktiken lokal rezipiert werden und dabei neue, in die lokalen Kontexte eingepasste Bedeutungen erlangten. Für den Jazz betont Nicholson insbesondere, dass im Zuge dieser gern als Glocalization bezeichneten Entwicklung die Idee von “Eigentum” an einer kulturellen Tradition immer unwichtiger wurde, weil “Ursprung” durch lokale Aneignung inklusive hybrider Methoden, also dem gleichzeitigen Verweis auf Traditionen des Jazz und Traditionen der eigenen kulturellen Herkunft, wettgemacht wurde.
Einem Exkurs in die Erfahrungen mit Nationalismus in der klassischen Musikwelt folgt Nicholson mit dem Unterkapitel “Jazz und Relativismus”. Relativismus, erklärt er, ginge davon aus, dass es eine objektive Wahrheit nicht gäbe, weil immer verschiedene Sichtweisen vorherrschten, die alle ihre Berechtigung hätten. Die “Doktrin des kulturellen Relativismus” habe, wie Nicholson schreibt, dazu geführt, dass Wissenschaftler, die dem Relativismus anhingen, historische Fakten zugunsten unterschiedlicher Sichtweisen anzweifelten. Insbesondere in den New Jazz Studies, einem interdisziplinären Forschungsansatz, für den etwa der amerikanische Wissenschaftler Krin Gabbard oder der Brite Tony Whyton stehen, habe die scheinbare Erweiterung bisheriger Sichtweisen um neue Perspektiven, die außerhalb der formalistischen Musikwissenschaft liegen, für reichhaltige Erkenntnisse sorgen sollen. Tatsächlich allerdings, findet Nicholson, habe eine solche Sicht auf den Jazz mit Ungenauigkeiten, historischen genauso wie Denkfehlern gearbeitet und damit die Geschichte verfälscht. Er stellt Paul Gilroys Theorien zum Black Atlantic (sehr verkürzt) als Gegenmodell zum Weltverständnis aus der Sicht von Nationalstaaten vor, und betont, Gilroys Thesen läge zumindest Whytons Modell der New Jazz Studies und seiner Sicht des Jazz als einer transnationalen Musik zugrunde. Die New Jazz Studies plädierten dafür, schreibt Nicholson, dass man im Jazz nicht von nationalen Kulturen sprechen solle, weil, frei nach Gilroy, die Diaspora, also das Modell transnationaler Entwicklungen größere Bedeutung habe als der Druck zu nationaler Einmütigkeit.
Und dann holt Nicholson aus: Es sei doch nachweisbar falsch, dass nationale Charaktere keinen Einfluss auf die Musik hätten. Man müsse doch nur auf den Einfluss von Sprachen auf Rhythmik oder Melodik schauen. Und auch im Jazz gäbe es doch unzählige spezifische Codes, die Jazzmusiker benutzten und die klar ihre kulturelle Herkunft markierten. Whyton würde etwa die Idee eines nordischen Tons im Jazz herunterspielen und als bloße Marketingstrategie interpretieren, an der eben auch Musiker beteiligt seien. Dabei würde er völlig außer Acht lassen, dass es bereits lange Forschungen zum Phänomen des nordischen Tons gäbe, die zwar im Bereich der komponierten Musik angestellt wurden, sich aber ohne weiteres auch auf den Jazz übertragen ließen. Gerade der norwegische oder schwedische Jazz sei doch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie lokale, regionale, nationale Kultur den Jazz hin zu einem eigenständigen Idiom beeinflussen könne.
Nicholsons Scharmützel mit den New Jazz Studies sind für den Außenseiter etwas – nun: vielleicht ja nur britisch. Paul Gilroys Thesen seien schon lange widerlegt. Krin Gabbards Buch würde vor Fehlern nur so strotzen, und Tony Whyton würde sich nach wie vor fast schon ideologisch auf Gilroy beziehen. Die Wirklichkeit sei ihnen wohl, zitiert er Richard Dawkins’ Postmodernismus-Kritik, zu uncool. Nicht nur, dass Nicholsons Einengung der Diskussion auf Gabbard und vor allem Whyton den New Jazz Studies nicht gerecht wird, die viel weiter greifen und weit mehr Autoren umfassen, als Nicholson hier benennt, tatsächlich ist sein eigener Ansatz in diesem wie auch in seinem früheren Buch ja einer, der dem interdisziplinären Anspruch der New Jazz Studies durchaus entspricht. Nur gehört zu den New Jazz Studies eben auch das Hinterfragen der eigenen Meinung, was Nicholson, der im britischen Jazzwise Magazine eine Kolumne mit dem augenzwinkernden Titel “Putting the World to Rights” hat, offenbar nicht ganz leicht fällt. Seine Beispiele für Glocalization im Jazz sind mehr als hilfreich, viele seiner Denkansätze sind diskutabel, doch die Spiegelfechterei mit Gegnern, denen er letzten Endes auch ein wenig das Wort auf der Seite herumdreht, wäre nicht nur nicht nötig, liest sich auch ein wenig beckmesserisch.
Wie schon sein früheres Buch, so hat also auch “Jazz and Culture in a Global Age” etliche wertvolle Ansätze. Die fünf Kapitel stehen jedes für sich, wobei die ersten vier klar aufeinander bezogen sind, während das letzte sich ein wenig unglücklich abseits der früheren Argumente wiederfindet, obwohl die Ausführungen über unterschiedliche Auffassungen von Moderne durchaus in Nicholsons Argumentation gepasst hätten. Die Hauptthese des Autors ist jene, dass der Jazz als eine ur-amerikanische Musik entstanden sei, die zu Zeiten nationalstaatlicher Identität sowohl nach innen wie auch nach außen identitätsstiftende Wirkung besaß. Jazz konnte auf der einen Seite als amerikanischer Beitrag zur Moderne rezipiert werden, wie es vor allem in Europa geschah; er konnte aber auch als Abbild einer multi-ethnischen Gesellschaft in einem durch und durch demokratisch verfassten System gedeutet werden, wie es insbesondere die amerikanische Politik in den Zeiten des Kalten Kriegs tat. Nicht zuletzt war Jazz auch ein Werkzeug der amerikanischen Musikindustrie, die von Anfang an darauf ausgerichtet war, über die eigenen Grenzen hinaus zu agieren, musikalische Werte weltweit zu etablieren, um damit im selben Radius ihren kommerziellen Profit einfahren zu können. So war der Jazz quasi Teil einer künstlerischen Globalisierungsstrategie, die wirtschaftlich genauso wie politisch gewollt war, die der Musik im Effekt aber ihre Position als identitätsstiftende nationalstaatliche Kennziffer nahm. Hier setzt Nicholsons Argument der Glocalization ein, das beobachtet, dass eine Musik, die so sozial und kommunikativ ausgerichtet ist wie der Jazz, einer Verortung in der Community bedarf, dass man nämlich Kreativität nicht so gern nur konsumiert, sondern darum wissen möchte, dass sie im persönlichen Umfeld möglich ist. Glocalization bezeichnet nach dieser Interpretation die Balance zwischen dem Wissen um die Herkunft der kulturellen Tradition des Jazz und der Erfahrung, dass die spannendsten Momente in dieser Musik dort geschehen, wo Musiker oder Musikerinnen sich ihrer eigenen Herkunft besinnen. Der Jazz unserer Tage wird von Künstlern gemacht, die sich ihrer Position sowohl im Kontinuum der Jazz- wie auch der Musikgeschichte bewusst sind, die ihre sozialen und kulturellen Erfahrungen übereinanderlegen, um aus der Authentizität ihrer Herkunft die Sprache des Jazz voranzutreiben.
Nicholsons Buch nähert sich dieser Erkenntnis mit dem Anspruch, die These der Glocalization, der Verortung kultureller Entwicklung in der internationalen Community des Jazz einerseits und der regionalen Community des eigenen Lebens der Musiker andererseits, tauge als generelles Erklärungsmodell für vieles, was im Jazz unserer Tage geschieht. Vor allem erkläre sie die unterschiedlichen Richtungen, die die Entwicklung des Jazz in den letzten Jahrzehnten in Europa und den USA genommen habe.
So ist “Jazz and Culture in a Global Age”, ganz wie der Klappentext es ankündigt, durchaus ein Denkanstöße gebendes und zugleich klar Stellung beziehendes Buch geworden. Dieser Rezensent hätte sich statt des etwas abseits stehenden Moderne-Schlusskapitels eine knappe und verbindende Zusammenfassung der vorhergehenden Argumente gewünscht. Nicholsons Beobachtungen mögen nicht überall stimmig erscheinen, einige der Debatten die er eröffnet, wirken unnötig, insgesamt aber regt er seine Leser ganz gewiss zum Weiterdiskutieren an.
Wolfram Knauer (Dezember 2014)
Warum Jazz? 111 gute Gründe
von Kevin Whitehead
Stuttgart 2014 (Reclam)
209 Seiten, 9,95 Euro
ISBN: 978-3-15-020359-0
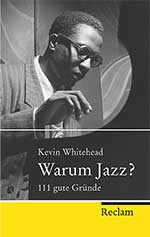 Warum Jazz? Das ist tatsächlich eine Frage, die diejenigen, die sich mit Jazz befassen – ob beruflich oder in ihrer Freizeit – immer wieder zu hören bekommen. Warum ausgerechnet Jazz? Was ist denn so schön an dieser Musik, die kaum mitsingbar ist, die manchmal zu altmodisch und dann wieder zu komplex oder avantgardistisch klingt. Warum eine Musik, die vom Hörer irgendwie Mitarbeit fordert?
Warum Jazz? Das ist tatsächlich eine Frage, die diejenigen, die sich mit Jazz befassen – ob beruflich oder in ihrer Freizeit – immer wieder zu hören bekommen. Warum ausgerechnet Jazz? Was ist denn so schön an dieser Musik, die kaum mitsingbar ist, die manchmal zu altmodisch und dann wieder zu komplex oder avantgardistisch klingt. Warum eine Musik, die vom Hörer irgendwie Mitarbeit fordert?
Kevin Whitehead findet 111 gute Gründe, aber mehr noch, er gibt 111 Antworten auf durchaus ernst gemeinte Fragen. Sein Buch “Warum Jazz?” wirkt damit auf den ersten Blick wie ein Vademecum für den Anfänger, der sich dem Jazz nähern möchte, sich aber unsicher fühlt, weil er nicht genau weiß, worauf er denn zu achten habe bei dieser Musikrichtung, bei der alle Konzertbesucher Experten zu sein scheinen. “Muss ich die Geschichte des Jazz kennen, um ihn schätzen zu können?” lautet gleich die zweite Frage, und Whiteheads korrekte Antwort ist: Nein, aber wie bei so vielem im Leben kann Erfahrung einem noch mehr Genuss bieten. “Erfahrene Hörer”, erklärt er also, “haben immer wieder Aha-Erlebnisse, das heißt, es gibt Momente, in denen sie erkennen, dass ein frischer oder neuer Klang auf alten Elementen gründet.” Vor allem kommt es auf Neugier an bei dieser Musik, auf die Fähigkeit, sich auf Überraschungen einlassen zu wollen. Dann erlebt man den Jazz vielleicht nicht länger als “altmodisch”, sondern als eine aktuelle Musik, eine musikalische Herangehensweise, die sich aus den Standards der Vergangenheit genauso nährt wie aus Einflüssen der Gegenwart.
Wie oft in Konversationen führen die Fragen auch Whitehead schnell dazu auszuholen. “Was ist Jazz?”, beginnt das Kapitel über “Grundlegendes”, in dem der Autor Improvisation und swing genauso abhandelt wie den Einfluss des Blues, das Repertoire des Jazz, Virtuosität oder die Bedeutung und Wirkung musikalischer Zitate.
“Konnte es nur in Amerika zur Vermischung afrikanischer und europäischer Elemente kommen?”, lautet eine der Fragen, die sein historisches Kapitel über den frühen Jazz einleitet, und seine Antwort versucht hier wie anderswo mit Legenden aufzuräumen. Die Kulturen, schreibt er, hätten sich bereits seit Jahrtausenden miteinander vermischt. Die Entstehung des Jazz im New Orleans des frühen 20sten Jahrhunderts sei höchstens ein Kulminationspunkt des Ganzen gewesen. Er erklärt den bandaufbau früher Jazzkapellen, beschreibt die Bedeutung von Musikern wie Buddy Bolden, Louis Armstrong oder Bix Beiderbecke und erwähnt die Rassentrennung in den USA, die dazu führte, dass schwarze und weiße Musiker nur selten miteinander spielten. Er betrachtet die Entwicklung des Jazzensembles hin zur Bigband, diskutiert die Bedeutung Duke Ellingtons und erklärt, warum der Jazz in den 1930er Jahren eine Art Popmusik war. Benny Goodman, Kansas City, Billie Holiday; die Fragen und Themen wechseln sich ab, und mit Django Reinhardt wird auch der Jazz in Europa kurz gestreift.
Whiteheads Fragestunde zum modernen Jazz beginnt sinnigerweise mit dem Dixieland-Revival der 1940er Jahre, dann erklärt er die harmonischen, rhythmischen und ästhetischen Neuerungen des Bebop, den Einfluss afro-kubanischer Elemente, aber auch die Frage, warum Jazzmusiker so gerne Aufnahmen mit Streichern machen. Cool Jazz, Hard Bop, Miles Davis, Bill Evans, Bürgerrechtsbewegung und Tourneen für das State-Department – viele der Fragen sind in diesen historischen Kapiteln so allgemein gehalten, dass sie Whitehead einfach nur zu knappen Zusammenfassungen von Jazzgeschichte animieren. Die Frage-Antwort-Struktur des Buchs erlaubt es ihm dabei allerdings, den Erzählfluss zu unterbrechen und das nächste Kapitel mit Ausrichtung auf die neue Frage jeweils aus einer anderen Perspektive zu beantworten.
“Was ist Avantgarde-Jazz”, beginnt eine weitere historische Abteilung, in der er bald über verschiedene Aspekte des Free Jazz, der Fusion, der 1970er und 1980er Jahre reflektiert. Und im letzten Kapitel nähert er sich sowohl Wynton Marsalis und den Young Lions als auch der aktuellen Jazzausbildung an Hochschulen. Steve Colemans Konzept der “M-Base” wird erklärt, aber auch die Conduction, also die Improvisationsdirigate etwa von Butch Morris. “Sind alle großen Jazzmusiker in New York zu Hause?” lautet eine Frage, und Whiteheads Antwort ist: Sicher nicht, aber vor allem in New York bekommen sie die größere Beachtung.
Die Frage der Fragen steht fast am Schluss des Buches: “Gibt es überhaupt noch eine Jazz-Avantgarde?” heißt sie, und Whitehead stellt klar, dass vieles, was unter diesem Label vermarktet wird, inzwischen eigentlich selbst als historisch bezeichnet werden müsste, weil die Parameter, nach denen sich die musikalische Ästhetik etwa freier Improvisationsmusik oder anderer sogenannter “cutting-edge”-Programme richtet, bereits vor Jahrzehnten festgelegt wurden.
“Warum Jazz? 111 gute Gründe” ersetzt keine Jazzgeschichte, aber in der häppchenartigen Weise, in der Kevin Whitehead sowohl allgemeine wie auch recht spezielle Fragen zum Jazz beantwortet, erfährt man nicht nur als Laie jede Menge über den Jazz, sondern wird auch als Kenner auf Facetten gestoßen, die einem Teile der Jazzgeschichte in neuem Licht erscheinen lassen. Dass der Autor die Entwicklungen in Europa bis auf wenige Seiten weitestgehend ausklammert, ist wohl vor allem der Tatsache zu verdanken, dass er sein Buch ursprünglich für ein amerikanisches Publikum geschrieben hat. Eine Erklärung hierzu – im Vorwort oder zumindest im Rahmen einer 112. Frage wäre ganz sinnvoll gewesen, zumal Whitehead selbst lange Zeit in Europa lebte und einen guten Einblick in die Entwicklungen hierzulande besitzt. Aber vielleicht ist es nicht die schlechteste Schlussfolgerung, wenn man sich nach 111 Fragen und Antworten dazu gedrängt fühlt, noch weitere zu stellen…
Wolfram Knauer (Juli 2014)
Jazz Me Blues. The Autobiography of Chris Barber
von Chris Barber (mit Alyn Shipton)
Sheffield 2014 (equinox)
172 Seiten, 19,999 Britische Pfund
ISBN: 978-1-84553-088-4
 Chris Barber hat auf seine eigene Art Jazzgeschichte geschrieben. Er hat den britischen Trad-Jazz, der lange Zeit recht puristisch auf New Orleans, auf kollektives Zusammenspiel, auf die Stilhaltung des Jazz der 1920er Jahre fokussiert war, in eine Gegenwart geholt, in der Skiffle, Blues und Rock ‘n’ Roll eine nicht minder wichtige Rolle spielten. Er entwickelte einen Stil, der auf der einen Seite die archaischen Seiten des frühen Jazz auf europäisches Ebenmaß glättete, verlor auf der anderen Seite nie den Respekt vor den Ursprüngen des Jazz aus den Augen und war sich durchaus auch der Entwicklungen dieser, “seiner” Musik bewusst, dessen Fans Barbers eigenen musikalischen Offenheit vielfach wohl nicht gefolgt wären.
Chris Barber hat auf seine eigene Art Jazzgeschichte geschrieben. Er hat den britischen Trad-Jazz, der lange Zeit recht puristisch auf New Orleans, auf kollektives Zusammenspiel, auf die Stilhaltung des Jazz der 1920er Jahre fokussiert war, in eine Gegenwart geholt, in der Skiffle, Blues und Rock ‘n’ Roll eine nicht minder wichtige Rolle spielten. Er entwickelte einen Stil, der auf der einen Seite die archaischen Seiten des frühen Jazz auf europäisches Ebenmaß glättete, verlor auf der anderen Seite nie den Respekt vor den Ursprüngen des Jazz aus den Augen und war sich durchaus auch der Entwicklungen dieser, “seiner” Musik bewusst, dessen Fans Barbers eigenen musikalischen Offenheit vielfach wohl nicht gefolgt wären.
In Zusammenarbeit mit Alyn Shipton hat Barber jetzt seine Autobiographie vorgelegt. In ihr erzählt er von seiner Kindheit in Londons Vorstädten, seiner Sozialisation in einem bewusst sozialistischen Haushalt und seiner ersten Begegnung mit dem Jazz durch den BBC. Er erhielt Geigenunterricht, kaufte sich seine ersten Jazzplatten, Louis Armstrong, Bessie Smith, Jelly Roll Morton, Duke Ellington, aber auch Blues von Sleepy John Estes oder Cow Cow Davenport. Nach dem Krieg zog seine Familie nach London, wo Barber Humphrey Lytteltons Band hörte und sich entschied, dass er Posaune spielen wollte. Er begann ein Mathematikstudium, dass er dann zugunsten der Musik aufgab. Er spielte mit verschiedenen Londoner Bands und erzählt, wie er und seine Musikfreunde verschiedenen Idolen des frühen Jazz anhingen, sie sich gegenseitig vorstellten und dabei immer tiefer in die Musik eindrangen.
Barber gründete eine Band zusammen mit dem Klarinettisten Monty Sunshine, der bald auch der Kornettist Ken Colyer und der Banjospieler und Gitarrist Lonnie Donegan angehörten und die 1953 und 1954, nachdem Colyer von einer längeren Reise nach New Orleans zurückgekehrt war, unter dem Namen Ken Colyer’s Jazzmen ihre ersten Aufnahmen vorlegte. Sie spielten Jazz ihrer Idole, daneben aber auch Trionummern mit Gesang und Banjo (Donegan), Gitarre (Colyer) und Bass (Barber), eine Besetzung, die die englische Tradition der Skiffle Musik begründete. Pat Halcox ersetzte Colyer, Donegan machte eine Solokarriere, Sunshine wurde Anfang der 1960er Jahre durch Ian Wheeler ersetzt, außerdem kam die die irische Sängerin Ottilie Patterson hinzu. Barbers Band aber war ab etwa 1953 ein Erfolgsmodell, tourte regelmäßig durch ganz Europa und beeinflusste mit ihrer Art eines weniger archaischen Dixieland eine ganze Generation von Jazzmusikern insbesondere in Skandinavien und Deutschland (wo nicht ganz ohne Grund die Hansestadt Hamburg unter traditionellen Jazzfreunden bald nur noch “Freie und Barberstadt Hamburg” hieß).
“Petite Fleur”, aufgenommen 1959, wurde ein Hit selbst in den USA, und Barber begründet die Tatsache, dass ihre Aufnahme sich besser verkaufte als das Original von Sidney Bechet mit der Tatsache, dass Monty Sunshine das Stück von einem Plattenspieler abgehört habe, der ein wenig zu schnell lief und es daher einen Halbton höher spielte als Bechet, was bestimmten Harmoniewechseln im Stück besonders gut getan hätte. In der Folge tourte Barber 1960 durch die Vereinigten Staaten, hörte jede Menge Jazz und Blues, traf auf traditionelle Kollegen, hörte aber auch die Musik der Zeit, etwa beim Monterey Jazz Festival, wo seine Band am selben Abend auftrat wie Ben Webster, Coleman Hawkins, J.J. Johnson und Ornette Coleman.
Zu seine großen Tourneen lud Barber sich immer amerikanische Stars ein, angefangen bei Bluesgrößen wie Sister Rosetta Tharpe, Sonny Terry, Brownie McGhee, Jimmy Witherspoon über Vertreter des klassischen Jazz wie Ed Hall, Albert Nicholas, Musiker des swingenden Mainstream wie Ray Nance oder Wild Bill Davis, R ‘n’ B-Musiker wie Louis Jordan, moderne Kollegen wie Joe Harriott oder John Lewis oder Musiker aus dem Poplager wie Van Morrison oder Paul McCartney.
Vielleicht ist es der Bescheidenheit Barbers zu verdanken, die ihn so liebenswert und unter Kollegen unterschiedlichster Stilrichtungen so beliebt gemacht hat, dass seine Autobiographie nicht selbst-erforschender ist, nicht weiter in die Tiefe dringt. Er nennt die Namen, viele Sessions, etliche Anekdoten. Über ihn selbst selbst aber erfahren wir leider recht wenig, auch seine musikalische Ästhetik scheint eher zwischen den Zeilen durch. Und so ist das Buch vor allem eine in Prosa gefasste Chronologie von Ereignissen, Plattenaufnahmen, Konzerten, wechselnden Besetzungen, mit dazwischen gestreuten, selbsterlebten oder von Kollegen gehörten Anekdoten. “Jazz Me Blues” ist damit ein stellenweise etwas namenslastiges, nicht überall flüssig zu lesendes Buch, das dennoch wichtige Facetten einer Spielart des europäischen Jazz beleuchtet. Und vielleicht ist es ja wirklich anderen überlassen, das alles etwas kritischer und mit Bezug auf die gesellschaftlichen wie musikalischen Veränderungen der Zeit, die Barber ja selbst mit geprägt hat, zu beschreiben.
Wolfram Knauer (August 2014)
Chet Baker. The Missing Years. A Memoir by Artt Frank
von Artt Frank
Charleston/SC 2014 (BooksEndependant)
215 Seiten, 19,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-9887687-4-1
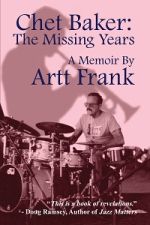 Artt Frank ist ein eher unbekannter Musiker des Jazz. In Tom Lords Diskographie sind gerade mal vier Sessions verzeichnet, die Frank ab 1997 als Schlagzeuger tätigte. Sein eigener “claim to fame” aber reicht zurück bis in die Mitt-1950er Jahre, als er zum ersten Mal Chet Baker im Bostoner Storyville Jazzclub hörte. Sie freundeten sich an, naja, sie sprachen anfangs des öfteren miteinander, und wann immer Frank in der Gegend war, in der Baker auftrat, stellte er sicher, dass er beim Konzert vorbeischaute. Ende der 1960er Jahre aber, als Baker nicht weit entfernt von Frank wohnte, der in Los Angeles als Maler arbeitete, wurde die Freundschaft enger, sie trafen sich immer wieder, und der Trompeter vertraute Frank viel Persönliches an, über seine Familie, über seine Drogensucht, über künstlerische und geschäftliche Entscheidungen.
Artt Frank ist ein eher unbekannter Musiker des Jazz. In Tom Lords Diskographie sind gerade mal vier Sessions verzeichnet, die Frank ab 1997 als Schlagzeuger tätigte. Sein eigener “claim to fame” aber reicht zurück bis in die Mitt-1950er Jahre, als er zum ersten Mal Chet Baker im Bostoner Storyville Jazzclub hörte. Sie freundeten sich an, naja, sie sprachen anfangs des öfteren miteinander, und wann immer Frank in der Gegend war, in der Baker auftrat, stellte er sicher, dass er beim Konzert vorbeischaute. Ende der 1960er Jahre aber, als Baker nicht weit entfernt von Frank wohnte, der in Los Angeles als Maler arbeitete, wurde die Freundschaft enger, sie trafen sich immer wieder, und der Trompeter vertraute Frank viel Persönliches an, über seine Familie, über seine Drogensucht, über künstlerische und geschäftliche Entscheidungen.
Franks Memoiren bilden diese Gespräche mit Baker ungemein lebendig erzählt ab, zum Teil mit erinnerten wortwörtlichen Zitaten. Ein wenig literarisch mutet das zum Teil an und man fragt sich, wie sehr man der Erinnerung des Autors trauen darf. Aber dann ist Geschichte nun mal immer die Sammlung von Erinnerungen, und Franks Erinnerung an Baker ist sicher weitaus tiefer als die selbst der meisten Biographen des Trompeters.
Mit dem Wissen also, dass man weder eine Biographie noch eine fundierte historische Studie vor sich hat, lässt sich aus Franks Buch eine Menge über Bakers Persönlichkeit herauslesen. Ein zweiter Band ist geplant.
Wolfram Knauer (August 2014)
Free Jazz and Improvisation on Vinyl 1965-1985. A Guide to 60 Independent Labels
von Johannes Rød
Oslo 2014 (Rune Grammofon)
110 Seiten, 299 Norwegische Kronen
ISBN: 82-92598-87-1
 Ornette Coleman brachte seine großen Quartettaufnahmen bei Atlantic heraus, Cecil Taylor nahm für Blue Note auf, John Coltrane für Impulse – zu Zeiten, als diese Labels bereits den Schritt von unabhängigen Plattenfirmen zu den Majors gegangen waren. Die meisten Entwicklungen des Free Jazz der Jahre 1965 bis 1985 aber wurden auf kleinen unabhängigen Labels veröffentlicht, oft genug Ein-Personen-Firmen, die mal weniger, mal mehr Produktionen pro Jahr herausbringen konnte und selten Mittel für aufwändige Produktionen besaßen. Und so waren die Platten in der Regel eine labor of love, aus dem Drang entstanden, eine Musik zu dokumentieren, die, weil der freien Improvisation verpflichtet, ansonsten verklungen wäre.
Ornette Coleman brachte seine großen Quartettaufnahmen bei Atlantic heraus, Cecil Taylor nahm für Blue Note auf, John Coltrane für Impulse – zu Zeiten, als diese Labels bereits den Schritt von unabhängigen Plattenfirmen zu den Majors gegangen waren. Die meisten Entwicklungen des Free Jazz der Jahre 1965 bis 1985 aber wurden auf kleinen unabhängigen Labels veröffentlicht, oft genug Ein-Personen-Firmen, die mal weniger, mal mehr Produktionen pro Jahr herausbringen konnte und selten Mittel für aufwändige Produktionen besaßen. Und so waren die Platten in der Regel eine labor of love, aus dem Drang entstanden, eine Musik zu dokumentieren, die, weil der freien Improvisation verpflichtet, ansonsten verklungen wäre.
Johannes Rød hat 60 dieser kleinen Labels in seinem Buch dokumentiert, von “A” wie dem Label About Time bis “V” wie der Firma Vinyl. Die Klassiker sind dabei, allen voran die deutschen FMP und Moers Music, das Schweizer HatHut Label, Black Saint und Soul Note aus Italien, ICP aus Holland, Incus aus Großbritannien, BYG Actuel aus Frankreich sowie die vielen amerikanischen Kleinstlabels wie Delmark, ESP, Flying Dutchman, Nessa, Strata-East oder Saturn. Rød beginnt jedes Kapitel mit einer Kurzdarstellung der Labelgeschichte, Hintergründen zur Entstehung, zu den Menschen, die die Musik produzierten, zur Programmpolitik. Dann folgt, wie auf Linienpapier eines altertümlichen Bestandsbuches die Diskographie im Bereich des Free Jazz bzw. der frei improvisierten Musik: Plattennummer, Künstler und Titel der Platte sowie Jahr der Veröffentlichung. Kurz und prägnant; weder Angaben zur Besetzung noch über eventuelle Wiederveröffentlichungen. Einige der großen, einflussreichen Labels erhalten einen ausführlicheren, bis zu einer Seite umfassenden Darstellungstext, ansonsten sind es meist nur wenige Zeilen. In der Mitte des Buchs finden sich sechzehn farbige Seiten, auf denen jeweils vier Plattencover abgebildet sind. Ein Epilog verweist auf weitere Veröffentlichungen, aber auch auf Entscheidungen des Autors, welche Labels er aufnehmen, welche er außer Acht lassen wollte. Schließlich findet sich noch ein Interview, dass der Journalist Rob Young mit dem norwegischen Labelchef Rune Kristoffersen führte, in dessen Verlag das Buch ja auch erschien und in dem dieser die Bedeutung der unabhängigen Labels für die Geschichte insbesondere des Free Jazz seit den 1960er Jahren erzählt. Er reflektiert darüber hinaus über Unterschiede zwischen europäischen und amerikanischen Produktionen und über die Veränderungen des Marktes während der 20 Jahre, die das Buch abdeckt sowie der Zeit danach.
Johannes Røds Buch ist ein wenig Dokumentation von Dokumentation, eine in ihrer Nüchternheit fast buchhalterische Darstellung des Free Jazz als einer Musik, die ihre historische Komponente auch dank der Leistung all dieser kleinen freien Labels erhielt. Das Buch wendet sich letzten Endes an Sammler, die mit ihm einen Katalog der wichtigsten Kleinauflagen des Genres an die Hand bekommen, edel gebunden, auf gutem Papier gedruckt und in einem Layout, das deutlich macht, dass nicht nur die Arbeit all dieser Labels, sondern auch die Leidenschaft der vielen Sammler eine labor of love ist.
Wolfram Knauer (August 2014)
Philosophie des Jazz
von Daniel Martin Feige
Frankfurt 2014 (Suhrkamp)
142 Seiten, 14,40 Euro
ISBN: 978-3-518-29696-7
 Was ist eigentlich Jazz? Diese Frage wird unterschiedlich beantwortet, je nachdem aus welcher Warte der Gefragte auf die Musik blickt. Der Musikwissenschaftler wird die harmonischen, rhythmischen, formalen, konzeptionellen Strukturen der Musik erklären können, der Historiker wird auf Entwicklungs- und Einflussstränge verweisen, der Soziologe wird sich vielleicht mit der Improvisation als einem gesellschaftlichen Modell befassen, der Linguist mit den musikalischen Äquivalenten von Vokabeln und Satzstrukturen, der Musiker wird einfach spielen, der Fan wird verzückt hören.
Was ist eigentlich Jazz? Diese Frage wird unterschiedlich beantwortet, je nachdem aus welcher Warte der Gefragte auf die Musik blickt. Der Musikwissenschaftler wird die harmonischen, rhythmischen, formalen, konzeptionellen Strukturen der Musik erklären können, der Historiker wird auf Entwicklungs- und Einflussstränge verweisen, der Soziologe wird sich vielleicht mit der Improvisation als einem gesellschaftlichen Modell befassen, der Linguist mit den musikalischen Äquivalenten von Vokabeln und Satzstrukturen, der Musiker wird einfach spielen, der Fan wird verzückt hören.
Was aber antwortet der Philosoph? Nun, Philosophen haben sich selten über Jazz geäußert, und wenn sie es taten, dann durchaus schon mal mit gehörigem Missverständnis wie im Fall Theodor W. Adornos, dessen Äußerungen zum Jazz eigentlich erst dann Sinn ergeben, wenn man sich die Musik vor Augen hält, die Adorno zur Zeit, als er diese Aufsätze schrieb, kennen konnte (oder kennen wollte). Ein großes Problem aller Auseinandersetzung mit dem Jazz nämlich ist ein terminologisches: Welchen Jazz meinen wir eigentlich? Sprechen wir von Jazz und denken dabei an eine im Volkstum von New Orleans verankerte Kunst, so haben wir eine grundsätzlich andere Situation als wenn wir von Jazz sprechen, aber die frei denkende und improvisierende Szene der europäischen 1960er und 1970er Jahre vor Augen haben.
Es ist also an der Zeit, dass sich ein veritabler Philosoph mit dieser Musik auseinandersetzt, und es ist angesichts der ausgeführten Probleme vielleicht ganz passend, dass Daniel Martin Feige seine Ausführungen nicht etwa mit der Frage nach dem Jazz beginnen lässt. Stattdessen beginnt er mit der Frage: “Was ist eine Philosophie des Jazz?”, und arbeitet erst einmal die Merkmale der Philosophie heraus, um dann auf Besonderheiten des Jazz einzugehen. “Man kann”, schreibt er, “über den Jazz nicht nachdenken, ohne zugleich kontrastiv über andere Arten von Musik und hier vor allem die Tradition der europäischen Kunstmusik nachzudenken.” Bei solch einem vergleichenden Ansatz bestünde die Gefahr falscher Maßstäbe, wenn man den Jazz aber kontrastiv zur europäischen Kunstmusik erläutere, ließe sich diesem Einwand trefflich begegnen.
In seinen einzelnen Kapiteln diskutiert Feige das improvisatorische Unterscheidungsmerkmal des Jazz (zur komponierten europäischen Kunstmusik), das Verhältnis zwischen improvisierten Performances und dem Werkverständnis (und der Bedeutung von Standards im Jazz), befasst sich mit den individuellen und kollektiven Aspekten in der musikalischen Praxis und hier insbesondere mit dem interaktiven Moment künstlerischen Handelns als verkörperter Tradition, um schließlich vom kontrastierenden Ansatz abzuweichen und eine generelle These aufzustellen, dass nämlich Jazz etwas explizit mache, was für Kunst als solche wesentlich sei. Somit gelangt Feige am Schluss seines Buchs von der Frage danach, was denn eine Philosophie des Jazz wohl ausmache, zu einer These über die philosophische Relevanz des Jazz über die rein musikalische Praxis hinaus.
Daniel Martin Feiges “Philosophie des Jazz” ist keine leichte Lektüre. Weder ersetzt das Buch eine Jazzgeschichte noch fasst es bisheriges ästhetisches oder philosophisches Nachdenken über Jazz konzis zusammen. Feige entwickelt seine Philosophie des Jazz aus dem intensiven Nachdenken über eine Musik, die ihm als mitteleuropäischer Philosoph natürlich auch die eigene Denkhaltung permanent vor Augen führt, und die schon von daher eine Kontrastierung mit der ästhetischen Wirklichkeit, aus der heraus er Musik erfährt, sinnvoll macht. Man möge daher vielleicht die Einschränkung erlauben, dass es sich bei Feiges Buch vor allem um eine “Europäische Philosophie des Jazz” handelt oder wenigstens um eine “Philosophie des Jazz aus europäischer Sicht”, denn die Kontrastierung mit der europäischen Kunstmusik, aus der heraus er seine Thesen entwickelt, kommt gewiss zu anderen Schlussfolgerungen als es eine Kontrastierung etwa mit afro-amerikanischen Traditionen tun würde. Westliche Philosophie, kritisiert Alison Baile, produziere immer noch Erkenntnisse über Wissen, Realität, Moral und die menschliche Natur, für die sie Aspekte wie Hautfarbe oder Geschlecht als nicht notwendige Kriterien erachte [“In its quest for certainty, Western philosophy continues to generate what it imagines to be colorless and genderless accounts of knowledge, reality, morality, and human nature” (Center on Democracy in a Multiracial Society. Towards a Bibliography of Critical Whiteness Studies, Urbana/IL 2006: p. 9)]. Eine Perspektivklärung aber ist von jeder Seite her notwendig, um eine Sache möglichst umfassend zu verstehen. Und so ist Daniel Martin Feiges Perspektive auf den Jazz aus europäischer philosophischer Sicht ein trefflicher, notwendiger und weiter-zu-diskutierender Beitrag zum Nachdenken über Jazz als universelle künstlerische Äußerung, ein Beitrag, wohlgemerkt, zu einer noch zu schreibenden umfassenderen Philosophie des Jazz.
Wolfram Knauer (September 2014)
Das zeitgenössische Jazzorchester in Europa. Einblick in Tendenzen, Strömungen und musikalische Einflüsse des großorchestralen Jazz
von Daniel Lindenblatt
München 2014 (Akademische Verlagsgemeinschaft)
117 Seiten, 34,90 Euro
ISBN: 978-3-86924-593-5
 Ist Bigband-Jazz nach wie vor eine aktuelle Musik? Neben großbesetzten Ensembles, die in der Tradition der klassischen Jazz-Bigband spielen, gibt es etliche Projekte, die den Sound dieser Instrumentierung erweitern und die Bigband damit ins 21ste Jahrhundert überführen. Eine Spurensuche der Möglichkeiten unternimmt Daniel Lindenblatt in seiner wissenschaftlichen Arbeit über Aspekte des aktuellen Bigbandjazz in Europa.
Ist Bigband-Jazz nach wie vor eine aktuelle Musik? Neben großbesetzten Ensembles, die in der Tradition der klassischen Jazz-Bigband spielen, gibt es etliche Projekte, die den Sound dieser Instrumentierung erweitern und die Bigband damit ins 21ste Jahrhundert überführen. Eine Spurensuche der Möglichkeiten unternimmt Daniel Lindenblatt in seiner wissenschaftlichen Arbeit über Aspekte des aktuellen Bigbandjazz in Europa.
Lindenblatt beginnt seine Darstellung mit dem Versuch einer terminologischen Unterscheidung zwischen “Bigband” und “Jazzorchester” (die so kategorial nicht ausfällt, wie es im Klappentext des Buchs behauptet wird), um dann über die Jahrzehnte seit der Swingära die Besetzungscharakteristika zu verfolgen und insbesondere die Besonderheiten des großorchestralen Jazz in Deutschland herauszustreichen, einem Land, dass nicht zuletzt durch seine Rundfunk-Bigbands eine besonders aktive und kreative Szene in diesem Bereich besitzt. Ein zweites Kapitel widmet sich Definitionsfragen im Jazz ganz allgemein, erläutert den Begriff des “ästhetischen Felds” des Jazz, das sich aus der Summe seiner Geschichte speist, und geht auf das Verständnis von Jazz als einer “grundsätzlichen Spielhaltung” ein, wie es insbesondere von europäischen Musikern gehegt wird. Ein Unterkapitel widmet sich dem für sein Thema besonders wichtigen Bereich der Komposition im Jazz, wobei Lindenblatt auch diskutiert, inwieweit die aus der klassischen Musik übernommene Idee eines Werkcharakters im Jazz funktioniere bzw. gegebenenfalls anders gefasst werden müsse.
Im praktisch-analytischen Teil seiner Arbeit greift Lindenblatt dann vier Fallbeispiele heraus, die er analysiert, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Tendenzen herauszuarbeiten. Für Geir Lysne etwa stellt er fest, dass dieser auch die improvisatorischen Teile seiner Kompositionen in dramaturgische Bögen einbinde, dass er bewusst folkloristische Elemente benutze, um “über das kompositorische Handwerk hinaus weitere charakterisierende Elemente” einzubringen, und dass er seine Stücke gern modal konzipiere. Diese Erkenntnisse baut er schließlich in eine Diskussion des “nordischen Tons” ein, der sicher nicht nur im Jazz, hier aber besonders geführt wird. Am Beispiel Rainer Tempels zeigt Lindenblatt, wie dieser sich sowohl einer traditionellen Bigband-Sprache als auch eher aus dem zeitgenössischen Kompositionsbereich abgeleiteter serieller Kompositionsprinzipien bediene. Monika Roscher wiederum benutze darüber hinaus auch “Einflüsse aus moderner Popularmusik und dessen Klangästhetik(en)” und erreiche dadurch eine bewusste Abwendung von “tradierten Konventionen des Bigband-Jazz”. Das Backyard Jazzorchestra schließlich arbeite insbesondere mit Elementen verschiedener folkloristischer Provenienz.
Die beiden Richtungen, die Lindenblatt in seinen Beispielen herausstreicht, beleuchten auf der einen Seite den Umgang der Bigband mit den Konventionen ihres eigenen Subgenres, auf der anderen Seite die Möglichkeiten dieser Besetzung, folkloristische Elemente aufzunehmen. Insbesondere in Europa gäbe es hier Entwicklungen, die weit von der jazz-spezifischen Traditionsbindung fortführten (wie sie in Amerika immer noch das Klangbild der Jazzorchester bestimmt).
Lindenblatts Arbeit entstand als wissenschaftliche Studie und liest sich entsprechend akademisch. Seinen Lesern kommt der Autor in kurzen Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel entgegen, lässt aber leider eine konzis formulierte Fragestellung vermissen. Seine im Vorwort des Buchs vorgetragenen Thesen haben stattdessen etwas Gemeinplatz-artiges (“Die ästhetischen Entwicklungen des zeitgenössischen Jazz spiegeln sich weiterhin in zeitgenössischen Großformationen des Jazz wi[e]der” / “Für das zeitgenössische Jazzorchester lassen sich Tendenzen und musikalische Einflüsse feststellen, deren Herkunft sich eindeutig auf eine europäische Musikkultur zurückführen lassen” / “Eine ‘Vielfalt der Stile’ kann in eine Vielfalt der Ästhetiken übersetzt werden”), und auch die lobenswerten Lupenblicke auf vier konkrete Beispiele führen nicht wirklich über das hinaus, was man bereits geahnt hat. Immerhin richtet Lindenblatt sein Augenmerk wirklich auf aktuelle Großformationen, bleibt aber auch hier zu musikimmanent, beschreibt und schlussfolgert, fragt jedoch nirgends nach dem Warum. Diese Frage allerdings bleibt dem Leser (zumindest diesem Leser) nach der Lektüre im Kopf. Warum schreiben Lysne, Tempel, Roscher oder Schultze so, wie sie schreiben, warum klingen die Bands so, wie sie klingen, welche konkreten Erkenntnisse lassen sich aus den zahlreichen analytischen Beobachtungen, die Lindenblatt anstellt, ziehen, und zwar mit klarem Bezug zu einer (zu welcher?) grundlegenden Fragestellung?
Wolfram Knauer (September 2014)
Piano Works
von Hank Jones
Santa Monica/CA ca. 2014 (Universal Music Publishing Group)
40 Seiten, 29,20 Euro
 Hank Jones war einer der bedeutendsten Pianisten des 20sten Jahrhunderts. Er ist ab den 1940er Jahren auf unzähligen Aufnahmen präsent als immer geschmackssicherer Begleiter und virtuoser Solist. Seit den 1950er Jahren hat er zudem viele Einspielungen mit eigenem Trio gemacht. In den 1970er Jahren machte insbesondere das Great Jazz Trio von sich Reden, in dem Jones mit Ron Carter und Tony Williams zusammenspielte. Auf solchen Einspielungen war Jones vor allem als Interpret von Standards zu hören; daneben aber war er immer auch als Komponist aktiv.
Hank Jones war einer der bedeutendsten Pianisten des 20sten Jahrhunderts. Er ist ab den 1940er Jahren auf unzähligen Aufnahmen präsent als immer geschmackssicherer Begleiter und virtuoser Solist. Seit den 1950er Jahren hat er zudem viele Einspielungen mit eigenem Trio gemacht. In den 1970er Jahren machte insbesondere das Great Jazz Trio von sich Reden, in dem Jones mit Ron Carter und Tony Williams zusammenspielte. Auf solchen Einspielungen war Jones vor allem als Interpret von Standards zu hören; daneben aber war er immer auch als Komponist aktiv.
Die in diesem Band enthaltenen Stücke stammen zumeist aus der Zeit nach 1970 und zeigen, wie Bob Blumenthal in seinem Vorwort betont, dass er die harmonischen Entwicklungen seines Bruders Thad, Oliver Nelsons und anderer Zeitgenossen wahrgenommen habe. Es gibt Blues (“Peedlum”) und harmonisch offenere Stücke (Passing Time”), Balladen (“Take a Good Look”) und Walzer (“Lullaby”). Die Lead-Sheets enthalten die themenmelodie, z.T. akkordisch gesetzt, sodass man einen kleinen Eindruck der typisch Jone’schen Voicings erhält, sowie die Harmoniegrundlagen der Improvisationschorusse, für einzelne Titel (“Alone & Blue”, “Good Night”) auch Texte. Weitere Titel sind “A Darker Hue of Blue”, “A Major Minor Contention”, “Ah Oui”, “Bangoon”, “Duplex”, “Good Night”, “Interface”, “Intimidation”, “Orientation” und “Sublime”.
Zwischen Bebop, Uptempo und Ballade finden sich in diesem Band wunderbare Piècen, die den Geist Hank Jones’ hervorrufen, zugleich aber auch jedes Repertoire bereichern können.
Wolfram Knauer (April 2014)
We Thought We Could Change the World. Conversations with Gérard Rouy
von Peter Brötzmann & Gérard Rouy
Hofheim 2014 (Wolke Verlag)
191 Seiten, 28 Euro
ISBN: 978-3-95593-047-9
 Gérard Rouy begleitete den Filmemacher Bernard Josse im November 2008 und im August 2009, als dieser seinen Film “Soldier of the Road” über Peter Brötzmann drehte. Rouy war dafür zuständig, den Saxophonisten zum Erzählen zu bringen, und Rouy berichtet, wie frustrierend es für ihn gewesen sei, dass der Film naturgemäß nur einen Bruchteil der Gespräche wiedergeben konnte. Im vorliegenden Buch werden diese Gespräche nun auf 100 Seiten gesammelt, daneben enthält es knapp 60 Seiten Fotos, die Gérard Rouy über die Jahrzehnte von Brötzmann machte, sowie Abbildungen diverser Kunstwerke des Saxophonisten, eine knappe Diskographie und einen Namensindex.
Gérard Rouy begleitete den Filmemacher Bernard Josse im November 2008 und im August 2009, als dieser seinen Film “Soldier of the Road” über Peter Brötzmann drehte. Rouy war dafür zuständig, den Saxophonisten zum Erzählen zu bringen, und Rouy berichtet, wie frustrierend es für ihn gewesen sei, dass der Film naturgemäß nur einen Bruchteil der Gespräche wiedergeben konnte. Im vorliegenden Buch werden diese Gespräche nun auf 100 Seiten gesammelt, daneben enthält es knapp 60 Seiten Fotos, die Gérard Rouy über die Jahrzehnte von Brötzmann machte, sowie Abbildungen diverser Kunstwerke des Saxophonisten, eine knappe Diskographie und einen Namensindex.
Die Gespräche drehen sich vor allem um Biographisches und Ästhetisches. Brötzmann erzählt über seine Kindheit in Schlawe im heutigen Polen, seine Jugend in Remscheid. Er erzählt vom Einfluss der Nachkriegszeit auf seine musikalische Haltung, vom Unterschied der ästhetischen Ansätze gleichaltriger europäischer Musiker, die durch ihre jeweiligen nationalen Erfahrungen geprägt waren. Brötzmann las Joachim Ernst Berendts Jazzbuch und hörte Willis Conovers Jazzsendung auf der Voice of America und war anfangs vor allem vom traditionellen Jazz fasziniert. Er spielte Klarinette zu den Platten, die er besaß und baute sich ein eigenes Schlagzeugset. Mit 17 Jahren entschloss er sich die Schule zu schmeißen und an der Kunstakademie in Wuppertal zu studieren. Auf dem Saxophon sei er reiner Autodidakt gewesen; seinen eigenen Sound sieht er als Resultat seines technisch “falschen” Ansatzes. In der Wuppertaler Galerie Parnass half er 1962 bei einer Ausstellung Nam June Paiks aus, der ihm die Welt John Cages öffnete.
Brötzmann erzählt vom deutschen Jazz der 1960er Jahre, von den ersten Schlagzeugern, mit denen er zusammenspielte, von Auftritten mit Alexander von Schlippenbachs Globe Unity Orchestra und ersten pan-europäischen Projekten. Er resümiert über die Weltveränderungsgedanken, die 1968 auch durch die Jazzszene schwappten, zeigt sich aber auch als Realist, der schnell erkannte, dass “wir vielleicht nicht die Welt nicht verändern können, dass wir aber sehr wohl von Zeit zu Zeit das Denken der Menschen beeinflussen können”. Ein eigenes Kapitel ist dem Projekt “Free Music Production” gewidmet, an deren Entstehung Brötzmann und Peter Kowald beteiligt waren. FMP schuf auch eine Verbindung zu Musikern aus dem Osten Deutschlands, und Brötzmann erzählt von Konzerten in der DDR und der Schwierigkeit, mit der Ostgage sinnvolle Dinge zu erstehen, da das Geld im Westen nur einen Bruchteil wert war. Er berichtet über sein Trio mit Fred van Hove und Han Bennink und über gemeinsame Projekte mit Albert Mangelsdorff, die halfen, dass einige der vehementen Kritiker seiner Musik ihm eine weitere Chance gaben.
Das Kapitel “Freundschaften” handelt von Misha Mengelberg, Frank Wright, Sonny Sharrock, geht aber auch auf gesellschaftspolitische Ansichten Brötzmanns ein. Er erzählt ausführlich von Parallelen zwischen seiner Musik und seinen bildenden Kunstwerken – der Unterschied der beiden Berufe sei vor allem, dass man als Maler allein arbeite – und identifiziert einzelne ikonographische Versatzstücke seiner Malerei. Er erzählt offen über seine Alkoholprobleme in der Vergangenheit und darüber, dass er Glück gehabt habe, den Absprung geschafft zu haben. Es gibt Leute, die meinen, im Alter sei Brötzmann melodischer geworden; er selbst aber findet, dass dieses Interesse an der Melodie immer dagewesen sei. Auch habe ihm bei allem Bemühen “sein eigenes Ding” zu machen, der amerikanische musikalische Ansatz in Bezug auf Songs oder den Blues immer gefallen. Improvisation sieht er größtenteils als Vergnügen, aber auch als Risiko, wobei sich diese beiden Seiten nicht ausschlössen. Er besäße sehr unterschiedliche Instrumente; seine Saxophonsammlung allein sei mittlerweile fast zu groß geworden.
Musiker zu sein, sei immer ein schweres Brot gewesen, die Zukunft der Musik aber sei in Gefahr, wenn selbst bei staatlich subventionierten Maßnahmen nur der breite Erfolg zähle. Es gäbe da sicher eine gehörige Überproduktion an Kunst, ihn selber eingeschlossen, im großen und ganzen aber seien vor allem die Strukturen, die noch in den 1970er und 1980er Jahren funktioniert hätten, den Bach runtergegangen. “Die jungen Leute kommunizieren nur noch über das Internet”, bedauert er und prophezeit: “Ich glaube, das ist sowieso das Ende aller Musik.” Bei allem Pessimismus müsse man als Musiker aber versuchen, das, was man selber mache, möglichst gut zu machen, um die Menschen zu erreichen und zu überzeugen.
“We Thought We Could Change the World” ist eine ausgesprochen lesenswerte Reflektion über Brötzmanns eigenen Lebensweg, seine Ideale und die Wirkung seiner Kunst. Die Musik ersetzt ein solches Buch nicht, aber sie bietet erhebliche zusätzliche Information. Rouys Fotos begleiten Brötzmann in diversen Projekten zwischen 1972 und 2009 und leiten sehr gelungen zu dem über, was auch nach der Lektüre dieses Buchs im Mittelpunkt stehen sollte: den Genuss einer Platte oder die Vorfreude aufs nächste Konzert.
Wolfram Knauer (April 2014)
Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall
von Gabriel Solis
New York 2014 (Oxford University Press)
183 Seiten, 16,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-974436-7
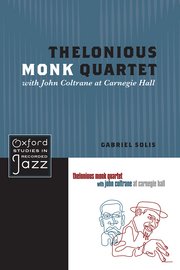 In 1957 John Coltrane followed Sonny Rollins as tenor saxophonist in Thelonious Monk’s band for half a year which resulted in one of the most important partnerships in jazz. The two made a couple of studio recordings, and later several bootlegs added to their discography. In 2005, Larry Appelbaum discovered tapes of a benefit concert played at Carnegie Hall, made for the Voice of America, but never broadcast. The recording was issued and celebrated by fans and critics alike. One main difference to bootlegs was that, unlike most other live recordings, this concert had originally been meant to be recorded and broadcast.
In 1957 John Coltrane followed Sonny Rollins as tenor saxophonist in Thelonious Monk’s band for half a year which resulted in one of the most important partnerships in jazz. The two made a couple of studio recordings, and later several bootlegs added to their discography. In 2005, Larry Appelbaum discovered tapes of a benefit concert played at Carnegie Hall, made for the Voice of America, but never broadcast. The recording was issued and celebrated by fans and critics alike. One main difference to bootlegs was that, unlike most other live recordings, this concert had originally been meant to be recorded and broadcast.
Gabriel Solis who is the author of one of the major studies of Thelonious Monk’s music, “Monk’s Music. Thelonious Monk and Jazz History in the Making” from 2008, examines the resulting album as a document of a crucial period in the musical development of both John Coltrane and Thelonious Monk, but he also asks “questions about changes in jazz over the course of the twentieth century, and critical questions about jazz’s place in American culture”.
In his introduction Solis places the recording within jazz history of its time, pointing out that the 1950s were “an exceptional moment for live jazz recordings”, introducing a different consciousness for the music both within the listener and the musicians. Solis then discusses the concepts of improvisation, composition, interaction, and repetition in jazz to lay ground for an understanding of his later analyses. Solis follows the concept of repetition from small to large, from motif, groove, and rhythm to chorus and repetition of pieces in a repertoire. He shortly touches upon aesthetic connotations of repetition in an African-American context. Solis then raises the question of composition and improvisation, terms which often are used too rigidly to do the music itself justice. Rather than view the two as antitheses, he refers to Bruno Nettl who described them as fundamentally part of the same idea. Solis focuses the reader’s attention on connotations of these and other terms so that they will read them with caution in his later text, that they will understand that whenever he speaks of composition there is an improvisational element present and vice versa. From small to big, Solis ends this part of his discussion with a reflection upon the “Werkbegriff” in jazz, a highly European concept that had an influence on jazz insofar as it has influenced all judgement of “established” music and kept jazz on the other side of the field for a long time. The result was, Solis concludes, that not Ellington, Parker, Coltrane, Monk earned the first Pulitzer for a jazz piece but Wynton Marsalis’ “semiclassical oratorio ‘Blood on the Fields'”. Solis ends his introduction with a short overview of the book’s chapter outline, part 1 looking at the careers of both protagonists up to the time of the concert as well as at the occasion of the concert, a benefit for the Morningside Heights Community Center, and the concert program aside from the Coltrane/Monk bill; part 2 analysing the eight tracks issued in four chapters, focusing on “the most compelling aspects of the particular performances”; and part 3 looking at the recording’s release in 2005 and its critical and aesthetic reception.
Chapter 1 looks at the musical partnership between Thelonious Monk and John Coltrane and how it affected both of their musical aesthetic and careers. Solis explains the different perception of the two artists, Monk as a composer, Coltrane as a performer/improviser. He discusses the various sidemen Monk hired for recordings since the 1940s and how their participation in and interpretation of his music affected his own style. Biographical asides are left at that, no explanation, for instance as to why Monk lost his cabaret card, but that is in line with the argument of his book which tries not to be biographical in the least and should be read alongside the biographies Solis lists in his bibliography (his own included). Solis mentions influences and experiences on John Coltrane’s much more recent career and his period working with Miles Davis. He explains how Coltrane and Monk got together in 1957 and then gives a short run-down of the existing studio recordings by the two musical partners. Monk’s influence on Coltrane is attested to, not the least by the saxophonist himself who acknowledged that he had learned “a lot, (…) little things” while working with Monk. The influence, Solis argues, was not merely musical, but aesthetic as well: “Monk gave Coltrane space and freedom”. And, he continues, Coltrane learned “a more sophisticated conception of form in solos”, he learned “musical direction”, he learned how to pay attention to “musical form”.
Chapter 2 starts with a discussion of the “‘jazz concert’ phenomenon” and how a concert on the stage of Carnegie Hall had to differ from a set in a New York night club. Solis looks at the idea of a jazz concert as a genre upon itself, discussing its history from the Clef Club through Benny Goodman’s and Duke Ellington’s Carnegie Hall concerts and Norman Granz’s Jazz at the Philharmonic events. He describes the specific story behind the benefit for the Morningside Heights Community Center and lists the other artists on the program, Sonny Rollins, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Austin Cromer, Chet Baker, and Zoot Sims. He looks at the admission fees and asks who the potential audience might have been, and he quotes from contemporary reviews of the concert.
Chapter 3 finally approaches the music itself, the two slow pieces of the first 30-minute set, “Monk’s Mood” and “Crepuscule with Nellie”, two interpretations with hardly any solo playing focused on “the formal structure of the compositions themselves”. Solis is both interested in the ballad approach of the two protagonists and in how Monk’s complex harmonic writing connects with the melodic direction of the pieces. Solis shows the orchestral qualities of “Monk’s Mood”. He describes the two melodies that form the piece, and he explains what he calls “a characteristically ‘Monkish’ ambiguity” in the harmonic approach. He runs down earlier interpretations of the piece by Monk and different bands, then analyses the Carnegie Hall performance, especially pointing out pianistic influences on Monk. Unlike “Monk’s Mood”, “Crepuscule with Nellie” was a new piece in Monk’s repertoire, which, as Solis explains, he continued to treat as “a more or less fixed composition”, never using it as a vehicle for extended improvisation. Solis points to possible influences from Debussy or Chopin and sees the piece’s concept as more pianistic or at least instrumental than that for “Monk’s Mood”. He compares the Carnegie Hall interpretation with later recordings and notices how all of them are similar.
Chapter 4 looks at the two up-tempo numbers from the first set, “Evidence” and “Nutty”. “Evidence”, based upon the harmonies of the standard “Just You, Just Me”, was a staple in Monk’s repertoire, likely to be recognized by the audience, and “Nutty” had a simple harmonic structure. In both pieces, Solis is interested in Coltrane’s solo language and in his reactions to Monk’s “idiosyncratic way of voicing chords”. With Monk, in these pieces, Solis is mostly interested in the way he works with the rhythm section and with the soloist. Solis calls “Evidence” “a study in dissonance”. He looks at the interaction between Monk and drummer Shadow Wilson who mostly keeps time, yet “adds a significant layer of complexity, keeping the head even more rhythmically unpredictable”. He points to changes in tension when Coltrane’s solo starts which he sees as “one large statement, rather than three self-contained choruses”. He also listens closely to Monk’s accompaniment heavily relying on material from the head of the composition. “Nutty” is taken a bit faster than in other recordings of the piece, and Solis compares’ Coltrane’s solo to a studio recording the two had done a bit earlier. Monk’s solo is based upon motivic references to the head.
Chapter 5 examines “Bye-Ya” and “Sweet and Lovely” from the second set, and the author’s interest lies in how the band treats “the songs holistically, approaching them melodically, harmonically, rhythmically, and motivically as complex entities, with musical challenges but also historical contexts and meanings to themselves and their audiences”. As to “Bye-Ya”, Solis discusses connotations of Latin influences in Monk’s life and music. He follows Coltrane through his solo and describes the interaction between the four musicians. “Sweet and Lovely” was the only standard of the evening, and Solis takes the chance to follow the song’s success through Monk’s youth and to ask about his possible interest in the tune which he first recorded in 1952. He examines the composition (“the head”) itself and discovers “Monkish” elements in it, then looks at the interpretation which starts “angular”. He discusses Monk’s approach to what Solis calls his “transitional” solo, points out how he plays with melodic and harmonic motifs and expectations, and how Coltrane follows with a “similarly organized chorus”. After the three choruses, the band pauses, then “jumps into a double time groove that is also at a significantly faster underlying tempo”.
Chapter 6 looks at the final “Blue Monk” and the band’s theme song “Epistrophy”. “Blue Monk” is a starting point for discussing the use of the blues with Monk and Coltrane. Short versions of “Epistrophy” ended both sets of the concert, and Solis asks about “how they placed Monk within the models of artistry and entertainment in the jazz world at the time”. The fact alone that the band had a theme song was unusual for a modern jazz combo. Solis describes the tune as “a cyclical, riff-driven piece, ideally suited to open-ended, vamp-like performances that build energy and can be extended or foreshortened in response to the energy in a room.”
Chapter 7 looks at the recording history of the never-broadcast Voice of America tapes and at the aesthetic context into which it was released in 2005. The release was celebrated by both the jazz and some mass media. Its success, Solis explains, has to be seen in context with the “Young Lions” movement of the 1990s which had revitalized a hardbop approach to jazz and given artists like Monk and Coltrane even more of a canonical status. Solis then focuses on the Blue Note label and its own role in the canonization of certain jazz musicians and asks about how the Carnegie Hall album fit into Blue Note’s catalogue of 2005. Finally he offers an aside about jazz education in the 2000s, the collegiate jazz scene and the university curriculum which jazz had entered by this time and which has “built a particular vision of the canon”.
Gabriel Solis’ book takes a single event, the Carnegie Hall concert by Thelonious Monk with John Coltrane, and uses it to explain what happens in the music itself, how it relates to the musical development of the two protagonists of the concert, how it fits into the context of the jazz aesthetic of the 1950s and how it fits into the context of the time of its release in 2005. The text is heavy on analytical aspects, yet manages to put these into context with the overall questions which the author never leaves out of his and his readers’ attention. It is an excellent addition to the scholarly literature on jazz, looking at details yet explaining so much more.
Wolfram Knauer (April 2014)
Ab Goldap. Rüdiger Carl im Gespräch mit Oliver Augst
Frankfurt/Main 2014 (weissbooks)
224 Seiten (208 Textseiten / 16 Seiten Bildtafel)
beiheftende CD mit 17 Liedern von Rüdiger Carl
30 Euro
ISBN: 978-86337-079-4
(Voraussichtlich im Handel ab 15. Mai 2014)
 Rüdiger Carl ist ein Multiinstrumentalist, der die Szene der frei improvisierten Musik in Deutschland seit den 1960er Jahren mitprägte, zugleich aber immer ein wenig zwischen den Stühlen der Avantgarde zu sitzen schien, die sich seit den frühen 1980er Jahren am liebsten von allen Genrefestschreibungen zu distanzieren versuchte. Nun hat Carl auf Anregung von und im Gespräch mit Oliver Augst eine Erzählbiographie vorgelegt, wie man solche Projekte vielleicht am besten nennen sollte, die in letzter Zeit immer öfter erscheinen und die subjektive Sicht ihrer Protagonisten auf ihre eigene Geschichte und die Welt überall durchscheinen lassen. Carls Erinnerungen sind dabei durchaus exemplarisch für den Versuch einer Generation, in einer wie auch immer zu definierenden Avantgarde auf gesellschaftliche Verhältnisse einerseits zu reagieren, sie andererseits zu spiegeln und künstlerisch zu kommentieren.
Rüdiger Carl ist ein Multiinstrumentalist, der die Szene der frei improvisierten Musik in Deutschland seit den 1960er Jahren mitprägte, zugleich aber immer ein wenig zwischen den Stühlen der Avantgarde zu sitzen schien, die sich seit den frühen 1980er Jahren am liebsten von allen Genrefestschreibungen zu distanzieren versuchte. Nun hat Carl auf Anregung von und im Gespräch mit Oliver Augst eine Erzählbiographie vorgelegt, wie man solche Projekte vielleicht am besten nennen sollte, die in letzter Zeit immer öfter erscheinen und die subjektive Sicht ihrer Protagonisten auf ihre eigene Geschichte und die Welt überall durchscheinen lassen. Carls Erinnerungen sind dabei durchaus exemplarisch für den Versuch einer Generation, in einer wie auch immer zu definierenden Avantgarde auf gesellschaftliche Verhältnisse einerseits zu reagieren, sie andererseits zu spiegeln und künstlerisch zu kommentieren.
Das Gespräch beginnt mit Carls Schulzeit in Kassel, einem Klassenlehrer, der politisches genauso wie menschliches Vorbild war. Nebenbei pflegte er Kontakte zum örtlichen Jazzclub. Zwischendrin Rückblenden in die “Urkindheit”, wie Augst sie nennt, die direkte Nachkriegszeit, Hunger, Armut, die Rückkehr des Vaters aus der Kriegsgefangenschaft, eine Welt, die in Carls nüchterner Erinnerung ein wenig an Arno Schmidts Erzählungen exakt derselben Lebenssituationen erinnert: das Schicksal einer Flüchtlingsfamilie – in Ostpreußen geboren kam Carl auf den Fluchtwirren der Zeit über Wien und andere Stationen nach Kassel –, das Schicksal von Spätheimkehrern, die aller Illusionen beraubt waren. Nach der mittleren Reife machte Carl eine Lehre als Schriftsetzer beim Bärenreiter Verlag, wo er Noten genauso wie Mozartbriefe setzte. Er erinnert sich an eine Jugend in den 1950er Jahren zwischen Literaturgesprächen, Konzertabenden und einer Lehre, die ihn einerseits unterforderte, andererseits jede Menge Inspiration für seine spätere künstlerische Arbeit in ihm weckte. Nach der Ausbildung ging er nach Berlin, bewarb sich an der Staatlichen Hochschule für bildende Künste, die ihn ablehnte, jobbte als Schriftsetzer und machte nebenbei Musik. Sein Akkordeon hatte ihm seine Großmutter bereits in Kassel geschenkt; bald tauschte er es gegen eine Querflöte ein, die er autodidaktisch erlernte. Er berichtet von seinen ersten Jazzerfahrungen in Kassel, Standards und Hardbop, von den seltsamen Verbindungen zwischen Grafikdesign und Jazz in jenen Jahren, vom Umstieg erst aufs Saxophon, dann auf die Klarinette.
“Jazz”. sagt Carl, “das ist ja ein alter Begriff und beschreibt auch ein altes Ding.” Er beklagt die Naivität in dem, was er heute so im Radio als Jazz hört, und er beschreibt, wie sich Europa in den 1960er Jahren freistrampelte von der amerikanischen Tradition, mehr Chaos einbrachte, “vor allem mehr Witz und Strapaze, das war etwas zeitversetzt der europäische Anteil, während die amerikanische 60er Jahre-Avantgarde manchmal fast den Ernst von Religionsgründern hatte”. Für ihn war irgendwann, als der Jazz mehr und mehr von Fusion durchdrängt wurde, die Luft raus. Jenen “grobkörnigen Typ von Musiker”, den er bevorzugt, gäbe es schon lange nicht mehr. An einer Stelle wagt er eine Selbstdefinition: “Als Dilettant war ich ja nun fast alles. Unterhaltungsmusiker und Querulant und Freejazzer und vielleicht sogar konzeptueller Komponist. Vielleicht sogar Minimal-Musiker.” Er habe versucht, keine Genregrenzen abzustecken, sondern offen zu bleiben, das Unerwartete, vielleicht auch das Unerhörte zu wagen. Das Wort “Musizieren” benutzt er oft spricht vom “Arbeiten” an der Musik, vom “Entdecken”, “Ausprobieren. Und was das “Freie” im Free Jazz anbelangt, so findet er, dieses müsse eben auch die Freiheit beinhalten, die Musik zu spielen, die einem just in dem Augenblick gerade so gefalle.
Carl erzählt von Kollegen und Freunden, von Musikern und Bildenden Künstlern, von ästhetischen Diskussionen und seiner heutigen Sicht über sie. Die Gespräche zwischen Augst und Carl wirken dabei selbst wie eine Art Improvisation, chronologisch angelegt aber mit weiten Exkursen: in Erinnerungen, in die Gegenwart, in die Interviewsituation, auch in Belange des Interviewers. Diese Verschobenheit in der Erzählung erlaubt tiefere Einblicke als es eine chronologische Erzählung täte: Carl erzählt aus dem Bauch heraus, und kein Redakteur presst dies in Kapitelüberschriften. Der Leser erfährt die Intensität des Gesprächs, hört quasi selbst mit zu.
Carmell Jones, Alexander von Schlippenbach, Peter Brötzmann, Sven-Åke Johansson, Jost Gebers: Carls Erzählung vermittelt eine lebendige Berliner Szene, schildert daneben auch die Realität des Überlebenmüssens und des Mixes verrückter Figuren. Er hatte Jobs in der Bundesdruckerei und als Bahnwärter, bevor er Anfang der 1970er Jahre nach Wuppertal zog, wo seine Profimusikerkarriere begann. Carl erzählt, wie er zum Akkordeon zurückkehrte, von seiner Zusammenarbeit mit Irène Schweizer, über das Globe Unity Orchestra, die Probleme des Frei-Spielens, über Pina Bausch, Joseph Beuys, Hans Reichel, der Faszination Thelonious Monks, über die Gefahr und die Chancen musikalischer Klischees und über die künstlerische Grundhaltung von “Verweigerung”. Er unternahm Tourneen durch die DDR, spielte beim legendären Festival in Peitz, trat mit dem Bergisch-Brandenburgischen Quartett mit Ernst Ludwig Petrowsky auf, erhielt Ost-Gagen, die man möglichst in Naturalien umtauschen musste, um einen brauchbaren Gegenwert zu erhalten.
Anfang der 1980er Jahre zog er nach Frankfurt, in eine damals äußerst lebendige und genreübergreifende Avantgardeszene. Er organisierte Konzerte im Porticus, wirkte in der FIM mit (Forum improvisierender Musiker), berichtet daneben auch über seine Kontakte (aber auch über die Nicht-Kontakte) zur örtlichen Jazzszene. Das berühmte Forsythe-Ballett habe ihm nie imponiert, der habe ja sicher auch nie einen Ton von ihm gehört; das Ensemble Modern sei brav, ordentlich, sauber, man müsse das aber nicht dauernd hören. Solche Passagen fallen zurück in den von den Weltläuften enttäuschten Anfangsduktus, der diesen Rezensenten die Lektüre dieses Buchs etwas skeptisch beginnen ließ. Da erwartet man dann Gegenwartspessimismus, romantisches wenn auch selbstkritisches Zurückerinnern an schwere Zeiten, die doch so viel inspirierter gewesen seien. Daneben aber swingt im Gespräch bald, ganz schnell eigentlich, noch etwas anderes dabei mit: eine nicht minder romantische Hoffnung darauf, nein ein Wissen darum, dass künstlerische Inspiration zu jeder Zeit möglich ist, dass gesellschaftliche Verhältnisse (auch Kunst-Verhältnisse) immer in Frage gestellt werden müssen, dass man seine Sache ernst nehmen muss, sich selbst aber nie zu ernst nehmen darf. Nach wenigen Seiten ist man gefangen vom lockeren Plaudern der beiden Freunde, die auf gemeinsame Bekannte rekurrieren, sich aufs Abendessen freuen oder aufs nächste Treffen.
Persönliche Fotos sowie ein Namensindex der im Text genannten Personen runden das Buch ab. Bastian Zimmermann lässt sich von der Lektüre zu einer zusammenfassenden Würdigung hinreißen (Nachwort); und Astrid Ihle beschreibt in ihrem Vorwort die Entstehungsgeschichte des Buchs, das mit einer CD kommt, die einen Liederzyklus mit 17 autobiographisch geprägten Stücken enthält, “komponiert, getextet, gesungen und am Klavier begleitet von Carl himself”. All das macht “Ab Goldap” zu einer überaus lesenswerten, mehr als runden Würdigung des Multiinstrumentalisten und – irgendwie – Avantgardephilosophen Rüdiger Carl.
Goldap, dies sei zum Schluss noch erläutert, ist der Ort in Ostpreußen, aus dem seine Familie kam, Ab Goldap also, über Kassel, Berlin bis Frankfurt…
Wolfram Knauer (Mai 2014)
Black Fire! New Spirits! Images of a Revolution. Radical Jazz in the USA 1960-75
herausgegeben von Stuart Baker
London 2014 (Soul Jazz Records)
189 Seiten, 30 Britische Pfund
ISBN: 978-09572600-1-6
 Black Music, Black Power: Die schwarze Musik begleitete die Bürgerrechtsbewegung in den USA als ein kongenialer Soundtrack. Vielleicht waren die Soulmusiker näher dran an der Bewegung, aus deren Reihen James Brown seine Hymne “Say It Loud: I’m Black and I’m Proud” einbrachte. Der Avantgardejazz der 1960er und 1970er Jahre aber hatte engste Berührungspunkte zur Bewegung, zu den friedlichen Protesten genauso wie zu den radikalen Wortführern ihrer Zeit, und die Musik vieler Free-Jazz-Musiker wurde nicht nur im Nachhinein als eine Reaktion auf die gesellschaftlichen Verhältnisse gelesen, als eine Rebellion gegen die Vorherrschaft weißer Wertesysteme. Etliche Künstler, die dem New Thing verbunden waren, betonten damals, ihre Musik sei eigentlich apolitisch, wann immer sie als schwarze Musiker aber in den amerikanischen Südstaaten spielten, wurden sie mit der politischen Realität des alltäglichen Rassismus konfrontiert, aus dem heraus ihre Musik genauso viel an Kraft und Widerstandspotential zog wie aus der langen und stolzen Tradition afro-amerikanischer Kultur.
Black Music, Black Power: Die schwarze Musik begleitete die Bürgerrechtsbewegung in den USA als ein kongenialer Soundtrack. Vielleicht waren die Soulmusiker näher dran an der Bewegung, aus deren Reihen James Brown seine Hymne “Say It Loud: I’m Black and I’m Proud” einbrachte. Der Avantgardejazz der 1960er und 1970er Jahre aber hatte engste Berührungspunkte zur Bewegung, zu den friedlichen Protesten genauso wie zu den radikalen Wortführern ihrer Zeit, und die Musik vieler Free-Jazz-Musiker wurde nicht nur im Nachhinein als eine Reaktion auf die gesellschaftlichen Verhältnisse gelesen, als eine Rebellion gegen die Vorherrschaft weißer Wertesysteme. Etliche Künstler, die dem New Thing verbunden waren, betonten damals, ihre Musik sei eigentlich apolitisch, wann immer sie als schwarze Musiker aber in den amerikanischen Südstaaten spielten, wurden sie mit der politischen Realität des alltäglichen Rassismus konfrontiert, aus dem heraus ihre Musik genauso viel an Kraft und Widerstandspotential zog wie aus der langen und stolzen Tradition afro-amerikanischer Kultur.
Stuart Baker dokumentiert in diesem Coffeetable-Buch die afro-amerikanische Avantgarde der 1960er und frühen 1970er Jahre als eine Musikszene, die im Auftreten, in der Selbstdarstellung, aber auch in Mode und Musik ein schwarzes Selbstbewusstsein vorlebte, das einmal mehr zeigt, dass Musik, egal unter welchen Umständen sie gemacht wird, gesellschaftliche Verhältnisse abbildet und oft genug Wege zu einer besseren Gesellschaft fordert oder gar aufzeigt. Bakers Einleitungstext schildert die Situation: Nachdem das Oberste Gericht in den Vereinigten Staaten die Gleichheit zwischen den Hautfarben noch einmal bekräftigt hatte, begannen schwarze Aktivisten die Umsetzung der Gerichtsurteile in der gesellschaftlichen Realität zu verlangen. Diskussionen jener Jahre drehten sich um Gewalt oder Gewaltlosigkeit, um die Stärkung der eigenen Community auch in ihrem Wissen um Wurzeln und eigene Geschichte, in der Musikergemeinschaft darüber hinaus auch um die Produktions- und Besitzverhältnisse an den von ihnen geschaffenen Werken.
Die von Baker ausgesuchten knapp 170 Fotos zeigen, wie er im Vorwort schreibt, vor allem eines: das unbedingte Selbstbewusstsein der Künstler, eine Selbstbestimmung, die sich deutlich darin äußert, wie sie sich der Kamera präsentieren. Jedem Künstler sind ein bis zwei Seiten gewidmet, aussagekräftige Fotos und ein kurzer biographischer Text. Baker hat darauf verzichtet, in diese kurzen Texte weitere politische Interpretationen zu packen, lässt stattdessen die Bilder für sich sprechen. Herbie Hancock in stolzer Pose vor dem Flügel, Nina Simone kämpferischem in die Kamera blickend, Famoudou Don Moye mit pseudo-afrikanischer Kriegsbemalung, Archie Shepp nachdenklich, Leon Thomas mit afrikanischer Trommel, AACM-Musiker vor einem Plakat des Improvisational Theatre, Jimmy Smith, der mit seinem eigenen Fotoapparat in die Kamera blickt, Tony Williams rauchend und am Arbeitsinstrument wartend, Stanley Cowell und Charles Tolliver in sympathischen Portraitfotos, die offenbar vor demselben Hintergrund und vom selben Fotografen geschossen wurden, Horace Silver vor der Blue-Note-Auslage eines Plattenladens, Cecil Taylor, in sich und in seine Musik vertieft, Thelonious Monk am heimischen, vollgepackten Flügel, George Benson im Cabriolet vor dem Village Vanguard, Pheeroan akLaff auf die Trommelstöcke konzentriert,.
Neben dem Blick, neben den Posen scheint auch die Mode der Zeit kämpferische Untertöne zu besitzen, sei es nun Elvin Jones’ lange Lederweste, Sun Ras außerweltliches Ornat, Gary Bartzs weite Schlaghose, Phil Upchurchs buntestem Bühnenkostüm oder in der Person von Miles Davis, der gleich in verschiedenen Modestilen gezeigt wird.
Mary Lou Williams ist neben Sun Ra die älteste der hier abgebildeten Musiker; weiße Kollegen muss man dagegen buchstäblich mit der Lupe suchen (fündig wurden wir auf Seite 92/93 im Ornette Coleman Quartett, in dem Charlie Haden aber fast vollständig von seinem Kontrabass verdeckt wird). Und so dokumentiert dieses Buch auch die Macht der Bilder, die den Jazz als eine ungemein kraftvolle, eine selbstbewusste (ja, dieses Wort muss noch einmal benutzt werden), als eine rebellierende und nach vorne blickende afro-amerikanische Musik darstellen.
Auf eine Identifizierung der Sidemen verzichtet der Herausgeber, und auch die Foto-Credits verweisen nur recht allgemein auf Getty Images, die Quelle der meisten der benutzten Bilder. Ein aussagekräftiges Buch ist dieser Bildband allemal und macht doppelt Lust aufs Hören der Musik, die ja nicht weniger kraftvoll und selbstbewusst daherkommt.
Wolfram Knauer (Juni 2014)
Jazz in Berlin
von Rainer Bratfisch
Berlin 2014 (Nicolai Verlag)
472 Seiten (im Schuber), 129 Euro
ISBN: 978-3-89479-802-4
 Rainer Bratfischs schwergewichtiges Buch “Jazz in Berlin” enthält weit mehr als jazzmusikalische Lokalgeschichten aus der Hauptstadt. Es ist in der Vernetzung der Berliner Jazzszene mit dem Rest Deutschlands (Ost wie West) eine eigentlich nur räumlich fokussierte Jazzgeschichte Deutschlands geworden, ein Steinbruch vielfältiger Informationen, die ausgewogen von den Anfängen der Jazzrezeption in den 1920er Jahren über die dunklen Kapitel des 3. Reichs, die geteilten Jazzszenen der 1950er bis 1980er Jahre in Ost und West bis in die wiedervereinigte Gegenwart einer der lebendigsten Jazzszenen Europas reicht. Ausführlich und aussagekräftig bebildert werden Musiker, Bands, Spielorte, Festivals beschrieb, die sogenannte Jazzszene(n) also, zwischen Tradition und Avantgarde, einschließlich ihres unterschiedlichen Publikums. Eine Geschichte des Jazz in Berlin ist dabei zwangsläufig auch eine Geschichte von Musik als Widerständigkeit, von Jazz als einer von Nazis und Stasi misstrauisch beäugten oder gar verbotenen Kunst, sowie eine Geschichte der Wege, Orte und Möglichkeiten, die seine Anhänger immer wieder fanden, die Musik trotzdem zu hören oder zu spielen.
Rainer Bratfischs schwergewichtiges Buch “Jazz in Berlin” enthält weit mehr als jazzmusikalische Lokalgeschichten aus der Hauptstadt. Es ist in der Vernetzung der Berliner Jazzszene mit dem Rest Deutschlands (Ost wie West) eine eigentlich nur räumlich fokussierte Jazzgeschichte Deutschlands geworden, ein Steinbruch vielfältiger Informationen, die ausgewogen von den Anfängen der Jazzrezeption in den 1920er Jahren über die dunklen Kapitel des 3. Reichs, die geteilten Jazzszenen der 1950er bis 1980er Jahre in Ost und West bis in die wiedervereinigte Gegenwart einer der lebendigsten Jazzszenen Europas reicht. Ausführlich und aussagekräftig bebildert werden Musiker, Bands, Spielorte, Festivals beschrieb, die sogenannte Jazzszene(n) also, zwischen Tradition und Avantgarde, einschließlich ihres unterschiedlichen Publikums. Eine Geschichte des Jazz in Berlin ist dabei zwangsläufig auch eine Geschichte von Musik als Widerständigkeit, von Jazz als einer von Nazis und Stasi misstrauisch beäugten oder gar verbotenen Kunst, sowie eine Geschichte der Wege, Orte und Möglichkeiten, die seine Anhänger immer wieder fanden, die Musik trotzdem zu hören oder zu spielen.
Bratfisch hatte 2005 den Band “Freie Szene. Die Jazzszene in der DDR” herausgegeben, der eine umfängliche Dokumentation der ostdeutschen Jazzgeschichte darstellt. In seinem Berlin-Buch hat er sich für kleine, thematisch fokussierte Kapitel entschieden, die einzelne Künstler oder Bands behandeln (Weintraub Syncopators, Charlie and his Orchestra, Zentralquartett, Coco Schumann), die Clubszene näher beleuchten, über den Jazz im Rundfunk berichten, über Initiativen, Festivals, Konzertreihen, über Jazzförderung oder über die Möglichkeit, Jazz zu studieren. Insbesondere im historischen Teil seines Buchs gelingen ihm dabei Schlaglichter auf eine Welt zwischen Faszination an der immer noch exotischen Musik des Jazz und Professionalisierung einer mehr und mehr selbstbewussten deutschen Jazzszene. Die Darstellung der aktuellen Szene versucht möglichst vollständig alle Aktivitäten zu erwähnen und dabei die Vielfältigkeit des Berliner Jazz zu berücksichtigen, der eben aus weit mehr als traditionellen und modernen Stilrichtungen besteht, über den Tellerrand blickt und mit Einflüssen aus anderen Genres experimentiert, so dass die Grenzen schon mal verschwimmen. Er reicht dabei tatsächlich bis kurz vor Drucklegung – die aktuellsten Informationen, die er verarbeitet, stammen vom Herbst 2013.
Bratfisch ist Journalist, seine Erzählung daher vor allem eine von Menschen und ihren Aktivitäten. In die Musik selbst steigt er kaum ein, hier verlässt er sich auf das Vorwissen seiner Leser über Stile, klangliche Klischees und alle mit ihnen verbundenen Befindsamkeiten. “Jazz in Berlin” ist in seiner Konzeption ein gelungenes Buch zum Blättern, zum Nachlesen, zur Referenz über Entwicklungen des deutschen (also nicht nur Berliner) Jazz. Der Anhang enthält biographische Notizen zu 85 wichtigen Musikerinnen und Musikern, quer durch alle geschichtlichen und stilistischen Epochen des Hauptstadtjazz. Der Preis des Buchs ist sicher erheblich, die Aufmachung jedoch, sorgfältig gebundenes Hardcover im Pappschuber, und die vielen Fotodokumente machen es zu einem wichtigen Dokument zur gesamtdeutschen Jazzgeschichte.
Wolfram Knauer (März 2014)
Charlie Parker
von Wolfram Knauer
Stuttgart 2014 (Reclam)
203 Seiten, 12,95 Euro
ISBN: 978-3-15-020342-2
Als die Nachricht vom Tod Charlie Parkers am 15. März 1955 die Runde machte, war die Betroffenheit groß. Charles Mingus fasste die Lücke vielleicht am besten zusammen, die der Altsaxophonist auf der Jazzszene hinterließ: “Die meisten der Solisten im Birdland mussten immer auf Parkers nächste Platte warten, um herauszufinden, was sie als nächstes spielen sollten. Was werden die wohl jetzt tun?”
Charlie Parker ist eine der prägenden Persönlichkeiten der Musik des 20sten Jahrhunderts. Er tauchte just zu dem Zeitpunkt auf, als der Jazz sich von einer reinen Unterhaltungsmusik hin zu einer Kunstform entwickelte, die neben gesellschaftlichem Vergnügen eine ästhetische Aussage in den Vordergrund stellte. Parker war ein instrumentaler Virtuose auf seinem Instrument, dem Altsaxophon; er war darüber hinaus ein musikalischer Innovator, dessen Neuerungen auf der Tradition basierten. Man hat ihn als Revolutionär des Jazz bezeichnet, und man hat ihn den größten Bluesmusiker dieser Musik genannt, ihn also mit der Avantgarde genauso wie mit der Tradition afro-amerikanischer Musik in Verbindung gebracht.
Parkers Musik hat den Jazz beeinflusst wie vor ihm nur die von Louis Armstrong, wie nach ihm die von John Coltrane und Miles Davis. Viele seiner musikalischen Phrasen wurden von so vielen Musikern aller Instrumentengattungen nachgespielt, dass sie quasi ins Standard-Improvisationsvokabular des Jazz übergingen. Aber Parker war noch mehr als ein großartiger Musiker. Er lebte ein Leben, das Dichtern und Philosophen als das Musterbeispiel des Künstlers erschien, weil es neben der künstlerischen Perfektion auch das Chaos und Scheitern beinhaltete. Musik, Alkohol, Drogen – Parker wurde zum Synonym für das bewunderte musikalische Genie, dem es nicht gelang, sein Privatleben in Ordnung zu bringen. Und sein früher Tod mit gerade mal 34 Jahren sorgte mit dafür, dass seine Legende weiterlebt bis in unsere Tage.
Parkers Musik ist in bald 1.000 Aufnahmen dokumentiert, in Studiositzungen für die Labels Dial, Savoy und Verve sowie in Livemitschnitten aus diversen Clubs in New York, Los Angeles und anderswo. Seine Musik ist seine Hinterlassenschaft, zugleich aber auch klingende Gegenwart, denn sein Einfluss im Jazz dauert, direkt oder über inzwischen mehrere Generationen gebrochen, bis heute an.
Die Literatur zu Parker ist auch ohne dieses Büchlein riesig. Der Saxophonist, sein Leben und seine Musik diente als Vorbild für Kurzgeschichten, Romane, Gedichte, Gemälde, Skulpturen, und er wurde in Clint Eastwoods Bird selbst zur Filmfigur. Kurz nach seinem Tod tauchten erste Graffiti an New Yorker Hauswänden auf, die behaupteten: “Bird Lives!” Wie kann ein Mann tot sein, dessen Musik so viel an Kreativität inspiriert hat und in Werken so vieler anderer Künstler – aller Kunstgattungen – weiterlebt? Was aber machte ihn zu einem so bewunderten Künstler? Was trieb ihn an und was hinderte ihn, neben der Musik auch sein Leben in den Griff zu kriegen? Oder: Was war, was blieb? Die Grundfrage jeder Lebenserzählung…
Wolfram Knauer (Februar 2014)[:]
