At Home in Our Sounds. Music, Race, and Cultural Politics in Interwar Paris
von Rachel Anne Gillett
New York 2021 (Oxford University Press)
235 Seiten, 53 Britische Pfund
ISBN: 978-0-19-084270-3
 Die Kulturhistorikerin Rachel Anne Gillett nimmt sich in ihrem Buch ein oft behandeltes Thema vor: den die populäre schwarze Musik im Paris zwischen den beiden Weltkriegen. Doch wer dabei eine weitere Abhandlung über amerikanische Jazzmusiker in Paris erwartet, über die Faszination der Stadt an der Seine für amerikanische Künstler im allgemeinen, über die afro-amerikanische Exilszene in der französischen Hauptstadt, die davon schwärmte, hier freier und mit weniger Rassismus leben zu können als in den USA, wird enttäuscht… dafür aber belohnt mit einer Studie, die daran erinnert, dass schwarze Musik in Paris – und hier kann man ergänzen: schwarze Musik in Europa – in jenen Jahren eben nicht nur von US-amerikanischen Musiker:innen gespielt wurde, sondern dass es daneben jede Menge anderer schwarzer Musiker gab, die aus Französisch-Westafrika oder den französischen Antillen stammten, die sich wegen der Jazzmode hierzulande aber oft genug amerikanisierte Namen gaben. Tatsächlich ließen sich zahlreiche US-Musiker – das bekannteste Beispiel ist Louis Armstrong – bei ihren Tourneen auf dem Alten Kontinent von Bands begleiten, deren Mitglieder aufs Publikum wie Amerikaner wirkten, tatsächlich aber Briten oder Franzosen schwarzer Hautfarbe waren.
Die Kulturhistorikerin Rachel Anne Gillett nimmt sich in ihrem Buch ein oft behandeltes Thema vor: den die populäre schwarze Musik im Paris zwischen den beiden Weltkriegen. Doch wer dabei eine weitere Abhandlung über amerikanische Jazzmusiker in Paris erwartet, über die Faszination der Stadt an der Seine für amerikanische Künstler im allgemeinen, über die afro-amerikanische Exilszene in der französischen Hauptstadt, die davon schwärmte, hier freier und mit weniger Rassismus leben zu können als in den USA, wird enttäuscht… dafür aber belohnt mit einer Studie, die daran erinnert, dass schwarze Musik in Paris – und hier kann man ergänzen: schwarze Musik in Europa – in jenen Jahren eben nicht nur von US-amerikanischen Musiker:innen gespielt wurde, sondern dass es daneben jede Menge anderer schwarzer Musiker gab, die aus Französisch-Westafrika oder den französischen Antillen stammten, die sich wegen der Jazzmode hierzulande aber oft genug amerikanisierte Namen gaben. Tatsächlich ließen sich zahlreiche US-Musiker – das bekannteste Beispiel ist Louis Armstrong – bei ihren Tourneen auf dem Alten Kontinent von Bands begleiten, deren Mitglieder aufs Publikum wie Amerikaner wirkten, tatsächlich aber Briten oder Franzosen schwarzer Hautfarbe waren.
Gillett nimmt diese Tatsache zum Anlass nach den verschiedenen Abstufungen von Rassismus in der französischen Gesellschaft zu fragen, die es Musikern einerseits erstrebenswert schienen ließ, sich auf der Bühne als Amerikaner auszugeben, die andererseits Jazz spielten, eine ungemein produktive Musik, die ja jeden, ob Franzosen europäischer oder sonstiger Herkunft ermutigte, etwas Eigenes zuzugeben, Manouchetraditionen im Falle Django Reinhardts oder die Biguine, die sie aus dem karibischen Inselstaat Martinique mitgebracht hatten. Diese beiden Themenkomplexe also stehen im Zentrum ihres Buchs: der Unterschied im französischen Rassismus und die Entwicklung eigener Stilsprachen, in denen Jazz und insbesondere afro-karibische Elemente zusammenkamen.
Im ersten Kapitel beschreibt Gillett den Erfolg des Jazz in den 1920er Jahren, der einerseits eng mit dem “tumulte noir” verknüpft war, dem Einfluss afrikanischer und afro-amerikanischer Kunst und Performance auf die zeitgenössische Kunst und Musik im Paris jener Zeit, der andererseits schwarzen Parisern zum ersten Mal deutlich machte, dass in der Mehrheitsgesellschaft offenbar mit zweierlei Maß gemessen wurde, je nachdem, ob sie es mit der willkommenen Mode des Jazz zu tun hatte oder mit Menschen mit franko-kolonialer Vergangenheit. Gillett verweist dabei auch auf schwarze Aktivistengruppen und zeichnet die Diskurse der Zeit nach.
Im zweiten Kapitel behandelt die Autorin den Erfolg afro-amerikanischer Musiker:innen im Europa jener Jahre, die Erfahrung einer von weit weniger, zumindest aber erheblich anderen rassistischen Regeln geprägten Gesellschaft als daheim in den USA. Sie nennt Namen wie Ada ‘Bricktop’ Smith, eine Sängerin, die ab 1924 einen Nightclub führte, in dem sich nicht nur die Hautfarben mischten, sondern auch die Celebrities Amerikas und Frankreichs. Sie beschreibt aber auch, wie Künstler:innen etwa aus Martinique die Chance ergriffen und in dieser Szene mitmischten. Zugleich erwähnt sie die unterschiedliche Lebenswirklichkeit weißer, afro-amerikanischer und schwarzer französischer Musiker:innen und wie ihr jeweiliges Bewusstsein in Bezug auf politischen Aktivismus oder gesellschaftliche Verhältnisse zu einer Art politischem schwarzen Kosmopolitismus führte.
1931 fand die sechsmonatige “Exposition Coloniale” in Paris statt, bei der die Diversität der Kulturen und Ressourcen der französischen Kolonien vorgeführt werden sollten. Gillett beschreibt, wie wichtig unterschiedliche Arten von Performance bei dieser Ausstellung waren, die – ähnlich wie bei Völkerschauen in Deutschland – zeigen sollten, wie die Menschen in anderen Teilen der Welt lebten und arbeiteten. Daneben gab es über-stilisierte Volkstänze und Volksmusik, die zuhause einer community-Funktion dienen mochten, hier aber zu rein stereotypen Klischees verkamen. Gillette zitiert aus Berichten über die Ausstellung, die solche Stereotype weitertragen, diskutiert aber auch die Kritik, die von anti-kolonialen Gruppen und Netzwerken kam. Die Ausstellung sei ein großer Erfolg für die Veranstalter gewesen, schreibt sie, wozu die Musik erheblich beigetragen habe. Auch für einige der beteiligten Musiker machte sich die Teilnahme an der Exposition bezahlt gemacht, den Klarinettisten Alexandre Stellio beispielsweise, dessen Band im Pavillon von Martinique gespielt hatte und die Popularität und Sichtbarkeit der antillischen Biguine in Frankreich anschob. Er und andere Kolleg:innen erhielten erfolgreiche Anschlussengagements in Pariser Clubs und Music-Halls.
Kapitel 4 ordnet den Erfolg der Biguine kulturpolitisch ein. Anders als der Blues oder der Charleston habe es sich hierbei eben um eine genuine Tradition von Menschen gehandelt, die in Frankreich lebten, war der Biguine zwar auch Export, aber einer also, der in der Kultur kolonialer französischer Subjekte verankert war. Gillett beschreibt die Erklärungsversuche der Zeit, wie sich Biguine und Jazz unterschieden, sie beschreibt Biguine zugleich als eine Musik, die es karibischen Musikern ermöglichte sich mit dieser Mischung aus afro-amerikanischen und eigenen traditionellen Momenten zu identifizieren. Und sie beschreibt Biguine als eine Community-Praxis, als Tanz, der Menschen unterschiedlicher Klassen und beider Geschlechter erreichte und einband.
1935 fiel Italien in Äthiopien ein. Im selben Jahr feierte man in Frankreich die 300jährige Kolonialisierung der Antillen. Höhepunkt der Feier war eine “Nuit Antillaise” in der Pariser Oper, die auch der Präsident besuchte, bei der Stellio auftrat und die Biguine und andere antillische Folklore zu erleben war – die Komponistin und Sängerin Maïotte Almaby schrieb eine spezielle Biguine für den Abend. Anti-Kolonialisten missfiel das romantisierte Bild, das auf der Nuit Antillaise präsentiert wurde; sie kritisierten auch, dass bei den hohen Eintrittspreisen die antillischen Arbeiter in Paris, deren Kultur hier ja auch gefeiert wurde, ganz bestimmt nicht dabei sein konnten. Gillette beschreibt die durch die Musik, aber auch die Berichte über Italiens Einmarsch in Äthiopien in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre ausgelösten Diskurse, eine neue Welle von Fremdenfeindlichkeit und Faschismus in ganz Europa. Und sie beschreibt, wie letztlich die deutsche Besatzung und der II. Weltkrieg den durchaus selbstbewussten Forderungen der anti-kolonialistischen, afro-französischen Community ein vorläufiges Ende bereitete. Als Hitler in Paris darauf angesprochen wurde, dass amerikanische Schwarze zur Kultur der Stadt erhebliches beigetragen hätten, antwortete er angeblich: “Wir werden zahlreiche Aufführungen der führenden Künstler aus aller Welt hier haben, aber die werden alle dem nordischen Ideal nachstreben.”
Im letzten Kapitel wirft Gillett noch einen Blick auf die Folgen des Kriegs für die Akzeptanz des Jazz einerseits und das Leben und die Kunst insbesondere antillischer Musiker andererseits. “Die Spannung zwischen Dazugehören und Französischsein”, schreibt sie, “charakterisieren noch heute die Diskurse in der französischen Gesellschaft und Musik, wie das lebendige und auch politisch engagierte Genre des französischen HipHop zeigen mag. Musik hat die Geschichte des schwarzen Frankreich geformt. (…) Die schwarze Kulturpolitik, die das Paris zwischen den Kriegen charakterisierte, klingt auch im 21sten Jahrhundert nach.”
Rachel Anne Gilletts Buch ist also keine Geschichte des Jazz im Paris der 1920er und 1930er Jahre. Mit ihrem Blick auch die Black Community – und zwar sowohl die afro-amerikanische wie auch die afro-französische – öffnet sie aber das Bewusstsein ihrer Leser:innen dafür, dass Musik schon in dieser Zeit nie nur eine Einbahnstraße war, nicht bloß US-amerikanischer Export, der hierzulande nur rezipiert wurde, sondern schon damals sehr direkt als Möglichkeit der Identifikation genutzt wurde, von afro-amerikanischen genauso wie afro-französischen Musiker:innen. Gillett verweist dabei auf Perspektiven, die sich auch in anderen europäischen Ländern beleuchten ließen, jenen mit langer kolonialer Vergangenheit wie insbesondere England, Spanien, Portugal und Italien genauso wie jenen mit vergleichsweise kurzer kolonialer Geschichte wie Deutschland. Ansätze für solch eine Auseinandersetzung existieren bereits; Gillett zeigt, wie wichtig der Perspektivwechsel sein kann, um den Diskurs aus unterschiedlichen Warten verstehen zu lernen.
Wolfram Knauer (April 2023)
Steve Lacy (unfinished)
herausgegeben von Guillaume Tarche
Nantes 2021 (Lenka Lente)
478 Seiten, 27 Euro
ISBN: 979-10-94601-40-2
 Steve Lacy war eine faszinierende Persönlichkeit. Ein Musiker, der mit 16 Jahren anfing traditionellen Jazz zu spielen und mit 22 auf Cecil Taylors Debutalbum “Jazz Advance” mitwirkte, der kurzzeitig Mitglied in Thelonious Mons Band war, dessen Stücke zeitlebens in seinem Repertoire blieben, dann Teil der europäischen Avantgarde/Free-Jazz-Szene wurde, erst in Italien, dann in Paris, von wo aus er mit seinem Sextett tourte, ab den 1970er Jahren aber immer wieder auch als Solist auf dem Sopransaxophon auftrat. Auf einem Instrument, das nach dem großen Sidney Bechet kaum ein Saxophonist mehr angerührt hatte, weil sein Beispiel einfach zu einflussreich war. Eigentlich war John Coltrane der einzige neben Lacy, der auf dem Instrument neue Wege beschritt (und Coltrane, erinnert sich Urs Leimgruber, hatte das Instrument aufgenommen, weil Lacy gezeigt hatte, dass man sich von Bechet lösen konnte). Lacy jedenfalls entwickelte einen ganz eigenen Ton, und aus dem Ton eine eigene Handschrift, die man sowohl in seinen Kompositionen wie auch seinen Improvisationen erkennen konnte. Diese Geradlinigkeit in seinem Spiel beeinflusste Musiker:innen weit über seine eigene Instrumentenfamilie hinaus, insbesondere in Europa, wo er den Ruf hatte, die Freiheit des Free Jazz mit einem Groove zu vermählen, der mal boppig klang, mal wie ein französisches Chanson, mal nach Monk, dann nach europäischer Avantgarde.
Steve Lacy war eine faszinierende Persönlichkeit. Ein Musiker, der mit 16 Jahren anfing traditionellen Jazz zu spielen und mit 22 auf Cecil Taylors Debutalbum “Jazz Advance” mitwirkte, der kurzzeitig Mitglied in Thelonious Mons Band war, dessen Stücke zeitlebens in seinem Repertoire blieben, dann Teil der europäischen Avantgarde/Free-Jazz-Szene wurde, erst in Italien, dann in Paris, von wo aus er mit seinem Sextett tourte, ab den 1970er Jahren aber immer wieder auch als Solist auf dem Sopransaxophon auftrat. Auf einem Instrument, das nach dem großen Sidney Bechet kaum ein Saxophonist mehr angerührt hatte, weil sein Beispiel einfach zu einflussreich war. Eigentlich war John Coltrane der einzige neben Lacy, der auf dem Instrument neue Wege beschritt (und Coltrane, erinnert sich Urs Leimgruber, hatte das Instrument aufgenommen, weil Lacy gezeigt hatte, dass man sich von Bechet lösen konnte). Lacy jedenfalls entwickelte einen ganz eigenen Ton, und aus dem Ton eine eigene Handschrift, die man sowohl in seinen Kompositionen wie auch seinen Improvisationen erkennen konnte. Diese Geradlinigkeit in seinem Spiel beeinflusste Musiker:innen weit über seine eigene Instrumentenfamilie hinaus, insbesondere in Europa, wo er den Ruf hatte, die Freiheit des Free Jazz mit einem Groove zu vermählen, der mal boppig klang, mal wie ein französisches Chanson, mal nach Monk, dann nach europäischer Avantgarde.
Lacys Biographie allein wäre ein Buch wert, und Jason Weiss hat ein solches bereits 2006 veröffentlicht, zwei Jahre nach Lacys Tod. Guillaume Tarche nähert sich Lacy von einer anderen Seite. Er lässt dessen Mitmusikerinnen und Mitmusiker zu Worte kommen, Kolleg:innen, die durch Lacys Musik nachhaltig geprägt und beeinflusst wurden, amerikanische und europäische Künstler, Mitglieder seiner Band und Projektpartner über die Jahre. Er fragte sie nach ihren Erinnerungen, danach, was sie in Lacys Musik hörten. Das Ergebnis sind 44 Kapitel, die jedes für sich von anderer Warte Lacys Musik, seine Persönlichkeit, seinen Einfluss beleuchten.
Die Sängerin und Geigerin Irène Aebi etwa erzählt, wie sie sich in Lacy verliebte, als dieser in Rom lebte. Martin Davidson beschreibt die ganz unterschiedlichen Seiten in Lacys Herangehensweise an Musik. James Lindblom erinnert an die Beziehung Lacys zu Lindbloms Tante, der Malerin Judith Lindblom, in den Mitt-1950er Jahren und zitiert aus Briefen zwischen den beiden. Guillermo Gregorio traf Lacy 1966 in Buenos Aires und vergleicht die Stadt, die Lacy kennenlernte mit der, in der er, Gregorio, lebte. Alvin Curran erinnert sich an Lacys Mitwirkung bei der Gruppe Musica Elettronica Viva 1968 in Rom. Ken Carter beleuchtet die späten 1960er und frühen 1970er Jahre, in denen er mit Lacy spielte. Allan Chase erinnert an die Zeit in den frühen 2000ern, als Lacy am New England Conservatory unterrichtete.
Evan Parker, Bruno Tocanne, Andrea Centazzo, Etienne Brunet, Jason Weiss, Christoph Gallio, Elsa Wolliaston, die Harfenistin Suzanna Klintcharova erinnern sich an ihren Kollegen und der Klarinettist Ben Goldberg berichtet von einer Unterrichtsstunde, die er 1986 in Paris beim Saxophonisten nahm. “I wanted to know how he did it”, schreibt Goldberg. Es seien die Melodien gewesen, die Lacy spielte, die ihn faszinierten, die Struktur, die er aus den Noten baute. Goldberg erinnert sich an Lacys Übemethoden, Skalen langsam spielen, während man im Raum herumläuft, jeder Ton ein Schritt, so dass die Töne unabhängiger voneinander werden. “Wenn du nur lang genug im Dunekln sitzt”, sagte ihm Lacy, “wirst du irgendwann das Licht sehen.” Und Urs Leimgruber erzählt von seiner eigenen anfänglichen Begeisterung für Bechet und Coltrane und darüber, wie Lacy in Nickelsdorf im Publikum saß, als er einmal einen Soloset spielte, außerdem erinnert er sich, dass er ihn ab und zu in seinem Pariser Apartment übern hörte, von dem er nicht weit entfernt wohnte.
Phillip Johnson analysiert Lacys “Prospectus”; Bill Shoemaker druckt ein Interview ab, das er 1999 mit dem Sopransaxophonisten führte. Roberto Ottaviano und Vincent Lainé beschäftigen sich mit Lacys Auseinandersetzung mit Poesie und dem Dichterischen. Dave Liebman lobt Lacys “consistency” und nennt ihn einen “long distance runner”. Uwe Oberg erinnert sich, dass ihm Lacy anfangs gar nicht so gefallken habe und wie er erst nach seinem Tod auf die Idee gekommen sei eine Band um die Kompositionen des Saxophonisten herum zu bauen, das Quartett Lacy Pool, dem anfangs ganz bewusst kein Saxophonist angehörte. Evan Parker und Seymour Wright schließlich hören gemeinsam Aufnahmen aus Lacys Diskographie und unterhalten sich über seine musikalische Entwicklung.
Lacys Kompositionen sind mehrere Kapitel gewidmet, unter anderem zwei analystische von Frank Carlberg und Jorrit Dijkstra sowie ein weiteres von Josh Sinton. Die Bedeutung der Musik Thelonious Monks für Lacy streichen Jacques Ponzio und Peter Katz heraus. Jon Raskin kommentiert eine Platte der Band ROVA, auf der diese Lacy-Stücke interpretiert; Steve Adams steuert die Partitur für zwei Arrangements bei, die er für Rova über “The Throes” und “Clichés” schrieb. Gilles Laheurte erinnert sich an eine Japantournee des Saxophonisten, und Jason Weiss beschließt das Buch mit einer Reflektion darüber, was das Wesen in Steve Lacys Musik ausmachte: der einzelne Ton.
Guillaume Tarches Buch ist eine mehr als gelungene Annäherung an Steve Lacys Musik. Gerade in der Vielgestalt der Berichte und Erinnerungen, der Analysen und Gespräche kommen unterschiedliche Seiten der Künstlerpersönlichkeit zum Tragen. Es ist ein Taschenbuch, doch ein dickes. Und weil es so viele Seiten aufschlägt, hätte man sich einen Index gewünscht, der Querverweise erschließen ließe. Aber das ist – zumindest für diesen Leser – auch das einzige Manko einer Labor of Love und einer würdigen Verbeugung vor einem großartigen Musiker. Steve Lacy (unfinished) – vielleicht nicht vollended, aber ein guter Anfang für eine eingehende Beschäftigung mit seiner Musik!
Wolfram Knauer (Oktober 2022)
Beneath Missouri Skies. Pat Metheny in Kansas City 1964-1972
von Carolyn Glenn Brewer
Denton/TX 2021 (University of North Texas Press)
266 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-57441-823-1
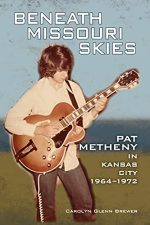 “Genies kommen nicht einfach aus dem Nichts”, lobt Peter Erskine das Buch, das Carolyn Glenn Brewer der Jugend des Gitarristen gewidmet hat, der Zeit zwischen seinem 10. und 18. Lebensjahr, um genau zu sein. Sie beginnt 1964, als Pat die Beatles bei ihrem ersten Auftritt in einer US-amerikanischen Fernsehshow sieht, und sie endet 1972, also zwei Jahre bevor er Mitglied der Gary Burton Band wird.
“Genies kommen nicht einfach aus dem Nichts”, lobt Peter Erskine das Buch, das Carolyn Glenn Brewer der Jugend des Gitarristen gewidmet hat, der Zeit zwischen seinem 10. und 18. Lebensjahr, um genau zu sein. Sie beginnt 1964, als Pat die Beatles bei ihrem ersten Auftritt in einer US-amerikanischen Fernsehshow sieht, und sie endet 1972, also zwei Jahre bevor er Mitglied der Gary Burton Band wird.
In der Familie Metheny spielte man Trompete, und auch der jüngste Sohn sollte diese Tradition fortführen, aber als Pat die Beatles gesehen hatte, wollte er unbedingt eine elektrische Gitarre. Für selbstverdiente 60 Dollar kaufte er sich sein erstes Instrument und begann mit Freunden in einer Beat-Band zu üben. Dann aber hörte er erst Miles Davis’ “‘Four’ & More”, dann Wes Montgomery’s “Goin’ Out of My Head”, und er hatte ein neues musikalisches Ziel.
Brewer begleitet Metheny beim Jazzcamp, erlebt ihn, wie er immer wieder erstaunt ist, auf verwandte Seelen zu treffen, Leute in seinem Alter, die sich genau wie er für Jazz interessierten vielleicht sogar einige der Größen so verehrten wie er. Sie erzählt vom New Sounds Trio und vom National Stage Band Camp, an dem Pat mit Freunden teilnahm und sich von einem der Lehrer, Attila Zoller, jede Menge technische Kniffs abschaute. Sie zeichnet das Bild der verschiedenen Communities, in denen Pat seinen Weg zwischen Nachahmung der Vorbilder und Experiment gehen konnte. Sie beschreibt Workshops in Kansas City und deren Effekt auf die lokale Szene; sie verweist auf das jährliche Kansas City Jazz Festival, bei dem neben den großen Namen immer auch lokale Talente auftraten. Hier hörte Pat seinen großen Helden zum ersten Mal live, Wes Montgomery, und holte sich ein Autogramm. Bei diesen Festivals wurde den weißen Jungen auch mehr als zuvor bewusst, dass ihr Interesse einer Musik galt, die von Afro-Amerikanern geschaffen worden waren, ein Bewusstsein für die Problematik des Rassismus, die in jenen Jahren (Ermordnung Martin Luther Kings) auch in den Straßen von Kansas City deutlich zu spüren war.
In Kansas City jedenfalls hatte Pat dann auch seinen ersten regelmäßigen Gig, 16 bis 19 Uhr zum Dinner an vier Abenden in der Woche. Die Band spielte Standards und Stücke aus dem Repertoire Wes Montgomerys, aber offensichtlich auch zu viele Monk-Stücke, die den Restaurantbesuchern nicht ganz so gut gefielen, so dass ihnen bereits nach zwei Wochen gekündigt wurde. Als er einmal beim Konzert eines anderen Ensembles einstieg, war der Pianist beeindruckt: “Ich würde ihm gern alle Finger brechen”, sagte er scherzhaft – Pat Metheny war auf dem Weg zum Weltklasse-Gitarristen. Auch andere in der Musikszene wurden auf ihn aufmerksam.
Brewer beschreibt die im Jazz besonders wichtige Meister-Schüler-Beziehung, etwa am Beispiel des Trompeters Dave Scott, einem von Methenys Jugendfreunden, den Clark Terry unter seine Fittiche nahm und ihm sowohl musikalisch wie auch menschlich einiges mit auf den Weg gab. Sie beschreibt Gigs zwischen Dinnermusik und Fusion, die verschiedenen Locations, in denen Metheny sein Handwerk lernte, sowie Mentoren und Kollegen, die seine Entwicklung beeinflussten. Und sie beendet sein Buch mit dem Schulabschluss Methenys und seinem Umzug zum Musikstudium in Miami.
Carolyn Glenn Brewers Buch ist eine sehr unübliche Biographie, die beispielhaft zeigt, wie wichtig die musikalische Prägephase für Jazzkünstler:innen ist. Sie wirft den Blick auf die Musik selbst, vor allem aber aufs musikalische Umfeld, auf Menschen, Orte, Chancen – und daneben die jugendliche Hingabe, die junge Musiker über sich selbst hinauswachsen lassen kann. Sie zeigt, wie wichtig die Dokumentation lokaler Szenen sein kann, und eben nicht nur an den bekannten Standorten dieser Musik. Und sie ermutigt solche Dokumentationen weitsichtig auch für andere Regionen, Zirkel, Musiker:innen zu erstellen.
Wolfram Knauer (August 2022)
Ode to a Tenor Titan. The Life and Times and Music of Michael Brecker
von Bill Milkowski
Guilford/CT 2021 (Backbeat Books)
374 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-4930-5376-6
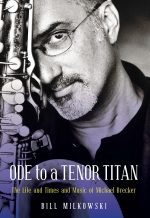 Bill Milkowski ist ein erfahrener Journalist und Mitarbeiter vieler internationaler Fachzeitschriften. Sein jüngstes Buch widmet sich dem Leben und der Musik des Saxophonisten Michael Brecker, einem der vielleicht einflussreichsten Musiker des ausgehenden 20sten Jahrhunderts. Von seinem Einfluss zeugen zahlreiche Statements von Kollegen, die Milkowski im Vorwort sammelt. Er habe nur einmal den Fehler gemacht ein Solo nach Brecker zu spielen, erinnert sich etwa David Sanborn. Andere schwärmen von seiner Virtuosität, seiner bewundernswerten Technik. Sein Einfluss sei so dominant gewesen, erklärt Joshua Redman, dass man einfach eine Meinung zu ihm haben musste, schon aus dem einfachen Grund, weil sein Sound, sein musikalisches Konzept so überzeugend gewesen seien, dass diese die Fähigkeit nahezu aller jüngerer Saxophonisten gefährdet hätten, einen eigenen Weg zu finden.
Bill Milkowski ist ein erfahrener Journalist und Mitarbeiter vieler internationaler Fachzeitschriften. Sein jüngstes Buch widmet sich dem Leben und der Musik des Saxophonisten Michael Brecker, einem der vielleicht einflussreichsten Musiker des ausgehenden 20sten Jahrhunderts. Von seinem Einfluss zeugen zahlreiche Statements von Kollegen, die Milkowski im Vorwort sammelt. Er habe nur einmal den Fehler gemacht ein Solo nach Brecker zu spielen, erinnert sich etwa David Sanborn. Andere schwärmen von seiner Virtuosität, seiner bewundernswerten Technik. Sein Einfluss sei so dominant gewesen, erklärt Joshua Redman, dass man einfach eine Meinung zu ihm haben musste, schon aus dem einfachen Grund, weil sein Sound, sein musikalisches Konzept so überzeugend gewesen seien, dass diese die Fähigkeit nahezu aller jüngerer Saxophonisten gefährdet hätten, einen eigenen Weg zu finden.
Tatsächlich war in den 1980er und 190er Jahren nicht nur in den USA von “Brecker Clones” die Rede, von Musikern also, die technisch perfekt klangen, denen man aber (anders übrigens als Brecker selbst) gern mal die Originalität und emotionale Tiefe absprach. Egal in welchem Kontext er arbeitete, argumentiert Milkowski, ob im bebop-beeinflussten modernen Jazz, in Jazzrock-Gruppen wie den Brecker Brothers mit seinem Bruder Randy, ob er mit Popstars zusammenspielte oder Claus Ogermans Suite “Cityscape” interpretierte, überall habe er zu überzeugen gewusst. Dabei sei der Saxophonist ungemein bescheiden geblieben, ein liebenswerter und empathischer Mensch. Herbie Hancock erinnert sich: “Jedes Solo, das Michael spielte, war einfach nur brillant. Wir kamen von der Bühne und ich sagte ihm: ‘Michael, das war einfach unglaublich.’ Und er antwortete nur: ‘Oh, Mann, das tut mir leid.’ Er entschuldigte sich!”
Milkowksi beginnt in Michael Breckers Kindheit in einem hochmusikalischen Haushalt. Ein Großonkel hatte 1916 den Roseland Ballroom in Philadelphia gegründet, den er drei Jahre später nach New York umzog und wo in der Swingära alle großen Bigbands der Zeit auftraten. Sein Vater hatte ein Klavier, ein Schlagzeugset und einen Kontrabass im Wohnzimmer stehen, und es habe immer wieder Jam Sessions zuhause gegeben. “Ich dachte lange Zeit”, erinnert Michael sich, “das machen alle Familien so.” Milkowski erzählt von Breckers Anfängen auf der Klarinette, seinem Wechsel erst zum Alt-, dann zum Tenorsaxophon und vom Einfluss seines größeren Bruders Randy. Er weiß um Breckers Studium und erste Auftrittserfahrungen, etwa in einer Band zusammen mit dem Trompeter Randy Sandke, in der die Musiker bereits mit einer Fusion zwischen Jazz und Rock experimentierten.
1969 kam Brecker nach New York und wurde durch seinen Bruder schnell rumgereicht, der sich zwischenzeitlich in der Band von Horace Silver einen Namen gemacht hatte, aber auch gute Kontakte in die Studioszene besaß. Milkowski hört sich Michaels erstes Studioalbum an, eingespielt unter dem Namen seines Bruders im legendären Rudy van Gelder-Studio, und er verfolgt den Erfolg der Band Dreams, in der Randy, Michael und Billy Cobham zusammen wirkten. Mike kam ins New York der großen Lofts, in denen Musiker (wie auch andere Künstler) auf ganzen Fabriketagen lebten und arbeiteten, und Milkowski beschreibt die Szene anschaulich, in der Brecker herausstach, weil er einerseits technisch brillant war, dabei aber auch die die Wurzeln seines Instruments im Blues und R&B kannte.
1974 waren Randy und Mike mit Yoko Ono auf Tournee, die alle Beteiligten als reinstes Desaster erinnern, aber auch als Beginn der Brecker Brothers Band, die im Januar 1975 erstmals in Studio ging. Milkowski hört sich die Alben an und spricht mit Zeitzeugen der Aufnahmen. Michael gehörte zu den aktivsten Musikern der Szene jener Jahre, wie sein Kalender des Jahres 1977 zeigt: Aufnahmen mit Hank Crawford, der J. Geils Band, mit Chet Baker, Charles Earland, Arif Mardin, Bob James und Fred Wesley, mit Bette Midler, Phoebe Snow, Patti Austin und Paul Simon, dazu zahlreiche Werbegigs.
Brecker hatte seit Hochschultagen gern getrunken; in den 1970er Jahren wechselte er vom Alkohol zum Heroin. Bob Mintzer erklärt Milkowski, wie Heroin ihm selbst den Mut gegeben habe in Situationen zu spielen, in denen er sich normalerweise zurückgehalten hätte, und Milkowski zitiert Jimmy Heath, Heroin habe halt keinen Einfluss auf die musikalischen Fähigkeiten, er selbst habe sich unter Heroin sogar besser konzentrieren können als unter irgend einer anderen Droge. Brecker also war oft unter Drogeneinfluss, was sein Spiel vordergründig nicht störte. Heroin oder bald darauf Kokain waren die Drogen der Zeit. In den 1970er, erinnert sich David Liebman, sei eigentlich jeder von irgendwas high gewesen.
1977 mieteten die Breckers zusammen mit einer Partnerin einen Club auf der Seventh Avenue South an, den sie immerhin acht Jahre lang betrieben. Neben dem normalen Programm feierten die Breckers dort den Release ihrer neuesten Alben. Michael blieb auf unterschiedlichem stilistischen Terrain aktiv, spielte mit Joni Mitchell, nahm ein Album mit Pat Metheny auf, ein anderes mit Chick Corea und wirkte in der Band Steps Ahead mit. Er lebte sein Leben auf der Überholspur, doch irgendwann merkte er, dass er das Junkie-Dasein nicht mehr ertragen mochte. Im Dezember 1981 begab Michael Brecker sich in eine Entzugsklink in Florida, im Januar 1982 begann er, zurück in New York, sein Leben neu zu ordnen.
Nach dem Entzug sei Brecker ein anderer Mensch gewesen, schreibt Bill Milkowski, und zitiert zahlreiche Kollegen, die Michaels neuen Fokus zu schätzen wussten, aber auch seine Unterstützung anderer drogenabhängiger Musiker. Auch sein Privatleben entspannte sich, als er seine spätere Frau Susan kennenlernte. Er machte Aufnahmen mit Steps Ahead und wagte 1987 endlich eine eigene Band auf die Beine zu stellen. Wir erfahren von Breckers Problemen mit einer Hernie im Kehlkopf und Versuchen mit einem Stützband um den Hals, mit leichtgängigeren Mundstücken oder mit elektronischen Instrumenten wie dem EWI zumindest zeitweise Linderung zu erfahren. Er tourte mit Paul Simon und trat wieder zusammen mit seinem Bruder auf, er spielte mit McCoy Tyner und Elvin Jones, den früheren Begleitern seines Idols John Coltrane, und mit Herbie Hancock, auf dessen “The New Standard”-Album er mitwirkte. Er spielte mit amerikanischen genauso wie mit europäischen Bands. Im Saxophone Summit traf er außerdem auf seine Freunde und Kollegen Joe Lovano und Dave Liebman, und er wirkte auf Charlie Hadens “American Dreams” mit.
Anfang der 2000er Jahre hatte Brecker immer wieder mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen, und im Herbst 2004 wurde bei ihm MDS festgestellt, eine Erkrankung des Knochenmarks. Im Sommer 2005 ging er zu einer Chemotherapie ins Krankenhaus; gleichzeitig wurde weltweit nach Stammzellenspendern gesucht. Im Juni 2006 stand Michael Brecker zum ersten Mal nach einem Jahr wieder auf der Bühne, zu einem Konzert aus Anlass von Herbie Hancocks 60stem Geburtstag. Er nahm eine weitere Platte auf, “Pilgrimage”, dann wurde er im Oktober des Jahres mit der Diagnose akute Leukämie konfrontiert. Seine Freunde verabschiedeten sich von ihm, am 13. Januar 2007 starb Michael Brecker in einem Krankenhaus in Manhattan.
Bill Milkowski erzählt Michael Breckers Geschichte mit viel Wissen und mit Empathie. Es sind die empathischen Passagen seines Buchs, die sich zügig lesen; an anderen Stellen hindert manchmal die Menge an Fakten. Milkowski hat mit zahlreichen Freunden, Kollegen, Weggefährten des Saxophonisten gesprochen, deren Einschätzungen Breckers als Saxophonist, als Mensch, als Künstler sich schon mal verdoppeln. Hier hätte Milkowski vielleicht gut getan, das eine oder andere Zitat wegzulassen, zumal er die Weggefährten noch einmal in einem Anhang zu Wort kommen lässt.
Eine kritische Biographie ist sein Buch gewiss nicht geworden, dafür ist Milkowski zu sehr Fan der Musik Michael Breckers. Das macht aber nichts, weil Milkowski seine Position von vornherein klarstellt und man als Leser weiß, aus welcher Warte das alles erzählt wird. Aus Sicht dieses Lesers jedenfalls bleiben insbesondere Passagen über Breckers Zielgerichtetheit in Erinnerung, die genauso seine Musik beeinflussten wie auch seine Abwendung von den Drogen ermöglichten. Und dann wird man, immer noch eine der wichtigsten Begleiterscheinungen bei der Lektüre von Biographien, angeregt, zahlreiche Aufnahmen wiederzuhören, das lyrische “Cityscape” von 1982 etwa, einige der Fusionplatten der 1970er, Herbie Hancocks “New Standard” und natürlich all die Aufnahmen unter seinem eigenen Namen. Und da es Milkowski gelingt, seinen Helden mit allen Stärken und Schwächen darzustellen, meint man nach der Lektüre tatsächlich einen anderen Brecker zu hören als zuvor, wissend, was es braucht um zu der Meisterschaft zu gelangen, für die Michael Brecker bis heute berühmt ist.
Wolfram Knauer (Juli 2022)
Ein bissl Bebop bevor ich geh’. Die Autobiographie von Heinz von Hermann
von Heinz von Hermann
Wien 2021 (MyMorawa)
490 Seiten, 19,50 Euro
ISBN: 978-3-99125-849-0
 Heinz von Hermann: ein Name, der aus der bundesdeutschen Bigbandlandschaft der 1960er bis 1980er Jahre nicht wegzudenken ist: Max Greger, SFB (Paul Kuhn), RIAS, Peter Herbolzheimers Rhythm Combination & Brass, Zusammenarbeit mit den Bigbands des NDR und des Hessischen Rundfunks, Tausende Aufnahmen als Studiomusiker mit Stars aus den unterschiedlichsten Welten der Unterhaltung, Arrangements für eine Vielzahl an Bands, Solist, der sich in modernen Zusammenhängen genauso wohlfühlt wie im Swing. Aber: “Ein bissl Bebop bevor ich geh'”: Der Titel seiner Biographie erklärt dann doch recht deutlich, an welcher Musik sein Herz hängt.
Heinz von Hermann: ein Name, der aus der bundesdeutschen Bigbandlandschaft der 1960er bis 1980er Jahre nicht wegzudenken ist: Max Greger, SFB (Paul Kuhn), RIAS, Peter Herbolzheimers Rhythm Combination & Brass, Zusammenarbeit mit den Bigbands des NDR und des Hessischen Rundfunks, Tausende Aufnahmen als Studiomusiker mit Stars aus den unterschiedlichsten Welten der Unterhaltung, Arrangements für eine Vielzahl an Bands, Solist, der sich in modernen Zusammenhängen genauso wohlfühlt wie im Swing. Aber: “Ein bissl Bebop bevor ich geh'”: Der Titel seiner Biographie erklärt dann doch recht deutlich, an welcher Musik sein Herz hängt.
Jetzt hat Heinz von Hermann seine Autobiographie veröffentlicht, ein Buch voller Geschichten, voller Erinnerungen, voller Namen, voller Musik. Zu erzählen hat er ja wirklich viel: über die Jugendzeit in Wien, erste Banderfahrungen am Kontrabass, bevor er mit der Uzi Förster Band nach Deutschland kommt, mit Peter Herbolzheimer in Nordafrika spielt, mit Gerry Hayes in Holland. Er lebt und arbeitet fast vier Jahre lang in Spanien, beginnt dann 1968 seine Bigbandkarriere, in der er internationale Stars begleitet, aber immer auch als Solist zu Gehör kommt. Er unterrichtet, gibt Workshops, veröffentlicht Platten unter eigenem Namen sowie Übungsbücher für Saxophonisten.
Von all dem handelt dieses Buch auch, zu all dem finden sich lesenswerte Anekdoten auf den fast 500 Seiten. Vor allem aber handelt es von Heinz von Hermann, von seiner Sicht auf die Welt und die Jazzszene, von seinen sehr persönlichen Erlebnissen und Begegnungen, von seinem Lebensweg, nicht immer gerade, aber am Ende doch ziemlich zielgerichtet. Er macht dabei aus seinem Herzen keine Mördergrube, erinnert sich ziemlich genau an die Empfindungen über Kollegen, Kritiker, Stilrichtungen, die ihm mal imponierten, die ihn aber durchaus auch mal irritiert zurückließen.
Sein Buch ist dabei so persönlich geschrieben, dass man gar nicht auf die Idee käme, es als eine objektive Berichterstattung über 70 Jahre österreichisch-deutsche Jazzgeschichte zu lesen. Stattdessen lässt man sich schnell und dankbar auf die Anekdoten ein, und auch auf seine unverstellt offene und subjektive Meinung. Ja, manchmal wird’s etwas zu kleinteilig, wenn man das Gefühl hat, Heinz von Hermann fällt aber auch zu jedem Konzert jeder Band, mit der er jemals gespielt hat, noch eine weitere Geschichte ein. Doch auch dann lohnt es sich weiterzublättern und dabei vielleicht unerwartete Anekdoten zu entdecken, die nicht unbedingt Jazzgeschichte erzählen, immer aber die Stimmung der Zeit wiedergeben, das Lebensgefühl, aus dem heraus Hermann und viele seiner Kollegen Musik machten.
Heinz von Hermann ist mittlerweile 85 Jahre alt. Er spielt immer noch, in Wien mit seiner eigenen Band, auf Tour z.B. mit Joe Haiders Sextett. Er hat seinen ganz eigenen Sound, tief verwurzelt im afro-amerikanischen Jazz der Postbop-Ära, kraftvoll und antreibend. Ein wenig von diesem Sound hat er auch in die Zeilen seines Buchs transportiert, ein herrlich swingendes Solo über … sein Leben mit dem Bebop.
Wolfram Knauer (Juni 2022)
Anthony Braxton. Creative Music
von Timo Hoyer
Hofheim 2021 (Wolke)
728 Seiten, 68 Euro
ISBN: 978-3-95593-000-4
 Es ist schon ein dicker Wälzer: über 700 Seiten stark, Hardcover mit Lesebändchen, und wer denkt, die Hälfte davon wird wahrscheinlich die Diskographie ausmachen, täuscht sich.
Es ist schon ein dicker Wälzer: über 700 Seiten stark, Hardcover mit Lesebändchen, und wer denkt, die Hälfte davon wird wahrscheinlich die Diskographie ausmachen, täuscht sich.
Timo Hoyer ist eigentlich Erziehungswissenschaftler, daneben aber auch Fan der Musik Anthony Braxtons, oder, wie er selbst es ausdrückt, “friendly experiencer”, und er kann diese Haltung sogar datieren, auf den 17. März 1989 nämlich, als er sich, ohne genau zu wissen, was ihn erwarten würde, das Anthony Braxton Trio auf der Jazzwoche Burghausen anhörte (20).
Es wurde eine Art Erweckungserlebnis: Danach sammelte er jede Platte, derer er habhaft werden konnte, reiste dem Saxophonisten und Komponisten hinterher, erst per Auto und Zug durch Europa, dann sogar in die USA. Er erwähnt all das, weil er gleich zu Beginn klarstellen will, dass er, nicht anders als andere Biographen Braxtons, nicht neutral, sondern parteiisch ist. Und diese Haltung macht sein dickes Buch dann durchaus auch zu einem Schmöker.
Hoyer teilt sein Werk in zwei Teile: knapp 220 Seiten Biographisches sowie gut 400 Seiten über die Musik. Dann folgen doch noch etwa 50 Seiten “Apparat” einschließlich Diskographie und Bibliographie.
Also los: “Biografische Komplexitäten” überschreibt Hoyer den Beginn des ersten Teils. “My life has been very beautiful and complex”, zitiert er den Saxophonisten, und dieser Komplexität versucht der Autor dann auf die Spur zu kommen. Familie sei für ihn nicht nur seine biologische, erklärt Braxton, sondern genauso “die vibrationale und die konstituierende”. Hoyer widmet sich aber erst einmal der biologischen. Er beschreibt die Lebensbedingungen (ganz allgemein) auf der schwarzen South Side Chicagos, verweist auf musikalische Traditionslinien, die sich rein geographisch mit den Lebenslinien des jungen Anthony überschneiden, als Einflüsse oder als Abgrenzungspotenzial. So sei Chicago ja die eigentlich US-amerikanische Bluesmetropole gewesen, doch habe Braxton eine “sonderbare Distanz” zum Blues gehegt, weil, zitiert ihn Hoyer: “I wanted to, I had to, find my own spaces.” (34)
Eine starke Mutter erzog ihn und seine Geschwister “mit religiöser Ernsthaftigkeit”, und ernstgenommen habe er die spirituelle Suche auch später, etwa, als er, angeregt durch Chick Corea, der Church of Scientology beitrat, die er dann aber schnell wieder verließ, “weil er um seine Gedankenfreiheit bangt” (37). Selbst von seiner Familie sei er wegen seiner musikalischen Vorlieben und seines intellektuellen Interesses schief angeguckt worden. Im Washington Park von Chicago, einer Art Speaker’s Corner, hörte er theoretischen, religiösen und weltanschaulichen Debatten zu, daneben bewunderte er den Westernstar Roy Rogers und den Raketenkonstrukteur Wernher von Braun. Im College belegte er Kurse über Philosophie, war aber vor allem in der Musikfakultät zu finden, wo er zusammen mit anderen späteren Größen afroamerikanischer Musik studierte, bis er bei einem Auftritt des nur fünf Jahre älteren Roscoe Mitchell merkte, dass der “sein überwältigendes Können (…) nie und nimmer auf dieser grundsoliden, aber nicht gerade experimentierfreudigen Bildungseinrichtung erworben haben” konnte(43). Er meldete sich zur Armee, hoffend, dass er durch die Mitwirkung in der Army Band selbst auch zu so einem Profi werden könne.
Nächste Station: Familie. Hoyer beginnt die auch hier vorherrschende Komplexität zusammenzufassen und beschreibt: Beziehungen, die zu keiner festen Bindung führten; dann eine Hochzeit wie aus einem Fellini-Film im Intellektuellen- und Künstler-Refugium Woodstock, New York; drei Kinder, größte Geldprobleme, die schon mal dazu führten, dass den Braxtons der Strom und das Telefon gesperrt wurden; schließlich eine Festanstellung, befristet erst am Mills College in Kalifornien, unbefristet dann am Wesleyan College in Connecticut. Die finanzielle Sicherheit ermöglichte ihm zwar die Realisierung einiger Projekte, half aber nicht die Familie zusammenzuhalten. Es kam zur Trennung, und Hoyer beschreibt anschaulich die “complexities”, die innerhalb der Familie zu tiefen Verwürfnissen geführt hätten, zwischen Braxton und seiner Ex-Frau genauso wie seinen Kindern.
“Musiker werden”: Als Jugendlicher hört Braxton Rock ‘n’ Roll und Doo-Wop-Ensembles. Er hört die Musik Ahmad Jamals und ist begeistert. Er fängt an Platten zu sammeln, aber keinesfalls die Avantgarde seiner Zeit, also nicht Parker, Coleman, Taylor, sondern Dave Brubeck. “I liked the more melodic players” erklärt er, Paul Desmond oder Jackie McLean, Warne Marsh, Johnny Hodges, Eric Dolphy (56). In seinem Werk wird er den Heroen seiner Jugend immer wieder Tribut zollen – Tristano etwa –, auch wenn die Musiker dieser Heldengeneration seine Ehrungen oft verständnislos entgegennehmen (58).
“Das erste Anthony Braxton Ensemble ist eine Doo-wop-Gruppe!” betont Hoyer (58), dann will Anthony Trompete spielen wie Miles Davis, dann Saxophon wie Paul Desmond. Er beginnt auf der Klarinette, nimmt ein Sopransaxophon dazu, dann ein Alt und Privatunterricht. Er habe immer schon einen etwas unüblichen Geschmack gehabt, erläutert Braxton: “I was the only African American in the United States who would go to a jam session and call ‘Take Five'” (61).
1963 gründet er sein erstes Quartett, spielt Standards und Bebop-Nummern. Und hier kommt die bereits erwähnte Begegnung mit Roscoe Mitchell ins Spiel, die ihn entscheiden ließ, sich für die Armee zu verpflichten. Anderthalb Jahre spielt er Marschmusik und Musicalhits, Swing und für Marschkapelle umgeschriebene Wagner-Titel, studiert nebenbei die Musik Charlie Parkers, aber auch jene seiner Zeitgenossen, John Coltrane und Ornette Coleman. Nebenbei belegt er in Chicago Kurse in Musikwissenschaft, bei denen er die Ignoranz der Lehrenden nicht verstehen mag, die sich eher über Schönberg aufregen, als dass sie Stockhausen oder John Cage Respekt zollten. Hier auch entsteht Braxtons erste Komposition “Piano Piece No. 1”, die sich anhört, “als wären dem späten Schönberg oder dem frühen Stockhausen beim Komponieren Flügel der Improvisation gewachsen” (65).
In der Armeekapelle lernt Braxton jede Menge, ist aber einziger Schwarzer unter vielen Weißen, sicher auch ein Grund, warum er sich jetzt auch politisch für die Bürgerrechtsbewegung interessiert. Die zweite Hälfte seiner Armeezeit verbringt er in Seoul, wo die Eigth Army Band, der er jetzt angehört, stationiert war. In Seoul hört er Schönbergs “Drei Klavierstücke op. 11” und ist geflasht. Er, der schon zuvor gemerkt hatte, dass er von Genregrenzen nicht viel hält, entdeckt, dass überall auf der Musik geforscht wurde, dass es sich daher lohnt, sich selbst den entlegensten, alten wie zeitgenössischen Werken zu nähern, um die Diskurse zu verstehen, die in ihnen abgebildet sind (70).
Musiker sein also: Nach seiner Armeezeit kehrt Braxton 1966 zurück nach Chicago, kommt in den Kreis der damals noch jungen AACM, entdeckt Stockhausen und Cage als “zwei neue Idole” (71). Muhal Richard Abrams wird zum Mentor, die AACM zu einer Art Laboratorium, in dem er (und viele andere) sich ausprobieren können. Daneben tourt er mit einer Soul-Show, bei der er allerdings aneckt, weil er immer mal wieder “ungebeten experimentelle Saxophonsoli” einstreut.
Er gründet ein Trio mit Leo Smith und Leroy Jenkins. Und er reist nach Europa. In Paris hatte sich das Art Ensemble of Chicago niedergelassen, und auch sonst waren eine ganze Reihe experimenteller Musiker hier aktiv, egal ob aus dem Bereich des “Jazz” oder der “Neuen Musik”. Braxton jedenfalls spielte bald mit Richard Teitelbaum genauso wie mit Steve McCall, Gunter Hampel oder Archie Shepp.
Es waren zwei sehr unterschiedliche Konzepte, die die Chicagoer Musiker da in Europa präsentierten: das Art Ensemble auf der einen Seite mit einer ritualhaften Bühnenpräsenz – oder, wie Hoyer schreibt: “Das Ensemble scheut auch keinen Budenzauber, keinen Konfettiregen, keinen Mummenschanz, und etwas folkloristisch darf es auch sein” (98) -, und Braxton, Jenkins, Smith, auf der anderen Seite, die sich höchstens “Trio” oder “Quartett” nannten, sperrige Musik spielten und auf Bühneneffekte verzichteten.
Die Kritik ist gespalten, aber das Publikum – und zwar ein durchwegs junges Publikum – spricht die Musik durchaus an – wenn auch nicht immer mit dem notwendigen Respekt, wie sich Leo Smith an einen Auftritt in der Pariser Universität erinnert, bei dem das Publikum mit Rasseln, Glocken, Pfeifen und Trommeln mindestens so laut mitmachen wollte wie die Band selbst (100).
Zurück in den USA wird Braxton viertes Mitglied der Gruppe Circle um den Pianisten Chick Corea, den Bassisten Dave Holland und den Schlagzeuger Barry Altschul. Hoyer beschreibt Repertoire und Faktur der Stücke, die unter anderem auf dem Label ECM erschienen. Und er beschreibt, wie Braxton immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses der Jazzkritik gerät. Deren Urteile sind nicht immer positiv, im Gegenteil… und so entscheidet Braxton, die besonders heftigen Angriffe aus den USA zu vermeiden und wieder nach Paris zu ziehen. Er spielt solistisch, im Duo, Trio oder Quartett, widmet einzelne Programme der Jazztradition, arbeitet mit Kolleg:innen der europäischen “frei improvisierenden” Szene zusammen, wie sich einzelne der Musiker nannten, weil sie sich dem Free Jazz nicht so recht zugehörig fühlten. Und er erhält einen Plattenvertrag bei Arista Records, der immerhin zu neun Alben führt, bevor es zu Verstimmungen kommt, ausgelöst etwa durch Linernotes in “eigenwilliger Diktion” (146). Die Labelbosse hatten gehofft, sich mit dieser Musik die Vorhut des Jazz sichern zu können, waren es aber irgendwann leid, dass Braxton partout keinen “Jazz” liefern wollte, wie sie sich ihn vorstellten.
Anlass auch für Hoyer, die Label-Landschaft der Zeit abzugrasen. Moers Records, Antilles, Dischi Della Quercia, Cecma, hatART/hatOLOGY, Sound Aspects, Victo und später Leo Records: Es sind die kleinen, unabhängigen Labels, die Braxtons Projekte forthin dokumentieren, sicher keine hohen Verkaufszahlen generieren und oft genug von ihm mitfinanziert werden müssen. Zum Geschäft gehört es jetzt auch, dass Braxton mit Produzenten zusammenarbeitet, die nicht immer zu den professionellsten gehören, und hier scheint selbst bei Hoyer schon mal die Empörung durch, wenn er etwa einen französischen Labelchef rügt, der 1985 in einer Pariser Kirche Solomaterial für ungefähr 14 Platten aufgenommen habe, von dem gerade mal 133 Minuten gesichert wurden, der Rest sei verschollen (155).
In der AACM war die Weitergabe von Wissen immer wichtig gewesen; vielleicht kam von dorther auch Braxtons Faszination fürs Lehren. Als er in den 1970er Jahren am Creative Music Studio in Woodstock, New York, unterrichtete, gehörte er jedenfalls zu den beliebtesten Dozenten (162). 1985 – mal wieder zu einer Zeit der finanziellen Ebbe – wird er zum Professor ernannt, als erster schwarzer Dozent am Mills College in Oakland, Kalifornien. Er gibt Kurse über “Musik seit Debussy”, über “Frauen und Creative Music”, über “Coltrane, Coleman und Mingus”, über zeitgemäße Instrumentierung und Orchestrierung (165). Er ist zwar der Lehrer, sieht sich aber zugleich immer als “student of music” (166). Nicht zuletzt tut ihm der Kontakt mit jungen kreativen Leuten gut.
Daneben komponiert und tourt er weiter, in kleinen Besetzungen oder für großes Orchester. Fünf Jahre später erhält er den Ruf auf eine Professur am Wesleyan College in Connecticut, wo er bis zu seiner Pensionierung arbeiten soll. Er veröffentlicht zahlreiche Platten mit seinem Quartett (Marilyn Crispell, Mark Dresser, Gerry Hemingway), beschäftigt sich erneut mit dem Repertoire der Jazzgeschichte, setzt sich häufiger ans Klavier, schreibt Orchestermusik, gründet das 35-köpfige Tri-Centric Ensemble, arbeitet am “Trillium”-Zyklus.
Er ist ein ausgesprochen beliebter Lehrer mit großem Einfluss auf seine Schüler:innen, aber so ganz froh ist er mit der Rolle doch nicht. Es sei schon richtig, dass der Jazz mittlerweile an den Hochschulen angelangt sei; aber da gäbe es schon jede Menge Scharlatane unter seinen Kollegen, die “ihren Mangel an Kreativität hinter Masken von Gelehrsamkeit und Professionalität zu verbergen” suchten (213). Ein unterhaltsam-aufschlussreiches Unterkapitel widmet Hoyer Braxtons Lehrmethoden, bezeugt von zahlreichen seiner Studierenden (ab 215).
2014 gründet Braxton die Tri-Centric Foundation als Nonprofit-Organisation, unter deren Dach er künftig seine Projekte realisieren, eine andere Art von Unterricht anbieten, Konzerte mit seiner Musik dokumentieren, seine Ideen und seine Kompositionen veröffentlichen kann. Daneben gründet wer ein eigenes Label, Braxton House. Während er in der Welt der zeitgenössischen Musik mittlerweile zumindest wahrgenommen und ausgezeichnet wird (unter anderem mit einem MacArthur Grant, hat die Jazzszene ihn, wie er empfindet, weitgehend abgeschrieben. Und so ist er mehr als erstaunt, als er 2014 mit der Auszeichnung der NEA als “Jazz Master” geehrt wird.
Wir sind mittlerweile auf Seite 253 angelangt. Zwei Seiten später beginnt der zweite Teil in Hoyers Werk, überschrieben “Creative Musics”. Und da wir das Buch nicht eins zu eins nacherzählen wollen, hier eine etwas zügigere Zusammenfassung: Hoyer beschreibt Braxtons Arbeitsweise, “Das System” (255), seine zahlreichen Schriften und den Grund für sie (269), Musikkonzepte wie “Sprachspiele” (303): Solo, Duos, kleine Formate, Creative Orchestra; “Tri-Centric Modelling” (454): Ghost Trance Music, Falling River Music, Diamond Curtain Wall Music u.a.; sowie “Quintessenzen” (551): Sonic Genome Project, Trillium. Und er endet mit dem Opernkomplex “Trillium J”, aufgeführt im August 2014 im New Yorker Roulette – und allein das Foto von Braxton mit der riesigen Partitur auf einem Handwagen ist imposant.
So, das war jetzt wirklich knapp für immerhin über 400 Seiten, die vollgepackt sind mit Beschreibungen und Einschätzungen von Aufnahmen und Kompositionen, mit Annäherungen an Braxtons kreativen Prozess, an dem langen Atem, den es braucht, all die Projekte nicht nur zu denken, sondern zu realisieren, denen sich der kreative Musiker und Komponist über all die Jahrzehnte verschrieben hat.
Timo Hoyer beschreibt all das als “friendly experiencer”, wie er zu Beginn anmerkte. Ja, es gibt auch kritische Töne, insbesondere dort, wo Braxton selbst kritisch mit sich ins Gericht geht. Vor allem aber bleibt Hoyer neugierig-wohlgesonnen, inspiriert durch die mal komplexen, dann rätselhaften, mal auf andere Musik, dann auf die Welt and far beyond verweisenden Kompositionen. Braxtons Musik ist nicht “einfach”, sie ist wahrscheinlich genauso “komplex” wie er sich selbst sieht. Und wenn auch Hoyers Buch diese Komplexität nicht an jeder Stelle auflösen kann – wer könnte das schon? –, so hilft es einem wenigstens dabei, eine Art Vogelperspektive einzunehmen und den Weg zu erahnen, den Braxton mit seiner Musik, seinen Aufnahmen, seinen Gedanken genommen hat.
Fazit: Kein Buch für die schnelle Lektüre, aber eine überaus anregende Studie zum Eintauchen in die komplexe Lebenswirklichkeit eines unverwechselbaren Komponisten und Instrumentalisten des 20./21. Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Mai 2022)
John Tchicai. A chaos with some kind of order
von Margriet Naber
Nijmegen 2021 (Ear Mind Heart Media)
188 Seiten, 23,50 Euro
ISBN: 978-90-831471-0-9
(John Tchicai)
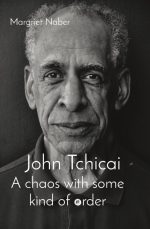 Als sie John Tchicai 1989 das erste Mal bei einem Workshop in Rotterdam traf, habe sie sich in seine Musik verliebt, schreibt Margriet Naber, beim zweiten Mal dann in ihn. Dann seien sie zusammengezogen. Ihr Leben mit ihm habe sie gelehrt, wie hilfreich Improvisation gerade in unvorhersehbaren Situationen sein kann, auch diese Erkenntnis wolle sie in ihrem Buch weitergeben.
Als sie John Tchicai 1989 das erste Mal bei einem Workshop in Rotterdam traf, habe sie sich in seine Musik verliebt, schreibt Margriet Naber, beim zweiten Mal dann in ihn. Dann seien sie zusammengezogen. Ihr Leben mit ihm habe sie gelehrt, wie hilfreich Improvisation gerade in unvorhersehbaren Situationen sein kann, auch diese Erkenntnis wolle sie in ihrem Buch weitergeben.
John Tchicai kam 1936 in Kopenhagen zur Welt. Die Mutter war Dänin, der Vater war mehr als zwei Jahrzehnte zuvor aus dem Kongo nach Europa gekommen. Tchicai wuchs in Aarhus auf, wo der Vater als Toilettenwärter eines Restaurants arbeitete. Musik habe er seinen Kindern kaum vermittelt, aber Zeitzeugen erinnern sich daran, dass er an seiner Arbeitsstätte immer auf den Türen getrommelt und wie intensiv er getanzt habe. In seiner Jugend begeisterte sich Tchicai erst von Billie Holidays Aufnahme über “Strange Fruit”, zugleich vom Sound des Saxophons. Er kaufte sich ein Altsaxophon und begann ab 1953 Konzerte zu besuchen, hörte Lionel Hampton in Kopenhagen sowie das Stan Kenton Orchester mit Lee Konitz, dessen improvisatorischer Ansatz ihm ungemein imponierte. Er schrieb sich für knapp zwei Jahre im Konservatorium von Aarhus für Klarinette ein, arbeitete dann als Koch, um schließlich seinen Wehrdienst in einer Marinekapelle abzuleisten. Danach zog es ihn in die dänische Hauptstadt, wo er regelmäßig bei Jam Sessions auftauchte. Als er zu einem Festival nach Helsinki reiste, traf er dort auf Bill Dixon und Archie Shepp, die ihn ermutigten, wenn er als Musiker etwas lernen wolle, müsse er unbedingt nach New York gehen.
Dorthin folg Tchicai dann im Dezember 1962, bezog mit seiner dänischen Freundin ein Zimmer auf der 46sten Straße und arbeitete als Koch in einem schwedischen Restaurant. Schnell schloss er Kontakte in der Musikerszene, traf Archie Shepp wieder und Don Cherry und hinterließ auch beim jungen Dichter, Aktivisten und Down-Beat-Kolumnisten LeRoi Jones Eindruck. Mit Cherry und Shepp gründete er die New York Contemporary Five, mit der er im Herbst 1963 fünf Wochen lang “zuhause”, nämlich im Montmartre Jazzclub in Kopenhagen zu hören war. Er begann eine eigene Klangsprache zu entwickeln und arbeitete mit zahlreichen Vertretern der damaligen New Yorker Avantgarde, mit Roswell Rudd, Milford Graves und vielen anderen. 1964 war Tchicai mit dabei, als Dixon und Kollegen die Jazz Composers’ Guild gründeten; zugleich machte er Aufnahmen fürs legendäre Label ESP’-Disk. Und 1965 ging er mit John Coltrane ins Studio, um “Ascension” aufzunehmen.
Als Tchicai 1966 zurück nach Kopenhagen zog, konnte er anfangs vom Namen profitieren, den er sich in New York gemacht hatte, und doch musste er teilweise als Postbote arbeiten, um über die Runden zu kommen. Er nahm an Multimediaprojekten teil, war bei pan-europäischen Bandprojekten etwa des Norddeutschen Rundfunks mit von der Partie und trat mit Yoko Ono und John Lennon bei einem Festival in England auf. Ende der 1960er Jahre begann er Workshops zu geben, nahm daneben Platten mit der von ihm gegründeten Cadentia Nova Danica auf sowie mit Kollegen wie Misha Mengelberg und Han Bennink.
Neben der Musik wurden ab 1970 Yoga und andere spirituelle Praktiken, die er durch Swami Narayanananda kennengelernt hatte, immer wichtiger in Tchicais Leben. Er gab weiterhin Musik- und Kulturunterricht an Schulen, trat aber nur noch selten auf. Seine spirituelle Arbeit habe seine Kreativität beflügelt, erklärte Tchicai später, weil sie ihm die Freiheit gäbe, die er auf der Suche nach neuen Möglichkeiten brauche. Man müsse im Hier und Jetzt sein, zugleich das Ego aus der Musik heraushalten, sagte er, und verstand sich selbst ein wenig als einen “Yogi in Disguise”, wie eine Komposition aus dieser Zeit heißt. Erst in den Mitt-1970er Jahren begann er nach einer Einladung von Iréne Schweizer wieder aufzutreten. Er beschäftigte sich verstärkt mit motivischer Entwicklung in seiner Improvisation. Naber schildert, wie Tchicai sich und seine Mitmusiker auf neue Stücke vorbereitete, immer darauf bedacht, nicht zu viel zu proben, damit beim Konzert die Spontaneität erhalten bliebe. Mehr und mehr band er außerdem auch das Publikum in seine Performances ein.
1980 gründete der Gitarrist Pierre Dørge, mit dem Tchicai schon länger zusammenarbeitete, sein New Jungle Orchestra, und der Saxophonist war bei vielen Konzerten und Aufnahmen der Band mit von der Partie. Naber berichtet aber auch von der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und von den weltweiten Reisen, bei denen es Tchicai immer wichtig war, auch etwas vom Land und seinen Leuten kennenzulernen.
1989 also gab Tchicai einen Workshop in Rotterdam, und von hier an ist Nabers Geschichte auch ihre eigene. Sie beschreibt seine Unterrichtsmethoden, seine Tagesroutinen, seinen Hang zum Üben. 1992 folgte sie ihm nach Davis, Kalifornien, wo er die Band Archetypes mit jungen Musiker:innen unterschiedlicher stilistischer Backgrounds gründete. Sie blieben bis 2001, zogen dann zurück nach Europa, erst nach Dänemark, dann in ein Dorf in den französischen Pyrenäen. Auch hier unterrichtete er, nahm außerdem Konzerte sonstwo auf dem Kontinent wahr. Im Juni 2012 hatte er einen Schlaganfall, den er ein paar Monate überlebte, dann aber im Krankenhaus von Perpignan verstarb. Bei seiner Einäscherung spielte Famoudou Don Moye; eine Straße in dem kleinen Dorf, in dem er gelebt hatte, wurde nach ihm benannt.
Margriet Naber ist es gelungen ihre sehr persönliche Erinnerung an ihren Ex-Mann mit einer sorgfältig recherchierten Biographie der Jahre vor ihrem Kennenlernen zu verbinden. Wo sie für die ersten 55 Jahre seines Lebens also auf ihre Notizen seiner Erzählungen, auf Interviews mit Zeitzeugen oder auf anderweitige Literatur angewiesen ist, versucht sie für die letzten zwanzig Jahre keine scheinbare Objektivität, sondern lässt ihre Leser:innen gerade aus ihrer subjektiven Warte eine persönlichere Perspektive auf den Saxophonisten, Komponisten und Avantgardisten John Tchicai erleben. Er habe viele Jahre seines Lebens damit verbracht, durch Yogaübungen seinen Atem zu kontrollieren, erklärt sie kurz vor Ende des Buchs. “Ich habe ihm oft beim Üben zugehört, und sein Atmen war das längste, ruhigste und friedlichste Atmen, das ich jemals gehört habe.” Zum Schluss verrät Naber dann noch Tchicais Ratschläge für Improvisatoren (Listen – Create – Improvise – Play together), listet einige der experimentelleren Auftritte des Saxophonisten zwischen 1965 und 1992, erklärt, wie er eine Setliste zusammenstellte, und druckt fünf seiner Kompositionen ab. Eine Diskographie und Bibliographie beschließen das Buch.
Wolfram Knauer (Juli 2021)
Universal Tonality. The Life and Music of William Parker
von Cisco Bradley
Durham/NC 2021 (Duke University Press)
416 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-4780-1119-4
 William Parker ist seit Jahrzehnten eine Integrationsfigur der New Yorker Jazz- und Improvisationsszene, ein Kontrabassist mit großem Ton, ein Bandleader unterschiedlichster Besetzungen, Sideman in diversesten Gruppen, Organisator von Community-Events, ein politisch bewusster und bewegter Vertreter aktueller Musik, ein Künstler und Aktivist. Als Cisco Bradley Parker im November 2015 mit dem Anliegen anmailte, einen längeren Text über sein Leben und seine Arbeit verfassen zu wollen, meldete der sich sofort zurück und ermutigte ihn zu mehr als einem längeren Text. Es folgten 21 Interviews, die Durchsicht von Kisten voller Familienerinnerungen, Fotos, Clippings und sonstiger Erinnerungsstücke, sowie Gespräche mit Parkers Frau, der Tänzerin Patricia Nicholson Parker, seiner Tochter, mit Mitmusikern wie Matthew Shipp und Cooper-Moore und vielen anderen.
William Parker ist seit Jahrzehnten eine Integrationsfigur der New Yorker Jazz- und Improvisationsszene, ein Kontrabassist mit großem Ton, ein Bandleader unterschiedlichster Besetzungen, Sideman in diversesten Gruppen, Organisator von Community-Events, ein politisch bewusster und bewegter Vertreter aktueller Musik, ein Künstler und Aktivist. Als Cisco Bradley Parker im November 2015 mit dem Anliegen anmailte, einen längeren Text über sein Leben und seine Arbeit verfassen zu wollen, meldete der sich sofort zurück und ermutigte ihn zu mehr als einem längeren Text. Es folgten 21 Interviews, die Durchsicht von Kisten voller Familienerinnerungen, Fotos, Clippings und sonstiger Erinnerungsstücke, sowie Gespräche mit Parkers Frau, der Tänzerin Patricia Nicholson Parker, seiner Tochter, mit Mitmusikern wie Matthew Shipp und Cooper-Moore und vielen anderen.
Bradley strukturiert sein Buch in drei Großkapitel: “Origins”, “Early Work”, und “Toward the Universal”. Im ersten Teil geht es um Parkers Herkunft, seine ästhetische und politische Bewusstwerdung als afro-amerikanischer Künstler; im zweiten Teil um seine Auftritte in der Loft-Scene der 1970er Jahre, um Projekte mit der Tänzerin Patricia Nicholson, und um seine Zusammenarbeit mit Cecil Taylor; im dritten Teil schließlich um seine eigenen Projekte zwischen Duo und Bigband, um sein Engagement in der Community, um seine Zusammenarbeit mit anderen aktuellen Musiker:innen.
Parker wuchs in einem sozialen Brennpunkt in der Süd-Bronx auf; Bradley aber beginnt seine Biographie in Afrika. Von dort nämlich seien seine Vorfahren gekommen, die irgendwann im 17. oder 18. Jahrhundert als Sklaven nach Amerika verschifft wurden. Die Familie seiner Mutter lebte nahe Orangeburg, South Carolina, die seines Vaters im ländlichen North Carolina. Etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts kann Parker seine Spuren in dieser Region verfolgen. Bradley erzählt die Familiengeschichte und den sozialen und gesellschaftlichen Kontext, die Lebenssituation seiner Vorfahren etwa, den alltäglichen Rassismus, den Umzug der Eltern nach Norden in den 1930er Jahren, die lebendige Kulturszene in der Bronx, in der Parker 1952 geboren wurde, die Rolle des Jazz in der Familie.
Sein Vater kaufte Platten, Soul und Motown, und wenn der Vater von der Arbeit nach Hause kam, wurde Ellingtons “Diminuendo and Crescendo in Blue” vom Newport Jazz Festival 1956 aufgelegt, und die Kinder tanzten zu Paul Gonsalves’ Solo. Bradley beschreibt die Community, in der Parker groß wurde und die emotionale Beziehung, die er zur Musik entwickelte. Wann immer er Geld ergattern konnte, steckte er dies in Platten. Musik war aber nur Teil des Lebens. Bradley befragt den Bassisten zu Schule, Sport, den Gefahren des Alltags in der kriminalitätsgefährdeten Bronx. Der Vater verlor seinen Job, wurde bei einem Überfall schwer verletzt und starb schließlich während eines Krankenhausaufenthalts, bei dem er nicht die sorgfältige Behandlung erfahren hatte, die er benötigt hätte.
Bradley erläutert den Kontext des Black-Power-Movement der späten 1960er Jahre und beschreibt, wie Parker vor allem durch Kunst und Musik mit der Bewegung in Kontakt kam. Kunst war politisch, und Politisches war bis in die Kunst hinein zu spüren. Parker sah die Fernsehshow “Soul!”, die nicht nur der Musik, sondern auch intellektuellen Wortführern des schwarzen Amerika eine Stimme verlieh. Schon als Kind hatte er Ornette Colemans “Free Jazz” gehört, die Avantgarde war für ihn mehr und mehr die wichtigste Stimme der Gegenwart. Er interessierte sich für Black Poetry von Dichtern wie Amiri Baraka, Eldridge Cleaver, Joseph Jarman oder Archie Shepp, las Romane, sah Filme von Truffaut, Godard und Bergman und durchforstete die Wochenzeitung Village Voice für Hinweise auf neue Filme. Er besuchte kostenlose Konzertein der Harlemer Dependance der New York Public Library, und er ging eines Tages ins Büro der Black Panthers in der Bronx, um die Menschen dort für die experimentellen Klänge zu interessieren, die so stark zu ihm sprachen.
Im zweiten Teil seines Buchs beschreibt Bradley die frühen musikalischen Erfahrungen Parkers und sein Wirken in der New Yorker Loft-Szene der 1970er Jahre. Den ersten Kontrabass habe er im Leihhaus erstanden, erfährt Bradley, der zweite landete ihm sofort einen Gig. Parker nahm Unterricht in Billy Taylors Community-orientierten Jazzmobile-Projekt in Harlem. Er spielte zu seinen Platten, etwa von Albert Ayler und Archie Shepp, und er hatte seine ersten Auftritte im von der Sängerin Maxine Sullivan geführten Club “The House That Jazz Built” in der Bronx. Er probte im Third World, einem Kulturzentrum im selben Stadtteil, und trat in Clubs im East Village auf, wo er Musiker:innen wie Daniel Carter, Gunter Hampel, Jeanne Lee und Rashied Ali kennenlernte. Zusammen mit einigen von ihnen organisierte er ein Gegenfestival zum Newport Jazz Festival, das 1972 nach New York gezogen war. Bradley berichtet auch von anderen Bands der Zeit, dem Music Ensemble etwa, dem Juice Quartet, dem Ensemble Muntu, der Zusammenarbeit mit Billy Bang, Rashid Bakr oder mit Don Cherry.
1973 lernte Parker die Tänzerin Patricia Nicholson kennen, die er zwei Jahre später heiratete. Beide sahen in der Improvisation in Musik und Tanz eine Art Gebet, einen Weg zu Transzendenz, Transformation und Heilung. Sie gründeten das Centering Dance Music Ensemble, ein freies Tanz- und Musikprojekt in unterschiedlichen Besetzungen, mit dem sie zwischen 1974 und 1980 Teil der Loftszene New Yorks waren. In den 1980er Jahren beteiligten sie sich an politischen Aktionen wie Protesten gegen die Kriegswaffenproduktion. 1985 gründeten sie zusammen mit Peter Kowald und mit der Hilfe von bundesdeutschen Fördergeldern (in anderen Quellen ist von einer Spende des Künstlers A.R. Penck die Rede, die Bradley nicht nennt) das Sound Unity Festival, bei dem Avantgarde-Musiker:innen aus Europa und den USA auftraten, das zugleich eine Art Community-Ansatz verfolgte, mit dem Parker die Musiker:innen der Stadt organisieren und ihnen dabei helfen wollte, ihr Publikum zu erweitern. Beim Sound Unity Festival traten Künstler:innen auf, die bei den großen Festivals der Region nicht zu hören waren. Auch die US-amerikanische Plattenindustrie hatte sich vom Jazz abgewandt; Parker und viele seiner Kollegen verdienten den Hauptteil ihres Geldes bei Tourneen in Europa. Bereits in den 1970er Jahren hatte Parker bei Projekten des Pianisten Cecil Taylor mitgewirkt, 1980 wurde er reguläres Mitglied der Cecil Taylor Unit. Parker erinnert sich daran, wie ihm die Auseinandersetzung mit Taylors Welt die Augen und Ohren öffnete. 1982 schrieb der Kritiker (und frühere Schlagzeuger) Stanley Crouch eine vernichtende Kritik über ein Konzert Taylors, das Bradley als Anfang des “Jazzkriegs” identifiziert, der sich bis weit in die 1990er Jahre hinziehen sollte, auf der einen Seite die experimentellen Avantgardisten New Yorks hatte und auf der anderen Seite zusammen mit Crouch bald Wynton Marsalis platzierte. Seine Zusammenarbeit mit Taylor erlaubte Parker daneben zahlreiche internationale Kooperationen, im Orchestra of Two Continents beispielsweise, oder als Gast während Taylors Aufenthalt in Berlin im Jahr 1988.
Der dritte Teil des Buchs widmet sich Parkers eigenen Projekten. Er ist überschrieben “Toward the Universal” und beschreibt, wie wichtig in Parkers musikalischen Projekten immer die politische Haltung und Aspekte von Community waren. “Der Künstler muss die politische Revolution vorantreiben”, wird Parker zitiert, den Bradley in eine Reihe mit politisch bewussten Künstlern vor ihm stellt. Beim Musikmachen gehe es nicht ums Geldverdienen, findet Parker, Musik sei das kosmologische Zentrum der Community. Seine eigene Bands wurden auf der New Yorker Jazzszene der 1980er Jahre jedenfalls vermehrt wahrgenommen, und während Parker seine Musik als Feier afro-amerikanischer Traditionen zelebrierte, war es ihm genauso wichtig, die Verbindungen aufzuzeigen, die es in der Musik auch zu Afrika, Asien, Europa, Australien und den beiden amerikanischen Kontinenten gibt. In diesem Kapitel nähert sich Bradley auch einigen der Platten, die Parker mit verschiedenen Bands aufnahm, weiß um weitere Projekte auf der internationalen Bühne, an denen er beteiligt war. Parker gründete sein Little Huey Creative Music Orchestra, trat mit Peter Brötzmanns Die Like a Dog Quartet auf, im Duo mit Hamid Drake, vor allem aber mit seinem eigenen Quartett sowie dem Raining on the Moon Quintet und Sextet. Er war an Tributprojekten beteiligt, etwa für Curtis Mayfield oder Duke Ellington, trat mit Milford Graves und Charles Gayle auf, vermehrt aber auch als Kontrabass-Solist. Das Buch schließt mit einem Blick auf jüngste Projekte Parkers, die nach wie vor mit drei Worten zu umschreiben sind, die nicht direkt aus der Musik stammen: “community, solidarity, compassion”.
Cisco Bradley hat eine Biographie geschrieben, die weit über sein Sujet hinausblickt, die nämlich immer die Community im Blick hat, aus der heraus, inmitten derer und für die William Parker seine Musik schuf und schafft. Es gelingt ihm dabei, trotz der Menge an Informationen, die er abhandelt, einen gut lesbaren Text zu schreiben, der den Kontext immer wieder zurück auf die Musik verweisen lässt. Eine beeindruckende Diskographie beschließt das sorgfältig annotierte Buch, das weit mehr ist als die Biographie eines Musikers. Es ist der Versuch einer Kulturgeschichte der New Yorker Avantgarde der 1970er und 1980er Jahre am Beispiel eines der an ihr am stärksten beteiligten Protagonisten.
Wolfram Knauer (April 2021)
Django Reinhardt. Un musicien tsigane dans l’europe nazie
von Gérard Régnier
Condé-sur-Noireau 2021 (L’Harmattan)
145 Seiten, 14 Euro
ISBN: 978-2-343-22153-3
 Gérard Régniers Buch basiert auf einem Vortrag, den er 2010 über Django Reinhardts Leben und Wirken zur Zeit der deutschen Besatzung von Paris hielt. Darin betont Régnier, dass Reinhardt als Sinti einerseits zu den von den Nationalsozialisten verfolgten Volksgruppen gehörte, er andererseits ausgerechnet in den Jahren der Besatzung zu einer französischen Legende wurde, vergleichbar höchstens mit Entertaintern wie Maurice Chevalier oder Charles Trenet.
Gérard Régniers Buch basiert auf einem Vortrag, den er 2010 über Django Reinhardts Leben und Wirken zur Zeit der deutschen Besatzung von Paris hielt. Darin betont Régnier, dass Reinhardt als Sinti einerseits zu den von den Nationalsozialisten verfolgten Volksgruppen gehörte, er andererseits ausgerechnet in den Jahren der Besatzung zu einer französischen Legende wurde, vergleichbar höchstens mit Entertaintern wie Maurice Chevalier oder Charles Trenet.
Régnier beginnt sein Buch mit einem generellen Kapitel über er die komplexe Geschichte der französischen Sinti und Roma. Er klärt biographische Details, die Geburt Djangos im Januar 1910 im Winterquartier der Manouche-Familie im belgischen Liberchies etwa oder die Schreibweise seines Nachnamens. Und er verweist auf die reiche Jazzgeschichte seines Geburtslands Belgien. In einem Blick nach Osten beschreibt er dann die Versuche der nationalsozialistischen Machthaber in Deutschland den Jazz auszurotten, streift die kurze Rückkehr von Jazz und amerikanischer Tanzmusik während der Olympischen Spiele von 1936 und betont, dass es den Nationalsozialisten trotz aller Versuche nicht gelungen sei, einem Großteil der deutschen Jugend ihre Faszination durch den Jazz zu nehmen.
Am 14. Juni 1940 marschierten die Deutschen in Paris ein. Recht schnell ließen sie den Betrieb von Cabarets, Music-Halls und Dancings wieder zu. Stephane Grappelli war nach Ausbruch des Kriegs in London geblieben, also stellte Django Reinhardt, der sich vor dem Krieg insbesondere durch die Unterstützung des Hot Club de France einen Namen machte, im Herbst 1940 eine neue Ausgabe des Quintette du Hot Club de France zusammen, in dem der Klarinettist Hubert Rostaing Grappellis Rolle übernahm. Régnier zeichnet die Clubszene der Zeit nach, beschreibt einige der Gigs, die Reinhardts Band wahrnahm, etwa bei einem “Festival de jazz français” im Dezember 1940. Er sammelt Verweise, Erinnerungen und Berichte aus zeitgenössischen Tageszeitungen, die Djangos Aktivitäten der Jahre 1941 und 1942 dokumentieren, druckt eine deutschsprachige Anzeige für seinen Auftritt im Cabaret “Le Nid” aus der “Pariser Zeitung”, begleitet ihn auf Reisen nach Belgien und Südfrankreich und erzählt über seine Heirat mit Sophie Ziegler im Juni 1943. Ein eigenes Kapitel widmet er Django Reinhardts Versuche in die Schweiz zu gelangen, ein weiteres der letzten großen Tournee durchs besetzte Frankreich Anfang 1944.
Am 25. August 1944 wurde Paris von den Amerikanern befreit, wenig später war Django, ein wenig wie eine Stimme der Kontinuität, wieder auf der Bühne zu hören. Zusammen mit Stéphane Grappelli spielte er seine gefeierte Interpretation der Marseillaise ein (“Echoes of France”) und begab sich auf eine Reise in die USA, wo er mit Duke Ellington in der Carnegie Hall auftrat und den neuen Bebop für sich entdeckte. 1951 kaufte er sich ein Haus in Samois-sur-Seine, trat aber weiterhin auch in Paris auf, jetzt meist mit einer elektrischen Gitarre und mit Klängen, die seine Begegnung mit dem modernen Jazz widerspiegelten. Am 16. Mai 1953 verstarb Django Reinhardt in Samois-sur-Seine an den Folgen einer Gehirnblutung.
Im letzten Kapitel seines Buchs versucht Régnier der Persönlichkeit des Gitarristen näherzukommen: seinem Ego, seinem Bedürfnis nach Freundschaft, seiner Gläubigkeit. Er diskutiert Django als Repräsentanten des französischen Jazz und fragt nach dem Einfluss klassischer Komponisten von Bach bis Ravel. Er weiß von Djangos zweiter Leidenschaft, der Malerei, die er genauso natürlich zu beherrschen schien wie sein Instrument. Und er fragt, ob Reinhardt als Kollaborateur der Deutschen zu gelten habe, nur weil er während der Besatzung immer als Musiker aktiv geblieben war.
Django Reinhardt galt in der Nazi-Terminologie als “Zigeuner”, er spielte eine von den Nazis verteufelte Musik. Und doch waren die schwarzen Jahre der deutschen Besatzung eine für ihn erfolgreiche Zeit, in der er Applaus auch von den Nazis erhielt, die ihn in den Pariser Cabarets hörten. Es ist ein Paradox, das sich vielleicht aus dem romantischen Bild erklären lässt, dass Frankreich und insbesondere Paris ja auch bei den deutschen Soldaten innehatte, ein wenig verruchter als daheim, ein wenig freier, ein wenig leidenschaftlicher, ein wenig mehr “Stadt des Lichts”. Reinhardts Musik war für viele der passende Soundtrack zu diesem Traum, Ideologie hin oder her.
Gérard Régniers Buch enthält zahlreiche neue Quellenverweise über die Karriere des Gitarristen im besetzten Paris. Er macht auf das Paradoxon aufmerksam, dass ausgerechnet ein Sinti-Musiker in diesen schweren Zeiten solch einen Erfolg haben konnte. Doch im Faktenreichtum seiner Recherche verliert er dann seine Ausgangsfrage ein wenig aus den Augen: warum nämlich die Deutschen ihre ganze Rasselehren zu vergessen schienen, wenn sie Reinhardt in Paris bewunderten. Man fragt sich unweigerlich, wie es anderen Mitgliedern seiner Sippe gegangen sein mag, wie die weniger herausragenden Roma und Sinti in jenen Jahren überlebten. Zusammen mit seinem Buch über “Jazz et societé sous l’Occupation” von 2009 lenkt Régnier den Blick seiner Leser immerhin geschickt auf ein Kapitel europäischer Kulturgeschichte, das voller Widersprüche steckt, in dem Ideologie und Faszination an einer so ungemein frei wirkenden Musik aufeinanderprallen und letzten Endes die Freiheit siegt.
Wolfram Knauer (April 2021)
Jazz/Rock/Pop – Das Dresdner Modell. Ein Beitrag zur Geschichte der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber
herausgegeben von Ralf Beutler & Frank-Harald Greß
Baden-Baden 2021 (Tectum)
156 Seiten, 28,00 Euro
ISBN: 9783828844414
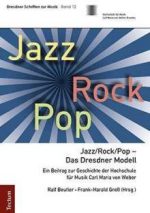 Als Frank-Harald Greß 1959 nach dem Studium der Musikwissenschaft begann an der Dresdner Musikhochschule zu unterrichten, “schmuggelte er”, wie er sich erinnert, den Jazz in seine Vorlesungen über Musikgeschichte, Akustik und Instrumentenkunde, obwohl es von staatlicher Seite noch erhebliche Vorbehalte gegen die “Musik des Klassenfeindes” gab. Als Greß im Jahr darauf eine Jazzcombo bei einer offiziellen Veranstaltung auftreten ließ, war der Rektor zwar ästhetisch entsetzt, meinte aber – die Großwetterlage in Bezug auf den Jazz hatte sich in der DDR gerade gewandelt –: “die Entwicklung der sozialistischen Musikkultur verlange, auch für ein höheres Niveau der ‘leichten Musik zu sorgen”. Gebeten, weitere Dozenten aus Jazz- und Tanzmusikkreisen zu verpflichten, wandte sich Greß an den Pianisten Günter Hörig. Der spielte mit seinem Trio vor, und einige argumentatorischen Tricks später (Jazz als Musik des “anderen” Amerika) wurde in Dresden der erste Studiengang für “Tanz- und Unterhaltungsmusik” begründet. Greß erinnert sich an einige der Schwierigkeiten des jungen Studiengangs – zum Vorspiel des ersten Schlagzeugbewerbers Baby Sommer gab es etwa kein hochschuleigenes Instrument, so dass der auf hölzernen Stuhlsitzen trommelte –, und er beschreibt, wie es ihm gelang, statt eines Aufbau- oder Zusatzstudiengangs eine selbständige Vollausbildung durchzusetzen, “mit Diplomabschluss für den Studiengang Kapellenleiter”. Er erinnert sich an die Probleme bei der Materialbeschaffung, sprich: dem Verbot der Einfuhr “westlicher” Noten, das aber letzten Endes dazu führte, dass die Lehrenden nach und nach eigene Unterrichtsliteratur verfassten. Das Dresdner Modell jedenfalls wurde bald von den anderen Musikhochschulen der DDR übernommen.
Als Frank-Harald Greß 1959 nach dem Studium der Musikwissenschaft begann an der Dresdner Musikhochschule zu unterrichten, “schmuggelte er”, wie er sich erinnert, den Jazz in seine Vorlesungen über Musikgeschichte, Akustik und Instrumentenkunde, obwohl es von staatlicher Seite noch erhebliche Vorbehalte gegen die “Musik des Klassenfeindes” gab. Als Greß im Jahr darauf eine Jazzcombo bei einer offiziellen Veranstaltung auftreten ließ, war der Rektor zwar ästhetisch entsetzt, meinte aber – die Großwetterlage in Bezug auf den Jazz hatte sich in der DDR gerade gewandelt –: “die Entwicklung der sozialistischen Musikkultur verlange, auch für ein höheres Niveau der ‘leichten Musik zu sorgen”. Gebeten, weitere Dozenten aus Jazz- und Tanzmusikkreisen zu verpflichten, wandte sich Greß an den Pianisten Günter Hörig. Der spielte mit seinem Trio vor, und einige argumentatorischen Tricks später (Jazz als Musik des “anderen” Amerika) wurde in Dresden der erste Studiengang für “Tanz- und Unterhaltungsmusik” begründet. Greß erinnert sich an einige der Schwierigkeiten des jungen Studiengangs – zum Vorspiel des ersten Schlagzeugbewerbers Baby Sommer gab es etwa kein hochschuleigenes Instrument, so dass der auf hölzernen Stuhlsitzen trommelte –, und er beschreibt, wie es ihm gelang, statt eines Aufbau- oder Zusatzstudiengangs eine selbständige Vollausbildung durchzusetzen, “mit Diplomabschluss für den Studiengang Kapellenleiter”. Er erinnert sich an die Probleme bei der Materialbeschaffung, sprich: dem Verbot der Einfuhr “westlicher” Noten, das aber letzten Endes dazu führte, dass die Lehrenden nach und nach eigene Unterrichtsliteratur verfassten. Das Dresdner Modell jedenfalls wurde bald von den anderen Musikhochschulen der DDR übernommen.
Diesem Studiengang, der nach der Wende in “Fachgruppe Jazz/Rock/Pop” unbenannt wurde und noch heute besteht, widmet sich jetzt eine Buchdokumentation mit 25 Essays zur Geschichte, zur Gegenwart und zum pädagogischen Anspruch der Jazz- und Pop-Ausbildung an der Dresdner Hochschule für Musik Carl Maria von Weber. Rainer Lischka war einer der Studenten der ersten Stunde; er erinnert sich an die Diskussionen in den 1960er Jahren und die geschickten strategischen Schachzüge, mithilfe derer Greß seinen Jazzkollegen einen freien Rücken verschaffte. Stefan Gies, Ralf Beutler und Günter Baby Sommer beschreiben die Hochschule der Nachwendezeit, an der die Dozent:innen versuchten, dem nun offiziell auch als Jazzstudiengang titulierten Programm ein eigenes Gesicht zu geben. Sommer verhehlt nicht die Anfeindungen, die es nicht nur aus der etablierten Musik gab, sondern auch aus der Jazzszene selbst, in der einige den abgesicherten institutionalisierten “Jazzprofessor” als Gegensatz zu dem verstanden, wofür Jazz immer gestanden hatte, Protest, Widerstand, Underground. Jens Wagner erinnert an Günter Hörigs pädagogisches Konzept. Der Rest des Buchs aber ist Gegenwart: Dozentinnen (Céline Rudolph, Esther Kaiser, Inéz Schaefer und Julia Kadel) und Dozenten (Thomas Zoller, Thomas Fellow, Stephan Bormann, Sönke Meinen, Matthias Bätzel, Malte Burba, Sebastian Studnitzky, Sebastian Haas, Sebastian Merk und andere) berichten über ihren eigenen Weg an die HfM Dresden und die Besonderheiten ihres Lehrangebots. Eine Auflistung aller seit 1962 im Fach Jazz/Rock/Pop Lehrender beschließt das Buch.
“Jazz/Rock/Pop – Das Dresdner Modell” ist eine Festschrift zum 60jährigen Bestehen des Dresdner Studiengangs. Diesen Festschrift-Charakter merkt man dem Buch an jeder Stelle an. Viel ist vom Modellcharakter die Rede, viel vom Stolz auf die eigene Abteilung. Es fehlt eine kritische Würdigung, es fehlt neben der Eigensicht die Sicht von außen. So ließe sich ein Aufsatz vorstellen, der die Erinnerungen Frank-Harald Greß’ in den Kontext der Kulturpolitik des DDR-Staats stellen würde. Es ließe sich eine kritische Auseinandersetzung vorstellen, was in einem künstlerischen Studiengang zu Jazz/Rock/Pop lehr- und lernbar ist und was nicht. Wünschenswert wäre aber auch ein Vergleich des “Dresdner Modells” mit anderen Studiengängen in Deutschland (oder darüber hinaus). So ist das Buch ein interessanter und von den Autor:innen höchst persönlich gestalteter “Beitrag zur Geschichte der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber”, der allerdings die Chance vergibt über den eigenen Tellerrand zu blicken. Immerhin: Die selbstgestellte Aufgabe des Bandes war es, “Einblicke vermitteln in Geschichte und Gegenwart” der Jazz/Rock/Pop-Ausbildung Und das ist auf jeden Fall gut gelungen.
Wolfram Knauer (April 2021)
A Jazzman’s Tale. A screenplay memoir of 1950s jazz trumpeter and pianist Charles Freeman Lee
von Annette Johnson
Middletown/DE 2021 (self-published/Amazon)
150 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 9781544648910
 Charles Freeman Lee – wahrscheinlich wirklich nur eingefleischten Jazzfans ist der Name ein Begriff: Zwischen 1952 und 1955 war er als Freeman Lee an verschiedenen Aufnahmesitzungen des legendären Pianisten Elmo Hope beteiligt gewesen. Der Klappentext von Annette Johnsons literarisch-biographischem Drehbuch fasst seine Karriere zusammen: Geboren in New York studierte Lee an der Wilberforce University, einem der sogenannten “Historically Black Colleges and Universities” der Vereinigten Staaten, in deren Schulband er unter anderem mit Frank Foster, George Russell, Snooky Young und anderen saß. Er tourte mit Snooky Youngs Band, kehrte dann zurück nach New York, wo er mit Musikern wie Eddie Cleanhead Vinson, James Moody, Lou Donaldson und Thelonious Monk auftrat und die bereits erwähnten Aufnahmen mit Elmo Hope machte. In New York verliebte er sich in Jenny, die damalige Frau Milt Jacksons, die sich daraufhin vom Vibraphonisten des Modern Jazz Quartet scheiden ließ, um Lee zu heiraten. Seine Heroinsucht brachte ihn wenig später ins New Yorker Gefängnis von Riker’s Island, wo er mit Jackie McLean, Hank Mobley und Elvin Jones auf alte Bekannte aus der Jazzszene trifft. In den 1970er und 1980er Jahren hatte Lee das Musikgeschäft verlassen und unterrichtete Biologie im Mittleren Westen, begann dann in den 1990ern wieder aufzutreten, jetzt vor allem mit europäischen und südafrikanischen Musikern und in Europa.
Charles Freeman Lee – wahrscheinlich wirklich nur eingefleischten Jazzfans ist der Name ein Begriff: Zwischen 1952 und 1955 war er als Freeman Lee an verschiedenen Aufnahmesitzungen des legendären Pianisten Elmo Hope beteiligt gewesen. Der Klappentext von Annette Johnsons literarisch-biographischem Drehbuch fasst seine Karriere zusammen: Geboren in New York studierte Lee an der Wilberforce University, einem der sogenannten “Historically Black Colleges and Universities” der Vereinigten Staaten, in deren Schulband er unter anderem mit Frank Foster, George Russell, Snooky Young und anderen saß. Er tourte mit Snooky Youngs Band, kehrte dann zurück nach New York, wo er mit Musikern wie Eddie Cleanhead Vinson, James Moody, Lou Donaldson und Thelonious Monk auftrat und die bereits erwähnten Aufnahmen mit Elmo Hope machte. In New York verliebte er sich in Jenny, die damalige Frau Milt Jacksons, die sich daraufhin vom Vibraphonisten des Modern Jazz Quartet scheiden ließ, um Lee zu heiraten. Seine Heroinsucht brachte ihn wenig später ins New Yorker Gefängnis von Riker’s Island, wo er mit Jackie McLean, Hank Mobley und Elvin Jones auf alte Bekannte aus der Jazzszene trifft. In den 1970er und 1980er Jahren hatte Lee das Musikgeschäft verlassen und unterrichtete Biologie im Mittleren Westen, begann dann in den 1990ern wieder aufzutreten, jetzt vor allem mit europäischen und südafrikanischen Musikern und in Europa.
Dort traf Annette Johnson Freeman Lee im Jahr 1993 in einem leeren Pariser Jazzclub, in dem er ihr seine Lebensgeschichte erzählte. Sie war von der Lebendigkeit seiner Erzählung so fasziniert, dass sie entschied ein Buch daraus zu machen, allerdings nicht irgendein Buch, sondern: ein Drehbuch. Und so ist “A Jazzman’s Tale” zwar die Biographie eines weitgehend vergessenen Bebop-Musikers, zugleich aber auch die auf einen zukünftigen Film gerichtete Dramatisierung dieser Geschichte durch die Autorin.
Wer schon mal Drehbücher gelesen hat, weiß, dass solch eine Lektüre schwerfällig ist, da sie die Dialogsequenzen genauso wiedergibt wie Kameraeinstellungen, Requisiten, Stimmungen. Die Geschichte wechselt zwischen dem New York der 1950er, dem Paris der 1990er und dem Ohio der 1940er Jahre, lässt Musiker wie Benny Bailey, Milt Jackson, Billy Brooks und Frank Foster auftreten, führt in Jazzclubs wie das Royal Roost oder das Paradise in Harlem, erzählt von Brotjobs in einer Näherei oder als Bote, von der Drogensucht, vom Frust zur Armee eingezogen zu werden, und vom Gefängnis. In unserem geistigen Soundtack hören wir Bebopklänge von Charlie Parker und Miles Davis’ Musik zum Film “Fahrstuhl zum Schafott”, erleben aber auch, wie der Saxophonist Big Nick Nicholas vier junge Trompeter durch sämtliche Tonarten jagt. Wir lesen von den unterschiedlichen Erfahrungen mit Rassismus, den Lee, wie er an einer Stelle anmerkt, nirgends als so schlimm erlebt habe wie in New York. Und wir haben teil an der zentralen Liebesgeschichte zwischen Freeman und Jenny, in der sich die Innen- und die Außensicht auf Persönliches, Gesellschaftliches und die Musik treffen, und die mit Lees Verhaftung endet.
Und so weiter und so fort. Ein erzählter Film ist wie duftendes Essen, er macht neugierig, stillt aber nicht den Hunger. Diesen, also den Hunger nach mehr Informationen über Freeman Lees Leben und Karriere, können immerhin die Interviewschnipsel aus dem Pariser Club befriedigen, die Johnson einstreut, sowie ein Gespräch, das seine Schwester Jane Lee Ball in den 1980er Jahren mit dem Trompeter über die New Yorker Jazzszene der späten 1940er und frühen 1950er Jahre führte. Zum Schluss vervollständigen noch Fotos aus der Geschichte des Wilberforce College (aber ohne konkreten Bezug zu Freeman Lee) das Buch.
Für den Jazzfreund mag sich “A Jazzman’s Tale” ein wenig zwiespältig lesen. Es ist, wie bereits erwähnt, keine klassische Biographie, und so sind auch alle von Johnson erfundenen Szenen nicht für bare Münze zu nehmen. Andererseits erlaubt die Dialogform, in der sie zahlreiche Erinnerungen Lees einbettet, die Atmosphäre, die verschiedenen Einflüsse und Erfahrungen, die den Trompeter geprägt und beeinflusst haben, weit besser zu vermitteln als dies eine nüchterne Darstellung vermocht hätte. Vielleicht hätte sich für die Buchveröffentlichung noch eine Chronologie angeboten, die dem nicht geübten Drehbuchleser erlaubte, die verschiedenen Szenen einzuordnen. Vielleicht wäre es eine gute Idee gewesen, den sehr persönlichen Interviews, die Grundlage des Drehbuchs waren, eine kurze Abhandlung über Lee als Trompeter zur Seite zu stellen. Aber dann war all das nie der Plan gewesen: Annette Johnson hat ein Drehbuch geschrieben, für einen Film, der zwar noch nicht gedreht ist, auf den man aber, sofern man sich auf die Lektüre einlässt, neugierig sein kann.
Wolfram Knauer
(März 2021)