Swing from a Small Island. The Story of Leslie Thompson
von Leslie Thompson & Jeffrey Green
London 2009 (Northway)
203 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-0-9557888-2-6
 Leslie Thompson gehört zu den bedeutendsten britischen Jazzmusikern der 1930er Jahre. 1985 setzte er sich mit dem Musikhistoriker Jeffrey Green zusammen, um seine Lebensgeschichte aufzuzeichnen, die Green später redigierte und in lesbare Form brachte. Die erste Ausgabe der Autobiographie erschien 1985; die Wiederveröffentlichung ist ein willkommenes Dokument zur europäischen Jazzgeschichte.
Leslie Thompson gehört zu den bedeutendsten britischen Jazzmusikern der 1930er Jahre. 1985 setzte er sich mit dem Musikhistoriker Jeffrey Green zusammen, um seine Lebensgeschichte aufzuzeichnen, die Green später redigierte und in lesbare Form brachte. Die erste Ausgabe der Autobiographie erschien 1985; die Wiederveröffentlichung ist ein willkommenes Dokument zur europäischen Jazzgeschichte.
Thompson kam 1901 in Jamaika zur Welt. Er erzählt über das Leben auf der Insel und seinen Wunsch Musiker zu werden. 1919 schiffte er sich mit einigen Mitmusikern nach England ein, wo er bald darauf Musik studierte. Zurück in Jamaika spielte er Trompete in Tanzkapellen und wurde Leiter einer Kapelle, die Stummfilme im Kino begleitete. Als der Tonfilm aufkam, sah er seine Arbeitsmöglichkeiten schwinden, kaufte eine Schiffspassage und setzte sich 1929 endgültig nach England ab.
Anfangs ohne Arbeit, traf Thompson nach einer Weile auf Will Garland, einen amerikanischen Konzertveranstalter, der verschiedene afro-amerikanische oder auch afrikanische Show-Acts managte und ihn engagierte. Thompson berichtet vom Alltag eines Unterhaltungsmusikers im London der frühen 1930er Jahre, von rassistischen Vorbehalten und von Überlebensstrategien. Er beschreibt einige der Acts, die er begleitete, aber auch die Szene der Theaterorchester, in der er bald einen Platz einnahm, so etwa in Noel Cowards Show “Words and Music” von 1932.
Im selben Jahr hörte er Louis Armstrong während dessen Londoner Konzerten, und als Armstrong im nächsten Jahr allein zu einem längeren Europaaufenthalt zurückkam, wurde Thompson Teil seiner europäischen Begleitband. Später spielte der Trompeter mit Ken Johnsons Jamaican Emperors of Jazz und andere schwarzen britischen Bands. 1942 wurde Thompson eingezogen, schnell aber zur Leitung einer Armeekappelle abgestellt. Nach dem Krieg schrieb er sich in der Guildham School of Music ein, entschied sich dann 1954, das Musikgeschäft ganz zu verlassen. In einer weiteren Karriere arbeitete er bis 1971 als Bewährungshelfer und danach noch fünf Jahre als Gefängniswärter.
Thompsons Autobiographie ist jazzhistorische Zeitgeschichte, ein wichtiges und wenig dokumentiertes Kapitel des europäischen Jazz, im Stil sehr persönlich gehalten und von Jeffrey Green in einen flüssig zu lesenden Text redigiert. Ein Anmerkungsapparat erklärt historische Sachverhalte; ein weiterer Anhang Aussagen von Zeitgenossen über Thompson. Ein Namensindex schließt das Buch ab, in dem außerdem etliche seltene Fotos abgedruckt sind.
Wolfram Knauer (Dezember 2013)
When Swing Was the Thing. Personality Profiles of the Big Band Era
von John R. Tumpak
Milwaukee 2009 (Marquette University Press)
264 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-0-87462-024-5
 Als in Kalifornien ansässiger Jazzjournalist beschäftigt sich John Tumpak sich seit langem mit der Bigband-Ära, den Jahren zwischen 1935 und 1946, als der Jazz die populäre Musik Amerikas war. Sein Buch “When Swing Was the Thing” enthält Profilen über und Interviews mit vierzehn Bandleadern, fünfzehn Sidemen, elf Vokalisten, fünf Arrangeuren und vier sonst mit dem Bandbusiness der Swingära befassten Personen. Tumpaks Auswahl umfasst bedeutende Stars wie Benny Goodman, Glenn Miller, Artie Shaw, Chick Webb, aber auch weniger nachhaltig wirkende Bands wie Horace Heidt, Alvino Rey, Orrin Tucker und andere.
Als in Kalifornien ansässiger Jazzjournalist beschäftigt sich John Tumpak sich seit langem mit der Bigband-Ära, den Jahren zwischen 1935 und 1946, als der Jazz die populäre Musik Amerikas war. Sein Buch “When Swing Was the Thing” enthält Profilen über und Interviews mit vierzehn Bandleadern, fünfzehn Sidemen, elf Vokalisten, fünf Arrangeuren und vier sonst mit dem Bandbusiness der Swingära befassten Personen. Tumpaks Auswahl umfasst bedeutende Stars wie Benny Goodman, Glenn Miller, Artie Shaw, Chick Webb, aber auch weniger nachhaltig wirkende Bands wie Horace Heidt, Alvino Rey, Orrin Tucker und andere.
Die Kapitel gehen knappe biographische Abrisse und widmen sich dann vor allem den Zwängen des Bandbusiness der 1930er und frühen 1940er Jahre. Nebenbei stellt Tumpak einige der wichtigen Spielstätten vor, bietet einen Einblick in die Agenturtätigkeit, die notwendig war, um solch große Orchester im ganzen Land zu buchen, benennt Rundfunk und Fernsehen als wichtige PR-Standbeine neben der Schallplatte. Von nachhaltiger Wirkung für den späteren Jazz sind unter den von ihm ausgewählten Bandleadern neben Goodman, Webb und Shaw vor allem John Kirby und Gerald Wilson.
Den für diesen Rezensenten spannendste Teil des Buchs bilden die Porträts ehemaliger Swingband-Sidemen, die in ihren Interviews mit Tumpak oft genug vom Alltag erzählen, aber auch von den Auswirkungen der stilistischen Umbrüche nach dem Bebop. Milt Bernhart, Buddy Childers, John LaPorta und Jake Hanna sind in diesem Teil die vielleicht bekanntesten Namen. Jack Costanzo mag man als Anfang der 1950er Jahre recht präsenten Bongospieler zumindest dem Sound nach kennen, der außerdem etlichen Hollywood-Stars das Bongospiel beibrachte. Rosalind Cron gehörte zu den International Sweethearts of Rhythm, mit denen sie 1945/46 auch durch die US-Armeebasen in Europa tourte. Den Gitarristen Roc Hillman, der mit den Dorsey Brothers spielte, oder den Trompeter Legh Knowles, der bei Glenn Miller seine Karriere begann und später ein erfolgreicher Weinbauer im Napa Valley wurde, wird selbst unter Jazzexperten kaum jemand kennen. Gleiches gilt für den Posaunisten Chico Sesma, der seit den frühen 1940er Jahren auf der Latin-Szene Süd-Kaliforniens aktiv ist, oder den Saxophonisten und Sänger Butch Stone, der in der Van Alexander Band als “der weiße Louos Jordan” bekannt wurde. Unter den von Tumpak vorgestellten Sidemen ist schließlich einer, der es in anderer Funktion zu weltweiter Bekanntheit brachte: Der Saxophonist Alan Greenspan gab seine vielversprechende Musikerlaufbahn auf, um sich der Ökonomie zu widmen und später von 1987 bis 2007 Chef der US-Notenbank zu werden.
Die Bigbandära war reich an Sängerinnen und Sängern, und Tumpak stellt auch diese vor. Bob Eberly wurde vor allem als Vokalist der Dorsey Brothers bekannt; Herb Jeffries sang sowohl mit Earl Hines als auch mit Duke Ellington. Jack Leonard erzählt über seine Zeit bei Tommy Dorsey, wo er durch keinen geringeren als Frank Sinatra ersetzt wurde. Jo Stafford und Kay Starr legten auch nach der Swingära anhaltende Karrieren hin; die Namen Dolores O’Neill oder Bea Wain dagegen muss der durchschnittliche Jazzfan wahrscheinlich eher googeln.
Frank Comstock berichtet über seine Arrangierarbeit für Les Brown, aber auch für die Zusammenarbeit mit Doris Day. Johnny Mandel erzählt, dass er in den 1940er Jahren zusammen mit Miles Davis und anderen in Gil Evans’ Apartment auf der 55sten Straße in Manhattan rumhing. Die drei Arrangeure Fletcher Henderson, Don Redman und Sy Oliver schließlich werden in einem Kapitel zusammengefasst, bevor der letzte Teil des Buchs die Radio-DJs Chuck Cecil und Henry Holloway, den Promoter Tom Sheils und den Kritiker George T. Simon vorstellt.
“When Swing Was the Thing” zeichnet sich dadurch aus, dass der Autor die bekannten Pfade der Swingära zwar nicht außer Acht lässt, seinen Fokus aber insbesondere auf weniger bekannte Persönlichkeiten legt, Musiker, deren Arbeit notwendig war, um die Swingindustrie am Leben zu halten. Tumpak kategorisiert nicht, und auch die Rollenverteilung schwarz-weiß, die politische oder wirtschaftliche Situation, in der sich die Musik in jenen Jahren abspielte, werden von ihm kaum kritisch hinterleuchtet. Man mag die Auswahl an Porträt-Subjekten hinterfragen, bei denen ein deutliches Schwergewicht auf weißen Bands und Musikern liegt; man mag sich wünschen, dass der Autor in seinen Gesprächen tiefer in Details über den musikalischen Alltag eingedrungen wäre. Das aber war nie seine Intention gewesen, wie Tumpak gleich in seinem Vorwort erklärt: Er wollte vor allem den persönlichen Hintergrund der von ihm porträtierten Musiker vorstellen, Charakterstudien erstellen. Das ist ihm auf jeden Fall gelungen, und weit über 100 seltene Fotos runden das Buch ab, das damit einen etwas anderen Einblick in die Swingära erlaubt.
Wolfram Knauer (November 2013)
New Orleans Trumpet in Chicago
von Christopher Hillman & Roy Middleton & Clive Wilson
Tavistock/England 2009 (Cygnet Productions)
100 Seiten, 12 Britische Pfund (inclusive Porto innerhalb Europas)
Bestellungen über gooferdust@hotmail.com
 Die Jazzforschung hat wissenschaftliche Studien immer genauso gebraucht wie Recherchen von musikalischen Laien, die dieser Musik aber mit Herzblut verbunden waren. Von Jazzfans in ihrer Freizeit erstellte Diskographien entsprechen dabei oft genug dem, was in der klassischen Musik als Werkverzeichnis bezeichnet wird und Musikforschern früher durchaus einen akademischen Grad einbringen konnte. Dies sei vorausgeschickt, denn die Würdigung der nicht-akademischen Beiträge zur Jazzforschung ist nicht zu unterschätzen.
Die Jazzforschung hat wissenschaftliche Studien immer genauso gebraucht wie Recherchen von musikalischen Laien, die dieser Musik aber mit Herzblut verbunden waren. Von Jazzfans in ihrer Freizeit erstellte Diskographien entsprechen dabei oft genug dem, was in der klassischen Musik als Werkverzeichnis bezeichnet wird und Musikforschern früher durchaus einen akademischen Grad einbringen konnte. Dies sei vorausgeschickt, denn die Würdigung der nicht-akademischen Beiträge zur Jazzforschung ist nicht zu unterschätzen.
Christopher Hillman ist einer der aktiven Forscher dieses Metiers. Ein Spezialist für frühen New-Orleans-Jazz hat er seit den frühen 1970er Jahren regelmäßig über die Heroen aus New Orleans publiziert, in Magazinen wie Storyville, dem Jazz Journal, Footnote und anderen Publikationen, die nicht so sehr journalistische Aspekte als vielmehr eine ernsthafte Recherche in den Vordergrund stellten.
Im vorliegenden Band finden sich Recherchen, die Hillman, Roy Middleton und Clive Wilson zu fünf Trompetern machten, die aus New Orleans stammte, die durch ihre Karriere aber bald nach Chicago verschlagen wurden. Jedes der Kapitel beginnt mit einer biographischen Würdigung und einem kurzen Abriss über die Tätigkeit des betreffenden Musikers im Chicago der 1930er (bis 1950er) Jahre. Die herausgestellten Künstler sind die Trompeter Lee Collins, Punch Miller, Herb Morand und Guy Kelly, die in der Chicagoer Jazzszene der 1930er Jahre besonders aktiv waren sowie der Schlagzeuger Snags Jones, der viel mit Punch Miller arbeitete, mit Lee Collins befreundet war und ein wenig im Schatten seines bekannteren Kollegen Baby Dodds stand.
Das Buch genauso wie andere Publikationen in dieser Reihe ist sicher vor allem für Sammler interessant. Die Verbindung der biographischen Darstellung und Diskographie ist allemal eine sinnvolle Kombination, die eine historische Einordnung der verzeichneten Aufnahmen erlaubt. Die Autoren runden das alles mit zum Teil seltenen Fotos der Bands sowie der Plattenlabels ab. Als Dreingabe gibt es eine CD mit seltenen Aufnahmen von Lee Collins aus den frühen 1950er Jahren sowie mit Punch Miller und Snags Jones aus dem Jahr 1941.
Wolfram Knauer (September 2013)
100+1 Saxen. De collectie van Leo van Oostrom
von Leo van Oostrom
Amsterdam 2009 (Edition Sax)
160 Seiten, 30 Euro
ISBN: 978-09-90-24403-7
 Leo van Oostrom ist als Saxophonist Mitglied des Metropole Orckestra, leitet außerdem das Dutch Saxophone Quartet und sammelt Instrumente. 101 Sammlerstücke aus seinem Fundus stellt er nun in einem exklusiven Fotoband vor.
Leo van Oostrom ist als Saxophonist Mitglied des Metropole Orckestra, leitet außerdem das Dutch Saxophone Quartet und sammelt Instrumente. 101 Sammlerstücke aus seinem Fundus stellt er nun in einem exklusiven Fotoband vor.
Nach einleitenden Kapiteln zu den verschiedenen Herstellern, Adolphe Sax selbst etwa, Adolphe Edouard Sax, Henri Selmer, oder Ferdinant August Buescher finden sich Instrumente aller Tonlagen und Größen, mit instrumentenspezifischen Angaben zum Baujahr, zur Größe, zum Tonumfang.
Am exotischsten sind die Abbildungen seltener Saxophonvarianten wie des Couenophons oder des Saxettes des Playasax oder des Mellosax, des Swanee-Sax, des Oktavins und einiger Nicht-Saxophon-Varianten, des Tarogato etwa, des JeTeL-Sax. Zu einigen dieser Sonderfabrikate erhält man nüchterne Informationen in Van Oostroms dreisprachigem Text (Niederländisch, Englisch, Französisch), zu vielen der Instrumente wünschte man sich darüber hinaus, sie einmal in Aktion zu hören.
Van Ostroms Buch ist sicher vor allem ein Geschenk für Saxophon-Narren; die exzellenten, gestochen scharfen Abbildungen haben darüber hinaus einen enormen ästhetischen Reiz.
Wolfram Knauer (April 2013)
Jazz Notes. Interviews across the Generations
von Sanford Josephson
Santa Barbara/CA 2009 (Praeger)
209 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-313-35700-8
 Sanford Josephson portraitiert in seinem Buch 22 Musiker, die er in biographischen Artikeln, oft mit Exzerpten selbst geführter Interviews vorstellt, um dann mit Kollegen zu sprechen, die mit diesen Musikern gespielt hatten oder stark von ihnen beeinflusst wurden. Sein Buch “Jazz Notes” ist damit eine atmosphärehaltige Lektüre, die einem die Künstler vor allem als hart arbeitende Menschen näher bringt, versucht, ihrer Musik ihren Charakter zuzugesellen. Das gelingt zumeist gut, zumal sämtliche Personen, die in Josephsons Buch eine Hauptrolle spielen, ein eigenes Buch verdienten – sofern es nicht schon geschrieben wurde.
Sanford Josephson portraitiert in seinem Buch 22 Musiker, die er in biographischen Artikeln, oft mit Exzerpten selbst geführter Interviews vorstellt, um dann mit Kollegen zu sprechen, die mit diesen Musikern gespielt hatten oder stark von ihnen beeinflusst wurden. Sein Buch “Jazz Notes” ist damit eine atmosphärehaltige Lektüre, die einem die Künstler vor allem als hart arbeitende Menschen näher bringt, versucht, ihrer Musik ihren Charakter zuzugesellen. Das gelingt zumeist gut, zumal sämtliche Personen, die in Josephsons Buch eine Hauptrolle spielen, ein eigenes Buch verdienten – sofern es nicht schon geschrieben wurde.
Die dramatis personae seiner “Jazz-Notizen” heißen: Hoagy Carmichael, Fats Waller, Joe Venuti, Count Basie, Jonah Jones, Art Tatum, Earle Warren, Howard McGhee, Milt Hinton, Helen Humes, Dizzy Gillespie, George Shearing, Dave Brubeck, Norris Turney, Jon Hendricks, Arvell Shaw, Gerry Mulligan, Dick Hyman, Maynard Ferguson, Stanley Cowell, David Sanborn und Billy Taylor. Josephsons Beobachtungen über ihre Persönlichkeit sind journalistisch und einfühlsam, seine Gespräche mit Zeitzeugen aufschlussreich, etwa, wenn Jeanie Bryson über ihren Vater Dizzy Gillespie berichtet, wenn Butch Miles über seine Zeit bei Basie erzählt, Barbara Carroll oder Marian McPartland über den Einfluss Art Tatums und so weiter und so fort.
Ab und zu kommen dabei über die bereits bekannten Eigenschaften der so Gefeierten auch eher wenig bekannte Geschichten zutage. Neu geschrieben werden muss die Jazzgeschichte deshalb sicher nicht, dafür geht Josephson denn auch nicht tief genug in seine Materie. Sein Buch bietet auf jeden Fall eine flotte und anekdotenreiche Lektüre, die man am besten bei swingender Musik genießt.
Wolfram Knauer (April 2013)
Jazz Diplomacy. Promoting America in the Cold War Era
von Lisa E. Davenport
Jackson/MS 2009 (University Press of Mississippi)
219 Seiten, 50,00 US-Dollar
ISBN: 978-1-60473-268-9
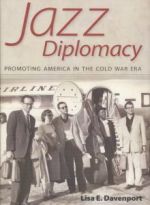 In den 1950er Jahren wurde der Jazz politisch. Nein, natürlich war Jazz bereits zuvor eine politische Musik, nicht nur in den Werken Duke Ellingtons, die sich schwarzer Musik- und Sozialgeschichte annahmen. Aber in den 1950er Jahren entdeckte die amerikanische Politik den Jazz als politisches Instrument im Rahmen des Kalten Kriegs. Musiker wie Louis Armstrong, Duke Ellington, Benny Goodman und Dizzy Gillespie sollten der Welt ein Amerika der Demokratie und Freiheit präsentieren, sollten für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft werben.
In den 1950er Jahren wurde der Jazz politisch. Nein, natürlich war Jazz bereits zuvor eine politische Musik, nicht nur in den Werken Duke Ellingtons, die sich schwarzer Musik- und Sozialgeschichte annahmen. Aber in den 1950er Jahren entdeckte die amerikanische Politik den Jazz als politisches Instrument im Rahmen des Kalten Kriegs. Musiker wie Louis Armstrong, Duke Ellington, Benny Goodman und Dizzy Gillespie sollten der Welt ein Amerika der Demokratie und Freiheit präsentieren, sollten für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft werben.
Lisa E. Davenport untersucht in ihrem aus ihrer Dissertation entstandenen Buch die Intentionen hinter der Entscheidung, Jazz als Instrument der amerikanischen Außenpolitik einzusetzen, aber auch die Probleme der Umsetzung. Zugleich fragt sie nach der Schere zwischen Außenwirkung und insbesondere dem immer noch währenden Rassismus in den Vereinigten Staaten. Davenport recherchierte für ihr Buch in Archiven, schaute sich Pläne, Protokolle, Regierungsentscheidungen in Bezug auf Jazzprojekte an, beleuchtet die Erfahrungen insbesondere schwarzer Musiker im Ausland und die tatsächliche Wahrnehmung ihrer Konzerte und Tourneen in Ländern hinter dem Eisernen Vorhang. Ihr Blick auf die ausländischen Aktivitäten richtet sich dabei aber auch immer wieder auch auf die Reaktionen im eigenen Land, auf politische, ideologische und gesellschaftliche Veränderungen, an denen die Außenwahrnehmung der USA durchaus beteiligt war.
Der Jazz wird von den USA immer noch als Mittel der Außenpolitik benutzt. Lisa Davenports Buch erklärt die Genese dieser politischen Qualität des Jazz und die alles andere als eindimensionalen Resultate dieser Jazz-Diplomatie.
Wolfram Knauer (November 2012)
“Ja, der Kurfürstendamm kann erzählen.” Unterhaltungsmusik in Berlin in Zeiten des Kalten Krieges
von Martin Lücke
Berlin 2009 (B&S Siebenhaar Verlag)
192 Seiten, 24,80 Euro
ISBN: 978-3-936962-46-8
 Berlin war eines der wichtigsten Zentren europäischer Unterhaltungskultur in den 1920er Jahren, wie man etwa aus Klaus Manns autobiographischem Roman “Der Wendepunkt” erfährt. Martin Lückes Sachbuch zitiert andere Quellen, um die Unterhaltungsmusik der Kaiserzeit, der Weimarer Republik und des Dritten Reichs zu beschreiben. Das alles ist allerdings nur die Vorgeschichte zu Lückes eigentlichem Thema, das dann tatsächlich mit der “Stunde Null” anfängt und fragt, wie sich im kriegszerstörten Berlin eine neue Musikszene aufbauen konnte, welche Rolle die Unterhaltungsmusik bei der Bewältigung von Krieg und Naziherrschaft spielte. Lücke schildert die ersten Konzerte im Nachkriegsberlin, schaut auf behördliche Regeln und die Arbeitssituation der Musiker. Er betrachtet die Geburt der GEMA und die Programmpolitik der öffentlichen Rundfunksender (RIAS, AFN). Das RBT-Orchester und der Schlagersänger Bully Buhlan erhalten ausführliche Würdigungen. Die wiederauflebende Kabarettszene um Günter Neumanns Insulaner erhält ein eigenes Kapitel, in dem auch Rex Stewarts Besuch beim Hot Club Berlin erwähnt wird. Einer der Hauptprotagonisten seines Buchs aber ist Hans Carste, der bereits in den 1930er Jahren erfolgreiche Filmmusiken geschrieben hatte und nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1948 wieder in Berlin von sich Reden machte. Carste dient Lücke als Musterbeispiel für eine Musik zwischen Schlager, Filmmusik und Bigbandjazz, dessen Erinnerungen und Dokumente die folgenden Seiten (und übrigens auch eine dem Buch beiheftenden CD) füllen. Carste wurde 1949 Abteilungsleiter Leichte Musik beim RIAS, der zwischen 1949 und 1961, als Berlin Zentrum des Kalten Kriegs war, zu einem der wichtigsten Propagandainstrumente in der Konkurrenz zwischen West und Ost wurde. Clubs wie die Badewanne und Hallen wie der Sportpalast erwähnt Lücke am Rande ebenfalls. Sein letztes Kapitel ist “Nach dem Mauerbau” überschrieben, befasst sich aber nur kurz mit den auseinander divergierenden Szenen. Lücke begleitet Hans Carste noch bis zu seinem Tod im Mai 1971, aber da ist der Berliner Kalte Krieg, von dem er erzählen will, bereits weitgehend vorbei.
Berlin war eines der wichtigsten Zentren europäischer Unterhaltungskultur in den 1920er Jahren, wie man etwa aus Klaus Manns autobiographischem Roman “Der Wendepunkt” erfährt. Martin Lückes Sachbuch zitiert andere Quellen, um die Unterhaltungsmusik der Kaiserzeit, der Weimarer Republik und des Dritten Reichs zu beschreiben. Das alles ist allerdings nur die Vorgeschichte zu Lückes eigentlichem Thema, das dann tatsächlich mit der “Stunde Null” anfängt und fragt, wie sich im kriegszerstörten Berlin eine neue Musikszene aufbauen konnte, welche Rolle die Unterhaltungsmusik bei der Bewältigung von Krieg und Naziherrschaft spielte. Lücke schildert die ersten Konzerte im Nachkriegsberlin, schaut auf behördliche Regeln und die Arbeitssituation der Musiker. Er betrachtet die Geburt der GEMA und die Programmpolitik der öffentlichen Rundfunksender (RIAS, AFN). Das RBT-Orchester und der Schlagersänger Bully Buhlan erhalten ausführliche Würdigungen. Die wiederauflebende Kabarettszene um Günter Neumanns Insulaner erhält ein eigenes Kapitel, in dem auch Rex Stewarts Besuch beim Hot Club Berlin erwähnt wird. Einer der Hauptprotagonisten seines Buchs aber ist Hans Carste, der bereits in den 1930er Jahren erfolgreiche Filmmusiken geschrieben hatte und nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1948 wieder in Berlin von sich Reden machte. Carste dient Lücke als Musterbeispiel für eine Musik zwischen Schlager, Filmmusik und Bigbandjazz, dessen Erinnerungen und Dokumente die folgenden Seiten (und übrigens auch eine dem Buch beiheftenden CD) füllen. Carste wurde 1949 Abteilungsleiter Leichte Musik beim RIAS, der zwischen 1949 und 1961, als Berlin Zentrum des Kalten Kriegs war, zu einem der wichtigsten Propagandainstrumente in der Konkurrenz zwischen West und Ost wurde. Clubs wie die Badewanne und Hallen wie der Sportpalast erwähnt Lücke am Rande ebenfalls. Sein letztes Kapitel ist “Nach dem Mauerbau” überschrieben, befasst sich aber nur kurz mit den auseinander divergierenden Szenen. Lücke begleitet Hans Carste noch bis zu seinem Tod im Mai 1971, aber da ist der Berliner Kalte Krieg, von dem er erzählen will, bereits weitgehend vorbei.
Kurz zusammengefasst erkennt man in Martin Lückes Buch also eigentlich zwei Themen. Das Anfangsthema ist tatsächlich das der Berliner Unterhaltungsmusikszene der Jahre 1945-1961. Daneben aber schiebt sich etwa ab der Hälfte des Textes das zweite Thema immer mehr in den Mittelpunkt des Buchs, nämlich Leben und Wirken Hans Carstes. Da verliert man dann als Leser schon mal den Roten Faden, weiß zwar, dass die Wahl Carstes durchaus ein geschickter Schachzug ist, um die historischen Fakten mit konkreten Inhalten zu füllen, vermisst aber gerade hier die allgemeinen Einordnungen, die Lücke in seinem ersten Teil so gut gelingen. Mit diesen Einschränkungen, die eher editorische sind – man hätte den Text auch im selben Buch deutlicher aufsplitten und den Leser damit eben nicht den roten Faden verlieren lassen können – bietet Lückes Buch eine hervorragende Dokumentation einer Szene, die eben nie “nur” eine Jazzszene war, sondern in Funktion und Selbstverständnis weit populärer angelegt als reine Jazzmusiker das hätten wahrhaben wollen.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
1959. the Year Everything Changed
von Fred Kaplan
Hoboken, New Jersey 2009 (John Wiley & Sons, Inc.)
322 Seiten, 27,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-470-38781-8
 Es ist gefährlich, zu viel Last auf einzelne Ereignisse zu legen, und nicht minder gefährlich scheint es, Schicksalsjahre auszurufen, auch wenn dies im Nachhinein geschieht. Gut, 1968 prägte tatsächlich nicht nur eine Generation, sondern steht, länderübergreifend für einen Wandel des sozialen und gesellschaftlichen Bewusstseins. Aber 1959? Fred Kaplan betrachtet in seinem Buch dieses Jahr als ein nicht minder schicksalsschweres Jahr. Er versammelt Fidel Castro, Malcolm X, Miles Davis, Ornette Coleman, Kalter Krieg, Independent Filme, Computer-Revolution, Mikrochips, Wettrennen im Weltall und vieles mehr in einem unterhaltsamen Buch, das einen tatsächlich in jenes Jahr verpflanzt und in der Vielseitigkeit der Darstellung durchaus Querverweise impliziert.
Es ist gefährlich, zu viel Last auf einzelne Ereignisse zu legen, und nicht minder gefährlich scheint es, Schicksalsjahre auszurufen, auch wenn dies im Nachhinein geschieht. Gut, 1968 prägte tatsächlich nicht nur eine Generation, sondern steht, länderübergreifend für einen Wandel des sozialen und gesellschaftlichen Bewusstseins. Aber 1959? Fred Kaplan betrachtet in seinem Buch dieses Jahr als ein nicht minder schicksalsschweres Jahr. Er versammelt Fidel Castro, Malcolm X, Miles Davis, Ornette Coleman, Kalter Krieg, Independent Filme, Computer-Revolution, Mikrochips, Wettrennen im Weltall und vieles mehr in einem unterhaltsamen Buch, das einen tatsächlich in jenes Jahr verpflanzt und in der Vielseitigkeit der Darstellung durchaus Querverweise impliziert.
Aus der Jazzseite sind etwa die Kapitel über Norman Mailer, Allan Ginsberg und Lenny Bruce interessant, vor allem aber die Kapitel “The Assault on the Chord”, das sich mit den harmonischen Experimenten George Russells und ihrer Umsetzung etwa durch Miles Davis befasst; “The Shape of Jazz to Come”, das Ornette Colemans neue Ästhetik beleuchtet; sowie “The New Language of Diplomacy”, das die Tourneen amerikanischer Jazzmusiker im Dienste des State Department beleuchtet.
Das alles ist kurzweilig dargestellt und unterhaltsam zu lesen. In der Nebeneinanderstellung ganz disparater Ereignisse öffnen sich durchaus interessante Querverbindungen, doch auch nach der Lektüre kommt 1959 weder an 1968 noch an andere Welt-Schicksalsjahre (1918, 1945, 1989) heran.
Lesenswert…
Wolfram Knauer (Mai 2012)
Roads of Jazz
Von Peter Bölke & Rolf Enoch
Hamburg 2009 (Edel Books)
156 Seiten, 6 CDs im Buchdeckel, 39,95 Euro
ISBN: 978-3940004-31-4
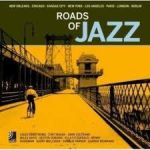 Das dicke Buch im Hardcovereinband und mit den vielen Fotos ist in Wahrheit – aber das merkt man erst, wenn man mitten drin ist im Schmökern – ein überdimensioniertes Begleitheft zu den sechs CDs, die in seinen Buchdeckeln heften. “Roads to Jazz” heißt es, und Autor Peter Bölke sowie Musikredakteur Rolf Enoch haben die Titel der CDs nach den wichtigsten Städten der Jazzgeschichte sortiert: New Orleans, Chicago, Kansas City, New York und Los Angeles. Die CDs wiederum sind chronologisch und stilistisch geordnet und heißen “Classic Jazz”, “New York Swing”, “New York Be-Bop”, “New York Modern Jazz”, “Cool & Westcoast Jazz” sowie “Jazz in Europe”. Alle Texte sind zweisprachig auf Deutsch und Englisch; im Anhang des Buchs befindet sich eine ausführliche Diskographie der Aufnahmen mit kompletten Besetzungsangaben und Daten.
Das dicke Buch im Hardcovereinband und mit den vielen Fotos ist in Wahrheit – aber das merkt man erst, wenn man mitten drin ist im Schmökern – ein überdimensioniertes Begleitheft zu den sechs CDs, die in seinen Buchdeckeln heften. “Roads to Jazz” heißt es, und Autor Peter Bölke sowie Musikredakteur Rolf Enoch haben die Titel der CDs nach den wichtigsten Städten der Jazzgeschichte sortiert: New Orleans, Chicago, Kansas City, New York und Los Angeles. Die CDs wiederum sind chronologisch und stilistisch geordnet und heißen “Classic Jazz”, “New York Swing”, “New York Be-Bop”, “New York Modern Jazz”, “Cool & Westcoast Jazz” sowie “Jazz in Europe”. Alle Texte sind zweisprachig auf Deutsch und Englisch; im Anhang des Buchs befindet sich eine ausführliche Diskographie der Aufnahmen mit kompletten Besetzungsangaben und Daten.
Über die Auswahl solcher Sampler kann man natürlich trefflich streiten – für Bölke und Enoch hört der amerikanische Jazz mit dem frühen Coltrane auf; die CD “Jazz in Europe” dagegen stellt gerade mal fünf Tracks von europäischen Musikern vor – alles andere sind Aufnahmen US-amerikanischer Jazzer, die in London, Paris oder Berlin eingespielt wurden.
Das Buch selbst besticht durch von Sven Grot wunderbar gestaltete Seiten mit knappen Texten zu den Musikern, die auf den CDs spielen und zu den Umständen, die sich mit der betreffenden historischen Situation verbindet. Allgemeinen Absätze zum Bebop oder zum Hardbop, zu V-Discs oder zu den Städten, in denen die Musik spielte und ausgesuchten Spielorten wie dem Cotton Club oder dem Birdland stehen kurze biographische Absätze gegenüber, in denen Bölke auf kürzestem Raum eine angemessene Würdigung der Künstler versucht. Das gelingt mal besser, lässt manchmal zu wünschen übrig, ist aber alles in allem eine kurzweilige Geschichte. Und als Text Book für Studenten ist dieses Buch eh nicht gedacht, sondern eher – siehe oben – als eine Art überdimensioniertes Begleitheft zu den CDs. Und da blättert man gern, zumal der Verlag wirklich schöne Fotos ausgewählt hat, Portraits der Musiker, aber auch Stadtlandschaften, Albumcovers, Plattenlabels etc.
Und natürlich ist das Buch wie alle Bücher in der Reihe “ear books” des Verlags Edel dazu gedacht, beim Hören der CDs durchblättert zu werden. Die kurzen Absätze hindern da nicht, sondern lassen im Gegenteil die wunderbare Musik auf den CDs im Mittelpunkt stehen.
“Roads of Jazz” ist ein ideales Geschenk selbst für Jazzfans, die schon einiges besitzen. Die werden die meisten der Titel zwar bereits in ihrer Sammlung haben und dennoch – gleich dem Rezensenten – neu hinhören, wenn die Mischung der Sampler-CDs und der Blick auf die Fotos die Neugier fokussiert.
Wolfram Knauer (Januar 2012)
The Ashgate Research Companion to Popular Musicology
herausgegeben von Derek B. Scott
Furnham, Surrey 2009 (Ashgate)
557 Seiten, 75 Britische Pfund
ISBN: 978-1-4094-2321-8
 Eine ernsthafte Jazzforschung gibt es bereits seit den 1950er Jahren; in den 1970er Jahren begann auch die Rock- und Popmusik Eingang in den musikwissenschaftlichen Kanon zu finden. Das alles aber war eine langsame Entwicklung, und auch heute beschäftigt sich der “gemeine” Musikologe eher noch Bach, Brahms oder Schönberg als mit Ellington, Zappa oder Madonna. Dennoch: Die Zeiten haben sich geändert, und auch wenn eine Theorie der populären Musikwissenschaft (wenn man den Buchtitel “popular musicology” so übersetzen will) bislang nicht gibt, so gibt es doch genügend Beispiele, welche wissenschaftliche Ansätze unterschiedliche Musikgenres gerecht zu werden vermögen. Wer vom Ashgate Research Companion ein Musterbuch für die Herangehensweise an populäre Musik erwartet, wird allerdings enttäuscht werden. Das Buch ist weit weniger generell als der Titel es erwarten lässt. Es enthält in erster Linie Case Studies, Aufsätze, die populäre Musik von unterschiedlichen Seiten angehen, so aber genauso in einer der Fachzeitschriften zur populären Musikforschung stehen könnten (etwa im Popular Music Research). Vor allem zwei Forschungsbereiche seien im Feld der populären Musikwissenschaft besonders virulent, erklärt der Herausgeber Derek B. Scott in seinem Vorwort: zum einen die Frage nach Identität, Ethnizität, Raum und Ort, zum anderen der Bereich Alben, Künstler, spezifische musikalische Genres. Als nächstes werde gern und oft nach Gender und Sexualität gefragt, aber auch nach Filmmusik, technologischen Entwicklungen, dem Thema Performance und dem Musikgeschäft. Schließlich gäbe es auch noch den Bereich der Popmusikpädagogik. Entsprechend gliedert Scott das Buch nach Überthemen: “Film, Video and Multimedia”, “Technology and Studio Production”, “Gender and Sexuality”, “Identity and Ethnicity”, “Performance and Gesture”, “Reception and Scenes” sowie “The Music Industry and Globalization”. Der Jazz spielt übrigens wahrscheinlich ganz zu Recht kaum eine Rolle in den Beiträgen des Buchs. Seine analytischen Modelle sind denn doch andere als die der Popmusik; seine Theorie wäre immer noch ein eigenes Buch wert. Was Scott dabei allerdings gelingt in diesem schwergewichtigen Opus, ist sehr unterschiedliche Approaches zu versammeln und so Studenten wie Forscher mit der Diversität nicht nur der populären Musik, sondern auch ihrer fachlichen Erforschung zu konfrontieren.
Eine ernsthafte Jazzforschung gibt es bereits seit den 1950er Jahren; in den 1970er Jahren begann auch die Rock- und Popmusik Eingang in den musikwissenschaftlichen Kanon zu finden. Das alles aber war eine langsame Entwicklung, und auch heute beschäftigt sich der “gemeine” Musikologe eher noch Bach, Brahms oder Schönberg als mit Ellington, Zappa oder Madonna. Dennoch: Die Zeiten haben sich geändert, und auch wenn eine Theorie der populären Musikwissenschaft (wenn man den Buchtitel “popular musicology” so übersetzen will) bislang nicht gibt, so gibt es doch genügend Beispiele, welche wissenschaftliche Ansätze unterschiedliche Musikgenres gerecht zu werden vermögen. Wer vom Ashgate Research Companion ein Musterbuch für die Herangehensweise an populäre Musik erwartet, wird allerdings enttäuscht werden. Das Buch ist weit weniger generell als der Titel es erwarten lässt. Es enthält in erster Linie Case Studies, Aufsätze, die populäre Musik von unterschiedlichen Seiten angehen, so aber genauso in einer der Fachzeitschriften zur populären Musikforschung stehen könnten (etwa im Popular Music Research). Vor allem zwei Forschungsbereiche seien im Feld der populären Musikwissenschaft besonders virulent, erklärt der Herausgeber Derek B. Scott in seinem Vorwort: zum einen die Frage nach Identität, Ethnizität, Raum und Ort, zum anderen der Bereich Alben, Künstler, spezifische musikalische Genres. Als nächstes werde gern und oft nach Gender und Sexualität gefragt, aber auch nach Filmmusik, technologischen Entwicklungen, dem Thema Performance und dem Musikgeschäft. Schließlich gäbe es auch noch den Bereich der Popmusikpädagogik. Entsprechend gliedert Scott das Buch nach Überthemen: “Film, Video and Multimedia”, “Technology and Studio Production”, “Gender and Sexuality”, “Identity and Ethnicity”, “Performance and Gesture”, “Reception and Scenes” sowie “The Music Industry and Globalization”. Der Jazz spielt übrigens wahrscheinlich ganz zu Recht kaum eine Rolle in den Beiträgen des Buchs. Seine analytischen Modelle sind denn doch andere als die der Popmusik; seine Theorie wäre immer noch ein eigenes Buch wert. Was Scott dabei allerdings gelingt in diesem schwergewichtigen Opus, ist sehr unterschiedliche Approaches zu versammeln und so Studenten wie Forscher mit der Diversität nicht nur der populären Musik, sondern auch ihrer fachlichen Erforschung zu konfrontieren.
Wolfram Knauer (Dezember 2011)
Jazzkritik in Österreich. Chronik / Dokumentationen / Stellungnahmen
von Wolfgang Lamprecht
Wien 2009 (Löcker)
253 Seiten, 22 Euro
ISBN: 978-3-85409-528-6
 Es gehört quasi zum guten Ton (den wir durchaus auch im Jazzinstitut pflegen), gleichzeitig die Qualität der aktuellen Entwicklungen im Jazz hoch zu loben und über den Zustand der Jazzkritik zu klagen. Sowohl in Fachzeitschriften wie in Tageszeitungen sei die Jazzkritik immer mehr zu “Fanprosa” verkommen, zitiert Wolfgang Lamprecht in seiner Studie Peter Niklas Wilson und zeichnet daraufhin in seinem Buch in einem überschaubaren geographischen Bereich, nämlich Österreich, die Entwicklung ebendieser Jazzkritik nach.
Es gehört quasi zum guten Ton (den wir durchaus auch im Jazzinstitut pflegen), gleichzeitig die Qualität der aktuellen Entwicklungen im Jazz hoch zu loben und über den Zustand der Jazzkritik zu klagen. Sowohl in Fachzeitschriften wie in Tageszeitungen sei die Jazzkritik immer mehr zu “Fanprosa” verkommen, zitiert Wolfgang Lamprecht in seiner Studie Peter Niklas Wilson und zeichnet daraufhin in seinem Buch in einem überschaubaren geographischen Bereich, nämlich Österreich, die Entwicklung ebendieser Jazzkritik nach.
Er beginnt mit der Frage danach, welche Beweggründe Kritiker eigentlich für ihren Beruf haben und welches Bewusstsein sie für ihr Publikum, also ihre Leser besitzen. Er benennt (und zwar tatsächlich mit Namen) die Verfilzung, die es auch im Jazzbereich zwischen Kritikern und Produzenten von Musik gibt, und gelangt dabei zu zehn Regeln, die einer jeden ernsthaften Jazzkritik zugrunde liegen sollten.
Im weit umfangreicheren historischen Teil des Buchs betrachtet Lamprecht dann, wie der Jazz seit der Zeit des Ragtime in der österreichischen Presse betrachtet, verstanden oder missverstanden wurde. Er unterhält sich ausführlich mit Günther Schifter, dem vor drei Jahren verstorbenen Schellacksammler und Zeitzeugen österreichischer Jazzgeschichte, sowie mit dem Musiker Ludwig Babinsky und belegt mit beiden Interviews eine seltsam unpolitische Haltung des Jazz vor dem Krieg. Dann geht er im Gallopp durch die Nachkriegszeit, beschreibt die Reibungen zwischen Traditionalisten, Modernisten und einer jungen Szene, die durchaus eine neue Art der künstlerischen Professionalität mit sich brachte. Ein schneller Überblick über die Entwicklung der Jazzkritik im 20sten Jahrhundert mündet in Fallbeispielen: Josephine Baker in den 1920er Jahren, die Verdammung des Jazz bereits Anfang der 30er, die Haltung des österreichischen Rundfunks zum Jazz in den 1930er Jahren. Lamprecht schaut dabei oft auf Vorurteile mehr als auf kritische Reflexionen in der Nachkriegszeit und macht es sich dabei doch etwas leicht: Über lange Strecken ließt sich sein Buch jetzt wie eine amüsante Sammlung von Stilblüten, über die man, aufgeklärter Bürger des 21sten Jahrhunderts, nur milde schmunzelnd den Kopf schütteln kann.
Man lernt über die Ursprünge des ersten österreichischen Jazzmagazines “Jazzlive”, weiß die Verdienste der jazzhistorischen Publikationen von Klaus Schulz gewürdigt und ist etwas abrupt im Jahr 2009, als das letzte voll und ganz dem Jazz gewidmete Magazin Jazzzeit als Folge der Wirtschaftskrise und zurückgehender Anzeigenkunden eingestellt werden musste.
Gerade zum Schluss scheint bei Lamprecht die Frustration durch, die sich bei ihm in seiner Betrachtung einer halt doch reichlich unprofessionellen Jazzpresselandschaft in Österreich offenbar einstellte. Dieser Frust macht Teile des Buchs durchaus zu einer amüsanten Lektüre, gerade dort, wo de Autor mit seiner eigenen Meinung nicht hinterm Berg hält. Er polemisiert gern und hat keine Probleme damit, inner-österreichische Streits zu benennen. Leider bleiben diese für den uneingeweihten Leser allerdings ein wenig undurchschaubar, auch deshalb, weil Lamprecht gern Position bezieht und damit keineswegs der objektive Beobachter ist, den man anhand des Titels und des großen Fußnotenapparats vielleicht erwartet.
Was am Ende fehlt ist ein Ausblick, sind die Lehren, die Lamprecht selbst gezogen hat aus dem sehr differenzierten Blick auf fast 100 Jahre Jazzkritik. Im Buchrückentext heißt es: “Die eigentliche Aufgabe von Kritik, eine nachvollziehbare Lesart des Hörens, eine Brücke zum Verständnis zu schaffen, ist damit nie wirklich erfüllt worden.” Die Definition allerdings, was Jazzkritik im 21sten Jahrhundert wirklich leisten kann, was sie leisten sollte, muss sich der Leser dann aber letztlich selber zurechtschneidern aus den vielfachen Anregungen, die Lamprecht gerade mit seinen Negativbeispielen zuhauf gibt.
Eine durchaus gemischt Lektüre also: Ungemein viel Anregendes, eine gehörige Prise Streitlust und doch am Ende ein wenig zu unstrukturiert. Aber vielleicht kann ein Buch über Jazzkritik nur genau das sein: eine Einladung zum Diskurs, nicht aber der Diskurs selbst.
Wolfram Knauer (August 2011)
Analyzing Jazz. A Schenkerian Approach
von Steve Larson
Harmonologia. Studies in Music Theory, No. 15
Hillsdale/NY 2009 (Pendragon Press)
204 Seiten, 99 US-Dollar
ISBN: 978-1-576471-86-9
 Das vorliegende Buch setzt sich mit der Jazzanalyse auseinander, also damit, wie man sich der auf Schallplatte festgehaltenen Aufnahme einer Jazzimprovisation mit dem traditionellen musikwissenschaftlichen Handwerkszeug nähern kann. Steve Larson will dabei zeigen, wie sich das System der Schenkerschen Analyse auf den Jazz anwenden lässt. Heinrich Schenker entwickelte seine Reduktionsanalyse, die vor allem tonale Musik auf die Hierarchie ihrer harmonischen und motivischen Entwicklung reduziert. Die Schenkersche Analyse hat vor allem in der US-amerikanischen Musikwissenschaft viele Anhänger gefunden, während sie in Deutschland selten und für den Jazz hierzulande meines Wissens bislang noch gar nicht verwendet wurde.
Das vorliegende Buch setzt sich mit der Jazzanalyse auseinander, also damit, wie man sich der auf Schallplatte festgehaltenen Aufnahme einer Jazzimprovisation mit dem traditionellen musikwissenschaftlichen Handwerkszeug nähern kann. Steve Larson will dabei zeigen, wie sich das System der Schenkerschen Analyse auf den Jazz anwenden lässt. Heinrich Schenker entwickelte seine Reduktionsanalyse, die vor allem tonale Musik auf die Hierarchie ihrer harmonischen und motivischen Entwicklung reduziert. Die Schenkersche Analyse hat vor allem in der US-amerikanischen Musikwissenschaft viele Anhänger gefunden, während sie in Deutschland selten und für den Jazz hierzulande meines Wissens bislang noch gar nicht verwendet wurde.
Eines der größten Probleme der Anwendung von Schenkers Methodik auf den Jazz ist die Tatsache, dass seine Methode einen Notentext zugrunde legt. Man brauche also, erläutert Larson in seiner Einleitung, möglichst genaue Transkriptionen der besten aufgenommenen Interpretationen. Lead-Sheets oder selbst die meisten der kommerziell veröffentlichten Transkriptionen reichten da nicht aus. Entsprechend macht sich der Autor selbst ans Werk, transkribiert verschiedene Interpretationen des Klassikers “Round Midnight” in der Interpretation von Thelonious Monk, Oscar Peterson und Bill Evans. Ihm ist dabei bewusst, dass jede Transkription in sich bereits eine Art der Analyse ist.
In Kapitel 2 seiner Arbeit hinterfragt er die Anwendbarkeit der Schenkerschen Analyse auf eine improvisierte Musik wie den Jazz und kommt für sich zum Schluss: (1.) dass diese durchaus nützlich sei, obwohl sie ursprünglich im Hinblick auf komponierte Musik entworfen wurde; (2.) dass sich auch von Schenker nicht vorgesehene komplexe Eigenheiten des Jazz in seine Methodik einpassen ließen; und (3.) dass die Ergebnisse komplexer Strukturen, die durch die Schenkersche Analyse darstellbar werden, von den Musikern durchaus intendiert seien. Hier liefert er sich ein paar Schattengefechte, etwa mit Wilhelm Furtwängler, der 1947 über den Jazz urteilte, ihm fehle der Sinn fürs Große, der Zusammenhalt über lange Strecken, im Jazz denke man nur von Moment zu Moment. Larson stellt dem die im Jazz übliche Metapher des “story telling” gegenüber, des Geschichtenerzählens, das von jedem Musiker gefordert werde.
Dann folgen die Hauptkapitel: Formale Analysen, Stimmführungsanalysen, Analysen des motivischen und des harmonischen Rhythmus und mehr in den Interpretationen von Monk, Peterson und Evans. Hardcore-Analysen, deren Resultat vor allem den großen Bogen der Aufnahmen herausarbeiten sollen, die Geschlossenheit von kreativem Einfall und formaler Gestaltung. Mit Bezug auf Evans vergleicht Larson darüber hinaus zwei Aufnahmen von “Round Midnight”, die zum einen im Studio, zum anderem bei einem Livekonzert entstanden sind. Immerhin fast die Hälfte des Buchs nehmen schließlich die Transkriptionen ein, keine Schenkersch-analytischen Zusammenfassungen, sondern ausgeschriebene Notentexte der Aufnahmen
Steve Larson will mit seinem Buch ein Argument für die Anwendbarkeit des Schenkerschen Analyseverfahrens auf den Jazz vorlegen. Bei anderen als den von ihm ausgewählten Titeln, insbesondere bei anderen Besetzungen, wäre die Analyse wahrscheinlich weit schwerer zu bewerkstelligen, so dass seine Quintessenz: Ja, die Schenkersche Analyse eignet sich auch für den Jazz, ein wenig schwach wirkt. Das überzeugendste Argument schließlich liefert er nicht: Zu erklären, warum er ausgerechnet für die von ihm ausgesuchten Stücke die Schenkersche Methode wählte und zugleich zu erklären, dass Analyse immer im Dienste der Erkenntnis stehen sollte, man also zuerst die Frage benötigt, um dann die Methode zu wählen, die zu einer sinnfälligen Antwort führt. Dementsprechend braucht es gewiss keiner allumfassenden Analysemethode für den Jazz – an Soloaufnahmen von Peterson, Monk und Evans kann man völlig anders herangehen als etwa an Ellingtons Orchestereinspielungen, an Soli von Charlie Parker oder die Unit Structures von Cecil Taylor. Es ist letzten Endes die Aufgabe des Analysierenden, dasjenige analytische Handwerkszeug zu wählen, das am ehesten geeignet ist, eine sinnvolle Aussage zu machen.
Wolfram Knauer (April 2011)
The Birth of Cool of Miles Davis and His Associates
von Frank Tirro
CMS Sourcebooks in American Music, No. 5
Hillsdale/NY 2009 (Pendragon Press)
196 Seiten, 1 Beilage-CD, 45 US-Dollar
ISBN: 978-1-57647-128-9
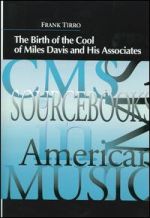 In der “Sourcebook in American Music”-Reihe des Pendragon-Verlags erscheint mit einer Monographie über die legendären Capitol-Nonet-Aufnahmen von Miles Davis der zweite Band, der sich mit einer klar umrissenen Besetzung auseinandersetzt und damit quasi ein abgeschlossenes Werk untersucht (der erste solche Band widmete sich den Hot-Five-Aufnahmen Louis Armstrongs.
In der “Sourcebook in American Music”-Reihe des Pendragon-Verlags erscheint mit einer Monographie über die legendären Capitol-Nonet-Aufnahmen von Miles Davis der zweite Band, der sich mit einer klar umrissenen Besetzung auseinandersetzt und damit quasi ein abgeschlossenes Werk untersucht (der erste solche Band widmete sich den Hot-Five-Aufnahmen Louis Armstrongs.
Jazz-Spezialist Frank Tirro beginnt mit einer generellen Einführung in die Bedeutung der Capitol-Aufnahmen des Trompeters. Im zweiten Kapitel beleuchtet er die grundsätzliche Idee des “Cool” – sowohl als Begriff und Lebenshaltung wie auch als Jazzstil. In Kapitel 3 geht er den Vorläufern dieses Stils auf den Grund, benennt die Spielhaltung etwa im Spiel und in den Kompositionen von Bix Beiderbecke, im Sound von Stan Getz und den Arrangements von Ralph Burns, aber auch in den Kompositionen und Interpretationen Dave Brubecks und insbesondere seines Octets (also einer dem Nonet vergleichbaren Besetzung). Nur kurz erwähnt Tirro die Bedeutung Duke Ellingtons (und Billy Strayhorns) sowie Lennie Tristanos als weitere Ausprägungen (a) kompositorischer Durchformung und (b) eines anderen Ansatzes von Cool Jazz.
Vor allem aber widmet der Autor sich im ersten Teil seines Buchs den Aufnahmen von Claude Thornhill, dessen Orchesterklang Miles angeblich zum Vorbild seines Nonet genommen habe. Er untersucht drei Aufnahmen Thornhills, Bill Bordens Arrangement über “Ev’rything I Love” sowie die beiden Gil-Evans-Arrangements über Charlie Parkers “Thriving On a Riff” und Miles Davis’ “Donna Lee”.
Der Hauptteil des Buchs dann widmet sich den Aufnahmen des Capitol Nonet, die Tirro den Arrangeuren gemäß ordnet. Er beschreibt die Aufnahmesituation (also Rundfunksendungen und Studiosessions) und analysiert dann nacheinander die Arrangements von Gil Evans (“Moon Dreams”; “Boplicity”), Gerry Mulligan (“Jeru”, “Godchild”, Venus de Milo”, “Rocker”), John Lewis (“Move”, “Budo”, “Rouge”), Johnny Carisi (“Israel”) sowie Davis selbst (“Deception”). Seine Analysen erklären den formalen Ablauf, stellen teilweise Seiten der Originalpartituren neben Transkriptionen, beleuchten, wie die Arrangeure zu bestimmten Klangfiguren gelangten und lenken den Leser auch immer wieder auf das “Außergewöhnliche”, das diese Klänge in der Zeit des Bebop ausmachten. So vergleicht er die Arrangement, die Mulligan über “Jeru” sowohl für Thornhill als auch für Davis schrieb, oder verweist er für den Beginn von “Godchild” auf die ungewöhnlichen Klangfiguren im Zusammengehen von Baritonsaxophon und Tuba.
Im Schlusskapitel beleuchtet Tirro den Nachhall der kurzlebigen Studioband, etwa in der Musik von J.J. Johnson und Kai Winding, in diversen Bands von Gerry Mulligan oder in der Musik von Shorty Rogers und anderen West-Coast-Musikern.
Frank Tirros Buch richtet sich vor allem an Studenten, ist aber auch für jeden Davis-Fan, der sich von Transkriptionen und musikalischen Fachbegriffen nicht verschrecken lässt, ein guter “Wieder”-Einstieg in die legendären Aufnahmen des “Birth of the Cool”.
Wolfram Knauer (April 2011)
Time and Anthony Braxton
Von Stuart Broomer
Toronto 2009 (The Mercury Press)
176 Seiten, 19,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-55128-144-5
 Anthony Braxtons Musik mag, scheint es, die erklärungsbedürftigste Variante des Jazz zu sein, was sich allein darin zeigt, dass Braxton selbst in seinen umfangreichen “Tri-Axium Writings” ausführliche Erläuterungen dazu verfasste, die seine Musik in Zusammenhang stellen mit philosophischen, musikästhetischen und ethischen Gedanken.
Anthony Braxtons Musik mag, scheint es, die erklärungsbedürftigste Variante des Jazz zu sein, was sich allein darin zeigt, dass Braxton selbst in seinen umfangreichen “Tri-Axium Writings” ausführliche Erläuterungen dazu verfasste, die seine Musik in Zusammenhang stellen mit philosophischen, musikästhetischen und ethischen Gedanken.
Der kanadische Journalist und Musikschriftsteller Stuart Broomer hat sich für sein Buch ein spezifisches Moment in Braxtons Musik herausgegriffen, das er von allen Seiten abklopft, um so der Philosophie und der Musik des Saxophonisten und Komponisten ein Stück näher zu kommen. “Time”, was im Englischen genauso für Zeit wie für Metrik und Rhythmus steht, und in jeder dieser unterschiedlichen Lesarten wiederum ganz verschiedene Bedeutungen besitzt, spiele im Verständnis von Braxtons Musik eine große Rolle (was jedem, der die große Sanduhr kennt, die den Ablauf seiner Sets in Konzerten markiert kennt, wohl bewusst ist). Zwischen diesen unterschiedlichen Lesarten von “Time” schwenkt sich Broomer hin und her. In Bezug auf die Musik sei Zeit, schreibt er etwa im Vorwort, nicht nur die Substanz, aus der diese bestehe, sondern zugleich Teil unserer eigenen Erfahrung, sei Musik damit wichtig für unsere eigene Art, Zeit zu konzeptualisieren. In Bezug auf Braxtons Karriere andererseits verweist er darauf, wie dieser in den 1970er Jahren als die “Zukunft” des Jazz begriffen wurde, wie er dagegen in seiner Arbeit immer wieder auf die Traditionen hingewiesen habe, von Jelly Roll Morton über Lennie Tristano und Charlie Parker bis zu John Coltrane and beyond.
Broomers erstes Kapitel, überschrieben “Groundings and Airings” beginnt in Chicago, der Stadt, in die, wie Braxton es formuliert, sogar Louis Armstrong gehen musste, um dort das Solo zu erfinden. In diesem Kapitel befasst sich Broomer vor allem mit den Jazztraditionen, mit denen sich – bewusst oder unbewusst – jeder Jazzmusiker auseinanderzusetzen hat, der in Chicago und mit dessen Musiktradition groß wird.
Das zweite Kapitel setzt sich mit Braxtons Solo-Performances auseinander, angefangen mit “For Alto”, das er 1970 für Delmark Records aufnahm. Als Braxton sich erstmals auf ein Solokonzert vorbereitet habe, habe er schnell gelernt, dass er die Beherrschung seiner eigenen “Sprache” verbessern müsse, da er sonst Gefahr liefe, dass ihm die Ideen ausgingen. Die Solostücke seien also eine Beweggrung für seine Auseinandersetzung mit komplexen Kompositionsmethoden gewesen. Und die “Sprache”, die er da ausarbeitete, umfasste Verweise auf Tradition genauso wie rein instrumentalspezifische und klangtechnische Details, unterschiedliche Timbres etwa oder die Varianten des lauten Ins-Instrument-Atmens.
Das dritte Kapitel befasst sich mit formbildenden Aspekten in Braxtons Werk, der Verwendung von Marschanklängen in seiner Musik etwa, seiner schon als Kind ausgeprägten Faszination von Paraden und Paradebands. Je mehr Broomer in die Musik eindringt, umso mehr enthüllt er aber auch seine eigene Erklärung als reine Annäherungen an seine Interpretationen komplexer Verstrickungen unterschiedlichster Einflüsse, Erinnerungen und Zeichen.
Kapitel vier ist überschrieben mit “The Quartet and Composition as Autobiography”. Er beschreibt das kompositorische Dilemma Braxtons: “Wie kann man in Klängen die komplexe Erfahrung von Bewusstsein und dem dauernd sich wandelnden Fokus des Bewusstseins, von der Kombination von Subjekten und Bedeutungen und Prozessen ausdrücken?” Zugleich stellt sich hier die Frage nach Komposition und Ausführung: Gerade im Quartett ging Braxton ja mit Kollegen an seine kompositorische Ausführung heran, denen er das, was er meinte, vermitteln wollte. Broomer beschreibt, wie die Titel immer kryptischer wurden, Ziffernfolgen nur noch oder Diagramme, und wie lange Interpretationen oft aus der Zusammenstellung verschiedener “Stücke” bestanden, so dass sich ihre Überschriften oft wie eine mathematische Gleichung lasen.
Kapitel fünf beschäftigt sich mit den Traditionsreminiszenzen in Braxtons Arbeit, den Verweisen auf Jazztradition, die schon in der Repertoireauswahl immer wieder auftauchen. Gershwin, Morton, Parker, Mingus, Joplin, Brubeck – Braxton stellt sich mit diesen Interpretationen immer wieder in die Reihe des Kontinuums, dessen Teil er selber ist, vielleicht auch (aber das ist nur unsere Interpretation), um hier die Kraft der Herkunft tanken zu können, mit der er seinen eigenen Weg weiterzugehen vermag, auch wenn viele Jazzfreunde außer der Improvisation in seinem Weg oft kaum Verweise an die Tradition mehr zu erkennen meinen.
Das sechste Kapitel widmet sich den kombinatorischen Kompositionen und Braxtons Conduction-Versuchen; Kapitel sieben dann den “Ghost Trance Musics”, jenen Stücken, die er nach 1995 für unterschiedliche Ensembles und Instrumentationen schrieb und die jeweils eine kontinuierliche, rhythmisch gleichmäßige, sich nicht wiederholende Melodie besaßen. Dieses Kapitel beinhaltet außerdem ein Interview, das Broomer 2007 mit Braxton führte und in dem er erklärt, wie er auf die Idee der Ghost Trance Musics kam und in welchen Traditionen er sich dabei sieht, der indianischer Musik etwa, Wagners, Sun Ras…
Das letzte Kapitel schließlich beleuchtet die nächste Phase in Braxtons Arbeit, die sogenannte “Diamond Curtain Wall Music”, in der Braxton sich auch ins Feld elektronischer Komposition begibt. Broomer konzentriert sich dabei vor allem auf Braxtons “Sonic Genome”-Projekt, aufgeführt bei der Winterolympiade in Vancouver im Januar 2010. Eine Timeline des Lebens und Schaffens des Saxophonisten, eine Diskographie, Literaturliste und ein ausführliches Register beschließen das Buch.
Stuart Broomers “Time and Anthony Braxton” beleuchtet immer wieder biographische Einflüsse auf Braxtons Musik; trotzdem steht Biographisches hier aber eher im Hintergrund. Broomer will sich mit seiner Fokussierung auf “Time” in allen verschiedenen Verständnisformen der Philosophie und der Entwicklung des kompositorischen Denkens Braxtons nähern. Das ist zum Teil ausgesprochen erhellend, zumal Broomer immer wieder von den doch recht abstrakten philosophischen Erklärungen zurück in die Realität des Musikdenkens und -machens blendet. Nicht nur für Braxton-Fans ist dieses Buch also lesenswert, sondern darüber hinaus für jeden, der sich mit aktuellen Diskursen im Feld zwischen Improvisation und Komposition befasst.
Wolfram Knauer (Februar 2011)
The Hearing Eye. Jazz & Blues Influences in African American Visual Art
Herausgegeben von Graham Lock & David Murray
New York 2009 (Oxford University Press)
366 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-534051-8
 Musik und Kunst, die abstrakteste und die zugänglichste aller Künste, haben sich immer wieder gegenseitig beeinflusst. Beispiele aus der europäischen Musik- und Kunstgeschichte gibt es zuhauf. Die Interdependenzen zwischen Jazz/Blues und afro-amerikanischer Kunst aber wurden nur selten untersucht. Alfred Appel wagte in seinem Buch “Jazz Modernism. From Ellington and Armstrong to Matisse and Joyce” eher einen großen Rundumschlag über die Verbindungen von Jazz und die Kunst der westlichen Welt, und auch das von Howard Becker, Robert R. Faulkner und Barbara Kirshenblatt-Gimblett herausgegebene Buch “Art from Start to Finish. Jazz, Painting, and other Improvisations” oder der von Daniel Soutif kuratierte Ausstellungskatalog “Le Siècle du Jazz. Art, cinema, musique et photographie de Picasso à Basquiat” zeigen die Verbindung zwischen Musik- und Kunstgeschichte eher allgemein und ohne einen konkreten Fokus auf Afro-Amerika.
Musik und Kunst, die abstrakteste und die zugänglichste aller Künste, haben sich immer wieder gegenseitig beeinflusst. Beispiele aus der europäischen Musik- und Kunstgeschichte gibt es zuhauf. Die Interdependenzen zwischen Jazz/Blues und afro-amerikanischer Kunst aber wurden nur selten untersucht. Alfred Appel wagte in seinem Buch “Jazz Modernism. From Ellington and Armstrong to Matisse and Joyce” eher einen großen Rundumschlag über die Verbindungen von Jazz und die Kunst der westlichen Welt, und auch das von Howard Becker, Robert R. Faulkner und Barbara Kirshenblatt-Gimblett herausgegebene Buch “Art from Start to Finish. Jazz, Painting, and other Improvisations” oder der von Daniel Soutif kuratierte Ausstellungskatalog “Le Siècle du Jazz. Art, cinema, musique et photographie de Picasso à Basquiat” zeigen die Verbindung zwischen Musik- und Kunstgeschichte eher allgemein und ohne einen konkreten Fokus auf Afro-Amerika.
Die beiden britischen Autoren Graham Lock und David Murray haben sich nun auf die Suche zwischen Jazz, Blues und afro-amerikanischen Künstlern und Kunstgattungen gemacht, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Das Buch ist quasi der zweite Teil eines größeren Forschungsprojektes, dessen erster Teil unter dem Titel “Thriving on a Riff” veröffentlicht wurde und das, wie die Herausgeber im Vorwort erinnern, den etwas grandiosen Projekttitel trug: “Criss Cross. Confluence and Influence in Twentieth-Century African-American Music, Visual Art, and Literature”.
Dieser Band also ist den bildenden Künsten gewidmet. Er beginnt mit einem Beitrag Paul Olivers zur Visualisierung von Anzeigen für Bluesplatten in den 1920er Jahren. Oliver untersucht die Texte der Anzeigen genauso wie die bildnerische Umsetzung, die Verwendung von Fotos, speziellen Reizworten (“race records” beispielsweise), aber auch die Ikonographie, mit der Zeichnungen den Inhalt der beworbenen Stücke wiedergeben, etwa in der Anzeige für den “First Degree Murder Blues” von Lil Johnson oder für Peetie Wheatstraws “Kidnappers Blues”.
Graham Lock beschreibt die Blues- und Negro-Folk-Songs-Gemälde von Rose Piper, eine Reihe an Bildern, die im Herbst 1947 in der New Yorker RoKo Galery ausgestellt wurden und von Aufnahmen etwa von Bessie Smith, Trixie Smith, Ma Rainey und anderen beeinflusst waren.
Lock interviewt außerdem den Quiltmacher Michael Cummings, dessen Quilts meist afro-amerikanische Themen haben und oft genug auf Jazz und Blues rekurrieren. Sie unterhalten sich vor allem über Cummings’ “African Jazz”-Reihe von zwölf Quilts, die von einem Poster inspiriert waren, das er in New Yorks Greenwich Village fand und das überschrieben war “Africans Playing Jazz, 1954”. Jeder der Quilts sei eine Art Variation des Grundmotivs von drei Musikern, und jeder Quilt erzähle dennoch eine andere Geschichte, ein wenig wie jeder Chorus einer Improvisation eine andere Geschichte erzählt. Einige der Quilts sind abgebildet, das inspirierende Poster aber leider nicht (auch nicht auf Michael Cummings’ Website, auf die im Artikel für den Fall verwiesen wird, dass man die komplette Quiltserie sehen will).
Sara Wood betrachtet die Malerei Norman Lewis’, der etliche Bilder mit konkretem Titelverweis auf den Jazz malte, in Hinblick auf den Einfluss des Bebop. Lock unterhält sich mit dem Collage-Künstler Sam Middleton über den “Maler als improvisierenden Solisten” und über Parallelen zwischen den Künsten. Richard H. King schreibt über Bob Thompson, dessen Bilder immer wieder konkrete musikalische Eindrücke wiederzugeben versuchten. Lock spricht außerdem mit Wadsworth Jarrell über die Künstlergruppe AFRICOBRA (African Commune of Bad Relevant Artists), eine AACM der Bildenden Kunst.
Zu den herausragenden afro-amerikanischen Künstlern, die sich immer wieder mit dem Jazz befassten, zählt Romare Bearden, dem Robert G. O’Meally einen Aufsatz widmet, in dem er Beardens Werk mit den Interpretationen seiner Kunst durch Albert Murray und Ralph Ellison vergleicht und im Diskurs der drei eine Art call-and-response quer durch die Kunstsparten feststellt. Auch Johannes Völz nimmt sich Bearden zum Thema und fragt, ob denn Bearden wirklich den Jazz gemalt habe bzw. wo genau in Beardens Gemälden wohl dieser Jazz zu finden sei. Natürlich sind da die Titel der Bilder, und sie sowie weitere Analogien, die gern in Bezug auf Beardens Werk mit dem Jazz gezogen werden, unterzieht Völz einer kritischen Betrachtung. Er warnt dabei vor der Interpretation wörtlicher Übersetzungen von einem künstlerischen Medium ins andere, weil sie meist zu oberflächlich blieben und die tatsächlich darunter liegenden kulturellen Diskurse über Blackness verschleierten.
Lock spricht mit Joe Overstreet, dessen Arbeit in den letzten Jahren immer stärker mit Licht und Schatten experimentiert, über seine abstrakte Phase und die Gründe der Rückkehr zur Gegenständlichkeit, über kubistische und andere Einflüsse und die Jazztitel und -themen einiger seiner Gemälde. Robert Farris Thompson liest die Kunst von Jean-Michel Basquiat als biographische Annäherung an Jazzgeschichte und die soziale Gegenwart New Yorks. Lock unterhält sich mit Ellen Banks, die postuliert, Musik sei ihr Stillleben, ihre Landschaft, ihr Akt. Banks ist das einzige Beispiel des Buchs eines Künstlers, der (also: die) Musik als einziges Thema ihrer Kunst sieht. Meist zeigen ihre Arbeiten abstrakte Formen, manchmal mit Worten durchsetzt, und ihr Einflüsse ist nicht nur der Jazz, sondern auch die europäische Barock- und klassische Musik.
Der letzte der gewürdigten Künstler ist der Fotograf Roy DeCarava, dessen “the sound i saw. improvisation on a jazz scene” Richard Inks näher begutachtet. Das Spiel mit Licht und Schatten lässt auch DeCaravas Bildern teilweise die Figuren wie Scherenschnitte oder Ikonen einer schwarzen Bildgeschichte erscheinen, etwa im Foto “Dancers” von 1956, das im Buch abgebildet ist. Zugleich versucht Inks, die Bilder aus “the sound i saw” als Narrativ zu lesen und die Geschichte(n) zu enträtseln, die dahinter steckt/en. Im letzten Kapitel schließlich spricht Graham Lock mit dem Saxophonisten Marty Ehrlich über den Maler Oliver Jackson und mit der Saxophonistin Jane Ira Bloom über Jackson Pollock, letzteres damit der einzige Nicht-Afro-Amerikaner der im Buch diskutierten Künstler.
In der Fokussierung auf schwarze amerikanische Künstler erlaubt “The Hearing Eye” einen Blick auf genreüberschreitende Einflüsse afro-amerikanischer Kultur. Dass Lock und Murray bestimmte Aspekte dabei völlig außer Acht lassen – sowohl Bildhauer als auch Installationskünstler, die sich von Blues und Jazz beeinflussen ließen, aber auch das ganze Genre der Graffiti- und HipHop-Szene – schränkt den Blick auf ein … sagen wir … “galerie-kompatibles” Themensegment ein. Die Ansätze der portraitierten Künstler sind dennoch so unterschiedlich wie die Ansätze der Autoren, sich ihrer Kunst und den Einflüssen durch die Musik zu nähern. Das ganze ist reich bebildert und wird ergänzt durch eine eigens eingerichtete Website, auf der noch einige weitere Bilder zu sehen sowie einige Hörbeispiele zu hören sind. Das klingt modern und up-to-date, ergänzt das Buch aber nur marginal – immerhin ist schon hier zu ahnen, wie ein eventueller dritter Band zum Thema des kulturellen Criss Cross aussehen könnte, in dem auf der dazugehörigen Website Videos und sonstige buch-unkompatible Medien geschaltet würden.
Wolfram Knauer (Februar 2011)
Digging. The Afro-American Soul of American Classical Music
Von Amiri Baraka
Berkeley 2009 (University of California Press)
411 Seiten, 18,95 US-$
ISBN: 978-0-520-25715-3
 Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich mit diesem Buch anfreunden konnte. Ich war höllisch neugierig auf das neueste Werk von Amiri Baraka, einst LeRoi Jones, dem großen afro-amerikanischen Poeten und Denker, einem Sprecher des New Thing in allen Künsten, damals in den 1960er Jahren, einem wortgewaltigen und zugleich ungemein streitbaren Fürsprecher schwarzer Kultur und nebenbei einem wirklich netten und humorvollen Menschen, wenn man ihn nicht in Bühnenpose oder Kampfesrhetorik vor sich hat.
Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich mit diesem Buch anfreunden konnte. Ich war höllisch neugierig auf das neueste Werk von Amiri Baraka, einst LeRoi Jones, dem großen afro-amerikanischen Poeten und Denker, einem Sprecher des New Thing in allen Künsten, damals in den 1960er Jahren, einem wortgewaltigen und zugleich ungemein streitbaren Fürsprecher schwarzer Kultur und nebenbei einem wirklich netten und humorvollen Menschen, wenn man ihn nicht in Bühnenpose oder Kampfesrhetorik vor sich hat.
Ich blätterte also und blieb bei der Plattenbesprechung eines Albums von Peter Brötzmann hängen, ziemlich am Schluss des Buches, dem Baraka unterstellt, sich nur auf marginale Seiten der Free-Jazz-Revolution zu konzentrieren, ihre Explosivität nämlich, ohne dabei ihre tieferen philosophischen und ästhetischen Einbindungen zu berücksichtigen, und so die Kraft und das raue Timbre des Originals zu benutzen, es aber seiner tieferen kompositorischen und improvisatorischen Aussage zu berauben. Was Baraka nicht begreift – obwohl ich annehme, dass er es durchaus begreift, er ist viel zu schlau, um es nicht zu wissen, aber er verfolgt nun mal in seinen Schriften durchaus auch eine politische Agenda – ist, dass Brötzmann und andere Künstler, die nicht der Great Black Music-Ästhetik mit all ihrer Geschichte und Tradition unterworfen sind, die Musik nun mal für sich umdeuten müssen, dass Aneignung zugleich auch Ver-Fremdung bedeutet und das das Maßanlegen der Ästhetik schwarzer Avantgarde an Brötzmann scheitert, wenn man die persönliche Betroffenheit, die individuelle Aneignung des Saxophonisten und seine Entwicklung aus dem Geiste der afro-amerikanischen Musik, aber eben in einer anderen Umgebung, außer acht lässt.
Aber da sind wir schon ganz beim Thema, warum es ein wenig dauerte, bis ich mich mit diesem Buch anfreunden konnte: Zu holzschnittartig und einseitig sind oft genug Barakas Thesen, seine vorausgesetzten ästhetischen Urteile, als dass ich sie auch nur als Diskussionsgrundlage unterschreiben möchte: Wenn wir über die Faktenbasis uneins sind, wie kann man dann diskutieren. Es dauerte also, bis ich seine Statements als solche durchaus auch polemische Aussagen akzeptieren konnte, mich von Kapitel zu Kapitel ein wenig aufregte, dabei dann aber jedes Mal selbst gefordert wurde Stellung zu beziehen – ganz so wie man zu Thilo Sarrazin Stellung beziehen muss, indem man die Fakten genauso wie die Thesen auf den eigenen, ganz persönlichen Prüfstand stellt.
Baraka fordert seine Leser also heraus; das hat er immer getan, in seinen Gedichten genauso wie in seinen Schriften, zu Musik, Theater oder zur Politik. Mit diesem Vorwissen muss man an das Buch herangehen: Es ist kein Schmöker für gemütliche Stunden; es ist keine Sammlung netter Anekdoten (obwohl es die auch gibt): Man begibt sich stattdessen in den Ring mit dem Autoren, in dem seine Linke und seine Rechte immer wieder dazu führen, dass man seine Deckung überprüft, dass man überlegt, ob die eigenen Einschätzungen richtig oder falsch sind, vor allem aber, wie diese eigenen Einschätzungen eigentlich sind und durch was sie beeinflusst wurden.
Persönlich sind etwa Kapitel über Miles Davis, Bill Cosby, besonders das über Nina Simone, David Murray, John Coltrane, Albert Ayler (als Coltrane ihn zum ersten Mal hörte, sei seine Respektbezeugung gewesen ihn zu fragen: “Mann, was für ein Blättchen benutzt du?”), Max Roach, Thelonious Monk, Abbey Lincoln (eines der wenigen Interviews im Buch).
Natürlich wettert Baraka gegen die weiße Besitznahme von Jazzstilen, gegen die mediale Hochstilisierung weißer Musiker zu Kings, Queens und sonstigen Hoheiten des Jazz. Die wenigen weißen Musiker, die bei ihm regelmäßig Erwähnung finden, ohne dass Baraka auch nur adjektivisch über sie herfällt sind etwa Stan Getz, Roswell Rudd oder Bruce Springsteen (letztere erhielten eigene kurze Kapitel im Buch). Bei Wynton Marsalis windet sich Baraka ein wenig. Eigentlich ist ihm dessen Ästhetik viel zu konservativ, aber dann hat Marsalis schließlich (wenn auch auf denkbar andere Art und Weise) Dinge erreicht, für die er, Baraka, in den 1960er Jahren gekämpft hatte. Also lautet sein Diktum: “Es gibt Hoffnung, denn Marsalis, ‘on fire’, kann wirklich sehr, sehr heiß sein.” On Fire!
Ein weiteres Thema, bei dem sich Baraka sichtlich windet, dem er dann aber auch nicht allzu viel Platz einräumt, ist das Thema Rap und aktuelle afro-amerikanische Popmusik: Wo sie politisch ist, schwarze Rots bewusst widerspiegelt, wunderbar; wo das fehlt oder ihm nicht glaubwürdig genug rüberkommt: Daumen runter.
Spannend sind auf jeden Fall seine Erinnerungen an Newark als einen wichtigen kulturellen Spielort knapp außerhalb New Yorks, Lebensmittelpunkt vieler Künstler mit einer eigener Szene, von der aber selten die Rede ist, weil nun mal Manhattan immer die Scheinwerfer auf sich zog. Lesens- und streitenswert auch sein Kapitel über “Jazz and the White Critic – thirty years later”, eine Fortsetzung eines Artikels, den er in den 1960er Jahren in der Zeitschrift Metronome veröffentlicht hatte. In zwei aufeinander folgenden Aufsätzen weist er darauf hin, welchen wichtigen Einfluss Jackie McLean auf die Auflösung formaler und harmonischer Strukturen vom Hardbop hin zum Free Jazz hatte – eine Rolle, die viel zu selten betont wird.
Und und und… immerhin 84 Kapitel umfasst das Buch, kurze Konzert- und Plattenrezensionen zum Teil, aber auch längere Features und Reflektionen. Wie gesagt: Man muss nicht (und wird kaum) mit allem seiner Meinung sein, um durch Baraka Anstöße zum Nachdenken und zum Die-eigene-Meinung-Überprüfen zu finden. Allein deshalb: Lesenswert”
Wolfram Knauer (Januar 2011)
Visiting Jazz. Quand les jazzmen américains ouvrent leur porte
von Thierry Pérémarti
Gémenos/France 2009 (Le Mot et le Reste)
376 Seiten, 23 Euro
ISBN 978-2-915378-96-2
 Thierri Pérémarti hat eine erfolgreiche Kolumne in der französischen Zeitschrift “Jazzman” (seit wenigen Jahren fusioniert mit “Jazz Magazine”), in der er Musiker besucht und ihr Zuhause beschreibt. Die kurzen Essays werfen ein etwas anderes, oft persönlicheres Licht auf die Musiker, auf ihre Hobbies, Autos und geben oft genug kurze Interviewausschnitte wider, die sich bei diesen Besuchen ergeben und die sich mal um Musik, mal aber auch um Alltägliches drehen. Die 78 Interviews reichen von Gato Barbiero bis Joe Zawinul, daneben finden sich Namen wie Ray Ellis, Chico Hamilton, Freddie Hubbard, Michel Petrucciani, Pharoah Sanders, Lalo Schifrin, Diane Schuur und viele andere. Ein kurzweiliges Buch mit jeweils einem persönlichen Foto im Umfeld des Musiker-Zuhauses, das hier leider nur schwarzweiß abgedruckt ist (im Original der Zeitschrift war es meist in Farbe).
Thierri Pérémarti hat eine erfolgreiche Kolumne in der französischen Zeitschrift “Jazzman” (seit wenigen Jahren fusioniert mit “Jazz Magazine”), in der er Musiker besucht und ihr Zuhause beschreibt. Die kurzen Essays werfen ein etwas anderes, oft persönlicheres Licht auf die Musiker, auf ihre Hobbies, Autos und geben oft genug kurze Interviewausschnitte wider, die sich bei diesen Besuchen ergeben und die sich mal um Musik, mal aber auch um Alltägliches drehen. Die 78 Interviews reichen von Gato Barbiero bis Joe Zawinul, daneben finden sich Namen wie Ray Ellis, Chico Hamilton, Freddie Hubbard, Michel Petrucciani, Pharoah Sanders, Lalo Schifrin, Diane Schuur und viele andere. Ein kurzweiliges Buch mit jeweils einem persönlichen Foto im Umfeld des Musiker-Zuhauses, das hier leider nur schwarzweiß abgedruckt ist (im Original der Zeitschrift war es meist in Farbe).
Wolfram Knauer (Dezember 2010)
Jazz in der Nachkriegszeit. Frankfurt am Main. Die Begegnungen zwischen Amerikanern und Deutschen
Von Anja Gallenkamp
München 2009 (AVM)
75 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-89975-832-0
 Die Rezeption des Jazz in Deutschland ist immer auch eine Rezeption der Amerikaner in Deutschland – so eng waren letzten Endes die amerikanischen Besatzungskräfte mit der Jazzentwicklung hierzulande verbunden. Es hat seinen Grund, warum Frankfurt am Main nach dem Krieg für lange Zeit als (moderne) Jazzhauptstadt der Republik galt: Hier saß das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte; hier gab es die meisten amerikanischen Soldaten und – eng damit verbunden – auch die meisten Soldatenclubs, in denen die US-amerikanischen Kunden nach der Musik verlangten, die sie von zuhause her gewohnt waren. Anfang der 1950er Jahre war das noch der Jazz, später ließ die Jazzliebe der Soldaten (wie auch ganz allgemein der amerikanischen Bevölkerung) nach; die Kapellen, die in den GI-Clubs aufspielten, mussten bald eine andere Musik spielen. Die Begegnungen zwischen Amerikanern und Deutschen jedenfalls waren ausschlaggebend für eine ganz spezifische Spielweise all jener Musiker, die das Glück hatten, in dieser Region zu arbeiten. Anja Gallenkamp hinterfragt in ihrer Studie die Kontakte zwischen Amerikanern und Deutschen, befragt Zeitzeugen und wertet Zeitschriften der Nachkriegszeit aus. Sie interessiert sich dafür, inwieweit das amerikanische Vorbild einen Dialog überhaupt noch ermöglichte bzw. inwieweit es über lange Jahre die Ausbildung eines eigenen Stils vielleicht eher verhinderte. Die Zeit, die sie dabei vor allem interessiert, sind die Jahre 1945 bis 1951/52, ihre Quellen etwa das von Horst Lippmann herausgegebene Hot Club Journal, die Zeitschrift Jazz Home sowie Interviews mit Joki Freund oder Ulrich Olshausen. Ihre Recherchen stellte Gallenkamp für ihre Magisterarbeit an, was vielleicht den etwas trockenen Stil erklären mag, der das Buch stellenweise zu einer etwas beschwerlichen Lektüre werden lässt. Viel Information hat sie zusammengetragen, wenig Neues entdeckt, Altbekanntes mit Quellenverweisen untermauert. Im ersten Kapitel wimmelt es ein wenig von jazzhistorischen Gemeinplätzen, die in ihrer Vereinfachung eher verwirren als erklären. Die benutzte Literatur ist in diesem Bereich recht begrenzt; insgesamt würde man sich – wenn man sich schon durch ein wissenschaftlich angelegtes Werk kämpft, eine etwas kritischere Herangehensweise an die Quellen wünschen. Noch mehr allerdings wünschte man, dass die Autoren sich weniger auf bekannte Quellen verlassen und dafür vielleicht selbst im einen oder anderen Archiv gestöbert hätte, dem Archiv der Stars and Stripes etwa, der amerikanischen Armeezeitung. Man wünschte sich, dass die Begegnung zwischen Amerikanern und Deutschen als eine wirkliche Begegnung dargestellt würde, nicht nur als eine einseitig bewundernde Verehrung, dass die Autorin also neben den deutschen Beispielen auch amerikanische gebracht hätte, Interviews etwa mit damals in Deutschland stationierten Soldaten und/oder Musikern geführt hätte. Das ist, zugegeben, mit der Zeit immer schwieriger, aber auch solche Zeitzeugen lassen sich noch finden, und diese Aufarbeitung wäre ungemein wichtig. Im letzten Kapitel merkt Gallenkamp immerhin an, was noch zu tun sei in der Erforschung des deutsch-amerikanischen Jazzdialogs. Schade, dass sie die Chance nicht selbst ergriffen hat, neben der durch einige Zeitzeugengespräche aufgelockerten Literaturarbeit in eine tiefere Recherche einzusteigen. So ist die wichtigste Erkenntnis ihres Buchs vielleicht, dass dieser Teil deutscher Jazzgeschichtsschreibung immer noch mehr Aufgaben enthält als Resultate.
Die Rezeption des Jazz in Deutschland ist immer auch eine Rezeption der Amerikaner in Deutschland – so eng waren letzten Endes die amerikanischen Besatzungskräfte mit der Jazzentwicklung hierzulande verbunden. Es hat seinen Grund, warum Frankfurt am Main nach dem Krieg für lange Zeit als (moderne) Jazzhauptstadt der Republik galt: Hier saß das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte; hier gab es die meisten amerikanischen Soldaten und – eng damit verbunden – auch die meisten Soldatenclubs, in denen die US-amerikanischen Kunden nach der Musik verlangten, die sie von zuhause her gewohnt waren. Anfang der 1950er Jahre war das noch der Jazz, später ließ die Jazzliebe der Soldaten (wie auch ganz allgemein der amerikanischen Bevölkerung) nach; die Kapellen, die in den GI-Clubs aufspielten, mussten bald eine andere Musik spielen. Die Begegnungen zwischen Amerikanern und Deutschen jedenfalls waren ausschlaggebend für eine ganz spezifische Spielweise all jener Musiker, die das Glück hatten, in dieser Region zu arbeiten. Anja Gallenkamp hinterfragt in ihrer Studie die Kontakte zwischen Amerikanern und Deutschen, befragt Zeitzeugen und wertet Zeitschriften der Nachkriegszeit aus. Sie interessiert sich dafür, inwieweit das amerikanische Vorbild einen Dialog überhaupt noch ermöglichte bzw. inwieweit es über lange Jahre die Ausbildung eines eigenen Stils vielleicht eher verhinderte. Die Zeit, die sie dabei vor allem interessiert, sind die Jahre 1945 bis 1951/52, ihre Quellen etwa das von Horst Lippmann herausgegebene Hot Club Journal, die Zeitschrift Jazz Home sowie Interviews mit Joki Freund oder Ulrich Olshausen. Ihre Recherchen stellte Gallenkamp für ihre Magisterarbeit an, was vielleicht den etwas trockenen Stil erklären mag, der das Buch stellenweise zu einer etwas beschwerlichen Lektüre werden lässt. Viel Information hat sie zusammengetragen, wenig Neues entdeckt, Altbekanntes mit Quellenverweisen untermauert. Im ersten Kapitel wimmelt es ein wenig von jazzhistorischen Gemeinplätzen, die in ihrer Vereinfachung eher verwirren als erklären. Die benutzte Literatur ist in diesem Bereich recht begrenzt; insgesamt würde man sich – wenn man sich schon durch ein wissenschaftlich angelegtes Werk kämpft, eine etwas kritischere Herangehensweise an die Quellen wünschen. Noch mehr allerdings wünschte man, dass die Autoren sich weniger auf bekannte Quellen verlassen und dafür vielleicht selbst im einen oder anderen Archiv gestöbert hätte, dem Archiv der Stars and Stripes etwa, der amerikanischen Armeezeitung. Man wünschte sich, dass die Begegnung zwischen Amerikanern und Deutschen als eine wirkliche Begegnung dargestellt würde, nicht nur als eine einseitig bewundernde Verehrung, dass die Autorin also neben den deutschen Beispielen auch amerikanische gebracht hätte, Interviews etwa mit damals in Deutschland stationierten Soldaten und/oder Musikern geführt hätte. Das ist, zugegeben, mit der Zeit immer schwieriger, aber auch solche Zeitzeugen lassen sich noch finden, und diese Aufarbeitung wäre ungemein wichtig. Im letzten Kapitel merkt Gallenkamp immerhin an, was noch zu tun sei in der Erforschung des deutsch-amerikanischen Jazzdialogs. Schade, dass sie die Chance nicht selbst ergriffen hat, neben der durch einige Zeitzeugengespräche aufgelockerten Literaturarbeit in eine tiefere Recherche einzusteigen. So ist die wichtigste Erkenntnis ihres Buchs vielleicht, dass dieser Teil deutscher Jazzgeschichtsschreibung immer noch mehr Aufgaben enthält als Resultate.
Wolfram Knauer (Oktober 2010)
Some Liked It Hot. Jazz Women in Film and Television, 1928-1959
Von Kristin A. McGee
Middletown/CT 2009 (Wesleyan University Press)
336 Seiten, 27,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8195-6908-0
 Kristin A. McGee verbindet in diesem aus ihrer Dissertation hervorgegangenen Buch gleich zwei Themen: die Stellung der Frau im Jazz und die Repräsentation des Jazz im Film – ihr Thema also ist dementsprechend die Repräsentation der Frau im Jazz, dargestellt in Film und Fernsehen in den Jahren zwischen 1928 und 1959. Sie fragt dabei neben historischen Fakten danach, wie es in beiden Genres – Jazz wie Film – aufgenommen wurde, Frauen als professionelle Akteure zu erleben. Ihr Handwerkszeug dabei zu eruieren, wie Frauen, ob weiß oder schwarz, entgegen dem üblichen Frauenbild in der Gesellschaft ihre (alternative) Identität im Beruf als Jazzmusiker schufen, ist neben der Musikethnologie das der Gender Studies und der allgemeinen Kulturwissenschaften.
Kristin A. McGee verbindet in diesem aus ihrer Dissertation hervorgegangenen Buch gleich zwei Themen: die Stellung der Frau im Jazz und die Repräsentation des Jazz im Film – ihr Thema also ist dementsprechend die Repräsentation der Frau im Jazz, dargestellt in Film und Fernsehen in den Jahren zwischen 1928 und 1959. Sie fragt dabei neben historischen Fakten danach, wie es in beiden Genres – Jazz wie Film – aufgenommen wurde, Frauen als professionelle Akteure zu erleben. Ihr Handwerkszeug dabei zu eruieren, wie Frauen, ob weiß oder schwarz, entgegen dem üblichen Frauenbild in der Gesellschaft ihre (alternative) Identität im Beruf als Jazzmusiker schufen, ist neben der Musikethnologie das der Gender Studies und der allgemeinen Kulturwissenschaften.
McGee beginnt ihr Buch mit einer Diskussion der Feminisierung der Massenkultur und der Mode von Frauenbands in den 1920er Jahren. Natürlich bezieht sich dieses Kapitel noch weit stärker auf die Bühne als auf den Film, aber genau das ist es, was McGee aufzeigen will, wie viele der auch im Film der 30er bis 50er Jahre enthaltenen Klischees sich auf der Varieté-Bühne der 1920er Jahre entwickelt hatten. Sie betrachtet Frauenensembles wie die Ingenues, die schon mal als die “Female Paul Whitemans of Syncopation” angekündigt wurden, oder die Harlem Playgirls, die in den schwarzen Zeitungen der 1930er Jahre gefeiert wurden. Da es in den meisten Teilen des Buchs die Darstellung der Musik im Film geht, macht es Sinn, sich, wo vorhanden, beim Lesen die entsprechenden Videos auf YouTube anzusehen, etwa Ausschnitte von Phil Spitalny and His Musical Queens oder der Bandleaderin Ina Ray Hutton. McGee erklärt, was in den Filmausschnitten zu sehen, aber auch, wie die diversen Bands in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden – als Bands genauso wie in ihrer Weiblichkeit. Sie findet vor allem, dass die Berichte selbst in den 1930er und 1940er Jahren nach wie vor das Ungewöhnliche einer reinen Frauenband stärker in den Vordergrund stellen als die musikalische Stärke der Ensembles. Hutton kommt dabei besonderes Gewicht zu, da ihre Band auch in Musikerkreisen einen exzellenten Ruf besaß.
Der dritte Teil des Buchs beschäftigt sich mit einem neuen Genre des Musikvideos in den 1940er Jahren, in dem schwarze Bands eine größere Rolle spielten. Themenschwerpunkte sind Hazel Scott, Lena Horne und eine neue Form der Erotisierung weiblicher Bands in den Soundies jener Zeit. Frauenbands erfuhren besonders während des Krieges einen Aufschwung, weil ihre männlichen Kollegen eingezogen wurden, eine Tatsache, auf die etwa im Film “When Johnny Comes Marching Home” auch thematisch eingegangen wird. Die International Sweethearts of Rhythm waren wahrscheinlich die bekannteste Frauenkapelle jener Jahre, und ihnen sowie ihrer Darstellung im Film widmet McGee ein eigenes Kapitel.
Im viertel Teil ihres Buches schließlich beleuchtet McGee die 50er Jahre, als Jazz in Musiksoundies immer weniger eine Rolle spielte, das Fernsehen dagegen zu einem allgegenwärtigen Medium wurde. So fragt sie nach Varietéshows im Fernsehen und der Präsenz weiblicher musikalischer Entertainer – Sängerinnen wie Peggy Lee und Lena Horne sowie Bandleaderinnen wie Ina Ray Hutton und Hazel Scott.
McGees Buch fokussiert den Blick des Lesers auf einen sehr speziellen Aspekt der Jazzgeschichte, und sie vermag jede Menge interessanter Backgroundinformationen dazu zu geben. Eine klare Storyline gibt es allerdings nicht in ihrem Buch, dem dann doch eher eine recht allgemein gehaltene Fragestellung zugrunde liegt und das sich stattdessen manchmal in Details verliert, bei denen sie letzten Endes mehr Fragen aufzuwerfen als Antworten zu geben scheint.
Wolfram Knauer (September 2010)
Fats Waller
von Igort & Carlos Sampayo
Bologna 2009 (Coconino Press)
152 Seiten, 17,50 Euro
ISBN: 978-8876-18159-7
 Igort und Carlos Sampayo sind in der Comicszene gefeierte Zeichner, deren “Fats Waller”-Buch bereits 2004 veröffentlicht und mittlerweile in etliche Sprachen übersetzt wurde (eine deutsche Ausgabe erschien 2005). Nun liegt uns die italienische Übersetzung des Buchs vor, Grund genug, hineinzusehen und einen Eindruck zu vermitteln. Es ist keine Comic-Biographie, wie man vermuten könnte, sondern ein an der Musik und am großen Fats Waller aufgehängtes Buch über Zeitgeschichte. Wir erleben den Pianisten im Plattenstudio, den Faschismus in Deutschland und Spanien, Liebe, Krieg, Leid und swingende Musik, durcheinandergewirbelt in hinreißenden Zeichnungen der Autoren, die den Jazz als Begleitmusik der schlimmsten Jahre des 20sten Jahrhunderts interpretieren. Das gelingt ihnen glänzend. Zum Schluss finden sich, quasi als Bonus Tracks, einige Skizzen zum Buch, auf zwei Blättern aber auch Hinweise auf die musikalischen Auswirkungen, wenn Fats Waller Thelonious Monk über die Schulter schaut.
Igort und Carlos Sampayo sind in der Comicszene gefeierte Zeichner, deren “Fats Waller”-Buch bereits 2004 veröffentlicht und mittlerweile in etliche Sprachen übersetzt wurde (eine deutsche Ausgabe erschien 2005). Nun liegt uns die italienische Übersetzung des Buchs vor, Grund genug, hineinzusehen und einen Eindruck zu vermitteln. Es ist keine Comic-Biographie, wie man vermuten könnte, sondern ein an der Musik und am großen Fats Waller aufgehängtes Buch über Zeitgeschichte. Wir erleben den Pianisten im Plattenstudio, den Faschismus in Deutschland und Spanien, Liebe, Krieg, Leid und swingende Musik, durcheinandergewirbelt in hinreißenden Zeichnungen der Autoren, die den Jazz als Begleitmusik der schlimmsten Jahre des 20sten Jahrhunderts interpretieren. Das gelingt ihnen glänzend. Zum Schluss finden sich, quasi als Bonus Tracks, einige Skizzen zum Buch, auf zwei Blättern aber auch Hinweise auf die musikalischen Auswirkungen, wenn Fats Waller Thelonious Monk über die Schulter schaut.
Wolfram Knauer (August 2010)
Thriving On a Riff. Jazz & Blues Influences in African American Literature and Film
herausgegeben von Graham Lock & David Murray
New York 2009 (Oxford University Press)
296 Seiten, 24,95 US-Dollar (oder 13,99 Britische Pfund)
ISBN: 978-0-19-533709-9
 Der Einfluss zwischen den Künsten ist immer wieder Thema für wissenschaftliche Symposien und Sammelbände, und der Einfluss des Jazz auf Literatur und Film insbesondere wegen der improvisatorischen Grundhaltung des Jazz ein gern behandeltes Thema. Doch machen es sich viele Autoren zu einfach mit den Wechselbeziehungen zwischen den Künsten, suchen nach augenfälligen Parallelen statt nach gemeinsamen künstlerisch-ästhetischen Ansätzen. Ein einfaches Übertragen künstlerischer Ideen oder Ästhetiken von einem Genre aufs andere ist in der Regel eh nicht möglich, und oft genug sind im Nachhinein festgestellte Parallelen oder Wechselbeziehungen theoretisch aufgepfropfte Interpretationsmodelle, nicht immer aber originär gewollt. Graham Lock und David Murray versuchen in dem von ihnen herausgegebenen Buch, eine Menge unterschiedlicher Ansätze einer Betrachtung des Zusammenspiels zwischen Jazz und Literatur, Jazz und Lyrik sowie Jazz und Film zu versammeln. Das Buch, das als Fortsetzung des Buchs “The Hearing Eye” zu lesen ist, hatte seinen Ursprung in einem Forschungsprojekt über wechselseitige Einflüsse zwischen afro-amerikanischer Musik des 20. Jahrhunderts, den visuellen Künsten und der Literatur.
Der Einfluss zwischen den Künsten ist immer wieder Thema für wissenschaftliche Symposien und Sammelbände, und der Einfluss des Jazz auf Literatur und Film insbesondere wegen der improvisatorischen Grundhaltung des Jazz ein gern behandeltes Thema. Doch machen es sich viele Autoren zu einfach mit den Wechselbeziehungen zwischen den Künsten, suchen nach augenfälligen Parallelen statt nach gemeinsamen künstlerisch-ästhetischen Ansätzen. Ein einfaches Übertragen künstlerischer Ideen oder Ästhetiken von einem Genre aufs andere ist in der Regel eh nicht möglich, und oft genug sind im Nachhinein festgestellte Parallelen oder Wechselbeziehungen theoretisch aufgepfropfte Interpretationsmodelle, nicht immer aber originär gewollt. Graham Lock und David Murray versuchen in dem von ihnen herausgegebenen Buch, eine Menge unterschiedlicher Ansätze einer Betrachtung des Zusammenspiels zwischen Jazz und Literatur, Jazz und Lyrik sowie Jazz und Film zu versammeln. Das Buch, das als Fortsetzung des Buchs “The Hearing Eye” zu lesen ist, hatte seinen Ursprung in einem Forschungsprojekt über wechselseitige Einflüsse zwischen afro-amerikanischer Musik des 20. Jahrhunderts, den visuellen Künsten und der Literatur.
Nick Heffernan macht den Anfang mit einer Analyse der Romane “The Autobiography of an Ex-Colored Man” von James Weldon Johnson (1912) und “Mojo Han. An Orphic Tale” von J.J. Phillips (1916) und untersucht insbesondere, wie in beiden Romanen die Wurzeln schwarzer Musik für die Identität der Protagonisten und für ihr Selbstverständnis als Afro-Amerikaner eine Rolle spielen. Corin Willes wirft einen Blick auf die Blackface Minstrelsy und fragt, wo sich Überreste dieser Gattung im frühen Tonfilm finden lassen. Steven C. Tracy untersucht Folk-Einfüsse (insbesondere aus dem Blues) auf Sterling Browns Gedichte. Graham Lock interviewt den Dichter Michael S. Harper über den Einfluss des Jazz auf seine Arbeit sowie über sein Gedicht “Dear John, Dear Coltrane” von 1970. Bertram D. Ashe untersucht Paul Beattys Roman “White Boy Shuffle Blues” auf die darin vorkommenden Bezüge zu Jazz, afro-amerikanischer Musik und sonstige Volkstraditionen. Graham Lock unterhält sich mit der Dichterin Jayne Cortez über ihren eigenen Bezug zu Musik, Politik und frühe Jazz-und-Lyrik-Projekte mit Horace Tapscott, über Ornette Coleman, mit dem sie kurzzeitig verheiratet war und über Jazzprojekte mit ihrem Sohn Denardo Coleman. Außerdem druckt er ihr Gedicht “A Miles Davis Trumpet” ab, das als von Cortez gelesenes Soundbeispiel auch auf der von der Oxford University Press eigens eingerichtete Website abrufbar ist. David Murray befasst sich mit Musik und Spiritualität in den Schriften von Nathaniel Mackey und Amiri Baraka, diskutiert insbesondere Barakas “Blues People” (1963) und “Black Music” (1967), die, wie er darstellt, auch auf seine Dichtung Einfluss hatten (etwa “Black Dada Nihilismus”).
John Gennari untersucht Ross Russells Charlie-Parker-Biographie “Bird Lives!” auf die wechselvolle Beziehung der beiden, nachdem Russell Parker 1945 für sein Dial-Label aufgenommen hatte. Er fragt nach den Schwierigkeiten, mit denen sich der Autor für sein Parker-Buch herumschlagen musste und vergleicht Russells Biographie schließlich mit seinem Roman “The Sound” und dessen Rezeption durch die Jazzkritik. Krin Gabbard beschäftigt sich mit dem Genre der Jazzautobiographie, vergleicht entsprechende Publikationen von Billie Holiday, Charles Mingus, Art Pepper, Sidney Bechet, Louis Armstrong, Duke Ellington, konzentriert sich dann aber vor allem auf Miles Davis’ “Miles. The Autobiography”. Er fragt nach dem “wahren” Miles Davis hinter den von Stuart Troupe edierten Gesprächen, aus denen das Buch entstanden war, danach, wie Miles gesehen werden wollte und wie die Person hinter dem Bild, das Miles da erschaffen wollte, wirklich aussah.
Mit Bezug zum Film macht sich Ian Brookes Gedanken über Filme wie “To Have and Have Not” oder “Casablanca”, über die narrative Ikonographie der Kriegszeit und die Darstellung schwarzer Menschen und die Funktion der Musik in diesen Filmen. David Butler untersucht die Rolle der Filmmusik, die John Lewis 1959 für “Odds Against Tomorrow” geschrieben hat. Er vergleicht Lewis’ Arbeit mit der Verwendung von Jazz in früheren Filmen und verweist darauf, dass Lewis der Überzeugung war, dass Jazz weit mehr als Nebenbeimusik sein könnte, dass Jazz als Filmmusik das gesamte Spektrum emotionalen Ausdrucks wiedergeben könne. Lewis’ Partitur habe jede Menge an Improvisation mit einbezogen, was bislang in Hollywood überhaupt nicht üblich gewesen sei, schreibt Brookes, und sie vermeide die typischen Jazzklischees. Brookes erzählt die Handlung des Films, diskutiert die Rolle des schwarzen Protagonisten (gespielt von Harry Belafonte) und bedauert, dass Lewis trotz der exzellenten Arbeit für diesen Film nicht die Gelegenheit erhielt, weiter in dem Metier der Filmmusik zu arbeiten. Mervyn Cooke nimmt sich das andere große Beispiel jazziger Filmmusik von 1959 vor: Otto Premingers “Anatomy of a Murder” für das Duke Ellington die Musik schrieb. Er analysiert einzelne Filmsequenzen und die sie begleitende Musik, vergleicht den Einsatz von Musik hier mit Filmen wie “The Man With the Folden Arm”, “Ascenceur pur l’échafaud” (mit seinen kongenialen Miles-Davis-Improvisationen), “Sait-on jamais” (mit Musik von John Lewis), “À bout de souffle” (mit einer Partitur von Martial Solal) und Roman Polanskis “Knife in the Water”, für das Krzysztof Komeda die Filmmusik schrieb.
In einem abschließenden Kapitel reflektiert Michael Jarrett dann über das grundsätzliche Missverständnis, Einfluss sei grundsätzlich ein bewusster Vorgang. Dann nimmt sich Jarrett ein konkretes Einflussthema vor: Er stellt auf seiner Website einen Klangmix verschiedener Titel zusammen, die auf das Eisenbahn-Thema rekurrieren, das sich in afro-amerikanischer Musik zwischen Jazz, Blues, Soul und Gospel so häufig findet. Er fragt nach unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten: Soundimitaten, Repräsentation von Zugmetaphern, Reduktion eines Songs auf Zuggeräusche etc. “Conduction” nennt Gregory Ulmer das neue Verständnis von Einflusssträngen, auf das Jarrett hiermit hinaus will, und das weit weniger zielgerichtet ist als es das Wort “Einfluss” vermuten lässt, und Jarrett überträgt Ulmers Modell beispielhaft auf Einflüsse in afro-amerikanischer Musik und Jazz.
Insgesamt ein Buch, das vom Großen zum Kleinen fortschreitet, anhand konkreter Beispiele jede Menge Anregungen für weitere Forschung über die die gegenseitigen Befruchtungen zwischen Jazz, Literatur und Film gibt. Spannende, anregende Lektüre.
Wolfram Knauer (August 2010)
Werkschau. 20 Jahre Schaffhauser Jazzfestival. Ein Rückblick
Herausgegeben von Daniel Fleischmann & Peter Pfister
Zürich 2009 (Chronos Verlag)
144 Seiten, 46 Schweizer Franken
ISBN: 978-3-0340-0961-4
 Für wen ist ein Buch, das auf ein Festival zurückblickt? Wohl tatsächlich vor allem für diejenige, die dieses Festival über die Jahre besucht haben, für die dieses Festival zur eigenen Geschmacksbildung beigetragen hat, die sich in der Dokumentation an die Atmosphäre, an musikalische Höhepunkte erinnern möchten. Das von Daniel Fleischmann redaktionell betreute und von Peter Pfister koordinierte Buch zum 20jährigen Jubiläum des Schaffhauser Festivals vertraut bei der Erinnerung in erster Linie auf Fotos, in zweiter Linie auf einige Texte, die die Bedeutung eines Schweizer Festivals beleuchten, auf organisatorische Probleme, auf ästhetische Diskussionen und auf das Überwinden von Schwierigkeiten eingehen. Die Fotos sind teils schwarzweiß, teils in Farbe gehalten, geben Spielsituationen genauso wieder wie das konzentriertes Aufanderhören der Musiker oder aber vor- bzw. nachbereitende Gespräche. Sie sind auf gutem, schwerem Papier gedruckt, und in ein angenehm voll-aufschlagbares Hardback gebunden. Am Schluss findet sich eine Übersicht der 20 Festivalplakate, leider aber kein Personenindex, auch keine Programmübersicht dieser Zeit. Dabei machen die Bilder neugierig genug darauf, wie denn die Abende programmiert wurden, von denen die Fotos stammen. Trotzdem, ein dankbar durchblätterbares Buch mit vielen sehenswerten Fotodokumenten zum zeitgenössischen Jazz aus der Schweiz, aus Europa und der ganzen Welt.
Für wen ist ein Buch, das auf ein Festival zurückblickt? Wohl tatsächlich vor allem für diejenige, die dieses Festival über die Jahre besucht haben, für die dieses Festival zur eigenen Geschmacksbildung beigetragen hat, die sich in der Dokumentation an die Atmosphäre, an musikalische Höhepunkte erinnern möchten. Das von Daniel Fleischmann redaktionell betreute und von Peter Pfister koordinierte Buch zum 20jährigen Jubiläum des Schaffhauser Festivals vertraut bei der Erinnerung in erster Linie auf Fotos, in zweiter Linie auf einige Texte, die die Bedeutung eines Schweizer Festivals beleuchten, auf organisatorische Probleme, auf ästhetische Diskussionen und auf das Überwinden von Schwierigkeiten eingehen. Die Fotos sind teils schwarzweiß, teils in Farbe gehalten, geben Spielsituationen genauso wieder wie das konzentriertes Aufanderhören der Musiker oder aber vor- bzw. nachbereitende Gespräche. Sie sind auf gutem, schwerem Papier gedruckt, und in ein angenehm voll-aufschlagbares Hardback gebunden. Am Schluss findet sich eine Übersicht der 20 Festivalplakate, leider aber kein Personenindex, auch keine Programmübersicht dieser Zeit. Dabei machen die Bilder neugierig genug darauf, wie denn die Abende programmiert wurden, von denen die Fotos stammen. Trotzdem, ein dankbar durchblätterbares Buch mit vielen sehenswerten Fotodokumenten zum zeitgenössischen Jazz aus der Schweiz, aus Europa und der ganzen Welt.
Wolfram Knauer (August 2010)
50 Jahre Jazzkeller Hofheim. 1959-2009 Kellertexte
herausgegeben von Roswitha Schlecker
Hofheim 2009 (Stadtmuseum Hofheim am Taunus)
120 Seiten; 10 Euro
ISBN: 978-3-933735-38-6
 Am 22. August 1959 eröffnete der Club der Jazzfreunde den ersten Jazzkeller in Hofheim am Taunus. 2009 feierte das Stadtmuseum das halbe Jahrhundert mit einer Ausstellung und einer Buchdokumentation über 50 Jahre bürgerschaftliches Engagement im Club der Jazzfreunde Hofheim. Die Dokumentation ist reich bebildert und schildert die Entwicklung des Clubs aus Beteilgtensicht: Von den Anfängen im Café Staab über Aufbruch, Jugendkultur und Politisierung der 1960er Jahre, sportliche Aktivitäten um den Club, ästhetische Diskussionen und schließlich das Hofheimer Jazzfest, das zwischen 1975 und 1995 zwanzigmal stattfand und über die Jahre wegen seiner künstlerischen Qualität zu einem deutschlandweit wahrgenommenen Festival wurde. Der Club war sozialer Treffpunkt, das wird schnell klar, und er hatte eine wichtige Funktion im Leben der aktiven Clubmitglieder, von denen eine überdurchschnittlich große Zahl beruflich mit der Musik verbunden blieb (als Verleger, als Buchhändler mit Jazzspezialsortiment, als Musikagent). Über die Musik selbst erfährt man dabei allerdings wenig, kriegt eher am Rande mit, dass Debatten um Free Jazz stattgefunden haben müssen, der im Club eine “große Minderheit” an Befürwortern hatte. Die Clubmitglieder jedenfalls engagierten sich nicht nur für ihren Verein, sondern auch in der Stadt, demonstrierten gegen Missstände, ja stellten 1980 sogar einen eigenen Kanzlerkandidaten auf, der die Partei G.A.F.N. (Gegen Alles Für Nichts) zur Macht bringen sollte. Hofheim, am Rande der Spontistadt Frankfurt gelegen, kriegte eben einiges mit an Ideen und Einfällen der Szene um Joschka Fischer und Daniel Kohn-Bendit. 1995 fand das 20. Hofheimer Jazzfest statt; der Jazzkeller macht weiter Konzerte, weiterhin mit Improvisationslust, wenn auch mit genauso unsicheren Mitteln. Zum 50sten Geburtstag schenkte der Verein sich selbst sein 21. Jazzfest. Die Dokumentation seiner Aktivitäten gibt ein lesenswertes Stimmungsbild einer aktiven Jazzgemeinde.
Am 22. August 1959 eröffnete der Club der Jazzfreunde den ersten Jazzkeller in Hofheim am Taunus. 2009 feierte das Stadtmuseum das halbe Jahrhundert mit einer Ausstellung und einer Buchdokumentation über 50 Jahre bürgerschaftliches Engagement im Club der Jazzfreunde Hofheim. Die Dokumentation ist reich bebildert und schildert die Entwicklung des Clubs aus Beteilgtensicht: Von den Anfängen im Café Staab über Aufbruch, Jugendkultur und Politisierung der 1960er Jahre, sportliche Aktivitäten um den Club, ästhetische Diskussionen und schließlich das Hofheimer Jazzfest, das zwischen 1975 und 1995 zwanzigmal stattfand und über die Jahre wegen seiner künstlerischen Qualität zu einem deutschlandweit wahrgenommenen Festival wurde. Der Club war sozialer Treffpunkt, das wird schnell klar, und er hatte eine wichtige Funktion im Leben der aktiven Clubmitglieder, von denen eine überdurchschnittlich große Zahl beruflich mit der Musik verbunden blieb (als Verleger, als Buchhändler mit Jazzspezialsortiment, als Musikagent). Über die Musik selbst erfährt man dabei allerdings wenig, kriegt eher am Rande mit, dass Debatten um Free Jazz stattgefunden haben müssen, der im Club eine “große Minderheit” an Befürwortern hatte. Die Clubmitglieder jedenfalls engagierten sich nicht nur für ihren Verein, sondern auch in der Stadt, demonstrierten gegen Missstände, ja stellten 1980 sogar einen eigenen Kanzlerkandidaten auf, der die Partei G.A.F.N. (Gegen Alles Für Nichts) zur Macht bringen sollte. Hofheim, am Rande der Spontistadt Frankfurt gelegen, kriegte eben einiges mit an Ideen und Einfällen der Szene um Joschka Fischer und Daniel Kohn-Bendit. 1995 fand das 20. Hofheimer Jazzfest statt; der Jazzkeller macht weiter Konzerte, weiterhin mit Improvisationslust, wenn auch mit genauso unsicheren Mitteln. Zum 50sten Geburtstag schenkte der Verein sich selbst sein 21. Jazzfest. Die Dokumentation seiner Aktivitäten gibt ein lesenswertes Stimmungsbild einer aktiven Jazzgemeinde.
Wolfram Knauer (August 2010)
Whisky & Jazz
von Hans Offringa (& Jack McCray)
Charleston/SC 2009 (Evening Post Publishing Company)
206 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-615-28155-1
 Wenn man nach Verbindungen zwischen Whisky und Jazz sucht, dann fallen einem wahrscheinlich als erstes die Trunkenbolde der Jazzgeschichte ein, von Bix Beiderbecke über Bunny Berigan bis zu Billie Holiday oder Lester Young und etlichen anderen, die oft genug mit Alkohol begannen und mit härteren Drogen endeten. Dies vorausgeschickt, mag man ein wenig ratlos vor diesem opulenten Coffeetable-Book stehen, das so unverblümt behauptet, die beiden hätten etwas gemeinsam. Jazz müsse swingen und Whisky müsse einen gewissen Nachgeschmack besitzen, schreibt Offringa. Für beide müsse man einen Geschmack entwickeln, beide würden von Experten und passionierten Handwerkern hergestellt. Naja, da fielen einem dann allerdings noch etliche andere mögliche Buchprojekte ein. Doch es ist nun mal Whisky… Hans Offringa also heißt der niederländische Whiskykenner, der schon etliche Bücher über den goldenen Stoff geschrieben hat und der sich diesmal mit Jack McCray einen ausgewiesenen Jazzexperten ins Boot geholt hat. Sie suchen zehn Musiker aus, die Jazzgeschichte geschrieben haben, sowie zehn gleichermaßen wichtige Single Malts. Nach einer Einführung in sowohl die Jazz- als auch die Whiskygeschichte gibt es dann kurze Essays zu Leben und Werk der Protagonisten bzw. Entstehung und Sein der Whiskysorten, beide Teile reich bebildert mit Fotos der jeweiligen Themenschwerpunkte. Die ausgewählten Jazzer sind keine Randfiguren: Cannonball Adderley, Chet Baker, John Coltrane, Miles Davis, Stan Getz, Dexter Gordon, Milt Jackson, Hank Mobley, Charlie Parker und Art Tatum. Jack McCray stellt sie in kurzen, liebevollen Artikeln vor, die sich ihrer Biographie genauso wie ihrer musikalischen Ästhetik widmen. An den Beginn des Buchs stellt McCray außerdem eine Einführung in die Jazzgeschichte, die auch alternative Narrative, also beispielsweise die Bedeutung seiner Heimatstadt Charleston, mit berücksichtigt. Zum Schluss kommen die beiden Erzählstränge des Buchs, der zum Whisky und der zum Jazz, dann zusammen, wenn den Musikern Whiskysorten zugeordnet werden, quasi wie eine Art Hör-und-Trink-Anleitung: Mit Jackson mit Balblair, Miles Davis mit Bruichladdich, Charlie Parker mit Springbank und so weiter. Über die Lieblingsgetränke der Musiker erfährt man eher wenig. Vielleicht hätten sie dem Single Malt einen Bourbon vorgezogen. Oder Milch, wie ein Foto im Hank-Mobley-Kapitel suggeriert.
Wenn man nach Verbindungen zwischen Whisky und Jazz sucht, dann fallen einem wahrscheinlich als erstes die Trunkenbolde der Jazzgeschichte ein, von Bix Beiderbecke über Bunny Berigan bis zu Billie Holiday oder Lester Young und etlichen anderen, die oft genug mit Alkohol begannen und mit härteren Drogen endeten. Dies vorausgeschickt, mag man ein wenig ratlos vor diesem opulenten Coffeetable-Book stehen, das so unverblümt behauptet, die beiden hätten etwas gemeinsam. Jazz müsse swingen und Whisky müsse einen gewissen Nachgeschmack besitzen, schreibt Offringa. Für beide müsse man einen Geschmack entwickeln, beide würden von Experten und passionierten Handwerkern hergestellt. Naja, da fielen einem dann allerdings noch etliche andere mögliche Buchprojekte ein. Doch es ist nun mal Whisky… Hans Offringa also heißt der niederländische Whiskykenner, der schon etliche Bücher über den goldenen Stoff geschrieben hat und der sich diesmal mit Jack McCray einen ausgewiesenen Jazzexperten ins Boot geholt hat. Sie suchen zehn Musiker aus, die Jazzgeschichte geschrieben haben, sowie zehn gleichermaßen wichtige Single Malts. Nach einer Einführung in sowohl die Jazz- als auch die Whiskygeschichte gibt es dann kurze Essays zu Leben und Werk der Protagonisten bzw. Entstehung und Sein der Whiskysorten, beide Teile reich bebildert mit Fotos der jeweiligen Themenschwerpunkte. Die ausgewählten Jazzer sind keine Randfiguren: Cannonball Adderley, Chet Baker, John Coltrane, Miles Davis, Stan Getz, Dexter Gordon, Milt Jackson, Hank Mobley, Charlie Parker und Art Tatum. Jack McCray stellt sie in kurzen, liebevollen Artikeln vor, die sich ihrer Biographie genauso wie ihrer musikalischen Ästhetik widmen. An den Beginn des Buchs stellt McCray außerdem eine Einführung in die Jazzgeschichte, die auch alternative Narrative, also beispielsweise die Bedeutung seiner Heimatstadt Charleston, mit berücksichtigt. Zum Schluss kommen die beiden Erzählstränge des Buchs, der zum Whisky und der zum Jazz, dann zusammen, wenn den Musikern Whiskysorten zugeordnet werden, quasi wie eine Art Hör-und-Trink-Anleitung: Mit Jackson mit Balblair, Miles Davis mit Bruichladdich, Charlie Parker mit Springbank und so weiter. Über die Lieblingsgetränke der Musiker erfährt man eher wenig. Vielleicht hätten sie dem Single Malt einen Bourbon vorgezogen. Oder Milch, wie ein Foto im Hank-Mobley-Kapitel suggeriert.
Das Buch ist sicher vor allem eine Geschenkidee an jemanden, der beidem zugetan ist: dem Whisky und dem Jazz. Über beide Seiten seines Hobbies wird der so Beschenkte einiges Interessante erfahren, blättern, und vielleicht noch andere, eigene Getränke-Musik-Kombinationen entdecken.
Wolfram Knauer (Juli 2010)
Insights in Jazz. An Inside View of Jazz Standard Chord Progressions
von John A. Elliott
London 2009 (Jazzwise Publications)
306 Seiten, 25 Britische Pfund (Buch) bzw. 12 Britische Pfund (PDF-Download)
ISBN: 978-0-9564031-1-7
 John Elliott, Jazzpianist und -lehrer aus Edinburgh, fasst sein Buch im Vorwort in einer Grafik zusammen: Er hat den gesamten Text in “wordle.-net” eingegeben, eine Website, die die Häufigkeit von im Text auftauchenden Worten analysiert und in eine Grafik umwandelt, in der besonders oft benutzte Worte größer und herausgehobener dargestellt werden als weniger oft benutzte Worte. “Cadence”, “Chord” und das Akkordsymbol “C∆” sind demnach die wichtigsten Wörter des Buchs, gefolgt von “Love”, “songs”, “chords”, “bridge”. “Love” fällt heraus; es taucht so oft auf, weil viele der Songs, die Elliott für sein Buch analysiert, nun mal “Love” im Titel führen. Elliott stellt in seinem Buch eine Methode auf, die Musikern helfen soll, die harmonische Struktur von Jazzstücken im Gedächtnis zu behalten. “Insights in Jazz” ist also keine neue Improvisationslehre, kein neues Harmonielehrebuch, sondern bietet eine Analyse ausgewählter Standards, die es Musikern und Musikstudenten leichter machen soll, diese zu memorieren. Sie baut auf Conrad Corks “New Guide to Harmony with LEGO Bricks” auf, einem Lehrbuch, das seit 1985 in mehreren Auflagen veröffentlicht wurde. Cork fasste oft vorkommende Akkordprogressionen in “bricks”, also Bausteinen, zusammen und definierte darüber hinaus eine Reihe an Verbindungspassagen (“joins”) zwischen solchen Bausteinen. Elliott ergänzt, er sei der Überzeugung, dass sich Standards am besten lernen ließen, wenn man sie grafisch darstelle. Harmoniesymboltechnisch hält er sich weitgehend zurück, beschränkt sich auf grundlegende Harmoniesymbole. Ansonsten präsentiert er die ausgesuchten Standards in einer Grafik, in der die formale Struktur angegeben ist, darin die Bausteine und Verbindungsstücke gemäß dem Lehrbuch von Cork sowie seine grundlegenden Akkordsymbole. Schließlich arbeitet er mit Farbe, um Passagen zu kennzeichnen, die nach Moll wechseln oder solche, in denen es zu erhöhter oder gar besonders erhöhter harmonischer Spannung kommt. Die “bricks” haben klar definierte Namen, etwa “Hover”, wenn sich die zugrunde liegende Harmonie über mehr als einen Takt erstreckt, “Dropback” für eine Kadenz von einem Dominantseptakkord zur Tonika etc., aber auch “Night and Day Cadence” für einer Drei-Akkord-Folge oder “Rainy Cadence” oder “Yardbird Cadence” für Akkordfolgen, wie sie in den gleichnamigen Titeln zu finden sind. Es gibt spezielle Namen für Turnarounds, für längere Akkordfolgen sowie für zwölf Verbindungspassagen, die quasi die zwölf möglichen Intervallpassagen kennzeichnen. Ein Ratschlag, den Elliott zu Beginn mitgibt, entnimmt er dem Studienhandbuch der Manhattan School of Music: “12 tunes say it all”: Man müsse nicht Hunderte Stücke auswendig kennen, sondern sei schon mal ganz gut bedient, wenn man zwölf Stücke kennen würde, die jede Menge an Grundstruktur und an harmonischen Phrasen enthalten, die auch in anderen Stücken immer wieder auftauchen. Elliott ergänzt die Liste um den Blues und hat damit 13 “beispielhafte” Titel, mit denen der Leser/Musiker anfangen könne: den Blues, “I’ve Got Rhythm”, “Cherokee”, “Sweet Georgia Brown”, “Indiana”, “How High the Moon”, “Out of Nowhere”, “Perdido”, “Honeysuckle Rose”, “Whispering”, “All the Things You Are”, “Night and Day” sowie “Lover”. Er beschreibt die am meisten üblichen Bausteine und gibt Tipps, wo man sein Pensum beginnen und wie man es fortsetzen könne. In “Insights in Jazz” führt Elliott einige neue Bausteine ein, etwa für spezielle Substitutakkorde oder Kadenzen. Er analysiert Titel, deren Schluss sich dem Schluss aus “Pennies from Heaven” bedient, besondere Kadenzen, etwa die “Rainbow”-Kadenz, die allerdings in “Over the Rainbow” gar nicht zu finden sei, sondern nur in Corks Analyse des Stücks. Ein Vorteil der Baustein-Methode sei, dass man auch dann leicht wieder in die Struktur eines Stücks hereinfinde, wenn man sich kurzzeitig musikalisch verlaufen habe, meint Elliott. Der erklärende Teil des Buchs umfasst knapp 60 Seiten, dann folgen die Anhänge, die die Theorie für den Musiker umsetzbar machen sollen: eine Übersicht über die verschiedenen “bricks”, “turnarounds” und “metabricks”, sowie die “Straßenkarte” zu über 200 Songs, einschließlich der meisten der 180 Standards, die von der Manhattan School of Music als Pflichtstücke vorausgesetzt werden, die man also während eines sechsjährigen Studiums lernen müsse. Melodien enthalten diese Übersichten nicht, aus Urheberrechtsgründen, wie Elliott anmerkt, aber auch, weil man Melodien seiner Meinung nach am besten von Platten abhören und lernen solle anstatt nach Noten. Es folgen 238 “Roadmaps” von “A Train” bis “Yours Is My Heart Alone”.
John Elliott, Jazzpianist und -lehrer aus Edinburgh, fasst sein Buch im Vorwort in einer Grafik zusammen: Er hat den gesamten Text in “wordle.-net” eingegeben, eine Website, die die Häufigkeit von im Text auftauchenden Worten analysiert und in eine Grafik umwandelt, in der besonders oft benutzte Worte größer und herausgehobener dargestellt werden als weniger oft benutzte Worte. “Cadence”, “Chord” und das Akkordsymbol “C∆” sind demnach die wichtigsten Wörter des Buchs, gefolgt von “Love”, “songs”, “chords”, “bridge”. “Love” fällt heraus; es taucht so oft auf, weil viele der Songs, die Elliott für sein Buch analysiert, nun mal “Love” im Titel führen. Elliott stellt in seinem Buch eine Methode auf, die Musikern helfen soll, die harmonische Struktur von Jazzstücken im Gedächtnis zu behalten. “Insights in Jazz” ist also keine neue Improvisationslehre, kein neues Harmonielehrebuch, sondern bietet eine Analyse ausgewählter Standards, die es Musikern und Musikstudenten leichter machen soll, diese zu memorieren. Sie baut auf Conrad Corks “New Guide to Harmony with LEGO Bricks” auf, einem Lehrbuch, das seit 1985 in mehreren Auflagen veröffentlicht wurde. Cork fasste oft vorkommende Akkordprogressionen in “bricks”, also Bausteinen, zusammen und definierte darüber hinaus eine Reihe an Verbindungspassagen (“joins”) zwischen solchen Bausteinen. Elliott ergänzt, er sei der Überzeugung, dass sich Standards am besten lernen ließen, wenn man sie grafisch darstelle. Harmoniesymboltechnisch hält er sich weitgehend zurück, beschränkt sich auf grundlegende Harmoniesymbole. Ansonsten präsentiert er die ausgesuchten Standards in einer Grafik, in der die formale Struktur angegeben ist, darin die Bausteine und Verbindungsstücke gemäß dem Lehrbuch von Cork sowie seine grundlegenden Akkordsymbole. Schließlich arbeitet er mit Farbe, um Passagen zu kennzeichnen, die nach Moll wechseln oder solche, in denen es zu erhöhter oder gar besonders erhöhter harmonischer Spannung kommt. Die “bricks” haben klar definierte Namen, etwa “Hover”, wenn sich die zugrunde liegende Harmonie über mehr als einen Takt erstreckt, “Dropback” für eine Kadenz von einem Dominantseptakkord zur Tonika etc., aber auch “Night and Day Cadence” für einer Drei-Akkord-Folge oder “Rainy Cadence” oder “Yardbird Cadence” für Akkordfolgen, wie sie in den gleichnamigen Titeln zu finden sind. Es gibt spezielle Namen für Turnarounds, für längere Akkordfolgen sowie für zwölf Verbindungspassagen, die quasi die zwölf möglichen Intervallpassagen kennzeichnen. Ein Ratschlag, den Elliott zu Beginn mitgibt, entnimmt er dem Studienhandbuch der Manhattan School of Music: “12 tunes say it all”: Man müsse nicht Hunderte Stücke auswendig kennen, sondern sei schon mal ganz gut bedient, wenn man zwölf Stücke kennen würde, die jede Menge an Grundstruktur und an harmonischen Phrasen enthalten, die auch in anderen Stücken immer wieder auftauchen. Elliott ergänzt die Liste um den Blues und hat damit 13 “beispielhafte” Titel, mit denen der Leser/Musiker anfangen könne: den Blues, “I’ve Got Rhythm”, “Cherokee”, “Sweet Georgia Brown”, “Indiana”, “How High the Moon”, “Out of Nowhere”, “Perdido”, “Honeysuckle Rose”, “Whispering”, “All the Things You Are”, “Night and Day” sowie “Lover”. Er beschreibt die am meisten üblichen Bausteine und gibt Tipps, wo man sein Pensum beginnen und wie man es fortsetzen könne. In “Insights in Jazz” führt Elliott einige neue Bausteine ein, etwa für spezielle Substitutakkorde oder Kadenzen. Er analysiert Titel, deren Schluss sich dem Schluss aus “Pennies from Heaven” bedient, besondere Kadenzen, etwa die “Rainbow”-Kadenz, die allerdings in “Over the Rainbow” gar nicht zu finden sei, sondern nur in Corks Analyse des Stücks. Ein Vorteil der Baustein-Methode sei, dass man auch dann leicht wieder in die Struktur eines Stücks hereinfinde, wenn man sich kurzzeitig musikalisch verlaufen habe, meint Elliott. Der erklärende Teil des Buchs umfasst knapp 60 Seiten, dann folgen die Anhänge, die die Theorie für den Musiker umsetzbar machen sollen: eine Übersicht über die verschiedenen “bricks”, “turnarounds” und “metabricks”, sowie die “Straßenkarte” zu über 200 Songs, einschließlich der meisten der 180 Standards, die von der Manhattan School of Music als Pflichtstücke vorausgesetzt werden, die man also während eines sechsjährigen Studiums lernen müsse. Melodien enthalten diese Übersichten nicht, aus Urheberrechtsgründen, wie Elliott anmerkt, aber auch, weil man Melodien seiner Meinung nach am besten von Platten abhören und lernen solle anstatt nach Noten. Es folgen 238 “Roadmaps” von “A Train” bis “Yours Is My Heart Alone”.
Ob das alles dem Musikstudenten oder Amateurmusiker (an beide richtet sich dieses Buch wohl vor allem) wirklich hilft, muss jedem selbst überlassen bleiben. Fürs Memorieren von Stücken gibt es schließlich von Musiker zu Musiker unterschiedliche Strategien. Elliotts auf dem “Brick”-System Corks aufbauendes System ist sicher eine hilfreiche Ergänzung und kann dem einen oder anderen Musiker damit helfen, sein Repertoire zu erweitern. Das Buch ist als Printversion über den Verlag Jazzwise zu beziehen oder aber direkt beim Autoren als personalisierte pdf-Version.
Link: Insights in Jazz.
Wolfram Knauer (Juli 2010)
Flow, Gesture, and Spaces in Free Jazz. Towards a Theory of Collaboration
von Guerino Mazzola & Paul B. Cherlin
Berlin 2009 (Springer)
141 Seiten, 53,45 Euro
ISBN: 978-3-540-92194-3
Es sei der Jazzforschung bislang nur unangemessen gelungen, die unterschiedlichen Aspekte des Free Jazz zu analysieren, merkt G uerino Mazzola im Vorwort seines Buches, das in der Reihe “Computational Music Science” erschien, und erklärt, dass er damit nicht einfach nur die komplexen Improvisationsmechanismen meine, sondern auch die dahinter liegende kulturelle Bedeutung dieser Musik. Sein Buch entstand aus einem Seminar an der University of Minnesota heraus, und das merkt man auch der Kapitelaufteilung des Buchs an, das sich ein wenig wie das Curriculum eines Semesters liest. Er und seine Mitautoren (zum Teil Studenten des Seminars, zum Teil mit dem auch als Pianist aktiven Mazzola assoziierte Musiker) beginnen mit grundlegenden Definitionen über die gesellschaftlichen, politischen und musikalischen Ursprünge der Free-Jazz-Bewegung. Mazzola untersucht ausgewählte Dokumente – Artikel, Interviews, Konzertmitschnitte –, um aus ihnen die Diskurse der 1960er Jahre herauszuarbeiten, wobei er sowohl auf Dokumente aus den USA wie aus Deutschland zurückgreift (letzteres in einer legendären Fernsehsendung von 1967, bei der Klaus Doldingers Quartett auf Peter Brötzmanns Trio traf), die unterschiedlichen Bedingungen für die Entstehung des Free Jazz in den USA und in Europa (Deutschland) allerdings weder hier noch später im Buch thematisiert. Im zweiten Kapitel (man fühlt sich versucht zu sagen, “In der zweiten Woche”) behandelt er vier Beispiele: Archie Shepps “Donaueschingen”, John Coltranes “Love Supreme”, Cecil Taylors “Candid Recordings”; und Bill Evans’ “Autumn Leaves” – letzteres ein Beispiel für die Ausweitung konventioneller Rahmenstrukturen des Jazz und die Entwicklung neuer Vokabeln im Jazzidiom, die Mazzola als musikalische “Gesten” bezeichnet. In weiteren Beispielen (etwa von Sun Ra oder dem Art Ensemble of Chicago), fragt er nach den Formen der musikalischen Kommunikation, der gestischen Interaktion und der daraus entstehenden “collective vibration”. Hier nun wird es philosophisch, wenn er “collaboratorive spaces” postuliert, die sich aus dem Flow der Interaktion und der gestischen Kommunikation ergäben. Im Free Jazz veranschaulicht er dies anhand Ornette Colemans Album “Free Jazz” sowie John Coltranes “Ascension”. Er spricht über die Faszination von “Time” und den Umgang von Free-Jazz-Musikern mit ihr sowie über die musikalische Geste als probates Mittel der musikalischen Entwicklung und als einer der wichtigsten Einflüsse auf die Wirkung der Musik beim Zuhörer. Und schließlich untersucht er die Bedeutung des Flow für das Entstehen oder besser für das Resultat einer intensiven Gruppendynamik. In einem Schlusskapitel propagiert Mazzola eine Zukunft für den Free Jazz, wobei er noch einmal klar macht, dass er diesen offenbar als ein recht klar umgrenztes Genre innerhalb der Jazzentwicklung zu begreifen scheint, und nicht als eine historische Etappe, und sagt dieser Stilrichtung eine Zukunft selbst in akademischer Umgebung voraus – vielleicht weil sich der Free Jazz, wie das Seminar, aus dem dieses Buch entstand, zeigt, mit interessanten Fragestellungen untersuchen lässt. Dem Buch hängt eine CD mit Improvisationen des Quartetts Tetrade bei, dem Mazzola (Klavier, Jeff Kaiser (Trompete), der kürzlich verstorbene Sirone (Bass) und Heinz Geissler (Schlagzeug) angehören.
uerino Mazzola im Vorwort seines Buches, das in der Reihe “Computational Music Science” erschien, und erklärt, dass er damit nicht einfach nur die komplexen Improvisationsmechanismen meine, sondern auch die dahinter liegende kulturelle Bedeutung dieser Musik. Sein Buch entstand aus einem Seminar an der University of Minnesota heraus, und das merkt man auch der Kapitelaufteilung des Buchs an, das sich ein wenig wie das Curriculum eines Semesters liest. Er und seine Mitautoren (zum Teil Studenten des Seminars, zum Teil mit dem auch als Pianist aktiven Mazzola assoziierte Musiker) beginnen mit grundlegenden Definitionen über die gesellschaftlichen, politischen und musikalischen Ursprünge der Free-Jazz-Bewegung. Mazzola untersucht ausgewählte Dokumente – Artikel, Interviews, Konzertmitschnitte –, um aus ihnen die Diskurse der 1960er Jahre herauszuarbeiten, wobei er sowohl auf Dokumente aus den USA wie aus Deutschland zurückgreift (letzteres in einer legendären Fernsehsendung von 1967, bei der Klaus Doldingers Quartett auf Peter Brötzmanns Trio traf), die unterschiedlichen Bedingungen für die Entstehung des Free Jazz in den USA und in Europa (Deutschland) allerdings weder hier noch später im Buch thematisiert. Im zweiten Kapitel (man fühlt sich versucht zu sagen, “In der zweiten Woche”) behandelt er vier Beispiele: Archie Shepps “Donaueschingen”, John Coltranes “Love Supreme”, Cecil Taylors “Candid Recordings”; und Bill Evans’ “Autumn Leaves” – letzteres ein Beispiel für die Ausweitung konventioneller Rahmenstrukturen des Jazz und die Entwicklung neuer Vokabeln im Jazzidiom, die Mazzola als musikalische “Gesten” bezeichnet. In weiteren Beispielen (etwa von Sun Ra oder dem Art Ensemble of Chicago), fragt er nach den Formen der musikalischen Kommunikation, der gestischen Interaktion und der daraus entstehenden “collective vibration”. Hier nun wird es philosophisch, wenn er “collaboratorive spaces” postuliert, die sich aus dem Flow der Interaktion und der gestischen Kommunikation ergäben. Im Free Jazz veranschaulicht er dies anhand Ornette Colemans Album “Free Jazz” sowie John Coltranes “Ascension”. Er spricht über die Faszination von “Time” und den Umgang von Free-Jazz-Musikern mit ihr sowie über die musikalische Geste als probates Mittel der musikalischen Entwicklung und als einer der wichtigsten Einflüsse auf die Wirkung der Musik beim Zuhörer. Und schließlich untersucht er die Bedeutung des Flow für das Entstehen oder besser für das Resultat einer intensiven Gruppendynamik. In einem Schlusskapitel propagiert Mazzola eine Zukunft für den Free Jazz, wobei er noch einmal klar macht, dass er diesen offenbar als ein recht klar umgrenztes Genre innerhalb der Jazzentwicklung zu begreifen scheint, und nicht als eine historische Etappe, und sagt dieser Stilrichtung eine Zukunft selbst in akademischer Umgebung voraus – vielleicht weil sich der Free Jazz, wie das Seminar, aus dem dieses Buch entstand, zeigt, mit interessanten Fragestellungen untersuchen lässt. Dem Buch hängt eine CD mit Improvisationen des Quartetts Tetrade bei, dem Mazzola (Klavier, Jeff Kaiser (Trompete), der kürzlich verstorbene Sirone (Bass) und Heinz Geissler (Schlagzeug) angehören.
(Wolfram Knauer, Juni 2010)
Il chitarrista di jazz. Charlie Christian e dintorni
Von Roberto G. Colombo
Genova 2009 (Erga Edizioni)
367 Seiten, 1 beiheftende CD, 25 Euro
ISBN: 978-88-8163-472-4
 Charlie Christian war einer der wichtigsten Gitarristen der Jazzgeschichte, weil er sein Instrument aus der reinen Begleitfunktion herauslöste und mit Melodieinstrumenten wie Saxophon oder Trompete auf eine Stufe stellte. Nur Django Reinhardt mag ähnlich einflussreich gewesen sein. Roberto G. Colombo hat nun ein Buch vorgelegt, in dem er dem Stil Charlie Christians auf die Spur kommen möchte, noch mehr aber dessen Einfluss auf andere Gitarristen des modernen Jazz. Eine analytische Beschreibung des Stils seines Helden mitsamt einzelner Transkriptionen findet sich seltsamerweise erst im letzten Kapitel, in dem Colombo Christians melodische, harmonische und rhythmische Sprache etwas näher untersucht. Der Hauptteil seines Buchs bezieht sich vor allem auf den Einfluss, den Christian etwa auf Musiker wie Barney Kessel und Tal Farlow, Jim Raney und Jim Hall, Kenny Burrell und Wes Montgomery und andere hatte, wobei er die hier genannten bewusst in Opposition zueinander bringt, um die unterschiedlichen stilistischen Wege herauszuarbeiten, die sie gegangen sind. Der gemeinsame Nenner, so Colombo, sei Charlie Christian gewesen, dessen Einfluss neben Django Reinhardts auch in Europa deutlich spürbar gewesen sei. In einem eigenen Kapitel über die elektrische Gitarre beschreibt er die Geschichte der elektrischen Verstärkung des Instruments und geht daneben auf andere frühe Vertreter der E-Gitarre ein, etwa die Hot String Bands des Western Swing jener Jahre oder den Posaunisten und Gitarristen Eddie Durham, die alle ihren eigenen Nachhall in Charlie Christians Spiel fanden. Das Buch bleibt eine eher trockene Lektüre, eine beiheftende CD enthält 42 Track Charlie Christians mit Benny Goodman genauso wie in diversen Jam Session-Zusammenhängen, in denen seine Nähe zum Bebop besonders gut zur Geltung kommt.
Charlie Christian war einer der wichtigsten Gitarristen der Jazzgeschichte, weil er sein Instrument aus der reinen Begleitfunktion herauslöste und mit Melodieinstrumenten wie Saxophon oder Trompete auf eine Stufe stellte. Nur Django Reinhardt mag ähnlich einflussreich gewesen sein. Roberto G. Colombo hat nun ein Buch vorgelegt, in dem er dem Stil Charlie Christians auf die Spur kommen möchte, noch mehr aber dessen Einfluss auf andere Gitarristen des modernen Jazz. Eine analytische Beschreibung des Stils seines Helden mitsamt einzelner Transkriptionen findet sich seltsamerweise erst im letzten Kapitel, in dem Colombo Christians melodische, harmonische und rhythmische Sprache etwas näher untersucht. Der Hauptteil seines Buchs bezieht sich vor allem auf den Einfluss, den Christian etwa auf Musiker wie Barney Kessel und Tal Farlow, Jim Raney und Jim Hall, Kenny Burrell und Wes Montgomery und andere hatte, wobei er die hier genannten bewusst in Opposition zueinander bringt, um die unterschiedlichen stilistischen Wege herauszuarbeiten, die sie gegangen sind. Der gemeinsame Nenner, so Colombo, sei Charlie Christian gewesen, dessen Einfluss neben Django Reinhardts auch in Europa deutlich spürbar gewesen sei. In einem eigenen Kapitel über die elektrische Gitarre beschreibt er die Geschichte der elektrischen Verstärkung des Instruments und geht daneben auf andere frühe Vertreter der E-Gitarre ein, etwa die Hot String Bands des Western Swing jener Jahre oder den Posaunisten und Gitarristen Eddie Durham, die alle ihren eigenen Nachhall in Charlie Christians Spiel fanden. Das Buch bleibt eine eher trockene Lektüre, eine beiheftende CD enthält 42 Track Charlie Christians mit Benny Goodman genauso wie in diversen Jam Session-Zusammenhängen, in denen seine Nähe zum Bebop besonders gut zur Geltung kommt.
Wolfram Knauer (Mai 2010)
All That Swedish Jazz. Zwölf schwedische Jazzstars erobern die Welt
von Lisbeth Axelsson
Bad Oeynhausen 2009 (jazzprezzo)
223 Seiten, 1 beiheftende CD, 35,00 Euro
ISBN: 978-3-9810250-9-5
 Hilfe die Schweden kommen! Oder die Norweger, die Dänen, die Finnen… Skandinavier jedenfalls, meint man, machen einen Großteil des Hypes, des Erfolgs des europäischen Jazz in den letzten Jahren aus. Nun, auf jeden Fall haben sie eine exzellente Musikerziehung von klein auf und bringen so hervorragende Musiker hervor, und auf jeden Fall verstehen sie sich aufs Marketing. Und so blättert es sich in diesem Buch, das im Original in schwedischer Sprache im Stockholmer Votum-Verlag erschienen ist, ein wenig wie im Katalog eines international sich erfolgreich vermarktenden Möbelhauses: bunt, lebendig, witzig. Lisbeth Axelsson hat für ihre Portraits von zwölf durchwegs jungen Musikerinnen und Musikern Fotos gesammelt, die diese nicht nur als Musiker, sondern auch als Privatmenschen zeigen: Viktoria Tolstoy etwa im Kreis ihrer Familie oder bei einem Treffen aller Tolstoy-Nachfahren (sie stammt ja bekanntlich tatsächlich aus der Familie des großen Schriftstellers), Lisen Rylander auf dem Segelboot, Magnus Coltrane Price mit Motorradhelm, Magnus Lindgren beim Wasserskifahren, Anders Öberg beim Joggen, Rigmor Gustafsson auf dem Fahrrad, Jon Fält beim Kücheputzen oder Karin Hammar im Fitnessstudio. Das Buch böte genügend Soff für eine Magisterarbeit darüber, wie die Musikerinnen und Musiker sich hier wohl darstellen wollen oder dargestellt worden, welche Inhalte allein die Ikonographie der Bilder vermittelt. Daneben stellt Lisbeth Axelsson biographische Texte, von O-Tönen durchzogen, Erinnerungen der Musiker darüber, wie sie zur Musik und wie zum Jazz kamen, was besonders herausfordernd ist am gewählten Beruf des Jazzmusikers und wo sie vielleicht noch hinwollen. Ach ja, die noch nicht genannten sind: Nils Landgren, Jan Lundgren, Peter Asplund und Martin Tingvall. Lesenswert ist das allemal, und, wie gesagt, ein Spaß machendes Bilderbuch außerdem. Der Verlag erkennt man kaum in Gestaltung und Papier – jazzprezzo macht sonst andere Bücher –: Dies ist deutlich eine Lizenzausgabe, bunt, gesund, frisch und … Lebst du noch, oder hörst du schon schwedischen Jazz?!
Hilfe die Schweden kommen! Oder die Norweger, die Dänen, die Finnen… Skandinavier jedenfalls, meint man, machen einen Großteil des Hypes, des Erfolgs des europäischen Jazz in den letzten Jahren aus. Nun, auf jeden Fall haben sie eine exzellente Musikerziehung von klein auf und bringen so hervorragende Musiker hervor, und auf jeden Fall verstehen sie sich aufs Marketing. Und so blättert es sich in diesem Buch, das im Original in schwedischer Sprache im Stockholmer Votum-Verlag erschienen ist, ein wenig wie im Katalog eines international sich erfolgreich vermarktenden Möbelhauses: bunt, lebendig, witzig. Lisbeth Axelsson hat für ihre Portraits von zwölf durchwegs jungen Musikerinnen und Musikern Fotos gesammelt, die diese nicht nur als Musiker, sondern auch als Privatmenschen zeigen: Viktoria Tolstoy etwa im Kreis ihrer Familie oder bei einem Treffen aller Tolstoy-Nachfahren (sie stammt ja bekanntlich tatsächlich aus der Familie des großen Schriftstellers), Lisen Rylander auf dem Segelboot, Magnus Coltrane Price mit Motorradhelm, Magnus Lindgren beim Wasserskifahren, Anders Öberg beim Joggen, Rigmor Gustafsson auf dem Fahrrad, Jon Fält beim Kücheputzen oder Karin Hammar im Fitnessstudio. Das Buch böte genügend Soff für eine Magisterarbeit darüber, wie die Musikerinnen und Musiker sich hier wohl darstellen wollen oder dargestellt worden, welche Inhalte allein die Ikonographie der Bilder vermittelt. Daneben stellt Lisbeth Axelsson biographische Texte, von O-Tönen durchzogen, Erinnerungen der Musiker darüber, wie sie zur Musik und wie zum Jazz kamen, was besonders herausfordernd ist am gewählten Beruf des Jazzmusikers und wo sie vielleicht noch hinwollen. Ach ja, die noch nicht genannten sind: Nils Landgren, Jan Lundgren, Peter Asplund und Martin Tingvall. Lesenswert ist das allemal, und, wie gesagt, ein Spaß machendes Bilderbuch außerdem. Der Verlag erkennt man kaum in Gestaltung und Papier – jazzprezzo macht sonst andere Bücher –: Dies ist deutlich eine Lizenzausgabe, bunt, gesund, frisch und … Lebst du noch, oder hörst du schon schwedischen Jazz?!
(Wolfram Knauer)
W.C. Handy. The Life and Times of the Man Who Made the Blues
von David Robertson
New York 2009 (Alfred A. Knopf)
286 Seiten, 27,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-307-26609-5
 W.C. Handy wurde als der Mann gefeiert, der den Blues erfunden habe, als “Father of the Blues”. Natürlich hat er das nicht getan – aber er hatte große Ohren, er hörte, was um ihn herum gesungen und gespielt wurde, er entwickelte ein Gespür für den populären Musikmarkt und er schrieb (oder kompilierte) einige der erfolgreichsten Blueskompositionen vor 1920. Er ist einer der großen Helden afro-amerikanischer Kulturgeschichte, ein Denkmal zu Lebzeiten, und bis heute präsent in den Titeln aus seiner Feder, den “St. Louis Blues”, “Beale Street Blues”, “Memphis Blues” und anderer Stücke, die weit über das Genre hinaus wirkten. David Robertson macht sich in seinem Buch auf die Suche nach dem Menschen William Christopher Handy und nach dem Umfeld, aus dem heraus er seiner Arbeit nachging. Er beschreibt ihn als Geschäftsmann, der sich nach Respekt von schwarzer wie weißer Seite sehnt, sein Geld aber im Vermarkten einer Musik verdient, die sich bewusst auf schwarze Roots stützt, der also quasi die “beiden Seelen” personifizierte, von denen W.E.B. Du Bois in seinem Buch “The Souls of Black Folk” schrieb. Handy wurde 1873 in einer Kleinstadt in Alabama geboren, acht Jahre nach der Emanzipation der schwarzen Sklaven. Sein Vater war Farmer und Pastor der lokalen AME Church. In der Schule erhielt er Musikunterricht, aber im richtigen Leben lernte er die wirkliche Musik kennen. Jim Turner, ein oft betrunkener Fiedler, machte ihn mit der Folk-Tradition der Gegend vertraut, Prototypen des späteren Blues. Er lernte heimlich Kornett, was von der Familie nicht gern gesehen wurde, die Musik, wenn überhaupt, nur in der Kirche duldete, und begann nach seinem High-School-Abschluss als Schulassistent im schwarzen Schulsystem seines County. 1892 machte er sich auf nach Chicago, wo damals die Weltausstellung stattfand und verdiente sich mit Freunden in einem Barbershop-Gesangsquartett ein wenig Geld. Im darauf folgenden Jahr zog er erst nach St. Louis, dann in andere Kleinstädte, schlug sich erst mit gelegentlichen Jobs, dann immerhin hauptberuflich mit Musik durch, als er in Evansville, Indiana, eine Brassband gründete. Von 1896 bis 1900 reiste er mit einer Minstrel-Show durch die Lande, und Robertson berichtet über einige der Szenen in der Show, in der sich weiße Schauspieler ihre Gesicht schwarz anmalten und sich über das Alltagsleben in der amerikanischen Provinz lustig machten. Aus heutiger Sicht war das alles eine herabwürdigende, rassistisch anmutende Show, an der sich schwarze Musiker gezwungenermaßen beteiligen mussten, um Geld zu verdienen. Daneben aber lernte Handy hier das Handwerkszeug für sein späteres Geschäft: Er lernte, was beim Publikum ankam, und wie man die Bedürfnisse eines ganz unterschiedlichen Publikums befriedigen konnte. 1900 spielte Handy ein Konzert im State Agricultural and Mechanical College for Negroes in Normal, Alabama, einer Reformschule im Sinne Booker T. Washingtons, und der Schulleiter engagierte ihn als Lehrer für Englisch und Musik. Als Handy in einem Schulkonzert Ragtimes und andere Titel spielte, die vielleicht eher in eine Minstrelshow gepasst hätten, bat man ihn, sich einen anderen Job zu suchen. Er ging wieder auf Minstrel-Tournee, und ließ sich dann in Clarksdale, Mississippi nieder, wo ihm ein Posten als Bandleader angeboten wurde. Diese Zeit war wohl besonders wichtig für Handy, den Melodiensammler, der sich die Musik der Farmarbeiter anhörte und viel davon in seinen späteren Kompositionen verwendete. 1905 zog er nach Memphis, spielte auf den Riverboats des Mississippi und schrieb sein erstes eigenes Stück, “Mr. Crump” (später “The Memphis Blues”). Dessen Copyright verkaufte er da noch für 50 Dollar; wenige Jahre später gründete er, klug geworden, zusammen mit Harry H. Pace den Musikverlag Pace & Handy. Robertson zeichnet den geschäftlichen Erfolg des Verlags nach und damit auch die erfolgreichen Kompositionen, die Handy in jenen Jahren veröffentlichte. 1917 hatte Handy ein Büro in Chicago eröffnet, aber tatsächlich zog es ihn nach New York, die Hauptstadt der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Als Musikverlag musste man ein Büro in New York haben, wo das Publikum in Musicals oder den Revuebühnen über Erfolg und Misserfolg der aktuellen Hits entschied. In seinem Büro trafen sich Bert Williams und Clarence Williams, Wilbur Sweatman und andere Größen des afro-amerikanischen Showbusiness. In den 1920er Jahren kam zum einträglichen Notengeschäft zusätzlich das neue Geschäft mit Schallplatten, Harry Pace entschied sich 1921, seinen eigenen Plattenverlag aufzumachen, und etliche der bislang bei beiden unter Vertrag stehenden Künstlern, darunter auch Fletcher Henderson, folgten ihm, statt bei Handy zu bleiben. Der wirkte auf die jungen Musiker inzwischen altbacken, unmodern; das Geschäft ging schlecht, und er profitierte kaum vom Boom schwarzer Musik in den frühen 1920er Jahren. 1924 traf er auf den Wall-Street-Anwalt Abbe Niles, der Handys und andere Blueskompositionen der Zeit liebte und an einem Artikel über den Blues arbeitete. Niles stand hinter dem Buchprojekt “Blues. An Anthology”, das 1926 erschien und Handy endgültig als “Father of the Blues” etablierte. Handy hatte noch weitere Ambitionen. Er, dessen Weg durch die Ideale sowohl Booker T. Washingtons wie auch W.E.B. Du Bois geprägt war, wollte eine veritable Kunstmusik schaffen, eine afro-amerikanische Symphonie. George Gershwin hatte ihm die Partitur seiner “Rhapsody in Blue” mit der Widmung versehen :”Für Mr. Handy, dessen frühe ‘Blue’ die Vorfahren für dieses Werk sind”. 1926 hörte Handy in der Aeolian Hall symphonische Arrangements über “St. Louis Blues” und “Beale Street Blues”; 1927 dirigierte er selbst George Antheils “Jazz Symphony” in der Carnegie Hall. In den 1930er Jahren wandte er sich in seiner Verlagsarbeit Negro Spirituals zu, trat ab und zu als Gast im Cotton Club auf (und spielte dort dann meist den “St. Louis Blues”) und veröffentlichte 1941 seine Autobiographie, “Father of the Blues”. 1943 hatte er einen folgenschweren Unfall, als er von der U-Bahn-Plattform stürzte und sich den Kopf verletzte. Danach war er blind, was ihn aber nicht davon abhielt, in der New Yorker Gesellschaft mitzumischen und sich, wo immer es ging, als Vater des Blues feiern zu lassen. 1956 wirkte er bei einem letzten öffentlichen Auftritt im Lewisohn Stadium in New York City mit, bei dem Leonard Bernstein ein Orchesterarrangement über den “St. Louis Blues” dirigierte. Zwei Jahre später starb W.C. Handy im Alter von 84 Jahren. Zur Trauerfeier kamen 150.000 Menschen, die die 138ste Straße in Harlem säumten, als Handys Sarg in die Abyssinian Baptist Church gebracht wurde. Robertsons Buch zeichnet Handys Lebensgeschichte mit allen Hochs und Tiefs nach, ist dabei, wie der Untertitel verspricht: eine Biographie mit Blick auf Leben und Zeit des W.C. Handy, nicht so sehr auf die Besonderheiten seiner Musik. Er erzählt die Ereignisse mit dem Blick für Einzelheiten (wenn er auch die immerhin nicht ganz unbedeutsame Identifikation zweier Personen auf einem Foto unterlässt, das Handy und seine zweite Frau zeigen, wie Handy unter dem Kichern und dem belustigten Grinsen von Dizzy Gillespie und Leonard Feather Dizzys gebogene Trompete befingert). Das Buch ist allemal eine lesenswerte Lektüre und gibt mit einem umfassenden Anmerkungsapparat die Möglichkeit zum weiteren Einstieg in die Erforschung beispielsweise des afro-amerikanischen Pubikationswesens im frühen 20sten Jahrhundert.
W.C. Handy wurde als der Mann gefeiert, der den Blues erfunden habe, als “Father of the Blues”. Natürlich hat er das nicht getan – aber er hatte große Ohren, er hörte, was um ihn herum gesungen und gespielt wurde, er entwickelte ein Gespür für den populären Musikmarkt und er schrieb (oder kompilierte) einige der erfolgreichsten Blueskompositionen vor 1920. Er ist einer der großen Helden afro-amerikanischer Kulturgeschichte, ein Denkmal zu Lebzeiten, und bis heute präsent in den Titeln aus seiner Feder, den “St. Louis Blues”, “Beale Street Blues”, “Memphis Blues” und anderer Stücke, die weit über das Genre hinaus wirkten. David Robertson macht sich in seinem Buch auf die Suche nach dem Menschen William Christopher Handy und nach dem Umfeld, aus dem heraus er seiner Arbeit nachging. Er beschreibt ihn als Geschäftsmann, der sich nach Respekt von schwarzer wie weißer Seite sehnt, sein Geld aber im Vermarkten einer Musik verdient, die sich bewusst auf schwarze Roots stützt, der also quasi die “beiden Seelen” personifizierte, von denen W.E.B. Du Bois in seinem Buch “The Souls of Black Folk” schrieb. Handy wurde 1873 in einer Kleinstadt in Alabama geboren, acht Jahre nach der Emanzipation der schwarzen Sklaven. Sein Vater war Farmer und Pastor der lokalen AME Church. In der Schule erhielt er Musikunterricht, aber im richtigen Leben lernte er die wirkliche Musik kennen. Jim Turner, ein oft betrunkener Fiedler, machte ihn mit der Folk-Tradition der Gegend vertraut, Prototypen des späteren Blues. Er lernte heimlich Kornett, was von der Familie nicht gern gesehen wurde, die Musik, wenn überhaupt, nur in der Kirche duldete, und begann nach seinem High-School-Abschluss als Schulassistent im schwarzen Schulsystem seines County. 1892 machte er sich auf nach Chicago, wo damals die Weltausstellung stattfand und verdiente sich mit Freunden in einem Barbershop-Gesangsquartett ein wenig Geld. Im darauf folgenden Jahr zog er erst nach St. Louis, dann in andere Kleinstädte, schlug sich erst mit gelegentlichen Jobs, dann immerhin hauptberuflich mit Musik durch, als er in Evansville, Indiana, eine Brassband gründete. Von 1896 bis 1900 reiste er mit einer Minstrel-Show durch die Lande, und Robertson berichtet über einige der Szenen in der Show, in der sich weiße Schauspieler ihre Gesicht schwarz anmalten und sich über das Alltagsleben in der amerikanischen Provinz lustig machten. Aus heutiger Sicht war das alles eine herabwürdigende, rassistisch anmutende Show, an der sich schwarze Musiker gezwungenermaßen beteiligen mussten, um Geld zu verdienen. Daneben aber lernte Handy hier das Handwerkszeug für sein späteres Geschäft: Er lernte, was beim Publikum ankam, und wie man die Bedürfnisse eines ganz unterschiedlichen Publikums befriedigen konnte. 1900 spielte Handy ein Konzert im State Agricultural and Mechanical College for Negroes in Normal, Alabama, einer Reformschule im Sinne Booker T. Washingtons, und der Schulleiter engagierte ihn als Lehrer für Englisch und Musik. Als Handy in einem Schulkonzert Ragtimes und andere Titel spielte, die vielleicht eher in eine Minstrelshow gepasst hätten, bat man ihn, sich einen anderen Job zu suchen. Er ging wieder auf Minstrel-Tournee, und ließ sich dann in Clarksdale, Mississippi nieder, wo ihm ein Posten als Bandleader angeboten wurde. Diese Zeit war wohl besonders wichtig für Handy, den Melodiensammler, der sich die Musik der Farmarbeiter anhörte und viel davon in seinen späteren Kompositionen verwendete. 1905 zog er nach Memphis, spielte auf den Riverboats des Mississippi und schrieb sein erstes eigenes Stück, “Mr. Crump” (später “The Memphis Blues”). Dessen Copyright verkaufte er da noch für 50 Dollar; wenige Jahre später gründete er, klug geworden, zusammen mit Harry H. Pace den Musikverlag Pace & Handy. Robertson zeichnet den geschäftlichen Erfolg des Verlags nach und damit auch die erfolgreichen Kompositionen, die Handy in jenen Jahren veröffentlichte. 1917 hatte Handy ein Büro in Chicago eröffnet, aber tatsächlich zog es ihn nach New York, die Hauptstadt der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Als Musikverlag musste man ein Büro in New York haben, wo das Publikum in Musicals oder den Revuebühnen über Erfolg und Misserfolg der aktuellen Hits entschied. In seinem Büro trafen sich Bert Williams und Clarence Williams, Wilbur Sweatman und andere Größen des afro-amerikanischen Showbusiness. In den 1920er Jahren kam zum einträglichen Notengeschäft zusätzlich das neue Geschäft mit Schallplatten, Harry Pace entschied sich 1921, seinen eigenen Plattenverlag aufzumachen, und etliche der bislang bei beiden unter Vertrag stehenden Künstlern, darunter auch Fletcher Henderson, folgten ihm, statt bei Handy zu bleiben. Der wirkte auf die jungen Musiker inzwischen altbacken, unmodern; das Geschäft ging schlecht, und er profitierte kaum vom Boom schwarzer Musik in den frühen 1920er Jahren. 1924 traf er auf den Wall-Street-Anwalt Abbe Niles, der Handys und andere Blueskompositionen der Zeit liebte und an einem Artikel über den Blues arbeitete. Niles stand hinter dem Buchprojekt “Blues. An Anthology”, das 1926 erschien und Handy endgültig als “Father of the Blues” etablierte. Handy hatte noch weitere Ambitionen. Er, dessen Weg durch die Ideale sowohl Booker T. Washingtons wie auch W.E.B. Du Bois geprägt war, wollte eine veritable Kunstmusik schaffen, eine afro-amerikanische Symphonie. George Gershwin hatte ihm die Partitur seiner “Rhapsody in Blue” mit der Widmung versehen :”Für Mr. Handy, dessen frühe ‘Blue’ die Vorfahren für dieses Werk sind”. 1926 hörte Handy in der Aeolian Hall symphonische Arrangements über “St. Louis Blues” und “Beale Street Blues”; 1927 dirigierte er selbst George Antheils “Jazz Symphony” in der Carnegie Hall. In den 1930er Jahren wandte er sich in seiner Verlagsarbeit Negro Spirituals zu, trat ab und zu als Gast im Cotton Club auf (und spielte dort dann meist den “St. Louis Blues”) und veröffentlichte 1941 seine Autobiographie, “Father of the Blues”. 1943 hatte er einen folgenschweren Unfall, als er von der U-Bahn-Plattform stürzte und sich den Kopf verletzte. Danach war er blind, was ihn aber nicht davon abhielt, in der New Yorker Gesellschaft mitzumischen und sich, wo immer es ging, als Vater des Blues feiern zu lassen. 1956 wirkte er bei einem letzten öffentlichen Auftritt im Lewisohn Stadium in New York City mit, bei dem Leonard Bernstein ein Orchesterarrangement über den “St. Louis Blues” dirigierte. Zwei Jahre später starb W.C. Handy im Alter von 84 Jahren. Zur Trauerfeier kamen 150.000 Menschen, die die 138ste Straße in Harlem säumten, als Handys Sarg in die Abyssinian Baptist Church gebracht wurde. Robertsons Buch zeichnet Handys Lebensgeschichte mit allen Hochs und Tiefs nach, ist dabei, wie der Untertitel verspricht: eine Biographie mit Blick auf Leben und Zeit des W.C. Handy, nicht so sehr auf die Besonderheiten seiner Musik. Er erzählt die Ereignisse mit dem Blick für Einzelheiten (wenn er auch die immerhin nicht ganz unbedeutsame Identifikation zweier Personen auf einem Foto unterlässt, das Handy und seine zweite Frau zeigen, wie Handy unter dem Kichern und dem belustigten Grinsen von Dizzy Gillespie und Leonard Feather Dizzys gebogene Trompete befingert). Das Buch ist allemal eine lesenswerte Lektüre und gibt mit einem umfassenden Anmerkungsapparat die Möglichkeit zum weiteren Einstieg in die Erforschung beispielsweise des afro-amerikanischen Pubikationswesens im frühen 20sten Jahrhundert.
Wolfram Knauer (Mai 2010)
Die unheimliche Maschine. Rasse und Repräsentation im Weimarer Kino
von Tobias Nagl
München 2009 (edition text + kritik)
827 Seiten, 49,00 Euro
ISBN: 798-3-88377-910-2
 In Jazzbüchern liest man oft vom Reiz des Exotischen, wenn von der Rezeption des frühen Jazz in Europa die Rede ist. Man verweist auf Bildende Künstler, Komponisten der klassischen Musiktradition und auch auf Schriftsteller, die afrikanischen oder asiatischen Einflüssen gegenüber offen standen, weil sie in ihnen Erweiterungsmöglichkeiten ihres eigenen künstlerischen Vokabulars sahen. Was dabei oft vergessen wird, ist ein differenzierter Blick darauf, wie Menschen anderer Hautfarbe tatsächlich in Europa wahrgenommen wurden und welche Mechanismen und/oder politischen Entwicklungen diese Wahrnehmung mit steuerten. Tobias Nagl stellt gleich in der Einleitung seines Buchs klar (und beruft such dabei auf Katrin Sieg): “Gerade die Extremität des wissenschaftlichen Rassismus in der deutschen Geschichte war es, die zusammen mit den widersprüchlichen Imperativen während der Demokratisierung des Landes den Diskurs um ‘Rasse’ und die Untersuchung seiner Nachwirkungen in offiziellen Kontexten tabuisierte.” Daher habe man es in Deutschland vorgezogen, mit Konzepten des “Anderen” oder auch des “Fremden” zu arbeiten, die allerdings seltsam unscharf blieben. Nagl arbeitet sich durch die Literatur zu Termini wie “Rasse” und “Rassismus”, stellt die relativ kurze koloniale Kultur Deutschlands und die postkoloniale Theorie gegenüber, und versteht seine eigene Arbeit, die Filmgeschichte, dabei als “Archäologie sozialer Praxis”. Dann arbeitet er sich anhand konkreter (Film-)Beispiele durch das wechselvolle Verhältnis der Deutschen zu Mitmenschen anderer Hautfarbe. Er thematisiert “Kolonialismus, Geschlecht und Rasse” im Film “Die Herrin der Welt” von 1919, den er in Verbindung zur Völkerschautradition jener Zeit setzt. Er referiert den Inhalt des Films sowie seine Rezeption in Deutschland und den missglückten Export des Films nach USA, berichtet aber auch über Rassismusproteste aus den Reihen des “Vereins chinesischer Studenten” in Berlin. Der Film “Die Schwarze Schmach” von 1921-23 dient Nagl zur Diskussion der Darstellung von Sexualität und der Reaktion von Zensur. Hier thematisiert er die Rheinlandbesetzung durch koloniale Regimenter der Franzosen nach dem Ersten Weltkrieg, die reichlich Stoff für eine rassistische deutsche Propaganda geliefert hatte, und vor dessen Hintergrund der Film zu sehen ist. Die Zensur kritisierte im Film genannte Fakten und Zahlen sah den Film als gefährliche rassistische Propaganda, die dazu führen könne, dass das deutsche Ansehen im Ausland Schaden nähme. Nagl zeigt Beispiele solcher Propaganda, etwa Briefverschlussmarken mit der Aufschrift “Versuchte Mutter m. Mischlingskind” oder mit der Abbildung dreier dürrer Kinder vor einem großen schwarzen Mann und der Aufschrift “Um einen Besatzungssoldaten zu ernähren müssen vier deutsche Kinder hungern!”. Weitere Kapitel befassen sich mit dem kolonialen Propagandafilm, mit Kulturfilmen über Afrika (Nebentitel “Kolonialrevisionismus und romantische Ethnografie” — hier geht es auch um das “Spektakel der Differenz”), mit dem Geschlechterverhältnis im kolonialen Spielfilm, dabei insbesondere schwarzen Frauenrollen im Weimarer Kino. Neben Menschen schwarzer Hautfarbe auf der Leinwand aber gab es auch eine schwarze deutsche Bevölkerung, gab es schwarze Schauspieler in Deutschland, denen Nagl ein eigenes Kapitel widmet. Er schildert den Alltag in der Filmbörse, in der koloniale Migranten sich als Komparsen fürs Kino bewarben. Ein Exkurs innerhalb dieses Kapitels zeichent die Karriere des Schauspielers Louis Brody in den 1920er genauso wie den 1930er Jahren nach, als er auch an Propagandafilmen des NS-Staats mitwirkte, etwa dem Film “Jud Süss” von 1940. Ein erster Jazzschwenk geschieht im kurzen Kapitel über den Schauspieler und Schlagzeuger Willy Allen, geboren als Wilhelm Panzer in Berlin, der im Film “Einbrecher” von 1930 mit Sidney Bechet zu sehen und hören ist. Das letzte Kapitel dann ist das Jazzforscher am direktesten ansprechende Kapitel, überschrieben “‘Afrika spricht!’ Modernismus, jazz und Minstrelsy”. Hier schildert Nagl den Erfolg schwarzer Revuen in der Folge der “Revue Nègre” mit Josephine Baker, Louis Douglas und der Claude Hopkins Band sowie der “Chocolate Kiddies Negro Revue” mit dem Orchester des Pianisten Sam Wooding. Beide Revue, schreibt Nagl, “boten keinen unvermittelten Ausdruck afroamerikanischer Kultur, sondern standen in der Tradition der bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Minstrel-Shows”, eine Aussage, die zumindest musikalisch in Frage zu stellen ist. Nagl beschreibt denunziatorische Attacken auf den Jazz als wilde und zu sexuellen Ausschweifungen einladende Musik, stellt aber auch fest, dass Jazz in deutschen Filmen eher eine geringe Rolle spielte. Afroamerikanische Musiker habe es in Deutschland zahlreich bereits seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts gegeben; und im Kaiserreich habe die Cakewalk-Mode auch Deutschland erfasst. “Die meisten Unterhaltungsmusiker, die in den unmittelbaren Nachkriegsjahren Jazz zu spielen versuchte, wussten jedoch nicht einmal genau, wie die Musik klang”, konstantiert Nagl und zeichnet dann die zunehmende Ernsthaftigkeit nach, mit der der Jazz rezipiert wurde, irgendwo zwischen Abscheu und exotischer Begeisterungswelle. Jazz spielte immerhin ab den Mitt-1920er Jahren eine größer werdende Rolle bei der Filmbegleitung, allerdings nicht in der “authentischen” Tradition des Hot-Jazz amerikanischer Prägung, sondern vor allem in der Tradition eines sinfonischen Jazz George Gershwins oder Paul Whitemans, wie er in Deutschland von Bands etwa um Bernard Etté oder Ernö Rapée gespielt wurde. Nagl beschreibt Josephine Bakers Siegeszug in Berlin und ihren Einfluss auf intellektuelle Verehrer und Schriftsteller. Anhand von Ernst Kreneks Jazz-Oper “Jonny spielt auf” thematisiert er die der Oper inheränte “Bedrohungsphantasie”: Ernst Krenek habe mit ihr alles andere als eine Verherrlichung des Jazz im Sinn gehabt. Im Jazzhass gehe es nicht nur um Musik und “rassische Invasion”, sondern auch um Ängste, die mit “Vorstellungen ausschweifender, transgressiver Sexualität” verbunden seien. Nagl verfolgt die Tiraden auf den Jazz von der Neuen Musik-Zeitung 1928 über Theodor W. Adorno bis zu Alfred Rosenberg und Wilhelm Fricks berüchtigtem Erlass ‘Wider die Negerkultur für deutsches Volkstum’. Er beschreibt die Rezeption einiger amerikanischer Filme mit afroamerikanischen Themen/Schauspielern sowie weitere Assoziationen, die mit Hilfe schwarzer Schauspieler transportiert werden sollten, etwa “moderne Exzentrik”. Schließlich wirft er noch einen Blick auf den Boxsport, in dem schwarze Athleten eine wichtige Rolle spielten, und seine Reflektion im Weimarer Kino. Und anhand des Tänzers Louis Douglas diskutiert er, wie die deutsche Linke mit dem Thema Hautfarbe / Rassismus umgeht. Nagls eindrucksvoll umfassendes Buch ist ein Standardwerk zur Rezeption afrikanischer wie afro-amerikanischer Kultur in Deutschland und erlaubt viele Erkenntnisse auch über die Bedingungen, in denen im Deutschland der 1920er und frühen 1930er Jahre Jazz gespielt und gehört wurde. Höchst empfehlenswert!
In Jazzbüchern liest man oft vom Reiz des Exotischen, wenn von der Rezeption des frühen Jazz in Europa die Rede ist. Man verweist auf Bildende Künstler, Komponisten der klassischen Musiktradition und auch auf Schriftsteller, die afrikanischen oder asiatischen Einflüssen gegenüber offen standen, weil sie in ihnen Erweiterungsmöglichkeiten ihres eigenen künstlerischen Vokabulars sahen. Was dabei oft vergessen wird, ist ein differenzierter Blick darauf, wie Menschen anderer Hautfarbe tatsächlich in Europa wahrgenommen wurden und welche Mechanismen und/oder politischen Entwicklungen diese Wahrnehmung mit steuerten. Tobias Nagl stellt gleich in der Einleitung seines Buchs klar (und beruft such dabei auf Katrin Sieg): “Gerade die Extremität des wissenschaftlichen Rassismus in der deutschen Geschichte war es, die zusammen mit den widersprüchlichen Imperativen während der Demokratisierung des Landes den Diskurs um ‘Rasse’ und die Untersuchung seiner Nachwirkungen in offiziellen Kontexten tabuisierte.” Daher habe man es in Deutschland vorgezogen, mit Konzepten des “Anderen” oder auch des “Fremden” zu arbeiten, die allerdings seltsam unscharf blieben. Nagl arbeitet sich durch die Literatur zu Termini wie “Rasse” und “Rassismus”, stellt die relativ kurze koloniale Kultur Deutschlands und die postkoloniale Theorie gegenüber, und versteht seine eigene Arbeit, die Filmgeschichte, dabei als “Archäologie sozialer Praxis”. Dann arbeitet er sich anhand konkreter (Film-)Beispiele durch das wechselvolle Verhältnis der Deutschen zu Mitmenschen anderer Hautfarbe. Er thematisiert “Kolonialismus, Geschlecht und Rasse” im Film “Die Herrin der Welt” von 1919, den er in Verbindung zur Völkerschautradition jener Zeit setzt. Er referiert den Inhalt des Films sowie seine Rezeption in Deutschland und den missglückten Export des Films nach USA, berichtet aber auch über Rassismusproteste aus den Reihen des “Vereins chinesischer Studenten” in Berlin. Der Film “Die Schwarze Schmach” von 1921-23 dient Nagl zur Diskussion der Darstellung von Sexualität und der Reaktion von Zensur. Hier thematisiert er die Rheinlandbesetzung durch koloniale Regimenter der Franzosen nach dem Ersten Weltkrieg, die reichlich Stoff für eine rassistische deutsche Propaganda geliefert hatte, und vor dessen Hintergrund der Film zu sehen ist. Die Zensur kritisierte im Film genannte Fakten und Zahlen sah den Film als gefährliche rassistische Propaganda, die dazu führen könne, dass das deutsche Ansehen im Ausland Schaden nähme. Nagl zeigt Beispiele solcher Propaganda, etwa Briefverschlussmarken mit der Aufschrift “Versuchte Mutter m. Mischlingskind” oder mit der Abbildung dreier dürrer Kinder vor einem großen schwarzen Mann und der Aufschrift “Um einen Besatzungssoldaten zu ernähren müssen vier deutsche Kinder hungern!”. Weitere Kapitel befassen sich mit dem kolonialen Propagandafilm, mit Kulturfilmen über Afrika (Nebentitel “Kolonialrevisionismus und romantische Ethnografie” — hier geht es auch um das “Spektakel der Differenz”), mit dem Geschlechterverhältnis im kolonialen Spielfilm, dabei insbesondere schwarzen Frauenrollen im Weimarer Kino. Neben Menschen schwarzer Hautfarbe auf der Leinwand aber gab es auch eine schwarze deutsche Bevölkerung, gab es schwarze Schauspieler in Deutschland, denen Nagl ein eigenes Kapitel widmet. Er schildert den Alltag in der Filmbörse, in der koloniale Migranten sich als Komparsen fürs Kino bewarben. Ein Exkurs innerhalb dieses Kapitels zeichent die Karriere des Schauspielers Louis Brody in den 1920er genauso wie den 1930er Jahren nach, als er auch an Propagandafilmen des NS-Staats mitwirkte, etwa dem Film “Jud Süss” von 1940. Ein erster Jazzschwenk geschieht im kurzen Kapitel über den Schauspieler und Schlagzeuger Willy Allen, geboren als Wilhelm Panzer in Berlin, der im Film “Einbrecher” von 1930 mit Sidney Bechet zu sehen und hören ist. Das letzte Kapitel dann ist das Jazzforscher am direktesten ansprechende Kapitel, überschrieben “‘Afrika spricht!’ Modernismus, jazz und Minstrelsy”. Hier schildert Nagl den Erfolg schwarzer Revuen in der Folge der “Revue Nègre” mit Josephine Baker, Louis Douglas und der Claude Hopkins Band sowie der “Chocolate Kiddies Negro Revue” mit dem Orchester des Pianisten Sam Wooding. Beide Revue, schreibt Nagl, “boten keinen unvermittelten Ausdruck afroamerikanischer Kultur, sondern standen in der Tradition der bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Minstrel-Shows”, eine Aussage, die zumindest musikalisch in Frage zu stellen ist. Nagl beschreibt denunziatorische Attacken auf den Jazz als wilde und zu sexuellen Ausschweifungen einladende Musik, stellt aber auch fest, dass Jazz in deutschen Filmen eher eine geringe Rolle spielte. Afroamerikanische Musiker habe es in Deutschland zahlreich bereits seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts gegeben; und im Kaiserreich habe die Cakewalk-Mode auch Deutschland erfasst. “Die meisten Unterhaltungsmusiker, die in den unmittelbaren Nachkriegsjahren Jazz zu spielen versuchte, wussten jedoch nicht einmal genau, wie die Musik klang”, konstantiert Nagl und zeichnet dann die zunehmende Ernsthaftigkeit nach, mit der der Jazz rezipiert wurde, irgendwo zwischen Abscheu und exotischer Begeisterungswelle. Jazz spielte immerhin ab den Mitt-1920er Jahren eine größer werdende Rolle bei der Filmbegleitung, allerdings nicht in der “authentischen” Tradition des Hot-Jazz amerikanischer Prägung, sondern vor allem in der Tradition eines sinfonischen Jazz George Gershwins oder Paul Whitemans, wie er in Deutschland von Bands etwa um Bernard Etté oder Ernö Rapée gespielt wurde. Nagl beschreibt Josephine Bakers Siegeszug in Berlin und ihren Einfluss auf intellektuelle Verehrer und Schriftsteller. Anhand von Ernst Kreneks Jazz-Oper “Jonny spielt auf” thematisiert er die der Oper inheränte “Bedrohungsphantasie”: Ernst Krenek habe mit ihr alles andere als eine Verherrlichung des Jazz im Sinn gehabt. Im Jazzhass gehe es nicht nur um Musik und “rassische Invasion”, sondern auch um Ängste, die mit “Vorstellungen ausschweifender, transgressiver Sexualität” verbunden seien. Nagl verfolgt die Tiraden auf den Jazz von der Neuen Musik-Zeitung 1928 über Theodor W. Adorno bis zu Alfred Rosenberg und Wilhelm Fricks berüchtigtem Erlass ‘Wider die Negerkultur für deutsches Volkstum’. Er beschreibt die Rezeption einiger amerikanischer Filme mit afroamerikanischen Themen/Schauspielern sowie weitere Assoziationen, die mit Hilfe schwarzer Schauspieler transportiert werden sollten, etwa “moderne Exzentrik”. Schließlich wirft er noch einen Blick auf den Boxsport, in dem schwarze Athleten eine wichtige Rolle spielten, und seine Reflektion im Weimarer Kino. Und anhand des Tänzers Louis Douglas diskutiert er, wie die deutsche Linke mit dem Thema Hautfarbe / Rassismus umgeht. Nagls eindrucksvoll umfassendes Buch ist ein Standardwerk zur Rezeption afrikanischer wie afro-amerikanischer Kultur in Deutschland und erlaubt viele Erkenntnisse auch über die Bedingungen, in denen im Deutschland der 1920er und frühen 1930er Jahre Jazz gespielt und gehört wurde. Höchst empfehlenswert!
(Wolfram Knauer, April 2010)
Musikszene Schweiz. Begegnungen mit Menschen und Orten
herausgegeben von Christoph Merki
Zürich 2009 (Chronos Verlag)
692 Seiten, 38 Euro
ISBN: 978-3-0340-0942-3
 “Musikszene Schweiz” will die Schweiz als Musikland darstellen, in seiner ganzen Fülle zwischen Volks-, Pop- und Kunstmusik, und auf sehr direktem Wege über Gespräche mit Musikmachern und -ermöglichern und Reportagen über Orte, an denen Musik stattfindet. Der Rundumschlag ist weit: Musical; Gregorianik; Mundart-Rap; volkstümliche Musik (wobei dieser Begriff hier offenbar anders als in Deutschland gebraucht wird, wo er mehr für die Schlagervariante der Volksmusikindustrie steht, während Franz-Xaver Nager, der sich in diesem Buch mit dem Thema beschäftigt, die ursprüngliche Volksmusik und ihre heutige Pflege meint); Oper; Worldmusic (bei der sich Marianne Berner in ihrem Bericht über Afropfingsten-Festival nicht die “Vorläufer” afrikanischer Musik in der Schweiz erwähnt, als das Land in den frühen 1960er Jahren Anlaufstelle für viele südafrikanische Musiker im Exil war); Internetsounds; Fußballgesänge; Alte Musik; “Jazz und anderes mehr” (über das Montreux Jazz Festival); Schlager; Punk; Filmmusik; Jodelgesang; Berner Mundartrock; Musiktherapie; Neue Musik; Blues; Operette; “Megarock und Pop”, Chorgesang; Free Jazz (ein Interview mit Patrik Landolf über das Unerhört-Festival in Zürich); “Die andere Musik” (über aktuelle alternative Musikformen); Gospel; Klassik am Lucerne Festival; Unterhaltungs- und Tanzmusik; “Jazz aus der Schweiz” (über das Schaffhauser Jazzfestival); Theatermusik; Rock/Pop bei Musicstar (über den gleichnamigen SF DRS-Sender); Reggae; Alpentöne; “Traditioneller Jazz” (über das Festival JazzAscona); Country Music; “Immigrantenmusik (Balkan)”; Blasmusik; Chanson und frankophone Musik; Techno; Orgelmusik; sowie “Musik der Kulturen der Welt”. Das Buch ist ein gelungener Überblick über ganz unterschiedliche Seiten eines bunten Musiklebens, eine Dokumentation des Status Quo einer Szene zwischen Tradition und Avantgarde, zwischen Etabliertheit und Suche nach dem eigenen Platz.
“Musikszene Schweiz” will die Schweiz als Musikland darstellen, in seiner ganzen Fülle zwischen Volks-, Pop- und Kunstmusik, und auf sehr direktem Wege über Gespräche mit Musikmachern und -ermöglichern und Reportagen über Orte, an denen Musik stattfindet. Der Rundumschlag ist weit: Musical; Gregorianik; Mundart-Rap; volkstümliche Musik (wobei dieser Begriff hier offenbar anders als in Deutschland gebraucht wird, wo er mehr für die Schlagervariante der Volksmusikindustrie steht, während Franz-Xaver Nager, der sich in diesem Buch mit dem Thema beschäftigt, die ursprüngliche Volksmusik und ihre heutige Pflege meint); Oper; Worldmusic (bei der sich Marianne Berner in ihrem Bericht über Afropfingsten-Festival nicht die “Vorläufer” afrikanischer Musik in der Schweiz erwähnt, als das Land in den frühen 1960er Jahren Anlaufstelle für viele südafrikanische Musiker im Exil war); Internetsounds; Fußballgesänge; Alte Musik; “Jazz und anderes mehr” (über das Montreux Jazz Festival); Schlager; Punk; Filmmusik; Jodelgesang; Berner Mundartrock; Musiktherapie; Neue Musik; Blues; Operette; “Megarock und Pop”, Chorgesang; Free Jazz (ein Interview mit Patrik Landolf über das Unerhört-Festival in Zürich); “Die andere Musik” (über aktuelle alternative Musikformen); Gospel; Klassik am Lucerne Festival; Unterhaltungs- und Tanzmusik; “Jazz aus der Schweiz” (über das Schaffhauser Jazzfestival); Theatermusik; Rock/Pop bei Musicstar (über den gleichnamigen SF DRS-Sender); Reggae; Alpentöne; “Traditioneller Jazz” (über das Festival JazzAscona); Country Music; “Immigrantenmusik (Balkan)”; Blasmusik; Chanson und frankophone Musik; Techno; Orgelmusik; sowie “Musik der Kulturen der Welt”. Das Buch ist ein gelungener Überblick über ganz unterschiedliche Seiten eines bunten Musiklebens, eine Dokumentation des Status Quo einer Szene zwischen Tradition und Avantgarde, zwischen Etabliertheit und Suche nach dem eigenen Platz.
(Wolfram Knauer, April 2010)
Swingingly yours Ilse Storb. Love and Peace
von Ute Büchter-Römer
Duisburg 2009 (NonEM Verlag)
112 Seiten + beigeheftete CD, 15,00 Euro
ISBN: 978-3-935744-09-6
 Ilse Storb war nie eine stille, sondern immer eine laute Kämpferin für den Jazz: als “Europas einzige Jazzprofessorin”, wie sie sich selbst gern bezeichnete, als Autorin mehrerer Sachbücher zum Jazz, als Gründerin des Jazzlabors an der Gesamthochschule, später Universität Duisburg, als Verfechterin eines musikalischen Dialogs der Kulturen, und als Workshopleiterin, die sich sicher war, dass man von Menschen anderer Herkunft viel lernen kann und die immer auf die Offenheit drängte, das “Fremde” als Einfluss auf sich wirken zu lassen. Ute Büchter-Römer hat aus den Daten und Fakten ihres Lebens eine Biographie zusammenstellt, in der der Weg von der klassischen Pianistin zur Jazzprofessorin allerdings nur halb so begeisternd nachvollzogen wird wie auf der beiheftenden CD, einer WDR5-Sendung aus dem Jahr 2002, in der die ganze Wucht der weit über die Jazzgrenzen bekannten Musikwissenschaftlerin zu spüren ist. Büchter-Römer rekapituliert die Lebensgeschichte, fasst die wichtigsten Veröffentlichungen Storbs zusammen, schreibt über Medienauftritte in Rundfunk wie Fernsehen (ja, auch über jene legendäre Stefan-Raab-Sendung), über Konzertreisen und Festivals, über Storbs Liebe zu zwei ihrer wichtigsten Sujets: der Musik von Louis Armstrong und Dave Brubeck. Die Biographie ist ein Geschenk zum 80sten Geburtstag; dementsprechend ist kritische Distanz weniger gefragt. Aber Ilse Storb ist eh, wie man schnell merkt, ein Gesamtkunstwerk, dem man in einem Buch allein kaum beikommt. Eine CD muss mindestens dabeiheften, besser noch hätte wahrscheinlich eine DVD dazugehört. Parallel erschien außerdem eine Festschrift (siehe den nächsten Beitrag).
Ilse Storb war nie eine stille, sondern immer eine laute Kämpferin für den Jazz: als “Europas einzige Jazzprofessorin”, wie sie sich selbst gern bezeichnete, als Autorin mehrerer Sachbücher zum Jazz, als Gründerin des Jazzlabors an der Gesamthochschule, später Universität Duisburg, als Verfechterin eines musikalischen Dialogs der Kulturen, und als Workshopleiterin, die sich sicher war, dass man von Menschen anderer Herkunft viel lernen kann und die immer auf die Offenheit drängte, das “Fremde” als Einfluss auf sich wirken zu lassen. Ute Büchter-Römer hat aus den Daten und Fakten ihres Lebens eine Biographie zusammenstellt, in der der Weg von der klassischen Pianistin zur Jazzprofessorin allerdings nur halb so begeisternd nachvollzogen wird wie auf der beiheftenden CD, einer WDR5-Sendung aus dem Jahr 2002, in der die ganze Wucht der weit über die Jazzgrenzen bekannten Musikwissenschaftlerin zu spüren ist. Büchter-Römer rekapituliert die Lebensgeschichte, fasst die wichtigsten Veröffentlichungen Storbs zusammen, schreibt über Medienauftritte in Rundfunk wie Fernsehen (ja, auch über jene legendäre Stefan-Raab-Sendung), über Konzertreisen und Festivals, über Storbs Liebe zu zwei ihrer wichtigsten Sujets: der Musik von Louis Armstrong und Dave Brubeck. Die Biographie ist ein Geschenk zum 80sten Geburtstag; dementsprechend ist kritische Distanz weniger gefragt. Aber Ilse Storb ist eh, wie man schnell merkt, ein Gesamtkunstwerk, dem man in einem Buch allein kaum beikommt. Eine CD muss mindestens dabeiheften, besser noch hätte wahrscheinlich eine DVD dazugehört. Parallel erschien außerdem eine Festschrift (siehe den nächsten Beitrag).
(Wolfram Knauer, März 2010)
Rastlose Brückenbauerin. Festschrift zum 80. Geburtstag von Ilse Storb
herausgegeben von Ulrich J. Blomann & Hans-Joachim Heßler
Duisburg 2009 (NonEM Verlag)
437 Seiten, 45 Euro
ISBN: 978-3-935744-10-2
 Ulrich J. Blomann und Hans-Joachim Heßler stellten zum 80. Geburtstag von “Europas einziger Jazzprofessorin” eine Sammlung von Aufsätzen zusammen, die sich mit unterschiedlichen Themenfeldern auseinandersetzen, die Ilse Storb in ihrer langen Berufskarriere als Pianistin, Musikwissenschaftlerin, Pädagogin und Hochschullehrerin irgendwann einmal gestreift hat. Für den Bereich ihrer größten Liebe, nämlich die Jazz- und Popularmusikforschung, befasst sich Ute Büchter-Römers mit der Änderung des Stimmideals von “Belcanto zum Rap”, schreibt Alfons Michael Dauer über die “Lineare Mehrstimmigkeit im alten Gospel” und Franz Kerschbaumer über impressionistische Strukturen (Strukturen?) im Jazz. Karsten Mützelfeldt trägt zwei Sendemanuskripte bei, eines über Jazz in Vietnam, das andere über Gunther Schuller; und Gudrun Endress ein Interview mit McCoy Tyner. Es gibt Beiträge zur Neuen Musik, zur Musikethnologie (erwähnenswert insbesondere Gerhard Kubiks Beitrag über “Das ‘Eigene’ und das ‘Fremde'”) und zur Musiksoziologie sowie einen ausführlichen theologischen Exkurs von Ute Ranke-Heinemann zum Thema “Die Hölle”. Schließlich finden sich jede Menge persönliche Gratulationen von Freunden, Kollegen, Mitstreitern über viele Jahrzehnte. Nicht alles hat mit Musik zu tun, aber alles irgendwie mit Ilse Storb, und vieles mit dem Titel des Buchs, dem “Brückenbauen” zwischen Stilen, Genres, Kulturen. Das Buch endet mit einem Interview mit der Jubilarin darüber, warum es in Deutschland für Frauen so schwer ist, eine Karriere zu machen, wie sie, Ilse Storb, sie gemacht hatte. Es ist bezeichnend, und durchaus ein Kompliment, dass dabei auch auf dem Papier die Lebendigkeit durchkommt, die Ilse Storb auszeichnet.
Ulrich J. Blomann und Hans-Joachim Heßler stellten zum 80. Geburtstag von “Europas einziger Jazzprofessorin” eine Sammlung von Aufsätzen zusammen, die sich mit unterschiedlichen Themenfeldern auseinandersetzen, die Ilse Storb in ihrer langen Berufskarriere als Pianistin, Musikwissenschaftlerin, Pädagogin und Hochschullehrerin irgendwann einmal gestreift hat. Für den Bereich ihrer größten Liebe, nämlich die Jazz- und Popularmusikforschung, befasst sich Ute Büchter-Römers mit der Änderung des Stimmideals von “Belcanto zum Rap”, schreibt Alfons Michael Dauer über die “Lineare Mehrstimmigkeit im alten Gospel” und Franz Kerschbaumer über impressionistische Strukturen (Strukturen?) im Jazz. Karsten Mützelfeldt trägt zwei Sendemanuskripte bei, eines über Jazz in Vietnam, das andere über Gunther Schuller; und Gudrun Endress ein Interview mit McCoy Tyner. Es gibt Beiträge zur Neuen Musik, zur Musikethnologie (erwähnenswert insbesondere Gerhard Kubiks Beitrag über “Das ‘Eigene’ und das ‘Fremde'”) und zur Musiksoziologie sowie einen ausführlichen theologischen Exkurs von Ute Ranke-Heinemann zum Thema “Die Hölle”. Schließlich finden sich jede Menge persönliche Gratulationen von Freunden, Kollegen, Mitstreitern über viele Jahrzehnte. Nicht alles hat mit Musik zu tun, aber alles irgendwie mit Ilse Storb, und vieles mit dem Titel des Buchs, dem “Brückenbauen” zwischen Stilen, Genres, Kulturen. Das Buch endet mit einem Interview mit der Jubilarin darüber, warum es in Deutschland für Frauen so schwer ist, eine Karriere zu machen, wie sie, Ilse Storb, sie gemacht hatte. Es ist bezeichnend, und durchaus ein Kompliment, dass dabei auch auf dem Papier die Lebendigkeit durchkommt, die Ilse Storb auszeichnet.
(Wolfram Knauer, März 2010)
From Harlem to Hollywood. My Life in Music
von Van Alexander & Stephen Frattalone
Albany/GA 2009 (BearManor Media)
197 Seiten, 19,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-59393-451-4
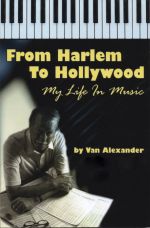 Van Alexander gehört nicht gerade zu den bekannten Namen der Jazzgeschichte. Man hat von ihm als Bandleader gehört, und wenn man sich gut auskennt, weiß man, dass er einst Arrangeur für Chick Webbs Band war und das Arrangement zu “A-Tisket, A-Tasket” geschrieben hat. In seiner Autobiographie erzählt Alexander nun seine Geschichte im Musikgeschäft. Alexander wurde 1915 in der Mitte Harlems geboren, das damals noch nicht wie wenige Jahre später Zentrum des schwarzen Amerikas war. Sein Vater war ein aus Ungarn emigrierter Jude, seine Mutter entstammte einer ursprünglich aus Rotterdam eingewanderten Familie und war regelmäßig als Pianistin in einem frühen lokalen Rundfunksender zu hören. Sie war zugleich Vans erste Klavierlehrerin. Er ging zur George Washington High School, und hörte abends die populären Swing-Bigbands im Radio, Paul Whiteman, Benny Goodman, die Casa Loma Band mit Glen Gray, Louis Armstrong, und hätte sich nicht träumen lassen später einmal für all diese Arrangements zu schreiben. Bald stellte er eine achtköpfige Band zusammen und machte seine ersten Gehversuche als Arrangeur. Nach seinem Schulabschluss war klar, dass dies seine Profession sein würde. Er nahm zusätzlichen Unterricht an der Columbia University sowie bei einigen Privatlehrern, die ihn in die Geheimnisse von Arrangement und Orchestrierung einweihten. Im Savoy Ballroom hörte er einige der angesagtesten Bands seiner Zeit und traute sich im Februar 1936, Chick Webb ein paar Arrangements mitzubringen. Webbs Band aber probte nicht etwa vor, sondern nach dem Job, und bis sie andere Arrangements von Musikern in der Band geprobt hatten, wurde es 5 Uhr morgens. Webb kaufte zwei Arrangements für 20 Dollar und engagierte Alexander kurz darauf für 75 Dollar pro Woche, jeweils drei Arrangements zu schreiben und für die Band zu kopieren. Webb empfahl ihn außerdem an Benny Goodman weiter, und Alexander erinnert sich lebhaft an die legendäre Big Band Battle zwischen Goodmans und Webbs Bands im Mai 1937. Wer den Namen Alexanders in den Diskographien Webbs vermisst, dem sei erklärt, dass Alexander damals noch unter seinem richtigen Namen Al Feldman firmierte und erst mit der Gründung seines eigenen Orchesters aus seinen zwei Vornamen seinen neuen Namen zusammensetzte. Ein eigenes Kapitel widmet Alexander der Entstehungsgeschichte seines All-Time-Greatest-Hits, “A-Tisket, A-Tasket”. Alexander erzählt von seinen Erfahrungen als weißer Arrangeur für eine schwarze Band, von Bandmusikern wie Taft Jordan oder Louie Jordan. Noch vor Webbs Tod verließ Alexander allerdings die Band und startete ein eigenes Orchester. Alexanders Vorbild war die Band von Isham Jones, und bald spielte die Band in den großen Ballsälen der Ostküste. Alexanders Orchester gehörte sicher nicht zu den großen Bands der Swingära, aber seine Darstellung wirft dennoch ein wenig Licht auf die Realität des Musikgeschäfts jener Jahre. Nach dem Krieg zog es Alexander nach Kalifornien, wo er für Bing Crosbys Bruder Bob eine neue Band aufzog. Nach nur drei Monaten feuerte Crosby ihn aus persönlichen Gründen und Alexander verklagte ihn und erhielt ein Jahresgehalt Entschädigung. In Kalifornien erhielt Alexander bald Arbeit als Arrangeur für das Plattenlabel Capitol sowie für Film und Fernsehen. Unter anderem schrieb er Musik für erfolgreiche Shows wie “I Dream of Jeannie” und “Bewitched”. Für seinen Freund Les Brown schrieb er in außerdem Arrangements für die “Dean Martin Show”. Alexander erzählt amüsante Anekdoten über all die Größen des Jazz und Showbusiness, mit denen er über die Jahrzehnte gearbeitet hat, und am Ende noch ein paar Stories von seinem Hobby, dem Golfspielen. Eine Diskographie der Aufnahmen seiner eigenen Bands, von Charles Garrod und Bill Korst bereits 1991 veröffentlicht, beschließt das Buch, das einen etwas anderen, sehr persönlichen, sicher auch sehr subjektiven und oft rosaroten Blick auf die Welt von Jazz und Entertainment wirft.
Van Alexander gehört nicht gerade zu den bekannten Namen der Jazzgeschichte. Man hat von ihm als Bandleader gehört, und wenn man sich gut auskennt, weiß man, dass er einst Arrangeur für Chick Webbs Band war und das Arrangement zu “A-Tisket, A-Tasket” geschrieben hat. In seiner Autobiographie erzählt Alexander nun seine Geschichte im Musikgeschäft. Alexander wurde 1915 in der Mitte Harlems geboren, das damals noch nicht wie wenige Jahre später Zentrum des schwarzen Amerikas war. Sein Vater war ein aus Ungarn emigrierter Jude, seine Mutter entstammte einer ursprünglich aus Rotterdam eingewanderten Familie und war regelmäßig als Pianistin in einem frühen lokalen Rundfunksender zu hören. Sie war zugleich Vans erste Klavierlehrerin. Er ging zur George Washington High School, und hörte abends die populären Swing-Bigbands im Radio, Paul Whiteman, Benny Goodman, die Casa Loma Band mit Glen Gray, Louis Armstrong, und hätte sich nicht träumen lassen später einmal für all diese Arrangements zu schreiben. Bald stellte er eine achtköpfige Band zusammen und machte seine ersten Gehversuche als Arrangeur. Nach seinem Schulabschluss war klar, dass dies seine Profession sein würde. Er nahm zusätzlichen Unterricht an der Columbia University sowie bei einigen Privatlehrern, die ihn in die Geheimnisse von Arrangement und Orchestrierung einweihten. Im Savoy Ballroom hörte er einige der angesagtesten Bands seiner Zeit und traute sich im Februar 1936, Chick Webb ein paar Arrangements mitzubringen. Webbs Band aber probte nicht etwa vor, sondern nach dem Job, und bis sie andere Arrangements von Musikern in der Band geprobt hatten, wurde es 5 Uhr morgens. Webb kaufte zwei Arrangements für 20 Dollar und engagierte Alexander kurz darauf für 75 Dollar pro Woche, jeweils drei Arrangements zu schreiben und für die Band zu kopieren. Webb empfahl ihn außerdem an Benny Goodman weiter, und Alexander erinnert sich lebhaft an die legendäre Big Band Battle zwischen Goodmans und Webbs Bands im Mai 1937. Wer den Namen Alexanders in den Diskographien Webbs vermisst, dem sei erklärt, dass Alexander damals noch unter seinem richtigen Namen Al Feldman firmierte und erst mit der Gründung seines eigenen Orchesters aus seinen zwei Vornamen seinen neuen Namen zusammensetzte. Ein eigenes Kapitel widmet Alexander der Entstehungsgeschichte seines All-Time-Greatest-Hits, “A-Tisket, A-Tasket”. Alexander erzählt von seinen Erfahrungen als weißer Arrangeur für eine schwarze Band, von Bandmusikern wie Taft Jordan oder Louie Jordan. Noch vor Webbs Tod verließ Alexander allerdings die Band und startete ein eigenes Orchester. Alexanders Vorbild war die Band von Isham Jones, und bald spielte die Band in den großen Ballsälen der Ostküste. Alexanders Orchester gehörte sicher nicht zu den großen Bands der Swingära, aber seine Darstellung wirft dennoch ein wenig Licht auf die Realität des Musikgeschäfts jener Jahre. Nach dem Krieg zog es Alexander nach Kalifornien, wo er für Bing Crosbys Bruder Bob eine neue Band aufzog. Nach nur drei Monaten feuerte Crosby ihn aus persönlichen Gründen und Alexander verklagte ihn und erhielt ein Jahresgehalt Entschädigung. In Kalifornien erhielt Alexander bald Arbeit als Arrangeur für das Plattenlabel Capitol sowie für Film und Fernsehen. Unter anderem schrieb er Musik für erfolgreiche Shows wie “I Dream of Jeannie” und “Bewitched”. Für seinen Freund Les Brown schrieb er in außerdem Arrangements für die “Dean Martin Show”. Alexander erzählt amüsante Anekdoten über all die Größen des Jazz und Showbusiness, mit denen er über die Jahrzehnte gearbeitet hat, und am Ende noch ein paar Stories von seinem Hobby, dem Golfspielen. Eine Diskographie der Aufnahmen seiner eigenen Bands, von Charles Garrod und Bill Korst bereits 1991 veröffentlicht, beschließt das Buch, das einen etwas anderen, sehr persönlichen, sicher auch sehr subjektiven und oft rosaroten Blick auf die Welt von Jazz und Entertainment wirft.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Analyser le Jazz
von Laurent Cugny
Paris 2009 (Outre Mesure)
576 Seiten, 44 Euro
ISBN: 978-2-907891-44-2
 Laurent Cugny ist Pianist, Arrangeur und Musikwissenschaftler und hat mit seinem Buch “Analyser le Jazz” ein Werk vorgelegt, in dem er versucht, die musikwissenschaftliche Herangehensweise an den Jazz zu strukturieren. Was ist überhaupt Jazz, fragt er zu Beginn, wie ist er zu definieren und wie kann man seine verschiedenen Komponenten analysieren. Wie lassen sich die Wandlungen der Jazzgeschichte analytisch beschreiben, welche Begriffe sind angemessen, welche müssen einer spezifischen Definition unterworfen werden? Wie geht man mit analytischen Begriffen um, die bereits von der konventionellen Musikwissenschaft belegt sind, etwa Komposition, Improvisation, Form, Struktur etc. In welcher Beziehung steht die Oralität der Überlieferung in afro-amerikanischer Musik zur Schriftlichkeit einer jeden analytischen Herangehensweise?
Laurent Cugny ist Pianist, Arrangeur und Musikwissenschaftler und hat mit seinem Buch “Analyser le Jazz” ein Werk vorgelegt, in dem er versucht, die musikwissenschaftliche Herangehensweise an den Jazz zu strukturieren. Was ist überhaupt Jazz, fragt er zu Beginn, wie ist er zu definieren und wie kann man seine verschiedenen Komponenten analysieren. Wie lassen sich die Wandlungen der Jazzgeschichte analytisch beschreiben, welche Begriffe sind angemessen, welche müssen einer spezifischen Definition unterworfen werden? Wie geht man mit analytischen Begriffen um, die bereits von der konventionellen Musikwissenschaft belegt sind, etwa Komposition, Improvisation, Form, Struktur etc. In welcher Beziehung steht die Oralität der Überlieferung in afro-amerikanischer Musik zur Schriftlichkeit einer jeden analytischen Herangehensweise?
Cugnys Ziel ist es eine Art Fahrplan zur analytischen Herangehensweise an Jazz zu geben. Weder die Methoden der klassischen Musikwissenschaft noch die der Musikethnologie, meint er, seien dem Jazz als einer improvisierten Musik wirklich angemessen. Um Jazz zu analysieren, reiche es nicht aus, bloß auf musikalische Strukturen oder motivische Beziehungen zu schauen; man müsse daneben jede Menge weiterer expressiver Techniken berücksichtigen.
In einem ersten Großkapitel untersucht Cugny das Jazz-Œuvre, wie man also Musik als “Text” behandeln kann, wie sich komponierte Strukturen, die Bedeutung von Improvisation und analytische Strukturen beschreiben lassen. Er unterscheidet zwischen der Analyse vorausbestimmter Faktoren (“moment avant”), etwa der Herkunft und Geschichte der zugrunde liegenden Komposition und ihrer formalen und harmonischen Struktur, sowie der Analyse progressiver Faktoren (“moment après”), unter denen er die Entwicklung einer Interpretation und/oder Improvisation versteht. In einem zweiten Großkapitel betrachtet Cugny dann die verschiedenen Parameter, die sich analysieren lassen: Harmonik, Rhythmik, Melodik, Form und Sound. Im dritten Teil schließlich beschäftigt sich Cugny mit der Geschichte der Jazzanalyse. Er unterscheidet rein harmonische, melodische, rhythmische oder formale Analysen, Analysen, die sich auf einzelne Soli beschränken, vergleichende Analysen und so weiter, und gibt dem Leser einen Leitfaden an die Hand, wie er unterschiedliche analytischen Werkzeuge für seine eigenen Zwecke verwenden kann. Er beschreibt die Möglichkeiten und Probleme der Transkription für die musikalische Analyse und gibt Beispiele für stilistische, semiotische und beschreibende Analysen.
Cugnys Buch ist mit weit über 500 Seiten keine leichte Lektüre, sondern eher eine trockene Studie, für die wenigsten Leser in einem Stück zu konsumieren. Man kann darüber streiten, ob eine Strukturierung analytischer Ansätze, wie er sie anbietet, überhaupt sinnvoll ist oder ob es nicht viel mehr Sinn macht, auf die zu analysierende Musik von Fall zu Fall zu reagieren und dabei auf diejenigen konkreten Dinge Bezug zu nehmen, die die Fragestellung hergibt, mit der man an das jeweilige Stück Musik herangeht. Hier scheint Cugnys Methodik eher ein Leitfaden für angehende Jazzanalytiker zu sein, der diese aber schnell auf die falsche Fährte bringen kann, wenn sie vor lauter Analyse nämlich die Notwendigkeit der Fragestellung außer Acht lassen. Ein Problem des Buchs ist auch die Literaturlage, auf die sich Cugny bezieht: größtenteils französische und ein paar amerikanische musikwissenschaftliche Bücher und Aufsätze und eben gerade nicht jene Ansätze, die mit konkreten Fragestellungen an die Musik herangehen. Auch fehlt eine Diskussion der unterschiedlichen Möglichkeiten klassischer musikwissenschaftlicher und musikethnologischer Werkzeuge, gewiss auch eine Darstellung der Diskussionen, die aus der afro-amerikanischen Literaturwissenschaft einen geänderten Blick auf den Jazz entwickelten. Schließlich bekommt man schnell den Eindruck, als zöge Cugny die musikimmanente Analyse auf jeden Fall einer der Einbeziehung außermusikalischer Komponenten in die Diskussion vor – was mir eine im 21sten Jahrhundert eher erstaunliche Sicht der Dinge scheint.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Bohuslav Martinů
herausgegeben von Ulrich Tadday
München 2009 (edition text + kritik)
160 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-3-86916-017-7
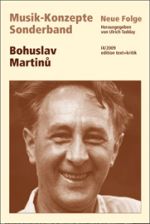 Der Komponist Buhuslav Martinů wurde 1890 in Böhmen geboren, lebte und arbeitete in Prag, Paris und New York und starb im August 1959 in der Schweiz. Im Mai 1959 fand in Dresden ein Symposium über den Komponisten statt; der vorliegende Band enthält die dort gehaltenen Referate. Die Beiträge befassen sich mit Martinůs Kammermusik seinen sinfonischen Kompositionen und seinem Opernschaffen, außerdem mit seiner Rezeption in den USA sowie in Böhmen. Martinůs “Jazz-Suite” von 1928 widmet Daniela Philippi eine ausführliche analytische Diskussion, in der sie sich allerdings vor allem auf die Behandlung der Klavierstimme konzentriert und die Idee von “Jazz”, die Martinů dabei vorschwebte, nicht weiter thematisiert. Wolfgang Rathert reiht Martinůs Sinfonien in die Tradition einer amerikanischen Sinfonik ein, in der seit den 1920er Jahren (eigentlich schon seit Dvorak) versucht wurde, eine eigenständige Musiksprache auch durch die Verwendung originärer Themen zu kreieren, eine “amerikanische Moderne”, für die sich das Vokabular des Jazz besonders gut eignete. Anders aber als Dvorak, der in seiner amerikanischen Zeit mit “Aus der Neuen Welt” eine ur-amerikanische Sinfonie schrieb, waren Martinůs sechs Sinfonien “ganz tschechische Symphonien aus der Tradition der Nationalromantik”, wie Rathert schreibt. Zum Jazz und seiner Rezeption bei Martinů also nicht wirklich viel in diesem Bändchen, das eine musikwissenschaftliche Annäherung an den Komponisten und sein Werk bietet.
Der Komponist Buhuslav Martinů wurde 1890 in Böhmen geboren, lebte und arbeitete in Prag, Paris und New York und starb im August 1959 in der Schweiz. Im Mai 1959 fand in Dresden ein Symposium über den Komponisten statt; der vorliegende Band enthält die dort gehaltenen Referate. Die Beiträge befassen sich mit Martinůs Kammermusik seinen sinfonischen Kompositionen und seinem Opernschaffen, außerdem mit seiner Rezeption in den USA sowie in Böhmen. Martinůs “Jazz-Suite” von 1928 widmet Daniela Philippi eine ausführliche analytische Diskussion, in der sie sich allerdings vor allem auf die Behandlung der Klavierstimme konzentriert und die Idee von “Jazz”, die Martinů dabei vorschwebte, nicht weiter thematisiert. Wolfgang Rathert reiht Martinůs Sinfonien in die Tradition einer amerikanischen Sinfonik ein, in der seit den 1920er Jahren (eigentlich schon seit Dvorak) versucht wurde, eine eigenständige Musiksprache auch durch die Verwendung originärer Themen zu kreieren, eine “amerikanische Moderne”, für die sich das Vokabular des Jazz besonders gut eignete. Anders aber als Dvorak, der in seiner amerikanischen Zeit mit “Aus der Neuen Welt” eine ur-amerikanische Sinfonie schrieb, waren Martinůs sechs Sinfonien “ganz tschechische Symphonien aus der Tradition der Nationalromantik”, wie Rathert schreibt. Zum Jazz und seiner Rezeption bei Martinů also nicht wirklich viel in diesem Bändchen, das eine musikwissenschaftliche Annäherung an den Komponisten und sein Werk bietet.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Miles on Miles. Interviews and Encounters with Miles Davis
herausgegeben von Paul Maher Jr. & Michael K. Dorr
Chicago 2009 (Lawrence Hill Books)
342 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-55652-706-7
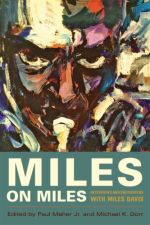 “Miles on Miles” folgt der musikalischen Entwicklung des Trompeters in seinen eigenen Worten, in Interviews, die Davis zwischen 1957 und 1998 gegeben hat. Paul Maher und Michael K. Dorr haben sich dabei vor allem auf solche Interviews gestütz, die relativ schwer zugänglich, selten oder gar bislang nie veröffentlicht wurden, darunter auch Transkripte einiger Radiointerviews. Den biographischen Anfang macht ein Interview, das George Avakian für die PR-Abteilung der Plattenfirma Columbia mit dem Trompeter machte und in dem er knapp über seine Kindheit und seine musikalische Entwicklung bis in die 1950er Jahre spricht. Nat Hentoffs “Afternoon with Miles Davis” von 1958 ist bereits anderswo erschienen und präsentiert Davis, wie er nachdenklich seine musikalische Ästhetik offenlegt, Platten aus seiner Sammlung kommentiert, von Billie Holiday und Louis Armstrong über das Modern Jazz Quartet bis zu Thelonious Monk und zurück zu Bessie Smith. Der Schlagzeuger Arthur Taylor brachte den eher öffentlichkeitsscheuen und Journalisten gegenüber oft abweisenden Miles Davis zum Reden, über Musik genauso wie über die Businessseiten seiner Karriere. Wenn ein Journalist wie Les Tompkins ihn tatsächlich auch zum Reden bringt, erkennt Miles das auch an: “Du hast Dir ein gutes Interview gekriegt. Das erste in drei Jahren”. Immer wieder wehrt er sich gegen das Wort “Jazz”, das er als rassistische Bezeichnung für die Musik ansieht. Al Aronowitz ist mit zwei Essays vertreten, in denen er über Miles, den Privatmann, den Partygänger und den Einfluss Jimi Hendrix’s auf Miles spricht. Ein langes Interview mit Leonard Feather präsentiert ihn eher zahm; in anderen Interviews gifted er über die Plattenfimen, die Tourbosse und die weiße Jazzkritik. Peinlich wird’s, als ein Radiomoderator, der wirklich nichts von Musik versteht, ihn zuhause erwischt und Miles mit Ihm Katz und Maus spielt, um ihn am Schluss einfach liegen zu lassen. Mit Cheryl McCall spricht Miles 1982 offen über Gesundheitsprobleme und Drogen. Drei nicht identifizierte Interviewausschnitte lassen ihn über Lippenproblemen, Mode und die Gründe sprechen, warum er die Plattenfirma Columbia verließ. Ben Sidran gelingt es, die ganze Zeit über nur über Musik mit Miles zu sprechen und den Trompeter am Ende mit der Bemerkung zu beeindrucken, dass sein Stück “Nardis” sein Name rückwärts sei. Mit Nick Kent spricht Miles unter anderem über Wynton Marsalis und die ästhetischen Unterschiede dessen und seiner musikalischen Welt. Robert Doerschuk spricht mit ihm für die Zeitschrift Keyboard über die Verwendung von Synthesizern in seinen Bands. Der Gitarrist Foley interviewt seinen gut gelaunten Chef anlässlich einer Fernsehshow. Das Buch schließt mit drei Features, die Mike Zwerin für die International Herald Tribune schrieb: über Miles, den “Prince of Silence”, Miles, den Maler, und Miles, den Filmschauspieler. “Miles on Miles” ist ein Case Book mit gut ausgewählten Interviews des Trompeters, die versuchen, die ganze Bandbreite seines musikalischen wie sozialen Lebens zu berühren. Ein Namensindex schließt den Band ab, der vielleicht nichts Neues bringt, in den O-Tönen aber überaus lebenswert ist.
“Miles on Miles” folgt der musikalischen Entwicklung des Trompeters in seinen eigenen Worten, in Interviews, die Davis zwischen 1957 und 1998 gegeben hat. Paul Maher und Michael K. Dorr haben sich dabei vor allem auf solche Interviews gestütz, die relativ schwer zugänglich, selten oder gar bislang nie veröffentlicht wurden, darunter auch Transkripte einiger Radiointerviews. Den biographischen Anfang macht ein Interview, das George Avakian für die PR-Abteilung der Plattenfirma Columbia mit dem Trompeter machte und in dem er knapp über seine Kindheit und seine musikalische Entwicklung bis in die 1950er Jahre spricht. Nat Hentoffs “Afternoon with Miles Davis” von 1958 ist bereits anderswo erschienen und präsentiert Davis, wie er nachdenklich seine musikalische Ästhetik offenlegt, Platten aus seiner Sammlung kommentiert, von Billie Holiday und Louis Armstrong über das Modern Jazz Quartet bis zu Thelonious Monk und zurück zu Bessie Smith. Der Schlagzeuger Arthur Taylor brachte den eher öffentlichkeitsscheuen und Journalisten gegenüber oft abweisenden Miles Davis zum Reden, über Musik genauso wie über die Businessseiten seiner Karriere. Wenn ein Journalist wie Les Tompkins ihn tatsächlich auch zum Reden bringt, erkennt Miles das auch an: “Du hast Dir ein gutes Interview gekriegt. Das erste in drei Jahren”. Immer wieder wehrt er sich gegen das Wort “Jazz”, das er als rassistische Bezeichnung für die Musik ansieht. Al Aronowitz ist mit zwei Essays vertreten, in denen er über Miles, den Privatmann, den Partygänger und den Einfluss Jimi Hendrix’s auf Miles spricht. Ein langes Interview mit Leonard Feather präsentiert ihn eher zahm; in anderen Interviews gifted er über die Plattenfimen, die Tourbosse und die weiße Jazzkritik. Peinlich wird’s, als ein Radiomoderator, der wirklich nichts von Musik versteht, ihn zuhause erwischt und Miles mit Ihm Katz und Maus spielt, um ihn am Schluss einfach liegen zu lassen. Mit Cheryl McCall spricht Miles 1982 offen über Gesundheitsprobleme und Drogen. Drei nicht identifizierte Interviewausschnitte lassen ihn über Lippenproblemen, Mode und die Gründe sprechen, warum er die Plattenfirma Columbia verließ. Ben Sidran gelingt es, die ganze Zeit über nur über Musik mit Miles zu sprechen und den Trompeter am Ende mit der Bemerkung zu beeindrucken, dass sein Stück “Nardis” sein Name rückwärts sei. Mit Nick Kent spricht Miles unter anderem über Wynton Marsalis und die ästhetischen Unterschiede dessen und seiner musikalischen Welt. Robert Doerschuk spricht mit ihm für die Zeitschrift Keyboard über die Verwendung von Synthesizern in seinen Bands. Der Gitarrist Foley interviewt seinen gut gelaunten Chef anlässlich einer Fernsehshow. Das Buch schließt mit drei Features, die Mike Zwerin für die International Herald Tribune schrieb: über Miles, den “Prince of Silence”, Miles, den Maler, und Miles, den Filmschauspieler. “Miles on Miles” ist ein Case Book mit gut ausgewählten Interviews des Trompeters, die versuchen, die ganze Bandbreite seines musikalischen wie sozialen Lebens zu berühren. Ein Namensindex schließt den Band ab, der vielleicht nichts Neues bringt, in den O-Tönen aber überaus lebenswert ist.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
The Ghosts of Harlem. Sessions with Jazz Legends. Photographs and Interviews
von Hank O’Neal
Nashville 2009 (Vanderbilt University Press)
488 Seiten + CD, 75 US-$
ISBN: 978-0-8265-1627-5
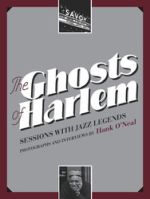 Hank O’Neal ist ein Tausendsassa: In den 1970er Jahren hatte er das Label Chiaroscuro gegründet, auf dem er insbesondere Musiker der älteren Generation produzierte, die auch im Alter noch hervorragend spielten. Er organisierte Konzerte und Jazz Festivals und machte sich auch als Fotograf einen Namen. Bei all dem war er immer ein guter Freund der Musiker, und das kommt diesem opulenten Buch zugute, das reich bebildert Interviews mit 42 Veteranen des Jazz enthält. Sie erzählen aus ihrem Leben und ihrer musikalischen Karriere, doch der das alles zusammenhaltende Faden ist der New Yorker Stadtteil Harlem, dem das Buch gewidmet ist.
Hank O’Neal ist ein Tausendsassa: In den 1970er Jahren hatte er das Label Chiaroscuro gegründet, auf dem er insbesondere Musiker der älteren Generation produzierte, die auch im Alter noch hervorragend spielten. Er organisierte Konzerte und Jazz Festivals und machte sich auch als Fotograf einen Namen. Bei all dem war er immer ein guter Freund der Musiker, und das kommt diesem opulenten Buch zugute, das reich bebildert Interviews mit 42 Veteranen des Jazz enthält. Sie erzählen aus ihrem Leben und ihrer musikalischen Karriere, doch der das alles zusammenhaltende Faden ist der New Yorker Stadtteil Harlem, dem das Buch gewidmet ist.
O’Neal beginnt mit einem umfangreichen Kapitel über Harlem, das Zentrum schwarzer Musik in den 1920er bis 1940er Jahren und verfolgt den Niedergang des Musikgeschäfts im nördlichen Manhattan, bebildert das ganze mit Fotos davon, wie es heute aussieht an den Schauplätzen ehemaliger Band-Battles und Jam Sessions und entdeckt mit Freude, dass seit den 1990er Jahren der Stadtteil seine Musik wiederentdeckt hat. Das Kapitel “Discovering Lost Locations” allein ist den Kauf des Buchs wert, das versucht, Geschichte vor dem völligen Verschwinden aus dem kollektiven Gedächtnis zu bewahren.
Aber die Interviews sind nicht minder spannend. Andy Kirk erzählt darüber, wie er 1920 zum ersten Mal nach New York kam, lässt uns an einigen Geschichten über seinen ehemaligen Manager Joe Glaser teilhaben (der dem Titel “Little Joe from Chicago” den Namen gab), schließlich über musikferne Berufe, die er in Harlem ausübte, etwa als Manager des Hotel Theresa auf der 125sten Straße. Benny Waters berichtet über Small’s Paradise in den 20er Jahren, über Piano-Cutting-Sessions im Reuben’s, in dem er an einem Abend Fats Waller, Art Tatum und Earl Hines hörte. Auch Doc Cheatham spricht über Small’s sowie über den Cotton Club, in dem er mit Cab Calloway spielte. Eddie Durham, weiß von Jimmie Luncefords Band zu berichten, mit der er seit 1935 spielte, erzählt vom Savoy Ballroom und von seiner Zeit bei Count Basie. Cab Calloway selbst berichtet über sein Engagement im Cotton Club, sowohl Uptown, wie auch Downtown; er spekuliert außerdem darüber, warum die Musikszene Uptown in den späten 1940er Jahren den Bach runter ging. Benny Carter erinnert sich an Clubs wie Leroy’s und an seine Zeit mit Chick Webb im Savoy Ballroom. Larence Lucie spricht über Gitarristenkollegen und über seine Aufnahmen mit Teddy Wilson und Billie Holiday. Jonah Jones erinnert sich an den Onyx Club, an Stuff Smith und seine Zeit mit Cab Calloway. Sammy Price berichtet, wie er den Produzenten Mayo Williams in seiner Heimatstadt Dallas getroffen hatte, der ihm später half, einen Vertrag mit der Plattenfirma Decca zu erhalten. Er habe immer in Harlem gelebt, auch wenn er selten Uptown gespielt habe. Danny Barker verrät, warum er aus seiner Heimatstadt New Orleans fortgegangen sei, um in New York heimisch zu werden und wie es in New York eine Art Club der New Orleanser Musiker gab.
Weitere Interviews etwa mit Sy Oliver, Buck Clayton, Maxine Sullivan, Franz Jackson, Al Casey, Buddy Tate, Dizzy Gillespie, J.C. Heard, Panama Francis, Joe Williams, Clark Terry, Billy Taylor, Illinois Jacquet und vielen anderen geben ein sehr persönliches und doch auch sehr professionell beleuchtetes Bild des Stadtteils. Sie alle erzählen von den Gigs, von den Arbeitsbedingungen, von verschiedenen Bands, der Lebendigkeit Harlems und vom Niedergang der Swingära, der quasi mit dem Niedergang Harlems als kulturellem Zentrum des Jazz einherging. O’Neal stellt Fragen zur Karriere und endet meist mit der Frage: Weißt Du noch, wann Du das letzte Mal in Harlem gespielt hast”, und die meisten der Musiker erinnern sich, dass das irgendwann Anfang der 1940er Jahre gewesen sein muss. Dizzy Gillespie und einige andere geben schließlich noch ein Bild des moderneren Harlem, des Bebop-Harlem mit Verweisen auf Minton’s Playhouse und Montroe’s Uptown House.
Alles in allem ist das ganze ein wunderbares Buchprojekt, ein “Coffetable book”, wie man so schön sagt, das sich trotz seiner Dicke leicht und schnell liest und einen hineinzieht in den Bann Harlems in den 20er bis 40er Jahren. Dem Buch heftet eine CD mit Aufnahmen Musikern aus dem Chiaroscuro-Stall bei, aufgenommen zwischen 1992 und 1996; swingender Mainstream-Jazz und zwischendurch auch ein paar O-Töne der Musiker.
(Wolfram Knauer)
I Feel a Song Coming On. The Life of Jimmy McHugh
von Alyn Shipton
Urbana 2009 (University of Illinois Press)
273 Seiten; 35,00 US-$
ISBN: 978-0-252-03465-7
 Alyn Shipton hat seit Jahren eine erfolgreiche Radioshow. Im Juli 2003 fiel einer seiner Kollegen aus, und er wurde gebeten, eine Show mit einem gewissen Jimmy McHugh” zu machen. Doch nicht der Songwriter!, meinte Shipton, wohl wissend, dass der weit über 100 sein müsste. Tatsächlich handelte es sich um den Enkel des Komponisten, und nach einer lebhaften Show entschieden die beiden, dass Shipton mit dem material, das sich im Privatarchiv der McHughs befand, leicht eine Biographie schreiben ließe. Er beginnt mit McHughs Kindheit in Boston, seine Erfahrungen im Bostoner Opernhaus, wo er ab 1910 als Office Boy arbeitete und dabei Stars wie Caruso, Calli-Curci, John McCormack und andere hörte. Nebenbei nahm er Klavierunterricht und interessierte sich neben der klassischen auch für die populäre Musik des Tages. Bald arbeitete er als Song Plugger für verschiedene Musikverlage, zuletzt Irving Berlins Verlag, und lernte dabei, was einen erfolgreichen Song ausmachte. 1920 zog es ihn nach New York, wo er auf der Tin Pan Alley dem Song-Plugger-Beruf weiter nachging, dabei aber neben den Kompositionen anderer auch begann, seine eigenen Titel zu promoten. Für eine Weile hatte er quasi drei Berufe: Musiker, Song-Plugger und Komponist, bis er mit “Everything Is Hotsy Totsy Now” und “I Can’t Believe That You’re In Love With Me” erste größere Hits einfuhr. Shipton beschreibt die Überschneidungen zwischen dem Geschäft eines Komponisten im Geschäft des American Popular Song und der Jazzszene jener Jahre — und zwar sowohl der weißen wie auch der schwarzen Jazzszene. 1927 erhielt Duke Ellington seit legendäres Engagement im New Yorker Cotton Club, und Jimmy McHugh war bald einer der Co-Komponisten für die regelmäßig wechselnden Revuen. Er traf die Textdichterin Dorothy Fields, und bald schrieben die beiden ihre Titel zusammen. “I Can’t Give You Anything But Love, Baby” war eine ihrer frühesten Kollaborationen, später dann “Diga Diga Doo” und andere Songs für die Revue “Blackbirds of 1928”. 1929 verließen beide New York und zogen nach Hollywood, wo der aufkommende Tonfilm ihnen viel einträgliche Arbeit versprach. Aus dieser Zeit stammen “Exactly Like You” und “On the Sunny Side of the Street”. 1931 teilten sie ihre Arbeit zwischen Broadway und Hollywood auf und schrieben 1933 eine Operette ein wenig im Stil von Gilbert and Sullivan. Oft wurden die beiden von der Öffentlichkeit wie ein verheiratetes Paar angesehen, obwohl sie beide anderweitig verheiratet waren. Shipton berichtet über das Einkommen, das McHugh mit seinen unterschiedlichen Aktivitäten erzielte. 1935 folgte “I’m in the Mood for Love”; aber etwa zur selben Zeit tat sich Field mit Jerome Kern für ein paar Shows zusammen und die langjährige Zusammenarbeit Fields/McHugh war vorbei. Bald schrieb er für Filme mit dem Kinderstar Shirley Temple, aber auch für die für Carmen Miranda. In den späten 1930er Jahren tat er sich mit dem Textdichter Johnny Mercer zusammen und schrieb Hits wie “That Old Black Magic” oder “Blues in the Night”. Immer noch war es ihm wichtig, dass seine Songs nicht nur auf der Leinwand zu hören waren, sondern auch von Jazz- und Swingbands gespielt wurden. Nach dem Krieg war McHugh weiterhin einer der Stars der New Yorker High Society, insbesondere, da er nun mit der Klatschreporterin Louella Parsons ging. In den 1960er Jahren lebte er vor allem vom vergangenen Ruhm. Shipton portraitiert McHugh als einen zielstrebigen Fließbandarbeiter an der Maschinerie des American Show Business, macht genügend Ausflüge ins Private, um das Bild eines erfolgreichen, aber mit den üblichen privaten Problemen zu kämpfenden Prominenten zu zeichnen und hält sich mit musikalischen Bewertungen oder auch nur Beschreibungen der Musik McHughs zurück. Eine Auflistung der Kompositionen seines Helden fehlt leider, dafür gibt es etliche seltene Fotos aus dem Familienarchiv der McHughs. Das ganze ist in der Detailverliebtheit manchmal etwas langwierig zu lesen, dennoch eine hilfreiche Biographie, in der jede Menge Informationen über die Broadway- und Hollywood-Szene gegeben werden.
Alyn Shipton hat seit Jahren eine erfolgreiche Radioshow. Im Juli 2003 fiel einer seiner Kollegen aus, und er wurde gebeten, eine Show mit einem gewissen Jimmy McHugh” zu machen. Doch nicht der Songwriter!, meinte Shipton, wohl wissend, dass der weit über 100 sein müsste. Tatsächlich handelte es sich um den Enkel des Komponisten, und nach einer lebhaften Show entschieden die beiden, dass Shipton mit dem material, das sich im Privatarchiv der McHughs befand, leicht eine Biographie schreiben ließe. Er beginnt mit McHughs Kindheit in Boston, seine Erfahrungen im Bostoner Opernhaus, wo er ab 1910 als Office Boy arbeitete und dabei Stars wie Caruso, Calli-Curci, John McCormack und andere hörte. Nebenbei nahm er Klavierunterricht und interessierte sich neben der klassischen auch für die populäre Musik des Tages. Bald arbeitete er als Song Plugger für verschiedene Musikverlage, zuletzt Irving Berlins Verlag, und lernte dabei, was einen erfolgreichen Song ausmachte. 1920 zog es ihn nach New York, wo er auf der Tin Pan Alley dem Song-Plugger-Beruf weiter nachging, dabei aber neben den Kompositionen anderer auch begann, seine eigenen Titel zu promoten. Für eine Weile hatte er quasi drei Berufe: Musiker, Song-Plugger und Komponist, bis er mit “Everything Is Hotsy Totsy Now” und “I Can’t Believe That You’re In Love With Me” erste größere Hits einfuhr. Shipton beschreibt die Überschneidungen zwischen dem Geschäft eines Komponisten im Geschäft des American Popular Song und der Jazzszene jener Jahre — und zwar sowohl der weißen wie auch der schwarzen Jazzszene. 1927 erhielt Duke Ellington seit legendäres Engagement im New Yorker Cotton Club, und Jimmy McHugh war bald einer der Co-Komponisten für die regelmäßig wechselnden Revuen. Er traf die Textdichterin Dorothy Fields, und bald schrieben die beiden ihre Titel zusammen. “I Can’t Give You Anything But Love, Baby” war eine ihrer frühesten Kollaborationen, später dann “Diga Diga Doo” und andere Songs für die Revue “Blackbirds of 1928”. 1929 verließen beide New York und zogen nach Hollywood, wo der aufkommende Tonfilm ihnen viel einträgliche Arbeit versprach. Aus dieser Zeit stammen “Exactly Like You” und “On the Sunny Side of the Street”. 1931 teilten sie ihre Arbeit zwischen Broadway und Hollywood auf und schrieben 1933 eine Operette ein wenig im Stil von Gilbert and Sullivan. Oft wurden die beiden von der Öffentlichkeit wie ein verheiratetes Paar angesehen, obwohl sie beide anderweitig verheiratet waren. Shipton berichtet über das Einkommen, das McHugh mit seinen unterschiedlichen Aktivitäten erzielte. 1935 folgte “I’m in the Mood for Love”; aber etwa zur selben Zeit tat sich Field mit Jerome Kern für ein paar Shows zusammen und die langjährige Zusammenarbeit Fields/McHugh war vorbei. Bald schrieb er für Filme mit dem Kinderstar Shirley Temple, aber auch für die für Carmen Miranda. In den späten 1930er Jahren tat er sich mit dem Textdichter Johnny Mercer zusammen und schrieb Hits wie “That Old Black Magic” oder “Blues in the Night”. Immer noch war es ihm wichtig, dass seine Songs nicht nur auf der Leinwand zu hören waren, sondern auch von Jazz- und Swingbands gespielt wurden. Nach dem Krieg war McHugh weiterhin einer der Stars der New Yorker High Society, insbesondere, da er nun mit der Klatschreporterin Louella Parsons ging. In den 1960er Jahren lebte er vor allem vom vergangenen Ruhm. Shipton portraitiert McHugh als einen zielstrebigen Fließbandarbeiter an der Maschinerie des American Show Business, macht genügend Ausflüge ins Private, um das Bild eines erfolgreichen, aber mit den üblichen privaten Problemen zu kämpfenden Prominenten zu zeichnen und hält sich mit musikalischen Bewertungen oder auch nur Beschreibungen der Musik McHughs zurück. Eine Auflistung der Kompositionen seines Helden fehlt leider, dafür gibt es etliche seltene Fotos aus dem Familienarchiv der McHughs. Das ganze ist in der Detailverliebtheit manchmal etwas langwierig zu lesen, dennoch eine hilfreiche Biographie, in der jede Menge Informationen über die Broadway- und Hollywood-Szene gegeben werden.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Traveling Blues. The Life and Music of Tommy Ladnier
Von Bo Lindström und Dan Vernhettes
Paris 2009 (Jazz ‘Edit)
216 Seiten
ISBN 978-2-9534-8310-9
 Tommy Ladnier ist eine Art Rätsel der Jazzgeschichte. Der Ruhm des Trompeters, der mit extrem schönem und antreibendem Sound spielte, seit 1923 auf Platten dokumentiert ist, mehrfach Europa bereiste, sich in den 1930er Jahren zurückzog, um mit einem Schneider- und Bügelgeschäft sein Geld zu verdienen und 1939 an den Folgen von Alkohol und eventuell einer Geschlechtskrankheit verstarb, geht vor allem auf Hugues Pannasié zurück, der ihn zusammen mit Mezz Mezzrow 1938 quasi wiederentdeckte, aus seinem musikalischen Exil holte und erneut Aufnahmen mit ihm machte.
Tommy Ladnier ist eine Art Rätsel der Jazzgeschichte. Der Ruhm des Trompeters, der mit extrem schönem und antreibendem Sound spielte, seit 1923 auf Platten dokumentiert ist, mehrfach Europa bereiste, sich in den 1930er Jahren zurückzog, um mit einem Schneider- und Bügelgeschäft sein Geld zu verdienen und 1939 an den Folgen von Alkohol und eventuell einer Geschlechtskrankheit verstarb, geht vor allem auf Hugues Pannasié zurück, der ihn zusammen mit Mezz Mezzrow 1938 quasi wiederentdeckte, aus seinem musikalischen Exil holte und erneut Aufnahmen mit ihm machte.
Bo Lindström und Dan Vernhettes sind Jazzfans und Privatforscher und haben mit ihrem Buch über Tommy Ladnier eine unglaublich sorgfältig recherchierte und bebilderte Biographie des Trompeters vorgelegt, die in 500 Exemplaren erschienen ist und neben Details zum Leben und zur Musik Ladniers jede Menge Information über die Rahmenbedingungen präsentiert, innerhalb derer Ladnier Musik machte.
Die Autoren beginnen mit der Kolonialgeschichte Louisianas und dem wechselvollen Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß, beschreiben die unterschiedlichen Gesetze, die das Zusammenleben der Sklavenbesitzer und ihrer Sklaven seit Zeiten Louis XIV regeln sollten und das reale Leben in Mandaville, einer Kleinstadt am nordöstlichen Ufer des Lake Pontchatrain, quasi gegenüber von New Orleans, wo Tommy Ladnier 1900 geboren wurde. Sie recherchieren die Familie des Trompeters, deren weiße Linie sie bis in die Schweiz zurückverfolgen, von wo Christian L’Adner stammte, der von Ludwig XV 1719 wegen Schmuggels und Schwarzmarkthandel in die Übersee-Strafkolonien verbannt worden war, und der als Urvater vieler Ladniers in Louisiana gilt. Eine Geburtsurkunde des Trompeters existiert nicht, und Lindström und Vernhettes spekulieren darüber, ob Willa Ladnier, die Frau seines Vaters, wohl wirklich die leibliche Mutter war oder ob Ladnier nicht vielleicht Kind einer Mischbeziehung und seine leibliche Mutter eine Weiße gewesen sei.
Sie beschreiben die Musik, die Ladnier in Mandaville gehört haben mag, den Einfluss durch Trompeter wie Bunk Johnson und Buddy Petit und begleiten Ladnier 1917 nach Chicago, wo er sich auf den Schlachthöfen verdingte, aber nebenbei all die großen Jazzmusiker hörte, die dort spielten, allen voran King Oliver. Ladnier war auch selbst bald als Musiker gefragt und machte 1923 seine ersten Plattenaufnahmen mit der Sängerin Monnette Moore; etwa zur gleichen Zeit außerdem Aufnahmen mit Jelly Roll Morton. Im Herbst des Jahres wurde er Mitglied der Blues Serenaders der Pianistin Lovie Austin, einer Band, mit der er Sängerinnen wie Ida Cox, Ma Rainey, Edmonia Henderson, Edna Hicks und Ethel Waters begleitete und im Dezember 1924 auch einige Instrumentaltitel einspielte.
1925 stieg Ladnier beim Sam Wooding Orchestra in New York ein, das sich kurz darauf zu einer Tournee nach Europa einschiffte. Die Tour begann im Admiralspalast Berlin, dann folgte das Thalia Theater in Hamburg, Stockholm, Kopenhagen, Prag, Budapest, Wien, Barcelona, Madrid, Paris, Zürich, wieder Berlin und schließlich Russland. Erst im Juli 1926 kehrte Ladnier von Danzig aus nach New York zurück. Dort jobbte er eine Weile, bis er als Ersatz von Rex Stewart ins Fletcher Henderson Orchestra engagiert wurde, mit dem er einige Platten einspielte, darunter den “The Chant”. Er reiste mit Henderson durchs Land, nahm nebenher ein paar Seiten mit Bessie Smith auf, und kündigte schließlich, um im Februar 1928 wieder bei Sam Wooding anzufangen. Der hatte bereits neue Europa-Pläne, und Ladnier reiste mit. Es begann ein weiteres Mal in Berlin, führte die Band, der diesmal auch der Trompeter Doc Cheatham angehörte, über Wien nach Konstantinopel, dann nach Hamburg, Bern, Mailand, Florenz und Nizza, wo Ladnier Wooding verließ. In der Folge spielte er mit Benny Peyton’s Band, mit Harry Fleming und in einer Revue des Tänzers Louis Douglas. Immer wieder kehrte er bei seinen Tourneen nach Paris zurück, wo er sich unter anderem mit Hugues Panassié anfreundete, dem französischen Jazzfan und -experten.
1930 stieg Ladnier in die Bigband des Sängers und Bandleaders Noble Sissle ein, der damals in Paris gastierte und mit dem er im Dezember des Jahres in die USA zurückkehrte. Dort gesellte sich der Band auch der Sopransaxophonist Sidney Bechet zu, der ähnliche europäische Erfahrungen gesammelt hatte wie Ladnier und mit dem sich der Trompeter daher schnell anfreundete. Mit Bechet gründete der Ladnier 1932 die Band “The New Orleans Feetwarmers”, die im Savoy Ballroom auftrat und auch Platteneinspielungen machten.Das Geschäft aber war schwer in jenen Jahren kurz nach dem Börsencrash, und 1933 eröffneten Bechet und Ladnier als Alternative zur Musik ein Schneider- und Bügelgeschäft in Harlem. Bechet zog sich bald wieder aus diesem “weltlichen” Beruf zurück, und das Geschäft existierte wohl gerade mal ein Jahr.
Zwischen 1934 und 1938 wird es dunkel in der Biographie Ladniers. Er habe sich nach Connecticut zurückgezogen, heißt es, wo er bei einem Freund gelebt habe. Über musikalische Aktivitäten in diesen Jahren ist jedenfalls nichts bekannt.1938 kam Hugues Panassié nach New York und wollte Aufnahmen im klassischen New-Orleans-Stil produzieren. Er tat sich mit dem Klarinettisten Mezz Mezzrow zusammen, und ihre erste Wahl für die Trompete war Tommy Ladnier. Sie fanden ihn, Pannasié unterhielt sich lange mit ihm, um die Aufnahmesitzung vorzubereiten (und einige Fotos auf der Straße in Harlem zu schießen); dann ging die Band im November und Dezember 1938 für insgesamt drei Plattensitzungen ins Studio. Am 23. Dezember organisierte John Hammond sein “From Spirituals to Swing”-Konzert in der Carnegie Hall und bat Sidney Bechet, eine New-Orleans-Besetzung zusammenzustellen, für die Bechet Ladnier engagierte. Glücklicherweise sind Mitschnitte des Konzerts gemacht und später veröffentlicht worden.
Am 1. Februar 1939 ging Ladnier zum letzten Mal ins Studio, wieder mit Mezz Mezzrow, um die Sängerin Rosetta Crawford zu begleiten. Er wohnte zeitweise bei Bechet, später dann bei Mezzrow in Harlem. Der fand ihn am 3. Juni tot im Sessel sitzend in seiner Wohnung. Ladnier wurde auf dem Frederick Douglas Cemetery in Staten Island, New York, beigesetzt.
Lindström und Vernhettes ist es gelungen, so viel Information wie irgend möglich über Tommy Ladnier zusammenzutragen, um aus den puzzlestein-artigen Versatzstücken ein eindrucksvolles Gesamtbild des Lebens und Wirkens eines schwarzen Musikers in den 1920er und frühen 1930er Jahren zusammenzubasteln. Sie bebildern das ganze mit teilweise seltenen Fotos, beschreiben neben den biographischen Details die Umstände, in denen Ladnier seine Musik machte und gehen mit knappen analytischen Absätzen und einzelnen Transkriptionen seiner Soli auch auf die Musik ein. Beide Autoren sind Fans, aber sie schreiben keine Hagiographie ihres Helden. Ihr Buch ist eine Fundgrube kleiner Informationen, die die Szenen jener Jahre beschreibt, durch die Tommy Ladnier gereist ist: New Orleans, Chicago, Europa, New York. Zum Schluss findet sich eine ausführliche Diskographie des Trompeters, in dem alle 191 Einspielungen, an denen Tommy Ladnier beteiligt war, aufgelistet sind.
Das Buch fast in LP-Format ist eine “labor of love”, eine opulente Dokumentation des Lebens eines Musikers, der scheinbar immer auf Reisen war: “Traveling Blues”.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Jazz et société sous l’Occupation
von Gérard Régnier
Paris 2009 (L’Harmattan)
296 Seiten, 28,00 Euro
ISBN: 978-2-296-10134-0
 Zusammen mit London und Berlin war Paris in den 1920er Jahren die wichtigste Stadt für den noch jungen europäischen Jazz. Frankreich hatte die afro-amerikanische Musik bereits kurz nach dem I. Weltkrieg umarmt, als James Reese Europe mit seiner Hellfighters Band in den befreiten Dörfern und Städten gefeiert wurde. Viele Künstler ließen sich in Paris nieder, das nicht nur eine amerikanische, sondern daneben auch eine afro-amerikanische Szene besaß. Sie lebten dort auch in den 1930er Jahren und planten Tourneen ins benachbarte Ausland, wobei Deutschland mehr und mehr umrundet werden musste, weil die Nazis hier den Jazz unterdrückten und seinen Künstlern die Auftrittsmöglichkeiten nahmen.
Zusammen mit London und Berlin war Paris in den 1920er Jahren die wichtigste Stadt für den noch jungen europäischen Jazz. Frankreich hatte die afro-amerikanische Musik bereits kurz nach dem I. Weltkrieg umarmt, als James Reese Europe mit seiner Hellfighters Band in den befreiten Dörfern und Städten gefeiert wurde. Viele Künstler ließen sich in Paris nieder, das nicht nur eine amerikanische, sondern daneben auch eine afro-amerikanische Szene besaß. Sie lebten dort auch in den 1930er Jahren und planten Tourneen ins benachbarte Ausland, wobei Deutschland mehr und mehr umrundet werden musste, weil die Nazis hier den Jazz unterdrückten und seinen Künstlern die Auftrittsmöglichkeiten nahmen.
Am 10. Mai 1940 begannen die deutschen Streitkräfte ihre Westoffensive; am 25. Mai wurden die “dancings”, Tanzsäle und Cabarets in Paris, geschlossen; am 14. Juni marschierten die Deutschen in Paris ein; am 4. Juli wurde ein fester Wechselkurs zwischen Franc und Reichsmark eingeführt; am 11. Juli waren die meisten Tanzhallen und Cabarets bereits wieder geöffnet. Jazz stand zwar auf der Bannliste der Nazis, aber in den besetzten Gebieten gab es wohl dringendere Aufgaben als ein Verbot dieser Musik durchzusetzen. Auch während der Besatzung jedenfalls konnte man in Frankreich Jazz hören, im Konzert, beim Tanzen, im Radio oder von Schallplatten. Auch hier allerdings wurden die Titel oft genug abgeändert, um die neuen Machthaber nicht zu provozieren. Aus “Lady Be Good” wurde dann “Les Bigoudis” oder “Soyez bonne madame”, aus “In the Mood” “Ambiance” oder “Dans l’ambiance”, aus “Blue and Sentimental” einfach “Bleu et sentimental”.
Eine Überlebensstrategie, die französische Jazzfans sich gleich zu Beginn der Besatzung ausdachten, war die Auslobung eines spezifischen “jazz français”. Gérard Régnier verfolgt die Aktivitäten der Szene um Charles Delaunay, den Hot Club de France und die bisherigen Spielstätten für Jazz insbesondere in Paris. Er beschäftigt sich damit, wie Jazz im Radio präsentiert wurde, beschreibt, wie das Vichy-Regime im Oktober 1942 einen Jazzbann aussprach, woraufhin die regelmäßigen Jazzsendungen etwa von Hugues Panassié von Marseille aus ausgestrahlt wurden. Auch im Schweizer Rundfunk ließen sich Jazzsendungen hören, und Radio Nimes brachte etwa am 18. Mai 1943 eine Sondersendung mit Musik von Django Reinhardt. Es gab zwar Tanzverbote, die aber nicht lange anhielten, wie Régnier aus einer zeitgenössischen Quelle zitiert: “Die Pariser mögen auf Essen und Rauchen verzichten und ein bisschen weniger Wein trinken. Aber sie gehen weiterhin ins Kino und ins Theater.” Die Erlasse trieben den Jazz höchstens noch mehr in die Keller als schon zuvor, in private Clubs, zu sogenannten “Tanzkursen” und subkulturellen Überraschungsparties. Letzten Endes aber verzeichnete das Moulin Rouge 1942 mehr als 60 Prozent mehr Zuschauer als noch 1941. Selbst in der deutschsprachigen “Pariser Zeitung” wurde 1941 “Der weltberühmte Django Reinhardt und das Quintett des Französischen Hot-Club” angekündigt.
Régnier verfolgt die Aktivitäten der beiden Hot-Club-Lenker Hugues Panassié, der auch während der Besatzung weiterhin Rundfunksendungen moderierte und Bücher publizierte (zum Schluss, 1944, in Genf), und Charles Delaunay, der versuchte, das Jazzleben in Paris mit unzähligen Konzerten am Laufen zu halten. Neben der Hauptstadt schaut Régnier aber auch auf andere Zentren, deren Jazzclubs sich im Hot Club de France zusammengeschlossen hatten, auf Bordeaux etwa oder Rennes, auf Le Mans, Angers, Troyes, Valenciennes, Marseille und Strasbourg, das ja nicht nur besetzt, sondern von den Deutschen annektiert worden war. Er wirft einen Blick auf die Konzentrationslager der Deutschen, in denen auch Jazzmusiker inhaftiert waren (die wohl als Soldaten gegen die Deutschen gekämpft hatten). Er berichtet über die Zazous und die “petits swings”, also die Swingfans, die dem Jazz vor allem als Modeerscheinung anhingen.
Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob der Jazz denn nun wirklich offiziell verboten war oder ob es sich dabei vor allem um eine Legende handelt. Régnier schaut sich die Erlasse der Besatzungsmacht durch, beleuchtet die Kontrollen der “Propagandastaffel” bei Konzerten und in Cabarets, berichtet über Zensur im Radio und Behinderungen bei Plattenaufnahmen. Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich mit den jüdischen Musikern in Frankreich, mit der Judenverfolgung in den besetzten Gebieten genauso wie im Vichy-Regime, die viele Menschen – darunter auch Musiker – dazu zwang, sich zu verstecken oder abzusetzen. Einige schwarze amerikanische Musiker waren in Frankreich geblieben; der Trompeter Arthur Briggs etwa wurde verhaftet und leitete in der Kaserne von Saint-Denis ein Orchester britischer Gefangener.
Schließlich befasst sich Régnier auch mit Django Reinhardt, in einem Kapitel, das er “Le cas Django Reinhardt” überschreibt”, “Der Fall Django Reinhardt”. Die Nazis hatten auch die “Zigeuner” in ihr “Endlösungs”-Programm einbeschlossen und Tausende Roma ermordet. Django Reinhardt aber war selbst bei Wehrmachtsoffizieren beliebt. Angeblich wollte der deutsche Kommandant, das Reinhardt auf eine Deutschlandtournee gehen solle, aber der Gitarrist weigerte sich, was ein Grund für seine Verhaftung im November 1943 gewesen sei, als er versuchte, die Schweizer Grenze zu passieren.
Kapitel 4 wendet sich den ideologischen Diskursen zu, die in jenen Jahren um den Jazz geführt wurden. Das Vichy-Regime sah im Jazz ein Zeichen des moralischen Verfalls und hielt ihm die heimische Folklore entgegen. Musiker, die für die deutschen Machthaber spielten oder gar Tourneen durch Deutschland absolvierten wie etwa Raymond Legrand, Charles Trenet oder Édith Piaf, wurden in der Szene schnell als Kollaborateure abgestempelt. Der Jazz war nie formell verboten, schlussfolgert Régnier; wenn überhaupt, dann stellte Jazz vielleicht eine Art “passiver Résistance” dar. 1944 wurde Paris von den Amerikanern befreit, Régnier wirft einen Blick auf die neue musikalische Freiheit, auf Konzerte der Royal Air Force Band, Glenn Millers Aufenthalt in Frankreich und die Sendungen auf AFN.Das Buch endet mit einer chronologischen Zeittafel der Ereignisse, einer ausführlichen Bibliographie sowie Quellendokumenten im Faksimile.
Régniers Arbeit ist ohne Zweifel Grundlagenforschung erster Güte – hervorragend recherchiert, lesenswert geschrieben und bei aller Nüchternheit der Fakten durchaus spannend zu lesen.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Herbie Nichols. A Jazzist’s Life
von Mark Miller
Toronto 2009 (Mercury Press)
224 Seiten, 19,95 US-$
ISBN: 978-1-55128-146-9
 Der Pianist Herbie Nichols war ein “musicians’ musician”, ein Musiker, der vor allem bei seinen Kollegen bewundert war, aber in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt wurde. Bei einem Kneipenbesuch habe er dessen Musik Jahren zufällig gehört, erzählt Miller in seinem Vorwort, und dann Frank Kimbraugh in New York angerufen, von dem er wusste, dass er viel Material über den Pianisten, sein Leben und seine Musik gesammelt hatte, um zu fragen, ob irgendwer sonst dessen Biographie schreibe. Nur wenig schriftliche Quellen standen ihm zur Verfügung und auch von den Musikern, die mit Nichols enger zusammengearbeitet hatten, lebten nicht mehr viele. Die Fakten, die Miller findet, verbindet er in seinem Buch mit einer Einordnung in die gesellschaftlichen und lokalen Verhältnisse der Zeit. Er erzählt, wie Nichols als Sohn von Eltern zur Welt kam, die aus Trinidad in die USA immigriert waren. Nichols nahm Klavierunterricht, entwickelte eine Liebe für russische Komponisten — Tschaikowski, Strawinsky, Rachmaninow — hörte aber auch die Jazzpianisten seiner Zeit, Jelly Roll Morton, Earl Hines, Duke Ellington, und spielte etwa ab 1937 mit den Royal Barons, einer Tanzkapelle. In den frühen 1940er Jahren war er in den Bebop-Kneipen präsent, auch wenn er, wie Leonard Feather berichtete, von den jungen Beboppern nicht ganz anerkannt und schon mal vom Klavierhocker vertrieben wurde. Von 1941 bis 1942 war er in der Army, spielte danach in einem Cabaret in Harlem und schrieb außerdem eine Kolumne für die Zeitschrift “The Music Dial”, in der er die Szene kommentierte und Thelonious Monks seltsame Musik lobte. Es dauerte nicht lang und auch Nichols gehörte zu dem Kreis, der sich um Monk bildete. In den späten 1940er Jahren arbeitete er mit Illinois Jacquet und John Kirby, gab außerdem Unterricht in “Jazz Theory – Bebop”. Er freundete sich mit Mary Lou Williams an, die drei seiner Kompositionen einspielte. Nichols selbst nahm erst im März 1952 sein erstes Album für das Label Hi-Lo auf, das eigentlich den Gospel- und R&B-Markt anpeilte. Seiner Karriere half das wenig — er musste Dixieland- und R&B-Gigs spielen, um sich über Wasser zu halten. 1955 nahm er seine erste Platte für das Blue-Note-Label auf und bekam damit endlich eine größere Sichtbarkeit sowohl in der Fachpresse als auch auf der New Yorker Szene — und zwar mit seiner eigenen Musik. Das Magazin Metronome brachte einen ausführlichen Artikel, in dem Nichols seine musikalische Ästhetik darlegen und erklären konnte, dass seine Definition des Jazz eher eine lockere sei: Jazz sei jede Art von Musik, die mit einem Swing-Beat gespielt werde und irgendeine Art von Improvisation enthalte. 1956 begleitete er für kurze Zeit Billie Holiday, die seinen Song “Serenade” als “Lady Sings the Blues” aufnahm. Nebenbei schrieb er Gedichte, die er an Freunde schickte und von denen Miller einige abdruckt. 1958 war Nichols allerdings schon wieder weitgehend von der Szene verschwunden, tauchte noch einmal kurz bei einer Mainstream-Session des Trompeters Joe Thomas auf, die zugleich seine letzte Einspielung sein sollte. Er trat mit Sheila Jordan auf und gab Roswell Rudd informellen Unterricht. 1961 zeichnete sich allerdings bereits ab, dass es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten bestellt war. Immerhin reiste er 1962 zum ersten Mal nach Europa, wo er mit seinem Trio in Helsinki beim Festival “Young America Presents” mitwirkte. Anfang 1963 ging es ihm immer schlechter, und die Ärzte diagnostizierten Leukämie. Herbie Nichols starb am 12. April. Miller erzählt die Geschichte des Pianisten entlang der Quellen — Zeitungsberichten, Zeitzeugeninterviews, Plattenaufnahmen, Liner Notes. Er beschreibt ein Leben zwischen Avantgarde-Ästhetik und Entertainment zum Brotverdienen, das Leben eines klugen, selbstbewussten Mannes, dem dennoch der populäre Erfolg und die große Anerkennung zu Lebzeiten versagt blieben. Nach seinem Tod wurde er irgendwann wiederentdeckt, von Misha Mengelberg etwa, der zeitlebens ein Nichols-Fan war oder vom New Yorker Pianisten Frank Kimbraugh, der ein eigenes Nichols-Projekt auf die Beine stellte, aber auch von Roswell Rudd und vielen anderen Musikern — aus der ganzen Welt. Millers Buch ist gerade deshalb lesenswert, weil über Nichols so wenig bekannt ist. .A.B. Spellman hatte in seinem Buch “Black Music. Four Lives” die bislang ausführlichste Würdigung Nichols’ verfasst, auf die sich auch Miller immer wieder stützt. Dazu aber sammelt Miller genügend weiteres Material, um seine Biographie zu einem neuen Standardwerk über den Pianisten zu machen. Die musikalische Bewertung überlässt er dabei Musikerkollegen; hier also wäre noch einiges zu leisten, obwohl Roswell Rudd da bereits selbst ein spannendes Büchlein vorgelegt hat. Zum Schluss seines Buchs gibt es eine Diskographie der Aufnahmen, an denen Nichols selbst beteiligt war, sowie von Platten anderer Künstler, auf denen Nichols-Kompositionen gespielt wurden.
Der Pianist Herbie Nichols war ein “musicians’ musician”, ein Musiker, der vor allem bei seinen Kollegen bewundert war, aber in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt wurde. Bei einem Kneipenbesuch habe er dessen Musik Jahren zufällig gehört, erzählt Miller in seinem Vorwort, und dann Frank Kimbraugh in New York angerufen, von dem er wusste, dass er viel Material über den Pianisten, sein Leben und seine Musik gesammelt hatte, um zu fragen, ob irgendwer sonst dessen Biographie schreibe. Nur wenig schriftliche Quellen standen ihm zur Verfügung und auch von den Musikern, die mit Nichols enger zusammengearbeitet hatten, lebten nicht mehr viele. Die Fakten, die Miller findet, verbindet er in seinem Buch mit einer Einordnung in die gesellschaftlichen und lokalen Verhältnisse der Zeit. Er erzählt, wie Nichols als Sohn von Eltern zur Welt kam, die aus Trinidad in die USA immigriert waren. Nichols nahm Klavierunterricht, entwickelte eine Liebe für russische Komponisten — Tschaikowski, Strawinsky, Rachmaninow — hörte aber auch die Jazzpianisten seiner Zeit, Jelly Roll Morton, Earl Hines, Duke Ellington, und spielte etwa ab 1937 mit den Royal Barons, einer Tanzkapelle. In den frühen 1940er Jahren war er in den Bebop-Kneipen präsent, auch wenn er, wie Leonard Feather berichtete, von den jungen Beboppern nicht ganz anerkannt und schon mal vom Klavierhocker vertrieben wurde. Von 1941 bis 1942 war er in der Army, spielte danach in einem Cabaret in Harlem und schrieb außerdem eine Kolumne für die Zeitschrift “The Music Dial”, in der er die Szene kommentierte und Thelonious Monks seltsame Musik lobte. Es dauerte nicht lang und auch Nichols gehörte zu dem Kreis, der sich um Monk bildete. In den späten 1940er Jahren arbeitete er mit Illinois Jacquet und John Kirby, gab außerdem Unterricht in “Jazz Theory – Bebop”. Er freundete sich mit Mary Lou Williams an, die drei seiner Kompositionen einspielte. Nichols selbst nahm erst im März 1952 sein erstes Album für das Label Hi-Lo auf, das eigentlich den Gospel- und R&B-Markt anpeilte. Seiner Karriere half das wenig — er musste Dixieland- und R&B-Gigs spielen, um sich über Wasser zu halten. 1955 nahm er seine erste Platte für das Blue-Note-Label auf und bekam damit endlich eine größere Sichtbarkeit sowohl in der Fachpresse als auch auf der New Yorker Szene — und zwar mit seiner eigenen Musik. Das Magazin Metronome brachte einen ausführlichen Artikel, in dem Nichols seine musikalische Ästhetik darlegen und erklären konnte, dass seine Definition des Jazz eher eine lockere sei: Jazz sei jede Art von Musik, die mit einem Swing-Beat gespielt werde und irgendeine Art von Improvisation enthalte. 1956 begleitete er für kurze Zeit Billie Holiday, die seinen Song “Serenade” als “Lady Sings the Blues” aufnahm. Nebenbei schrieb er Gedichte, die er an Freunde schickte und von denen Miller einige abdruckt. 1958 war Nichols allerdings schon wieder weitgehend von der Szene verschwunden, tauchte noch einmal kurz bei einer Mainstream-Session des Trompeters Joe Thomas auf, die zugleich seine letzte Einspielung sein sollte. Er trat mit Sheila Jordan auf und gab Roswell Rudd informellen Unterricht. 1961 zeichnete sich allerdings bereits ab, dass es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten bestellt war. Immerhin reiste er 1962 zum ersten Mal nach Europa, wo er mit seinem Trio in Helsinki beim Festival “Young America Presents” mitwirkte. Anfang 1963 ging es ihm immer schlechter, und die Ärzte diagnostizierten Leukämie. Herbie Nichols starb am 12. April. Miller erzählt die Geschichte des Pianisten entlang der Quellen — Zeitungsberichten, Zeitzeugeninterviews, Plattenaufnahmen, Liner Notes. Er beschreibt ein Leben zwischen Avantgarde-Ästhetik und Entertainment zum Brotverdienen, das Leben eines klugen, selbstbewussten Mannes, dem dennoch der populäre Erfolg und die große Anerkennung zu Lebzeiten versagt blieben. Nach seinem Tod wurde er irgendwann wiederentdeckt, von Misha Mengelberg etwa, der zeitlebens ein Nichols-Fan war oder vom New Yorker Pianisten Frank Kimbraugh, der ein eigenes Nichols-Projekt auf die Beine stellte, aber auch von Roswell Rudd und vielen anderen Musikern — aus der ganzen Welt. Millers Buch ist gerade deshalb lesenswert, weil über Nichols so wenig bekannt ist. .A.B. Spellman hatte in seinem Buch “Black Music. Four Lives” die bislang ausführlichste Würdigung Nichols’ verfasst, auf die sich auch Miller immer wieder stützt. Dazu aber sammelt Miller genügend weiteres Material, um seine Biographie zu einem neuen Standardwerk über den Pianisten zu machen. Die musikalische Bewertung überlässt er dabei Musikerkollegen; hier also wäre noch einiges zu leisten, obwohl Roswell Rudd da bereits selbst ein spannendes Büchlein vorgelegt hat. Zum Schluss seines Buchs gibt es eine Diskographie der Aufnahmen, an denen Nichols selbst beteiligt war, sowie von Platten anderer Künstler, auf denen Nichols-Kompositionen gespielt wurden.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Das große Buch der Trompete, Band 2
von Friedel Keim
Mainz 2009 (Schott)
482 Seiten, 39,95 Euro
ISBN: 978-3-7957-0677-7
 Friedel Keim veröffentlichte 2005 sein “Großes Buch der Trompete”, das auch auf dieser Website gewürdigt wurde. Nur vier Jahre später legt er einen Ergänzungsband vor, der mehr als halb so dick wie der ursprüngliche Band ist und den in Band 1 enthaltenen 2.043 Biographien noch einmal 757 Kurzbiographien hinzufügt. Wieder ist Keim genreübergreifender Detektiv, forscht nach Geburts- und Sterbedaten selbst von Musikern, die nicht in der ersten Reihe standen, sondern vielleicht eher zu den zweitrangigen Musikern ihres Faches gehörten bzw. gehören. Seine Liebe gilt deutlich dem Jazz, aber klassische Trompeter finden genauso ausführlich Erwähnung wie Musiker aus dem Showgeschäft oder aus dem Rock- und Popbusiness. In Band 2 gibt es nicht mehr die anz großen Stars — die wurden bereits im ersten Band abgefeiert. Dafür finden sich viele Musiker, die einem kaum ein Begriff sind, deren Namen man aber von den Besetzungslisten großer Bands erinnert, wenn man ihre Biographie liest. Außerdem gibt es Ergänzungen und Korrekturen zum ersten Band und einige lesenswerte Kapitel etwa über die Trompete im (insbesondere deutschen) Fernsehen, die Trompete in der Literatur, Weiterentwicklungen des Instruments, eine ausführliche Bibliographie von Trompetenschulen sowie ein “Trompeten-Kuriositäten” überschriebenes Kapitel, in dem Keim etwa über Trompetenärmel in der Mode sinniert oder eine Trompetenwette aus “Wetten Dass…?” beschreibt, ein Lippenmassagegerät vorstellt und über einen Zwischenfall am Pariser Flughafen berichtet, bei dem Valery Ponomarev seine Trompete nicht aufgeben,. sondern als Handgepäck mitnehmen wollte, worauf es zu einem Handgemenge kam, bei dem er sich den Arm brach. Keim ist Mainzer, also ist der Schelm nicht weit, und ein paar Witze gibt’s auch, etwa diesen: “Ein Trompeter übt jeden Tag volle acht Stunden lang. Da sagt ein Kollege zu ihm: ‘Wie schaffst du das nur? Also ich könnte das nicht.’ ‘man muss eben wissen, was man will.’ ‘Und was willst du?’ ‘Die Wohnung nebenan!'” Ein Nachschlagewerk, das es also nicht an Abwechslung mangeln lässt, spannend zu durchblättern und für Trompetenliebhaber — wie schon Band 1 — ein absolutes Muss.
Friedel Keim veröffentlichte 2005 sein “Großes Buch der Trompete”, das auch auf dieser Website gewürdigt wurde. Nur vier Jahre später legt er einen Ergänzungsband vor, der mehr als halb so dick wie der ursprüngliche Band ist und den in Band 1 enthaltenen 2.043 Biographien noch einmal 757 Kurzbiographien hinzufügt. Wieder ist Keim genreübergreifender Detektiv, forscht nach Geburts- und Sterbedaten selbst von Musikern, die nicht in der ersten Reihe standen, sondern vielleicht eher zu den zweitrangigen Musikern ihres Faches gehörten bzw. gehören. Seine Liebe gilt deutlich dem Jazz, aber klassische Trompeter finden genauso ausführlich Erwähnung wie Musiker aus dem Showgeschäft oder aus dem Rock- und Popbusiness. In Band 2 gibt es nicht mehr die anz großen Stars — die wurden bereits im ersten Band abgefeiert. Dafür finden sich viele Musiker, die einem kaum ein Begriff sind, deren Namen man aber von den Besetzungslisten großer Bands erinnert, wenn man ihre Biographie liest. Außerdem gibt es Ergänzungen und Korrekturen zum ersten Band und einige lesenswerte Kapitel etwa über die Trompete im (insbesondere deutschen) Fernsehen, die Trompete in der Literatur, Weiterentwicklungen des Instruments, eine ausführliche Bibliographie von Trompetenschulen sowie ein “Trompeten-Kuriositäten” überschriebenes Kapitel, in dem Keim etwa über Trompetenärmel in der Mode sinniert oder eine Trompetenwette aus “Wetten Dass…?” beschreibt, ein Lippenmassagegerät vorstellt und über einen Zwischenfall am Pariser Flughafen berichtet, bei dem Valery Ponomarev seine Trompete nicht aufgeben,. sondern als Handgepäck mitnehmen wollte, worauf es zu einem Handgemenge kam, bei dem er sich den Arm brach. Keim ist Mainzer, also ist der Schelm nicht weit, und ein paar Witze gibt’s auch, etwa diesen: “Ein Trompeter übt jeden Tag volle acht Stunden lang. Da sagt ein Kollege zu ihm: ‘Wie schaffst du das nur? Also ich könnte das nicht.’ ‘man muss eben wissen, was man will.’ ‘Und was willst du?’ ‘Die Wohnung nebenan!'” Ein Nachschlagewerk, das es also nicht an Abwechslung mangeln lässt, spannend zu durchblättern und für Trompetenliebhaber — wie schon Band 1 — ein absolutes Muss.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Clarinet Bird. Rolf Kühn. Jazzgespräche
von Maxi Sickert
Berlin 2009 (Christian Broecking Verlag), passim (F)
242 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-938763-10-0
 Es ist vielleicht das spannendste deutsche Jazzbuch des Jahres 2009, und man wundert sich, warum niemand früher auf die Idee gekommen ist, die Geschichte des Klarinettisten Rolf Kühn festzuhalten, der in den späten 1940er und den 1950er Jahren als junger Star des deutschen Jazz gefeiert wurde, den es dann nach New York verschlug, wo er mit Benny Goodman und Billie Holiday spielte, bevor er in den 1960er Jahren wieder zurück nach Deutschland kam, sich — auch angespornt durch das Zusammenspiel mit seinem jüngeren Bruder Joachim — avancierteren Stilrichtungen zuwandte, bevor er in den 1980er Jahren vor allem als Dirigent und Filmkomponist in Erscheinung trat. Die Liebe zum Jazz aber ließ ihn nie los, und von ihr handelt dieses Buch. Maxi Sickert lässt Rolf Kühn erzählen, über seine Kindheit in Leipzig, seinen Onkel und seine Tante, die als Juden in Auschwitz ermordet wurden, über seine Eltern und die Arbeit seines Vaters als Zirkusakrobat, über die ersten Klarinettenstunden und den ersten Jazz, über Jutta Hipp, den RIAS und das 1. Deutsche Jazz Festival in Frankfurt. Er traf den amerikanischen Klarinettisten Buddy De Franco und entschied sich, nach Amerika zu gehen, traf dort auf Friedrich Gulda und John Hammond, der seine erste amerikanische Platte produzierte. Ein langes Kapitel befasst sich mit Benny Goodman, in dessen Orchester Kühn von 1958 bis 1960 saß. 1960 spielte er mit Jimmy Garrison im Small’s Paradise; damals wohnte er auf der 87sten Straße im selben Haus wie Billie Holiday. Für Cannonball Adderley schrieb er Streicherarrangements und war danach auch sonst als Arrangeur für Platten und Werbefilme aktiv. 1961 kehrte Kühn zurück nach Deutschland. In den 1960er Jahren trat er oft bei den legendären NDR Jazz-Workshops auf, lernte außerdem Dirigieren. 1966 war Kühn bei der Uraufführung von Gunther Schullers Oper “The Visitation” in Hamburg mit von der Partie, die neben dem klassischen Klangkörper auch ein Jazzensemble verwandte (und hier erzählt neben Kühn auch Schuller persönlich). Ebenfalls 1966 floh Joachim Kühn aus der DDR und die beiden Brüder taten sich in einer neuen Band zusammen. Sie traten 1967 beim Newport Jazz Festival auf und nahmen die Platte “Impressions of New York” auf. (Auch Joachim Kühn kommt ausführlich zu Wort im Buch.) Rolf Kühn erzählt über Joachim Ernst Berendt und das Plattenkabel MPS, über die Tücken seines Instruments, der Klarinette, und seine Begegnung mit Ornette Coleman. Schließlich erzählt er von seiner jüngsten Band, einem Trio mit dem Schlagzeuger Christian Lillinger, dem Gitarristen Ronny Graupe und dem Bassisten Johannes Fink. Und in einem “Letze Fragen” überschrieben Rundumschlag äußert er sich über Drogen, Rassismus, Musicals und die Eigenständigkeit des deutschen Jazz. Ausgespart sind seine Zeiten als musikalischer Leiter des Theater des Westens, Informationen über seine Filmmusiken oder persönlichere Erfahrungen, etwa in seiner Ehe mit der Schauspielerin Judy Winter. Aber dann heißt der Untertitel des Buchs ja auch “Jazzgespräche”. 35 Seiten mit seltenen Fotos runden das Buch ab, das von Maxi Sickert zu einer äußerst lesenswerten und unterhaltsamen Reise durch die deutsche Jazzgeschichte und die Entwicklung eines vielschichtigen Musikers zusammengefasst wurde, ein Buch das vieles erklärt, was in vielleicht sachlicheren Büchern zur Jazzgeschichte nicht erwähnt wird, was aber die Schubladen ein wenig durcheinander rüttelt, weil sich Jazzbiographien nun mal selten in einer einzigen ästhetischen Schublade abspielen. Es ist ein Musterbeispiel einer von der Herausgeberin mit sicherer Hand geführten Autobiographie, die am Schluss neugierig macht auf den Klang des Protagonisten, der dankenswerter Weise zum 80sten Geburtstag Kühns auf etlichen CD-Wiederveröffentlichungen wieder greif- und hörbar ist.
Es ist vielleicht das spannendste deutsche Jazzbuch des Jahres 2009, und man wundert sich, warum niemand früher auf die Idee gekommen ist, die Geschichte des Klarinettisten Rolf Kühn festzuhalten, der in den späten 1940er und den 1950er Jahren als junger Star des deutschen Jazz gefeiert wurde, den es dann nach New York verschlug, wo er mit Benny Goodman und Billie Holiday spielte, bevor er in den 1960er Jahren wieder zurück nach Deutschland kam, sich — auch angespornt durch das Zusammenspiel mit seinem jüngeren Bruder Joachim — avancierteren Stilrichtungen zuwandte, bevor er in den 1980er Jahren vor allem als Dirigent und Filmkomponist in Erscheinung trat. Die Liebe zum Jazz aber ließ ihn nie los, und von ihr handelt dieses Buch. Maxi Sickert lässt Rolf Kühn erzählen, über seine Kindheit in Leipzig, seinen Onkel und seine Tante, die als Juden in Auschwitz ermordet wurden, über seine Eltern und die Arbeit seines Vaters als Zirkusakrobat, über die ersten Klarinettenstunden und den ersten Jazz, über Jutta Hipp, den RIAS und das 1. Deutsche Jazz Festival in Frankfurt. Er traf den amerikanischen Klarinettisten Buddy De Franco und entschied sich, nach Amerika zu gehen, traf dort auf Friedrich Gulda und John Hammond, der seine erste amerikanische Platte produzierte. Ein langes Kapitel befasst sich mit Benny Goodman, in dessen Orchester Kühn von 1958 bis 1960 saß. 1960 spielte er mit Jimmy Garrison im Small’s Paradise; damals wohnte er auf der 87sten Straße im selben Haus wie Billie Holiday. Für Cannonball Adderley schrieb er Streicherarrangements und war danach auch sonst als Arrangeur für Platten und Werbefilme aktiv. 1961 kehrte Kühn zurück nach Deutschland. In den 1960er Jahren trat er oft bei den legendären NDR Jazz-Workshops auf, lernte außerdem Dirigieren. 1966 war Kühn bei der Uraufführung von Gunther Schullers Oper “The Visitation” in Hamburg mit von der Partie, die neben dem klassischen Klangkörper auch ein Jazzensemble verwandte (und hier erzählt neben Kühn auch Schuller persönlich). Ebenfalls 1966 floh Joachim Kühn aus der DDR und die beiden Brüder taten sich in einer neuen Band zusammen. Sie traten 1967 beim Newport Jazz Festival auf und nahmen die Platte “Impressions of New York” auf. (Auch Joachim Kühn kommt ausführlich zu Wort im Buch.) Rolf Kühn erzählt über Joachim Ernst Berendt und das Plattenkabel MPS, über die Tücken seines Instruments, der Klarinette, und seine Begegnung mit Ornette Coleman. Schließlich erzählt er von seiner jüngsten Band, einem Trio mit dem Schlagzeuger Christian Lillinger, dem Gitarristen Ronny Graupe und dem Bassisten Johannes Fink. Und in einem “Letze Fragen” überschrieben Rundumschlag äußert er sich über Drogen, Rassismus, Musicals und die Eigenständigkeit des deutschen Jazz. Ausgespart sind seine Zeiten als musikalischer Leiter des Theater des Westens, Informationen über seine Filmmusiken oder persönlichere Erfahrungen, etwa in seiner Ehe mit der Schauspielerin Judy Winter. Aber dann heißt der Untertitel des Buchs ja auch “Jazzgespräche”. 35 Seiten mit seltenen Fotos runden das Buch ab, das von Maxi Sickert zu einer äußerst lesenswerten und unterhaltsamen Reise durch die deutsche Jazzgeschichte und die Entwicklung eines vielschichtigen Musikers zusammengefasst wurde, ein Buch das vieles erklärt, was in vielleicht sachlicheren Büchern zur Jazzgeschichte nicht erwähnt wird, was aber die Schubladen ein wenig durcheinander rüttelt, weil sich Jazzbiographien nun mal selten in einer einzigen ästhetischen Schublade abspielen. Es ist ein Musterbeispiel einer von der Herausgeberin mit sicherer Hand geführten Autobiographie, die am Schluss neugierig macht auf den Klang des Protagonisten, der dankenswerter Weise zum 80sten Geburtstag Kühns auf etlichen CD-Wiederveröffentlichungen wieder greif- und hörbar ist.
(Wolfram Knauer (Januar 2010)
The Year Before the Flood. A Story of New Orleans
von Ned Sublette
Chicago 2009 (Lawrence Hill Books)
452 Seiten
ISBN: 978-1-55652-824-8
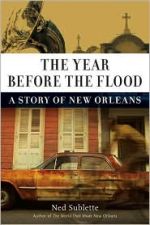 Wo Ned Sublette in seinem bereits besprochenen, vielgerühmten Buch zur Kolonialisierung von New Orleans die Frühgeschichte der Stadt erzählt, in der der Jazz geboren wurde, da beleuchtet er in seinem neuesten Buch die Stadt in der Gegenwart des Jahres 2005, im Jahr vor dem Hurricane Katrina, der die Stadt in ihren Grundfesten erschütterte, nicht nur die architektonische Schäden anrichtete, sondern die Struktur der Stadt als soziales Gebilde, ja sogar ihre bloße Existenz in Frage stellte. Das Manuskript über das Leben in New Orleans war ebreits weit forgeschritten, als der Hurricane am 27. August 2005 auf die Stadt am MississippiDelta zustürmte.Jeder in New Orleans habe gewusst, dass eine Katastrophe bevorstand, und jeder habe es offenen Auges verdrängt. Auch die Armen hätten es gewusst, und sie hätte es am stärksten getroffen. Sie seien schließlich mit OneWayTickets aus der Stadt gebracht worden und ihre Rückkehr sei durch Bürokratie oder die Dampfwalzen der Regierung erschwert oder unmöglich gemachtt worden. Das Buch entstand parallel zu seinen Forschungen zu den kulturellen Verbindungen zwischen New Orleans, Kuba und Santo Domingo im 18. und 19. Jahrhundert. Nach Katrina lag das Manuskript auf seinem Schreibtisch; die Folgen des Hurricanes waren so enorm, dass Sublette das Buchthema änderte und neben den sozialen und kulturellen Bedingungen der Stadt auch deren Bezug zur Gegenwart aufzeigen wollte, zur Zeit vor und zur Zeit nach Katrina. Das Buch enthält viele autobiographische Notizen — Sublette lebte bis zu seinem neunten Lebensjahr in New Orleans — hier finden sich die meisten und eindringlichsten historischen Informationen über den alltäglichen Rassismus der 50er, 60er und 70er Jahre und die Probleme ihn zu überkommen. Ein längerer Exkurs erzählt die Geschichte des rassistischen Films “The Birth of a Nation” von 1915, daneben aber auch Sublettes eigenen Erlebnisse mit dem Rassismus des amerikanischen Süden oder über die Arbeitsmöglichkeiten für schwarze Musiker im New Orleans der 1950er Jahre. Er erzählt Geschichten über seinen Aufenthalt für die Recherchen zu dem Buch, im jahr vor Katrina, über die sozialen Ungleichheiten der Stadt, über den Kulturschock, den er als mittlerweile New Yorker bei der Rückkehr in den Süden empfand, über alte Jazzmusiker und die Hip-Hop-Szene der Stadt, über Mardi Gras und die karribischen Verbindungen, über das JazzFest, Super Sunday und den “mörderischen Sommer” vor dem Hurricane. Schließlich der kürzere dritte Teil des Buchs, geschrieben nach Katrina, im Schock der Ereignisse und der hilflosen Versuche einer Rettung der Stadt. New Orleans sei immer anders als alle anderen Großstädte der USA gewesen, schreibt Sublette: Die Stadt mit dem unsichersten Boden des Landes wurde bewohnt von den Menschen mit den tiefsten Wurzeln. Die meisten der Menschen, die in New Orleans lebten, waren sein Generationen in der Stadt verwurzelt. Genau das ist es, was er in seinem Buch nachzuzeichnen evrsucht, und die persönliche Betroffenheit, mit der er Gegenwart, Geschichte und Autobiographisches verwebt macht das Buch zu einer spannenden Lektüre, die einen zurückläßt einw enig wie der Blues: traurig, aber hoffend und in jedem Fall beeindruckt vond er Stärke der in die Geschichte verwickelten Menschen.
Wo Ned Sublette in seinem bereits besprochenen, vielgerühmten Buch zur Kolonialisierung von New Orleans die Frühgeschichte der Stadt erzählt, in der der Jazz geboren wurde, da beleuchtet er in seinem neuesten Buch die Stadt in der Gegenwart des Jahres 2005, im Jahr vor dem Hurricane Katrina, der die Stadt in ihren Grundfesten erschütterte, nicht nur die architektonische Schäden anrichtete, sondern die Struktur der Stadt als soziales Gebilde, ja sogar ihre bloße Existenz in Frage stellte. Das Manuskript über das Leben in New Orleans war ebreits weit forgeschritten, als der Hurricane am 27. August 2005 auf die Stadt am MississippiDelta zustürmte.Jeder in New Orleans habe gewusst, dass eine Katastrophe bevorstand, und jeder habe es offenen Auges verdrängt. Auch die Armen hätten es gewusst, und sie hätte es am stärksten getroffen. Sie seien schließlich mit OneWayTickets aus der Stadt gebracht worden und ihre Rückkehr sei durch Bürokratie oder die Dampfwalzen der Regierung erschwert oder unmöglich gemachtt worden. Das Buch entstand parallel zu seinen Forschungen zu den kulturellen Verbindungen zwischen New Orleans, Kuba und Santo Domingo im 18. und 19. Jahrhundert. Nach Katrina lag das Manuskript auf seinem Schreibtisch; die Folgen des Hurricanes waren so enorm, dass Sublette das Buchthema änderte und neben den sozialen und kulturellen Bedingungen der Stadt auch deren Bezug zur Gegenwart aufzeigen wollte, zur Zeit vor und zur Zeit nach Katrina. Das Buch enthält viele autobiographische Notizen — Sublette lebte bis zu seinem neunten Lebensjahr in New Orleans — hier finden sich die meisten und eindringlichsten historischen Informationen über den alltäglichen Rassismus der 50er, 60er und 70er Jahre und die Probleme ihn zu überkommen. Ein längerer Exkurs erzählt die Geschichte des rassistischen Films “The Birth of a Nation” von 1915, daneben aber auch Sublettes eigenen Erlebnisse mit dem Rassismus des amerikanischen Süden oder über die Arbeitsmöglichkeiten für schwarze Musiker im New Orleans der 1950er Jahre. Er erzählt Geschichten über seinen Aufenthalt für die Recherchen zu dem Buch, im jahr vor Katrina, über die sozialen Ungleichheiten der Stadt, über den Kulturschock, den er als mittlerweile New Yorker bei der Rückkehr in den Süden empfand, über alte Jazzmusiker und die Hip-Hop-Szene der Stadt, über Mardi Gras und die karribischen Verbindungen, über das JazzFest, Super Sunday und den “mörderischen Sommer” vor dem Hurricane. Schließlich der kürzere dritte Teil des Buchs, geschrieben nach Katrina, im Schock der Ereignisse und der hilflosen Versuche einer Rettung der Stadt. New Orleans sei immer anders als alle anderen Großstädte der USA gewesen, schreibt Sublette: Die Stadt mit dem unsichersten Boden des Landes wurde bewohnt von den Menschen mit den tiefsten Wurzeln. Die meisten der Menschen, die in New Orleans lebten, waren sein Generationen in der Stadt verwurzelt. Genau das ist es, was er in seinem Buch nachzuzeichnen evrsucht, und die persönliche Betroffenheit, mit der er Gegenwart, Geschichte und Autobiographisches verwebt macht das Buch zu einer spannenden Lektüre, die einen zurückläßt einw enig wie der Blues: traurig, aber hoffend und in jedem Fall beeindruckt vond er Stärke der in die Geschichte verwickelten Menschen.
(Wolfram Knauer)
Ellington Uptown. Duke Ellington, James P. Johnson, and the Birth of Cool Jazz
von John Howland
Ann Arbor 2009 (University of Michigan Press)
340 Seiten, 28,95 US-$
ISBN: 978-0-472-03316-4
 Wenn man von “sinfonischem jazz” spricht, so tut man das in Jazzerkreisen meist etwas herablassend und denkt an die Aufnahmen Paul Whitemans, der eine “Lady” aus dem Jazz machen wollte, die raue Musik der Afro-Amerikaner in schöne Kleider verpacken, sie aus den Kaschemmen nehmen und in die Konzertsäle des Landes bringen wollte. Nun ist das schon mit der Verteufelung Paul Whitemans so eine Sache: Nicht nur hatte er in seiner Band immer hervorragende Jazzsolisten (Bix Beiderbecke etwa oder Frank Trumbauer, aber auch Joe Venuti, Jack Tegarden und viele andere). Vor allem aber gehörchte sein ästhetisches Konzept völlig anderen Gesetzen als das des Jazz derselben Zeit — ihn also nach den Maßstäben zu messen, die man an Armstrong, Morton, Ellington, Henderson und andere anlegte, wäre beiden Seiten gegenüber völlig unangemessen. John Howland beleuchtet in seinem Buch eine oft vergessene Seite dieses “sinfonischen Jazz”, die Annäherung von schwarzen Jazzkomponisten ans Oeuvre ihrer klassischen Kollegen. Schon ältere Musiker wie Will Marion Cook, Will Vodery, James Reese Europe und andere hatten mit ihrer Musik nicht nur auf die Tanz-, sondern auch auf die Konzertsäle gezielt, wollten eine Musik schreiben, die nicht nur in die Beine ging, sondern auch als Konzertmusik überdauern konnte. Vor allem der Pianist und Komponist James P. Johnson sowie der Pianist und Bandleader Duke Ellington nahmen sich des Oeuvres eines Konzertjazz ernsthaft und langfristig an und schrieben Kompositionen, die die üblichen formalen und ästhetischen Modelle des Jazz durchbrachen. Howland diskutiert die grundsätzliche Idee eines “sinfonischen Jazz”, wie sie sich erstmals in Paul Whitemans Aeolian-Hall-Konzert “First Experiment in Modern Music” von 1924 zeigte und die Reaktionen auf Jazz und “Kunst-Jazz” von ganz unterschiedlichen Seiten: jener der klassischen Kritiker genauso wie jener der Wortführer der Harlem Renaissance, die jedem künstlerischen Konzept gegenüber weitaus aufgeschlossener waren als einer schwarzen Folklore. In einem ersten Kapitel beschreibt Howland das vielfältige Beziehungsgeflecht zwischen Jazz, Blues und schwarzem Entertainment, innerhalb dessen auch Johnson und Ellington ihre oft für die Bühne konzipierten Werke erarbeiteten. Ein zweites Kapitel ist Johnsons “Yamekraw” gewidmet, einer Komposition, die auf volksmusikalischen Melodien aus den amerikanischen Südstaaten (Georgia, South Carolina) basiert. Im dritten Kapitel beschreibt er, wie die Konzertambitionen und die Bühnenmusikerfahrungen beider Komponisten, Johnson und Ellington, sich gegenseitig beeinflussten, analysisert Ellingtons Cotton-Club-Shows oder seinen Kurzfilm “Symphony in Black”, um dann im vierten Kapitel die “extended compositions” des Duke zu untersuchen, von “Rhapsody Junior” (1926) bis zu “Black, Brown and Beige” (1943) und sie mit Kompositionen aus dem Whiteman’schen Oeuvre zu vergleichen. Für ein Kapitel über Johnsons “Harlem Symphony” greift Howland auf bislang unbekanntes Material im Johnson-Nachlass zurück und betrachtet in einem sechsten Kapitel Ellingtons Carnegie-Hall-Konzerte über die Jahre und die programmatischen Ideen, die ihnen zugrunde lagen. Sein Schlusskapitel vergleicht die unterschiedlichen ästhetischen Ansätze seiner beiden protagonisten und diskutiert ihren ästhetischen wie kompositorischen Einfluss. Howlands Buch deckt damit eine vielfach vernachlässigte Seite der Jazzgeschichte auf, in gründlich recherchierten, mit Notenbeispielen und Formanalysen durchsetzten Argumentationssträngen, die einmal mehr klar machen, dass viele Jazzmusiker, die man allgemein vor allem für ihre gutgelaunte Musik schätzt, ganz andere Motivationen hatten, dass noch hinter dem swingendsten Stück Musik jede Menge ästhetischen Wollens stecken kann — wenn man nur weiß, wo man schauen muss.
Wenn man von “sinfonischem jazz” spricht, so tut man das in Jazzerkreisen meist etwas herablassend und denkt an die Aufnahmen Paul Whitemans, der eine “Lady” aus dem Jazz machen wollte, die raue Musik der Afro-Amerikaner in schöne Kleider verpacken, sie aus den Kaschemmen nehmen und in die Konzertsäle des Landes bringen wollte. Nun ist das schon mit der Verteufelung Paul Whitemans so eine Sache: Nicht nur hatte er in seiner Band immer hervorragende Jazzsolisten (Bix Beiderbecke etwa oder Frank Trumbauer, aber auch Joe Venuti, Jack Tegarden und viele andere). Vor allem aber gehörchte sein ästhetisches Konzept völlig anderen Gesetzen als das des Jazz derselben Zeit — ihn also nach den Maßstäben zu messen, die man an Armstrong, Morton, Ellington, Henderson und andere anlegte, wäre beiden Seiten gegenüber völlig unangemessen. John Howland beleuchtet in seinem Buch eine oft vergessene Seite dieses “sinfonischen Jazz”, die Annäherung von schwarzen Jazzkomponisten ans Oeuvre ihrer klassischen Kollegen. Schon ältere Musiker wie Will Marion Cook, Will Vodery, James Reese Europe und andere hatten mit ihrer Musik nicht nur auf die Tanz-, sondern auch auf die Konzertsäle gezielt, wollten eine Musik schreiben, die nicht nur in die Beine ging, sondern auch als Konzertmusik überdauern konnte. Vor allem der Pianist und Komponist James P. Johnson sowie der Pianist und Bandleader Duke Ellington nahmen sich des Oeuvres eines Konzertjazz ernsthaft und langfristig an und schrieben Kompositionen, die die üblichen formalen und ästhetischen Modelle des Jazz durchbrachen. Howland diskutiert die grundsätzliche Idee eines “sinfonischen Jazz”, wie sie sich erstmals in Paul Whitemans Aeolian-Hall-Konzert “First Experiment in Modern Music” von 1924 zeigte und die Reaktionen auf Jazz und “Kunst-Jazz” von ganz unterschiedlichen Seiten: jener der klassischen Kritiker genauso wie jener der Wortführer der Harlem Renaissance, die jedem künstlerischen Konzept gegenüber weitaus aufgeschlossener waren als einer schwarzen Folklore. In einem ersten Kapitel beschreibt Howland das vielfältige Beziehungsgeflecht zwischen Jazz, Blues und schwarzem Entertainment, innerhalb dessen auch Johnson und Ellington ihre oft für die Bühne konzipierten Werke erarbeiteten. Ein zweites Kapitel ist Johnsons “Yamekraw” gewidmet, einer Komposition, die auf volksmusikalischen Melodien aus den amerikanischen Südstaaten (Georgia, South Carolina) basiert. Im dritten Kapitel beschreibt er, wie die Konzertambitionen und die Bühnenmusikerfahrungen beider Komponisten, Johnson und Ellington, sich gegenseitig beeinflussten, analysisert Ellingtons Cotton-Club-Shows oder seinen Kurzfilm “Symphony in Black”, um dann im vierten Kapitel die “extended compositions” des Duke zu untersuchen, von “Rhapsody Junior” (1926) bis zu “Black, Brown and Beige” (1943) und sie mit Kompositionen aus dem Whiteman’schen Oeuvre zu vergleichen. Für ein Kapitel über Johnsons “Harlem Symphony” greift Howland auf bislang unbekanntes Material im Johnson-Nachlass zurück und betrachtet in einem sechsten Kapitel Ellingtons Carnegie-Hall-Konzerte über die Jahre und die programmatischen Ideen, die ihnen zugrunde lagen. Sein Schlusskapitel vergleicht die unterschiedlichen ästhetischen Ansätze seiner beiden protagonisten und diskutiert ihren ästhetischen wie kompositorischen Einfluss. Howlands Buch deckt damit eine vielfach vernachlässigte Seite der Jazzgeschichte auf, in gründlich recherchierten, mit Notenbeispielen und Formanalysen durchsetzten Argumentationssträngen, die einmal mehr klar machen, dass viele Jazzmusiker, die man allgemein vor allem für ihre gutgelaunte Musik schätzt, ganz andere Motivationen hatten, dass noch hinter dem swingendsten Stück Musik jede Menge ästhetischen Wollens stecken kann — wenn man nur weiß, wo man schauen muss.
(Wolfram Knauer)
Jazz und seine Musiker im Roman. “Vernacular and Sophisticated”
von Alexander Ebert
Hamburg 2009 (Verlag Dr. Kovac)
326 Seiten, 68 Euro
ISBN: 978-3-8300-4567-0
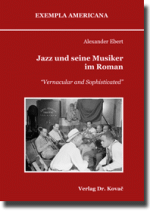 Der Jazz war immer wieder Thema der Literatur, ob in seiner improvisatorischen Faszination oder in der Persönlichkeit von Jazzmusikern, also als ein Idealbild des Künstlers, wie es eh gern in Romanen thematisiert wird. Alexander Ebert untersucht in seiner im Fachbereich Amerikanistik verfassten Dissertation sieben Romane, in denen Jazz oder Jazzmusikern eine wichtige Rolle zukommt: Langston Hughes’ “Not Without Laughter” (1930), Dorothy Bakers “Young Man With a Horn” (1938), Ralph Ellisons “Invisible Man” (1952), John Clellon Holmes “The Horn” (1958), Albert Murrays “Train Whistle Guitar” (1974), Michael Ondaatjes “Coming Through Slaughter” (1979), Toni Morrisons “Jazz” (1992) sowie als Einleitung F. Scott Fitzgeralds “The Great Gatsby”. Ebert untersucht sie auf die unterschiedliche Bedeutung des “vernacular”, also eines spezifisch afro-amerikanischen Umgangs mit Sprache (und Musik) und auf die Beziehung dieses “vernacular” mit Aspekten des Blues oder des Jazz (bzw. besser: des Blues- oder des Jazzspielens, oder gar: des Blues- oder des Jazzlebens). Es ist eine Dissertation, also keineswegs Einführungsliteratur zum Thema, und Eberts Bezüge auf Sekundärliteratur können den ungeübten Leser leicht stärker irritieren als sie ihm die Dinge veranschaulichen, zumal sie in der Regel unkommentiert und höchstens zur Unterstreichung der eigenen Argumentation übernommen werden. Es ist das alte Probelm deutscher Dissertationsordnungen, die Doktoranden dazu verdonnern ihre Dissertationen im Ton der Doktorarbeit zu veröffentlichen statt sie für die Publikation “leserlicher” zu machen. In den USA läuft das anders: Aus Dissertationen entstandene Buchpublikationen müssen grundsätzlich in eine Schriftfassung gebracht werden, von der der Verlag der Meinung ist, dass sie sich sich auch auf dem (Fach-)Markt behaupten kann. Das allerdings wird schwierig mit Sätzen wie: “Die durch das blues idiom transformierten, in das Verhaltensschema der einzelnen Charaktere implantierten affirmativen Selbstdarstellungscharakteristika werden von den hier behandelten afroamerikanischen Autoren in ihrer Wirkung stets basierend auf Erfahrungen der Adoleszenzphase vorgestellt.” Was Ebert in seiner Studie nur am Rande behandelt, ist die Tatsache, dass “Jazz” und “Jazz” auch in Afro-Amerika durchaus unterschiedliche Dinge sind, dass es nicht nur Wechsel im musikalischen, sondern auch im ästhetischen Ansatz gab und damit verbunden Änderungen in der Wahrnehmung sowohl in der Fachwelt wie auch in der breiteren Öffentlichkeit, dass schließlich die Bedeutung von “Jazz” je nach Position des Betrachtenden eine komplett andere sein konnte und selbst bei einzelnen Autoren (Ellison und Murray insbesondere) laufend Positionsverschiebungen stattfinden. Seine Studien belegen, wie Ebert schreibt, “welche unterschiedlichen Annäherungsweisen an den Jazz als Kultur möglich” seien. Sein Buch ist auf jeden Fall eine große Fleißarbeit, die vor allem herausfindet, wie sprachliche Aspekte (also das “vernacular”, für das mir auch bei Ebert aber dann doch noch eine bessere Definition fehlt) unterschiedlich eingesetzt werden, ob als störender Impuls, als eine “sich selbst aus dem Unterbewusstsein heraus ebnende Größe”, als eine prägende Erfahrung oder aber auf abstrakterer Ebene.
Der Jazz war immer wieder Thema der Literatur, ob in seiner improvisatorischen Faszination oder in der Persönlichkeit von Jazzmusikern, also als ein Idealbild des Künstlers, wie es eh gern in Romanen thematisiert wird. Alexander Ebert untersucht in seiner im Fachbereich Amerikanistik verfassten Dissertation sieben Romane, in denen Jazz oder Jazzmusikern eine wichtige Rolle zukommt: Langston Hughes’ “Not Without Laughter” (1930), Dorothy Bakers “Young Man With a Horn” (1938), Ralph Ellisons “Invisible Man” (1952), John Clellon Holmes “The Horn” (1958), Albert Murrays “Train Whistle Guitar” (1974), Michael Ondaatjes “Coming Through Slaughter” (1979), Toni Morrisons “Jazz” (1992) sowie als Einleitung F. Scott Fitzgeralds “The Great Gatsby”. Ebert untersucht sie auf die unterschiedliche Bedeutung des “vernacular”, also eines spezifisch afro-amerikanischen Umgangs mit Sprache (und Musik) und auf die Beziehung dieses “vernacular” mit Aspekten des Blues oder des Jazz (bzw. besser: des Blues- oder des Jazzspielens, oder gar: des Blues- oder des Jazzlebens). Es ist eine Dissertation, also keineswegs Einführungsliteratur zum Thema, und Eberts Bezüge auf Sekundärliteratur können den ungeübten Leser leicht stärker irritieren als sie ihm die Dinge veranschaulichen, zumal sie in der Regel unkommentiert und höchstens zur Unterstreichung der eigenen Argumentation übernommen werden. Es ist das alte Probelm deutscher Dissertationsordnungen, die Doktoranden dazu verdonnern ihre Dissertationen im Ton der Doktorarbeit zu veröffentlichen statt sie für die Publikation “leserlicher” zu machen. In den USA läuft das anders: Aus Dissertationen entstandene Buchpublikationen müssen grundsätzlich in eine Schriftfassung gebracht werden, von der der Verlag der Meinung ist, dass sie sich sich auch auf dem (Fach-)Markt behaupten kann. Das allerdings wird schwierig mit Sätzen wie: “Die durch das blues idiom transformierten, in das Verhaltensschema der einzelnen Charaktere implantierten affirmativen Selbstdarstellungscharakteristika werden von den hier behandelten afroamerikanischen Autoren in ihrer Wirkung stets basierend auf Erfahrungen der Adoleszenzphase vorgestellt.” Was Ebert in seiner Studie nur am Rande behandelt, ist die Tatsache, dass “Jazz” und “Jazz” auch in Afro-Amerika durchaus unterschiedliche Dinge sind, dass es nicht nur Wechsel im musikalischen, sondern auch im ästhetischen Ansatz gab und damit verbunden Änderungen in der Wahrnehmung sowohl in der Fachwelt wie auch in der breiteren Öffentlichkeit, dass schließlich die Bedeutung von “Jazz” je nach Position des Betrachtenden eine komplett andere sein konnte und selbst bei einzelnen Autoren (Ellison und Murray insbesondere) laufend Positionsverschiebungen stattfinden. Seine Studien belegen, wie Ebert schreibt, “welche unterschiedlichen Annäherungsweisen an den Jazz als Kultur möglich” seien. Sein Buch ist auf jeden Fall eine große Fleißarbeit, die vor allem herausfindet, wie sprachliche Aspekte (also das “vernacular”, für das mir auch bei Ebert aber dann doch noch eine bessere Definition fehlt) unterschiedlich eingesetzt werden, ob als störender Impuls, als eine “sich selbst aus dem Unterbewusstsein heraus ebnende Größe”, als eine prägende Erfahrung oder aber auf abstrakterer Ebene.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Fats Waller on the Air. Additions and Corrections
von Stephen Taylor
“Additions and Corrections” update
Stephen Taylors hat Ergänzungen und Korrekturen zu seiner umfassenden Discographie von Livemitschnitten Fats Wallers, “Fats Waller on the Air. The Radio Broadcasts & Discography”, online gestellt. Die 73-seitige pdf-Datei kann direkt auf der Website seines Buchs runtergeladen werden.
Stephen Taylor has updated his comprehensive discography of radio broadcasts, “Fats Waller on the Air. The Radio Broadcasts & Discography”, with “additions and corrections” which can be downloaded for free on the website of his book.
The Jazz Composer. Moving Music Off the Paper
von Graham Collier
London 2009 (Northway Publications)
338 Seiten, 19,99 £
ISBN: 978-09557888-0-2
 Graham Collier war immer ein streitbarer Beobachter der Jazzszene, in der er selbst seit über mehr als vier Jahrzehnten aktiv teilnimmt. Er begann als Kontrabassist, machte sich dann auch als Komponist und Bandleader einen Namen, durch dessen Ensembles viele der wichtigsten britischen Musiker gingen. Er unterrichtete an der Royal Academy in Music, gibt bis heute viele Workshops und schreibt Kompositionen für unterschiedliche Ensembles von kleineren Besetzungen bis hin zur Bigband. Daneben war er immer auch schriftstellerisch tätig, verfasste mehrere Bücher zur Jazzpädagogik sowie eine regelmäßige Kolumne für das Magazin “Jazz Changes” der International Association of Schools of Jazz. Sein neuestes Buch befasst sich in erster Linie mit der Rolle des Jazzkomponisten und seinen Möglichkeiten innerhalb des Metiers. Er fragt, was Arrangements bewirken können und sollen, welche unterschiedlichen Arten von “Komposition” es im Jazz gibt, zwischen originärer Erfindung, Kompilation und Arrangement, geht auf konkrete Beispiele ein, vorrangig Duke Ellington und Miles Davis, daneben aber auch auf Kollegen wie Charles Mingus, Ornette Coleman, Wayne Shorter, Gil Evans, die Idee des Third Stream oder im letzten Kapitel auf seine eigenen Kompositionen. Dazwischen aber, und das macht das Buch wirklich lesenswert, gibt Collier jede Menge Ansichten zum Jazz, seiner Ästhetik, seiner Rezeption und erzählt aus seinen eigenen Erfahrungen. Das Kapitel “It Ain’t Who You Are (It’s the Way That You Do It)” beispielsweise beschäftigt sich sowohl mit den Erfahrungen eines europäischen Musikers in einer ursprünglich amerikanischen Musik, mit sexistischen und homophoben Ansichten von Musikern und Kritikern (Collier ist selbst lebt offen schwul) sowie mit einer seltsamen Art von Rassismus, der man als weißer Musiker in der afro-amerikanischen Musiksprache des Jazz schon mal begegnen kann. Die kleinen polemischen Asides seines Buchs laden zum Nachdenken und Mitargumentieren ein, darüber etwa, welche Rolle die Tradition im Jazz spielt, inwiefern Komponisten im Jazz Kontrolle über ihre Solisten ausüben wollen, wie wichtig und wie frei Improvisation wirklich ist und vieles mehr. Collier schreibt lesens- und nachdenkenswert, nicht aus der Position des Allwissenden Jazzhistorikers, sondern aus der des kritischen Komponisten, des nachfragenden Hörers mit offenen Ohren, des an der Musik und dem Warum hinter ihr Interessierten. Er lässt genüdem Leser genügend Raum, seine eigenen Antworten auf viele der Fragen zu finden. Und komponiert damit quasi einen Diskurs zu Jazzästhetik und Komposition, dessen Solisten im besten Fall seine Leser sind. Absolut empfehlenswert!
Graham Collier war immer ein streitbarer Beobachter der Jazzszene, in der er selbst seit über mehr als vier Jahrzehnten aktiv teilnimmt. Er begann als Kontrabassist, machte sich dann auch als Komponist und Bandleader einen Namen, durch dessen Ensembles viele der wichtigsten britischen Musiker gingen. Er unterrichtete an der Royal Academy in Music, gibt bis heute viele Workshops und schreibt Kompositionen für unterschiedliche Ensembles von kleineren Besetzungen bis hin zur Bigband. Daneben war er immer auch schriftstellerisch tätig, verfasste mehrere Bücher zur Jazzpädagogik sowie eine regelmäßige Kolumne für das Magazin “Jazz Changes” der International Association of Schools of Jazz. Sein neuestes Buch befasst sich in erster Linie mit der Rolle des Jazzkomponisten und seinen Möglichkeiten innerhalb des Metiers. Er fragt, was Arrangements bewirken können und sollen, welche unterschiedlichen Arten von “Komposition” es im Jazz gibt, zwischen originärer Erfindung, Kompilation und Arrangement, geht auf konkrete Beispiele ein, vorrangig Duke Ellington und Miles Davis, daneben aber auch auf Kollegen wie Charles Mingus, Ornette Coleman, Wayne Shorter, Gil Evans, die Idee des Third Stream oder im letzten Kapitel auf seine eigenen Kompositionen. Dazwischen aber, und das macht das Buch wirklich lesenswert, gibt Collier jede Menge Ansichten zum Jazz, seiner Ästhetik, seiner Rezeption und erzählt aus seinen eigenen Erfahrungen. Das Kapitel “It Ain’t Who You Are (It’s the Way That You Do It)” beispielsweise beschäftigt sich sowohl mit den Erfahrungen eines europäischen Musikers in einer ursprünglich amerikanischen Musik, mit sexistischen und homophoben Ansichten von Musikern und Kritikern (Collier ist selbst lebt offen schwul) sowie mit einer seltsamen Art von Rassismus, der man als weißer Musiker in der afro-amerikanischen Musiksprache des Jazz schon mal begegnen kann. Die kleinen polemischen Asides seines Buchs laden zum Nachdenken und Mitargumentieren ein, darüber etwa, welche Rolle die Tradition im Jazz spielt, inwiefern Komponisten im Jazz Kontrolle über ihre Solisten ausüben wollen, wie wichtig und wie frei Improvisation wirklich ist und vieles mehr. Collier schreibt lesens- und nachdenkenswert, nicht aus der Position des Allwissenden Jazzhistorikers, sondern aus der des kritischen Komponisten, des nachfragenden Hörers mit offenen Ohren, des an der Musik und dem Warum hinter ihr Interessierten. Er lässt genüdem Leser genügend Raum, seine eigenen Antworten auf viele der Fragen zu finden. Und komponiert damit quasi einen Diskurs zu Jazzästhetik und Komposition, dessen Solisten im besten Fall seine Leser sind. Absolut empfehlenswert!
(Wolfram Knauer)
Weblink: www.jazzcontinuum.com.
Weblink: www.thejazzcomposer.com.
Jazz
von Gary Giddins & Scott DeVeaux
New York 2009 (W.W. Norton)
704 Seiten, 39,95 US-$
ISBN: 978-0-39306-861-0
 Es ist schon mutig, auf den weiß Gott nicht kleinen Jazzbuchmarkt ein neues dickes Buch zur gesamten Jazzgeschichte zu werfen. Gary Giddins, langjähriger Kritiker amerikanische für Zeitungen und Zeitschriften und Autor etlicher Bücher sowie Scott DeVeaux, Musikwissenschaftler und Autor des vielgelobten Buchs “The Birth of Bebop” haben sich für ihr neues Jazzbuch mit dem simplen Titel “Jazz” daher ein etwas anderes Konzept ausgedacht. Statt die Jazzgeschichte als eine Geschichte von Biographien zu erzählen, erzählen sie sie anhand von konkreten Stücken, von Aufnahmen. Biographische Kommentare sind durchaus auch vorhanden; die Titel aber stehen im Vordergrund, die Giddins und DeVeaux analysieren, beschreiben und in die Jazzgeschichte einordnen. Ihre Analysen bedienen sich dabei keiner Notenbeispiele und auch keiner allzu komplizierten Fachtermini — das Buch wendet sich an interessierte Fans, aber nicht dezidiert an Studenten oder Musikwissenschaftler. Analytische Anmerkungen zu Aufnahmen bestehen vor allem aus kurz gehaltenen Ablaufbeschreibungen, Chorus für Chorus mit vorgeschalteter Sekundenzahl, damit man die Beschreibungen beim Hören mitlesen kann. Das ist eine durchaus sinnvolle Herangehensweise, schult sie doch das Ohr des Lesers und richtet seine Aufmerksamkeit auf das, was in der Musik geschieht. Konkret sieht das dann so aus, dass ein Kapitel mit einer biographischen Einordnung des Künstlers beginnt, dann die Umstände des besprochenen Titels und/oder Albums erlöutert werden, bevor eine übersichtlich-tabellarische Ablaufbeschreibung den Leser zum Mithören/Mitlesen auffordert. Dem schließt sich in der Regel eine kurze Beschreibung des Einflusses des betreffenden Künstlers an. Pro Künstler findet sich meist ein besprochener Titel; und es sind nicht immer die “wichtigsten”, sondern oft solche, die Giddins und DeVeaux einfach als besonders gelungen für das hielten, was sie darstellen wollten. Armstrong, Ellington, Parker, Miles und einige andere Künstler sind mit mehr als einem Titel vertreten, meist, weil sie in ihrem Schaffen so unterschiedliche Seiten zeigten, dass die Beschränkung auf einen einzelnen Titel ihnen nicht gerecht würde. Über die Auswahl sowohl der so herausgestellten Künstler wie auch der Stücke mag man sich streiten; das Problem der Auswahl aber stellt sich bei jedem (insbesonders enzyklopädischen) Werk. Und neben den punktuellen Blicken auf einzelne Entwicklungen des Jazz gelingt es den beiden auch immer wieder Verbindungsschnüre zu ziehen, musikalische Entwicklungen oder Personalstile miteinander zu verknüofen, auf Einflüsse, parallele Entwicklungen etc. hinzuweisen. Natürlich nutzt das Buch so vor allem dann, wenn man die Musik auch wirklich vor sich hat — und am besten eine Auswahl, die genau die im Buch besprochenen Titel enthält. Das aber wird keine noch so gut bestückte Plattensammlung leisten — und so haben die Autoren zusätzlich auch gleich eine CD-Edition kuratiert, in der die 45 im Buch näher analysierten Titel enthalten sind, die allerdings separat erstanden werden muss und fast doppelt so teuer wie das Buch ist. Wer sich beides zulegt hat allerdings wirklich einen erstklassigen “Primer” zur Jazzgeschichte in der Hand: von der Original Dixieland Jass Band über King Oliver, Louis Armstrong, Bessie Smith, Ellington, Basie und Goodman, Parker, Gillespie und Monk, das Modern jazz Quartet und Dave Brubeck, den Free Jazz Ornette Colemans oder Cecil Taylors bis hin zur Avantgarde der 80er und 90er Jahre und selbst Beispielen aus jüngster Zeit. Was fehlt, ist Europa: Einzig Django Reinhardt und Jan Garbarek fanden Eingang in den Olymp von Giddins’ und Deveaux’s Gnaden. Aber dann ist diese Entscheidung wohl verständlich — hier wählten sie zwei Musiker aus, die auch auf den amerikanischen Jazz von nicht unerheblichem Einfluss waren. Und die europäische Jazzgeschichte sollte vielleicht tatsächlich von anderer Seite aufgearbeitet werden … wir arbeiten dran.
Es ist schon mutig, auf den weiß Gott nicht kleinen Jazzbuchmarkt ein neues dickes Buch zur gesamten Jazzgeschichte zu werfen. Gary Giddins, langjähriger Kritiker amerikanische für Zeitungen und Zeitschriften und Autor etlicher Bücher sowie Scott DeVeaux, Musikwissenschaftler und Autor des vielgelobten Buchs “The Birth of Bebop” haben sich für ihr neues Jazzbuch mit dem simplen Titel “Jazz” daher ein etwas anderes Konzept ausgedacht. Statt die Jazzgeschichte als eine Geschichte von Biographien zu erzählen, erzählen sie sie anhand von konkreten Stücken, von Aufnahmen. Biographische Kommentare sind durchaus auch vorhanden; die Titel aber stehen im Vordergrund, die Giddins und DeVeaux analysieren, beschreiben und in die Jazzgeschichte einordnen. Ihre Analysen bedienen sich dabei keiner Notenbeispiele und auch keiner allzu komplizierten Fachtermini — das Buch wendet sich an interessierte Fans, aber nicht dezidiert an Studenten oder Musikwissenschaftler. Analytische Anmerkungen zu Aufnahmen bestehen vor allem aus kurz gehaltenen Ablaufbeschreibungen, Chorus für Chorus mit vorgeschalteter Sekundenzahl, damit man die Beschreibungen beim Hören mitlesen kann. Das ist eine durchaus sinnvolle Herangehensweise, schult sie doch das Ohr des Lesers und richtet seine Aufmerksamkeit auf das, was in der Musik geschieht. Konkret sieht das dann so aus, dass ein Kapitel mit einer biographischen Einordnung des Künstlers beginnt, dann die Umstände des besprochenen Titels und/oder Albums erlöutert werden, bevor eine übersichtlich-tabellarische Ablaufbeschreibung den Leser zum Mithören/Mitlesen auffordert. Dem schließt sich in der Regel eine kurze Beschreibung des Einflusses des betreffenden Künstlers an. Pro Künstler findet sich meist ein besprochener Titel; und es sind nicht immer die “wichtigsten”, sondern oft solche, die Giddins und DeVeaux einfach als besonders gelungen für das hielten, was sie darstellen wollten. Armstrong, Ellington, Parker, Miles und einige andere Künstler sind mit mehr als einem Titel vertreten, meist, weil sie in ihrem Schaffen so unterschiedliche Seiten zeigten, dass die Beschränkung auf einen einzelnen Titel ihnen nicht gerecht würde. Über die Auswahl sowohl der so herausgestellten Künstler wie auch der Stücke mag man sich streiten; das Problem der Auswahl aber stellt sich bei jedem (insbesonders enzyklopädischen) Werk. Und neben den punktuellen Blicken auf einzelne Entwicklungen des Jazz gelingt es den beiden auch immer wieder Verbindungsschnüre zu ziehen, musikalische Entwicklungen oder Personalstile miteinander zu verknüofen, auf Einflüsse, parallele Entwicklungen etc. hinzuweisen. Natürlich nutzt das Buch so vor allem dann, wenn man die Musik auch wirklich vor sich hat — und am besten eine Auswahl, die genau die im Buch besprochenen Titel enthält. Das aber wird keine noch so gut bestückte Plattensammlung leisten — und so haben die Autoren zusätzlich auch gleich eine CD-Edition kuratiert, in der die 45 im Buch näher analysierten Titel enthalten sind, die allerdings separat erstanden werden muss und fast doppelt so teuer wie das Buch ist. Wer sich beides zulegt hat allerdings wirklich einen erstklassigen “Primer” zur Jazzgeschichte in der Hand: von der Original Dixieland Jass Band über King Oliver, Louis Armstrong, Bessie Smith, Ellington, Basie und Goodman, Parker, Gillespie und Monk, das Modern jazz Quartet und Dave Brubeck, den Free Jazz Ornette Colemans oder Cecil Taylors bis hin zur Avantgarde der 80er und 90er Jahre und selbst Beispielen aus jüngster Zeit. Was fehlt, ist Europa: Einzig Django Reinhardt und Jan Garbarek fanden Eingang in den Olymp von Giddins’ und Deveaux’s Gnaden. Aber dann ist diese Entscheidung wohl verständlich — hier wählten sie zwei Musiker aus, die auch auf den amerikanischen Jazz von nicht unerheblichem Einfluss waren. Und die europäische Jazzgeschichte sollte vielleicht tatsächlich von anderer Seite aufgearbeitet werden … wir arbeiten dran.
(Wolfram Knauer)
Weblink: www.garygiddins.com.
Jade Visions. The Life and Music of Scott LaFaro
von Helene LaFaro-Fernández
Denton/TX 2009 (University of North Texas Press)
322 Seiten, 24,95 US-$
ISBN: 978-1-57441-273-4
 Neben Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter und einigen anderen der großen Namen des modernen Jazz ist Scott LaFaro einer der Musiker, über die am häufigsten Diplomarbeiten geschrieben werden — so zumindest scheint es uns im Jazzinstitut, wo wir regelmäßig mit Anfragen zu dem früh verstorbenen Bassisten konfrontiert werden. Jetzt legt seine Schwester eine Biographie vor, die das nur fünfundzwanzigjährige Leben des Kontrabassisten beleuchtet. LaFaro wurde in eine italienisch-schottische Familie geboren, die früh erkannte, dass ihr Sohn musikalisch begabt war. Er spielte bereits mit drei Jahren Mandoline und nahm seine ersten Geigenstunden mit fünf. Im College nahm er Klarinettenunterricht, mit 18 dann kaufte sein Vater ihm einen Kontrabass. Schon in den ersten Bands, mit denen er spielte, wurde klar, dass seine Art Bass zu spielen von dem abwich, was man sonst so hörte; statt nur die Time zu markieren, setzte er Akzente, spielte Linien, setzte Töne zwischen die Beats. In der Band des Posaunisten Buddy Morrow machte er 1956 seine ersten Aufnahmen mit Swing- und Tanzmusik. Bei einer Session traf er auf Chet Baker, der ihn einlud, bei der nächsten Tour seiner Band mitzuwirken. Hier beginnt der Teil der Biographie, in der Helene LaFaro-Fernández auf Zeitzeugen zurückgreift und insbesondere Kollegen interviewt, Walter Norris etwa, Gary Peacock oder Paul Motian. LaFaro arbeitete in der Band von Pat Moran und mit Victor Feldman und spielt 1958 u.a. in Stan Getz’s Quintett an der Westküste. Er nahm Platten auf mit Hampton Hawes, Buddy DeFranco und anderen. 1959 arbeitete er als Bassist des Stan Kenton Orchestra, bis ihm Herb Geller einen Job in der Benny Goodman Band besorgte. Vor allem aber begann in diesem Jahr LaFaros Zusammenarbeit mit Bill Evans. Außerdem er wurde als “Bass New Star” im Down Beat gewürdigt. 1960 trat er vor allem mit Evans’ Trio auf, aber auch mit Ornette Coleman, Booker Littler und Thelonious Monk. Vom Januar 1961 stammen die legendären Trioaufnahmen aus dem Village Vanguard, die bis zum heutigen Tag zu den einflussreichsten Klaviertrioeinspielungen zählen. Am 6. Juli schlief LaFaro am Steuer seines Wagens ein und fuhr gegen einen Baum. Er und sein Freund Frank Ottley waren sofort tot. LaFaros Schwester erzählt die Geschichte ihres Bruders mit vielen Fakten, aber auch mit dem Wissen um seine Bedeutung für die Jazzgeschichte. Sie sammelt Erinnerungen von Mitmusikern und Freunden und bat Gene Lees, Marc Johnson, Jeff Campbell und Phil Palombi um eine musikalische Einschätzung. Barrie Kolstein berichtet im Anhang, wie das Instrument, das beim Autounfall erheblich beschädigt worden war, restauriert wurde und gibt genaue eine Beschreibung des Kontrabasses. Chuck Ralston ergänzt das alles um eine Diskographie, der Aufnahmen, an denen LaFaro teilhatte, von Buddy Morrow über Clifford Brown und Chet Baker, Victor Feldman, Stan Getz, Hampton Hawes, Buddy DeFranco, Harold Land, Pat Moran, Marty Paich, Stan Kenton, Herb Geller, Booker Little, Steve Kuhn, Gunther Schuller, Ornette Coleman bis hin zum legendären Bill Evans Trio. Helene LaFaro-Fernández hat ihrem Bruder mit diesem Buch, in dem auch viele private Fotos enthalten sind, ein würdiges Denkmal gesetzt, persönlich und doch sachlich, die biographischen Detials genauso berücksichtigend wie seine musikalische Entwicklung und seinen Einfluss auf Bassisten bis zum heutigen Tag.
Neben Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter und einigen anderen der großen Namen des modernen Jazz ist Scott LaFaro einer der Musiker, über die am häufigsten Diplomarbeiten geschrieben werden — so zumindest scheint es uns im Jazzinstitut, wo wir regelmäßig mit Anfragen zu dem früh verstorbenen Bassisten konfrontiert werden. Jetzt legt seine Schwester eine Biographie vor, die das nur fünfundzwanzigjährige Leben des Kontrabassisten beleuchtet. LaFaro wurde in eine italienisch-schottische Familie geboren, die früh erkannte, dass ihr Sohn musikalisch begabt war. Er spielte bereits mit drei Jahren Mandoline und nahm seine ersten Geigenstunden mit fünf. Im College nahm er Klarinettenunterricht, mit 18 dann kaufte sein Vater ihm einen Kontrabass. Schon in den ersten Bands, mit denen er spielte, wurde klar, dass seine Art Bass zu spielen von dem abwich, was man sonst so hörte; statt nur die Time zu markieren, setzte er Akzente, spielte Linien, setzte Töne zwischen die Beats. In der Band des Posaunisten Buddy Morrow machte er 1956 seine ersten Aufnahmen mit Swing- und Tanzmusik. Bei einer Session traf er auf Chet Baker, der ihn einlud, bei der nächsten Tour seiner Band mitzuwirken. Hier beginnt der Teil der Biographie, in der Helene LaFaro-Fernández auf Zeitzeugen zurückgreift und insbesondere Kollegen interviewt, Walter Norris etwa, Gary Peacock oder Paul Motian. LaFaro arbeitete in der Band von Pat Moran und mit Victor Feldman und spielt 1958 u.a. in Stan Getz’s Quintett an der Westküste. Er nahm Platten auf mit Hampton Hawes, Buddy DeFranco und anderen. 1959 arbeitete er als Bassist des Stan Kenton Orchestra, bis ihm Herb Geller einen Job in der Benny Goodman Band besorgte. Vor allem aber begann in diesem Jahr LaFaros Zusammenarbeit mit Bill Evans. Außerdem er wurde als “Bass New Star” im Down Beat gewürdigt. 1960 trat er vor allem mit Evans’ Trio auf, aber auch mit Ornette Coleman, Booker Littler und Thelonious Monk. Vom Januar 1961 stammen die legendären Trioaufnahmen aus dem Village Vanguard, die bis zum heutigen Tag zu den einflussreichsten Klaviertrioeinspielungen zählen. Am 6. Juli schlief LaFaro am Steuer seines Wagens ein und fuhr gegen einen Baum. Er und sein Freund Frank Ottley waren sofort tot. LaFaros Schwester erzählt die Geschichte ihres Bruders mit vielen Fakten, aber auch mit dem Wissen um seine Bedeutung für die Jazzgeschichte. Sie sammelt Erinnerungen von Mitmusikern und Freunden und bat Gene Lees, Marc Johnson, Jeff Campbell und Phil Palombi um eine musikalische Einschätzung. Barrie Kolstein berichtet im Anhang, wie das Instrument, das beim Autounfall erheblich beschädigt worden war, restauriert wurde und gibt genaue eine Beschreibung des Kontrabasses. Chuck Ralston ergänzt das alles um eine Diskographie, der Aufnahmen, an denen LaFaro teilhatte, von Buddy Morrow über Clifford Brown und Chet Baker, Victor Feldman, Stan Getz, Hampton Hawes, Buddy DeFranco, Harold Land, Pat Moran, Marty Paich, Stan Kenton, Herb Geller, Booker Little, Steve Kuhn, Gunther Schuller, Ornette Coleman bis hin zum legendären Bill Evans Trio. Helene LaFaro-Fernández hat ihrem Bruder mit diesem Buch, in dem auch viele private Fotos enthalten sind, ein würdiges Denkmal gesetzt, persönlich und doch sachlich, die biographischen Detials genauso berücksichtigend wie seine musikalische Entwicklung und seinen Einfluss auf Bassisten bis zum heutigen Tag.
(Wolfram Knauer)
Bitches Brew. Genesi del capolavoro di Miles Davis
von Enrico Merlin & Veniero Rizzardi
Milano 2009 (ilSaggiatore)
318 Seiten, 35 Euro
ISBN: 978-8-84281-501-3
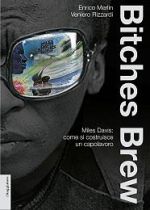 Ashley Kahn hat mit seinen Büchern über Miles Davis’ Album “Kind of Blue” und John Coltranes “A Love Supreme” quasi ein neues Genre der Jazzliteratur begonnen: Bücher, die einzelne Plattensitzungen des Jazz von allen Seiten beleuchten. Das Beispiel hat Schule gemacht: Enrico Merlin und Veniero Rizzardi legen jetzt ein durchaus vergleichbares Werb über Miles’ Album “Bitches Brew” von 1969 vor, sicher ein Meilenstein der Jazzgeschichte, ein großer Wurf, der aufzeigte, wie eine weitsichtige Fusion aus Jazz- und Rockelementen musikalisch spannende Ergebnisse zeitigen konnte. Die beiden Autoren zeichnen Entstehungsgeschichte und Einflüsse auf. Miles sei es immer besonders um Sound gegangen, von seinen Capitol-Nonett-Aufnahmen über die Zusammenarbeit mit Gil Evans bis zum elektrischen Miles. Sie diskutieren einige Vorgängeralben zu “Bitches Brew”, darunter “Circle in the Round” und “Directions”, analysieren die Schneidetechnik etwa auf dem Album “In a Silent Way”, indem sie die ursprünglich veröffentlichte Aufnahmemit den Basterbändern vergleichen. Die Teo Macero-Sammlung landete nach dem Tod des Produzenten in der New York Library for the Performing Arts. Ihr ist zu verdanken, dass die Lead-Sheets für die Plattensitzung genauso erhalten sind wie Notizen, Korrespondenz, Schneideanweisungen und vieles mehr, dass die Autoren zur Analyse der Aufnahmegenese genauso nutzten wie Strudiomitschnitte, auf denen neben der Musik auch die Gespräche zwischen Miles und seinen Musikern und dem Produzenten zu hören sind. Sie vergleichen die verschiedenen Takes der einzelnen Stücke und mutmaßen über Gründe für Änderungen oder Zusammenschnitte. Viele Fotos machen das alles lebendig; Notenbeispiele und analytische Formskizzen führen den Leser näher an den musikalischen Ablauf heran; eine Chronologie der Jahre 1967 bis 1973 fasst die mit dem Album “Bitches Brew” zusammenhängenden Aktivitäten Miles’ übersichtlich zusammen. Das Buch ist bislang nur auf italienisch erhältlich; eine zumindest englische Übersetzung wäre sicher wünschenswert.
Ashley Kahn hat mit seinen Büchern über Miles Davis’ Album “Kind of Blue” und John Coltranes “A Love Supreme” quasi ein neues Genre der Jazzliteratur begonnen: Bücher, die einzelne Plattensitzungen des Jazz von allen Seiten beleuchten. Das Beispiel hat Schule gemacht: Enrico Merlin und Veniero Rizzardi legen jetzt ein durchaus vergleichbares Werb über Miles’ Album “Bitches Brew” von 1969 vor, sicher ein Meilenstein der Jazzgeschichte, ein großer Wurf, der aufzeigte, wie eine weitsichtige Fusion aus Jazz- und Rockelementen musikalisch spannende Ergebnisse zeitigen konnte. Die beiden Autoren zeichnen Entstehungsgeschichte und Einflüsse auf. Miles sei es immer besonders um Sound gegangen, von seinen Capitol-Nonett-Aufnahmen über die Zusammenarbeit mit Gil Evans bis zum elektrischen Miles. Sie diskutieren einige Vorgängeralben zu “Bitches Brew”, darunter “Circle in the Round” und “Directions”, analysieren die Schneidetechnik etwa auf dem Album “In a Silent Way”, indem sie die ursprünglich veröffentlichte Aufnahmemit den Basterbändern vergleichen. Die Teo Macero-Sammlung landete nach dem Tod des Produzenten in der New York Library for the Performing Arts. Ihr ist zu verdanken, dass die Lead-Sheets für die Plattensitzung genauso erhalten sind wie Notizen, Korrespondenz, Schneideanweisungen und vieles mehr, dass die Autoren zur Analyse der Aufnahmegenese genauso nutzten wie Strudiomitschnitte, auf denen neben der Musik auch die Gespräche zwischen Miles und seinen Musikern und dem Produzenten zu hören sind. Sie vergleichen die verschiedenen Takes der einzelnen Stücke und mutmaßen über Gründe für Änderungen oder Zusammenschnitte. Viele Fotos machen das alles lebendig; Notenbeispiele und analytische Formskizzen führen den Leser näher an den musikalischen Ablauf heran; eine Chronologie der Jahre 1967 bis 1973 fasst die mit dem Album “Bitches Brew” zusammenhängenden Aktivitäten Miles’ übersichtlich zusammen. Das Buch ist bislang nur auf italienisch erhältlich; eine zumindest englische Übersetzung wäre sicher wünschenswert.
(Wolfram Knauer)
We Want Miles
herausgegeben von Vincent Bessières
Paris 2009 (Cité de la Musique)
223 Seiten, 39 Euro
ISBN: 978-2-84597-340-4
 “We Want Miles” heißt die oppulente Ausstellung die Vincent Bessières für die Cité de la Musique in Paris zusammengestellt hat, wo sie von Oktober 2009 bis Januar 2010 gezeigt wird (danach von April bis August 2010 im Montréal Museum of Fine Arts. Die Ausstellung in Paris umfasst zwei Stockwerke voll mit Material, das sich auf Miles bezieht: Klangkabinen, in denen man Musik aus den verschiedenen Schaffensperioden seines Lebens hören kann, seltene Filmausschnitte von Konzerten oder Interviews, in denen er über seine Musik spricht, seine Kleidung und Gemälde, vieler seiner Instrumente, originale Notenblätter etlicher Aufnahmesessions, einschließlich der legendären Capitol-Nonett-Aufnahmen von 1949, sowie handschriftliche Notizen über die Aufnahmesitzungen, die oft von seinem langjährigen Produzenten Teo Macero stammen. Dem Kurator der Ausstellung Vincent Bessières und seinen Mitarbeitern von der Cité de la Musique ist es gelungen, ein wenig vom Geist des Trompeters einzufangen, den Besucher langsam in Miles’ Welt eintauchen zu lassen. Sie zeichnen seine musikalische und persönliche Entwicklung über die Jahre in Saal nach Saal nach und geben selbst seinem Rückzug von Musik und Öffentlichkeit in den späten 1970er Jahren einen eigenen Raum: einen dunklen Durchgang mit wenigen Dokumenten an den schwarzen Wänden, die knappe Einblicke in seine Probleme der Zeit geben. Am Anfang der Ausstellung mag man noch meinen, dieses Foto sei einem doch eh bekannt, diese Platten ebenfalls oder jener Zeitungsartikel. Mehr und mehr aber wird man in den Sog der Ausstellung gezogen und erlebt bestimmte Phasen in Miles’ Entwicklung anders als man sie zuvor erlebt hat, einfach durch die Art und Weise, wie die Ausstellungsstücke einander gegenübergestellt sind, wie die Musik aus den Klangkabinen, die Videos und all die anderen Dokumente einander ergänzen und einen die Musik und das Leben von Miles Davis neu entdecken, neu sehen, neu hören lassen. Der Ausstellungskatalog zeigt viele der in der Cité de la Musique zu sehenden Exponate und enthält daneben einen ausführlichen Text von Franck Bergerot sowie kürzere Texte von George Avakian, Laurent Cugny, Ira Gitler, David Liebman, Francis Marmande, John Szwed und Mike Zwerin. Noch ist er nur in Französisch erhältlich; eine englische Fassung wird aber spätestens zur Ausstellung in Montréal erhältlich sein.
“We Want Miles” heißt die oppulente Ausstellung die Vincent Bessières für die Cité de la Musique in Paris zusammengestellt hat, wo sie von Oktober 2009 bis Januar 2010 gezeigt wird (danach von April bis August 2010 im Montréal Museum of Fine Arts. Die Ausstellung in Paris umfasst zwei Stockwerke voll mit Material, das sich auf Miles bezieht: Klangkabinen, in denen man Musik aus den verschiedenen Schaffensperioden seines Lebens hören kann, seltene Filmausschnitte von Konzerten oder Interviews, in denen er über seine Musik spricht, seine Kleidung und Gemälde, vieler seiner Instrumente, originale Notenblätter etlicher Aufnahmesessions, einschließlich der legendären Capitol-Nonett-Aufnahmen von 1949, sowie handschriftliche Notizen über die Aufnahmesitzungen, die oft von seinem langjährigen Produzenten Teo Macero stammen. Dem Kurator der Ausstellung Vincent Bessières und seinen Mitarbeitern von der Cité de la Musique ist es gelungen, ein wenig vom Geist des Trompeters einzufangen, den Besucher langsam in Miles’ Welt eintauchen zu lassen. Sie zeichnen seine musikalische und persönliche Entwicklung über die Jahre in Saal nach Saal nach und geben selbst seinem Rückzug von Musik und Öffentlichkeit in den späten 1970er Jahren einen eigenen Raum: einen dunklen Durchgang mit wenigen Dokumenten an den schwarzen Wänden, die knappe Einblicke in seine Probleme der Zeit geben. Am Anfang der Ausstellung mag man noch meinen, dieses Foto sei einem doch eh bekannt, diese Platten ebenfalls oder jener Zeitungsartikel. Mehr und mehr aber wird man in den Sog der Ausstellung gezogen und erlebt bestimmte Phasen in Miles’ Entwicklung anders als man sie zuvor erlebt hat, einfach durch die Art und Weise, wie die Ausstellungsstücke einander gegenübergestellt sind, wie die Musik aus den Klangkabinen, die Videos und all die anderen Dokumente einander ergänzen und einen die Musik und das Leben von Miles Davis neu entdecken, neu sehen, neu hören lassen. Der Ausstellungskatalog zeigt viele der in der Cité de la Musique zu sehenden Exponate und enthält daneben einen ausführlichen Text von Franck Bergerot sowie kürzere Texte von George Avakian, Laurent Cugny, Ira Gitler, David Liebman, Francis Marmande, John Szwed und Mike Zwerin. Noch ist er nur in Französisch erhältlich; eine englische Fassung wird aber spätestens zur Ausstellung in Montréal erhältlich sein.
(Wolfram Knauer)
Satchmo. The Wonderful World and Art of Louis Armstrong
von Stephen Brower
New York 2009 (Abrams)
256 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-0-8109-9528-4
 Louis Armstrong war ein großartiger Musiker, das ist bekannt. Schon weniger bekannt ist, dass er zeitlebens mit seiner Schreibmaschine reiste und ein fleißiger Briefeschreiber war — viele seiner Briefe erzählten Autobiographisches und waren Grundlage für seine beiden Autobiographien, die 1936 und 1954 erschienen. Vor zehn Jahren brachte Thomas Brothers etliche dieser Briefe und maschienenschriftlichen Manuskripte, die heute im Armstrong Archive in Queens, New York, lagern, in Buchform heraus (“Louis Armstrong In His Own Words”, Oxford University Press, 1999). Im Armstrong Archive aber findet sich noch eine weitere, unerwartete künstlerische Seite des Trompeters. Dieser nämlich war ein großer Tonbandfreund und schnitt Sendungen aus dem Rundfunk genauso mit wie Gespräche zwischen sich und Freunden oder Nachbarn oder auch sich selbst beim Üben oder beim Mitspielen mit Plattenaufnahmen (zum Teil sogar von sich selbst). Ausschnitte aus diesen Bändern sind im letzten Jahr veröffentlicht worden; spannend aber ist an ihnen nicht nur die darauf enthaltene Musik. Armstrong sorgte sich sich nämlich auch um die Verpackung, bastelte mit Schere, Klebstoff und Scotch Tape (der amerikanischen Variante unseres Tesafilms) seltsame Collagen, die teilweise Bezug zu dem auf den Bändern enthaltenen Aufnahmen besaßen, zum Teil aber auch nicht. Fotos von ihm selbst mit bekannten Stars des Jazz oder Showbusiness sind darauf ebenso zu sehen wie Zeitungsausrisse, Fotos, die ihm von Fans zugeschickt wurden, handschriftliche oder maschinenschriftliche Kommentare, die er teilweise Zeile für Zeile, teilweise gar Wort für Wort ausgeschnitten und aufgeklebt hatte. Das alles hatte früh begonnen, mit Scrapbooks, die Clippings, Zeitungsausschnitte über seine Arbeit enthielten. Browers Buch enthält eine Vielzahl an Beispielen, aus den Scrapbooks, aus seinen Briefen, vor allem aber von den beklebten Reel-to-Reel-Tapes aus der Sammlung des Armstrong Archive. Brower setzt die darauf zu sehenden Szenen in seinem Text in Relation zu Armstrongs Leben und Karriere. Das ganze in einem wunderschönen großformatigen, durchwegs farbig gehaltenen, auf Mattglanzpapier gedruckten Buch, das Einblicke in die spielerische Kreativität erlaubt, die Grundlage seiner Musik genauso war wie offenbar überhaupt seines Lebens.
Louis Armstrong war ein großartiger Musiker, das ist bekannt. Schon weniger bekannt ist, dass er zeitlebens mit seiner Schreibmaschine reiste und ein fleißiger Briefeschreiber war — viele seiner Briefe erzählten Autobiographisches und waren Grundlage für seine beiden Autobiographien, die 1936 und 1954 erschienen. Vor zehn Jahren brachte Thomas Brothers etliche dieser Briefe und maschienenschriftlichen Manuskripte, die heute im Armstrong Archive in Queens, New York, lagern, in Buchform heraus (“Louis Armstrong In His Own Words”, Oxford University Press, 1999). Im Armstrong Archive aber findet sich noch eine weitere, unerwartete künstlerische Seite des Trompeters. Dieser nämlich war ein großer Tonbandfreund und schnitt Sendungen aus dem Rundfunk genauso mit wie Gespräche zwischen sich und Freunden oder Nachbarn oder auch sich selbst beim Üben oder beim Mitspielen mit Plattenaufnahmen (zum Teil sogar von sich selbst). Ausschnitte aus diesen Bändern sind im letzten Jahr veröffentlicht worden; spannend aber ist an ihnen nicht nur die darauf enthaltene Musik. Armstrong sorgte sich sich nämlich auch um die Verpackung, bastelte mit Schere, Klebstoff und Scotch Tape (der amerikanischen Variante unseres Tesafilms) seltsame Collagen, die teilweise Bezug zu dem auf den Bändern enthaltenen Aufnahmen besaßen, zum Teil aber auch nicht. Fotos von ihm selbst mit bekannten Stars des Jazz oder Showbusiness sind darauf ebenso zu sehen wie Zeitungsausrisse, Fotos, die ihm von Fans zugeschickt wurden, handschriftliche oder maschinenschriftliche Kommentare, die er teilweise Zeile für Zeile, teilweise gar Wort für Wort ausgeschnitten und aufgeklebt hatte. Das alles hatte früh begonnen, mit Scrapbooks, die Clippings, Zeitungsausschnitte über seine Arbeit enthielten. Browers Buch enthält eine Vielzahl an Beispielen, aus den Scrapbooks, aus seinen Briefen, vor allem aber von den beklebten Reel-to-Reel-Tapes aus der Sammlung des Armstrong Archive. Brower setzt die darauf zu sehenden Szenen in seinem Text in Relation zu Armstrongs Leben und Karriere. Das ganze in einem wunderschönen großformatigen, durchwegs farbig gehaltenen, auf Mattglanzpapier gedruckten Buch, das Einblicke in die spielerische Kreativität erlaubt, die Grundlage seiner Musik genauso war wie offenbar überhaupt seines Lebens.
(Wolfram Knauer)
Go man, go! In de coulissen van de jazz
von Jeroen de Valk
Amsterdam 2009 (Van Gennep)
174 Seiten, 17,50 Euro
ISBN: 978-90-5515-0847
 Jeroen de Valk ist ein international renommierter Jazzjournalist, der bislang zwei wegweisende Biographien vorgelegt hat, eine über Chet Baker sowie eine über Ben Webster. In seinem neuen Buch versammelt er Artikel und Interviews, die er vor allem für die holländische Zeitschrift Jazz Nu geführt hatte. Akkordeonist Johnny Meijer blick ein wenig wehmütig auf die gute alte Zeit zurück, auf die guten Musiker, mit denen er zusammengespielt hat, genauso wie auf die schlechten. Jimmy Rowles erzählt, wie er einst Marilyn Monroe begleitet habe, Dave Brubeck davon, wie Darius Milhaud ihn auf seinem musikalischen Weg ermutigt habe. Illinois Jacquet berichtet, dass er immer noch sein “Flying Home”-Solo spielen müsse, zu dem ihn einst Lionel Hampton angefeuert habe. Sonny Rollins gibt Einblick in seine künstlerischen Selbstzweifel. Branford Marsalis macht deutlich, dass das Wichtigste im Spiel seines Vaters Ellis dessen “Sound” sein, nicht sein Anschlag, nicht seine Voicings, sondern sein “Sound! Sound! SOUND!”. Charlie Haden spricht über seine Zeit bei Ornette Coleman und seine frühere Drogensucht. Weitere Interviews geben Einblick in die musikalische Welt von Künstlern wie Ray Brown, Biig Jay McNeely, Tommy Flanagan, Joe Zawinul, Woody Shaw, Michael Brecker, aber auch von Rita Reys, Cees Slinger, Pim Jacobs, Ruud Brink, Rinus Groeneveld, Hein Van de Geyn und Joris Teepe.
Jeroen de Valk ist ein international renommierter Jazzjournalist, der bislang zwei wegweisende Biographien vorgelegt hat, eine über Chet Baker sowie eine über Ben Webster. In seinem neuen Buch versammelt er Artikel und Interviews, die er vor allem für die holländische Zeitschrift Jazz Nu geführt hatte. Akkordeonist Johnny Meijer blick ein wenig wehmütig auf die gute alte Zeit zurück, auf die guten Musiker, mit denen er zusammengespielt hat, genauso wie auf die schlechten. Jimmy Rowles erzählt, wie er einst Marilyn Monroe begleitet habe, Dave Brubeck davon, wie Darius Milhaud ihn auf seinem musikalischen Weg ermutigt habe. Illinois Jacquet berichtet, dass er immer noch sein “Flying Home”-Solo spielen müsse, zu dem ihn einst Lionel Hampton angefeuert habe. Sonny Rollins gibt Einblick in seine künstlerischen Selbstzweifel. Branford Marsalis macht deutlich, dass das Wichtigste im Spiel seines Vaters Ellis dessen “Sound” sein, nicht sein Anschlag, nicht seine Voicings, sondern sein “Sound! Sound! SOUND!”. Charlie Haden spricht über seine Zeit bei Ornette Coleman und seine frühere Drogensucht. Weitere Interviews geben Einblick in die musikalische Welt von Künstlern wie Ray Brown, Biig Jay McNeely, Tommy Flanagan, Joe Zawinul, Woody Shaw, Michael Brecker, aber auch von Rita Reys, Cees Slinger, Pim Jacobs, Ruud Brink, Rinus Groeneveld, Hein Van de Geyn und Joris Teepe.
(Wolfram Knauer)
Han Bennink. De wereld als trommel
von Erik van den Berg
Amsterdam 2009 (Uitgeverij Thomas Rap)
239 Seiten plus eine beigeheftete CD, 19,90 Euro
ISBN: 978-90-600-5671-4
 Wer international über Jazz in Holland spricht, kommt schnell auf die drei vielleicht einflussreichsten, sicher aber eigenständigsten Musiker des Landes: Willem Breuker, Misha Mengelberg und Han Bennink. Bennink ist seit mehr als 50 Jahren auf der Szene, einer der bedeutendsten europäischen Schlagzeuger des freien Jazz, daneben aber (wie durchaus auch andere große Perkussionisten dieser Richtung) ein begnadeter Swinger, denn er hat in seiner Laufbahn alles durchgemacht, vom traditionellen Jazz über den Swing, Bebop und modene Stilrichtungen bis zur freien Improvisation mit Brötzmann und Konsorten. Eric van den Berg hat nun eine Biographie des Schlagzeugers vorgelegt. Er beginnt mit der Familiengeschichte: Benninks Vater Rein war selbst Jazzmusiker gewesen, spielte Schlagzeug und Saxophon. Han wurde die Musik also quasi in die Wiege gelegt, und mit 15 Jahren trat er bereits mit seinem Vater auf, wie u.a. vier Aufnahmen auf der dem Buch beiliegenden CD belegen. 1959 errang das Quintett des Pianisten Eric van Trigt bei einem Wettbewerb in Bussum den zweiten Platz, dank auch des Schlagzeugsolos des 19jährigen Han Bennink. Bennink hörte amerikanische Bands und ließ sich von deren Schlagzeugern beeinflussen, etwa von Kenny Clarke, Louis Hayes oder Elvin Jones. 1961 fuhr er als Teil einer Schiffscombo nach New York und war von der Musik dieser Stadt beeidnruckt. Ein Jahr später begann seine Zusammenarbeit mit dem Pianisten Misha Mengelberg. Er spielte mit der Sängerin Rita Reys und begleitete amerikanische Stars wie Johnny Griffin und andere. 1964 spielte er mit Eric Dolphy, orientierte sich immer mehr an Musikern des amerikanischen “New Thing”. 1966 trat das Misha Mengelberg Quartet beim Newport Jazz Festival auf. Nebenbei war Bennink immer auch als Maler aktiv; bei seiner ersten Soloausstellung in einer Amsterdamer Galerie spielte auch Willem Breuker mit. Breuker, Mengelberg und Bennink gründeten den Instant Composers Pool (ICP), um der neuen Musik Spielorte zu verschaffen. Mehr und mehr arbeitete Bennink auch mit europäischen Kollegen zusammen, 1966 etwa mit Gunter Hampel und später mit Peter Brötzmann, bei dessen “Machine Gun”-Album von 1968 er mit von der Partie war, wie auch bei späteren Aufnahmen zwischen Duo, Trio und großer Besetzung. 1969 gehörte er zur europäischen Besetzung für Manfred Schoofs “European Echoes”. Die 70er Jahre waren die Zeit der europäischen Zusammenarbeit, ob im Rahmen von ICP oder bei Konzerten oder Aufnahmen für das FMP-Label. Wechselnde Besetzungen auch später, und keine stilistischen Berührungsängste: ob Free Jazz mit Cecil Taylor, freie improvisierte Musik mit Derek Bailey, traditionelle Gigs etwa mit Art Hodes oder Soul mit Percy Sledge. Zusammen mit dem Klarinettisten Michael Moore und dem Cellisten Ernst Reijseger bildete Bennink in den 1990er Jahren das Clusone Trio. Van den Berg beschreibt Benninks Instrumentarium, aber auch den theatralischen Klamauk, den Bennink auf ihnen vollführen kann, ohne jemals den musikalischen Sinn aus dem Blick zu verlieren, etwa wenn er in einer Performance im Museum of Contemporary Art in Toronto 2005 auf Käsetrommeln spielt, was ihm eine Einladung in Jay Lenos Talkshow einbrachte (die er allerdings ablehnte). Van den Berg greift auf Interviews mit Bennink und seinen Musikerkollegen zurück, aber auch auf Benninks Tagebuch. Am Schluss findet sich ein Blindfold Test, eine Liste (nur) der wichtigsten Platten sowie eine Literaturliste. Die beiligende CD enthält neben Aufnahmen mit seinem Vater von 1955 einen Mitschnitt des Zaans Rhythme Quartet von 1960, des Misha Mengelberg/Pieter Noordijk Quartet von 1966, Benninks Schlagzeugsolo vom Newport Jazz Festival 1966, eine Trioaufnahme mit Sonny Sollins, drei Titel mit Art Hodes sowie ein Live-Duomitschnitt mit Misha Mengelberg aus dem Jahr 1978. Ein lobens- und lohnenswertes Buch über einen der spannendsten Schlagzeuger Europas. Zur Lektüre braucht es bislang noch ordentlicher niederländischer Sprachkenntnisse; wir hoffen auf eine englische Übersetzung des Buchs.
Wer international über Jazz in Holland spricht, kommt schnell auf die drei vielleicht einflussreichsten, sicher aber eigenständigsten Musiker des Landes: Willem Breuker, Misha Mengelberg und Han Bennink. Bennink ist seit mehr als 50 Jahren auf der Szene, einer der bedeutendsten europäischen Schlagzeuger des freien Jazz, daneben aber (wie durchaus auch andere große Perkussionisten dieser Richtung) ein begnadeter Swinger, denn er hat in seiner Laufbahn alles durchgemacht, vom traditionellen Jazz über den Swing, Bebop und modene Stilrichtungen bis zur freien Improvisation mit Brötzmann und Konsorten. Eric van den Berg hat nun eine Biographie des Schlagzeugers vorgelegt. Er beginnt mit der Familiengeschichte: Benninks Vater Rein war selbst Jazzmusiker gewesen, spielte Schlagzeug und Saxophon. Han wurde die Musik also quasi in die Wiege gelegt, und mit 15 Jahren trat er bereits mit seinem Vater auf, wie u.a. vier Aufnahmen auf der dem Buch beiliegenden CD belegen. 1959 errang das Quintett des Pianisten Eric van Trigt bei einem Wettbewerb in Bussum den zweiten Platz, dank auch des Schlagzeugsolos des 19jährigen Han Bennink. Bennink hörte amerikanische Bands und ließ sich von deren Schlagzeugern beeinflussen, etwa von Kenny Clarke, Louis Hayes oder Elvin Jones. 1961 fuhr er als Teil einer Schiffscombo nach New York und war von der Musik dieser Stadt beeidnruckt. Ein Jahr später begann seine Zusammenarbeit mit dem Pianisten Misha Mengelberg. Er spielte mit der Sängerin Rita Reys und begleitete amerikanische Stars wie Johnny Griffin und andere. 1964 spielte er mit Eric Dolphy, orientierte sich immer mehr an Musikern des amerikanischen “New Thing”. 1966 trat das Misha Mengelberg Quartet beim Newport Jazz Festival auf. Nebenbei war Bennink immer auch als Maler aktiv; bei seiner ersten Soloausstellung in einer Amsterdamer Galerie spielte auch Willem Breuker mit. Breuker, Mengelberg und Bennink gründeten den Instant Composers Pool (ICP), um der neuen Musik Spielorte zu verschaffen. Mehr und mehr arbeitete Bennink auch mit europäischen Kollegen zusammen, 1966 etwa mit Gunter Hampel und später mit Peter Brötzmann, bei dessen “Machine Gun”-Album von 1968 er mit von der Partie war, wie auch bei späteren Aufnahmen zwischen Duo, Trio und großer Besetzung. 1969 gehörte er zur europäischen Besetzung für Manfred Schoofs “European Echoes”. Die 70er Jahre waren die Zeit der europäischen Zusammenarbeit, ob im Rahmen von ICP oder bei Konzerten oder Aufnahmen für das FMP-Label. Wechselnde Besetzungen auch später, und keine stilistischen Berührungsängste: ob Free Jazz mit Cecil Taylor, freie improvisierte Musik mit Derek Bailey, traditionelle Gigs etwa mit Art Hodes oder Soul mit Percy Sledge. Zusammen mit dem Klarinettisten Michael Moore und dem Cellisten Ernst Reijseger bildete Bennink in den 1990er Jahren das Clusone Trio. Van den Berg beschreibt Benninks Instrumentarium, aber auch den theatralischen Klamauk, den Bennink auf ihnen vollführen kann, ohne jemals den musikalischen Sinn aus dem Blick zu verlieren, etwa wenn er in einer Performance im Museum of Contemporary Art in Toronto 2005 auf Käsetrommeln spielt, was ihm eine Einladung in Jay Lenos Talkshow einbrachte (die er allerdings ablehnte). Van den Berg greift auf Interviews mit Bennink und seinen Musikerkollegen zurück, aber auch auf Benninks Tagebuch. Am Schluss findet sich ein Blindfold Test, eine Liste (nur) der wichtigsten Platten sowie eine Literaturliste. Die beiligende CD enthält neben Aufnahmen mit seinem Vater von 1955 einen Mitschnitt des Zaans Rhythme Quartet von 1960, des Misha Mengelberg/Pieter Noordijk Quartet von 1966, Benninks Schlagzeugsolo vom Newport Jazz Festival 1966, eine Trioaufnahme mit Sonny Sollins, drei Titel mit Art Hodes sowie ein Live-Duomitschnitt mit Misha Mengelberg aus dem Jahr 1978. Ein lobens- und lohnenswertes Buch über einen der spannendsten Schlagzeuger Europas. Zur Lektüre braucht es bislang noch ordentlicher niederländischer Sprachkenntnisse; wir hoffen auf eine englische Übersetzung des Buchs.
(Wolfram Knauer)
Pop. Geschichte eines Konzepts 1955-2009
von Thomas Hecken
Bielefeld 2009 (transkript)
563 Seiten, 35,80 Euro
ISBN: 978-3-89942-982-4
 Mit dem Begriff “Pop” verbinden sich alle möglichen kulturellen Phänomene und Tendenzen, angefangen bei der Popmusik über die Pop-Art, die Popkultur bis hin zu Phänomenen in Underground, New Journalism, Postmoderne und Lifestyle. Thomas Hecken, germanist an der Ruhr-Universität in Bochum, versucht in seinem Buch die verschiedenen Seiten von “Pop” zwischen Underground und Kommerz zu beleuchten. Er beginnt weit vor der Popkultur (nach unserem Verständnis), nämlich bei Herder, Schiller, Kant und dem Reiz des Populären, klopft außerdem Baudelaire, Huysmans, Wilde und Nietzsche mit ihrer Tendenz künstlich zu erregen, den Futurismus, den Expressionismus, den Dadaismus und den Surrealismus sowie das Jazz Age und die Neue Sachlichkeit daraufhin ab, inwiefern sie als Vorläufer oder Einflussgeber der Pop-Idee dienen könnten. In seinem zweiten Kapitel arbeitet er heraus, wie diese Pop-Idee in den 50er und 60er Jahren aus der Pop Art herausgelöst wurde. Er diskutiert Begriffe wie “Massenkultur” und “populäre Kultur”, reflektiert über die englische Independent Group und das Verhältnis von Pop Art zur Tradition der Dekadenz und Avantgarde. Mitte der 60er Jahre also setzte sich der Begriff “Pop” für ein neues Konzept durch, das aber immer noch weit stärker im bildnerisch künstlerischen Bereich als etwa in der Musik angesiedelt war. Daneben wurde “Pop” immer mehr synonym als Träger des zeitgenössisch vorherrschenden Geschmacks verstanden und damit als ein auch jugendkulturelles Phänomen. Hier nun kommt mehr und mehr auch die Musik ins Spiel, von Beatles über Rolling Stones bis The Who, die nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in der Reflektion den Pop-Diskurs beeinflussten. Pop bestimmt mit seiner positiv-jungen Belegung dabei auch die Ästhetik anderer Genres, ob Film, Literatur oder Feuilleton. Parallel entwickelte sich in den 1960er Jahren aber auch eine Art Underground-Popästhetik. In seinem diesbezüglichen Kapitel versucht Hecken eine ausführliche Abgrenzung zwischen Pop und Rock und der mit beiden verbundenen künstlerischen wie ästhetischen Konnotationen. Neben den üblichen anglo-amerikanischen bemüht Hecken auch deutsche Beispiele. War man in den 60er Jahren damit beschäftigt, die ästhetischen Konzepte überhaupt zu entwickeln, so konnte man in den 70er Jahren bereits über sie reflektieren, wie Hecken in seinem Kapitel über die “Pop-Theorie” darlegt. Dieser Diskurs handelt von Oberflächlichkeit oder Gegenkultur, von Kommerz und Konsum-Freiheit, von Manipulation und Populismus. Ein eigenes Kapitel widmet Hecken der Diskussion, wie sich “Pop” in der Postmoderne-Diskussion der 70er Jahre wiederfindet. Konkrete Beispiele liefert der Eklektizismus im Rock (Zappa), Glam (David Bowie) und Punk. In den 80er Jahren dann stellt Hecken die “Vollendung der Pop-Affirmation” fest. Schließlich beschäftigt er sich im Schlusskapitel (aber auch immer wieder zwischendurch) mit seiner eigenen Rolle und der seiner Kollegen: mit der Akademisierung von Pop und der Theoriebildung über Poptheorie. Ein ausführliches Literaturverzeichnis beendet das Buch. Alles in allem: ein dicker Brocken “Pop”, in dem Hecken die Debatten um Begriff und Inhalt nachzeichnet, ein spannendes Buch und ein exzellentes Nachschlagwerk zur Idee des “Pop”-Konzepts, das historisch erläutert und doch auch laufend zum Hinterfragen und zum Selbst-Stellungnehmen auffordert.. Der Jazz übrigens kommt innerhalb des Buchs kaum vor, doch berühren sich die (auch ästhetischen) Welten von Jazz und Pop in den 60er und 70er Jahren so oft, dass Hecken einem auch da den Weg weisen kann, wenn man wieder einmal unreflektiert über “Pop” spricht und ahnt, dass das Phänomen weit vielfältiger ist als der griffige Name.
Mit dem Begriff “Pop” verbinden sich alle möglichen kulturellen Phänomene und Tendenzen, angefangen bei der Popmusik über die Pop-Art, die Popkultur bis hin zu Phänomenen in Underground, New Journalism, Postmoderne und Lifestyle. Thomas Hecken, germanist an der Ruhr-Universität in Bochum, versucht in seinem Buch die verschiedenen Seiten von “Pop” zwischen Underground und Kommerz zu beleuchten. Er beginnt weit vor der Popkultur (nach unserem Verständnis), nämlich bei Herder, Schiller, Kant und dem Reiz des Populären, klopft außerdem Baudelaire, Huysmans, Wilde und Nietzsche mit ihrer Tendenz künstlich zu erregen, den Futurismus, den Expressionismus, den Dadaismus und den Surrealismus sowie das Jazz Age und die Neue Sachlichkeit daraufhin ab, inwiefern sie als Vorläufer oder Einflussgeber der Pop-Idee dienen könnten. In seinem zweiten Kapitel arbeitet er heraus, wie diese Pop-Idee in den 50er und 60er Jahren aus der Pop Art herausgelöst wurde. Er diskutiert Begriffe wie “Massenkultur” und “populäre Kultur”, reflektiert über die englische Independent Group und das Verhältnis von Pop Art zur Tradition der Dekadenz und Avantgarde. Mitte der 60er Jahre also setzte sich der Begriff “Pop” für ein neues Konzept durch, das aber immer noch weit stärker im bildnerisch künstlerischen Bereich als etwa in der Musik angesiedelt war. Daneben wurde “Pop” immer mehr synonym als Träger des zeitgenössisch vorherrschenden Geschmacks verstanden und damit als ein auch jugendkulturelles Phänomen. Hier nun kommt mehr und mehr auch die Musik ins Spiel, von Beatles über Rolling Stones bis The Who, die nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in der Reflektion den Pop-Diskurs beeinflussten. Pop bestimmt mit seiner positiv-jungen Belegung dabei auch die Ästhetik anderer Genres, ob Film, Literatur oder Feuilleton. Parallel entwickelte sich in den 1960er Jahren aber auch eine Art Underground-Popästhetik. In seinem diesbezüglichen Kapitel versucht Hecken eine ausführliche Abgrenzung zwischen Pop und Rock und der mit beiden verbundenen künstlerischen wie ästhetischen Konnotationen. Neben den üblichen anglo-amerikanischen bemüht Hecken auch deutsche Beispiele. War man in den 60er Jahren damit beschäftigt, die ästhetischen Konzepte überhaupt zu entwickeln, so konnte man in den 70er Jahren bereits über sie reflektieren, wie Hecken in seinem Kapitel über die “Pop-Theorie” darlegt. Dieser Diskurs handelt von Oberflächlichkeit oder Gegenkultur, von Kommerz und Konsum-Freiheit, von Manipulation und Populismus. Ein eigenes Kapitel widmet Hecken der Diskussion, wie sich “Pop” in der Postmoderne-Diskussion der 70er Jahre wiederfindet. Konkrete Beispiele liefert der Eklektizismus im Rock (Zappa), Glam (David Bowie) und Punk. In den 80er Jahren dann stellt Hecken die “Vollendung der Pop-Affirmation” fest. Schließlich beschäftigt er sich im Schlusskapitel (aber auch immer wieder zwischendurch) mit seiner eigenen Rolle und der seiner Kollegen: mit der Akademisierung von Pop und der Theoriebildung über Poptheorie. Ein ausführliches Literaturverzeichnis beendet das Buch. Alles in allem: ein dicker Brocken “Pop”, in dem Hecken die Debatten um Begriff und Inhalt nachzeichnet, ein spannendes Buch und ein exzellentes Nachschlagwerk zur Idee des “Pop”-Konzepts, das historisch erläutert und doch auch laufend zum Hinterfragen und zum Selbst-Stellungnehmen auffordert.. Der Jazz übrigens kommt innerhalb des Buchs kaum vor, doch berühren sich die (auch ästhetischen) Welten von Jazz und Pop in den 60er und 70er Jahren so oft, dass Hecken einem auch da den Weg weisen kann, wenn man wieder einmal unreflektiert über “Pop” spricht und ahnt, dass das Phänomen weit vielfältiger ist als der griffige Name.
(Wolfram Knauer)
tell no lies, claim no victories
herausgegeben von Philipp Schmickl & Hans Falb
Nickelsdorf 2009 (Verein Impro 2000)
208 Seiten, 25 Euro
 Gerade in den experimentellen Seiten des Jazz und der improvisierten Musikbedarf es Veranstalter, die vor allem ihrem eigenen Ohr folgen und nicht auf Publikum schielen müssen. Macht man das lang genug und bleibt sich selbst, den Musikern und dem Publikum gegenüber (ästhetisch) ehrlich, dann erreicht man im Idealfall ein eingeschworenes Publikum, das das Möglichmachen von Experimenten zu schätzen weiß. Ein solcher Fall ist das Konfrontationen-Festival im österreichischen Nickelsdorf, das seit 30 Jahren das Experiment eines Festivals improvisierter Musik wagt und damit weit über die Grenzen Österreichs bekannt wurde. Konfrontationen-Gründer Hans Falb und Philipp Schmickl haben nun ein Buch vorgelegt, das verschiedene Seiten der improvisierten Musik dokumentiert, daneben aber immer auch eine Homage an die Freiheit der Performance und damit an das Nickelsdorfer Festival selbst ist. Joe McPhee verneigt sich darin vor Clifford Thornton; Georg Graewe reflektiert über die Spielstätten, in denen Jazzmusiker arbeiten; Hans Falb schreibt über den Klarinettisten John Carter. Falb unterhält sich außerdem mit Roscoe Mitchell über die AACM, und Alexandre Pierrepont reflektiert über jüngere Aktivitäten der AACM. Paul Lovens erzählt übers Schlagzeugspielen, über sein Instrument, über (nicht mur musikalische) Einflüsse auf seine Kunst, über das Gedächtnis,und warum er beim Spielen meist ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte trägt. Auch Hamid Drake erzählt über seine Einflüsse, insbesondere über die Bedeutung Fred Andersons und der Chicagoer Community für seine Entwicklung. Joelle Léandre erklärt, dass das Improvisieren eine ernsthafte Kunst sei, die man nicht improvisiere. Evan Parker reflektiert über aktuelle improvisierte Musik und wie sich ihre Ästhetik ändere. Mircea Streit berichtet über improvisierte Musik in Rumänien. Dazwischen gibt es viele Fotos, die ein wenig den Geist Nickelsdorfs beschwören: musikalisch, nachdenklich, beschaulich, intensiv, kreativ. Eine Labor of Love, ganz wie das Festival. Konfrontationen…
Gerade in den experimentellen Seiten des Jazz und der improvisierten Musikbedarf es Veranstalter, die vor allem ihrem eigenen Ohr folgen und nicht auf Publikum schielen müssen. Macht man das lang genug und bleibt sich selbst, den Musikern und dem Publikum gegenüber (ästhetisch) ehrlich, dann erreicht man im Idealfall ein eingeschworenes Publikum, das das Möglichmachen von Experimenten zu schätzen weiß. Ein solcher Fall ist das Konfrontationen-Festival im österreichischen Nickelsdorf, das seit 30 Jahren das Experiment eines Festivals improvisierter Musik wagt und damit weit über die Grenzen Österreichs bekannt wurde. Konfrontationen-Gründer Hans Falb und Philipp Schmickl haben nun ein Buch vorgelegt, das verschiedene Seiten der improvisierten Musik dokumentiert, daneben aber immer auch eine Homage an die Freiheit der Performance und damit an das Nickelsdorfer Festival selbst ist. Joe McPhee verneigt sich darin vor Clifford Thornton; Georg Graewe reflektiert über die Spielstätten, in denen Jazzmusiker arbeiten; Hans Falb schreibt über den Klarinettisten John Carter. Falb unterhält sich außerdem mit Roscoe Mitchell über die AACM, und Alexandre Pierrepont reflektiert über jüngere Aktivitäten der AACM. Paul Lovens erzählt übers Schlagzeugspielen, über sein Instrument, über (nicht mur musikalische) Einflüsse auf seine Kunst, über das Gedächtnis,und warum er beim Spielen meist ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte trägt. Auch Hamid Drake erzählt über seine Einflüsse, insbesondere über die Bedeutung Fred Andersons und der Chicagoer Community für seine Entwicklung. Joelle Léandre erklärt, dass das Improvisieren eine ernsthafte Kunst sei, die man nicht improvisiere. Evan Parker reflektiert über aktuelle improvisierte Musik und wie sich ihre Ästhetik ändere. Mircea Streit berichtet über improvisierte Musik in Rumänien. Dazwischen gibt es viele Fotos, die ein wenig den Geist Nickelsdorfs beschwören: musikalisch, nachdenklich, beschaulich, intensiv, kreativ. Eine Labor of Love, ganz wie das Festival. Konfrontationen…
(Wolfram Knauer)
Das Buch kann hier bestellt werden: www.konfrontationen.at/ko09/nolies.html
Man of the Light. Życie I twórczość Zigniewa Seiferta,
Aneta Norek
Krakow 2009 (Musica Iagellonica)
168 Seiten plus eine beigeheftete CD, 45 PLN
ISBN: 978-83-7099-166-1
 Aneta Norek schrieb ihre Magisterarbeit über den Einfluss der Musik von Karol Szymanowski auf den Jazzgeiger Zbigniew Seifert. Bei den Recherchen traf sie auf so viele Musiker, die von Seiferts Musik nachhaltig beeinflusst waren, dass sie sich entschloss, eine Biographie des 1979 an Krebs verstorbenen polnischen Violinisten zu schreiben. Sie kontaktierte viele der Musiker, mit denen Seifert seit den frühen 1960er Jahren zusammengespielt hatte, forschte in Archiven vor Ort in Krakau genauso wie beispielsweise beim Jazzinstitut Darmstadt und legt jetzt ein Buch vor, das sein Leben und seine musikalische Entwicklung verfolgt, gespickt ist mit seltenen Fotos und Dokumenten. Diese machen das Buch sicher auch für Leser interessant, die des Polnischen nicht mächtig sind. Auch ohne die notwendigen Sprachkenntnisse merkt man schnell, welch akribische Arbeit in Noreks Recherchen ging, und hofft, dass vielleicht doch eines Tages eine zumindest englische Übersetzung des Buches möglich wird. Die Buchvorstellung fand übrigens im Rahmen eines Seifert gewidmeten Festivals in Krakau statt, bei dem unter anderem Seiferts “Jazzkonzert für Violine, Sinfonieorchester und Rhythmusgruppe” aufgeführt wurde, mit Mateusz Smoczynski (Geige), Joachim Kühn (Piano), Bronislaw Suchanek (Bass), Janusz Stefanski (Drums) und dem Philharmonischen Orchester Krakau. Eine CD mit der Originalaufnahme dieser Komposition heftet dem Buch bei. Kühn war 1974 ebenfalls mit von der Partie, daneben spielten außer Seifert Eberhard Weber, Daniel Humair und das Runfkunkorchester Hannover des NDR.
Aneta Norek schrieb ihre Magisterarbeit über den Einfluss der Musik von Karol Szymanowski auf den Jazzgeiger Zbigniew Seifert. Bei den Recherchen traf sie auf so viele Musiker, die von Seiferts Musik nachhaltig beeinflusst waren, dass sie sich entschloss, eine Biographie des 1979 an Krebs verstorbenen polnischen Violinisten zu schreiben. Sie kontaktierte viele der Musiker, mit denen Seifert seit den frühen 1960er Jahren zusammengespielt hatte, forschte in Archiven vor Ort in Krakau genauso wie beispielsweise beim Jazzinstitut Darmstadt und legt jetzt ein Buch vor, das sein Leben und seine musikalische Entwicklung verfolgt, gespickt ist mit seltenen Fotos und Dokumenten. Diese machen das Buch sicher auch für Leser interessant, die des Polnischen nicht mächtig sind. Auch ohne die notwendigen Sprachkenntnisse merkt man schnell, welch akribische Arbeit in Noreks Recherchen ging, und hofft, dass vielleicht doch eines Tages eine zumindest englische Übersetzung des Buches möglich wird. Die Buchvorstellung fand übrigens im Rahmen eines Seifert gewidmeten Festivals in Krakau statt, bei dem unter anderem Seiferts “Jazzkonzert für Violine, Sinfonieorchester und Rhythmusgruppe” aufgeführt wurde, mit Mateusz Smoczynski (Geige), Joachim Kühn (Piano), Bronislaw Suchanek (Bass), Janusz Stefanski (Drums) und dem Philharmonischen Orchester Krakau. Eine CD mit der Originalaufnahme dieser Komposition heftet dem Buch bei. Kühn war 1974 ebenfalls mit von der Partie, daneben spielten außer Seifert Eberhard Weber, Daniel Humair und das Runfkunkorchester Hannover des NDR.
(Wolfram Knauer)
Art Tatum. Eine Biographie
von Mark Lehmstedt
Leipzig 2009 (Lehmstedt Verlag)
319 Seiten, 39,90 Euro
ISBN: 978-3-937146-80-5
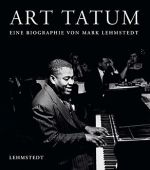 Über Art Tatum ist viel geschrieben worden. Es existiert eine umfassende Diskographie (von Arnold Laubich & Ray Spencer, 1982) und eine Biographie (von James Lester, 1994), außerdem eine Dissertation, die seine frühe Zeit in Toledo untersucht (von Imelda Hunt, 1995). Nun legt ausgerechnet ein deutscher Autor eine umfassende Tatum-Biographie vor, für die er in Archiven gestöbert und alles an Informationen über den Pianisten zusammengeklaubt hat, was er finden konnte. Herausgekommen ist ein überaus lesenswertes Buch, die Lebensgeschichte eines Mannes, der in eine Mittelklassefamilie geboren wurde, mit nur geringster Sehkraft durchs Leben kam und seit den frühen 1930er Jahren zu den bewundertsten Pianisten des Jazz gehörte. “Ich spiele nur Klavier”, soll Fats Waller einmal gesagt haben, als Art Tatum einen Club betrat, in dem er spielte, “aber heute ist Gott im Raum.” Lehmstedt nimmt die veröffentlichten Biographien zum Ausgangspunkt und baut auf ihnen auf, verflicht die Informationen, die er über Tatum erhält, mit denen über andere Musiker oder über soziale oder Lebensumstände der Zeit. Er durchsetzt die Geschichte vor allem stark mit Zeitzeugenberichten, Ausschnitten aus Interviews mit Tatum oder anderen Musikern und muss sich damit nur selten mit eigenen Mutmaßungen begnügen. Er beschreibt den Ruhm, den Tatum als Solist hatte, und zwar nicht nur in der Welt des Jazz, er schreibt über das schlagzeuglose Klaviertrio, das Tatum zwar nicht erfunden, aber ganz sicher besonders bekannt gemacht hatte, über Konzerte in Kaschemmen, mondänen Nightclubs und auf großen Konzertbühnen, über Jam Sessions mit Kollegen, seine Plattenaufnahmen für Norman Granz und über die unendliche Bewunderung, die Tatum, von Musikern aus allen Stilbereichen des Jazz, aber auch aus der Klassik und von anderswo entgegengebracht wurde. Lehmstedt gelingt es, all diese Puzzleteilchen seiner Recherche zu einen spannend zu lesenden Text zusammenzufügen, in dem seine eigene Bewunderung durchscheint ohne zu dominieren. Die Musik kommt bei alledem manchmal etwas kurz: Lehmstedt ist kein Musikschriftsteller, dem es gelingen könnte, die Musik mit Worten zum Klingen zu bringen. Seine musikalischen Einlassungen lassen es meist beim oft-gelesenen Klischeehaften, ohne tiefer in die Musik einzudringen, ohne zu hinterfragen, was genau an Tatums Tastenvirtuosität so fesselnd ist. Er muss sich auf Kollegen stützen, um dies zu tun, aber dafür hat er genügend — und zwar genügend gute — Schriftsteller, die er zitieren kann. Diese Tatsache ist also keineswegs als Kritik zu werten, und eigentlich fehlt die musikalische Einlassung auch nicht wirklich, denn das Buch heißt nun mal “Eine Biographie”, und es ist am besten mit einer Tatum CD (oder zwei oder drei) zu lesen. Und anzuschauen: Viele Fotos nämlich sind auch dabei, wunderbar reproduziert und oft genug großformatig abgedruckt. Am Ende finden sich eine Diskographie sowie eine ausführliche Literaturliste und ein Personenindex. Das ganze ist eindeutig eine “labor of love”, daneben eine Fleißarbeit und schließlich eine spannende Lektüre für jeden, der dem Klaviergott des Jazz näher kommen will.
Über Art Tatum ist viel geschrieben worden. Es existiert eine umfassende Diskographie (von Arnold Laubich & Ray Spencer, 1982) und eine Biographie (von James Lester, 1994), außerdem eine Dissertation, die seine frühe Zeit in Toledo untersucht (von Imelda Hunt, 1995). Nun legt ausgerechnet ein deutscher Autor eine umfassende Tatum-Biographie vor, für die er in Archiven gestöbert und alles an Informationen über den Pianisten zusammengeklaubt hat, was er finden konnte. Herausgekommen ist ein überaus lesenswertes Buch, die Lebensgeschichte eines Mannes, der in eine Mittelklassefamilie geboren wurde, mit nur geringster Sehkraft durchs Leben kam und seit den frühen 1930er Jahren zu den bewundertsten Pianisten des Jazz gehörte. “Ich spiele nur Klavier”, soll Fats Waller einmal gesagt haben, als Art Tatum einen Club betrat, in dem er spielte, “aber heute ist Gott im Raum.” Lehmstedt nimmt die veröffentlichten Biographien zum Ausgangspunkt und baut auf ihnen auf, verflicht die Informationen, die er über Tatum erhält, mit denen über andere Musiker oder über soziale oder Lebensumstände der Zeit. Er durchsetzt die Geschichte vor allem stark mit Zeitzeugenberichten, Ausschnitten aus Interviews mit Tatum oder anderen Musikern und muss sich damit nur selten mit eigenen Mutmaßungen begnügen. Er beschreibt den Ruhm, den Tatum als Solist hatte, und zwar nicht nur in der Welt des Jazz, er schreibt über das schlagzeuglose Klaviertrio, das Tatum zwar nicht erfunden, aber ganz sicher besonders bekannt gemacht hatte, über Konzerte in Kaschemmen, mondänen Nightclubs und auf großen Konzertbühnen, über Jam Sessions mit Kollegen, seine Plattenaufnahmen für Norman Granz und über die unendliche Bewunderung, die Tatum, von Musikern aus allen Stilbereichen des Jazz, aber auch aus der Klassik und von anderswo entgegengebracht wurde. Lehmstedt gelingt es, all diese Puzzleteilchen seiner Recherche zu einen spannend zu lesenden Text zusammenzufügen, in dem seine eigene Bewunderung durchscheint ohne zu dominieren. Die Musik kommt bei alledem manchmal etwas kurz: Lehmstedt ist kein Musikschriftsteller, dem es gelingen könnte, die Musik mit Worten zum Klingen zu bringen. Seine musikalischen Einlassungen lassen es meist beim oft-gelesenen Klischeehaften, ohne tiefer in die Musik einzudringen, ohne zu hinterfragen, was genau an Tatums Tastenvirtuosität so fesselnd ist. Er muss sich auf Kollegen stützen, um dies zu tun, aber dafür hat er genügend — und zwar genügend gute — Schriftsteller, die er zitieren kann. Diese Tatsache ist also keineswegs als Kritik zu werten, und eigentlich fehlt die musikalische Einlassung auch nicht wirklich, denn das Buch heißt nun mal “Eine Biographie”, und es ist am besten mit einer Tatum CD (oder zwei oder drei) zu lesen. Und anzuschauen: Viele Fotos nämlich sind auch dabei, wunderbar reproduziert und oft genug großformatig abgedruckt. Am Ende finden sich eine Diskographie sowie eine ausführliche Literaturliste und ein Personenindex. Das ganze ist eindeutig eine “labor of love”, daneben eine Fleißarbeit und schließlich eine spannende Lektüre für jeden, der dem Klaviergott des Jazz näher kommen will.
(Wolfram Knauer)
The Music and Life of Theodore “Fats” Navarro. Infatuation
von Leif Bo Petersen & Theo Rehak
Lanham/MD 2009 (Scarecrow Press)
378 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-6721-5
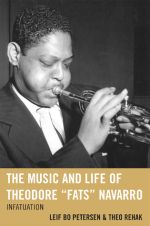 Leif Bo Petersen und Theo Rehak (der Bruder des Posaunisten Frank Rehak) sind beide Amateurtrompeter und seit langem von der Musik Fats Navarros fasziniert. Rehak war 1966 durch den Kritiker George Hoefer, der ein Freund der Familie war, auf Navarro aufmerksam geworden und hatte seither Interviews und Informationen über den Trompeter gesammelt. In der vorliegenden Biographie vereinen sie ihr Fachwissen in einem beispielhaften Unterfangen, biographische Details, musikalische Analyse und diskographische Recherche zusammenzubringen. Rehak fand 1969 die Mutter Navarros und konnte so die Kindheit und Jugend des Trompeters sorgfältig recherchieren. Navarro wurde 1923 in Key West geboren. In der Schule begann er Trompete zu spielen, tourte mit Freunden und spielte in Hotels und Kaschemmen. 1941 wurde er Mitglied der Territory Band von Sol Albright in Orlando, später im selben Jahr spielte er in der Band von Snookum Russell in Indianapolis, in der er neben dem Posaunisten J.J. Johnson saß. Von 1943 bis 1945 wirkte er in Andy Kirks Band, in der auch Howard McGhee spielte, und war 1945 mit Coleman Hawkins auf der 52nd Street in New York zu hören. In New York hörte er Dizzy Gillespie, von dem er so begeistert war, dass er dessen Soli Ton für Ton nachspielen konnte. Im Frühjahr 1945 ersetzte er Gillespie in der Band Billy Eckstines. Nach diversen Bigbands war er ab 1946 in kleineren Besetzungen zu hören, etwa von Hawkins, Kenny Clarke oder Eddie Lockjaw Davis. Anfang 1947 spielte er mit der Illinois Jacquet Big Band, ab Herbst des Jahres erschienen dann seine ersten Aufnahmen unter eigenem Namen, die er für das Blue Note-Label einspielte. Er war mit Tadd Dameron zu hören und mit Allstar-Bands um Hawkins oder Lionel Hampton und wurde 1948 Mitglied des Septetts Benny Goodmans, der damals versuchte auf den Zug des modernen Jazz aufzuspringen. 1949 war Navarro bei Bud Powells legendärer Plattensitzung für Blue Note mit dabei und trat 1949 im Birdland mit Charlie Parker auf. Er war damals bereits schwer heroin-abhängig und litt außerdem an fortgeschrittener Tuberkulose, an der er am 6. Juli 1950 verstarb. Petersen und Rehak teilen sich die Arbeit: Rehak erzählt die Lebensgeschichte, sorgfältig recherchiert, gewürzt mit Interviews von Zeitzeugen und Musikerkollegen, Petersen liefert die zwischen die Kapitel geschaltete Diskographie, die allerdings weit mehr ist als eine herkömmliche Diskographie, nämlich zugleich analytische Anmerkungen und Transkriptionen vieler Soli des Trompeters enthält. Für jeden ist etwas dabei, und besser ist es wohl kaum zu machen. Ein mehr als lobenswerter jazzhistorischer Wurf der Buchrreihe, die vom Institute of Jazz Studies an der Rutgers University betreut und herausgegeben wird.
Leif Bo Petersen und Theo Rehak (der Bruder des Posaunisten Frank Rehak) sind beide Amateurtrompeter und seit langem von der Musik Fats Navarros fasziniert. Rehak war 1966 durch den Kritiker George Hoefer, der ein Freund der Familie war, auf Navarro aufmerksam geworden und hatte seither Interviews und Informationen über den Trompeter gesammelt. In der vorliegenden Biographie vereinen sie ihr Fachwissen in einem beispielhaften Unterfangen, biographische Details, musikalische Analyse und diskographische Recherche zusammenzubringen. Rehak fand 1969 die Mutter Navarros und konnte so die Kindheit und Jugend des Trompeters sorgfältig recherchieren. Navarro wurde 1923 in Key West geboren. In der Schule begann er Trompete zu spielen, tourte mit Freunden und spielte in Hotels und Kaschemmen. 1941 wurde er Mitglied der Territory Band von Sol Albright in Orlando, später im selben Jahr spielte er in der Band von Snookum Russell in Indianapolis, in der er neben dem Posaunisten J.J. Johnson saß. Von 1943 bis 1945 wirkte er in Andy Kirks Band, in der auch Howard McGhee spielte, und war 1945 mit Coleman Hawkins auf der 52nd Street in New York zu hören. In New York hörte er Dizzy Gillespie, von dem er so begeistert war, dass er dessen Soli Ton für Ton nachspielen konnte. Im Frühjahr 1945 ersetzte er Gillespie in der Band Billy Eckstines. Nach diversen Bigbands war er ab 1946 in kleineren Besetzungen zu hören, etwa von Hawkins, Kenny Clarke oder Eddie Lockjaw Davis. Anfang 1947 spielte er mit der Illinois Jacquet Big Band, ab Herbst des Jahres erschienen dann seine ersten Aufnahmen unter eigenem Namen, die er für das Blue Note-Label einspielte. Er war mit Tadd Dameron zu hören und mit Allstar-Bands um Hawkins oder Lionel Hampton und wurde 1948 Mitglied des Septetts Benny Goodmans, der damals versuchte auf den Zug des modernen Jazz aufzuspringen. 1949 war Navarro bei Bud Powells legendärer Plattensitzung für Blue Note mit dabei und trat 1949 im Birdland mit Charlie Parker auf. Er war damals bereits schwer heroin-abhängig und litt außerdem an fortgeschrittener Tuberkulose, an der er am 6. Juli 1950 verstarb. Petersen und Rehak teilen sich die Arbeit: Rehak erzählt die Lebensgeschichte, sorgfältig recherchiert, gewürzt mit Interviews von Zeitzeugen und Musikerkollegen, Petersen liefert die zwischen die Kapitel geschaltete Diskographie, die allerdings weit mehr ist als eine herkömmliche Diskographie, nämlich zugleich analytische Anmerkungen und Transkriptionen vieler Soli des Trompeters enthält. Für jeden ist etwas dabei, und besser ist es wohl kaum zu machen. Ein mehr als lobenswerter jazzhistorischer Wurf der Buchrreihe, die vom Institute of Jazz Studies an der Rutgers University betreut und herausgegeben wird.
(Wolfram Knauer)
Die Stimme im HipHop. Untersuchungen eines intermedialen Phänomens
Herausgegeben von Fernand Hörner & Oliver Kautny
Bielefeld 2009 (transcript)
Reihe Studien zur Popularmusik
210 Seiten, 22,80 Euro
ISBN: 978-3-89942-998-5
 Schon lange ist HipHop kein Jugendphänomen allein mehr, schon lange spielt er nicht mehr nur in der Subkultur Afro-Amerikas ab. HipHop ist ein weltweites genreübergreifendes Phänomen geworden, das insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Kreativität in musikalische Äuzßerungen umzusetzen. Die Beiträge des vorliegenden Bandes untersuchen, welche Rolle dabei die Stimme spielt, und was Stimme über die Worte hinaus, die mit ihr gesungen und gerapt werden, an Informationen gibt. Murray Forman untersucht dabei, wie vokale Intonation im Rap mit der Konstruktuon symbolischer Werte und sozialer Bedeutungen korreliert. Christian Bielefeldt geht auf die konkreten Inhalte ein, die sich klischeehaft in vielen Rap-Lyrics finden und stellt die beiden Narrative von Black Dandy und Bad Nigga gegenüber. Johannes Ismaiel-Wendt und Susanne Stemmler befassen sich mit der Musik des kanadisch-somalischen MCs K’Naan, dessen Lieder den Hörer im Ineinandergreifen von Stimme, Text, Musik und biographischer Information mit einer Vorstellung von Afrika verbinden, die dem Sänger vorschwebt. Fernand Hörner analysiert den Videoclip “Authentik” der französischen HipHop-Band Suprême NTM. Stefan Neumann schaut auf die HipHop-Skits, die gesprochenen Worte, die sich oft zwischen den Tracks von HipHop-Alben finden. Oliver Lautny untersucht “Flow” als ein rhythmisches Phänomen zwischen Worten, Reimen und Musik. Dietmar Elflein untersucht fünf HipHop-Beats auf die Beziehungen zwischen Beat, Sound und Stimme. Das Buch versammelt dabei sowohl musikwissenschaftliche wie auch allgemein kulturwissenschaftliche und soziologische Ansätze, ist nicht als Einführung ins Thema gedacht, bietet stattdessen jede Menge interessanter Einblicke in ein Forschungsgebiet, das dem Jazz gar nicht ganz so entfernt ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.
Schon lange ist HipHop kein Jugendphänomen allein mehr, schon lange spielt er nicht mehr nur in der Subkultur Afro-Amerikas ab. HipHop ist ein weltweites genreübergreifendes Phänomen geworden, das insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Kreativität in musikalische Äuzßerungen umzusetzen. Die Beiträge des vorliegenden Bandes untersuchen, welche Rolle dabei die Stimme spielt, und was Stimme über die Worte hinaus, die mit ihr gesungen und gerapt werden, an Informationen gibt. Murray Forman untersucht dabei, wie vokale Intonation im Rap mit der Konstruktuon symbolischer Werte und sozialer Bedeutungen korreliert. Christian Bielefeldt geht auf die konkreten Inhalte ein, die sich klischeehaft in vielen Rap-Lyrics finden und stellt die beiden Narrative von Black Dandy und Bad Nigga gegenüber. Johannes Ismaiel-Wendt und Susanne Stemmler befassen sich mit der Musik des kanadisch-somalischen MCs K’Naan, dessen Lieder den Hörer im Ineinandergreifen von Stimme, Text, Musik und biographischer Information mit einer Vorstellung von Afrika verbinden, die dem Sänger vorschwebt. Fernand Hörner analysiert den Videoclip “Authentik” der französischen HipHop-Band Suprême NTM. Stefan Neumann schaut auf die HipHop-Skits, die gesprochenen Worte, die sich oft zwischen den Tracks von HipHop-Alben finden. Oliver Lautny untersucht “Flow” als ein rhythmisches Phänomen zwischen Worten, Reimen und Musik. Dietmar Elflein untersucht fünf HipHop-Beats auf die Beziehungen zwischen Beat, Sound und Stimme. Das Buch versammelt dabei sowohl musikwissenschaftliche wie auch allgemein kulturwissenschaftliche und soziologische Ansätze, ist nicht als Einführung ins Thema gedacht, bietet stattdessen jede Menge interessanter Einblicke in ein Forschungsgebiet, das dem Jazz gar nicht ganz so entfernt ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.
(Wolfram Knauer)
Jazz behind the dikes. Vijfenachtig jaar schrijven over jazz in Nederland
von Walter van de Leur
Amsterdam 2009
Vossiuspers UvA / Amsterdam University Press
28 Seiten, 8,50 Euro
ISBN: 978-9-056-29555-4
 Das kleine Büchlein der Amsterdam University Press enthält die Antrittsvorlesung Walter van de Leurs als Professor für Jazz und Improvisationsmusik an der Universität Amsterdam im Juni 2008. In ihr beleuchtet er 85 Jahre Schreiben über Jazz in den Niederlanden. Es begann alles Mitte der 1920er Jahre, als erst James Meyer, später die Original Ramblers in Holland zu Popularität gelangten und der Jazz mehr und mehr zu einem berichtenswerten Thema wurde. 1931 rief der Altsaxophonist Ben Bakema die Zeitschrift “De Jazzwereld” ins Leben, die bis 1940 erschien und sich selbst als holländischer “Melody Maker” verstand. 1949 erschien Hans de Vaals Buch “Jazz, van Oerwoudrhythme tot Hollywoodsymphonie”, das doch eine recht eingeschränkte Vorstellung von dem widerspiegelt, was Jazz ausmacht und insbesondere den Bebop als definitive Degeneration der ursprünglichen Jazzmusik verteufelte. Solche Sichtweisen, meint Van de Leur, sagen dabei ja durchaus etwas über Rezeptionshaltungen und ästhetische Diskussionen der Zeit aus. Zwei jüngere Studien zum Jazz in den Niederlanden von Kees Wouters und Henk Kleinhout untersuchen die Früh- und Nachkriegsgeschichte des Jazz in den Niederlanden; eine Studie zur Jazzkritik in den Niederlande allerdings, die dem entsprechen könnte, was John Gennari in seinem Buch “Blowing Hot and Cool. Jazz and its Critics” für die USA vorgelegt hat, fehle bislang noch. Die letzten vierzig Jahre des niederländischen Jazzlebens seien aber überhaupt kaum wissenschaftlich (oder mit der notwendigen kritischen Distanz) bearbeitet worden, auch Kevin Whitehead’s “New Dutch Swing” enthalte nicht viel mehr als ein atmosphärisches Bild der Amsterdamer Szene. Jazzjournalistik sei in den Niederlanden wie anderswo auch ein oft von Laien und Liebhabern beackertes Feld; Journalisten, die mit tatsächlichem journalistischem Ethos an ihre Arbeit gehen, von der Sache etwas verstehen und zugleich die notwendige kritische Distanz besitzen, seien eher selten. Aber wie solle das auch anders sein, wo doch selbst die Musiker des Jazz anfangs höchstens in anderen Bands, Workshops etc. Unterricht erhalten haben, ihren eigenen Weg aber selbst suchen mussten. Auch auf der Hochschule lerne man höchstens das Handwerk, den eigenen Weg müsse man auch hier selber finden. Nicht anders, scheint sein Fazit, sei es wohl, wenn man über Jazz schreiben wolle. Der Lehrstuhl jedenfalls, den Van de Leur an der Universität von Amsterdam angetreten hat, soll auch dabei helfen, das Denken, Forschen und Schreiben über Jazz und improvisierte Musik in den Niederlanden zu verbessern.
Das kleine Büchlein der Amsterdam University Press enthält die Antrittsvorlesung Walter van de Leurs als Professor für Jazz und Improvisationsmusik an der Universität Amsterdam im Juni 2008. In ihr beleuchtet er 85 Jahre Schreiben über Jazz in den Niederlanden. Es begann alles Mitte der 1920er Jahre, als erst James Meyer, später die Original Ramblers in Holland zu Popularität gelangten und der Jazz mehr und mehr zu einem berichtenswerten Thema wurde. 1931 rief der Altsaxophonist Ben Bakema die Zeitschrift “De Jazzwereld” ins Leben, die bis 1940 erschien und sich selbst als holländischer “Melody Maker” verstand. 1949 erschien Hans de Vaals Buch “Jazz, van Oerwoudrhythme tot Hollywoodsymphonie”, das doch eine recht eingeschränkte Vorstellung von dem widerspiegelt, was Jazz ausmacht und insbesondere den Bebop als definitive Degeneration der ursprünglichen Jazzmusik verteufelte. Solche Sichtweisen, meint Van de Leur, sagen dabei ja durchaus etwas über Rezeptionshaltungen und ästhetische Diskussionen der Zeit aus. Zwei jüngere Studien zum Jazz in den Niederlanden von Kees Wouters und Henk Kleinhout untersuchen die Früh- und Nachkriegsgeschichte des Jazz in den Niederlanden; eine Studie zur Jazzkritik in den Niederlande allerdings, die dem entsprechen könnte, was John Gennari in seinem Buch “Blowing Hot and Cool. Jazz and its Critics” für die USA vorgelegt hat, fehle bislang noch. Die letzten vierzig Jahre des niederländischen Jazzlebens seien aber überhaupt kaum wissenschaftlich (oder mit der notwendigen kritischen Distanz) bearbeitet worden, auch Kevin Whitehead’s “New Dutch Swing” enthalte nicht viel mehr als ein atmosphärisches Bild der Amsterdamer Szene. Jazzjournalistik sei in den Niederlanden wie anderswo auch ein oft von Laien und Liebhabern beackertes Feld; Journalisten, die mit tatsächlichem journalistischem Ethos an ihre Arbeit gehen, von der Sache etwas verstehen und zugleich die notwendige kritische Distanz besitzen, seien eher selten. Aber wie solle das auch anders sein, wo doch selbst die Musiker des Jazz anfangs höchstens in anderen Bands, Workshops etc. Unterricht erhalten haben, ihren eigenen Weg aber selbst suchen mussten. Auch auf der Hochschule lerne man höchstens das Handwerk, den eigenen Weg müsse man auch hier selber finden. Nicht anders, scheint sein Fazit, sei es wohl, wenn man über Jazz schreiben wolle. Der Lehrstuhl jedenfalls, den Van de Leur an der Universität von Amsterdam angetreten hat, soll auch dabei helfen, das Denken, Forschen und Schreiben über Jazz und improvisierte Musik in den Niederlanden zu verbessern.
(Wolfram Knauer)
Blue Note Photography: Francis Wolff / Jimmy Katz
herausgegeben von Rainer Placke & Ingo Wulff
Bad Oeynhausen 2009
jazzprezzo
204 Seiten, 2 CDs, 70 Euro
ISBN: 978-3-9810250-8-8
 Vor 70 Jahren erschien die erste Platte des Labels Blue Note, gegründet von den beiden in Deutschland geborenen Exilanten Alfred Lion und Francis Wolff. In diesem Jahr häufen sich also die Jubelfeierlichkeiten, und es ist irgendwie vielleicht ganz passend, dass das Hauptwerk hierzu aus einem deutschen Verlag stammt, herausgegeben von zwei ästhetischen Überzeugungstätern, die darin den gründern von Blue Note ganz ähnlich sind, die auch nur aufnahmen, was ihnen gefiel. Francis Wolff war nicht nur Eigner des Labels, sondern zugleich Fotograf, und seine sicht der Musiker bestimmt bis zum heutigen Tag die visuelle Vorstellung jener legendären Aufnahmen insbesondere aus den 1950er und 1960er Jahren. Placke und Wulff sichteten hunderte von Kontaktbögen und wählten Fotos aus, in denen sich entweder die Atmosphäre der Aufnahmesitzungen besonders gut mitteilt oder aber in denen Francis Wolff Musiker inner- oder außerhalb des Studios in ungewöhnlichen Settings zeigte. Es sind Fotos, die Jazzgeschichte schrieben, Fotos, die aussehen wie solche, die Jazzgeschichte schrieben (weil sie von derselben Fotosession stammen) und Fotos, die man noch nie gesehen hat, die aber gerade in der Bündelung dieses Buchs die Menschen dahinter, die Musiker, ihre Kunst und künstlerische Verletzlichkeit näherbringen. Eine Aufnahmesitzung von 1946, bei der sich Sidney Bechet und Albert Nicholas gegenüberstehen, aufmerksam, konzentriert, aber offensichtlich noch nicht bei der Aufnahme. Miles Davis mit übereinandergeschlagenen Beinen und leicht zur Seite gelegtem Kopf. Davis, der J.J. Johnson eine Stelle auf dem Klavier vorspielt. Clifford Brown, konzentriert in die Trompete blasend, Bud Powell, aufmerksam zuhörend. Jimmy Smith, rauchend und lachend (einem Playback zuhörend?). Thad Jones in die Ferne blickend zwischen parkenden Autos oder, in einem anderen Bild, an ein Straßenschild lehnend. Paul Chambers mit Bass vor dem Alvin Hotel. Max Roach, konzentriert Stöcke balancierend hinter seinem Schlagzeugset. Sonny Rollins, ein wenig ermüdet im Rudy van Gelder Studio. Mittagsause auf dem Hof des Studios mit Clifford Jordan, Lee Moran und anderen. Donald Byrd, der einem kleinen Kind seine Trompete zeigt. John Coltrane, konzentriert zuhörend. Bud Powell im Auto, Noten studierend, mit seinem Sohn. Lou Donaldson im Park, Jackie McLean mit einem Kapuzineräffchen oder an einer Pariser Metrostation, Dexter Gordon in der Kutsche. Der blutjunge Tony Williams hinterm Schlagzeug, Wayne Shorter, nachdenklich auf seinem Instrumentenkoffer sitzend, Dexter Gordon mit einer Zeitungsverkäuferin flirtend. Elvin Jones mit nacktem Oberkörper und sichtichem Spaß an der Musik, Herbie Hancock auf dem Boden liegend, rauchend, entspannend. Cecil Taylor, Ornette Coleman, Don Cherry, Pharoah Sanders. Namen, Gesichter, Instrumente, Sounds. Es ist erstaunlich von welcher bildlichen Qualität diese Fotos zeugen, die die Musiker als Menschen zeigen, kritisch, meditativ, reflexiv, in einem kreativen Prozess, der dauernde Aufmerksamkeit erfordert. Jimmy Katz hat seit den frühen 1990er Jahren Fotos für das wiederbelebte Blue-Note-Label gemacht. Und auch wenn er nicht vom Fotografen Francis Wolff beeinflusst ist, so stammen seine Bilder doch aus einem ähnlichen Geiste: Auch er versucht die Persönlichkeit einzufangen, die Magie der Musik, wie sie sich in der Haltung und den Gesichtern der Musiker widerspiegelt. Einige Musiker begegnen uns in seinen Bildern wieder, etwa Elvin Jones, Andrew Hill oder Max Roach. Andere lassen uns vergegenwärtigen, dass diese lange Tradition noch immer lebt: dass der Jazz fortbestehen wird, solange es kreative Musiker gibt. Das Buch wird angerundet durch Artikel von Michael Cuscuna, Ashley Kahn, Bruce Lundvall, Rudy Van Gelder und Jimmy Katz. Zwei CDs geben einen Querschnitt durch die Blue-Note-Plattengeschichte von Albert Ammons und Meade Lux Lewis über Sidney Bechet, Thelonious Monk, Bud Powell, Art Blakey, John Coltrane, Herbie Hancock bis zur jungen Blue-Note-Generation, Cassandra Wilson, Jacky Terrasson, Joe Lovano, Greg Osby oder Dianne Reeves. Ein mächtiges Buch, ein schweres Buch, und irgendwie schon jetzt ein Buch des Jahres. Mit Liebe zusammengestellt; von Ingo Wulff verlässlich hervorragend gestaltet, auf schwerem Papier gedruckt. Weihnachtsgeschenk? Weihnachtsgeschenk!
Vor 70 Jahren erschien die erste Platte des Labels Blue Note, gegründet von den beiden in Deutschland geborenen Exilanten Alfred Lion und Francis Wolff. In diesem Jahr häufen sich also die Jubelfeierlichkeiten, und es ist irgendwie vielleicht ganz passend, dass das Hauptwerk hierzu aus einem deutschen Verlag stammt, herausgegeben von zwei ästhetischen Überzeugungstätern, die darin den gründern von Blue Note ganz ähnlich sind, die auch nur aufnahmen, was ihnen gefiel. Francis Wolff war nicht nur Eigner des Labels, sondern zugleich Fotograf, und seine sicht der Musiker bestimmt bis zum heutigen Tag die visuelle Vorstellung jener legendären Aufnahmen insbesondere aus den 1950er und 1960er Jahren. Placke und Wulff sichteten hunderte von Kontaktbögen und wählten Fotos aus, in denen sich entweder die Atmosphäre der Aufnahmesitzungen besonders gut mitteilt oder aber in denen Francis Wolff Musiker inner- oder außerhalb des Studios in ungewöhnlichen Settings zeigte. Es sind Fotos, die Jazzgeschichte schrieben, Fotos, die aussehen wie solche, die Jazzgeschichte schrieben (weil sie von derselben Fotosession stammen) und Fotos, die man noch nie gesehen hat, die aber gerade in der Bündelung dieses Buchs die Menschen dahinter, die Musiker, ihre Kunst und künstlerische Verletzlichkeit näherbringen. Eine Aufnahmesitzung von 1946, bei der sich Sidney Bechet und Albert Nicholas gegenüberstehen, aufmerksam, konzentriert, aber offensichtlich noch nicht bei der Aufnahme. Miles Davis mit übereinandergeschlagenen Beinen und leicht zur Seite gelegtem Kopf. Davis, der J.J. Johnson eine Stelle auf dem Klavier vorspielt. Clifford Brown, konzentriert in die Trompete blasend, Bud Powell, aufmerksam zuhörend. Jimmy Smith, rauchend und lachend (einem Playback zuhörend?). Thad Jones in die Ferne blickend zwischen parkenden Autos oder, in einem anderen Bild, an ein Straßenschild lehnend. Paul Chambers mit Bass vor dem Alvin Hotel. Max Roach, konzentriert Stöcke balancierend hinter seinem Schlagzeugset. Sonny Rollins, ein wenig ermüdet im Rudy van Gelder Studio. Mittagsause auf dem Hof des Studios mit Clifford Jordan, Lee Moran und anderen. Donald Byrd, der einem kleinen Kind seine Trompete zeigt. John Coltrane, konzentriert zuhörend. Bud Powell im Auto, Noten studierend, mit seinem Sohn. Lou Donaldson im Park, Jackie McLean mit einem Kapuzineräffchen oder an einer Pariser Metrostation, Dexter Gordon in der Kutsche. Der blutjunge Tony Williams hinterm Schlagzeug, Wayne Shorter, nachdenklich auf seinem Instrumentenkoffer sitzend, Dexter Gordon mit einer Zeitungsverkäuferin flirtend. Elvin Jones mit nacktem Oberkörper und sichtichem Spaß an der Musik, Herbie Hancock auf dem Boden liegend, rauchend, entspannend. Cecil Taylor, Ornette Coleman, Don Cherry, Pharoah Sanders. Namen, Gesichter, Instrumente, Sounds. Es ist erstaunlich von welcher bildlichen Qualität diese Fotos zeugen, die die Musiker als Menschen zeigen, kritisch, meditativ, reflexiv, in einem kreativen Prozess, der dauernde Aufmerksamkeit erfordert. Jimmy Katz hat seit den frühen 1990er Jahren Fotos für das wiederbelebte Blue-Note-Label gemacht. Und auch wenn er nicht vom Fotografen Francis Wolff beeinflusst ist, so stammen seine Bilder doch aus einem ähnlichen Geiste: Auch er versucht die Persönlichkeit einzufangen, die Magie der Musik, wie sie sich in der Haltung und den Gesichtern der Musiker widerspiegelt. Einige Musiker begegnen uns in seinen Bildern wieder, etwa Elvin Jones, Andrew Hill oder Max Roach. Andere lassen uns vergegenwärtigen, dass diese lange Tradition noch immer lebt: dass der Jazz fortbestehen wird, solange es kreative Musiker gibt. Das Buch wird angerundet durch Artikel von Michael Cuscuna, Ashley Kahn, Bruce Lundvall, Rudy Van Gelder und Jimmy Katz. Zwei CDs geben einen Querschnitt durch die Blue-Note-Plattengeschichte von Albert Ammons und Meade Lux Lewis über Sidney Bechet, Thelonious Monk, Bud Powell, Art Blakey, John Coltrane, Herbie Hancock bis zur jungen Blue-Note-Generation, Cassandra Wilson, Jacky Terrasson, Joe Lovano, Greg Osby oder Dianne Reeves. Ein mächtiges Buch, ein schweres Buch, und irgendwie schon jetzt ein Buch des Jahres. Mit Liebe zusammengestellt; von Ingo Wulff verlässlich hervorragend gestaltet, auf schwerem Papier gedruckt. Weihnachtsgeschenk? Weihnachtsgeschenk!
(Wolfram Knauer)
Heiko Ueberschaer (Herausgeber)
The German Real Book Vol. I
Schiffdorf Wehdel 2009
Nil Edition
keine Seitenzählung, 39,90 Euro
keine ISBN-Nummer
 Das Real Book ist seit Jahrzehnten unverzichtbares Hilfsmittel für Jazzmusiker, wenn sie erfolgreich Gigs oder Jam Sessions bestreiten wollen. Ursprünglich war es eine klug zusammengestellte Sammlung der wichtigsten Standards; bald aber gab es spezielle Real Books, die insbesondere versuchten neben den althergebrachten Musical-Kompositionen auch Kompositionen aktueller Musiker zu präsentieren und so vielleicht auch das allgemein verwendete Repertoire des Jazz ein weing zu aktualisieren und erneuern. Es gab spezielle Real Books, die sich besonderen Stilen zuwandten (Latin Real Book) und solche, die Kompositionen von regionalen Musikern vorstellten. Einige Beispiele für nationale Real Books existieren auch bereits, so etwa ein Swiss Real Book und selbst ein Hamburg Real Book. Nun hat der Nil Verlag mit dem German Real Book nachgezogen. Wo man im originalen Real Book jeden der Titel kennt, weil er sich über Generationen ins Repertoire gebrannt hat, da gehen solche Spezial Real Books den genau umgekehrten Weg: Die in ihnen enthaltenen Kompositionen sind wahrscheinlich den wenigsten bekannt, sollen ja erst durch die Sammlung die Hoffnung darauf, dass das Repertoire bei Sessions oft gespielt wird und sich dadurch Lieblingstitel herausmendeln zu zumindest nationalen Standards werden. Die Komponisten des German Real Books stammen zumeist aus der jüngeren Generation; die Heroen des deutschen Jazz der 1950er, 1960er oder 1970er Jahre also sucht man vergebens. Clemens Orth Jan Klare, Jörg Widmoser, Marco Piludu, Achim Kück, Peter Autschbach, Martin LeJeune, Massoud Goudemann, Dirik Schilgen, Ralph Abelein, Christian Ammann, Andreas Hertel, Michael breotenbach und etliche andere sind mit bis zu drei Titeln vertreten; insbesamt umfast das Buch immerhin 125 Kompositionen deutscher Komponisten und Komponistinnen. Nur elf davon übrigens haben einen deutlich als deutsch erkennbaren Titel; der rest meist englische Überschriften. Es gibt, wie nicht anders zu erwarten, Lead Sheets mit Harmoniesymbolen und einige kleine Arrangements, einfachere Themen, die den üblichen Formschemata gehorchen (Blues, 32-Takte etc.), aber auch komplexere, mehrteilige Stücke, die allerdings eher den kleineren Teil des Buchs ausmachen. Wie gesagt: Was davon wirklich zu deutschen Standards werden kann bleibt abzuwarten und wird sich aus der Akzeptanz bei den Jazz Sessions in den Clubs ergeben. Eine gelungene Edition ist das Buch allemal und es bleibt zu hoffen, dass verschiedene Clubs vielleicht ab und an German Real Book Jam Sessions einführen, bei denen dieses Buch als Vorlage für den Abend dient und die Musiker sich der Musik ihrer Kollegen annehmen.
Das Real Book ist seit Jahrzehnten unverzichtbares Hilfsmittel für Jazzmusiker, wenn sie erfolgreich Gigs oder Jam Sessions bestreiten wollen. Ursprünglich war es eine klug zusammengestellte Sammlung der wichtigsten Standards; bald aber gab es spezielle Real Books, die insbesondere versuchten neben den althergebrachten Musical-Kompositionen auch Kompositionen aktueller Musiker zu präsentieren und so vielleicht auch das allgemein verwendete Repertoire des Jazz ein weing zu aktualisieren und erneuern. Es gab spezielle Real Books, die sich besonderen Stilen zuwandten (Latin Real Book) und solche, die Kompositionen von regionalen Musikern vorstellten. Einige Beispiele für nationale Real Books existieren auch bereits, so etwa ein Swiss Real Book und selbst ein Hamburg Real Book. Nun hat der Nil Verlag mit dem German Real Book nachgezogen. Wo man im originalen Real Book jeden der Titel kennt, weil er sich über Generationen ins Repertoire gebrannt hat, da gehen solche Spezial Real Books den genau umgekehrten Weg: Die in ihnen enthaltenen Kompositionen sind wahrscheinlich den wenigsten bekannt, sollen ja erst durch die Sammlung die Hoffnung darauf, dass das Repertoire bei Sessions oft gespielt wird und sich dadurch Lieblingstitel herausmendeln zu zumindest nationalen Standards werden. Die Komponisten des German Real Books stammen zumeist aus der jüngeren Generation; die Heroen des deutschen Jazz der 1950er, 1960er oder 1970er Jahre also sucht man vergebens. Clemens Orth Jan Klare, Jörg Widmoser, Marco Piludu, Achim Kück, Peter Autschbach, Martin LeJeune, Massoud Goudemann, Dirik Schilgen, Ralph Abelein, Christian Ammann, Andreas Hertel, Michael breotenbach und etliche andere sind mit bis zu drei Titeln vertreten; insbesamt umfast das Buch immerhin 125 Kompositionen deutscher Komponisten und Komponistinnen. Nur elf davon übrigens haben einen deutlich als deutsch erkennbaren Titel; der rest meist englische Überschriften. Es gibt, wie nicht anders zu erwarten, Lead Sheets mit Harmoniesymbolen und einige kleine Arrangements, einfachere Themen, die den üblichen Formschemata gehorchen (Blues, 32-Takte etc.), aber auch komplexere, mehrteilige Stücke, die allerdings eher den kleineren Teil des Buchs ausmachen. Wie gesagt: Was davon wirklich zu deutschen Standards werden kann bleibt abzuwarten und wird sich aus der Akzeptanz bei den Jazz Sessions in den Clubs ergeben. Eine gelungene Edition ist das Buch allemal und es bleibt zu hoffen, dass verschiedene Clubs vielleicht ab und an German Real Book Jam Sessions einführen, bei denen dieses Buch als Vorlage für den Abend dient und die Musiker sich der Musik ihrer Kollegen annehmen.
(Wolfram Knauer)
Heinz Protzer
Attila Zoller. Sein Leben – Seine Zeit – Seine Musik. Mit einer Diskographie von Dr. Michael Frohne
Erftstadt 2009
Selbstverlag des Autors
334 Seiten, 22,50 Euro
ISBN: 978-3-00-026568-6
zu beziehen über den Buchhandel oder direkt beim Autor: zollerbuch@prohei.de.
 Attila Zoller gehört zu wichtigsten europäischen Gitarristen der 1950er und 1960er Jahre und hat auch nach seinem Umzug in die USA konsequent eine ästhetisch suchende Haltung verfolgt, die das Risiko und das Suchen nach neuen Wegen der Sicherheit und den ausgetretenen Pfaden vorzog. Heinz Protzer würdigt Leben und Musik dieses ungaro-austro-deutsch-amerikanischen Musikers in einem umfangreichen Buch, in dem auch Kollegen und Zeitzeugen ausführlich zu Wort kommen. Bis 1948 lebte der 1927 geborene Attila Zoller in Ungarn, wo er traditionelle Musik spielte, aber etwa um 1946/47 auch zum ersten Mal Jazz hörte. 1948 ging er nach Wien, wo er endgültig zum Jazz konvertierte. Er spielte mit Joe Zawinul, Hans Koller und vor allem mit der Vibraphonistin Vera Auer, in deren Quartett er einige Jahre lang mitwirkte. 1954 zog es ihn nach Deutschland, wo es vor allem in den US-Army-Clubs viel Arbeit gab. Zoller wurde in die Frankfurter Jazzszene aufgebommen, mit deren Musikern er auch ästhetisch einiges gemeinsam hatte: das Interesse an musikalischen Experimenten à la Lennie Tristano beispielsweise. Bald spielte er mit Jutta Hipp, dann mit dem New Jazz Ensemble Hans Kollers, lebte ein Nomadenleben im Untergrund der Jazzszene. 1958 gründete er ein Quartett zusammen mit dem damals in Baden-Baden lebenden Bassisten und Cellisten Oscar Pettiford, dem außerdem Koller und der Schlagzeuger Jimmy Pratt angehörten. 1959 erhielt Zoller durch Fürsprache seines Kollegen Jim Hall ein Stipendium für die School of Jazz in Lenox, eine Art Jazz-Sommerakademie und erreichte das Ursprungsland des Jazz im Spätsommer 1959. Dort war er auch seiner Verlobten Jutta Hipp wieder nahe — die Beziehung ging allerdings bald darauf in die Brüche und er spielte sogar mit dem Gedanken, nach Deutschland zurückzukehren. Allerdings lernte er bald darauf eine andere Frau kennen, die er im Februar 1960 heiratete. Er spielte in den New Yorker Clubs, arbeitete als Vertreter für die Gitarrenbaufirma Framus, wirkte in den Bands von Herbie Mann und Dave Pike mit. Zwischendurch reiste er immer wieder mal nach Europa, erhielt 1965 einen Preis für seine Musik zum Film “Das Brot der frühen Jahre” nach Heinrich Böll und spielte die vielgerühmte Platte “Heinrich Heine – Lyrik und Jazz” ein. Ende der 1960er Jahre nahm er ein vielbeachtetes Album mit Albert Mangelsdorff und Martial Solal auf und baute in den 1970er Jahren in Vermont, wo er sich niedergelassen hatte, eine Art Jazzschule auf. In den 1970er bis 1990er Jahren arbeitete er mit vielen unterschiedlichen Musikern, litt aber nach 1994 stark unter einer Krebserkrankung, an der er am 25. Januar 1998 verstarb. Protzer hat die Lebensgeschichte des Gitarristen sorgfältig recherchiert und reichert sie um Interviewausschnitte sowohl mit Zoller als auch ihm verbundenen Musikern an. Ein als “Chronik” überschriebener Teil des Buch stellt die Biographie in Beziehung zu allgemein- und musikgeschichtlichen Ereignissen und Entwicklungen der Zeit. Im Kapitel über seine Musik zitiert er vor allem Kritiken und andere Literaturl, die Zollers musikalische Leistungen würdigt, beschreibt aber nicht wirklich die musikalischen Besonderheiten in seinem Spiel. Es gibt ein Kapitel zur Filmmusik — neben dem “Brot der frühen Tage” schrieb Zoller etwa auch die Musik zu “Katz und Maus” nach Günter Grass –, ein Kapitel über Zoller, den Innovator, und eines über den Pädagogen und Gründer des Vermont Jazz Center. Außerdem finden sich Originalbeiträge von Zeitzeugen und Musikern, Würdigungen von Alexander Schmitz, Gudrun Endress, Jimmy Raney, Sandor Szabo, Klaus Doldinger, Lajos Dudas, Willi Geipel, Helmut Nieberle, Fritz Pauer, Aladar Pege, Werner Wunderlich, Matthias Winckelmann und Ingeborg Drews. Am Ende des Buchs steht eine von Michael Frohne zusammengestellte umfassende Zoller-Diskographie, die Aufnahmen von 1950 bis 1998 verzeichnet. Ein Personenindex und etliche zum Teil seltene und bislang unveröffentlichte Fotos runden das Buch ab, das nicht nur eine große Verbeugung vor Attila Zoller, dem innovativen Gitarristen darstellt, sondern auch ein Beitrag zur europäischen Jazzgeschichte und zur (noch ungeschriebenen) Geschichte europäischer Expatriates in den USA ist.
Attila Zoller gehört zu wichtigsten europäischen Gitarristen der 1950er und 1960er Jahre und hat auch nach seinem Umzug in die USA konsequent eine ästhetisch suchende Haltung verfolgt, die das Risiko und das Suchen nach neuen Wegen der Sicherheit und den ausgetretenen Pfaden vorzog. Heinz Protzer würdigt Leben und Musik dieses ungaro-austro-deutsch-amerikanischen Musikers in einem umfangreichen Buch, in dem auch Kollegen und Zeitzeugen ausführlich zu Wort kommen. Bis 1948 lebte der 1927 geborene Attila Zoller in Ungarn, wo er traditionelle Musik spielte, aber etwa um 1946/47 auch zum ersten Mal Jazz hörte. 1948 ging er nach Wien, wo er endgültig zum Jazz konvertierte. Er spielte mit Joe Zawinul, Hans Koller und vor allem mit der Vibraphonistin Vera Auer, in deren Quartett er einige Jahre lang mitwirkte. 1954 zog es ihn nach Deutschland, wo es vor allem in den US-Army-Clubs viel Arbeit gab. Zoller wurde in die Frankfurter Jazzszene aufgebommen, mit deren Musikern er auch ästhetisch einiges gemeinsam hatte: das Interesse an musikalischen Experimenten à la Lennie Tristano beispielsweise. Bald spielte er mit Jutta Hipp, dann mit dem New Jazz Ensemble Hans Kollers, lebte ein Nomadenleben im Untergrund der Jazzszene. 1958 gründete er ein Quartett zusammen mit dem damals in Baden-Baden lebenden Bassisten und Cellisten Oscar Pettiford, dem außerdem Koller und der Schlagzeuger Jimmy Pratt angehörten. 1959 erhielt Zoller durch Fürsprache seines Kollegen Jim Hall ein Stipendium für die School of Jazz in Lenox, eine Art Jazz-Sommerakademie und erreichte das Ursprungsland des Jazz im Spätsommer 1959. Dort war er auch seiner Verlobten Jutta Hipp wieder nahe — die Beziehung ging allerdings bald darauf in die Brüche und er spielte sogar mit dem Gedanken, nach Deutschland zurückzukehren. Allerdings lernte er bald darauf eine andere Frau kennen, die er im Februar 1960 heiratete. Er spielte in den New Yorker Clubs, arbeitete als Vertreter für die Gitarrenbaufirma Framus, wirkte in den Bands von Herbie Mann und Dave Pike mit. Zwischendurch reiste er immer wieder mal nach Europa, erhielt 1965 einen Preis für seine Musik zum Film “Das Brot der frühen Jahre” nach Heinrich Böll und spielte die vielgerühmte Platte “Heinrich Heine – Lyrik und Jazz” ein. Ende der 1960er Jahre nahm er ein vielbeachtetes Album mit Albert Mangelsdorff und Martial Solal auf und baute in den 1970er Jahren in Vermont, wo er sich niedergelassen hatte, eine Art Jazzschule auf. In den 1970er bis 1990er Jahren arbeitete er mit vielen unterschiedlichen Musikern, litt aber nach 1994 stark unter einer Krebserkrankung, an der er am 25. Januar 1998 verstarb. Protzer hat die Lebensgeschichte des Gitarristen sorgfältig recherchiert und reichert sie um Interviewausschnitte sowohl mit Zoller als auch ihm verbundenen Musikern an. Ein als “Chronik” überschriebener Teil des Buch stellt die Biographie in Beziehung zu allgemein- und musikgeschichtlichen Ereignissen und Entwicklungen der Zeit. Im Kapitel über seine Musik zitiert er vor allem Kritiken und andere Literaturl, die Zollers musikalische Leistungen würdigt, beschreibt aber nicht wirklich die musikalischen Besonderheiten in seinem Spiel. Es gibt ein Kapitel zur Filmmusik — neben dem “Brot der frühen Tage” schrieb Zoller etwa auch die Musik zu “Katz und Maus” nach Günter Grass –, ein Kapitel über Zoller, den Innovator, und eines über den Pädagogen und Gründer des Vermont Jazz Center. Außerdem finden sich Originalbeiträge von Zeitzeugen und Musikern, Würdigungen von Alexander Schmitz, Gudrun Endress, Jimmy Raney, Sandor Szabo, Klaus Doldinger, Lajos Dudas, Willi Geipel, Helmut Nieberle, Fritz Pauer, Aladar Pege, Werner Wunderlich, Matthias Winckelmann und Ingeborg Drews. Am Ende des Buchs steht eine von Michael Frohne zusammengestellte umfassende Zoller-Diskographie, die Aufnahmen von 1950 bis 1998 verzeichnet. Ein Personenindex und etliche zum Teil seltene und bislang unveröffentlichte Fotos runden das Buch ab, das nicht nur eine große Verbeugung vor Attila Zoller, dem innovativen Gitarristen darstellt, sondern auch ein Beitrag zur europäischen Jazzgeschichte und zur (noch ungeschriebenen) Geschichte europäischer Expatriates in den USA ist.
(Wolfram Knauer)
Andrew Wright Hurley
The Return of Jazz. Joachim-Ernst Berendt and West German cultural change
New York 2009
Berghahn Books
296 Seiten, 58 US-Dollar
ISBN: 978-1-84545-566-8
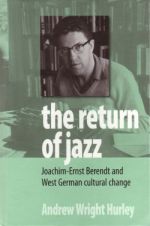 Joachim Ernst Berendt wurde oft als der “Jazzpapst” beschrieben, und tatsächlich war sein Einfluss so allumfassend, dass über all die Jahre keine Veröffentlichung aus Deutschland sich kritisch würdigend mit seiner Rolle in der deutschen Nachkriegs-Jazzgeschichte befasst hat. Vielleicht bedurfte es des Blicks von außen, und vielleicht ist es symptomatisch, dass das erste Buch, die erste Studie über Berendt den Kritiker, Produzenten, Macher und Philosophen von einem Forscher stammt, dessen Arbeitsmittelpunkt so weit von Deutschland entfernt liegt wie nur irgend möglich: vom Australier Andrew Hurley. Hurley hat das Jazzinstitut Darmstadt für das vorliegende Buch öfters und ausgiebig besucht, in Berendts Papieren und Korrespondenz gewühlt und mit vielen Musikern und Kollegen des Jazzpapstes gesprochen. Ihm ist dabei eine Studie gelungen, die sich mit fast allen Aspekten des Berendtschen Schaffens auseinandersetzt: mit Religion, Politik, Rassismus, Antifaschismus, Weltoffenheit, mit musikalischer Neugier, Machtbewusstsein und einem durchaus manchmal übersteigerten Selbstbewusstsein, mit seiner Selbsteinschätzung als Neuerer und Ermöglicher, als Verteidiger einer neuen Kunst gegen den Zopf der alten Meinungen Europas. Hurley beschäftigt sich dabei mit Berendt genauso wie mit seinen Kritikern, klopft die Argumente auf beiden Seiten auf die tatsächlichen Entwicklungen und ihre Folgen ab und zeichnet dabei das Bild eines kreativen Musikimpresarios, dessen Entwicklung folgerichtig von seinen Jugenderfahrungen im kirchlichen Elternhaus und mit den Folgen des Nazi-Reichs über die Entdeckung einer Individualismus predigenden Musik hin zu weltmusikalischer Neugier und schließlich zu einer körper-klang-orientierten Suche nach dem Sinn von Leben und Sein führt, alle Etappen tief in musikalischen Erfahrungen getränkt, aus denen er seine eigenen Erklärungsversuche abzuleiten verstand. Das Buch ist eine historische Dissertation und dennoch spannend zu lesen, vielleicht gerade wegen des Blicks von außen, der manchmal mehr Klarheit erlaubt als es vielleicht uns möglich ist, deren aller erstes Jazzbuch das Berendtsche war. Das Jazzinstitut wird des öfteren erwähnt, weil es Berendt verbunden bleibt und hier der Berendtsche Nachlass seinen Platz fand. Das Vorwort stammt von Dan Morgenstern, dem Direktor des Institute of Jazz Studies, der zugleich Berendts Jazzbuch ins Englische übersetzte. Das Nachwort stammt von Wolfram Knauer, der einen Blick auf die Bedeutung Berendts für den deutschen Jazz bis heute wirft.
Joachim Ernst Berendt wurde oft als der “Jazzpapst” beschrieben, und tatsächlich war sein Einfluss so allumfassend, dass über all die Jahre keine Veröffentlichung aus Deutschland sich kritisch würdigend mit seiner Rolle in der deutschen Nachkriegs-Jazzgeschichte befasst hat. Vielleicht bedurfte es des Blicks von außen, und vielleicht ist es symptomatisch, dass das erste Buch, die erste Studie über Berendt den Kritiker, Produzenten, Macher und Philosophen von einem Forscher stammt, dessen Arbeitsmittelpunkt so weit von Deutschland entfernt liegt wie nur irgend möglich: vom Australier Andrew Hurley. Hurley hat das Jazzinstitut Darmstadt für das vorliegende Buch öfters und ausgiebig besucht, in Berendts Papieren und Korrespondenz gewühlt und mit vielen Musikern und Kollegen des Jazzpapstes gesprochen. Ihm ist dabei eine Studie gelungen, die sich mit fast allen Aspekten des Berendtschen Schaffens auseinandersetzt: mit Religion, Politik, Rassismus, Antifaschismus, Weltoffenheit, mit musikalischer Neugier, Machtbewusstsein und einem durchaus manchmal übersteigerten Selbstbewusstsein, mit seiner Selbsteinschätzung als Neuerer und Ermöglicher, als Verteidiger einer neuen Kunst gegen den Zopf der alten Meinungen Europas. Hurley beschäftigt sich dabei mit Berendt genauso wie mit seinen Kritikern, klopft die Argumente auf beiden Seiten auf die tatsächlichen Entwicklungen und ihre Folgen ab und zeichnet dabei das Bild eines kreativen Musikimpresarios, dessen Entwicklung folgerichtig von seinen Jugenderfahrungen im kirchlichen Elternhaus und mit den Folgen des Nazi-Reichs über die Entdeckung einer Individualismus predigenden Musik hin zu weltmusikalischer Neugier und schließlich zu einer körper-klang-orientierten Suche nach dem Sinn von Leben und Sein führt, alle Etappen tief in musikalischen Erfahrungen getränkt, aus denen er seine eigenen Erklärungsversuche abzuleiten verstand. Das Buch ist eine historische Dissertation und dennoch spannend zu lesen, vielleicht gerade wegen des Blicks von außen, der manchmal mehr Klarheit erlaubt als es vielleicht uns möglich ist, deren aller erstes Jazzbuch das Berendtsche war. Das Jazzinstitut wird des öfteren erwähnt, weil es Berendt verbunden bleibt und hier der Berendtsche Nachlass seinen Platz fand. Das Vorwort stammt von Dan Morgenstern, dem Direktor des Institute of Jazz Studies, der zugleich Berendts Jazzbuch ins Englische übersetzte. Das Nachwort stammt von Wolfram Knauer, der einen Blick auf die Bedeutung Berendts für den deutschen Jazz bis heute wirft.
(Wolfram Knauer)
Roy Nathanson
subway moon
Köln 2009
buddy’s knife jazzedition
135 Seiten, 16,00 Euro
ISBN: 978-3-00-025376-8
 Der kleine Kölner Verlag buddy’s knife hat sich darauf spezialisiert, poetische Texte insbesondere amerikanischer Musiker herauszubringen, die eine andere Seite ihrer Kreativität zeigen. Nach Bänden mit Gedichten von Henry Grimes sowie Gedichten und Texten von William Parker ist jetzt ein Band erschienen, in dem der Saxophonist Roy Nathanson zu Worte kommt. Seine Musik, schreibt Jeff Friedman im Vorwort, sei ohne seine Lyrik nicht vorstellbar und seine Lyrik lebe von den Rhythmen seiner Musik. Man denkt ein wenig an Lester Youngs Diktum, er kenne alle Texte zu den Songs, die er interpretiere und könne sich gar nicht vorstellen, wie man ohne die Kenntnis der Texte kongeniale Geschichten darüber improvisieren könne. Wenn Musik nun das Leben widerspiegelt, dann sind die Texte der Improvisationen Nathansons vielleicht die Worte, die er hier anordnet, um sie lyrisch seine eigene Befindlichkeit beschreiben zu lassen. Nathanson, der aus der Knitting-Factory-Szene New Yorks stammt und mit den Jazz Passengers, mit Projekten mit Anthony Coleman und eigenen Bands arbeitete, schreibt Gedichte über sein Instrument, darüber, wie er Drittklässler unterrichtet oder über die Soundanlagen in Clubs. Er fragt in einem seiner Gedichte, ob es wohl eine Formel gibt, wie man eine Geschichte entwickeln kann, wenn sie sich bereits in voller Geschwindigkeit befindet. Oder er fragt sich, auf welche Tonhöhe wohl die U-Bahn gestimmt sein möge. Andere Gedichte spiegeln sein privates Leben wider oder die politischen Entwicklungen in Nah und Fern. Der Tod seines Bruders, die Bombadierung des Libanons, Freundschaft, geliebte Städte, Menschen, Kollegen. Ein Gedicht ist der Zirkularatmung gewidmet, und am Schluss steht ein längerer Text über seinen Vater, wenige Wochen nach dessen Tod geschrieben. Der war an Alzheimer erkrankt, und Nathanson beschreibt, wie er ihm, der früher selbst als Musiker gearbeitet hatte, bei einem Besuch ein Saxophon mitgebracht habe. Er habe geswingt und die Melodie auf eine Art und Weise gespielt, wie Nathanson es selten gehört habe. Diese Konzentration auf die Melodie, die Reduktion aufs Lyrische, das Zusammenspiel zwischen Lyrik, Rhythmik und Melodie — all das spürt man auch in diesem Buch, das überaus persönlich ist und dabei in jeder Zeile auch der Musik verbunden bleibt.
Der kleine Kölner Verlag buddy’s knife hat sich darauf spezialisiert, poetische Texte insbesondere amerikanischer Musiker herauszubringen, die eine andere Seite ihrer Kreativität zeigen. Nach Bänden mit Gedichten von Henry Grimes sowie Gedichten und Texten von William Parker ist jetzt ein Band erschienen, in dem der Saxophonist Roy Nathanson zu Worte kommt. Seine Musik, schreibt Jeff Friedman im Vorwort, sei ohne seine Lyrik nicht vorstellbar und seine Lyrik lebe von den Rhythmen seiner Musik. Man denkt ein wenig an Lester Youngs Diktum, er kenne alle Texte zu den Songs, die er interpretiere und könne sich gar nicht vorstellen, wie man ohne die Kenntnis der Texte kongeniale Geschichten darüber improvisieren könne. Wenn Musik nun das Leben widerspiegelt, dann sind die Texte der Improvisationen Nathansons vielleicht die Worte, die er hier anordnet, um sie lyrisch seine eigene Befindlichkeit beschreiben zu lassen. Nathanson, der aus der Knitting-Factory-Szene New Yorks stammt und mit den Jazz Passengers, mit Projekten mit Anthony Coleman und eigenen Bands arbeitete, schreibt Gedichte über sein Instrument, darüber, wie er Drittklässler unterrichtet oder über die Soundanlagen in Clubs. Er fragt in einem seiner Gedichte, ob es wohl eine Formel gibt, wie man eine Geschichte entwickeln kann, wenn sie sich bereits in voller Geschwindigkeit befindet. Oder er fragt sich, auf welche Tonhöhe wohl die U-Bahn gestimmt sein möge. Andere Gedichte spiegeln sein privates Leben wider oder die politischen Entwicklungen in Nah und Fern. Der Tod seines Bruders, die Bombadierung des Libanons, Freundschaft, geliebte Städte, Menschen, Kollegen. Ein Gedicht ist der Zirkularatmung gewidmet, und am Schluss steht ein längerer Text über seinen Vater, wenige Wochen nach dessen Tod geschrieben. Der war an Alzheimer erkrankt, und Nathanson beschreibt, wie er ihm, der früher selbst als Musiker gearbeitet hatte, bei einem Besuch ein Saxophon mitgebracht habe. Er habe geswingt und die Melodie auf eine Art und Weise gespielt, wie Nathanson es selten gehört habe. Diese Konzentration auf die Melodie, die Reduktion aufs Lyrische, das Zusammenspiel zwischen Lyrik, Rhythmik und Melodie — all das spürt man auch in diesem Buch, das überaus persönlich ist und dabei in jeder Zeile auch der Musik verbunden bleibt.
(Wolfram Knauer)
Kai Lothwesen
Klang, Struktur, Konzept. Die Bedeutung der Neuen Musuik für Free Jazz und Improvisationsmusik
Bielefeld 2009
transcript Verlag (Studien zur Popularmusik)
261 Seiten, 27,80 Euro
ISBN: 978389942-930-5
 Kai Lothwesens musikwissenschaftliche Dissertation befasst sich mit den Einflüssen der europäischen Kunstmusik auf den Free Jazz und die improvisierte Musik. Er untersucht damit eine musikalische Ausprägung, die immer ein wenig in ihrem Bezug auf die afro-amerikanische Tradition und die europäische zeitgenössische Musik schwankte und schon in ihrer Benennung (Free Jazz, improvisierte Musik) leichte identitätsprobleme andeutete. Er beschreibt die Merkmale der europäischen Improvisationsmusik, untersucht das Verhältnis von Komposition und Improvisation, analysiert die Traditionen der Neuen Musik und des Jazz und wagt eine Positionsbestimmung des Free Jazz und der Improvisierten Musik. Einem theoretisch analysierenden Kapitel folgen dann konkrete praktische Fallbeispiele, namentlich die Pianisten Georg Graewe und Alexander von Schlippenbach sowie der Bassist Barry Guy. Zum Schluss vergleicht er die Parameter “Klang”, “Struktur” und “Konzept” auf Parallelen zwischen Neuer Musik und Free Jazz / Improvisierter Musik. Das Buch bietet eine theoretische Grundlage zur weiteren Auseinandersetzung mit den gegenseitigen Einflüssen zwischen Jazz und Neuer Musik.
Kai Lothwesens musikwissenschaftliche Dissertation befasst sich mit den Einflüssen der europäischen Kunstmusik auf den Free Jazz und die improvisierte Musik. Er untersucht damit eine musikalische Ausprägung, die immer ein wenig in ihrem Bezug auf die afro-amerikanische Tradition und die europäische zeitgenössische Musik schwankte und schon in ihrer Benennung (Free Jazz, improvisierte Musik) leichte identitätsprobleme andeutete. Er beschreibt die Merkmale der europäischen Improvisationsmusik, untersucht das Verhältnis von Komposition und Improvisation, analysiert die Traditionen der Neuen Musik und des Jazz und wagt eine Positionsbestimmung des Free Jazz und der Improvisierten Musik. Einem theoretisch analysierenden Kapitel folgen dann konkrete praktische Fallbeispiele, namentlich die Pianisten Georg Graewe und Alexander von Schlippenbach sowie der Bassist Barry Guy. Zum Schluss vergleicht er die Parameter “Klang”, “Struktur” und “Konzept” auf Parallelen zwischen Neuer Musik und Free Jazz / Improvisierter Musik. Das Buch bietet eine theoretische Grundlage zur weiteren Auseinandersetzung mit den gegenseitigen Einflüssen zwischen Jazz und Neuer Musik.
(Wolfram Knauer)
Erik Kjellberg
Jan Johansson – tiden och musiken
Hedemora – Möklinta/Sweden 2009
Gidlunds förlag
442 pages, accompanying CD
ISBN: 978-91-7844-753-4
 Jan Johansson gehört zu den einflussreichsten schwedischen Musikern des modernen Jazz. In Kopenhagen begleitete er Ende der 1950er Jahre Stan Getz und andere amerikanische Musiker, beschäftigte sich daneben aber auch damit, einen schwedischen Klang in seiner Musik zu verfolgen. Sein Album “Jazz på Svenska” nutzte alte schwedische Volksweisen für die Arrangements und Improvisationen, die in der Stimmung und Klangästhetik bereits viel von dem vorwegnahmen, was später Musiker wie Esbjörn Svensson als neuen schwedischen Sound populär machen sollten. Erik Kjellbergs Biographie verfolgt Johanssons Leben von seinen Anfängen bis zu seinem frühen Tod durch einen Autounfall. Er beschreibt die musikalische Emanzipation und Selbstbewusstwerdung des schwedischen Musikers, aber auch seine Ausflüge in die Filmmusik (etwa als Komponist von Astrid-Lindgren-Verfilmungen), seine Arbeit fürs schwedische Radio und seine Kompositionen für Besetzungen zwischen Trio, Combo und Sinfonieorchester. Der Fließtext, der das Leben des Pianisten und Komponisten chronologisch und die Musik nach Gattungen getrennt beleuchtet verbindet biographische Forschung, Interviews mit Zeitgenossen und Musikerkollegen sowie musikalische Analysen ausgewählter Stücke, die mit leräuternden Notenbeispielen verbunden sind. Bislang unveröffentlichte Fotos, eine ausführliche Diskographie sowie ein Namens- und Titelindex und schließlich eine CD mit Aufnahmen zwischen 1963 und 1968 runden das Buch ab, für das der Leser des Schwedischen schon einigermaßen mächtig sein sollte. Eine eindrucksvolle und beispielhafte Monographie eines bis heute nachwirkenden Musikers.
Jan Johansson gehört zu den einflussreichsten schwedischen Musikern des modernen Jazz. In Kopenhagen begleitete er Ende der 1950er Jahre Stan Getz und andere amerikanische Musiker, beschäftigte sich daneben aber auch damit, einen schwedischen Klang in seiner Musik zu verfolgen. Sein Album “Jazz på Svenska” nutzte alte schwedische Volksweisen für die Arrangements und Improvisationen, die in der Stimmung und Klangästhetik bereits viel von dem vorwegnahmen, was später Musiker wie Esbjörn Svensson als neuen schwedischen Sound populär machen sollten. Erik Kjellbergs Biographie verfolgt Johanssons Leben von seinen Anfängen bis zu seinem frühen Tod durch einen Autounfall. Er beschreibt die musikalische Emanzipation und Selbstbewusstwerdung des schwedischen Musikers, aber auch seine Ausflüge in die Filmmusik (etwa als Komponist von Astrid-Lindgren-Verfilmungen), seine Arbeit fürs schwedische Radio und seine Kompositionen für Besetzungen zwischen Trio, Combo und Sinfonieorchester. Der Fließtext, der das Leben des Pianisten und Komponisten chronologisch und die Musik nach Gattungen getrennt beleuchtet verbindet biographische Forschung, Interviews mit Zeitgenossen und Musikerkollegen sowie musikalische Analysen ausgewählter Stücke, die mit leräuternden Notenbeispielen verbunden sind. Bislang unveröffentlichte Fotos, eine ausführliche Diskographie sowie ein Namens- und Titelindex und schließlich eine CD mit Aufnahmen zwischen 1963 und 1968 runden das Buch ab, für das der Leser des Schwedischen schon einigermaßen mächtig sein sollte. Eine eindrucksvolle und beispielhafte Monographie eines bis heute nachwirkenden Musikers.
(Wolfram Knauer)Swing from a Small Island. The Story of Leslie Thompson
von Leslie Thompson & Jeffrey Green
London 2009 (Northway)
203 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-0-9557888-2-6
 Leslie Thompson gehört zu den bedeutendsten britischen Jazzmusikern der 1930er Jahre. 1985 setzte er sich mit dem Musikhistoriker Jeffrey Green zusammen, um seine Lebensgeschichte aufzuzeichnen, die Green später redigierte und in lesbare Form brachte. Die erste Ausgabe der Autobiographie erschien 1985; die Wiederveröffentlichung ist ein willkommenes Dokument zur europäischen Jazzgeschichte.
Leslie Thompson gehört zu den bedeutendsten britischen Jazzmusikern der 1930er Jahre. 1985 setzte er sich mit dem Musikhistoriker Jeffrey Green zusammen, um seine Lebensgeschichte aufzuzeichnen, die Green später redigierte und in lesbare Form brachte. Die erste Ausgabe der Autobiographie erschien 1985; die Wiederveröffentlichung ist ein willkommenes Dokument zur europäischen Jazzgeschichte.
Thompson kam 1901 in Jamaika zur Welt. Er erzählt über das Leben auf der Insel und seinen Wunsch Musiker zu werden. 1919 schiffte er sich mit einigen Mitmusikern nach England ein, wo er bald darauf Musik studierte. Zurück in Jamaika spielte er Trompete in Tanzkapellen und wurde Leiter einer Kapelle, die Stummfilme im Kino begleitete. Als der Tonfilm aufkam, sah er seine Arbeitsmöglichkeiten schwinden, kaufte eine Schiffspassage und setzte sich 1929 endgültig nach England ab.
Anfangs ohne Arbeit, traf Thompson nach einer Weile auf Will Garland, einen amerikanischen Konzertveranstalter, der verschiedene afro-amerikanische oder auch afrikanische Show-Acts managte und ihn engagierte. Thompson berichtet vom Alltag eines Unterhaltungsmusikers im London der frühen 1930er Jahre, von rassistischen Vorbehalten und von Überlebensstrategien. Er beschreibt einige der Acts, die er begleitete, aber auch die Szene der Theaterorchester, in der er bald einen Platz einnahm, so etwa in Noel Cowards Show “Words and Music” von 1932.
Im selben Jahr hörte er Louis Armstrong während dessen Londoner Konzerten, und als Armstrong im nächsten Jahr allein zu einem längeren Europaaufenthalt zurückkam, wurde Thompson Teil seiner europäischen Begleitband. Später spielte der Trompeter mit Ken Johnsons Jamaican Emperors of Jazz und andere schwarzen britischen Bands. 1942 wurde Thompson eingezogen, schnell aber zur Leitung einer Armeekappelle abgestellt. Nach dem Krieg schrieb er sich in der Guildham School of Music ein, entschied sich dann 1954, das Musikgeschäft ganz zu verlassen. In einer weiteren Karriere arbeitete er bis 1971 als Bewährungshelfer und danach noch fünf Jahre als Gefängniswärter.
Thompsons Autobiographie ist jazzhistorische Zeitgeschichte, ein wichtiges und wenig dokumentiertes Kapitel des europäischen Jazz, im Stil sehr persönlich gehalten und von Jeffrey Green in einen flüssig zu lesenden Text redigiert. Ein Anmerkungsapparat erklärt historische Sachverhalte; ein weiterer Anhang Aussagen von Zeitgenossen über Thompson. Ein Namensindex schließt das Buch ab, in dem außerdem etliche seltene Fotos abgedruckt sind.
Wolfram Knauer (Dezember 2013)
When Swing Was the Thing. Personality Profiles of the Big Band Era
von John R. Tumpak
Milwaukee 2009 (Marquette University Press)
264 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-0-87462-024-5
 Als in Kalifornien ansässiger Jazzjournalist beschäftigt sich John Tumpak sich seit langem mit der Bigband-Ära, den Jahren zwischen 1935 und 1946, als der Jazz die populäre Musik Amerikas war. Sein Buch “When Swing Was the Thing” enthält Profilen über und Interviews mit vierzehn Bandleadern, fünfzehn Sidemen, elf Vokalisten, fünf Arrangeuren und vier sonst mit dem Bandbusiness der Swingära befassten Personen. Tumpaks Auswahl umfasst bedeutende Stars wie Benny Goodman, Glenn Miller, Artie Shaw, Chick Webb, aber auch weniger nachhaltig wirkende Bands wie Horace Heidt, Alvino Rey, Orrin Tucker und andere.
Als in Kalifornien ansässiger Jazzjournalist beschäftigt sich John Tumpak sich seit langem mit der Bigband-Ära, den Jahren zwischen 1935 und 1946, als der Jazz die populäre Musik Amerikas war. Sein Buch “When Swing Was the Thing” enthält Profilen über und Interviews mit vierzehn Bandleadern, fünfzehn Sidemen, elf Vokalisten, fünf Arrangeuren und vier sonst mit dem Bandbusiness der Swingära befassten Personen. Tumpaks Auswahl umfasst bedeutende Stars wie Benny Goodman, Glenn Miller, Artie Shaw, Chick Webb, aber auch weniger nachhaltig wirkende Bands wie Horace Heidt, Alvino Rey, Orrin Tucker und andere.
Die Kapitel gehen knappe biographische Abrisse und widmen sich dann vor allem den Zwängen des Bandbusiness der 1930er und frühen 1940er Jahre. Nebenbei stellt Tumpak einige der wichtigen Spielstätten vor, bietet einen Einblick in die Agenturtätigkeit, die notwendig war, um solch große Orchester im ganzen Land zu buchen, benennt Rundfunk und Fernsehen als wichtige PR-Standbeine neben der Schallplatte. Von nachhaltiger Wirkung für den späteren Jazz sind unter den von ihm ausgewählten Bandleadern neben Goodman, Webb und Shaw vor allem John Kirby und Gerald Wilson.
Den für diesen Rezensenten spannendste Teil des Buchs bilden die Porträts ehemaliger Swingband-Sidemen, die in ihren Interviews mit Tumpak oft genug vom Alltag erzählen, aber auch von den Auswirkungen der stilistischen Umbrüche nach dem Bebop. Milt Bernhart, Buddy Childers, John LaPorta und Jake Hanna sind in diesem Teil die vielleicht bekanntesten Namen. Jack Costanzo mag man als Anfang der 1950er Jahre recht präsenten Bongospieler zumindest dem Sound nach kennen, der außerdem etlichen Hollywood-Stars das Bongospiel beibrachte. Rosalind Cron gehörte zu den International Sweethearts of Rhythm, mit denen sie 1945/46 auch durch die US-Armeebasen in Europa tourte. Den Gitarristen Roc Hillman, der mit den Dorsey Brothers spielte, oder den Trompeter Legh Knowles, der bei Glenn Miller seine Karriere begann und später ein erfolgreicher Weinbauer im Napa Valley wurde, wird selbst unter Jazzexperten kaum jemand kennen. Gleiches gilt für den Posaunisten Chico Sesma, der seit den frühen 1940er Jahren auf der Latin-Szene Süd-Kaliforniens aktiv ist, oder den Saxophonisten und Sänger Butch Stone, der in der Van Alexander Band als “der weiße Louos Jordan” bekannt wurde. Unter den von Tumpak vorgestellten Sidemen ist schließlich einer, der es in anderer Funktion zu weltweiter Bekanntheit brachte: Der Saxophonist Alan Greenspan gab seine vielversprechende Musikerlaufbahn auf, um sich der Ökonomie zu widmen und später von 1987 bis 2007 Chef der US-Notenbank zu werden.
Die Bigbandära war reich an Sängerinnen und Sängern, und Tumpak stellt auch diese vor. Bob Eberly wurde vor allem als Vokalist der Dorsey Brothers bekannt; Herb Jeffries sang sowohl mit Earl Hines als auch mit Duke Ellington. Jack Leonard erzählt über seine Zeit bei Tommy Dorsey, wo er durch keinen geringeren als Frank Sinatra ersetzt wurde. Jo Stafford und Kay Starr legten auch nach der Swingära anhaltende Karrieren hin; die Namen Dolores O’Neill oder Bea Wain dagegen muss der durchschnittliche Jazzfan wahrscheinlich eher googeln.
Frank Comstock berichtet über seine Arrangierarbeit für Les Brown, aber auch für die Zusammenarbeit mit Doris Day. Johnny Mandel erzählt, dass er in den 1940er Jahren zusammen mit Miles Davis und anderen in Gil Evans’ Apartment auf der 55sten Straße in Manhattan rumhing. Die drei Arrangeure Fletcher Henderson, Don Redman und Sy Oliver schließlich werden in einem Kapitel zusammengefasst, bevor der letzte Teil des Buchs die Radio-DJs Chuck Cecil und Henry Holloway, den Promoter Tom Sheils und den Kritiker George T. Simon vorstellt.
“When Swing Was the Thing” zeichnet sich dadurch aus, dass der Autor die bekannten Pfade der Swingära zwar nicht außer Acht lässt, seinen Fokus aber insbesondere auf weniger bekannte Persönlichkeiten legt, Musiker, deren Arbeit notwendig war, um die Swingindustrie am Leben zu halten. Tumpak kategorisiert nicht, und auch die Rollenverteilung schwarz-weiß, die politische oder wirtschaftliche Situation, in der sich die Musik in jenen Jahren abspielte, werden von ihm kaum kritisch hinterleuchtet. Man mag die Auswahl an Porträt-Subjekten hinterfragen, bei denen ein deutliches Schwergewicht auf weißen Bands und Musikern liegt; man mag sich wünschen, dass der Autor in seinen Gesprächen tiefer in Details über den musikalischen Alltag eingedrungen wäre. Das aber war nie seine Intention gewesen, wie Tumpak gleich in seinem Vorwort erklärt: Er wollte vor allem den persönlichen Hintergrund der von ihm porträtierten Musiker vorstellen, Charakterstudien erstellen. Das ist ihm auf jeden Fall gelungen, und weit über 100 seltene Fotos runden das Buch ab, das damit einen etwas anderen Einblick in die Swingära erlaubt.
Wolfram Knauer (November 2013)
New Orleans Trumpet in Chicago
von Christopher Hillman & Roy Middleton & Clive Wilson
Tavistock/England 2009 (Cygnet Productions)
100 Seiten, 12 Britische Pfund (inclusive Porto innerhalb Europas)
Bestellungen über gooferdust@hotmail.com
 Die Jazzforschung hat wissenschaftliche Studien immer genauso gebraucht wie Recherchen von musikalischen Laien, die dieser Musik aber mit Herzblut verbunden waren. Von Jazzfans in ihrer Freizeit erstellte Diskographien entsprechen dabei oft genug dem, was in der klassischen Musik als Werkverzeichnis bezeichnet wird und Musikforschern früher durchaus einen akademischen Grad einbringen konnte. Dies sei vorausgeschickt, denn die Würdigung der nicht-akademischen Beiträge zur Jazzforschung ist nicht zu unterschätzen.
Die Jazzforschung hat wissenschaftliche Studien immer genauso gebraucht wie Recherchen von musikalischen Laien, die dieser Musik aber mit Herzblut verbunden waren. Von Jazzfans in ihrer Freizeit erstellte Diskographien entsprechen dabei oft genug dem, was in der klassischen Musik als Werkverzeichnis bezeichnet wird und Musikforschern früher durchaus einen akademischen Grad einbringen konnte. Dies sei vorausgeschickt, denn die Würdigung der nicht-akademischen Beiträge zur Jazzforschung ist nicht zu unterschätzen.
Christopher Hillman ist einer der aktiven Forscher dieses Metiers. Ein Spezialist für frühen New-Orleans-Jazz hat er seit den frühen 1970er Jahren regelmäßig über die Heroen aus New Orleans publiziert, in Magazinen wie Storyville, dem Jazz Journal, Footnote und anderen Publikationen, die nicht so sehr journalistische Aspekte als vielmehr eine ernsthafte Recherche in den Vordergrund stellten.
Im vorliegenden Band finden sich Recherchen, die Hillman, Roy Middleton und Clive Wilson zu fünf Trompetern machten, die aus New Orleans stammte, die durch ihre Karriere aber bald nach Chicago verschlagen wurden. Jedes der Kapitel beginnt mit einer biographischen Würdigung und einem kurzen Abriss über die Tätigkeit des betreffenden Musikers im Chicago der 1930er (bis 1950er) Jahre. Die herausgestellten Künstler sind die Trompeter Lee Collins, Punch Miller, Herb Morand und Guy Kelly, die in der Chicagoer Jazzszene der 1930er Jahre besonders aktiv waren sowie der Schlagzeuger Snags Jones, der viel mit Punch Miller arbeitete, mit Lee Collins befreundet war und ein wenig im Schatten seines bekannteren Kollegen Baby Dodds stand.
Das Buch genauso wie andere Publikationen in dieser Reihe ist sicher vor allem für Sammler interessant. Die Verbindung der biographischen Darstellung und Diskographie ist allemal eine sinnvolle Kombination, die eine historische Einordnung der verzeichneten Aufnahmen erlaubt. Die Autoren runden das alles mit zum Teil seltenen Fotos der Bands sowie der Plattenlabels ab. Als Dreingabe gibt es eine CD mit seltenen Aufnahmen von Lee Collins aus den frühen 1950er Jahren sowie mit Punch Miller und Snags Jones aus dem Jahr 1941.
Wolfram Knauer (September 2013)
100+1 Saxen. De collectie van Leo van Oostrom
von Leo van Oostrom
Amsterdam 2009 (Edition Sax)
160 Seiten, 30 Euro
ISBN: 978-09-90-24403-7
 Leo van Oostrom ist als Saxophonist Mitglied des Metropole Orckestra, leitet außerdem das Dutch Saxophone Quartet und sammelt Instrumente. 101 Sammlerstücke aus seinem Fundus stellt er nun in einem exklusiven Fotoband vor.
Leo van Oostrom ist als Saxophonist Mitglied des Metropole Orckestra, leitet außerdem das Dutch Saxophone Quartet und sammelt Instrumente. 101 Sammlerstücke aus seinem Fundus stellt er nun in einem exklusiven Fotoband vor.
Nach einleitenden Kapiteln zu den verschiedenen Herstellern, Adolphe Sax selbst etwa, Adolphe Edouard Sax, Henri Selmer, oder Ferdinant August Buescher finden sich Instrumente aller Tonlagen und Größen, mit instrumentenspezifischen Angaben zum Baujahr, zur Größe, zum Tonumfang.
Am exotischsten sind die Abbildungen seltener Saxophonvarianten wie des Couenophons oder des Saxettes des Playasax oder des Mellosax, des Swanee-Sax, des Oktavins und einiger Nicht-Saxophon-Varianten, des Tarogato etwa, des JeTeL-Sax. Zu einigen dieser Sonderfabrikate erhält man nüchterne Informationen in Van Oostroms dreisprachigem Text (Niederländisch, Englisch, Französisch), zu vielen der Instrumente wünschte man sich darüber hinaus, sie einmal in Aktion zu hören.
Van Ostroms Buch ist sicher vor allem ein Geschenk für Saxophon-Narren; die exzellenten, gestochen scharfen Abbildungen haben darüber hinaus einen enormen ästhetischen Reiz.
Wolfram Knauer (April 2013)
Jazz Notes. Interviews across the Generations
von Sanford Josephson
Santa Barbara/CA 2009 (Praeger)
209 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-313-35700-8
 Sanford Josephson portraitiert in seinem Buch 22 Musiker, die er in biographischen Artikeln, oft mit Exzerpten selbst geführter Interviews vorstellt, um dann mit Kollegen zu sprechen, die mit diesen Musikern gespielt hatten oder stark von ihnen beeinflusst wurden. Sein Buch “Jazz Notes” ist damit eine atmosphärehaltige Lektüre, die einem die Künstler vor allem als hart arbeitende Menschen näher bringt, versucht, ihrer Musik ihren Charakter zuzugesellen. Das gelingt zumeist gut, zumal sämtliche Personen, die in Josephsons Buch eine Hauptrolle spielen, ein eigenes Buch verdienten – sofern es nicht schon geschrieben wurde.
Sanford Josephson portraitiert in seinem Buch 22 Musiker, die er in biographischen Artikeln, oft mit Exzerpten selbst geführter Interviews vorstellt, um dann mit Kollegen zu sprechen, die mit diesen Musikern gespielt hatten oder stark von ihnen beeinflusst wurden. Sein Buch “Jazz Notes” ist damit eine atmosphärehaltige Lektüre, die einem die Künstler vor allem als hart arbeitende Menschen näher bringt, versucht, ihrer Musik ihren Charakter zuzugesellen. Das gelingt zumeist gut, zumal sämtliche Personen, die in Josephsons Buch eine Hauptrolle spielen, ein eigenes Buch verdienten – sofern es nicht schon geschrieben wurde.
Die dramatis personae seiner “Jazz-Notizen” heißen: Hoagy Carmichael, Fats Waller, Joe Venuti, Count Basie, Jonah Jones, Art Tatum, Earle Warren, Howard McGhee, Milt Hinton, Helen Humes, Dizzy Gillespie, George Shearing, Dave Brubeck, Norris Turney, Jon Hendricks, Arvell Shaw, Gerry Mulligan, Dick Hyman, Maynard Ferguson, Stanley Cowell, David Sanborn und Billy Taylor. Josephsons Beobachtungen über ihre Persönlichkeit sind journalistisch und einfühlsam, seine Gespräche mit Zeitzeugen aufschlussreich, etwa, wenn Jeanie Bryson über ihren Vater Dizzy Gillespie berichtet, wenn Butch Miles über seine Zeit bei Basie erzählt, Barbara Carroll oder Marian McPartland über den Einfluss Art Tatums und so weiter und so fort.
Ab und zu kommen dabei über die bereits bekannten Eigenschaften der so Gefeierten auch eher wenig bekannte Geschichten zutage. Neu geschrieben werden muss die Jazzgeschichte deshalb sicher nicht, dafür geht Josephson denn auch nicht tief genug in seine Materie. Sein Buch bietet auf jeden Fall eine flotte und anekdotenreiche Lektüre, die man am besten bei swingender Musik genießt.
Wolfram Knauer (April 2013)
Jazz Diplomacy. Promoting America in the Cold War Era
von Lisa E. Davenport
Jackson/MS 2009 (University Press of Mississippi)
219 Seiten, 50,00 US-Dollar
ISBN: 978-1-60473-268-9
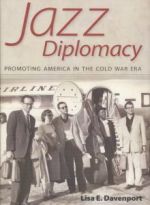 In den 1950er Jahren wurde der Jazz politisch. Nein, natürlich war Jazz bereits zuvor eine politische Musik, nicht nur in den Werken Duke Ellingtons, die sich schwarzer Musik- und Sozialgeschichte annahmen. Aber in den 1950er Jahren entdeckte die amerikanische Politik den Jazz als politisches Instrument im Rahmen des Kalten Kriegs. Musiker wie Louis Armstrong, Duke Ellington, Benny Goodman und Dizzy Gillespie sollten der Welt ein Amerika der Demokratie und Freiheit präsentieren, sollten für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft werben.
In den 1950er Jahren wurde der Jazz politisch. Nein, natürlich war Jazz bereits zuvor eine politische Musik, nicht nur in den Werken Duke Ellingtons, die sich schwarzer Musik- und Sozialgeschichte annahmen. Aber in den 1950er Jahren entdeckte die amerikanische Politik den Jazz als politisches Instrument im Rahmen des Kalten Kriegs. Musiker wie Louis Armstrong, Duke Ellington, Benny Goodman und Dizzy Gillespie sollten der Welt ein Amerika der Demokratie und Freiheit präsentieren, sollten für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft werben.
Lisa E. Davenport untersucht in ihrem aus ihrer Dissertation entstandenen Buch die Intentionen hinter der Entscheidung, Jazz als Instrument der amerikanischen Außenpolitik einzusetzen, aber auch die Probleme der Umsetzung. Zugleich fragt sie nach der Schere zwischen Außenwirkung und insbesondere dem immer noch währenden Rassismus in den Vereinigten Staaten. Davenport recherchierte für ihr Buch in Archiven, schaute sich Pläne, Protokolle, Regierungsentscheidungen in Bezug auf Jazzprojekte an, beleuchtet die Erfahrungen insbesondere schwarzer Musiker im Ausland und die tatsächliche Wahrnehmung ihrer Konzerte und Tourneen in Ländern hinter dem Eisernen Vorhang. Ihr Blick auf die ausländischen Aktivitäten richtet sich dabei aber auch immer wieder auch auf die Reaktionen im eigenen Land, auf politische, ideologische und gesellschaftliche Veränderungen, an denen die Außenwahrnehmung der USA durchaus beteiligt war.
Der Jazz wird von den USA immer noch als Mittel der Außenpolitik benutzt. Lisa Davenports Buch erklärt die Genese dieser politischen Qualität des Jazz und die alles andere als eindimensionalen Resultate dieser Jazz-Diplomatie.
Wolfram Knauer (November 2012)
“Ja, der Kurfürstendamm kann erzählen.” Unterhaltungsmusik in Berlin in Zeiten des Kalten Krieges
von Martin Lücke
Berlin 2009 (B&S Siebenhaar Verlag)
192 Seiten, 24,80 Euro
ISBN: 978-3-936962-46-8
 Berlin war eines der wichtigsten Zentren europäischer Unterhaltungskultur in den 1920er Jahren, wie man etwa aus Klaus Manns autobiographischem Roman “Der Wendepunkt” erfährt. Martin Lückes Sachbuch zitiert andere Quellen, um die Unterhaltungsmusik der Kaiserzeit, der Weimarer Republik und des Dritten Reichs zu beschreiben. Das alles ist allerdings nur die Vorgeschichte zu Lückes eigentlichem Thema, das dann tatsächlich mit der “Stunde Null” anfängt und fragt, wie sich im kriegszerstörten Berlin eine neue Musikszene aufbauen konnte, welche Rolle die Unterhaltungsmusik bei der Bewältigung von Krieg und Naziherrschaft spielte. Lücke schildert die ersten Konzerte im Nachkriegsberlin, schaut auf behördliche Regeln und die Arbeitssituation der Musiker. Er betrachtet die Geburt der GEMA und die Programmpolitik der öffentlichen Rundfunksender (RIAS, AFN). Das RBT-Orchester und der Schlagersänger Bully Buhlan erhalten ausführliche Würdigungen. Die wiederauflebende Kabarettszene um Günter Neumanns Insulaner erhält ein eigenes Kapitel, in dem auch Rex Stewarts Besuch beim Hot Club Berlin erwähnt wird. Einer der Hauptprotagonisten seines Buchs aber ist Hans Carste, der bereits in den 1930er Jahren erfolgreiche Filmmusiken geschrieben hatte und nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1948 wieder in Berlin von sich Reden machte. Carste dient Lücke als Musterbeispiel für eine Musik zwischen Schlager, Filmmusik und Bigbandjazz, dessen Erinnerungen und Dokumente die folgenden Seiten (und übrigens auch eine dem Buch beiheftenden CD) füllen. Carste wurde 1949 Abteilungsleiter Leichte Musik beim RIAS, der zwischen 1949 und 1961, als Berlin Zentrum des Kalten Kriegs war, zu einem der wichtigsten Propagandainstrumente in der Konkurrenz zwischen West und Ost wurde. Clubs wie die Badewanne und Hallen wie der Sportpalast erwähnt Lücke am Rande ebenfalls. Sein letztes Kapitel ist “Nach dem Mauerbau” überschrieben, befasst sich aber nur kurz mit den auseinander divergierenden Szenen. Lücke begleitet Hans Carste noch bis zu seinem Tod im Mai 1971, aber da ist der Berliner Kalte Krieg, von dem er erzählen will, bereits weitgehend vorbei.
Berlin war eines der wichtigsten Zentren europäischer Unterhaltungskultur in den 1920er Jahren, wie man etwa aus Klaus Manns autobiographischem Roman “Der Wendepunkt” erfährt. Martin Lückes Sachbuch zitiert andere Quellen, um die Unterhaltungsmusik der Kaiserzeit, der Weimarer Republik und des Dritten Reichs zu beschreiben. Das alles ist allerdings nur die Vorgeschichte zu Lückes eigentlichem Thema, das dann tatsächlich mit der “Stunde Null” anfängt und fragt, wie sich im kriegszerstörten Berlin eine neue Musikszene aufbauen konnte, welche Rolle die Unterhaltungsmusik bei der Bewältigung von Krieg und Naziherrschaft spielte. Lücke schildert die ersten Konzerte im Nachkriegsberlin, schaut auf behördliche Regeln und die Arbeitssituation der Musiker. Er betrachtet die Geburt der GEMA und die Programmpolitik der öffentlichen Rundfunksender (RIAS, AFN). Das RBT-Orchester und der Schlagersänger Bully Buhlan erhalten ausführliche Würdigungen. Die wiederauflebende Kabarettszene um Günter Neumanns Insulaner erhält ein eigenes Kapitel, in dem auch Rex Stewarts Besuch beim Hot Club Berlin erwähnt wird. Einer der Hauptprotagonisten seines Buchs aber ist Hans Carste, der bereits in den 1930er Jahren erfolgreiche Filmmusiken geschrieben hatte und nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1948 wieder in Berlin von sich Reden machte. Carste dient Lücke als Musterbeispiel für eine Musik zwischen Schlager, Filmmusik und Bigbandjazz, dessen Erinnerungen und Dokumente die folgenden Seiten (und übrigens auch eine dem Buch beiheftenden CD) füllen. Carste wurde 1949 Abteilungsleiter Leichte Musik beim RIAS, der zwischen 1949 und 1961, als Berlin Zentrum des Kalten Kriegs war, zu einem der wichtigsten Propagandainstrumente in der Konkurrenz zwischen West und Ost wurde. Clubs wie die Badewanne und Hallen wie der Sportpalast erwähnt Lücke am Rande ebenfalls. Sein letztes Kapitel ist “Nach dem Mauerbau” überschrieben, befasst sich aber nur kurz mit den auseinander divergierenden Szenen. Lücke begleitet Hans Carste noch bis zu seinem Tod im Mai 1971, aber da ist der Berliner Kalte Krieg, von dem er erzählen will, bereits weitgehend vorbei.
Kurz zusammengefasst erkennt man in Martin Lückes Buch also eigentlich zwei Themen. Das Anfangsthema ist tatsächlich das der Berliner Unterhaltungsmusikszene der Jahre 1945-1961. Daneben aber schiebt sich etwa ab der Hälfte des Textes das zweite Thema immer mehr in den Mittelpunkt des Buchs, nämlich Leben und Wirken Hans Carstes. Da verliert man dann als Leser schon mal den Roten Faden, weiß zwar, dass die Wahl Carstes durchaus ein geschickter Schachzug ist, um die historischen Fakten mit konkreten Inhalten zu füllen, vermisst aber gerade hier die allgemeinen Einordnungen, die Lücke in seinem ersten Teil so gut gelingen. Mit diesen Einschränkungen, die eher editorische sind – man hätte den Text auch im selben Buch deutlicher aufsplitten und den Leser damit eben nicht den roten Faden verlieren lassen können – bietet Lückes Buch eine hervorragende Dokumentation einer Szene, die eben nie “nur” eine Jazzszene war, sondern in Funktion und Selbstverständnis weit populärer angelegt als reine Jazzmusiker das hätten wahrhaben wollen.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
1959. the Year Everything Changed
von Fred Kaplan
Hoboken, New Jersey 2009 (John Wiley & Sons, Inc.)
322 Seiten, 27,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-470-38781-8
 Es ist gefährlich, zu viel Last auf einzelne Ereignisse zu legen, und nicht minder gefährlich scheint es, Schicksalsjahre auszurufen, auch wenn dies im Nachhinein geschieht. Gut, 1968 prägte tatsächlich nicht nur eine Generation, sondern steht, länderübergreifend für einen Wandel des sozialen und gesellschaftlichen Bewusstseins. Aber 1959? Fred Kaplan betrachtet in seinem Buch dieses Jahr als ein nicht minder schicksalsschweres Jahr. Er versammelt Fidel Castro, Malcolm X, Miles Davis, Ornette Coleman, Kalter Krieg, Independent Filme, Computer-Revolution, Mikrochips, Wettrennen im Weltall und vieles mehr in einem unterhaltsamen Buch, das einen tatsächlich in jenes Jahr verpflanzt und in der Vielseitigkeit der Darstellung durchaus Querverweise impliziert.
Es ist gefährlich, zu viel Last auf einzelne Ereignisse zu legen, und nicht minder gefährlich scheint es, Schicksalsjahre auszurufen, auch wenn dies im Nachhinein geschieht. Gut, 1968 prägte tatsächlich nicht nur eine Generation, sondern steht, länderübergreifend für einen Wandel des sozialen und gesellschaftlichen Bewusstseins. Aber 1959? Fred Kaplan betrachtet in seinem Buch dieses Jahr als ein nicht minder schicksalsschweres Jahr. Er versammelt Fidel Castro, Malcolm X, Miles Davis, Ornette Coleman, Kalter Krieg, Independent Filme, Computer-Revolution, Mikrochips, Wettrennen im Weltall und vieles mehr in einem unterhaltsamen Buch, das einen tatsächlich in jenes Jahr verpflanzt und in der Vielseitigkeit der Darstellung durchaus Querverweise impliziert.
Aus der Jazzseite sind etwa die Kapitel über Norman Mailer, Allan Ginsberg und Lenny Bruce interessant, vor allem aber die Kapitel “The Assault on the Chord”, das sich mit den harmonischen Experimenten George Russells und ihrer Umsetzung etwa durch Miles Davis befasst; “The Shape of Jazz to Come”, das Ornette Colemans neue Ästhetik beleuchtet; sowie “The New Language of Diplomacy”, das die Tourneen amerikanischer Jazzmusiker im Dienste des State Department beleuchtet.
Das alles ist kurzweilig dargestellt und unterhaltsam zu lesen. In der Nebeneinanderstellung ganz disparater Ereignisse öffnen sich durchaus interessante Querverbindungen, doch auch nach der Lektüre kommt 1959 weder an 1968 noch an andere Welt-Schicksalsjahre (1918, 1945, 1989) heran.
Lesenswert…
Wolfram Knauer (Mai 2012)
Roads of Jazz
Von Peter Bölke & Rolf Enoch
Hamburg 2009 (Edel Books)
156 Seiten, 6 CDs im Buchdeckel, 39,95 Euro
ISBN: 978-3940004-31-4
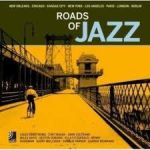 Das dicke Buch im Hardcovereinband und mit den vielen Fotos ist in Wahrheit – aber das merkt man erst, wenn man mitten drin ist im Schmökern – ein überdimensioniertes Begleitheft zu den sechs CDs, die in seinen Buchdeckeln heften. “Roads to Jazz” heißt es, und Autor Peter Bölke sowie Musikredakteur Rolf Enoch haben die Titel der CDs nach den wichtigsten Städten der Jazzgeschichte sortiert: New Orleans, Chicago, Kansas City, New York und Los Angeles. Die CDs wiederum sind chronologisch und stilistisch geordnet und heißen “Classic Jazz”, “New York Swing”, “New York Be-Bop”, “New York Modern Jazz”, “Cool & Westcoast Jazz” sowie “Jazz in Europe”. Alle Texte sind zweisprachig auf Deutsch und Englisch; im Anhang des Buchs befindet sich eine ausführliche Diskographie der Aufnahmen mit kompletten Besetzungsangaben und Daten.
Das dicke Buch im Hardcovereinband und mit den vielen Fotos ist in Wahrheit – aber das merkt man erst, wenn man mitten drin ist im Schmökern – ein überdimensioniertes Begleitheft zu den sechs CDs, die in seinen Buchdeckeln heften. “Roads to Jazz” heißt es, und Autor Peter Bölke sowie Musikredakteur Rolf Enoch haben die Titel der CDs nach den wichtigsten Städten der Jazzgeschichte sortiert: New Orleans, Chicago, Kansas City, New York und Los Angeles. Die CDs wiederum sind chronologisch und stilistisch geordnet und heißen “Classic Jazz”, “New York Swing”, “New York Be-Bop”, “New York Modern Jazz”, “Cool & Westcoast Jazz” sowie “Jazz in Europe”. Alle Texte sind zweisprachig auf Deutsch und Englisch; im Anhang des Buchs befindet sich eine ausführliche Diskographie der Aufnahmen mit kompletten Besetzungsangaben und Daten.
Über die Auswahl solcher Sampler kann man natürlich trefflich streiten – für Bölke und Enoch hört der amerikanische Jazz mit dem frühen Coltrane auf; die CD “Jazz in Europe” dagegen stellt gerade mal fünf Tracks von europäischen Musikern vor – alles andere sind Aufnahmen US-amerikanischer Jazzer, die in London, Paris oder Berlin eingespielt wurden.
Das Buch selbst besticht durch von Sven Grot wunderbar gestaltete Seiten mit knappen Texten zu den Musikern, die auf den CDs spielen und zu den Umständen, die sich mit der betreffenden historischen Situation verbindet. Allgemeinen Absätze zum Bebop oder zum Hardbop, zu V-Discs oder zu den Städten, in denen die Musik spielte und ausgesuchten Spielorten wie dem Cotton Club oder dem Birdland stehen kurze biographische Absätze gegenüber, in denen Bölke auf kürzestem Raum eine angemessene Würdigung der Künstler versucht. Das gelingt mal besser, lässt manchmal zu wünschen übrig, ist aber alles in allem eine kurzweilige Geschichte. Und als Text Book für Studenten ist dieses Buch eh nicht gedacht, sondern eher – siehe oben – als eine Art überdimensioniertes Begleitheft zu den CDs. Und da blättert man gern, zumal der Verlag wirklich schöne Fotos ausgewählt hat, Portraits der Musiker, aber auch Stadtlandschaften, Albumcovers, Plattenlabels etc.
Und natürlich ist das Buch wie alle Bücher in der Reihe “ear books” des Verlags Edel dazu gedacht, beim Hören der CDs durchblättert zu werden. Die kurzen Absätze hindern da nicht, sondern lassen im Gegenteil die wunderbare Musik auf den CDs im Mittelpunkt stehen.
“Roads of Jazz” ist ein ideales Geschenk selbst für Jazzfans, die schon einiges besitzen. Die werden die meisten der Titel zwar bereits in ihrer Sammlung haben und dennoch – gleich dem Rezensenten – neu hinhören, wenn die Mischung der Sampler-CDs und der Blick auf die Fotos die Neugier fokussiert.
Wolfram Knauer (Januar 2012)
The Ashgate Research Companion to Popular Musicology
herausgegeben von Derek B. Scott
Furnham, Surrey 2009 (Ashgate)
557 Seiten, 75 Britische Pfund
ISBN: 978-1-4094-2321-8
 Eine ernsthafte Jazzforschung gibt es bereits seit den 1950er Jahren; in den 1970er Jahren begann auch die Rock- und Popmusik Eingang in den musikwissenschaftlichen Kanon zu finden. Das alles aber war eine langsame Entwicklung, und auch heute beschäftigt sich der “gemeine” Musikologe eher noch Bach, Brahms oder Schönberg als mit Ellington, Zappa oder Madonna. Dennoch: Die Zeiten haben sich geändert, und auch wenn eine Theorie der populären Musikwissenschaft (wenn man den Buchtitel “popular musicology” so übersetzen will) bislang nicht gibt, so gibt es doch genügend Beispiele, welche wissenschaftliche Ansätze unterschiedliche Musikgenres gerecht zu werden vermögen. Wer vom Ashgate Research Companion ein Musterbuch für die Herangehensweise an populäre Musik erwartet, wird allerdings enttäuscht werden. Das Buch ist weit weniger generell als der Titel es erwarten lässt. Es enthält in erster Linie Case Studies, Aufsätze, die populäre Musik von unterschiedlichen Seiten angehen, so aber genauso in einer der Fachzeitschriften zur populären Musikforschung stehen könnten (etwa im Popular Music Research). Vor allem zwei Forschungsbereiche seien im Feld der populären Musikwissenschaft besonders virulent, erklärt der Herausgeber Derek B. Scott in seinem Vorwort: zum einen die Frage nach Identität, Ethnizität, Raum und Ort, zum anderen der Bereich Alben, Künstler, spezifische musikalische Genres. Als nächstes werde gern und oft nach Gender und Sexualität gefragt, aber auch nach Filmmusik, technologischen Entwicklungen, dem Thema Performance und dem Musikgeschäft. Schließlich gäbe es auch noch den Bereich der Popmusikpädagogik. Entsprechend gliedert Scott das Buch nach Überthemen: “Film, Video and Multimedia”, “Technology and Studio Production”, “Gender and Sexuality”, “Identity and Ethnicity”, “Performance and Gesture”, “Reception and Scenes” sowie “The Music Industry and Globalization”. Der Jazz spielt übrigens wahrscheinlich ganz zu Recht kaum eine Rolle in den Beiträgen des Buchs. Seine analytischen Modelle sind denn doch andere als die der Popmusik; seine Theorie wäre immer noch ein eigenes Buch wert. Was Scott dabei allerdings gelingt in diesem schwergewichtigen Opus, ist sehr unterschiedliche Approaches zu versammeln und so Studenten wie Forscher mit der Diversität nicht nur der populären Musik, sondern auch ihrer fachlichen Erforschung zu konfrontieren.
Eine ernsthafte Jazzforschung gibt es bereits seit den 1950er Jahren; in den 1970er Jahren begann auch die Rock- und Popmusik Eingang in den musikwissenschaftlichen Kanon zu finden. Das alles aber war eine langsame Entwicklung, und auch heute beschäftigt sich der “gemeine” Musikologe eher noch Bach, Brahms oder Schönberg als mit Ellington, Zappa oder Madonna. Dennoch: Die Zeiten haben sich geändert, und auch wenn eine Theorie der populären Musikwissenschaft (wenn man den Buchtitel “popular musicology” so übersetzen will) bislang nicht gibt, so gibt es doch genügend Beispiele, welche wissenschaftliche Ansätze unterschiedliche Musikgenres gerecht zu werden vermögen. Wer vom Ashgate Research Companion ein Musterbuch für die Herangehensweise an populäre Musik erwartet, wird allerdings enttäuscht werden. Das Buch ist weit weniger generell als der Titel es erwarten lässt. Es enthält in erster Linie Case Studies, Aufsätze, die populäre Musik von unterschiedlichen Seiten angehen, so aber genauso in einer der Fachzeitschriften zur populären Musikforschung stehen könnten (etwa im Popular Music Research). Vor allem zwei Forschungsbereiche seien im Feld der populären Musikwissenschaft besonders virulent, erklärt der Herausgeber Derek B. Scott in seinem Vorwort: zum einen die Frage nach Identität, Ethnizität, Raum und Ort, zum anderen der Bereich Alben, Künstler, spezifische musikalische Genres. Als nächstes werde gern und oft nach Gender und Sexualität gefragt, aber auch nach Filmmusik, technologischen Entwicklungen, dem Thema Performance und dem Musikgeschäft. Schließlich gäbe es auch noch den Bereich der Popmusikpädagogik. Entsprechend gliedert Scott das Buch nach Überthemen: “Film, Video and Multimedia”, “Technology and Studio Production”, “Gender and Sexuality”, “Identity and Ethnicity”, “Performance and Gesture”, “Reception and Scenes” sowie “The Music Industry and Globalization”. Der Jazz spielt übrigens wahrscheinlich ganz zu Recht kaum eine Rolle in den Beiträgen des Buchs. Seine analytischen Modelle sind denn doch andere als die der Popmusik; seine Theorie wäre immer noch ein eigenes Buch wert. Was Scott dabei allerdings gelingt in diesem schwergewichtigen Opus, ist sehr unterschiedliche Approaches zu versammeln und so Studenten wie Forscher mit der Diversität nicht nur der populären Musik, sondern auch ihrer fachlichen Erforschung zu konfrontieren.
Wolfram Knauer (Dezember 2011)
Jazzkritik in Österreich. Chronik / Dokumentationen / Stellungnahmen
von Wolfgang Lamprecht
Wien 2009 (Löcker)
253 Seiten, 22 Euro
ISBN: 978-3-85409-528-6
 Es gehört quasi zum guten Ton (den wir durchaus auch im Jazzinstitut pflegen), gleichzeitig die Qualität der aktuellen Entwicklungen im Jazz hoch zu loben und über den Zustand der Jazzkritik zu klagen. Sowohl in Fachzeitschriften wie in Tageszeitungen sei die Jazzkritik immer mehr zu “Fanprosa” verkommen, zitiert Wolfgang Lamprecht in seiner Studie Peter Niklas Wilson und zeichnet daraufhin in seinem Buch in einem überschaubaren geographischen Bereich, nämlich Österreich, die Entwicklung ebendieser Jazzkritik nach.
Es gehört quasi zum guten Ton (den wir durchaus auch im Jazzinstitut pflegen), gleichzeitig die Qualität der aktuellen Entwicklungen im Jazz hoch zu loben und über den Zustand der Jazzkritik zu klagen. Sowohl in Fachzeitschriften wie in Tageszeitungen sei die Jazzkritik immer mehr zu “Fanprosa” verkommen, zitiert Wolfgang Lamprecht in seiner Studie Peter Niklas Wilson und zeichnet daraufhin in seinem Buch in einem überschaubaren geographischen Bereich, nämlich Österreich, die Entwicklung ebendieser Jazzkritik nach.
Er beginnt mit der Frage danach, welche Beweggründe Kritiker eigentlich für ihren Beruf haben und welches Bewusstsein sie für ihr Publikum, also ihre Leser besitzen. Er benennt (und zwar tatsächlich mit Namen) die Verfilzung, die es auch im Jazzbereich zwischen Kritikern und Produzenten von Musik gibt, und gelangt dabei zu zehn Regeln, die einer jeden ernsthaften Jazzkritik zugrunde liegen sollten.
Im weit umfangreicheren historischen Teil des Buchs betrachtet Lamprecht dann, wie der Jazz seit der Zeit des Ragtime in der österreichischen Presse betrachtet, verstanden oder missverstanden wurde. Er unterhält sich ausführlich mit Günther Schifter, dem vor drei Jahren verstorbenen Schellacksammler und Zeitzeugen österreichischer Jazzgeschichte, sowie mit dem Musiker Ludwig Babinsky und belegt mit beiden Interviews eine seltsam unpolitische Haltung des Jazz vor dem Krieg. Dann geht er im Gallopp durch die Nachkriegszeit, beschreibt die Reibungen zwischen Traditionalisten, Modernisten und einer jungen Szene, die durchaus eine neue Art der künstlerischen Professionalität mit sich brachte. Ein schneller Überblick über die Entwicklung der Jazzkritik im 20sten Jahrhundert mündet in Fallbeispielen: Josephine Baker in den 1920er Jahren, die Verdammung des Jazz bereits Anfang der 30er, die Haltung des österreichischen Rundfunks zum Jazz in den 1930er Jahren. Lamprecht schaut dabei oft auf Vorurteile mehr als auf kritische Reflexionen in der Nachkriegszeit und macht es sich dabei doch etwas leicht: Über lange Strecken ließt sich sein Buch jetzt wie eine amüsante Sammlung von Stilblüten, über die man, aufgeklärter Bürger des 21sten Jahrhunderts, nur milde schmunzelnd den Kopf schütteln kann.
Man lernt über die Ursprünge des ersten österreichischen Jazzmagazines “Jazzlive”, weiß die Verdienste der jazzhistorischen Publikationen von Klaus Schulz gewürdigt und ist etwas abrupt im Jahr 2009, als das letzte voll und ganz dem Jazz gewidmete Magazin Jazzzeit als Folge der Wirtschaftskrise und zurückgehender Anzeigenkunden eingestellt werden musste.
Gerade zum Schluss scheint bei Lamprecht die Frustration durch, die sich bei ihm in seiner Betrachtung einer halt doch reichlich unprofessionellen Jazzpresselandschaft in Österreich offenbar einstellte. Dieser Frust macht Teile des Buchs durchaus zu einer amüsanten Lektüre, gerade dort, wo de Autor mit seiner eigenen Meinung nicht hinterm Berg hält. Er polemisiert gern und hat keine Probleme damit, inner-österreichische Streits zu benennen. Leider bleiben diese für den uneingeweihten Leser allerdings ein wenig undurchschaubar, auch deshalb, weil Lamprecht gern Position bezieht und damit keineswegs der objektive Beobachter ist, den man anhand des Titels und des großen Fußnotenapparats vielleicht erwartet.
Was am Ende fehlt ist ein Ausblick, sind die Lehren, die Lamprecht selbst gezogen hat aus dem sehr differenzierten Blick auf fast 100 Jahre Jazzkritik. Im Buchrückentext heißt es: “Die eigentliche Aufgabe von Kritik, eine nachvollziehbare Lesart des Hörens, eine Brücke zum Verständnis zu schaffen, ist damit nie wirklich erfüllt worden.” Die Definition allerdings, was Jazzkritik im 21sten Jahrhundert wirklich leisten kann, was sie leisten sollte, muss sich der Leser dann aber letztlich selber zurechtschneidern aus den vielfachen Anregungen, die Lamprecht gerade mit seinen Negativbeispielen zuhauf gibt.
Eine durchaus gemischt Lektüre also: Ungemein viel Anregendes, eine gehörige Prise Streitlust und doch am Ende ein wenig zu unstrukturiert. Aber vielleicht kann ein Buch über Jazzkritik nur genau das sein: eine Einladung zum Diskurs, nicht aber der Diskurs selbst.
Wolfram Knauer (August 2011)
Analyzing Jazz. A Schenkerian Approach
von Steve Larson
Harmonologia. Studies in Music Theory, No. 15
Hillsdale/NY 2009 (Pendragon Press)
204 Seiten, 99 US-Dollar
ISBN: 978-1-576471-86-9
 Das vorliegende Buch setzt sich mit der Jazzanalyse auseinander, also damit, wie man sich der auf Schallplatte festgehaltenen Aufnahme einer Jazzimprovisation mit dem traditionellen musikwissenschaftlichen Handwerkszeug nähern kann. Steve Larson will dabei zeigen, wie sich das System der Schenkerschen Analyse auf den Jazz anwenden lässt. Heinrich Schenker entwickelte seine Reduktionsanalyse, die vor allem tonale Musik auf die Hierarchie ihrer harmonischen und motivischen Entwicklung reduziert. Die Schenkersche Analyse hat vor allem in der US-amerikanischen Musikwissenschaft viele Anhänger gefunden, während sie in Deutschland selten und für den Jazz hierzulande meines Wissens bislang noch gar nicht verwendet wurde.
Das vorliegende Buch setzt sich mit der Jazzanalyse auseinander, also damit, wie man sich der auf Schallplatte festgehaltenen Aufnahme einer Jazzimprovisation mit dem traditionellen musikwissenschaftlichen Handwerkszeug nähern kann. Steve Larson will dabei zeigen, wie sich das System der Schenkerschen Analyse auf den Jazz anwenden lässt. Heinrich Schenker entwickelte seine Reduktionsanalyse, die vor allem tonale Musik auf die Hierarchie ihrer harmonischen und motivischen Entwicklung reduziert. Die Schenkersche Analyse hat vor allem in der US-amerikanischen Musikwissenschaft viele Anhänger gefunden, während sie in Deutschland selten und für den Jazz hierzulande meines Wissens bislang noch gar nicht verwendet wurde.
Eines der größten Probleme der Anwendung von Schenkers Methodik auf den Jazz ist die Tatsache, dass seine Methode einen Notentext zugrunde legt. Man brauche also, erläutert Larson in seiner Einleitung, möglichst genaue Transkriptionen der besten aufgenommenen Interpretationen. Lead-Sheets oder selbst die meisten der kommerziell veröffentlichten Transkriptionen reichten da nicht aus. Entsprechend macht sich der Autor selbst ans Werk, transkribiert verschiedene Interpretationen des Klassikers “Round Midnight” in der Interpretation von Thelonious Monk, Oscar Peterson und Bill Evans. Ihm ist dabei bewusst, dass jede Transkription in sich bereits eine Art der Analyse ist.
In Kapitel 2 seiner Arbeit hinterfragt er die Anwendbarkeit der Schenkerschen Analyse auf eine improvisierte Musik wie den Jazz und kommt für sich zum Schluss: (1.) dass diese durchaus nützlich sei, obwohl sie ursprünglich im Hinblick auf komponierte Musik entworfen wurde; (2.) dass sich auch von Schenker nicht vorgesehene komplexe Eigenheiten des Jazz in seine Methodik einpassen ließen; und (3.) dass die Ergebnisse komplexer Strukturen, die durch die Schenkersche Analyse darstellbar werden, von den Musikern durchaus intendiert seien. Hier liefert er sich ein paar Schattengefechte, etwa mit Wilhelm Furtwängler, der 1947 über den Jazz urteilte, ihm fehle der Sinn fürs Große, der Zusammenhalt über lange Strecken, im Jazz denke man nur von Moment zu Moment. Larson stellt dem die im Jazz übliche Metapher des “story telling” gegenüber, des Geschichtenerzählens, das von jedem Musiker gefordert werde.
Dann folgen die Hauptkapitel: Formale Analysen, Stimmführungsanalysen, Analysen des motivischen und des harmonischen Rhythmus und mehr in den Interpretationen von Monk, Peterson und Evans. Hardcore-Analysen, deren Resultat vor allem den großen Bogen der Aufnahmen herausarbeiten sollen, die Geschlossenheit von kreativem Einfall und formaler Gestaltung. Mit Bezug auf Evans vergleicht Larson darüber hinaus zwei Aufnahmen von “Round Midnight”, die zum einen im Studio, zum anderem bei einem Livekonzert entstanden sind. Immerhin fast die Hälfte des Buchs nehmen schließlich die Transkriptionen ein, keine Schenkersch-analytischen Zusammenfassungen, sondern ausgeschriebene Notentexte der Aufnahmen
Steve Larson will mit seinem Buch ein Argument für die Anwendbarkeit des Schenkerschen Analyseverfahrens auf den Jazz vorlegen. Bei anderen als den von ihm ausgewählten Titeln, insbesondere bei anderen Besetzungen, wäre die Analyse wahrscheinlich weit schwerer zu bewerkstelligen, so dass seine Quintessenz: Ja, die Schenkersche Analyse eignet sich auch für den Jazz, ein wenig schwach wirkt. Das überzeugendste Argument schließlich liefert er nicht: Zu erklären, warum er ausgerechnet für die von ihm ausgesuchten Stücke die Schenkersche Methode wählte und zugleich zu erklären, dass Analyse immer im Dienste der Erkenntnis stehen sollte, man also zuerst die Frage benötigt, um dann die Methode zu wählen, die zu einer sinnfälligen Antwort führt. Dementsprechend braucht es gewiss keiner allumfassenden Analysemethode für den Jazz – an Soloaufnahmen von Peterson, Monk und Evans kann man völlig anders herangehen als etwa an Ellingtons Orchestereinspielungen, an Soli von Charlie Parker oder die Unit Structures von Cecil Taylor. Es ist letzten Endes die Aufgabe des Analysierenden, dasjenige analytische Handwerkszeug zu wählen, das am ehesten geeignet ist, eine sinnvolle Aussage zu machen.
Wolfram Knauer (April 2011)
The Birth of Cool of Miles Davis and His Associates
von Frank Tirro
CMS Sourcebooks in American Music, No. 5
Hillsdale/NY 2009 (Pendragon Press)
196 Seiten, 1 Beilage-CD, 45 US-Dollar
ISBN: 978-1-57647-128-9
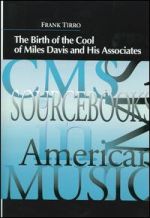 In der “Sourcebook in American Music”-Reihe des Pendragon-Verlags erscheint mit einer Monographie über die legendären Capitol-Nonet-Aufnahmen von Miles Davis der zweite Band, der sich mit einer klar umrissenen Besetzung auseinandersetzt und damit quasi ein abgeschlossenes Werk untersucht (der erste solche Band widmete sich den Hot-Five-Aufnahmen Louis Armstrongs.
In der “Sourcebook in American Music”-Reihe des Pendragon-Verlags erscheint mit einer Monographie über die legendären Capitol-Nonet-Aufnahmen von Miles Davis der zweite Band, der sich mit einer klar umrissenen Besetzung auseinandersetzt und damit quasi ein abgeschlossenes Werk untersucht (der erste solche Band widmete sich den Hot-Five-Aufnahmen Louis Armstrongs.
Jazz-Spezialist Frank Tirro beginnt mit einer generellen Einführung in die Bedeutung der Capitol-Aufnahmen des Trompeters. Im zweiten Kapitel beleuchtet er die grundsätzliche Idee des “Cool” – sowohl als Begriff und Lebenshaltung wie auch als Jazzstil. In Kapitel 3 geht er den Vorläufern dieses Stils auf den Grund, benennt die Spielhaltung etwa im Spiel und in den Kompositionen von Bix Beiderbecke, im Sound von Stan Getz und den Arrangements von Ralph Burns, aber auch in den Kompositionen und Interpretationen Dave Brubecks und insbesondere seines Octets (also einer dem Nonet vergleichbaren Besetzung). Nur kurz erwähnt Tirro die Bedeutung Duke Ellingtons (und Billy Strayhorns) sowie Lennie Tristanos als weitere Ausprägungen (a) kompositorischer Durchformung und (b) eines anderen Ansatzes von Cool Jazz.
Vor allem aber widmet der Autor sich im ersten Teil seines Buchs den Aufnahmen von Claude Thornhill, dessen Orchesterklang Miles angeblich zum Vorbild seines Nonet genommen habe. Er untersucht drei Aufnahmen Thornhills, Bill Bordens Arrangement über “Ev’rything I Love” sowie die beiden Gil-Evans-Arrangements über Charlie Parkers “Thriving On a Riff” und Miles Davis’ “Donna Lee”.
Der Hauptteil des Buchs dann widmet sich den Aufnahmen des Capitol Nonet, die Tirro den Arrangeuren gemäß ordnet. Er beschreibt die Aufnahmesituation (also Rundfunksendungen und Studiosessions) und analysiert dann nacheinander die Arrangements von Gil Evans (“Moon Dreams”; “Boplicity”), Gerry Mulligan (“Jeru”, “Godchild”, Venus de Milo”, “Rocker”), John Lewis (“Move”, “Budo”, “Rouge”), Johnny Carisi (“Israel”) sowie Davis selbst (“Deception”). Seine Analysen erklären den formalen Ablauf, stellen teilweise Seiten der Originalpartituren neben Transkriptionen, beleuchten, wie die Arrangeure zu bestimmten Klangfiguren gelangten und lenken den Leser auch immer wieder auf das “Außergewöhnliche”, das diese Klänge in der Zeit des Bebop ausmachten. So vergleicht er die Arrangement, die Mulligan über “Jeru” sowohl für Thornhill als auch für Davis schrieb, oder verweist er für den Beginn von “Godchild” auf die ungewöhnlichen Klangfiguren im Zusammengehen von Baritonsaxophon und Tuba.
Im Schlusskapitel beleuchtet Tirro den Nachhall der kurzlebigen Studioband, etwa in der Musik von J.J. Johnson und Kai Winding, in diversen Bands von Gerry Mulligan oder in der Musik von Shorty Rogers und anderen West-Coast-Musikern.
Frank Tirros Buch richtet sich vor allem an Studenten, ist aber auch für jeden Davis-Fan, der sich von Transkriptionen und musikalischen Fachbegriffen nicht verschrecken lässt, ein guter “Wieder”-Einstieg in die legendären Aufnahmen des “Birth of the Cool”.
Wolfram Knauer (April 2011)
Time and Anthony Braxton
Von Stuart Broomer
Toronto 2009 (The Mercury Press)
176 Seiten, 19,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-55128-144-5
 Anthony Braxtons Musik mag, scheint es, die erklärungsbedürftigste Variante des Jazz zu sein, was sich allein darin zeigt, dass Braxton selbst in seinen umfangreichen “Tri-Axium Writings” ausführliche Erläuterungen dazu verfasste, die seine Musik in Zusammenhang stellen mit philosophischen, musikästhetischen und ethischen Gedanken.
Anthony Braxtons Musik mag, scheint es, die erklärungsbedürftigste Variante des Jazz zu sein, was sich allein darin zeigt, dass Braxton selbst in seinen umfangreichen “Tri-Axium Writings” ausführliche Erläuterungen dazu verfasste, die seine Musik in Zusammenhang stellen mit philosophischen, musikästhetischen und ethischen Gedanken.
Der kanadische Journalist und Musikschriftsteller Stuart Broomer hat sich für sein Buch ein spezifisches Moment in Braxtons Musik herausgegriffen, das er von allen Seiten abklopft, um so der Philosophie und der Musik des Saxophonisten und Komponisten ein Stück näher zu kommen. “Time”, was im Englischen genauso für Zeit wie für Metrik und Rhythmus steht, und in jeder dieser unterschiedlichen Lesarten wiederum ganz verschiedene Bedeutungen besitzt, spiele im Verständnis von Braxtons Musik eine große Rolle (was jedem, der die große Sanduhr kennt, die den Ablauf seiner Sets in Konzerten markiert kennt, wohl bewusst ist). Zwischen diesen unterschiedlichen Lesarten von “Time” schwenkt sich Broomer hin und her. In Bezug auf die Musik sei Zeit, schreibt er etwa im Vorwort, nicht nur die Substanz, aus der diese bestehe, sondern zugleich Teil unserer eigenen Erfahrung, sei Musik damit wichtig für unsere eigene Art, Zeit zu konzeptualisieren. In Bezug auf Braxtons Karriere andererseits verweist er darauf, wie dieser in den 1970er Jahren als die “Zukunft” des Jazz begriffen wurde, wie er dagegen in seiner Arbeit immer wieder auf die Traditionen hingewiesen habe, von Jelly Roll Morton über Lennie Tristano und Charlie Parker bis zu John Coltrane and beyond.
Broomers erstes Kapitel, überschrieben “Groundings and Airings” beginnt in Chicago, der Stadt, in die, wie Braxton es formuliert, sogar Louis Armstrong gehen musste, um dort das Solo zu erfinden. In diesem Kapitel befasst sich Broomer vor allem mit den Jazztraditionen, mit denen sich – bewusst oder unbewusst – jeder Jazzmusiker auseinanderzusetzen hat, der in Chicago und mit dessen Musiktradition groß wird.
Das zweite Kapitel setzt sich mit Braxtons Solo-Performances auseinander, angefangen mit “For Alto”, das er 1970 für Delmark Records aufnahm. Als Braxton sich erstmals auf ein Solokonzert vorbereitet habe, habe er schnell gelernt, dass er die Beherrschung seiner eigenen “Sprache” verbessern müsse, da er sonst Gefahr liefe, dass ihm die Ideen ausgingen. Die Solostücke seien also eine Beweggrung für seine Auseinandersetzung mit komplexen Kompositionsmethoden gewesen. Und die “Sprache”, die er da ausarbeitete, umfasste Verweise auf Tradition genauso wie rein instrumentalspezifische und klangtechnische Details, unterschiedliche Timbres etwa oder die Varianten des lauten Ins-Instrument-Atmens.
Das dritte Kapitel befasst sich mit formbildenden Aspekten in Braxtons Werk, der Verwendung von Marschanklängen in seiner Musik etwa, seiner schon als Kind ausgeprägten Faszination von Paraden und Paradebands. Je mehr Broomer in die Musik eindringt, umso mehr enthüllt er aber auch seine eigene Erklärung als reine Annäherungen an seine Interpretationen komplexer Verstrickungen unterschiedlichster Einflüsse, Erinnerungen und Zeichen.
Kapitel vier ist überschrieben mit “The Quartet and Composition as Autobiography”. Er beschreibt das kompositorische Dilemma Braxtons: “Wie kann man in Klängen die komplexe Erfahrung von Bewusstsein und dem dauernd sich wandelnden Fokus des Bewusstseins, von der Kombination von Subjekten und Bedeutungen und Prozessen ausdrücken?” Zugleich stellt sich hier die Frage nach Komposition und Ausführung: Gerade im Quartett ging Braxton ja mit Kollegen an seine kompositorische Ausführung heran, denen er das, was er meinte, vermitteln wollte. Broomer beschreibt, wie die Titel immer kryptischer wurden, Ziffernfolgen nur noch oder Diagramme, und wie lange Interpretationen oft aus der Zusammenstellung verschiedener “Stücke” bestanden, so dass sich ihre Überschriften oft wie eine mathematische Gleichung lasen.
Kapitel fünf beschäftigt sich mit den Traditionsreminiszenzen in Braxtons Arbeit, den Verweisen auf Jazztradition, die schon in der Repertoireauswahl immer wieder auftauchen. Gershwin, Morton, Parker, Mingus, Joplin, Brubeck – Braxton stellt sich mit diesen Interpretationen immer wieder in die Reihe des Kontinuums, dessen Teil er selber ist, vielleicht auch (aber das ist nur unsere Interpretation), um hier die Kraft der Herkunft tanken zu können, mit der er seinen eigenen Weg weiterzugehen vermag, auch wenn viele Jazzfreunde außer der Improvisation in seinem Weg oft kaum Verweise an die Tradition mehr zu erkennen meinen.
Das sechste Kapitel widmet sich den kombinatorischen Kompositionen und Braxtons Conduction-Versuchen; Kapitel sieben dann den “Ghost Trance Musics”, jenen Stücken, die er nach 1995 für unterschiedliche Ensembles und Instrumentationen schrieb und die jeweils eine kontinuierliche, rhythmisch gleichmäßige, sich nicht wiederholende Melodie besaßen. Dieses Kapitel beinhaltet außerdem ein Interview, das Broomer 2007 mit Braxton führte und in dem er erklärt, wie er auf die Idee der Ghost Trance Musics kam und in welchen Traditionen er sich dabei sieht, der indianischer Musik etwa, Wagners, Sun Ras…
Das letzte Kapitel schließlich beleuchtet die nächste Phase in Braxtons Arbeit, die sogenannte “Diamond Curtain Wall Music”, in der Braxton sich auch ins Feld elektronischer Komposition begibt. Broomer konzentriert sich dabei vor allem auf Braxtons “Sonic Genome”-Projekt, aufgeführt bei der Winterolympiade in Vancouver im Januar 2010. Eine Timeline des Lebens und Schaffens des Saxophonisten, eine Diskographie, Literaturliste und ein ausführliches Register beschließen das Buch.
Stuart Broomers “Time and Anthony Braxton” beleuchtet immer wieder biographische Einflüsse auf Braxtons Musik; trotzdem steht Biographisches hier aber eher im Hintergrund. Broomer will sich mit seiner Fokussierung auf “Time” in allen verschiedenen Verständnisformen der Philosophie und der Entwicklung des kompositorischen Denkens Braxtons nähern. Das ist zum Teil ausgesprochen erhellend, zumal Broomer immer wieder von den doch recht abstrakten philosophischen Erklärungen zurück in die Realität des Musikdenkens und -machens blendet. Nicht nur für Braxton-Fans ist dieses Buch also lesenswert, sondern darüber hinaus für jeden, der sich mit aktuellen Diskursen im Feld zwischen Improvisation und Komposition befasst.
Wolfram Knauer (Februar 2011)
The Hearing Eye. Jazz & Blues Influences in African American Visual Art
Herausgegeben von Graham Lock & David Murray
New York 2009 (Oxford University Press)
366 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-534051-8
 Musik und Kunst, die abstrakteste und die zugänglichste aller Künste, haben sich immer wieder gegenseitig beeinflusst. Beispiele aus der europäischen Musik- und Kunstgeschichte gibt es zuhauf. Die Interdependenzen zwischen Jazz/Blues und afro-amerikanischer Kunst aber wurden nur selten untersucht. Alfred Appel wagte in seinem Buch “Jazz Modernism. From Ellington and Armstrong to Matisse and Joyce” eher einen großen Rundumschlag über die Verbindungen von Jazz und die Kunst der westlichen Welt, und auch das von Howard Becker, Robert R. Faulkner und Barbara Kirshenblatt-Gimblett herausgegebene Buch “Art from Start to Finish. Jazz, Painting, and other Improvisations” oder der von Daniel Soutif kuratierte Ausstellungskatalog “Le Siècle du Jazz. Art, cinema, musique et photographie de Picasso à Basquiat” zeigen die Verbindung zwischen Musik- und Kunstgeschichte eher allgemein und ohne einen konkreten Fokus auf Afro-Amerika.
Musik und Kunst, die abstrakteste und die zugänglichste aller Künste, haben sich immer wieder gegenseitig beeinflusst. Beispiele aus der europäischen Musik- und Kunstgeschichte gibt es zuhauf. Die Interdependenzen zwischen Jazz/Blues und afro-amerikanischer Kunst aber wurden nur selten untersucht. Alfred Appel wagte in seinem Buch “Jazz Modernism. From Ellington and Armstrong to Matisse and Joyce” eher einen großen Rundumschlag über die Verbindungen von Jazz und die Kunst der westlichen Welt, und auch das von Howard Becker, Robert R. Faulkner und Barbara Kirshenblatt-Gimblett herausgegebene Buch “Art from Start to Finish. Jazz, Painting, and other Improvisations” oder der von Daniel Soutif kuratierte Ausstellungskatalog “Le Siècle du Jazz. Art, cinema, musique et photographie de Picasso à Basquiat” zeigen die Verbindung zwischen Musik- und Kunstgeschichte eher allgemein und ohne einen konkreten Fokus auf Afro-Amerika.
Die beiden britischen Autoren Graham Lock und David Murray haben sich nun auf die Suche zwischen Jazz, Blues und afro-amerikanischen Künstlern und Kunstgattungen gemacht, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Das Buch ist quasi der zweite Teil eines größeren Forschungsprojektes, dessen erster Teil unter dem Titel “Thriving on a Riff” veröffentlicht wurde und das, wie die Herausgeber im Vorwort erinnern, den etwas grandiosen Projekttitel trug: “Criss Cross. Confluence and Influence in Twentieth-Century African-American Music, Visual Art, and Literature”.
Dieser Band also ist den bildenden Künsten gewidmet. Er beginnt mit einem Beitrag Paul Olivers zur Visualisierung von Anzeigen für Bluesplatten in den 1920er Jahren. Oliver untersucht die Texte der Anzeigen genauso wie die bildnerische Umsetzung, die Verwendung von Fotos, speziellen Reizworten (“race records” beispielsweise), aber auch die Ikonographie, mit der Zeichnungen den Inhalt der beworbenen Stücke wiedergeben, etwa in der Anzeige für den “First Degree Murder Blues” von Lil Johnson oder für Peetie Wheatstraws “Kidnappers Blues”.
Graham Lock beschreibt die Blues- und Negro-Folk-Songs-Gemälde von Rose Piper, eine Reihe an Bildern, die im Herbst 1947 in der New Yorker RoKo Galery ausgestellt wurden und von Aufnahmen etwa von Bessie Smith, Trixie Smith, Ma Rainey und anderen beeinflusst waren.
Lock interviewt außerdem den Quiltmacher Michael Cummings, dessen Quilts meist afro-amerikanische Themen haben und oft genug auf Jazz und Blues rekurrieren. Sie unterhalten sich vor allem über Cummings’ “African Jazz”-Reihe von zwölf Quilts, die von einem Poster inspiriert waren, das er in New Yorks Greenwich Village fand und das überschrieben war “Africans Playing Jazz, 1954”. Jeder der Quilts sei eine Art Variation des Grundmotivs von drei Musikern, und jeder Quilt erzähle dennoch eine andere Geschichte, ein wenig wie jeder Chorus einer Improvisation eine andere Geschichte erzählt. Einige der Quilts sind abgebildet, das inspirierende Poster aber leider nicht (auch nicht auf Michael Cummings’ Website, auf die im Artikel für den Fall verwiesen wird, dass man die komplette Quiltserie sehen will).
Sara Wood betrachtet die Malerei Norman Lewis’, der etliche Bilder mit konkretem Titelverweis auf den Jazz malte, in Hinblick auf den Einfluss des Bebop. Lock unterhält sich mit dem Collage-Künstler Sam Middleton über den “Maler als improvisierenden Solisten” und über Parallelen zwischen den Künsten. Richard H. King schreibt über Bob Thompson, dessen Bilder immer wieder konkrete musikalische Eindrücke wiederzugeben versuchten. Lock spricht außerdem mit Wadsworth Jarrell über die Künstlergruppe AFRICOBRA (African Commune of Bad Relevant Artists), eine AACM der Bildenden Kunst.
Zu den herausragenden afro-amerikanischen Künstlern, die sich immer wieder mit dem Jazz befassten, zählt Romare Bearden, dem Robert G. O’Meally einen Aufsatz widmet, in dem er Beardens Werk mit den Interpretationen seiner Kunst durch Albert Murray und Ralph Ellison vergleicht und im Diskurs der drei eine Art call-and-response quer durch die Kunstsparten feststellt. Auch Johannes Völz nimmt sich Bearden zum Thema und fragt, ob denn Bearden wirklich den Jazz gemalt habe bzw. wo genau in Beardens Gemälden wohl dieser Jazz zu finden sei. Natürlich sind da die Titel der Bilder, und sie sowie weitere Analogien, die gern in Bezug auf Beardens Werk mit dem Jazz gezogen werden, unterzieht Völz einer kritischen Betrachtung. Er warnt dabei vor der Interpretation wörtlicher Übersetzungen von einem künstlerischen Medium ins andere, weil sie meist zu oberflächlich blieben und die tatsächlich darunter liegenden kulturellen Diskurse über Blackness verschleierten.
Lock spricht mit Joe Overstreet, dessen Arbeit in den letzten Jahren immer stärker mit Licht und Schatten experimentiert, über seine abstrakte Phase und die Gründe der Rückkehr zur Gegenständlichkeit, über kubistische und andere Einflüsse und die Jazztitel und -themen einiger seiner Gemälde. Robert Farris Thompson liest die Kunst von Jean-Michel Basquiat als biographische Annäherung an Jazzgeschichte und die soziale Gegenwart New Yorks. Lock unterhält sich mit Ellen Banks, die postuliert, Musik sei ihr Stillleben, ihre Landschaft, ihr Akt. Banks ist das einzige Beispiel des Buchs eines Künstlers, der (also: die) Musik als einziges Thema ihrer Kunst sieht. Meist zeigen ihre Arbeiten abstrakte Formen, manchmal mit Worten durchsetzt, und ihr Einflüsse ist nicht nur der Jazz, sondern auch die europäische Barock- und klassische Musik.
Der letzte der gewürdigten Künstler ist der Fotograf Roy DeCarava, dessen “the sound i saw. improvisation on a jazz scene” Richard Inks näher begutachtet. Das Spiel mit Licht und Schatten lässt auch DeCaravas Bildern teilweise die Figuren wie Scherenschnitte oder Ikonen einer schwarzen Bildgeschichte erscheinen, etwa im Foto “Dancers” von 1956, das im Buch abgebildet ist. Zugleich versucht Inks, die Bilder aus “the sound i saw” als Narrativ zu lesen und die Geschichte(n) zu enträtseln, die dahinter steckt/en. Im letzten Kapitel schließlich spricht Graham Lock mit dem Saxophonisten Marty Ehrlich über den Maler Oliver Jackson und mit der Saxophonistin Jane Ira Bloom über Jackson Pollock, letzteres damit der einzige Nicht-Afro-Amerikaner der im Buch diskutierten Künstler.
In der Fokussierung auf schwarze amerikanische Künstler erlaubt “The Hearing Eye” einen Blick auf genreüberschreitende Einflüsse afro-amerikanischer Kultur. Dass Lock und Murray bestimmte Aspekte dabei völlig außer Acht lassen – sowohl Bildhauer als auch Installationskünstler, die sich von Blues und Jazz beeinflussen ließen, aber auch das ganze Genre der Graffiti- und HipHop-Szene – schränkt den Blick auf ein … sagen wir … “galerie-kompatibles” Themensegment ein. Die Ansätze der portraitierten Künstler sind dennoch so unterschiedlich wie die Ansätze der Autoren, sich ihrer Kunst und den Einflüssen durch die Musik zu nähern. Das ganze ist reich bebildert und wird ergänzt durch eine eigens eingerichtete Website, auf der noch einige weitere Bilder zu sehen sowie einige Hörbeispiele zu hören sind. Das klingt modern und up-to-date, ergänzt das Buch aber nur marginal – immerhin ist schon hier zu ahnen, wie ein eventueller dritter Band zum Thema des kulturellen Criss Cross aussehen könnte, in dem auf der dazugehörigen Website Videos und sonstige buch-unkompatible Medien geschaltet würden.
Wolfram Knauer (Februar 2011)
Digging. The Afro-American Soul of American Classical Music
Von Amiri Baraka
Berkeley 2009 (University of California Press)
411 Seiten, 18,95 US-$
ISBN: 978-0-520-25715-3
 Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich mit diesem Buch anfreunden konnte. Ich war höllisch neugierig auf das neueste Werk von Amiri Baraka, einst LeRoi Jones, dem großen afro-amerikanischen Poeten und Denker, einem Sprecher des New Thing in allen Künsten, damals in den 1960er Jahren, einem wortgewaltigen und zugleich ungemein streitbaren Fürsprecher schwarzer Kultur und nebenbei einem wirklich netten und humorvollen Menschen, wenn man ihn nicht in Bühnenpose oder Kampfesrhetorik vor sich hat.
Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich mit diesem Buch anfreunden konnte. Ich war höllisch neugierig auf das neueste Werk von Amiri Baraka, einst LeRoi Jones, dem großen afro-amerikanischen Poeten und Denker, einem Sprecher des New Thing in allen Künsten, damals in den 1960er Jahren, einem wortgewaltigen und zugleich ungemein streitbaren Fürsprecher schwarzer Kultur und nebenbei einem wirklich netten und humorvollen Menschen, wenn man ihn nicht in Bühnenpose oder Kampfesrhetorik vor sich hat.
Ich blätterte also und blieb bei der Plattenbesprechung eines Albums von Peter Brötzmann hängen, ziemlich am Schluss des Buches, dem Baraka unterstellt, sich nur auf marginale Seiten der Free-Jazz-Revolution zu konzentrieren, ihre Explosivität nämlich, ohne dabei ihre tieferen philosophischen und ästhetischen Einbindungen zu berücksichtigen, und so die Kraft und das raue Timbre des Originals zu benutzen, es aber seiner tieferen kompositorischen und improvisatorischen Aussage zu berauben. Was Baraka nicht begreift – obwohl ich annehme, dass er es durchaus begreift, er ist viel zu schlau, um es nicht zu wissen, aber er verfolgt nun mal in seinen Schriften durchaus auch eine politische Agenda – ist, dass Brötzmann und andere Künstler, die nicht der Great Black Music-Ästhetik mit all ihrer Geschichte und Tradition unterworfen sind, die Musik nun mal für sich umdeuten müssen, dass Aneignung zugleich auch Ver-Fremdung bedeutet und das das Maßanlegen der Ästhetik schwarzer Avantgarde an Brötzmann scheitert, wenn man die persönliche Betroffenheit, die individuelle Aneignung des Saxophonisten und seine Entwicklung aus dem Geiste der afro-amerikanischen Musik, aber eben in einer anderen Umgebung, außer acht lässt.
Aber da sind wir schon ganz beim Thema, warum es ein wenig dauerte, bis ich mich mit diesem Buch anfreunden konnte: Zu holzschnittartig und einseitig sind oft genug Barakas Thesen, seine vorausgesetzten ästhetischen Urteile, als dass ich sie auch nur als Diskussionsgrundlage unterschreiben möchte: Wenn wir über die Faktenbasis uneins sind, wie kann man dann diskutieren. Es dauerte also, bis ich seine Statements als solche durchaus auch polemische Aussagen akzeptieren konnte, mich von Kapitel zu Kapitel ein wenig aufregte, dabei dann aber jedes Mal selbst gefordert wurde Stellung zu beziehen – ganz so wie man zu Thilo Sarrazin Stellung beziehen muss, indem man die Fakten genauso wie die Thesen auf den eigenen, ganz persönlichen Prüfstand stellt.
Baraka fordert seine Leser also heraus; das hat er immer getan, in seinen Gedichten genauso wie in seinen Schriften, zu Musik, Theater oder zur Politik. Mit diesem Vorwissen muss man an das Buch herangehen: Es ist kein Schmöker für gemütliche Stunden; es ist keine Sammlung netter Anekdoten (obwohl es die auch gibt): Man begibt sich stattdessen in den Ring mit dem Autoren, in dem seine Linke und seine Rechte immer wieder dazu führen, dass man seine Deckung überprüft, dass man überlegt, ob die eigenen Einschätzungen richtig oder falsch sind, vor allem aber, wie diese eigenen Einschätzungen eigentlich sind und durch was sie beeinflusst wurden.
Persönlich sind etwa Kapitel über Miles Davis, Bill Cosby, besonders das über Nina Simone, David Murray, John Coltrane, Albert Ayler (als Coltrane ihn zum ersten Mal hörte, sei seine Respektbezeugung gewesen ihn zu fragen: “Mann, was für ein Blättchen benutzt du?”), Max Roach, Thelonious Monk, Abbey Lincoln (eines der wenigen Interviews im Buch).
Natürlich wettert Baraka gegen die weiße Besitznahme von Jazzstilen, gegen die mediale Hochstilisierung weißer Musiker zu Kings, Queens und sonstigen Hoheiten des Jazz. Die wenigen weißen Musiker, die bei ihm regelmäßig Erwähnung finden, ohne dass Baraka auch nur adjektivisch über sie herfällt sind etwa Stan Getz, Roswell Rudd oder Bruce Springsteen (letztere erhielten eigene kurze Kapitel im Buch). Bei Wynton Marsalis windet sich Baraka ein wenig. Eigentlich ist ihm dessen Ästhetik viel zu konservativ, aber dann hat Marsalis schließlich (wenn auch auf denkbar andere Art und Weise) Dinge erreicht, für die er, Baraka, in den 1960er Jahren gekämpft hatte. Also lautet sein Diktum: “Es gibt Hoffnung, denn Marsalis, ‘on fire’, kann wirklich sehr, sehr heiß sein.” On Fire!
Ein weiteres Thema, bei dem sich Baraka sichtlich windet, dem er dann aber auch nicht allzu viel Platz einräumt, ist das Thema Rap und aktuelle afro-amerikanische Popmusik: Wo sie politisch ist, schwarze Rots bewusst widerspiegelt, wunderbar; wo das fehlt oder ihm nicht glaubwürdig genug rüberkommt: Daumen runter.
Spannend sind auf jeden Fall seine Erinnerungen an Newark als einen wichtigen kulturellen Spielort knapp außerhalb New Yorks, Lebensmittelpunkt vieler Künstler mit einer eigener Szene, von der aber selten die Rede ist, weil nun mal Manhattan immer die Scheinwerfer auf sich zog. Lesens- und streitenswert auch sein Kapitel über “Jazz and the White Critic – thirty years later”, eine Fortsetzung eines Artikels, den er in den 1960er Jahren in der Zeitschrift Metronome veröffentlicht hatte. In zwei aufeinander folgenden Aufsätzen weist er darauf hin, welchen wichtigen Einfluss Jackie McLean auf die Auflösung formaler und harmonischer Strukturen vom Hardbop hin zum Free Jazz hatte – eine Rolle, die viel zu selten betont wird.
Und und und… immerhin 84 Kapitel umfasst das Buch, kurze Konzert- und Plattenrezensionen zum Teil, aber auch längere Features und Reflektionen. Wie gesagt: Man muss nicht (und wird kaum) mit allem seiner Meinung sein, um durch Baraka Anstöße zum Nachdenken und zum Die-eigene-Meinung-Überprüfen zu finden. Allein deshalb: Lesenswert”
Wolfram Knauer (Januar 2011)
Visiting Jazz. Quand les jazzmen américains ouvrent leur porte
von Thierry Pérémarti
Gémenos/France 2009 (Le Mot et le Reste)
376 Seiten, 23 Euro
ISBN 978-2-915378-96-2
 Thierri Pérémarti hat eine erfolgreiche Kolumne in der französischen Zeitschrift “Jazzman” (seit wenigen Jahren fusioniert mit “Jazz Magazine”), in der er Musiker besucht und ihr Zuhause beschreibt. Die kurzen Essays werfen ein etwas anderes, oft persönlicheres Licht auf die Musiker, auf ihre Hobbies, Autos und geben oft genug kurze Interviewausschnitte wider, die sich bei diesen Besuchen ergeben und die sich mal um Musik, mal aber auch um Alltägliches drehen. Die 78 Interviews reichen von Gato Barbiero bis Joe Zawinul, daneben finden sich Namen wie Ray Ellis, Chico Hamilton, Freddie Hubbard, Michel Petrucciani, Pharoah Sanders, Lalo Schifrin, Diane Schuur und viele andere. Ein kurzweiliges Buch mit jeweils einem persönlichen Foto im Umfeld des Musiker-Zuhauses, das hier leider nur schwarzweiß abgedruckt ist (im Original der Zeitschrift war es meist in Farbe).
Thierri Pérémarti hat eine erfolgreiche Kolumne in der französischen Zeitschrift “Jazzman” (seit wenigen Jahren fusioniert mit “Jazz Magazine”), in der er Musiker besucht und ihr Zuhause beschreibt. Die kurzen Essays werfen ein etwas anderes, oft persönlicheres Licht auf die Musiker, auf ihre Hobbies, Autos und geben oft genug kurze Interviewausschnitte wider, die sich bei diesen Besuchen ergeben und die sich mal um Musik, mal aber auch um Alltägliches drehen. Die 78 Interviews reichen von Gato Barbiero bis Joe Zawinul, daneben finden sich Namen wie Ray Ellis, Chico Hamilton, Freddie Hubbard, Michel Petrucciani, Pharoah Sanders, Lalo Schifrin, Diane Schuur und viele andere. Ein kurzweiliges Buch mit jeweils einem persönlichen Foto im Umfeld des Musiker-Zuhauses, das hier leider nur schwarzweiß abgedruckt ist (im Original der Zeitschrift war es meist in Farbe).
Wolfram Knauer (Dezember 2010)
Jazz in der Nachkriegszeit. Frankfurt am Main. Die Begegnungen zwischen Amerikanern und Deutschen
Von Anja Gallenkamp
München 2009 (AVM)
75 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-89975-832-0
 Die Rezeption des Jazz in Deutschland ist immer auch eine Rezeption der Amerikaner in Deutschland – so eng waren letzten Endes die amerikanischen Besatzungskräfte mit der Jazzentwicklung hierzulande verbunden. Es hat seinen Grund, warum Frankfurt am Main nach dem Krieg für lange Zeit als (moderne) Jazzhauptstadt der Republik galt: Hier saß das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte; hier gab es die meisten amerikanischen Soldaten und – eng damit verbunden – auch die meisten Soldatenclubs, in denen die US-amerikanischen Kunden nach der Musik verlangten, die sie von zuhause her gewohnt waren. Anfang der 1950er Jahre war das noch der Jazz, später ließ die Jazzliebe der Soldaten (wie auch ganz allgemein der amerikanischen Bevölkerung) nach; die Kapellen, die in den GI-Clubs aufspielten, mussten bald eine andere Musik spielen. Die Begegnungen zwischen Amerikanern und Deutschen jedenfalls waren ausschlaggebend für eine ganz spezifische Spielweise all jener Musiker, die das Glück hatten, in dieser Region zu arbeiten. Anja Gallenkamp hinterfragt in ihrer Studie die Kontakte zwischen Amerikanern und Deutschen, befragt Zeitzeugen und wertet Zeitschriften der Nachkriegszeit aus. Sie interessiert sich dafür, inwieweit das amerikanische Vorbild einen Dialog überhaupt noch ermöglichte bzw. inwieweit es über lange Jahre die Ausbildung eines eigenen Stils vielleicht eher verhinderte. Die Zeit, die sie dabei vor allem interessiert, sind die Jahre 1945 bis 1951/52, ihre Quellen etwa das von Horst Lippmann herausgegebene Hot Club Journal, die Zeitschrift Jazz Home sowie Interviews mit Joki Freund oder Ulrich Olshausen. Ihre Recherchen stellte Gallenkamp für ihre Magisterarbeit an, was vielleicht den etwas trockenen Stil erklären mag, der das Buch stellenweise zu einer etwas beschwerlichen Lektüre werden lässt. Viel Information hat sie zusammengetragen, wenig Neues entdeckt, Altbekanntes mit Quellenverweisen untermauert. Im ersten Kapitel wimmelt es ein wenig von jazzhistorischen Gemeinplätzen, die in ihrer Vereinfachung eher verwirren als erklären. Die benutzte Literatur ist in diesem Bereich recht begrenzt; insgesamt würde man sich – wenn man sich schon durch ein wissenschaftlich angelegtes Werk kämpft, eine etwas kritischere Herangehensweise an die Quellen wünschen. Noch mehr allerdings wünschte man, dass die Autoren sich weniger auf bekannte Quellen verlassen und dafür vielleicht selbst im einen oder anderen Archiv gestöbert hätte, dem Archiv der Stars and Stripes etwa, der amerikanischen Armeezeitung. Man wünschte sich, dass die Begegnung zwischen Amerikanern und Deutschen als eine wirkliche Begegnung dargestellt würde, nicht nur als eine einseitig bewundernde Verehrung, dass die Autorin also neben den deutschen Beispielen auch amerikanische gebracht hätte, Interviews etwa mit damals in Deutschland stationierten Soldaten und/oder Musikern geführt hätte. Das ist, zugegeben, mit der Zeit immer schwieriger, aber auch solche Zeitzeugen lassen sich noch finden, und diese Aufarbeitung wäre ungemein wichtig. Im letzten Kapitel merkt Gallenkamp immerhin an, was noch zu tun sei in der Erforschung des deutsch-amerikanischen Jazzdialogs. Schade, dass sie die Chance nicht selbst ergriffen hat, neben der durch einige Zeitzeugengespräche aufgelockerten Literaturarbeit in eine tiefere Recherche einzusteigen. So ist die wichtigste Erkenntnis ihres Buchs vielleicht, dass dieser Teil deutscher Jazzgeschichtsschreibung immer noch mehr Aufgaben enthält als Resultate.
Die Rezeption des Jazz in Deutschland ist immer auch eine Rezeption der Amerikaner in Deutschland – so eng waren letzten Endes die amerikanischen Besatzungskräfte mit der Jazzentwicklung hierzulande verbunden. Es hat seinen Grund, warum Frankfurt am Main nach dem Krieg für lange Zeit als (moderne) Jazzhauptstadt der Republik galt: Hier saß das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte; hier gab es die meisten amerikanischen Soldaten und – eng damit verbunden – auch die meisten Soldatenclubs, in denen die US-amerikanischen Kunden nach der Musik verlangten, die sie von zuhause her gewohnt waren. Anfang der 1950er Jahre war das noch der Jazz, später ließ die Jazzliebe der Soldaten (wie auch ganz allgemein der amerikanischen Bevölkerung) nach; die Kapellen, die in den GI-Clubs aufspielten, mussten bald eine andere Musik spielen. Die Begegnungen zwischen Amerikanern und Deutschen jedenfalls waren ausschlaggebend für eine ganz spezifische Spielweise all jener Musiker, die das Glück hatten, in dieser Region zu arbeiten. Anja Gallenkamp hinterfragt in ihrer Studie die Kontakte zwischen Amerikanern und Deutschen, befragt Zeitzeugen und wertet Zeitschriften der Nachkriegszeit aus. Sie interessiert sich dafür, inwieweit das amerikanische Vorbild einen Dialog überhaupt noch ermöglichte bzw. inwieweit es über lange Jahre die Ausbildung eines eigenen Stils vielleicht eher verhinderte. Die Zeit, die sie dabei vor allem interessiert, sind die Jahre 1945 bis 1951/52, ihre Quellen etwa das von Horst Lippmann herausgegebene Hot Club Journal, die Zeitschrift Jazz Home sowie Interviews mit Joki Freund oder Ulrich Olshausen. Ihre Recherchen stellte Gallenkamp für ihre Magisterarbeit an, was vielleicht den etwas trockenen Stil erklären mag, der das Buch stellenweise zu einer etwas beschwerlichen Lektüre werden lässt. Viel Information hat sie zusammengetragen, wenig Neues entdeckt, Altbekanntes mit Quellenverweisen untermauert. Im ersten Kapitel wimmelt es ein wenig von jazzhistorischen Gemeinplätzen, die in ihrer Vereinfachung eher verwirren als erklären. Die benutzte Literatur ist in diesem Bereich recht begrenzt; insgesamt würde man sich – wenn man sich schon durch ein wissenschaftlich angelegtes Werk kämpft, eine etwas kritischere Herangehensweise an die Quellen wünschen. Noch mehr allerdings wünschte man, dass die Autoren sich weniger auf bekannte Quellen verlassen und dafür vielleicht selbst im einen oder anderen Archiv gestöbert hätte, dem Archiv der Stars and Stripes etwa, der amerikanischen Armeezeitung. Man wünschte sich, dass die Begegnung zwischen Amerikanern und Deutschen als eine wirkliche Begegnung dargestellt würde, nicht nur als eine einseitig bewundernde Verehrung, dass die Autorin also neben den deutschen Beispielen auch amerikanische gebracht hätte, Interviews etwa mit damals in Deutschland stationierten Soldaten und/oder Musikern geführt hätte. Das ist, zugegeben, mit der Zeit immer schwieriger, aber auch solche Zeitzeugen lassen sich noch finden, und diese Aufarbeitung wäre ungemein wichtig. Im letzten Kapitel merkt Gallenkamp immerhin an, was noch zu tun sei in der Erforschung des deutsch-amerikanischen Jazzdialogs. Schade, dass sie die Chance nicht selbst ergriffen hat, neben der durch einige Zeitzeugengespräche aufgelockerten Literaturarbeit in eine tiefere Recherche einzusteigen. So ist die wichtigste Erkenntnis ihres Buchs vielleicht, dass dieser Teil deutscher Jazzgeschichtsschreibung immer noch mehr Aufgaben enthält als Resultate.
Wolfram Knauer (Oktober 2010)
Some Liked It Hot. Jazz Women in Film and Television, 1928-1959
Von Kristin A. McGee
Middletown/CT 2009 (Wesleyan University Press)
336 Seiten, 27,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8195-6908-0
 Kristin A. McGee verbindet in diesem aus ihrer Dissertation hervorgegangenen Buch gleich zwei Themen: die Stellung der Frau im Jazz und die Repräsentation des Jazz im Film – ihr Thema also ist dementsprechend die Repräsentation der Frau im Jazz, dargestellt in Film und Fernsehen in den Jahren zwischen 1928 und 1959. Sie fragt dabei neben historischen Fakten danach, wie es in beiden Genres – Jazz wie Film – aufgenommen wurde, Frauen als professionelle Akteure zu erleben. Ihr Handwerkszeug dabei zu eruieren, wie Frauen, ob weiß oder schwarz, entgegen dem üblichen Frauenbild in der Gesellschaft ihre (alternative) Identität im Beruf als Jazzmusiker schufen, ist neben der Musikethnologie das der Gender Studies und der allgemeinen Kulturwissenschaften.
Kristin A. McGee verbindet in diesem aus ihrer Dissertation hervorgegangenen Buch gleich zwei Themen: die Stellung der Frau im Jazz und die Repräsentation des Jazz im Film – ihr Thema also ist dementsprechend die Repräsentation der Frau im Jazz, dargestellt in Film und Fernsehen in den Jahren zwischen 1928 und 1959. Sie fragt dabei neben historischen Fakten danach, wie es in beiden Genres – Jazz wie Film – aufgenommen wurde, Frauen als professionelle Akteure zu erleben. Ihr Handwerkszeug dabei zu eruieren, wie Frauen, ob weiß oder schwarz, entgegen dem üblichen Frauenbild in der Gesellschaft ihre (alternative) Identität im Beruf als Jazzmusiker schufen, ist neben der Musikethnologie das der Gender Studies und der allgemeinen Kulturwissenschaften.
McGee beginnt ihr Buch mit einer Diskussion der Feminisierung der Massenkultur und der Mode von Frauenbands in den 1920er Jahren. Natürlich bezieht sich dieses Kapitel noch weit stärker auf die Bühne als auf den Film, aber genau das ist es, was McGee aufzeigen will, wie viele der auch im Film der 30er bis 50er Jahre enthaltenen Klischees sich auf der Varieté-Bühne der 1920er Jahre entwickelt hatten. Sie betrachtet Frauenensembles wie die Ingenues, die schon mal als die “Female Paul Whitemans of Syncopation” angekündigt wurden, oder die Harlem Playgirls, die in den schwarzen Zeitungen der 1930er Jahre gefeiert wurden. Da es in den meisten Teilen des Buchs die Darstellung der Musik im Film geht, macht es Sinn, sich, wo vorhanden, beim Lesen die entsprechenden Videos auf YouTube anzusehen, etwa Ausschnitte von Phil Spitalny and His Musical Queens oder der Bandleaderin Ina Ray Hutton. McGee erklärt, was in den Filmausschnitten zu sehen, aber auch, wie die diversen Bands in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden – als Bands genauso wie in ihrer Weiblichkeit. Sie findet vor allem, dass die Berichte selbst in den 1930er und 1940er Jahren nach wie vor das Ungewöhnliche einer reinen Frauenband stärker in den Vordergrund stellen als die musikalische Stärke der Ensembles. Hutton kommt dabei besonderes Gewicht zu, da ihre Band auch in Musikerkreisen einen exzellenten Ruf besaß.
Der dritte Teil des Buchs beschäftigt sich mit einem neuen Genre des Musikvideos in den 1940er Jahren, in dem schwarze Bands eine größere Rolle spielten. Themenschwerpunkte sind Hazel Scott, Lena Horne und eine neue Form der Erotisierung weiblicher Bands in den Soundies jener Zeit. Frauenbands erfuhren besonders während des Krieges einen Aufschwung, weil ihre männlichen Kollegen eingezogen wurden, eine Tatsache, auf die etwa im Film “When Johnny Comes Marching Home” auch thematisch eingegangen wird. Die International Sweethearts of Rhythm waren wahrscheinlich die bekannteste Frauenkapelle jener Jahre, und ihnen sowie ihrer Darstellung im Film widmet McGee ein eigenes Kapitel.
Im viertel Teil ihres Buches schließlich beleuchtet McGee die 50er Jahre, als Jazz in Musiksoundies immer weniger eine Rolle spielte, das Fernsehen dagegen zu einem allgegenwärtigen Medium wurde. So fragt sie nach Varietéshows im Fernsehen und der Präsenz weiblicher musikalischer Entertainer – Sängerinnen wie Peggy Lee und Lena Horne sowie Bandleaderinnen wie Ina Ray Hutton und Hazel Scott.
McGees Buch fokussiert den Blick des Lesers auf einen sehr speziellen Aspekt der Jazzgeschichte, und sie vermag jede Menge interessanter Backgroundinformationen dazu zu geben. Eine klare Storyline gibt es allerdings nicht in ihrem Buch, dem dann doch eher eine recht allgemein gehaltene Fragestellung zugrunde liegt und das sich stattdessen manchmal in Details verliert, bei denen sie letzten Endes mehr Fragen aufzuwerfen als Antworten zu geben scheint.
Wolfram Knauer (September 2010)
Fats Waller
von Igort & Carlos Sampayo
Bologna 2009 (Coconino Press)
152 Seiten, 17,50 Euro
ISBN: 978-8876-18159-7
 Igort und Carlos Sampayo sind in der Comicszene gefeierte Zeichner, deren “Fats Waller”-Buch bereits 2004 veröffentlicht und mittlerweile in etliche Sprachen übersetzt wurde (eine deutsche Ausgabe erschien 2005). Nun liegt uns die italienische Übersetzung des Buchs vor, Grund genug, hineinzusehen und einen Eindruck zu vermitteln. Es ist keine Comic-Biographie, wie man vermuten könnte, sondern ein an der Musik und am großen Fats Waller aufgehängtes Buch über Zeitgeschichte. Wir erleben den Pianisten im Plattenstudio, den Faschismus in Deutschland und Spanien, Liebe, Krieg, Leid und swingende Musik, durcheinandergewirbelt in hinreißenden Zeichnungen der Autoren, die den Jazz als Begleitmusik der schlimmsten Jahre des 20sten Jahrhunderts interpretieren. Das gelingt ihnen glänzend. Zum Schluss finden sich, quasi als Bonus Tracks, einige Skizzen zum Buch, auf zwei Blättern aber auch Hinweise auf die musikalischen Auswirkungen, wenn Fats Waller Thelonious Monk über die Schulter schaut.
Igort und Carlos Sampayo sind in der Comicszene gefeierte Zeichner, deren “Fats Waller”-Buch bereits 2004 veröffentlicht und mittlerweile in etliche Sprachen übersetzt wurde (eine deutsche Ausgabe erschien 2005). Nun liegt uns die italienische Übersetzung des Buchs vor, Grund genug, hineinzusehen und einen Eindruck zu vermitteln. Es ist keine Comic-Biographie, wie man vermuten könnte, sondern ein an der Musik und am großen Fats Waller aufgehängtes Buch über Zeitgeschichte. Wir erleben den Pianisten im Plattenstudio, den Faschismus in Deutschland und Spanien, Liebe, Krieg, Leid und swingende Musik, durcheinandergewirbelt in hinreißenden Zeichnungen der Autoren, die den Jazz als Begleitmusik der schlimmsten Jahre des 20sten Jahrhunderts interpretieren. Das gelingt ihnen glänzend. Zum Schluss finden sich, quasi als Bonus Tracks, einige Skizzen zum Buch, auf zwei Blättern aber auch Hinweise auf die musikalischen Auswirkungen, wenn Fats Waller Thelonious Monk über die Schulter schaut.
Wolfram Knauer (August 2010)
Thriving On a Riff. Jazz & Blues Influences in African American Literature and Film
herausgegeben von Graham Lock & David Murray
New York 2009 (Oxford University Press)
296 Seiten, 24,95 US-Dollar (oder 13,99 Britische Pfund)
ISBN: 978-0-19-533709-9
 Der Einfluss zwischen den Künsten ist immer wieder Thema für wissenschaftliche Symposien und Sammelbände, und der Einfluss des Jazz auf Literatur und Film insbesondere wegen der improvisatorischen Grundhaltung des Jazz ein gern behandeltes Thema. Doch machen es sich viele Autoren zu einfach mit den Wechselbeziehungen zwischen den Künsten, suchen nach augenfälligen Parallelen statt nach gemeinsamen künstlerisch-ästhetischen Ansätzen. Ein einfaches Übertragen künstlerischer Ideen oder Ästhetiken von einem Genre aufs andere ist in der Regel eh nicht möglich, und oft genug sind im Nachhinein festgestellte Parallelen oder Wechselbeziehungen theoretisch aufgepfropfte Interpretationsmodelle, nicht immer aber originär gewollt. Graham Lock und David Murray versuchen in dem von ihnen herausgegebenen Buch, eine Menge unterschiedlicher Ansätze einer Betrachtung des Zusammenspiels zwischen Jazz und Literatur, Jazz und Lyrik sowie Jazz und Film zu versammeln. Das Buch, das als Fortsetzung des Buchs “The Hearing Eye” zu lesen ist, hatte seinen Ursprung in einem Forschungsprojekt über wechselseitige Einflüsse zwischen afro-amerikanischer Musik des 20. Jahrhunderts, den visuellen Künsten und der Literatur.
Der Einfluss zwischen den Künsten ist immer wieder Thema für wissenschaftliche Symposien und Sammelbände, und der Einfluss des Jazz auf Literatur und Film insbesondere wegen der improvisatorischen Grundhaltung des Jazz ein gern behandeltes Thema. Doch machen es sich viele Autoren zu einfach mit den Wechselbeziehungen zwischen den Künsten, suchen nach augenfälligen Parallelen statt nach gemeinsamen künstlerisch-ästhetischen Ansätzen. Ein einfaches Übertragen künstlerischer Ideen oder Ästhetiken von einem Genre aufs andere ist in der Regel eh nicht möglich, und oft genug sind im Nachhinein festgestellte Parallelen oder Wechselbeziehungen theoretisch aufgepfropfte Interpretationsmodelle, nicht immer aber originär gewollt. Graham Lock und David Murray versuchen in dem von ihnen herausgegebenen Buch, eine Menge unterschiedlicher Ansätze einer Betrachtung des Zusammenspiels zwischen Jazz und Literatur, Jazz und Lyrik sowie Jazz und Film zu versammeln. Das Buch, das als Fortsetzung des Buchs “The Hearing Eye” zu lesen ist, hatte seinen Ursprung in einem Forschungsprojekt über wechselseitige Einflüsse zwischen afro-amerikanischer Musik des 20. Jahrhunderts, den visuellen Künsten und der Literatur.
Nick Heffernan macht den Anfang mit einer Analyse der Romane “The Autobiography of an Ex-Colored Man” von James Weldon Johnson (1912) und “Mojo Han. An Orphic Tale” von J.J. Phillips (1916) und untersucht insbesondere, wie in beiden Romanen die Wurzeln schwarzer Musik für die Identität der Protagonisten und für ihr Selbstverständnis als Afro-Amerikaner eine Rolle spielen. Corin Willes wirft einen Blick auf die Blackface Minstrelsy und fragt, wo sich Überreste dieser Gattung im frühen Tonfilm finden lassen. Steven C. Tracy untersucht Folk-Einfüsse (insbesondere aus dem Blues) auf Sterling Browns Gedichte. Graham Lock interviewt den Dichter Michael S. Harper über den Einfluss des Jazz auf seine Arbeit sowie über sein Gedicht “Dear John, Dear Coltrane” von 1970. Bertram D. Ashe untersucht Paul Beattys Roman “White Boy Shuffle Blues” auf die darin vorkommenden Bezüge zu Jazz, afro-amerikanischer Musik und sonstige Volkstraditionen. Graham Lock unterhält sich mit der Dichterin Jayne Cortez über ihren eigenen Bezug zu Musik, Politik und frühe Jazz-und-Lyrik-Projekte mit Horace Tapscott, über Ornette Coleman, mit dem sie kurzzeitig verheiratet war und über Jazzprojekte mit ihrem Sohn Denardo Coleman. Außerdem druckt er ihr Gedicht “A Miles Davis Trumpet” ab, das als von Cortez gelesenes Soundbeispiel auch auf der von der Oxford University Press eigens eingerichtete Website abrufbar ist. David Murray befasst sich mit Musik und Spiritualität in den Schriften von Nathaniel Mackey und Amiri Baraka, diskutiert insbesondere Barakas “Blues People” (1963) und “Black Music” (1967), die, wie er darstellt, auch auf seine Dichtung Einfluss hatten (etwa “Black Dada Nihilismus”).
John Gennari untersucht Ross Russells Charlie-Parker-Biographie “Bird Lives!” auf die wechselvolle Beziehung der beiden, nachdem Russell Parker 1945 für sein Dial-Label aufgenommen hatte. Er fragt nach den Schwierigkeiten, mit denen sich der Autor für sein Parker-Buch herumschlagen musste und vergleicht Russells Biographie schließlich mit seinem Roman “The Sound” und dessen Rezeption durch die Jazzkritik. Krin Gabbard beschäftigt sich mit dem Genre der Jazzautobiographie, vergleicht entsprechende Publikationen von Billie Holiday, Charles Mingus, Art Pepper, Sidney Bechet, Louis Armstrong, Duke Ellington, konzentriert sich dann aber vor allem auf Miles Davis’ “Miles. The Autobiography”. Er fragt nach dem “wahren” Miles Davis hinter den von Stuart Troupe edierten Gesprächen, aus denen das Buch entstanden war, danach, wie Miles gesehen werden wollte und wie die Person hinter dem Bild, das Miles da erschaffen wollte, wirklich aussah.
Mit Bezug zum Film macht sich Ian Brookes Gedanken über Filme wie “To Have and Have Not” oder “Casablanca”, über die narrative Ikonographie der Kriegszeit und die Darstellung schwarzer Menschen und die Funktion der Musik in diesen Filmen. David Butler untersucht die Rolle der Filmmusik, die John Lewis 1959 für “Odds Against Tomorrow” geschrieben hat. Er vergleicht Lewis’ Arbeit mit der Verwendung von Jazz in früheren Filmen und verweist darauf, dass Lewis der Überzeugung war, dass Jazz weit mehr als Nebenbeimusik sein könnte, dass Jazz als Filmmusik das gesamte Spektrum emotionalen Ausdrucks wiedergeben könne. Lewis’ Partitur habe jede Menge an Improvisation mit einbezogen, was bislang in Hollywood überhaupt nicht üblich gewesen sei, schreibt Brookes, und sie vermeide die typischen Jazzklischees. Brookes erzählt die Handlung des Films, diskutiert die Rolle des schwarzen Protagonisten (gespielt von Harry Belafonte) und bedauert, dass Lewis trotz der exzellenten Arbeit für diesen Film nicht die Gelegenheit erhielt, weiter in dem Metier der Filmmusik zu arbeiten. Mervyn Cooke nimmt sich das andere große Beispiel jazziger Filmmusik von 1959 vor: Otto Premingers “Anatomy of a Murder” für das Duke Ellington die Musik schrieb. Er analysiert einzelne Filmsequenzen und die sie begleitende Musik, vergleicht den Einsatz von Musik hier mit Filmen wie “The Man With the Folden Arm”, “Ascenceur pur l’échafaud” (mit seinen kongenialen Miles-Davis-Improvisationen), “Sait-on jamais” (mit Musik von John Lewis), “À bout de souffle” (mit einer Partitur von Martial Solal) und Roman Polanskis “Knife in the Water”, für das Krzysztof Komeda die Filmmusik schrieb.
In einem abschließenden Kapitel reflektiert Michael Jarrett dann über das grundsätzliche Missverständnis, Einfluss sei grundsätzlich ein bewusster Vorgang. Dann nimmt sich Jarrett ein konkretes Einflussthema vor: Er stellt auf seiner Website einen Klangmix verschiedener Titel zusammen, die auf das Eisenbahn-Thema rekurrieren, das sich in afro-amerikanischer Musik zwischen Jazz, Blues, Soul und Gospel so häufig findet. Er fragt nach unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten: Soundimitaten, Repräsentation von Zugmetaphern, Reduktion eines Songs auf Zuggeräusche etc. “Conduction” nennt Gregory Ulmer das neue Verständnis von Einflusssträngen, auf das Jarrett hiermit hinaus will, und das weit weniger zielgerichtet ist als es das Wort “Einfluss” vermuten lässt, und Jarrett überträgt Ulmers Modell beispielhaft auf Einflüsse in afro-amerikanischer Musik und Jazz.
Insgesamt ein Buch, das vom Großen zum Kleinen fortschreitet, anhand konkreter Beispiele jede Menge Anregungen für weitere Forschung über die die gegenseitigen Befruchtungen zwischen Jazz, Literatur und Film gibt. Spannende, anregende Lektüre.
Wolfram Knauer (August 2010)
Werkschau. 20 Jahre Schaffhauser Jazzfestival. Ein Rückblick
Herausgegeben von Daniel Fleischmann & Peter Pfister
Zürich 2009 (Chronos Verlag)
144 Seiten, 46 Schweizer Franken
ISBN: 978-3-0340-0961-4
 Für wen ist ein Buch, das auf ein Festival zurückblickt? Wohl tatsächlich vor allem für diejenige, die dieses Festival über die Jahre besucht haben, für die dieses Festival zur eigenen Geschmacksbildung beigetragen hat, die sich in der Dokumentation an die Atmosphäre, an musikalische Höhepunkte erinnern möchten. Das von Daniel Fleischmann redaktionell betreute und von Peter Pfister koordinierte Buch zum 20jährigen Jubiläum des Schaffhauser Festivals vertraut bei der Erinnerung in erster Linie auf Fotos, in zweiter Linie auf einige Texte, die die Bedeutung eines Schweizer Festivals beleuchten, auf organisatorische Probleme, auf ästhetische Diskussionen und auf das Überwinden von Schwierigkeiten eingehen. Die Fotos sind teils schwarzweiß, teils in Farbe gehalten, geben Spielsituationen genauso wieder wie das konzentriertes Aufanderhören der Musiker oder aber vor- bzw. nachbereitende Gespräche. Sie sind auf gutem, schwerem Papier gedruckt, und in ein angenehm voll-aufschlagbares Hardback gebunden. Am Schluss findet sich eine Übersicht der 20 Festivalplakate, leider aber kein Personenindex, auch keine Programmübersicht dieser Zeit. Dabei machen die Bilder neugierig genug darauf, wie denn die Abende programmiert wurden, von denen die Fotos stammen. Trotzdem, ein dankbar durchblätterbares Buch mit vielen sehenswerten Fotodokumenten zum zeitgenössischen Jazz aus der Schweiz, aus Europa und der ganzen Welt.
Für wen ist ein Buch, das auf ein Festival zurückblickt? Wohl tatsächlich vor allem für diejenige, die dieses Festival über die Jahre besucht haben, für die dieses Festival zur eigenen Geschmacksbildung beigetragen hat, die sich in der Dokumentation an die Atmosphäre, an musikalische Höhepunkte erinnern möchten. Das von Daniel Fleischmann redaktionell betreute und von Peter Pfister koordinierte Buch zum 20jährigen Jubiläum des Schaffhauser Festivals vertraut bei der Erinnerung in erster Linie auf Fotos, in zweiter Linie auf einige Texte, die die Bedeutung eines Schweizer Festivals beleuchten, auf organisatorische Probleme, auf ästhetische Diskussionen und auf das Überwinden von Schwierigkeiten eingehen. Die Fotos sind teils schwarzweiß, teils in Farbe gehalten, geben Spielsituationen genauso wieder wie das konzentriertes Aufanderhören der Musiker oder aber vor- bzw. nachbereitende Gespräche. Sie sind auf gutem, schwerem Papier gedruckt, und in ein angenehm voll-aufschlagbares Hardback gebunden. Am Schluss findet sich eine Übersicht der 20 Festivalplakate, leider aber kein Personenindex, auch keine Programmübersicht dieser Zeit. Dabei machen die Bilder neugierig genug darauf, wie denn die Abende programmiert wurden, von denen die Fotos stammen. Trotzdem, ein dankbar durchblätterbares Buch mit vielen sehenswerten Fotodokumenten zum zeitgenössischen Jazz aus der Schweiz, aus Europa und der ganzen Welt.
Wolfram Knauer (August 2010)
50 Jahre Jazzkeller Hofheim. 1959-2009 Kellertexte
herausgegeben von Roswitha Schlecker
Hofheim 2009 (Stadtmuseum Hofheim am Taunus)
120 Seiten; 10 Euro
ISBN: 978-3-933735-38-6
 Am 22. August 1959 eröffnete der Club der Jazzfreunde den ersten Jazzkeller in Hofheim am Taunus. 2009 feierte das Stadtmuseum das halbe Jahrhundert mit einer Ausstellung und einer Buchdokumentation über 50 Jahre bürgerschaftliches Engagement im Club der Jazzfreunde Hofheim. Die Dokumentation ist reich bebildert und schildert die Entwicklung des Clubs aus Beteilgtensicht: Von den Anfängen im Café Staab über Aufbruch, Jugendkultur und Politisierung der 1960er Jahre, sportliche Aktivitäten um den Club, ästhetische Diskussionen und schließlich das Hofheimer Jazzfest, das zwischen 1975 und 1995 zwanzigmal stattfand und über die Jahre wegen seiner künstlerischen Qualität zu einem deutschlandweit wahrgenommenen Festival wurde. Der Club war sozialer Treffpunkt, das wird schnell klar, und er hatte eine wichtige Funktion im Leben der aktiven Clubmitglieder, von denen eine überdurchschnittlich große Zahl beruflich mit der Musik verbunden blieb (als Verleger, als Buchhändler mit Jazzspezialsortiment, als Musikagent). Über die Musik selbst erfährt man dabei allerdings wenig, kriegt eher am Rande mit, dass Debatten um Free Jazz stattgefunden haben müssen, der im Club eine “große Minderheit” an Befürwortern hatte. Die Clubmitglieder jedenfalls engagierten sich nicht nur für ihren Verein, sondern auch in der Stadt, demonstrierten gegen Missstände, ja stellten 1980 sogar einen eigenen Kanzlerkandidaten auf, der die Partei G.A.F.N. (Gegen Alles Für Nichts) zur Macht bringen sollte. Hofheim, am Rande der Spontistadt Frankfurt gelegen, kriegte eben einiges mit an Ideen und Einfällen der Szene um Joschka Fischer und Daniel Kohn-Bendit. 1995 fand das 20. Hofheimer Jazzfest statt; der Jazzkeller macht weiter Konzerte, weiterhin mit Improvisationslust, wenn auch mit genauso unsicheren Mitteln. Zum 50sten Geburtstag schenkte der Verein sich selbst sein 21. Jazzfest. Die Dokumentation seiner Aktivitäten gibt ein lesenswertes Stimmungsbild einer aktiven Jazzgemeinde.
Am 22. August 1959 eröffnete der Club der Jazzfreunde den ersten Jazzkeller in Hofheim am Taunus. 2009 feierte das Stadtmuseum das halbe Jahrhundert mit einer Ausstellung und einer Buchdokumentation über 50 Jahre bürgerschaftliches Engagement im Club der Jazzfreunde Hofheim. Die Dokumentation ist reich bebildert und schildert die Entwicklung des Clubs aus Beteilgtensicht: Von den Anfängen im Café Staab über Aufbruch, Jugendkultur und Politisierung der 1960er Jahre, sportliche Aktivitäten um den Club, ästhetische Diskussionen und schließlich das Hofheimer Jazzfest, das zwischen 1975 und 1995 zwanzigmal stattfand und über die Jahre wegen seiner künstlerischen Qualität zu einem deutschlandweit wahrgenommenen Festival wurde. Der Club war sozialer Treffpunkt, das wird schnell klar, und er hatte eine wichtige Funktion im Leben der aktiven Clubmitglieder, von denen eine überdurchschnittlich große Zahl beruflich mit der Musik verbunden blieb (als Verleger, als Buchhändler mit Jazzspezialsortiment, als Musikagent). Über die Musik selbst erfährt man dabei allerdings wenig, kriegt eher am Rande mit, dass Debatten um Free Jazz stattgefunden haben müssen, der im Club eine “große Minderheit” an Befürwortern hatte. Die Clubmitglieder jedenfalls engagierten sich nicht nur für ihren Verein, sondern auch in der Stadt, demonstrierten gegen Missstände, ja stellten 1980 sogar einen eigenen Kanzlerkandidaten auf, der die Partei G.A.F.N. (Gegen Alles Für Nichts) zur Macht bringen sollte. Hofheim, am Rande der Spontistadt Frankfurt gelegen, kriegte eben einiges mit an Ideen und Einfällen der Szene um Joschka Fischer und Daniel Kohn-Bendit. 1995 fand das 20. Hofheimer Jazzfest statt; der Jazzkeller macht weiter Konzerte, weiterhin mit Improvisationslust, wenn auch mit genauso unsicheren Mitteln. Zum 50sten Geburtstag schenkte der Verein sich selbst sein 21. Jazzfest. Die Dokumentation seiner Aktivitäten gibt ein lesenswertes Stimmungsbild einer aktiven Jazzgemeinde.
Wolfram Knauer (August 2010)
Whisky & Jazz
von Hans Offringa (& Jack McCray)
Charleston/SC 2009 (Evening Post Publishing Company)
206 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-615-28155-1
 Wenn man nach Verbindungen zwischen Whisky und Jazz sucht, dann fallen einem wahrscheinlich als erstes die Trunkenbolde der Jazzgeschichte ein, von Bix Beiderbecke über Bunny Berigan bis zu Billie Holiday oder Lester Young und etlichen anderen, die oft genug mit Alkohol begannen und mit härteren Drogen endeten. Dies vorausgeschickt, mag man ein wenig ratlos vor diesem opulenten Coffeetable-Book stehen, das so unverblümt behauptet, die beiden hätten etwas gemeinsam. Jazz müsse swingen und Whisky müsse einen gewissen Nachgeschmack besitzen, schreibt Offringa. Für beide müsse man einen Geschmack entwickeln, beide würden von Experten und passionierten Handwerkern hergestellt. Naja, da fielen einem dann allerdings noch etliche andere mögliche Buchprojekte ein. Doch es ist nun mal Whisky… Hans Offringa also heißt der niederländische Whiskykenner, der schon etliche Bücher über den goldenen Stoff geschrieben hat und der sich diesmal mit Jack McCray einen ausgewiesenen Jazzexperten ins Boot geholt hat. Sie suchen zehn Musiker aus, die Jazzgeschichte geschrieben haben, sowie zehn gleichermaßen wichtige Single Malts. Nach einer Einführung in sowohl die Jazz- als auch die Whiskygeschichte gibt es dann kurze Essays zu Leben und Werk der Protagonisten bzw. Entstehung und Sein der Whiskysorten, beide Teile reich bebildert mit Fotos der jeweiligen Themenschwerpunkte. Die ausgewählten Jazzer sind keine Randfiguren: Cannonball Adderley, Chet Baker, John Coltrane, Miles Davis, Stan Getz, Dexter Gordon, Milt Jackson, Hank Mobley, Charlie Parker und Art Tatum. Jack McCray stellt sie in kurzen, liebevollen Artikeln vor, die sich ihrer Biographie genauso wie ihrer musikalischen Ästhetik widmen. An den Beginn des Buchs stellt McCray außerdem eine Einführung in die Jazzgeschichte, die auch alternative Narrative, also beispielsweise die Bedeutung seiner Heimatstadt Charleston, mit berücksichtigt. Zum Schluss kommen die beiden Erzählstränge des Buchs, der zum Whisky und der zum Jazz, dann zusammen, wenn den Musikern Whiskysorten zugeordnet werden, quasi wie eine Art Hör-und-Trink-Anleitung: Mit Jackson mit Balblair, Miles Davis mit Bruichladdich, Charlie Parker mit Springbank und so weiter. Über die Lieblingsgetränke der Musiker erfährt man eher wenig. Vielleicht hätten sie dem Single Malt einen Bourbon vorgezogen. Oder Milch, wie ein Foto im Hank-Mobley-Kapitel suggeriert.
Wenn man nach Verbindungen zwischen Whisky und Jazz sucht, dann fallen einem wahrscheinlich als erstes die Trunkenbolde der Jazzgeschichte ein, von Bix Beiderbecke über Bunny Berigan bis zu Billie Holiday oder Lester Young und etlichen anderen, die oft genug mit Alkohol begannen und mit härteren Drogen endeten. Dies vorausgeschickt, mag man ein wenig ratlos vor diesem opulenten Coffeetable-Book stehen, das so unverblümt behauptet, die beiden hätten etwas gemeinsam. Jazz müsse swingen und Whisky müsse einen gewissen Nachgeschmack besitzen, schreibt Offringa. Für beide müsse man einen Geschmack entwickeln, beide würden von Experten und passionierten Handwerkern hergestellt. Naja, da fielen einem dann allerdings noch etliche andere mögliche Buchprojekte ein. Doch es ist nun mal Whisky… Hans Offringa also heißt der niederländische Whiskykenner, der schon etliche Bücher über den goldenen Stoff geschrieben hat und der sich diesmal mit Jack McCray einen ausgewiesenen Jazzexperten ins Boot geholt hat. Sie suchen zehn Musiker aus, die Jazzgeschichte geschrieben haben, sowie zehn gleichermaßen wichtige Single Malts. Nach einer Einführung in sowohl die Jazz- als auch die Whiskygeschichte gibt es dann kurze Essays zu Leben und Werk der Protagonisten bzw. Entstehung und Sein der Whiskysorten, beide Teile reich bebildert mit Fotos der jeweiligen Themenschwerpunkte. Die ausgewählten Jazzer sind keine Randfiguren: Cannonball Adderley, Chet Baker, John Coltrane, Miles Davis, Stan Getz, Dexter Gordon, Milt Jackson, Hank Mobley, Charlie Parker und Art Tatum. Jack McCray stellt sie in kurzen, liebevollen Artikeln vor, die sich ihrer Biographie genauso wie ihrer musikalischen Ästhetik widmen. An den Beginn des Buchs stellt McCray außerdem eine Einführung in die Jazzgeschichte, die auch alternative Narrative, also beispielsweise die Bedeutung seiner Heimatstadt Charleston, mit berücksichtigt. Zum Schluss kommen die beiden Erzählstränge des Buchs, der zum Whisky und der zum Jazz, dann zusammen, wenn den Musikern Whiskysorten zugeordnet werden, quasi wie eine Art Hör-und-Trink-Anleitung: Mit Jackson mit Balblair, Miles Davis mit Bruichladdich, Charlie Parker mit Springbank und so weiter. Über die Lieblingsgetränke der Musiker erfährt man eher wenig. Vielleicht hätten sie dem Single Malt einen Bourbon vorgezogen. Oder Milch, wie ein Foto im Hank-Mobley-Kapitel suggeriert.
Das Buch ist sicher vor allem eine Geschenkidee an jemanden, der beidem zugetan ist: dem Whisky und dem Jazz. Über beide Seiten seines Hobbies wird der so Beschenkte einiges Interessante erfahren, blättern, und vielleicht noch andere, eigene Getränke-Musik-Kombinationen entdecken.
Wolfram Knauer (Juli 2010)
Insights in Jazz. An Inside View of Jazz Standard Chord Progressions
von John A. Elliott
London 2009 (Jazzwise Publications)
306 Seiten, 25 Britische Pfund (Buch) bzw. 12 Britische Pfund (PDF-Download)
ISBN: 978-0-9564031-1-7
 John Elliott, Jazzpianist und -lehrer aus Edinburgh, fasst sein Buch im Vorwort in einer Grafik zusammen: Er hat den gesamten Text in “wordle.-net” eingegeben, eine Website, die die Häufigkeit von im Text auftauchenden Worten analysiert und in eine Grafik umwandelt, in der besonders oft benutzte Worte größer und herausgehobener dargestellt werden als weniger oft benutzte Worte. “Cadence”, “Chord” und das Akkordsymbol “C∆” sind demnach die wichtigsten Wörter des Buchs, gefolgt von “Love”, “songs”, “chords”, “bridge”. “Love” fällt heraus; es taucht so oft auf, weil viele der Songs, die Elliott für sein Buch analysiert, nun mal “Love” im Titel führen. Elliott stellt in seinem Buch eine Methode auf, die Musikern helfen soll, die harmonische Struktur von Jazzstücken im Gedächtnis zu behalten. “Insights in Jazz” ist also keine neue Improvisationslehre, kein neues Harmonielehrebuch, sondern bietet eine Analyse ausgewählter Standards, die es Musikern und Musikstudenten leichter machen soll, diese zu memorieren. Sie baut auf Conrad Corks “New Guide to Harmony with LEGO Bricks” auf, einem Lehrbuch, das seit 1985 in mehreren Auflagen veröffentlicht wurde. Cork fasste oft vorkommende Akkordprogressionen in “bricks”, also Bausteinen, zusammen und definierte darüber hinaus eine Reihe an Verbindungspassagen (“joins”) zwischen solchen Bausteinen. Elliott ergänzt, er sei der Überzeugung, dass sich Standards am besten lernen ließen, wenn man sie grafisch darstelle. Harmoniesymboltechnisch hält er sich weitgehend zurück, beschränkt sich auf grundlegende Harmoniesymbole. Ansonsten präsentiert er die ausgesuchten Standards in einer Grafik, in der die formale Struktur angegeben ist, darin die Bausteine und Verbindungsstücke gemäß dem Lehrbuch von Cork sowie seine grundlegenden Akkordsymbole. Schließlich arbeitet er mit Farbe, um Passagen zu kennzeichnen, die nach Moll wechseln oder solche, in denen es zu erhöhter oder gar besonders erhöhter harmonischer Spannung kommt. Die “bricks” haben klar definierte Namen, etwa “Hover”, wenn sich die zugrunde liegende Harmonie über mehr als einen Takt erstreckt, “Dropback” für eine Kadenz von einem Dominantseptakkord zur Tonika etc., aber auch “Night and Day Cadence” für einer Drei-Akkord-Folge oder “Rainy Cadence” oder “Yardbird Cadence” für Akkordfolgen, wie sie in den gleichnamigen Titeln zu finden sind. Es gibt spezielle Namen für Turnarounds, für längere Akkordfolgen sowie für zwölf Verbindungspassagen, die quasi die zwölf möglichen Intervallpassagen kennzeichnen. Ein Ratschlag, den Elliott zu Beginn mitgibt, entnimmt er dem Studienhandbuch der Manhattan School of Music: “12 tunes say it all”: Man müsse nicht Hunderte Stücke auswendig kennen, sondern sei schon mal ganz gut bedient, wenn man zwölf Stücke kennen würde, die jede Menge an Grundstruktur und an harmonischen Phrasen enthalten, die auch in anderen Stücken immer wieder auftauchen. Elliott ergänzt die Liste um den Blues und hat damit 13 “beispielhafte” Titel, mit denen der Leser/Musiker anfangen könne: den Blues, “I’ve Got Rhythm”, “Cherokee”, “Sweet Georgia Brown”, “Indiana”, “How High the Moon”, “Out of Nowhere”, “Perdido”, “Honeysuckle Rose”, “Whispering”, “All the Things You Are”, “Night and Day” sowie “Lover”. Er beschreibt die am meisten üblichen Bausteine und gibt Tipps, wo man sein Pensum beginnen und wie man es fortsetzen könne. In “Insights in Jazz” führt Elliott einige neue Bausteine ein, etwa für spezielle Substitutakkorde oder Kadenzen. Er analysiert Titel, deren Schluss sich dem Schluss aus “Pennies from Heaven” bedient, besondere Kadenzen, etwa die “Rainbow”-Kadenz, die allerdings in “Over the Rainbow” gar nicht zu finden sei, sondern nur in Corks Analyse des Stücks. Ein Vorteil der Baustein-Methode sei, dass man auch dann leicht wieder in die Struktur eines Stücks hereinfinde, wenn man sich kurzzeitig musikalisch verlaufen habe, meint Elliott. Der erklärende Teil des Buchs umfasst knapp 60 Seiten, dann folgen die Anhänge, die die Theorie für den Musiker umsetzbar machen sollen: eine Übersicht über die verschiedenen “bricks”, “turnarounds” und “metabricks”, sowie die “Straßenkarte” zu über 200 Songs, einschließlich der meisten der 180 Standards, die von der Manhattan School of Music als Pflichtstücke vorausgesetzt werden, die man also während eines sechsjährigen Studiums lernen müsse. Melodien enthalten diese Übersichten nicht, aus Urheberrechtsgründen, wie Elliott anmerkt, aber auch, weil man Melodien seiner Meinung nach am besten von Platten abhören und lernen solle anstatt nach Noten. Es folgen 238 “Roadmaps” von “A Train” bis “Yours Is My Heart Alone”.
John Elliott, Jazzpianist und -lehrer aus Edinburgh, fasst sein Buch im Vorwort in einer Grafik zusammen: Er hat den gesamten Text in “wordle.-net” eingegeben, eine Website, die die Häufigkeit von im Text auftauchenden Worten analysiert und in eine Grafik umwandelt, in der besonders oft benutzte Worte größer und herausgehobener dargestellt werden als weniger oft benutzte Worte. “Cadence”, “Chord” und das Akkordsymbol “C∆” sind demnach die wichtigsten Wörter des Buchs, gefolgt von “Love”, “songs”, “chords”, “bridge”. “Love” fällt heraus; es taucht so oft auf, weil viele der Songs, die Elliott für sein Buch analysiert, nun mal “Love” im Titel führen. Elliott stellt in seinem Buch eine Methode auf, die Musikern helfen soll, die harmonische Struktur von Jazzstücken im Gedächtnis zu behalten. “Insights in Jazz” ist also keine neue Improvisationslehre, kein neues Harmonielehrebuch, sondern bietet eine Analyse ausgewählter Standards, die es Musikern und Musikstudenten leichter machen soll, diese zu memorieren. Sie baut auf Conrad Corks “New Guide to Harmony with LEGO Bricks” auf, einem Lehrbuch, das seit 1985 in mehreren Auflagen veröffentlicht wurde. Cork fasste oft vorkommende Akkordprogressionen in “bricks”, also Bausteinen, zusammen und definierte darüber hinaus eine Reihe an Verbindungspassagen (“joins”) zwischen solchen Bausteinen. Elliott ergänzt, er sei der Überzeugung, dass sich Standards am besten lernen ließen, wenn man sie grafisch darstelle. Harmoniesymboltechnisch hält er sich weitgehend zurück, beschränkt sich auf grundlegende Harmoniesymbole. Ansonsten präsentiert er die ausgesuchten Standards in einer Grafik, in der die formale Struktur angegeben ist, darin die Bausteine und Verbindungsstücke gemäß dem Lehrbuch von Cork sowie seine grundlegenden Akkordsymbole. Schließlich arbeitet er mit Farbe, um Passagen zu kennzeichnen, die nach Moll wechseln oder solche, in denen es zu erhöhter oder gar besonders erhöhter harmonischer Spannung kommt. Die “bricks” haben klar definierte Namen, etwa “Hover”, wenn sich die zugrunde liegende Harmonie über mehr als einen Takt erstreckt, “Dropback” für eine Kadenz von einem Dominantseptakkord zur Tonika etc., aber auch “Night and Day Cadence” für einer Drei-Akkord-Folge oder “Rainy Cadence” oder “Yardbird Cadence” für Akkordfolgen, wie sie in den gleichnamigen Titeln zu finden sind. Es gibt spezielle Namen für Turnarounds, für längere Akkordfolgen sowie für zwölf Verbindungspassagen, die quasi die zwölf möglichen Intervallpassagen kennzeichnen. Ein Ratschlag, den Elliott zu Beginn mitgibt, entnimmt er dem Studienhandbuch der Manhattan School of Music: “12 tunes say it all”: Man müsse nicht Hunderte Stücke auswendig kennen, sondern sei schon mal ganz gut bedient, wenn man zwölf Stücke kennen würde, die jede Menge an Grundstruktur und an harmonischen Phrasen enthalten, die auch in anderen Stücken immer wieder auftauchen. Elliott ergänzt die Liste um den Blues und hat damit 13 “beispielhafte” Titel, mit denen der Leser/Musiker anfangen könne: den Blues, “I’ve Got Rhythm”, “Cherokee”, “Sweet Georgia Brown”, “Indiana”, “How High the Moon”, “Out of Nowhere”, “Perdido”, “Honeysuckle Rose”, “Whispering”, “All the Things You Are”, “Night and Day” sowie “Lover”. Er beschreibt die am meisten üblichen Bausteine und gibt Tipps, wo man sein Pensum beginnen und wie man es fortsetzen könne. In “Insights in Jazz” führt Elliott einige neue Bausteine ein, etwa für spezielle Substitutakkorde oder Kadenzen. Er analysiert Titel, deren Schluss sich dem Schluss aus “Pennies from Heaven” bedient, besondere Kadenzen, etwa die “Rainbow”-Kadenz, die allerdings in “Over the Rainbow” gar nicht zu finden sei, sondern nur in Corks Analyse des Stücks. Ein Vorteil der Baustein-Methode sei, dass man auch dann leicht wieder in die Struktur eines Stücks hereinfinde, wenn man sich kurzzeitig musikalisch verlaufen habe, meint Elliott. Der erklärende Teil des Buchs umfasst knapp 60 Seiten, dann folgen die Anhänge, die die Theorie für den Musiker umsetzbar machen sollen: eine Übersicht über die verschiedenen “bricks”, “turnarounds” und “metabricks”, sowie die “Straßenkarte” zu über 200 Songs, einschließlich der meisten der 180 Standards, die von der Manhattan School of Music als Pflichtstücke vorausgesetzt werden, die man also während eines sechsjährigen Studiums lernen müsse. Melodien enthalten diese Übersichten nicht, aus Urheberrechtsgründen, wie Elliott anmerkt, aber auch, weil man Melodien seiner Meinung nach am besten von Platten abhören und lernen solle anstatt nach Noten. Es folgen 238 “Roadmaps” von “A Train” bis “Yours Is My Heart Alone”.
Ob das alles dem Musikstudenten oder Amateurmusiker (an beide richtet sich dieses Buch wohl vor allem) wirklich hilft, muss jedem selbst überlassen bleiben. Fürs Memorieren von Stücken gibt es schließlich von Musiker zu Musiker unterschiedliche Strategien. Elliotts auf dem “Brick”-System Corks aufbauendes System ist sicher eine hilfreiche Ergänzung und kann dem einen oder anderen Musiker damit helfen, sein Repertoire zu erweitern. Das Buch ist als Printversion über den Verlag Jazzwise zu beziehen oder aber direkt beim Autoren als personalisierte pdf-Version.
Link: Insights in Jazz.
Wolfram Knauer (Juli 2010)
Flow, Gesture, and Spaces in Free Jazz. Towards a Theory of Collaboration
von Guerino Mazzola & Paul B. Cherlin
Berlin 2009 (Springer)
141 Seiten, 53,45 Euro
ISBN: 978-3-540-92194-3
Es sei der Jazzforschung bislang nur unangemessen gelungen, die unterschiedlichen Aspekte des Free Jazz zu analysieren, merkt G uerino Mazzola im Vorwort seines Buches, das in der Reihe “Computational Music Science” erschien, und erklärt, dass er damit nicht einfach nur die komplexen Improvisationsmechanismen meine, sondern auch die dahinter liegende kulturelle Bedeutung dieser Musik. Sein Buch entstand aus einem Seminar an der University of Minnesota heraus, und das merkt man auch der Kapitelaufteilung des Buchs an, das sich ein wenig wie das Curriculum eines Semesters liest. Er und seine Mitautoren (zum Teil Studenten des Seminars, zum Teil mit dem auch als Pianist aktiven Mazzola assoziierte Musiker) beginnen mit grundlegenden Definitionen über die gesellschaftlichen, politischen und musikalischen Ursprünge der Free-Jazz-Bewegung. Mazzola untersucht ausgewählte Dokumente – Artikel, Interviews, Konzertmitschnitte –, um aus ihnen die Diskurse der 1960er Jahre herauszuarbeiten, wobei er sowohl auf Dokumente aus den USA wie aus Deutschland zurückgreift (letzteres in einer legendären Fernsehsendung von 1967, bei der Klaus Doldingers Quartett auf Peter Brötzmanns Trio traf), die unterschiedlichen Bedingungen für die Entstehung des Free Jazz in den USA und in Europa (Deutschland) allerdings weder hier noch später im Buch thematisiert. Im zweiten Kapitel (man fühlt sich versucht zu sagen, “In der zweiten Woche”) behandelt er vier Beispiele: Archie Shepps “Donaueschingen”, John Coltranes “Love Supreme”, Cecil Taylors “Candid Recordings”; und Bill Evans’ “Autumn Leaves” – letzteres ein Beispiel für die Ausweitung konventioneller Rahmenstrukturen des Jazz und die Entwicklung neuer Vokabeln im Jazzidiom, die Mazzola als musikalische “Gesten” bezeichnet. In weiteren Beispielen (etwa von Sun Ra oder dem Art Ensemble of Chicago), fragt er nach den Formen der musikalischen Kommunikation, der gestischen Interaktion und der daraus entstehenden “collective vibration”. Hier nun wird es philosophisch, wenn er “collaboratorive spaces” postuliert, die sich aus dem Flow der Interaktion und der gestischen Kommunikation ergäben. Im Free Jazz veranschaulicht er dies anhand Ornette Colemans Album “Free Jazz” sowie John Coltranes “Ascension”. Er spricht über die Faszination von “Time” und den Umgang von Free-Jazz-Musikern mit ihr sowie über die musikalische Geste als probates Mittel der musikalischen Entwicklung und als einer der wichtigsten Einflüsse auf die Wirkung der Musik beim Zuhörer. Und schließlich untersucht er die Bedeutung des Flow für das Entstehen oder besser für das Resultat einer intensiven Gruppendynamik. In einem Schlusskapitel propagiert Mazzola eine Zukunft für den Free Jazz, wobei er noch einmal klar macht, dass er diesen offenbar als ein recht klar umgrenztes Genre innerhalb der Jazzentwicklung zu begreifen scheint, und nicht als eine historische Etappe, und sagt dieser Stilrichtung eine Zukunft selbst in akademischer Umgebung voraus – vielleicht weil sich der Free Jazz, wie das Seminar, aus dem dieses Buch entstand, zeigt, mit interessanten Fragestellungen untersuchen lässt. Dem Buch hängt eine CD mit Improvisationen des Quartetts Tetrade bei, dem Mazzola (Klavier, Jeff Kaiser (Trompete), der kürzlich verstorbene Sirone (Bass) und Heinz Geissler (Schlagzeug) angehören.
uerino Mazzola im Vorwort seines Buches, das in der Reihe “Computational Music Science” erschien, und erklärt, dass er damit nicht einfach nur die komplexen Improvisationsmechanismen meine, sondern auch die dahinter liegende kulturelle Bedeutung dieser Musik. Sein Buch entstand aus einem Seminar an der University of Minnesota heraus, und das merkt man auch der Kapitelaufteilung des Buchs an, das sich ein wenig wie das Curriculum eines Semesters liest. Er und seine Mitautoren (zum Teil Studenten des Seminars, zum Teil mit dem auch als Pianist aktiven Mazzola assoziierte Musiker) beginnen mit grundlegenden Definitionen über die gesellschaftlichen, politischen und musikalischen Ursprünge der Free-Jazz-Bewegung. Mazzola untersucht ausgewählte Dokumente – Artikel, Interviews, Konzertmitschnitte –, um aus ihnen die Diskurse der 1960er Jahre herauszuarbeiten, wobei er sowohl auf Dokumente aus den USA wie aus Deutschland zurückgreift (letzteres in einer legendären Fernsehsendung von 1967, bei der Klaus Doldingers Quartett auf Peter Brötzmanns Trio traf), die unterschiedlichen Bedingungen für die Entstehung des Free Jazz in den USA und in Europa (Deutschland) allerdings weder hier noch später im Buch thematisiert. Im zweiten Kapitel (man fühlt sich versucht zu sagen, “In der zweiten Woche”) behandelt er vier Beispiele: Archie Shepps “Donaueschingen”, John Coltranes “Love Supreme”, Cecil Taylors “Candid Recordings”; und Bill Evans’ “Autumn Leaves” – letzteres ein Beispiel für die Ausweitung konventioneller Rahmenstrukturen des Jazz und die Entwicklung neuer Vokabeln im Jazzidiom, die Mazzola als musikalische “Gesten” bezeichnet. In weiteren Beispielen (etwa von Sun Ra oder dem Art Ensemble of Chicago), fragt er nach den Formen der musikalischen Kommunikation, der gestischen Interaktion und der daraus entstehenden “collective vibration”. Hier nun wird es philosophisch, wenn er “collaboratorive spaces” postuliert, die sich aus dem Flow der Interaktion und der gestischen Kommunikation ergäben. Im Free Jazz veranschaulicht er dies anhand Ornette Colemans Album “Free Jazz” sowie John Coltranes “Ascension”. Er spricht über die Faszination von “Time” und den Umgang von Free-Jazz-Musikern mit ihr sowie über die musikalische Geste als probates Mittel der musikalischen Entwicklung und als einer der wichtigsten Einflüsse auf die Wirkung der Musik beim Zuhörer. Und schließlich untersucht er die Bedeutung des Flow für das Entstehen oder besser für das Resultat einer intensiven Gruppendynamik. In einem Schlusskapitel propagiert Mazzola eine Zukunft für den Free Jazz, wobei er noch einmal klar macht, dass er diesen offenbar als ein recht klar umgrenztes Genre innerhalb der Jazzentwicklung zu begreifen scheint, und nicht als eine historische Etappe, und sagt dieser Stilrichtung eine Zukunft selbst in akademischer Umgebung voraus – vielleicht weil sich der Free Jazz, wie das Seminar, aus dem dieses Buch entstand, zeigt, mit interessanten Fragestellungen untersuchen lässt. Dem Buch hängt eine CD mit Improvisationen des Quartetts Tetrade bei, dem Mazzola (Klavier, Jeff Kaiser (Trompete), der kürzlich verstorbene Sirone (Bass) und Heinz Geissler (Schlagzeug) angehören.
(Wolfram Knauer, Juni 2010)
Il chitarrista di jazz. Charlie Christian e dintorni
Von Roberto G. Colombo
Genova 2009 (Erga Edizioni)
367 Seiten, 1 beiheftende CD, 25 Euro
ISBN: 978-88-8163-472-4
 Charlie Christian war einer der wichtigsten Gitarristen der Jazzgeschichte, weil er sein Instrument aus der reinen Begleitfunktion herauslöste und mit Melodieinstrumenten wie Saxophon oder Trompete auf eine Stufe stellte. Nur Django Reinhardt mag ähnlich einflussreich gewesen sein. Roberto G. Colombo hat nun ein Buch vorgelegt, in dem er dem Stil Charlie Christians auf die Spur kommen möchte, noch mehr aber dessen Einfluss auf andere Gitarristen des modernen Jazz. Eine analytische Beschreibung des Stils seines Helden mitsamt einzelner Transkriptionen findet sich seltsamerweise erst im letzten Kapitel, in dem Colombo Christians melodische, harmonische und rhythmische Sprache etwas näher untersucht. Der Hauptteil seines Buchs bezieht sich vor allem auf den Einfluss, den Christian etwa auf Musiker wie Barney Kessel und Tal Farlow, Jim Raney und Jim Hall, Kenny Burrell und Wes Montgomery und andere hatte, wobei er die hier genannten bewusst in Opposition zueinander bringt, um die unterschiedlichen stilistischen Wege herauszuarbeiten, die sie gegangen sind. Der gemeinsame Nenner, so Colombo, sei Charlie Christian gewesen, dessen Einfluss neben Django Reinhardts auch in Europa deutlich spürbar gewesen sei. In einem eigenen Kapitel über die elektrische Gitarre beschreibt er die Geschichte der elektrischen Verstärkung des Instruments und geht daneben auf andere frühe Vertreter der E-Gitarre ein, etwa die Hot String Bands des Western Swing jener Jahre oder den Posaunisten und Gitarristen Eddie Durham, die alle ihren eigenen Nachhall in Charlie Christians Spiel fanden. Das Buch bleibt eine eher trockene Lektüre, eine beiheftende CD enthält 42 Track Charlie Christians mit Benny Goodman genauso wie in diversen Jam Session-Zusammenhängen, in denen seine Nähe zum Bebop besonders gut zur Geltung kommt.
Charlie Christian war einer der wichtigsten Gitarristen der Jazzgeschichte, weil er sein Instrument aus der reinen Begleitfunktion herauslöste und mit Melodieinstrumenten wie Saxophon oder Trompete auf eine Stufe stellte. Nur Django Reinhardt mag ähnlich einflussreich gewesen sein. Roberto G. Colombo hat nun ein Buch vorgelegt, in dem er dem Stil Charlie Christians auf die Spur kommen möchte, noch mehr aber dessen Einfluss auf andere Gitarristen des modernen Jazz. Eine analytische Beschreibung des Stils seines Helden mitsamt einzelner Transkriptionen findet sich seltsamerweise erst im letzten Kapitel, in dem Colombo Christians melodische, harmonische und rhythmische Sprache etwas näher untersucht. Der Hauptteil seines Buchs bezieht sich vor allem auf den Einfluss, den Christian etwa auf Musiker wie Barney Kessel und Tal Farlow, Jim Raney und Jim Hall, Kenny Burrell und Wes Montgomery und andere hatte, wobei er die hier genannten bewusst in Opposition zueinander bringt, um die unterschiedlichen stilistischen Wege herauszuarbeiten, die sie gegangen sind. Der gemeinsame Nenner, so Colombo, sei Charlie Christian gewesen, dessen Einfluss neben Django Reinhardts auch in Europa deutlich spürbar gewesen sei. In einem eigenen Kapitel über die elektrische Gitarre beschreibt er die Geschichte der elektrischen Verstärkung des Instruments und geht daneben auf andere frühe Vertreter der E-Gitarre ein, etwa die Hot String Bands des Western Swing jener Jahre oder den Posaunisten und Gitarristen Eddie Durham, die alle ihren eigenen Nachhall in Charlie Christians Spiel fanden. Das Buch bleibt eine eher trockene Lektüre, eine beiheftende CD enthält 42 Track Charlie Christians mit Benny Goodman genauso wie in diversen Jam Session-Zusammenhängen, in denen seine Nähe zum Bebop besonders gut zur Geltung kommt.
Wolfram Knauer (Mai 2010)
All That Swedish Jazz. Zwölf schwedische Jazzstars erobern die Welt
von Lisbeth Axelsson
Bad Oeynhausen 2009 (jazzprezzo)
223 Seiten, 1 beiheftende CD, 35,00 Euro
ISBN: 978-3-9810250-9-5
 Hilfe die Schweden kommen! Oder die Norweger, die Dänen, die Finnen… Skandinavier jedenfalls, meint man, machen einen Großteil des Hypes, des Erfolgs des europäischen Jazz in den letzten Jahren aus. Nun, auf jeden Fall haben sie eine exzellente Musikerziehung von klein auf und bringen so hervorragende Musiker hervor, und auf jeden Fall verstehen sie sich aufs Marketing. Und so blättert es sich in diesem Buch, das im Original in schwedischer Sprache im Stockholmer Votum-Verlag erschienen ist, ein wenig wie im Katalog eines international sich erfolgreich vermarktenden Möbelhauses: bunt, lebendig, witzig. Lisbeth Axelsson hat für ihre Portraits von zwölf durchwegs jungen Musikerinnen und Musikern Fotos gesammelt, die diese nicht nur als Musiker, sondern auch als Privatmenschen zeigen: Viktoria Tolstoy etwa im Kreis ihrer Familie oder bei einem Treffen aller Tolstoy-Nachfahren (sie stammt ja bekanntlich tatsächlich aus der Familie des großen Schriftstellers), Lisen Rylander auf dem Segelboot, Magnus Coltrane Price mit Motorradhelm, Magnus Lindgren beim Wasserskifahren, Anders Öberg beim Joggen, Rigmor Gustafsson auf dem Fahrrad, Jon Fält beim Kücheputzen oder Karin Hammar im Fitnessstudio. Das Buch böte genügend Soff für eine Magisterarbeit darüber, wie die Musikerinnen und Musiker sich hier wohl darstellen wollen oder dargestellt worden, welche Inhalte allein die Ikonographie der Bilder vermittelt. Daneben stellt Lisbeth Axelsson biographische Texte, von O-Tönen durchzogen, Erinnerungen der Musiker darüber, wie sie zur Musik und wie zum Jazz kamen, was besonders herausfordernd ist am gewählten Beruf des Jazzmusikers und wo sie vielleicht noch hinwollen. Ach ja, die noch nicht genannten sind: Nils Landgren, Jan Lundgren, Peter Asplund und Martin Tingvall. Lesenswert ist das allemal, und, wie gesagt, ein Spaß machendes Bilderbuch außerdem. Der Verlag erkennt man kaum in Gestaltung und Papier – jazzprezzo macht sonst andere Bücher –: Dies ist deutlich eine Lizenzausgabe, bunt, gesund, frisch und … Lebst du noch, oder hörst du schon schwedischen Jazz?!
Hilfe die Schweden kommen! Oder die Norweger, die Dänen, die Finnen… Skandinavier jedenfalls, meint man, machen einen Großteil des Hypes, des Erfolgs des europäischen Jazz in den letzten Jahren aus. Nun, auf jeden Fall haben sie eine exzellente Musikerziehung von klein auf und bringen so hervorragende Musiker hervor, und auf jeden Fall verstehen sie sich aufs Marketing. Und so blättert es sich in diesem Buch, das im Original in schwedischer Sprache im Stockholmer Votum-Verlag erschienen ist, ein wenig wie im Katalog eines international sich erfolgreich vermarktenden Möbelhauses: bunt, lebendig, witzig. Lisbeth Axelsson hat für ihre Portraits von zwölf durchwegs jungen Musikerinnen und Musikern Fotos gesammelt, die diese nicht nur als Musiker, sondern auch als Privatmenschen zeigen: Viktoria Tolstoy etwa im Kreis ihrer Familie oder bei einem Treffen aller Tolstoy-Nachfahren (sie stammt ja bekanntlich tatsächlich aus der Familie des großen Schriftstellers), Lisen Rylander auf dem Segelboot, Magnus Coltrane Price mit Motorradhelm, Magnus Lindgren beim Wasserskifahren, Anders Öberg beim Joggen, Rigmor Gustafsson auf dem Fahrrad, Jon Fält beim Kücheputzen oder Karin Hammar im Fitnessstudio. Das Buch böte genügend Soff für eine Magisterarbeit darüber, wie die Musikerinnen und Musiker sich hier wohl darstellen wollen oder dargestellt worden, welche Inhalte allein die Ikonographie der Bilder vermittelt. Daneben stellt Lisbeth Axelsson biographische Texte, von O-Tönen durchzogen, Erinnerungen der Musiker darüber, wie sie zur Musik und wie zum Jazz kamen, was besonders herausfordernd ist am gewählten Beruf des Jazzmusikers und wo sie vielleicht noch hinwollen. Ach ja, die noch nicht genannten sind: Nils Landgren, Jan Lundgren, Peter Asplund und Martin Tingvall. Lesenswert ist das allemal, und, wie gesagt, ein Spaß machendes Bilderbuch außerdem. Der Verlag erkennt man kaum in Gestaltung und Papier – jazzprezzo macht sonst andere Bücher –: Dies ist deutlich eine Lizenzausgabe, bunt, gesund, frisch und … Lebst du noch, oder hörst du schon schwedischen Jazz?!
(Wolfram Knauer)
W.C. Handy. The Life and Times of the Man Who Made the Blues
von David Robertson
New York 2009 (Alfred A. Knopf)
286 Seiten, 27,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-307-26609-5
 W.C. Handy wurde als der Mann gefeiert, der den Blues erfunden habe, als “Father of the Blues”. Natürlich hat er das nicht getan – aber er hatte große Ohren, er hörte, was um ihn herum gesungen und gespielt wurde, er entwickelte ein Gespür für den populären Musikmarkt und er schrieb (oder kompilierte) einige der erfolgreichsten Blueskompositionen vor 1920. Er ist einer der großen Helden afro-amerikanischer Kulturgeschichte, ein Denkmal zu Lebzeiten, und bis heute präsent in den Titeln aus seiner Feder, den “St. Louis Blues”, “Beale Street Blues”, “Memphis Blues” und anderer Stücke, die weit über das Genre hinaus wirkten. David Robertson macht sich in seinem Buch auf die Suche nach dem Menschen William Christopher Handy und nach dem Umfeld, aus dem heraus er seiner Arbeit nachging. Er beschreibt ihn als Geschäftsmann, der sich nach Respekt von schwarzer wie weißer Seite sehnt, sein Geld aber im Vermarkten einer Musik verdient, die sich bewusst auf schwarze Roots stützt, der also quasi die “beiden Seelen” personifizierte, von denen W.E.B. Du Bois in seinem Buch “The Souls of Black Folk” schrieb. Handy wurde 1873 in einer Kleinstadt in Alabama geboren, acht Jahre nach der Emanzipation der schwarzen Sklaven. Sein Vater war Farmer und Pastor der lokalen AME Church. In der Schule erhielt er Musikunterricht, aber im richtigen Leben lernte er die wirkliche Musik kennen. Jim Turner, ein oft betrunkener Fiedler, machte ihn mit der Folk-Tradition der Gegend vertraut, Prototypen des späteren Blues. Er lernte heimlich Kornett, was von der Familie nicht gern gesehen wurde, die Musik, wenn überhaupt, nur in der Kirche duldete, und begann nach seinem High-School-Abschluss als Schulassistent im schwarzen Schulsystem seines County. 1892 machte er sich auf nach Chicago, wo damals die Weltausstellung stattfand und verdiente sich mit Freunden in einem Barbershop-Gesangsquartett ein wenig Geld. Im darauf folgenden Jahr zog er erst nach St. Louis, dann in andere Kleinstädte, schlug sich erst mit gelegentlichen Jobs, dann immerhin hauptberuflich mit Musik durch, als er in Evansville, Indiana, eine Brassband gründete. Von 1896 bis 1900 reiste er mit einer Minstrel-Show durch die Lande, und Robertson berichtet über einige der Szenen in der Show, in der sich weiße Schauspieler ihre Gesicht schwarz anmalten und sich über das Alltagsleben in der amerikanischen Provinz lustig machten. Aus heutiger Sicht war das alles eine herabwürdigende, rassistisch anmutende Show, an der sich schwarze Musiker gezwungenermaßen beteiligen mussten, um Geld zu verdienen. Daneben aber lernte Handy hier das Handwerkszeug für sein späteres Geschäft: Er lernte, was beim Publikum ankam, und wie man die Bedürfnisse eines ganz unterschiedlichen Publikums befriedigen konnte. 1900 spielte Handy ein Konzert im State Agricultural and Mechanical College for Negroes in Normal, Alabama, einer Reformschule im Sinne Booker T. Washingtons, und der Schulleiter engagierte ihn als Lehrer für Englisch und Musik. Als Handy in einem Schulkonzert Ragtimes und andere Titel spielte, die vielleicht eher in eine Minstrelshow gepasst hätten, bat man ihn, sich einen anderen Job zu suchen. Er ging wieder auf Minstrel-Tournee, und ließ sich dann in Clarksdale, Mississippi nieder, wo ihm ein Posten als Bandleader angeboten wurde. Diese Zeit war wohl besonders wichtig für Handy, den Melodiensammler, der sich die Musik der Farmarbeiter anhörte und viel davon in seinen späteren Kompositionen verwendete. 1905 zog er nach Memphis, spielte auf den Riverboats des Mississippi und schrieb sein erstes eigenes Stück, “Mr. Crump” (später “The Memphis Blues”). Dessen Copyright verkaufte er da noch für 50 Dollar; wenige Jahre später gründete er, klug geworden, zusammen mit Harry H. Pace den Musikverlag Pace & Handy. Robertson zeichnet den geschäftlichen Erfolg des Verlags nach und damit auch die erfolgreichen Kompositionen, die Handy in jenen Jahren veröffentlichte. 1917 hatte Handy ein Büro in Chicago eröffnet, aber tatsächlich zog es ihn nach New York, die Hauptstadt der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Als Musikverlag musste man ein Büro in New York haben, wo das Publikum in Musicals oder den Revuebühnen über Erfolg und Misserfolg der aktuellen Hits entschied. In seinem Büro trafen sich Bert Williams und Clarence Williams, Wilbur Sweatman und andere Größen des afro-amerikanischen Showbusiness. In den 1920er Jahren kam zum einträglichen Notengeschäft zusätzlich das neue Geschäft mit Schallplatten, Harry Pace entschied sich 1921, seinen eigenen Plattenverlag aufzumachen, und etliche der bislang bei beiden unter Vertrag stehenden Künstlern, darunter auch Fletcher Henderson, folgten ihm, statt bei Handy zu bleiben. Der wirkte auf die jungen Musiker inzwischen altbacken, unmodern; das Geschäft ging schlecht, und er profitierte kaum vom Boom schwarzer Musik in den frühen 1920er Jahren. 1924 traf er auf den Wall-Street-Anwalt Abbe Niles, der Handys und andere Blueskompositionen der Zeit liebte und an einem Artikel über den Blues arbeitete. Niles stand hinter dem Buchprojekt “Blues. An Anthology”, das 1926 erschien und Handy endgültig als “Father of the Blues” etablierte. Handy hatte noch weitere Ambitionen. Er, dessen Weg durch die Ideale sowohl Booker T. Washingtons wie auch W.E.B. Du Bois geprägt war, wollte eine veritable Kunstmusik schaffen, eine afro-amerikanische Symphonie. George Gershwin hatte ihm die Partitur seiner “Rhapsody in Blue” mit der Widmung versehen :”Für Mr. Handy, dessen frühe ‘Blue’ die Vorfahren für dieses Werk sind”. 1926 hörte Handy in der Aeolian Hall symphonische Arrangements über “St. Louis Blues” und “Beale Street Blues”; 1927 dirigierte er selbst George Antheils “Jazz Symphony” in der Carnegie Hall. In den 1930er Jahren wandte er sich in seiner Verlagsarbeit Negro Spirituals zu, trat ab und zu als Gast im Cotton Club auf (und spielte dort dann meist den “St. Louis Blues”) und veröffentlichte 1941 seine Autobiographie, “Father of the Blues”. 1943 hatte er einen folgenschweren Unfall, als er von der U-Bahn-Plattform stürzte und sich den Kopf verletzte. Danach war er blind, was ihn aber nicht davon abhielt, in der New Yorker Gesellschaft mitzumischen und sich, wo immer es ging, als Vater des Blues feiern zu lassen. 1956 wirkte er bei einem letzten öffentlichen Auftritt im Lewisohn Stadium in New York City mit, bei dem Leonard Bernstein ein Orchesterarrangement über den “St. Louis Blues” dirigierte. Zwei Jahre später starb W.C. Handy im Alter von 84 Jahren. Zur Trauerfeier kamen 150.000 Menschen, die die 138ste Straße in Harlem säumten, als Handys Sarg in die Abyssinian Baptist Church gebracht wurde. Robertsons Buch zeichnet Handys Lebensgeschichte mit allen Hochs und Tiefs nach, ist dabei, wie der Untertitel verspricht: eine Biographie mit Blick auf Leben und Zeit des W.C. Handy, nicht so sehr auf die Besonderheiten seiner Musik. Er erzählt die Ereignisse mit dem Blick für Einzelheiten (wenn er auch die immerhin nicht ganz unbedeutsame Identifikation zweier Personen auf einem Foto unterlässt, das Handy und seine zweite Frau zeigen, wie Handy unter dem Kichern und dem belustigten Grinsen von Dizzy Gillespie und Leonard Feather Dizzys gebogene Trompete befingert). Das Buch ist allemal eine lesenswerte Lektüre und gibt mit einem umfassenden Anmerkungsapparat die Möglichkeit zum weiteren Einstieg in die Erforschung beispielsweise des afro-amerikanischen Pubikationswesens im frühen 20sten Jahrhundert.
W.C. Handy wurde als der Mann gefeiert, der den Blues erfunden habe, als “Father of the Blues”. Natürlich hat er das nicht getan – aber er hatte große Ohren, er hörte, was um ihn herum gesungen und gespielt wurde, er entwickelte ein Gespür für den populären Musikmarkt und er schrieb (oder kompilierte) einige der erfolgreichsten Blueskompositionen vor 1920. Er ist einer der großen Helden afro-amerikanischer Kulturgeschichte, ein Denkmal zu Lebzeiten, und bis heute präsent in den Titeln aus seiner Feder, den “St. Louis Blues”, “Beale Street Blues”, “Memphis Blues” und anderer Stücke, die weit über das Genre hinaus wirkten. David Robertson macht sich in seinem Buch auf die Suche nach dem Menschen William Christopher Handy und nach dem Umfeld, aus dem heraus er seiner Arbeit nachging. Er beschreibt ihn als Geschäftsmann, der sich nach Respekt von schwarzer wie weißer Seite sehnt, sein Geld aber im Vermarkten einer Musik verdient, die sich bewusst auf schwarze Roots stützt, der also quasi die “beiden Seelen” personifizierte, von denen W.E.B. Du Bois in seinem Buch “The Souls of Black Folk” schrieb. Handy wurde 1873 in einer Kleinstadt in Alabama geboren, acht Jahre nach der Emanzipation der schwarzen Sklaven. Sein Vater war Farmer und Pastor der lokalen AME Church. In der Schule erhielt er Musikunterricht, aber im richtigen Leben lernte er die wirkliche Musik kennen. Jim Turner, ein oft betrunkener Fiedler, machte ihn mit der Folk-Tradition der Gegend vertraut, Prototypen des späteren Blues. Er lernte heimlich Kornett, was von der Familie nicht gern gesehen wurde, die Musik, wenn überhaupt, nur in der Kirche duldete, und begann nach seinem High-School-Abschluss als Schulassistent im schwarzen Schulsystem seines County. 1892 machte er sich auf nach Chicago, wo damals die Weltausstellung stattfand und verdiente sich mit Freunden in einem Barbershop-Gesangsquartett ein wenig Geld. Im darauf folgenden Jahr zog er erst nach St. Louis, dann in andere Kleinstädte, schlug sich erst mit gelegentlichen Jobs, dann immerhin hauptberuflich mit Musik durch, als er in Evansville, Indiana, eine Brassband gründete. Von 1896 bis 1900 reiste er mit einer Minstrel-Show durch die Lande, und Robertson berichtet über einige der Szenen in der Show, in der sich weiße Schauspieler ihre Gesicht schwarz anmalten und sich über das Alltagsleben in der amerikanischen Provinz lustig machten. Aus heutiger Sicht war das alles eine herabwürdigende, rassistisch anmutende Show, an der sich schwarze Musiker gezwungenermaßen beteiligen mussten, um Geld zu verdienen. Daneben aber lernte Handy hier das Handwerkszeug für sein späteres Geschäft: Er lernte, was beim Publikum ankam, und wie man die Bedürfnisse eines ganz unterschiedlichen Publikums befriedigen konnte. 1900 spielte Handy ein Konzert im State Agricultural and Mechanical College for Negroes in Normal, Alabama, einer Reformschule im Sinne Booker T. Washingtons, und der Schulleiter engagierte ihn als Lehrer für Englisch und Musik. Als Handy in einem Schulkonzert Ragtimes und andere Titel spielte, die vielleicht eher in eine Minstrelshow gepasst hätten, bat man ihn, sich einen anderen Job zu suchen. Er ging wieder auf Minstrel-Tournee, und ließ sich dann in Clarksdale, Mississippi nieder, wo ihm ein Posten als Bandleader angeboten wurde. Diese Zeit war wohl besonders wichtig für Handy, den Melodiensammler, der sich die Musik der Farmarbeiter anhörte und viel davon in seinen späteren Kompositionen verwendete. 1905 zog er nach Memphis, spielte auf den Riverboats des Mississippi und schrieb sein erstes eigenes Stück, “Mr. Crump” (später “The Memphis Blues”). Dessen Copyright verkaufte er da noch für 50 Dollar; wenige Jahre später gründete er, klug geworden, zusammen mit Harry H. Pace den Musikverlag Pace & Handy. Robertson zeichnet den geschäftlichen Erfolg des Verlags nach und damit auch die erfolgreichen Kompositionen, die Handy in jenen Jahren veröffentlichte. 1917 hatte Handy ein Büro in Chicago eröffnet, aber tatsächlich zog es ihn nach New York, die Hauptstadt der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Als Musikverlag musste man ein Büro in New York haben, wo das Publikum in Musicals oder den Revuebühnen über Erfolg und Misserfolg der aktuellen Hits entschied. In seinem Büro trafen sich Bert Williams und Clarence Williams, Wilbur Sweatman und andere Größen des afro-amerikanischen Showbusiness. In den 1920er Jahren kam zum einträglichen Notengeschäft zusätzlich das neue Geschäft mit Schallplatten, Harry Pace entschied sich 1921, seinen eigenen Plattenverlag aufzumachen, und etliche der bislang bei beiden unter Vertrag stehenden Künstlern, darunter auch Fletcher Henderson, folgten ihm, statt bei Handy zu bleiben. Der wirkte auf die jungen Musiker inzwischen altbacken, unmodern; das Geschäft ging schlecht, und er profitierte kaum vom Boom schwarzer Musik in den frühen 1920er Jahren. 1924 traf er auf den Wall-Street-Anwalt Abbe Niles, der Handys und andere Blueskompositionen der Zeit liebte und an einem Artikel über den Blues arbeitete. Niles stand hinter dem Buchprojekt “Blues. An Anthology”, das 1926 erschien und Handy endgültig als “Father of the Blues” etablierte. Handy hatte noch weitere Ambitionen. Er, dessen Weg durch die Ideale sowohl Booker T. Washingtons wie auch W.E.B. Du Bois geprägt war, wollte eine veritable Kunstmusik schaffen, eine afro-amerikanische Symphonie. George Gershwin hatte ihm die Partitur seiner “Rhapsody in Blue” mit der Widmung versehen :”Für Mr. Handy, dessen frühe ‘Blue’ die Vorfahren für dieses Werk sind”. 1926 hörte Handy in der Aeolian Hall symphonische Arrangements über “St. Louis Blues” und “Beale Street Blues”; 1927 dirigierte er selbst George Antheils “Jazz Symphony” in der Carnegie Hall. In den 1930er Jahren wandte er sich in seiner Verlagsarbeit Negro Spirituals zu, trat ab und zu als Gast im Cotton Club auf (und spielte dort dann meist den “St. Louis Blues”) und veröffentlichte 1941 seine Autobiographie, “Father of the Blues”. 1943 hatte er einen folgenschweren Unfall, als er von der U-Bahn-Plattform stürzte und sich den Kopf verletzte. Danach war er blind, was ihn aber nicht davon abhielt, in der New Yorker Gesellschaft mitzumischen und sich, wo immer es ging, als Vater des Blues feiern zu lassen. 1956 wirkte er bei einem letzten öffentlichen Auftritt im Lewisohn Stadium in New York City mit, bei dem Leonard Bernstein ein Orchesterarrangement über den “St. Louis Blues” dirigierte. Zwei Jahre später starb W.C. Handy im Alter von 84 Jahren. Zur Trauerfeier kamen 150.000 Menschen, die die 138ste Straße in Harlem säumten, als Handys Sarg in die Abyssinian Baptist Church gebracht wurde. Robertsons Buch zeichnet Handys Lebensgeschichte mit allen Hochs und Tiefs nach, ist dabei, wie der Untertitel verspricht: eine Biographie mit Blick auf Leben und Zeit des W.C. Handy, nicht so sehr auf die Besonderheiten seiner Musik. Er erzählt die Ereignisse mit dem Blick für Einzelheiten (wenn er auch die immerhin nicht ganz unbedeutsame Identifikation zweier Personen auf einem Foto unterlässt, das Handy und seine zweite Frau zeigen, wie Handy unter dem Kichern und dem belustigten Grinsen von Dizzy Gillespie und Leonard Feather Dizzys gebogene Trompete befingert). Das Buch ist allemal eine lesenswerte Lektüre und gibt mit einem umfassenden Anmerkungsapparat die Möglichkeit zum weiteren Einstieg in die Erforschung beispielsweise des afro-amerikanischen Pubikationswesens im frühen 20sten Jahrhundert.
Wolfram Knauer (Mai 2010)
Die unheimliche Maschine. Rasse und Repräsentation im Weimarer Kino
von Tobias Nagl
München 2009 (edition text + kritik)
827 Seiten, 49,00 Euro
ISBN: 798-3-88377-910-2
 In Jazzbüchern liest man oft vom Reiz des Exotischen, wenn von der Rezeption des frühen Jazz in Europa die Rede ist. Man verweist auf Bildende Künstler, Komponisten der klassischen Musiktradition und auch auf Schriftsteller, die afrikanischen oder asiatischen Einflüssen gegenüber offen standen, weil sie in ihnen Erweiterungsmöglichkeiten ihres eigenen künstlerischen Vokabulars sahen. Was dabei oft vergessen wird, ist ein differenzierter Blick darauf, wie Menschen anderer Hautfarbe tatsächlich in Europa wahrgenommen wurden und welche Mechanismen und/oder politischen Entwicklungen diese Wahrnehmung mit steuerten. Tobias Nagl stellt gleich in der Einleitung seines Buchs klar (und beruft such dabei auf Katrin Sieg): “Gerade die Extremität des wissenschaftlichen Rassismus in der deutschen Geschichte war es, die zusammen mit den widersprüchlichen Imperativen während der Demokratisierung des Landes den Diskurs um ‘Rasse’ und die Untersuchung seiner Nachwirkungen in offiziellen Kontexten tabuisierte.” Daher habe man es in Deutschland vorgezogen, mit Konzepten des “Anderen” oder auch des “Fremden” zu arbeiten, die allerdings seltsam unscharf blieben. Nagl arbeitet sich durch die Literatur zu Termini wie “Rasse” und “Rassismus”, stellt die relativ kurze koloniale Kultur Deutschlands und die postkoloniale Theorie gegenüber, und versteht seine eigene Arbeit, die Filmgeschichte, dabei als “Archäologie sozialer Praxis”. Dann arbeitet er sich anhand konkreter (Film-)Beispiele durch das wechselvolle Verhältnis der Deutschen zu Mitmenschen anderer Hautfarbe. Er thematisiert “Kolonialismus, Geschlecht und Rasse” im Film “Die Herrin der Welt” von 1919, den er in Verbindung zur Völkerschautradition jener Zeit setzt. Er referiert den Inhalt des Films sowie seine Rezeption in Deutschland und den missglückten Export des Films nach USA, berichtet aber auch über Rassismusproteste aus den Reihen des “Vereins chinesischer Studenten” in Berlin. Der Film “Die Schwarze Schmach” von 1921-23 dient Nagl zur Diskussion der Darstellung von Sexualität und der Reaktion von Zensur. Hier thematisiert er die Rheinlandbesetzung durch koloniale Regimenter der Franzosen nach dem Ersten Weltkrieg, die reichlich Stoff für eine rassistische deutsche Propaganda geliefert hatte, und vor dessen Hintergrund der Film zu sehen ist. Die Zensur kritisierte im Film genannte Fakten und Zahlen sah den Film als gefährliche rassistische Propaganda, die dazu führen könne, dass das deutsche Ansehen im Ausland Schaden nähme. Nagl zeigt Beispiele solcher Propaganda, etwa Briefverschlussmarken mit der Aufschrift “Versuchte Mutter m. Mischlingskind” oder mit der Abbildung dreier dürrer Kinder vor einem großen schwarzen Mann und der Aufschrift “Um einen Besatzungssoldaten zu ernähren müssen vier deutsche Kinder hungern!”. Weitere Kapitel befassen sich mit dem kolonialen Propagandafilm, mit Kulturfilmen über Afrika (Nebentitel “Kolonialrevisionismus und romantische Ethnografie” — hier geht es auch um das “Spektakel der Differenz”), mit dem Geschlechterverhältnis im kolonialen Spielfilm, dabei insbesondere schwarzen Frauenrollen im Weimarer Kino. Neben Menschen schwarzer Hautfarbe auf der Leinwand aber gab es auch eine schwarze deutsche Bevölkerung, gab es schwarze Schauspieler in Deutschland, denen Nagl ein eigenes Kapitel widmet. Er schildert den Alltag in der Filmbörse, in der koloniale Migranten sich als Komparsen fürs Kino bewarben. Ein Exkurs innerhalb dieses Kapitels zeichent die Karriere des Schauspielers Louis Brody in den 1920er genauso wie den 1930er Jahren nach, als er auch an Propagandafilmen des NS-Staats mitwirkte, etwa dem Film “Jud Süss” von 1940. Ein erster Jazzschwenk geschieht im kurzen Kapitel über den Schauspieler und Schlagzeuger Willy Allen, geboren als Wilhelm Panzer in Berlin, der im Film “Einbrecher” von 1930 mit Sidney Bechet zu sehen und hören ist. Das letzte Kapitel dann ist das Jazzforscher am direktesten ansprechende Kapitel, überschrieben “‘Afrika spricht!’ Modernismus, jazz und Minstrelsy”. Hier schildert Nagl den Erfolg schwarzer Revuen in der Folge der “Revue Nègre” mit Josephine Baker, Louis Douglas und der Claude Hopkins Band sowie der “Chocolate Kiddies Negro Revue” mit dem Orchester des Pianisten Sam Wooding. Beide Revue, schreibt Nagl, “boten keinen unvermittelten Ausdruck afroamerikanischer Kultur, sondern standen in der Tradition der bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Minstrel-Shows”, eine Aussage, die zumindest musikalisch in Frage zu stellen ist. Nagl beschreibt denunziatorische Attacken auf den Jazz als wilde und zu sexuellen Ausschweifungen einladende Musik, stellt aber auch fest, dass Jazz in deutschen Filmen eher eine geringe Rolle spielte. Afroamerikanische Musiker habe es in Deutschland zahlreich bereits seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts gegeben; und im Kaiserreich habe die Cakewalk-Mode auch Deutschland erfasst. “Die meisten Unterhaltungsmusiker, die in den unmittelbaren Nachkriegsjahren Jazz zu spielen versuchte, wussten jedoch nicht einmal genau, wie die Musik klang”, konstantiert Nagl und zeichnet dann die zunehmende Ernsthaftigkeit nach, mit der der Jazz rezipiert wurde, irgendwo zwischen Abscheu und exotischer Begeisterungswelle. Jazz spielte immerhin ab den Mitt-1920er Jahren eine größer werdende Rolle bei der Filmbegleitung, allerdings nicht in der “authentischen” Tradition des Hot-Jazz amerikanischer Prägung, sondern vor allem in der Tradition eines sinfonischen Jazz George Gershwins oder Paul Whitemans, wie er in Deutschland von Bands etwa um Bernard Etté oder Ernö Rapée gespielt wurde. Nagl beschreibt Josephine Bakers Siegeszug in Berlin und ihren Einfluss auf intellektuelle Verehrer und Schriftsteller. Anhand von Ernst Kreneks Jazz-Oper “Jonny spielt auf” thematisiert er die der Oper inheränte “Bedrohungsphantasie”: Ernst Krenek habe mit ihr alles andere als eine Verherrlichung des Jazz im Sinn gehabt. Im Jazzhass gehe es nicht nur um Musik und “rassische Invasion”, sondern auch um Ängste, die mit “Vorstellungen ausschweifender, transgressiver Sexualität” verbunden seien. Nagl verfolgt die Tiraden auf den Jazz von der Neuen Musik-Zeitung 1928 über Theodor W. Adorno bis zu Alfred Rosenberg und Wilhelm Fricks berüchtigtem Erlass ‘Wider die Negerkultur für deutsches Volkstum’. Er beschreibt die Rezeption einiger amerikanischer Filme mit afroamerikanischen Themen/Schauspielern sowie weitere Assoziationen, die mit Hilfe schwarzer Schauspieler transportiert werden sollten, etwa “moderne Exzentrik”. Schließlich wirft er noch einen Blick auf den Boxsport, in dem schwarze Athleten eine wichtige Rolle spielten, und seine Reflektion im Weimarer Kino. Und anhand des Tänzers Louis Douglas diskutiert er, wie die deutsche Linke mit dem Thema Hautfarbe / Rassismus umgeht. Nagls eindrucksvoll umfassendes Buch ist ein Standardwerk zur Rezeption afrikanischer wie afro-amerikanischer Kultur in Deutschland und erlaubt viele Erkenntnisse auch über die Bedingungen, in denen im Deutschland der 1920er und frühen 1930er Jahre Jazz gespielt und gehört wurde. Höchst empfehlenswert!
In Jazzbüchern liest man oft vom Reiz des Exotischen, wenn von der Rezeption des frühen Jazz in Europa die Rede ist. Man verweist auf Bildende Künstler, Komponisten der klassischen Musiktradition und auch auf Schriftsteller, die afrikanischen oder asiatischen Einflüssen gegenüber offen standen, weil sie in ihnen Erweiterungsmöglichkeiten ihres eigenen künstlerischen Vokabulars sahen. Was dabei oft vergessen wird, ist ein differenzierter Blick darauf, wie Menschen anderer Hautfarbe tatsächlich in Europa wahrgenommen wurden und welche Mechanismen und/oder politischen Entwicklungen diese Wahrnehmung mit steuerten. Tobias Nagl stellt gleich in der Einleitung seines Buchs klar (und beruft such dabei auf Katrin Sieg): “Gerade die Extremität des wissenschaftlichen Rassismus in der deutschen Geschichte war es, die zusammen mit den widersprüchlichen Imperativen während der Demokratisierung des Landes den Diskurs um ‘Rasse’ und die Untersuchung seiner Nachwirkungen in offiziellen Kontexten tabuisierte.” Daher habe man es in Deutschland vorgezogen, mit Konzepten des “Anderen” oder auch des “Fremden” zu arbeiten, die allerdings seltsam unscharf blieben. Nagl arbeitet sich durch die Literatur zu Termini wie “Rasse” und “Rassismus”, stellt die relativ kurze koloniale Kultur Deutschlands und die postkoloniale Theorie gegenüber, und versteht seine eigene Arbeit, die Filmgeschichte, dabei als “Archäologie sozialer Praxis”. Dann arbeitet er sich anhand konkreter (Film-)Beispiele durch das wechselvolle Verhältnis der Deutschen zu Mitmenschen anderer Hautfarbe. Er thematisiert “Kolonialismus, Geschlecht und Rasse” im Film “Die Herrin der Welt” von 1919, den er in Verbindung zur Völkerschautradition jener Zeit setzt. Er referiert den Inhalt des Films sowie seine Rezeption in Deutschland und den missglückten Export des Films nach USA, berichtet aber auch über Rassismusproteste aus den Reihen des “Vereins chinesischer Studenten” in Berlin. Der Film “Die Schwarze Schmach” von 1921-23 dient Nagl zur Diskussion der Darstellung von Sexualität und der Reaktion von Zensur. Hier thematisiert er die Rheinlandbesetzung durch koloniale Regimenter der Franzosen nach dem Ersten Weltkrieg, die reichlich Stoff für eine rassistische deutsche Propaganda geliefert hatte, und vor dessen Hintergrund der Film zu sehen ist. Die Zensur kritisierte im Film genannte Fakten und Zahlen sah den Film als gefährliche rassistische Propaganda, die dazu führen könne, dass das deutsche Ansehen im Ausland Schaden nähme. Nagl zeigt Beispiele solcher Propaganda, etwa Briefverschlussmarken mit der Aufschrift “Versuchte Mutter m. Mischlingskind” oder mit der Abbildung dreier dürrer Kinder vor einem großen schwarzen Mann und der Aufschrift “Um einen Besatzungssoldaten zu ernähren müssen vier deutsche Kinder hungern!”. Weitere Kapitel befassen sich mit dem kolonialen Propagandafilm, mit Kulturfilmen über Afrika (Nebentitel “Kolonialrevisionismus und romantische Ethnografie” — hier geht es auch um das “Spektakel der Differenz”), mit dem Geschlechterverhältnis im kolonialen Spielfilm, dabei insbesondere schwarzen Frauenrollen im Weimarer Kino. Neben Menschen schwarzer Hautfarbe auf der Leinwand aber gab es auch eine schwarze deutsche Bevölkerung, gab es schwarze Schauspieler in Deutschland, denen Nagl ein eigenes Kapitel widmet. Er schildert den Alltag in der Filmbörse, in der koloniale Migranten sich als Komparsen fürs Kino bewarben. Ein Exkurs innerhalb dieses Kapitels zeichent die Karriere des Schauspielers Louis Brody in den 1920er genauso wie den 1930er Jahren nach, als er auch an Propagandafilmen des NS-Staats mitwirkte, etwa dem Film “Jud Süss” von 1940. Ein erster Jazzschwenk geschieht im kurzen Kapitel über den Schauspieler und Schlagzeuger Willy Allen, geboren als Wilhelm Panzer in Berlin, der im Film “Einbrecher” von 1930 mit Sidney Bechet zu sehen und hören ist. Das letzte Kapitel dann ist das Jazzforscher am direktesten ansprechende Kapitel, überschrieben “‘Afrika spricht!’ Modernismus, jazz und Minstrelsy”. Hier schildert Nagl den Erfolg schwarzer Revuen in der Folge der “Revue Nègre” mit Josephine Baker, Louis Douglas und der Claude Hopkins Band sowie der “Chocolate Kiddies Negro Revue” mit dem Orchester des Pianisten Sam Wooding. Beide Revue, schreibt Nagl, “boten keinen unvermittelten Ausdruck afroamerikanischer Kultur, sondern standen in der Tradition der bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Minstrel-Shows”, eine Aussage, die zumindest musikalisch in Frage zu stellen ist. Nagl beschreibt denunziatorische Attacken auf den Jazz als wilde und zu sexuellen Ausschweifungen einladende Musik, stellt aber auch fest, dass Jazz in deutschen Filmen eher eine geringe Rolle spielte. Afroamerikanische Musiker habe es in Deutschland zahlreich bereits seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts gegeben; und im Kaiserreich habe die Cakewalk-Mode auch Deutschland erfasst. “Die meisten Unterhaltungsmusiker, die in den unmittelbaren Nachkriegsjahren Jazz zu spielen versuchte, wussten jedoch nicht einmal genau, wie die Musik klang”, konstantiert Nagl und zeichnet dann die zunehmende Ernsthaftigkeit nach, mit der der Jazz rezipiert wurde, irgendwo zwischen Abscheu und exotischer Begeisterungswelle. Jazz spielte immerhin ab den Mitt-1920er Jahren eine größer werdende Rolle bei der Filmbegleitung, allerdings nicht in der “authentischen” Tradition des Hot-Jazz amerikanischer Prägung, sondern vor allem in der Tradition eines sinfonischen Jazz George Gershwins oder Paul Whitemans, wie er in Deutschland von Bands etwa um Bernard Etté oder Ernö Rapée gespielt wurde. Nagl beschreibt Josephine Bakers Siegeszug in Berlin und ihren Einfluss auf intellektuelle Verehrer und Schriftsteller. Anhand von Ernst Kreneks Jazz-Oper “Jonny spielt auf” thematisiert er die der Oper inheränte “Bedrohungsphantasie”: Ernst Krenek habe mit ihr alles andere als eine Verherrlichung des Jazz im Sinn gehabt. Im Jazzhass gehe es nicht nur um Musik und “rassische Invasion”, sondern auch um Ängste, die mit “Vorstellungen ausschweifender, transgressiver Sexualität” verbunden seien. Nagl verfolgt die Tiraden auf den Jazz von der Neuen Musik-Zeitung 1928 über Theodor W. Adorno bis zu Alfred Rosenberg und Wilhelm Fricks berüchtigtem Erlass ‘Wider die Negerkultur für deutsches Volkstum’. Er beschreibt die Rezeption einiger amerikanischer Filme mit afroamerikanischen Themen/Schauspielern sowie weitere Assoziationen, die mit Hilfe schwarzer Schauspieler transportiert werden sollten, etwa “moderne Exzentrik”. Schließlich wirft er noch einen Blick auf den Boxsport, in dem schwarze Athleten eine wichtige Rolle spielten, und seine Reflektion im Weimarer Kino. Und anhand des Tänzers Louis Douglas diskutiert er, wie die deutsche Linke mit dem Thema Hautfarbe / Rassismus umgeht. Nagls eindrucksvoll umfassendes Buch ist ein Standardwerk zur Rezeption afrikanischer wie afro-amerikanischer Kultur in Deutschland und erlaubt viele Erkenntnisse auch über die Bedingungen, in denen im Deutschland der 1920er und frühen 1930er Jahre Jazz gespielt und gehört wurde. Höchst empfehlenswert!
(Wolfram Knauer, April 2010)
Musikszene Schweiz. Begegnungen mit Menschen und Orten
herausgegeben von Christoph Merki
Zürich 2009 (Chronos Verlag)
692 Seiten, 38 Euro
ISBN: 978-3-0340-0942-3
 “Musikszene Schweiz” will die Schweiz als Musikland darstellen, in seiner ganzen Fülle zwischen Volks-, Pop- und Kunstmusik, und auf sehr direktem Wege über Gespräche mit Musikmachern und -ermöglichern und Reportagen über Orte, an denen Musik stattfindet. Der Rundumschlag ist weit: Musical; Gregorianik; Mundart-Rap; volkstümliche Musik (wobei dieser Begriff hier offenbar anders als in Deutschland gebraucht wird, wo er mehr für die Schlagervariante der Volksmusikindustrie steht, während Franz-Xaver Nager, der sich in diesem Buch mit dem Thema beschäftigt, die ursprüngliche Volksmusik und ihre heutige Pflege meint); Oper; Worldmusic (bei der sich Marianne Berner in ihrem Bericht über Afropfingsten-Festival nicht die “Vorläufer” afrikanischer Musik in der Schweiz erwähnt, als das Land in den frühen 1960er Jahren Anlaufstelle für viele südafrikanische Musiker im Exil war); Internetsounds; Fußballgesänge; Alte Musik; “Jazz und anderes mehr” (über das Montreux Jazz Festival); Schlager; Punk; Filmmusik; Jodelgesang; Berner Mundartrock; Musiktherapie; Neue Musik; Blues; Operette; “Megarock und Pop”, Chorgesang; Free Jazz (ein Interview mit Patrik Landolf über das Unerhört-Festival in Zürich); “Die andere Musik” (über aktuelle alternative Musikformen); Gospel; Klassik am Lucerne Festival; Unterhaltungs- und Tanzmusik; “Jazz aus der Schweiz” (über das Schaffhauser Jazzfestival); Theatermusik; Rock/Pop bei Musicstar (über den gleichnamigen SF DRS-Sender); Reggae; Alpentöne; “Traditioneller Jazz” (über das Festival JazzAscona); Country Music; “Immigrantenmusik (Balkan)”; Blasmusik; Chanson und frankophone Musik; Techno; Orgelmusik; sowie “Musik der Kulturen der Welt”. Das Buch ist ein gelungener Überblick über ganz unterschiedliche Seiten eines bunten Musiklebens, eine Dokumentation des Status Quo einer Szene zwischen Tradition und Avantgarde, zwischen Etabliertheit und Suche nach dem eigenen Platz.
“Musikszene Schweiz” will die Schweiz als Musikland darstellen, in seiner ganzen Fülle zwischen Volks-, Pop- und Kunstmusik, und auf sehr direktem Wege über Gespräche mit Musikmachern und -ermöglichern und Reportagen über Orte, an denen Musik stattfindet. Der Rundumschlag ist weit: Musical; Gregorianik; Mundart-Rap; volkstümliche Musik (wobei dieser Begriff hier offenbar anders als in Deutschland gebraucht wird, wo er mehr für die Schlagervariante der Volksmusikindustrie steht, während Franz-Xaver Nager, der sich in diesem Buch mit dem Thema beschäftigt, die ursprüngliche Volksmusik und ihre heutige Pflege meint); Oper; Worldmusic (bei der sich Marianne Berner in ihrem Bericht über Afropfingsten-Festival nicht die “Vorläufer” afrikanischer Musik in der Schweiz erwähnt, als das Land in den frühen 1960er Jahren Anlaufstelle für viele südafrikanische Musiker im Exil war); Internetsounds; Fußballgesänge; Alte Musik; “Jazz und anderes mehr” (über das Montreux Jazz Festival); Schlager; Punk; Filmmusik; Jodelgesang; Berner Mundartrock; Musiktherapie; Neue Musik; Blues; Operette; “Megarock und Pop”, Chorgesang; Free Jazz (ein Interview mit Patrik Landolf über das Unerhört-Festival in Zürich); “Die andere Musik” (über aktuelle alternative Musikformen); Gospel; Klassik am Lucerne Festival; Unterhaltungs- und Tanzmusik; “Jazz aus der Schweiz” (über das Schaffhauser Jazzfestival); Theatermusik; Rock/Pop bei Musicstar (über den gleichnamigen SF DRS-Sender); Reggae; Alpentöne; “Traditioneller Jazz” (über das Festival JazzAscona); Country Music; “Immigrantenmusik (Balkan)”; Blasmusik; Chanson und frankophone Musik; Techno; Orgelmusik; sowie “Musik der Kulturen der Welt”. Das Buch ist ein gelungener Überblick über ganz unterschiedliche Seiten eines bunten Musiklebens, eine Dokumentation des Status Quo einer Szene zwischen Tradition und Avantgarde, zwischen Etabliertheit und Suche nach dem eigenen Platz.
(Wolfram Knauer, April 2010)
Swingingly yours Ilse Storb. Love and Peace
von Ute Büchter-Römer
Duisburg 2009 (NonEM Verlag)
112 Seiten + beigeheftete CD, 15,00 Euro
ISBN: 978-3-935744-09-6
 Ilse Storb war nie eine stille, sondern immer eine laute Kämpferin für den Jazz: als “Europas einzige Jazzprofessorin”, wie sie sich selbst gern bezeichnete, als Autorin mehrerer Sachbücher zum Jazz, als Gründerin des Jazzlabors an der Gesamthochschule, später Universität Duisburg, als Verfechterin eines musikalischen Dialogs der Kulturen, und als Workshopleiterin, die sich sicher war, dass man von Menschen anderer Herkunft viel lernen kann und die immer auf die Offenheit drängte, das “Fremde” als Einfluss auf sich wirken zu lassen. Ute Büchter-Römer hat aus den Daten und Fakten ihres Lebens eine Biographie zusammenstellt, in der der Weg von der klassischen Pianistin zur Jazzprofessorin allerdings nur halb so begeisternd nachvollzogen wird wie auf der beiheftenden CD, einer WDR5-Sendung aus dem Jahr 2002, in der die ganze Wucht der weit über die Jazzgrenzen bekannten Musikwissenschaftlerin zu spüren ist. Büchter-Römer rekapituliert die Lebensgeschichte, fasst die wichtigsten Veröffentlichungen Storbs zusammen, schreibt über Medienauftritte in Rundfunk wie Fernsehen (ja, auch über jene legendäre Stefan-Raab-Sendung), über Konzertreisen und Festivals, über Storbs Liebe zu zwei ihrer wichtigsten Sujets: der Musik von Louis Armstrong und Dave Brubeck. Die Biographie ist ein Geschenk zum 80sten Geburtstag; dementsprechend ist kritische Distanz weniger gefragt. Aber Ilse Storb ist eh, wie man schnell merkt, ein Gesamtkunstwerk, dem man in einem Buch allein kaum beikommt. Eine CD muss mindestens dabeiheften, besser noch hätte wahrscheinlich eine DVD dazugehört. Parallel erschien außerdem eine Festschrift (siehe den nächsten Beitrag).
Ilse Storb war nie eine stille, sondern immer eine laute Kämpferin für den Jazz: als “Europas einzige Jazzprofessorin”, wie sie sich selbst gern bezeichnete, als Autorin mehrerer Sachbücher zum Jazz, als Gründerin des Jazzlabors an der Gesamthochschule, später Universität Duisburg, als Verfechterin eines musikalischen Dialogs der Kulturen, und als Workshopleiterin, die sich sicher war, dass man von Menschen anderer Herkunft viel lernen kann und die immer auf die Offenheit drängte, das “Fremde” als Einfluss auf sich wirken zu lassen. Ute Büchter-Römer hat aus den Daten und Fakten ihres Lebens eine Biographie zusammenstellt, in der der Weg von der klassischen Pianistin zur Jazzprofessorin allerdings nur halb so begeisternd nachvollzogen wird wie auf der beiheftenden CD, einer WDR5-Sendung aus dem Jahr 2002, in der die ganze Wucht der weit über die Jazzgrenzen bekannten Musikwissenschaftlerin zu spüren ist. Büchter-Römer rekapituliert die Lebensgeschichte, fasst die wichtigsten Veröffentlichungen Storbs zusammen, schreibt über Medienauftritte in Rundfunk wie Fernsehen (ja, auch über jene legendäre Stefan-Raab-Sendung), über Konzertreisen und Festivals, über Storbs Liebe zu zwei ihrer wichtigsten Sujets: der Musik von Louis Armstrong und Dave Brubeck. Die Biographie ist ein Geschenk zum 80sten Geburtstag; dementsprechend ist kritische Distanz weniger gefragt. Aber Ilse Storb ist eh, wie man schnell merkt, ein Gesamtkunstwerk, dem man in einem Buch allein kaum beikommt. Eine CD muss mindestens dabeiheften, besser noch hätte wahrscheinlich eine DVD dazugehört. Parallel erschien außerdem eine Festschrift (siehe den nächsten Beitrag).
(Wolfram Knauer, März 2010)
Rastlose Brückenbauerin. Festschrift zum 80. Geburtstag von Ilse Storb
herausgegeben von Ulrich J. Blomann & Hans-Joachim Heßler
Duisburg 2009 (NonEM Verlag)
437 Seiten, 45 Euro
ISBN: 978-3-935744-10-2
 Ulrich J. Blomann und Hans-Joachim Heßler stellten zum 80. Geburtstag von “Europas einziger Jazzprofessorin” eine Sammlung von Aufsätzen zusammen, die sich mit unterschiedlichen Themenfeldern auseinandersetzen, die Ilse Storb in ihrer langen Berufskarriere als Pianistin, Musikwissenschaftlerin, Pädagogin und Hochschullehrerin irgendwann einmal gestreift hat. Für den Bereich ihrer größten Liebe, nämlich die Jazz- und Popularmusikforschung, befasst sich Ute Büchter-Römers mit der Änderung des Stimmideals von “Belcanto zum Rap”, schreibt Alfons Michael Dauer über die “Lineare Mehrstimmigkeit im alten Gospel” und Franz Kerschbaumer über impressionistische Strukturen (Strukturen?) im Jazz. Karsten Mützelfeldt trägt zwei Sendemanuskripte bei, eines über Jazz in Vietnam, das andere über Gunther Schuller; und Gudrun Endress ein Interview mit McCoy Tyner. Es gibt Beiträge zur Neuen Musik, zur Musikethnologie (erwähnenswert insbesondere Gerhard Kubiks Beitrag über “Das ‘Eigene’ und das ‘Fremde'”) und zur Musiksoziologie sowie einen ausführlichen theologischen Exkurs von Ute Ranke-Heinemann zum Thema “Die Hölle”. Schließlich finden sich jede Menge persönliche Gratulationen von Freunden, Kollegen, Mitstreitern über viele Jahrzehnte. Nicht alles hat mit Musik zu tun, aber alles irgendwie mit Ilse Storb, und vieles mit dem Titel des Buchs, dem “Brückenbauen” zwischen Stilen, Genres, Kulturen. Das Buch endet mit einem Interview mit der Jubilarin darüber, warum es in Deutschland für Frauen so schwer ist, eine Karriere zu machen, wie sie, Ilse Storb, sie gemacht hatte. Es ist bezeichnend, und durchaus ein Kompliment, dass dabei auch auf dem Papier die Lebendigkeit durchkommt, die Ilse Storb auszeichnet.
Ulrich J. Blomann und Hans-Joachim Heßler stellten zum 80. Geburtstag von “Europas einziger Jazzprofessorin” eine Sammlung von Aufsätzen zusammen, die sich mit unterschiedlichen Themenfeldern auseinandersetzen, die Ilse Storb in ihrer langen Berufskarriere als Pianistin, Musikwissenschaftlerin, Pädagogin und Hochschullehrerin irgendwann einmal gestreift hat. Für den Bereich ihrer größten Liebe, nämlich die Jazz- und Popularmusikforschung, befasst sich Ute Büchter-Römers mit der Änderung des Stimmideals von “Belcanto zum Rap”, schreibt Alfons Michael Dauer über die “Lineare Mehrstimmigkeit im alten Gospel” und Franz Kerschbaumer über impressionistische Strukturen (Strukturen?) im Jazz. Karsten Mützelfeldt trägt zwei Sendemanuskripte bei, eines über Jazz in Vietnam, das andere über Gunther Schuller; und Gudrun Endress ein Interview mit McCoy Tyner. Es gibt Beiträge zur Neuen Musik, zur Musikethnologie (erwähnenswert insbesondere Gerhard Kubiks Beitrag über “Das ‘Eigene’ und das ‘Fremde'”) und zur Musiksoziologie sowie einen ausführlichen theologischen Exkurs von Ute Ranke-Heinemann zum Thema “Die Hölle”. Schließlich finden sich jede Menge persönliche Gratulationen von Freunden, Kollegen, Mitstreitern über viele Jahrzehnte. Nicht alles hat mit Musik zu tun, aber alles irgendwie mit Ilse Storb, und vieles mit dem Titel des Buchs, dem “Brückenbauen” zwischen Stilen, Genres, Kulturen. Das Buch endet mit einem Interview mit der Jubilarin darüber, warum es in Deutschland für Frauen so schwer ist, eine Karriere zu machen, wie sie, Ilse Storb, sie gemacht hatte. Es ist bezeichnend, und durchaus ein Kompliment, dass dabei auch auf dem Papier die Lebendigkeit durchkommt, die Ilse Storb auszeichnet.
(Wolfram Knauer, März 2010)
From Harlem to Hollywood. My Life in Music
von Van Alexander & Stephen Frattalone
Albany/GA 2009 (BearManor Media)
197 Seiten, 19,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-59393-451-4
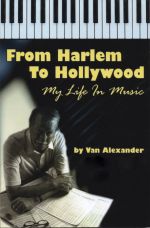 Van Alexander gehört nicht gerade zu den bekannten Namen der Jazzgeschichte. Man hat von ihm als Bandleader gehört, und wenn man sich gut auskennt, weiß man, dass er einst Arrangeur für Chick Webbs Band war und das Arrangement zu “A-Tisket, A-Tasket” geschrieben hat. In seiner Autobiographie erzählt Alexander nun seine Geschichte im Musikgeschäft. Alexander wurde 1915 in der Mitte Harlems geboren, das damals noch nicht wie wenige Jahre später Zentrum des schwarzen Amerikas war. Sein Vater war ein aus Ungarn emigrierter Jude, seine Mutter entstammte einer ursprünglich aus Rotterdam eingewanderten Familie und war regelmäßig als Pianistin in einem frühen lokalen Rundfunksender zu hören. Sie war zugleich Vans erste Klavierlehrerin. Er ging zur George Washington High School, und hörte abends die populären Swing-Bigbands im Radio, Paul Whiteman, Benny Goodman, die Casa Loma Band mit Glen Gray, Louis Armstrong, und hätte sich nicht träumen lassen später einmal für all diese Arrangements zu schreiben. Bald stellte er eine achtköpfige Band zusammen und machte seine ersten Gehversuche als Arrangeur. Nach seinem Schulabschluss war klar, dass dies seine Profession sein würde. Er nahm zusätzlichen Unterricht an der Columbia University sowie bei einigen Privatlehrern, die ihn in die Geheimnisse von Arrangement und Orchestrierung einweihten. Im Savoy Ballroom hörte er einige der angesagtesten Bands seiner Zeit und traute sich im Februar 1936, Chick Webb ein paar Arrangements mitzubringen. Webbs Band aber probte nicht etwa vor, sondern nach dem Job, und bis sie andere Arrangements von Musikern in der Band geprobt hatten, wurde es 5 Uhr morgens. Webb kaufte zwei Arrangements für 20 Dollar und engagierte Alexander kurz darauf für 75 Dollar pro Woche, jeweils drei Arrangements zu schreiben und für die Band zu kopieren. Webb empfahl ihn außerdem an Benny Goodman weiter, und Alexander erinnert sich lebhaft an die legendäre Big Band Battle zwischen Goodmans und Webbs Bands im Mai 1937. Wer den Namen Alexanders in den Diskographien Webbs vermisst, dem sei erklärt, dass Alexander damals noch unter seinem richtigen Namen Al Feldman firmierte und erst mit der Gründung seines eigenen Orchesters aus seinen zwei Vornamen seinen neuen Namen zusammensetzte. Ein eigenes Kapitel widmet Alexander der Entstehungsgeschichte seines All-Time-Greatest-Hits, “A-Tisket, A-Tasket”. Alexander erzählt von seinen Erfahrungen als weißer Arrangeur für eine schwarze Band, von Bandmusikern wie Taft Jordan oder Louie Jordan. Noch vor Webbs Tod verließ Alexander allerdings die Band und startete ein eigenes Orchester. Alexanders Vorbild war die Band von Isham Jones, und bald spielte die Band in den großen Ballsälen der Ostküste. Alexanders Orchester gehörte sicher nicht zu den großen Bands der Swingära, aber seine Darstellung wirft dennoch ein wenig Licht auf die Realität des Musikgeschäfts jener Jahre. Nach dem Krieg zog es Alexander nach Kalifornien, wo er für Bing Crosbys Bruder Bob eine neue Band aufzog. Nach nur drei Monaten feuerte Crosby ihn aus persönlichen Gründen und Alexander verklagte ihn und erhielt ein Jahresgehalt Entschädigung. In Kalifornien erhielt Alexander bald Arbeit als Arrangeur für das Plattenlabel Capitol sowie für Film und Fernsehen. Unter anderem schrieb er Musik für erfolgreiche Shows wie “I Dream of Jeannie” und “Bewitched”. Für seinen Freund Les Brown schrieb er in außerdem Arrangements für die “Dean Martin Show”. Alexander erzählt amüsante Anekdoten über all die Größen des Jazz und Showbusiness, mit denen er über die Jahrzehnte gearbeitet hat, und am Ende noch ein paar Stories von seinem Hobby, dem Golfspielen. Eine Diskographie der Aufnahmen seiner eigenen Bands, von Charles Garrod und Bill Korst bereits 1991 veröffentlicht, beschließt das Buch, das einen etwas anderen, sehr persönlichen, sicher auch sehr subjektiven und oft rosaroten Blick auf die Welt von Jazz und Entertainment wirft.
Van Alexander gehört nicht gerade zu den bekannten Namen der Jazzgeschichte. Man hat von ihm als Bandleader gehört, und wenn man sich gut auskennt, weiß man, dass er einst Arrangeur für Chick Webbs Band war und das Arrangement zu “A-Tisket, A-Tasket” geschrieben hat. In seiner Autobiographie erzählt Alexander nun seine Geschichte im Musikgeschäft. Alexander wurde 1915 in der Mitte Harlems geboren, das damals noch nicht wie wenige Jahre später Zentrum des schwarzen Amerikas war. Sein Vater war ein aus Ungarn emigrierter Jude, seine Mutter entstammte einer ursprünglich aus Rotterdam eingewanderten Familie und war regelmäßig als Pianistin in einem frühen lokalen Rundfunksender zu hören. Sie war zugleich Vans erste Klavierlehrerin. Er ging zur George Washington High School, und hörte abends die populären Swing-Bigbands im Radio, Paul Whiteman, Benny Goodman, die Casa Loma Band mit Glen Gray, Louis Armstrong, und hätte sich nicht träumen lassen später einmal für all diese Arrangements zu schreiben. Bald stellte er eine achtköpfige Band zusammen und machte seine ersten Gehversuche als Arrangeur. Nach seinem Schulabschluss war klar, dass dies seine Profession sein würde. Er nahm zusätzlichen Unterricht an der Columbia University sowie bei einigen Privatlehrern, die ihn in die Geheimnisse von Arrangement und Orchestrierung einweihten. Im Savoy Ballroom hörte er einige der angesagtesten Bands seiner Zeit und traute sich im Februar 1936, Chick Webb ein paar Arrangements mitzubringen. Webbs Band aber probte nicht etwa vor, sondern nach dem Job, und bis sie andere Arrangements von Musikern in der Band geprobt hatten, wurde es 5 Uhr morgens. Webb kaufte zwei Arrangements für 20 Dollar und engagierte Alexander kurz darauf für 75 Dollar pro Woche, jeweils drei Arrangements zu schreiben und für die Band zu kopieren. Webb empfahl ihn außerdem an Benny Goodman weiter, und Alexander erinnert sich lebhaft an die legendäre Big Band Battle zwischen Goodmans und Webbs Bands im Mai 1937. Wer den Namen Alexanders in den Diskographien Webbs vermisst, dem sei erklärt, dass Alexander damals noch unter seinem richtigen Namen Al Feldman firmierte und erst mit der Gründung seines eigenen Orchesters aus seinen zwei Vornamen seinen neuen Namen zusammensetzte. Ein eigenes Kapitel widmet Alexander der Entstehungsgeschichte seines All-Time-Greatest-Hits, “A-Tisket, A-Tasket”. Alexander erzählt von seinen Erfahrungen als weißer Arrangeur für eine schwarze Band, von Bandmusikern wie Taft Jordan oder Louie Jordan. Noch vor Webbs Tod verließ Alexander allerdings die Band und startete ein eigenes Orchester. Alexanders Vorbild war die Band von Isham Jones, und bald spielte die Band in den großen Ballsälen der Ostküste. Alexanders Orchester gehörte sicher nicht zu den großen Bands der Swingära, aber seine Darstellung wirft dennoch ein wenig Licht auf die Realität des Musikgeschäfts jener Jahre. Nach dem Krieg zog es Alexander nach Kalifornien, wo er für Bing Crosbys Bruder Bob eine neue Band aufzog. Nach nur drei Monaten feuerte Crosby ihn aus persönlichen Gründen und Alexander verklagte ihn und erhielt ein Jahresgehalt Entschädigung. In Kalifornien erhielt Alexander bald Arbeit als Arrangeur für das Plattenlabel Capitol sowie für Film und Fernsehen. Unter anderem schrieb er Musik für erfolgreiche Shows wie “I Dream of Jeannie” und “Bewitched”. Für seinen Freund Les Brown schrieb er in außerdem Arrangements für die “Dean Martin Show”. Alexander erzählt amüsante Anekdoten über all die Größen des Jazz und Showbusiness, mit denen er über die Jahrzehnte gearbeitet hat, und am Ende noch ein paar Stories von seinem Hobby, dem Golfspielen. Eine Diskographie der Aufnahmen seiner eigenen Bands, von Charles Garrod und Bill Korst bereits 1991 veröffentlicht, beschließt das Buch, das einen etwas anderen, sehr persönlichen, sicher auch sehr subjektiven und oft rosaroten Blick auf die Welt von Jazz und Entertainment wirft.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Analyser le Jazz
von Laurent Cugny
Paris 2009 (Outre Mesure)
576 Seiten, 44 Euro
ISBN: 978-2-907891-44-2
 Laurent Cugny ist Pianist, Arrangeur und Musikwissenschaftler und hat mit seinem Buch “Analyser le Jazz” ein Werk vorgelegt, in dem er versucht, die musikwissenschaftliche Herangehensweise an den Jazz zu strukturieren. Was ist überhaupt Jazz, fragt er zu Beginn, wie ist er zu definieren und wie kann man seine verschiedenen Komponenten analysieren. Wie lassen sich die Wandlungen der Jazzgeschichte analytisch beschreiben, welche Begriffe sind angemessen, welche müssen einer spezifischen Definition unterworfen werden? Wie geht man mit analytischen Begriffen um, die bereits von der konventionellen Musikwissenschaft belegt sind, etwa Komposition, Improvisation, Form, Struktur etc. In welcher Beziehung steht die Oralität der Überlieferung in afro-amerikanischer Musik zur Schriftlichkeit einer jeden analytischen Herangehensweise?
Laurent Cugny ist Pianist, Arrangeur und Musikwissenschaftler und hat mit seinem Buch “Analyser le Jazz” ein Werk vorgelegt, in dem er versucht, die musikwissenschaftliche Herangehensweise an den Jazz zu strukturieren. Was ist überhaupt Jazz, fragt er zu Beginn, wie ist er zu definieren und wie kann man seine verschiedenen Komponenten analysieren. Wie lassen sich die Wandlungen der Jazzgeschichte analytisch beschreiben, welche Begriffe sind angemessen, welche müssen einer spezifischen Definition unterworfen werden? Wie geht man mit analytischen Begriffen um, die bereits von der konventionellen Musikwissenschaft belegt sind, etwa Komposition, Improvisation, Form, Struktur etc. In welcher Beziehung steht die Oralität der Überlieferung in afro-amerikanischer Musik zur Schriftlichkeit einer jeden analytischen Herangehensweise?
Cugnys Ziel ist es eine Art Fahrplan zur analytischen Herangehensweise an Jazz zu geben. Weder die Methoden der klassischen Musikwissenschaft noch die der Musikethnologie, meint er, seien dem Jazz als einer improvisierten Musik wirklich angemessen. Um Jazz zu analysieren, reiche es nicht aus, bloß auf musikalische Strukturen oder motivische Beziehungen zu schauen; man müsse daneben jede Menge weiterer expressiver Techniken berücksichtigen.
In einem ersten Großkapitel untersucht Cugny das Jazz-Œuvre, wie man also Musik als “Text” behandeln kann, wie sich komponierte Strukturen, die Bedeutung von Improvisation und analytische Strukturen beschreiben lassen. Er unterscheidet zwischen der Analyse vorausbestimmter Faktoren (“moment avant”), etwa der Herkunft und Geschichte der zugrunde liegenden Komposition und ihrer formalen und harmonischen Struktur, sowie der Analyse progressiver Faktoren (“moment après”), unter denen er die Entwicklung einer Interpretation und/oder Improvisation versteht. In einem zweiten Großkapitel betrachtet Cugny dann die verschiedenen Parameter, die sich analysieren lassen: Harmonik, Rhythmik, Melodik, Form und Sound. Im dritten Teil schließlich beschäftigt sich Cugny mit der Geschichte der Jazzanalyse. Er unterscheidet rein harmonische, melodische, rhythmische oder formale Analysen, Analysen, die sich auf einzelne Soli beschränken, vergleichende Analysen und so weiter, und gibt dem Leser einen Leitfaden an die Hand, wie er unterschiedliche analytischen Werkzeuge für seine eigenen Zwecke verwenden kann. Er beschreibt die Möglichkeiten und Probleme der Transkription für die musikalische Analyse und gibt Beispiele für stilistische, semiotische und beschreibende Analysen.
Cugnys Buch ist mit weit über 500 Seiten keine leichte Lektüre, sondern eher eine trockene Studie, für die wenigsten Leser in einem Stück zu konsumieren. Man kann darüber streiten, ob eine Strukturierung analytischer Ansätze, wie er sie anbietet, überhaupt sinnvoll ist oder ob es nicht viel mehr Sinn macht, auf die zu analysierende Musik von Fall zu Fall zu reagieren und dabei auf diejenigen konkreten Dinge Bezug zu nehmen, die die Fragestellung hergibt, mit der man an das jeweilige Stück Musik herangeht. Hier scheint Cugnys Methodik eher ein Leitfaden für angehende Jazzanalytiker zu sein, der diese aber schnell auf die falsche Fährte bringen kann, wenn sie vor lauter Analyse nämlich die Notwendigkeit der Fragestellung außer Acht lassen. Ein Problem des Buchs ist auch die Literaturlage, auf die sich Cugny bezieht: größtenteils französische und ein paar amerikanische musikwissenschaftliche Bücher und Aufsätze und eben gerade nicht jene Ansätze, die mit konkreten Fragestellungen an die Musik herangehen. Auch fehlt eine Diskussion der unterschiedlichen Möglichkeiten klassischer musikwissenschaftlicher und musikethnologischer Werkzeuge, gewiss auch eine Darstellung der Diskussionen, die aus der afro-amerikanischen Literaturwissenschaft einen geänderten Blick auf den Jazz entwickelten. Schließlich bekommt man schnell den Eindruck, als zöge Cugny die musikimmanente Analyse auf jeden Fall einer der Einbeziehung außermusikalischer Komponenten in die Diskussion vor – was mir eine im 21sten Jahrhundert eher erstaunliche Sicht der Dinge scheint.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Bohuslav Martinů
herausgegeben von Ulrich Tadday
München 2009 (edition text + kritik)
160 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-3-86916-017-7
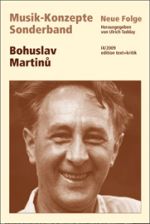 Der Komponist Buhuslav Martinů wurde 1890 in Böhmen geboren, lebte und arbeitete in Prag, Paris und New York und starb im August 1959 in der Schweiz. Im Mai 1959 fand in Dresden ein Symposium über den Komponisten statt; der vorliegende Band enthält die dort gehaltenen Referate. Die Beiträge befassen sich mit Martinůs Kammermusik seinen sinfonischen Kompositionen und seinem Opernschaffen, außerdem mit seiner Rezeption in den USA sowie in Böhmen. Martinůs “Jazz-Suite” von 1928 widmet Daniela Philippi eine ausführliche analytische Diskussion, in der sie sich allerdings vor allem auf die Behandlung der Klavierstimme konzentriert und die Idee von “Jazz”, die Martinů dabei vorschwebte, nicht weiter thematisiert. Wolfgang Rathert reiht Martinůs Sinfonien in die Tradition einer amerikanischen Sinfonik ein, in der seit den 1920er Jahren (eigentlich schon seit Dvorak) versucht wurde, eine eigenständige Musiksprache auch durch die Verwendung originärer Themen zu kreieren, eine “amerikanische Moderne”, für die sich das Vokabular des Jazz besonders gut eignete. Anders aber als Dvorak, der in seiner amerikanischen Zeit mit “Aus der Neuen Welt” eine ur-amerikanische Sinfonie schrieb, waren Martinůs sechs Sinfonien “ganz tschechische Symphonien aus der Tradition der Nationalromantik”, wie Rathert schreibt. Zum Jazz und seiner Rezeption bei Martinů also nicht wirklich viel in diesem Bändchen, das eine musikwissenschaftliche Annäherung an den Komponisten und sein Werk bietet.
Der Komponist Buhuslav Martinů wurde 1890 in Böhmen geboren, lebte und arbeitete in Prag, Paris und New York und starb im August 1959 in der Schweiz. Im Mai 1959 fand in Dresden ein Symposium über den Komponisten statt; der vorliegende Band enthält die dort gehaltenen Referate. Die Beiträge befassen sich mit Martinůs Kammermusik seinen sinfonischen Kompositionen und seinem Opernschaffen, außerdem mit seiner Rezeption in den USA sowie in Böhmen. Martinůs “Jazz-Suite” von 1928 widmet Daniela Philippi eine ausführliche analytische Diskussion, in der sie sich allerdings vor allem auf die Behandlung der Klavierstimme konzentriert und die Idee von “Jazz”, die Martinů dabei vorschwebte, nicht weiter thematisiert. Wolfgang Rathert reiht Martinůs Sinfonien in die Tradition einer amerikanischen Sinfonik ein, in der seit den 1920er Jahren (eigentlich schon seit Dvorak) versucht wurde, eine eigenständige Musiksprache auch durch die Verwendung originärer Themen zu kreieren, eine “amerikanische Moderne”, für die sich das Vokabular des Jazz besonders gut eignete. Anders aber als Dvorak, der in seiner amerikanischen Zeit mit “Aus der Neuen Welt” eine ur-amerikanische Sinfonie schrieb, waren Martinůs sechs Sinfonien “ganz tschechische Symphonien aus der Tradition der Nationalromantik”, wie Rathert schreibt. Zum Jazz und seiner Rezeption bei Martinů also nicht wirklich viel in diesem Bändchen, das eine musikwissenschaftliche Annäherung an den Komponisten und sein Werk bietet.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Miles on Miles. Interviews and Encounters with Miles Davis
herausgegeben von Paul Maher Jr. & Michael K. Dorr
Chicago 2009 (Lawrence Hill Books)
342 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-55652-706-7
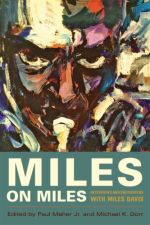 “Miles on Miles” folgt der musikalischen Entwicklung des Trompeters in seinen eigenen Worten, in Interviews, die Davis zwischen 1957 und 1998 gegeben hat. Paul Maher und Michael K. Dorr haben sich dabei vor allem auf solche Interviews gestütz, die relativ schwer zugänglich, selten oder gar bislang nie veröffentlicht wurden, darunter auch Transkripte einiger Radiointerviews. Den biographischen Anfang macht ein Interview, das George Avakian für die PR-Abteilung der Plattenfirma Columbia mit dem Trompeter machte und in dem er knapp über seine Kindheit und seine musikalische Entwicklung bis in die 1950er Jahre spricht. Nat Hentoffs “Afternoon with Miles Davis” von 1958 ist bereits anderswo erschienen und präsentiert Davis, wie er nachdenklich seine musikalische Ästhetik offenlegt, Platten aus seiner Sammlung kommentiert, von Billie Holiday und Louis Armstrong über das Modern Jazz Quartet bis zu Thelonious Monk und zurück zu Bessie Smith. Der Schlagzeuger Arthur Taylor brachte den eher öffentlichkeitsscheuen und Journalisten gegenüber oft abweisenden Miles Davis zum Reden, über Musik genauso wie über die Businessseiten seiner Karriere. Wenn ein Journalist wie Les Tompkins ihn tatsächlich auch zum Reden bringt, erkennt Miles das auch an: “Du hast Dir ein gutes Interview gekriegt. Das erste in drei Jahren”. Immer wieder wehrt er sich gegen das Wort “Jazz”, das er als rassistische Bezeichnung für die Musik ansieht. Al Aronowitz ist mit zwei Essays vertreten, in denen er über Miles, den Privatmann, den Partygänger und den Einfluss Jimi Hendrix’s auf Miles spricht. Ein langes Interview mit Leonard Feather präsentiert ihn eher zahm; in anderen Interviews gifted er über die Plattenfimen, die Tourbosse und die weiße Jazzkritik. Peinlich wird’s, als ein Radiomoderator, der wirklich nichts von Musik versteht, ihn zuhause erwischt und Miles mit Ihm Katz und Maus spielt, um ihn am Schluss einfach liegen zu lassen. Mit Cheryl McCall spricht Miles 1982 offen über Gesundheitsprobleme und Drogen. Drei nicht identifizierte Interviewausschnitte lassen ihn über Lippenproblemen, Mode und die Gründe sprechen, warum er die Plattenfirma Columbia verließ. Ben Sidran gelingt es, die ganze Zeit über nur über Musik mit Miles zu sprechen und den Trompeter am Ende mit der Bemerkung zu beeindrucken, dass sein Stück “Nardis” sein Name rückwärts sei. Mit Nick Kent spricht Miles unter anderem über Wynton Marsalis und die ästhetischen Unterschiede dessen und seiner musikalischen Welt. Robert Doerschuk spricht mit ihm für die Zeitschrift Keyboard über die Verwendung von Synthesizern in seinen Bands. Der Gitarrist Foley interviewt seinen gut gelaunten Chef anlässlich einer Fernsehshow. Das Buch schließt mit drei Features, die Mike Zwerin für die International Herald Tribune schrieb: über Miles, den “Prince of Silence”, Miles, den Maler, und Miles, den Filmschauspieler. “Miles on Miles” ist ein Case Book mit gut ausgewählten Interviews des Trompeters, die versuchen, die ganze Bandbreite seines musikalischen wie sozialen Lebens zu berühren. Ein Namensindex schließt den Band ab, der vielleicht nichts Neues bringt, in den O-Tönen aber überaus lebenswert ist.
“Miles on Miles” folgt der musikalischen Entwicklung des Trompeters in seinen eigenen Worten, in Interviews, die Davis zwischen 1957 und 1998 gegeben hat. Paul Maher und Michael K. Dorr haben sich dabei vor allem auf solche Interviews gestütz, die relativ schwer zugänglich, selten oder gar bislang nie veröffentlicht wurden, darunter auch Transkripte einiger Radiointerviews. Den biographischen Anfang macht ein Interview, das George Avakian für die PR-Abteilung der Plattenfirma Columbia mit dem Trompeter machte und in dem er knapp über seine Kindheit und seine musikalische Entwicklung bis in die 1950er Jahre spricht. Nat Hentoffs “Afternoon with Miles Davis” von 1958 ist bereits anderswo erschienen und präsentiert Davis, wie er nachdenklich seine musikalische Ästhetik offenlegt, Platten aus seiner Sammlung kommentiert, von Billie Holiday und Louis Armstrong über das Modern Jazz Quartet bis zu Thelonious Monk und zurück zu Bessie Smith. Der Schlagzeuger Arthur Taylor brachte den eher öffentlichkeitsscheuen und Journalisten gegenüber oft abweisenden Miles Davis zum Reden, über Musik genauso wie über die Businessseiten seiner Karriere. Wenn ein Journalist wie Les Tompkins ihn tatsächlich auch zum Reden bringt, erkennt Miles das auch an: “Du hast Dir ein gutes Interview gekriegt. Das erste in drei Jahren”. Immer wieder wehrt er sich gegen das Wort “Jazz”, das er als rassistische Bezeichnung für die Musik ansieht. Al Aronowitz ist mit zwei Essays vertreten, in denen er über Miles, den Privatmann, den Partygänger und den Einfluss Jimi Hendrix’s auf Miles spricht. Ein langes Interview mit Leonard Feather präsentiert ihn eher zahm; in anderen Interviews gifted er über die Plattenfimen, die Tourbosse und die weiße Jazzkritik. Peinlich wird’s, als ein Radiomoderator, der wirklich nichts von Musik versteht, ihn zuhause erwischt und Miles mit Ihm Katz und Maus spielt, um ihn am Schluss einfach liegen zu lassen. Mit Cheryl McCall spricht Miles 1982 offen über Gesundheitsprobleme und Drogen. Drei nicht identifizierte Interviewausschnitte lassen ihn über Lippenproblemen, Mode und die Gründe sprechen, warum er die Plattenfirma Columbia verließ. Ben Sidran gelingt es, die ganze Zeit über nur über Musik mit Miles zu sprechen und den Trompeter am Ende mit der Bemerkung zu beeindrucken, dass sein Stück “Nardis” sein Name rückwärts sei. Mit Nick Kent spricht Miles unter anderem über Wynton Marsalis und die ästhetischen Unterschiede dessen und seiner musikalischen Welt. Robert Doerschuk spricht mit ihm für die Zeitschrift Keyboard über die Verwendung von Synthesizern in seinen Bands. Der Gitarrist Foley interviewt seinen gut gelaunten Chef anlässlich einer Fernsehshow. Das Buch schließt mit drei Features, die Mike Zwerin für die International Herald Tribune schrieb: über Miles, den “Prince of Silence”, Miles, den Maler, und Miles, den Filmschauspieler. “Miles on Miles” ist ein Case Book mit gut ausgewählten Interviews des Trompeters, die versuchen, die ganze Bandbreite seines musikalischen wie sozialen Lebens zu berühren. Ein Namensindex schließt den Band ab, der vielleicht nichts Neues bringt, in den O-Tönen aber überaus lebenswert ist.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
The Ghosts of Harlem. Sessions with Jazz Legends. Photographs and Interviews
von Hank O’Neal
Nashville 2009 (Vanderbilt University Press)
488 Seiten + CD, 75 US-$
ISBN: 978-0-8265-1627-5
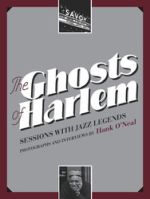 Hank O’Neal ist ein Tausendsassa: In den 1970er Jahren hatte er das Label Chiaroscuro gegründet, auf dem er insbesondere Musiker der älteren Generation produzierte, die auch im Alter noch hervorragend spielten. Er organisierte Konzerte und Jazz Festivals und machte sich auch als Fotograf einen Namen. Bei all dem war er immer ein guter Freund der Musiker, und das kommt diesem opulenten Buch zugute, das reich bebildert Interviews mit 42 Veteranen des Jazz enthält. Sie erzählen aus ihrem Leben und ihrer musikalischen Karriere, doch der das alles zusammenhaltende Faden ist der New Yorker Stadtteil Harlem, dem das Buch gewidmet ist.
Hank O’Neal ist ein Tausendsassa: In den 1970er Jahren hatte er das Label Chiaroscuro gegründet, auf dem er insbesondere Musiker der älteren Generation produzierte, die auch im Alter noch hervorragend spielten. Er organisierte Konzerte und Jazz Festivals und machte sich auch als Fotograf einen Namen. Bei all dem war er immer ein guter Freund der Musiker, und das kommt diesem opulenten Buch zugute, das reich bebildert Interviews mit 42 Veteranen des Jazz enthält. Sie erzählen aus ihrem Leben und ihrer musikalischen Karriere, doch der das alles zusammenhaltende Faden ist der New Yorker Stadtteil Harlem, dem das Buch gewidmet ist.
O’Neal beginnt mit einem umfangreichen Kapitel über Harlem, das Zentrum schwarzer Musik in den 1920er bis 1940er Jahren und verfolgt den Niedergang des Musikgeschäfts im nördlichen Manhattan, bebildert das ganze mit Fotos davon, wie es heute aussieht an den Schauplätzen ehemaliger Band-Battles und Jam Sessions und entdeckt mit Freude, dass seit den 1990er Jahren der Stadtteil seine Musik wiederentdeckt hat. Das Kapitel “Discovering Lost Locations” allein ist den Kauf des Buchs wert, das versucht, Geschichte vor dem völligen Verschwinden aus dem kollektiven Gedächtnis zu bewahren.
Aber die Interviews sind nicht minder spannend. Andy Kirk erzählt darüber, wie er 1920 zum ersten Mal nach New York kam, lässt uns an einigen Geschichten über seinen ehemaligen Manager Joe Glaser teilhaben (der dem Titel “Little Joe from Chicago” den Namen gab), schließlich über musikferne Berufe, die er in Harlem ausübte, etwa als Manager des Hotel Theresa auf der 125sten Straße. Benny Waters berichtet über Small’s Paradise in den 20er Jahren, über Piano-Cutting-Sessions im Reuben’s, in dem er an einem Abend Fats Waller, Art Tatum und Earl Hines hörte. Auch Doc Cheatham spricht über Small’s sowie über den Cotton Club, in dem er mit Cab Calloway spielte. Eddie Durham, weiß von Jimmie Luncefords Band zu berichten, mit der er seit 1935 spielte, erzählt vom Savoy Ballroom und von seiner Zeit bei Count Basie. Cab Calloway selbst berichtet über sein Engagement im Cotton Club, sowohl Uptown, wie auch Downtown; er spekuliert außerdem darüber, warum die Musikszene Uptown in den späten 1940er Jahren den Bach runter ging. Benny Carter erinnert sich an Clubs wie Leroy’s und an seine Zeit mit Chick Webb im Savoy Ballroom. Larence Lucie spricht über Gitarristenkollegen und über seine Aufnahmen mit Teddy Wilson und Billie Holiday. Jonah Jones erinnert sich an den Onyx Club, an Stuff Smith und seine Zeit mit Cab Calloway. Sammy Price berichtet, wie er den Produzenten Mayo Williams in seiner Heimatstadt Dallas getroffen hatte, der ihm später half, einen Vertrag mit der Plattenfirma Decca zu erhalten. Er habe immer in Harlem gelebt, auch wenn er selten Uptown gespielt habe. Danny Barker verrät, warum er aus seiner Heimatstadt New Orleans fortgegangen sei, um in New York heimisch zu werden und wie es in New York eine Art Club der New Orleanser Musiker gab.
Weitere Interviews etwa mit Sy Oliver, Buck Clayton, Maxine Sullivan, Franz Jackson, Al Casey, Buddy Tate, Dizzy Gillespie, J.C. Heard, Panama Francis, Joe Williams, Clark Terry, Billy Taylor, Illinois Jacquet und vielen anderen geben ein sehr persönliches und doch auch sehr professionell beleuchtetes Bild des Stadtteils. Sie alle erzählen von den Gigs, von den Arbeitsbedingungen, von verschiedenen Bands, der Lebendigkeit Harlems und vom Niedergang der Swingära, der quasi mit dem Niedergang Harlems als kulturellem Zentrum des Jazz einherging. O’Neal stellt Fragen zur Karriere und endet meist mit der Frage: Weißt Du noch, wann Du das letzte Mal in Harlem gespielt hast”, und die meisten der Musiker erinnern sich, dass das irgendwann Anfang der 1940er Jahre gewesen sein muss. Dizzy Gillespie und einige andere geben schließlich noch ein Bild des moderneren Harlem, des Bebop-Harlem mit Verweisen auf Minton’s Playhouse und Montroe’s Uptown House.
Alles in allem ist das ganze ein wunderbares Buchprojekt, ein “Coffetable book”, wie man so schön sagt, das sich trotz seiner Dicke leicht und schnell liest und einen hineinzieht in den Bann Harlems in den 20er bis 40er Jahren. Dem Buch heftet eine CD mit Aufnahmen Musikern aus dem Chiaroscuro-Stall bei, aufgenommen zwischen 1992 und 1996; swingender Mainstream-Jazz und zwischendurch auch ein paar O-Töne der Musiker.
(Wolfram Knauer)
I Feel a Song Coming On. The Life of Jimmy McHugh
von Alyn Shipton
Urbana 2009 (University of Illinois Press)
273 Seiten; 35,00 US-$
ISBN: 978-0-252-03465-7
 Alyn Shipton hat seit Jahren eine erfolgreiche Radioshow. Im Juli 2003 fiel einer seiner Kollegen aus, und er wurde gebeten, eine Show mit einem gewissen Jimmy McHugh” zu machen. Doch nicht der Songwriter!, meinte Shipton, wohl wissend, dass der weit über 100 sein müsste. Tatsächlich handelte es sich um den Enkel des Komponisten, und nach einer lebhaften Show entschieden die beiden, dass Shipton mit dem material, das sich im Privatarchiv der McHughs befand, leicht eine Biographie schreiben ließe. Er beginnt mit McHughs Kindheit in Boston, seine Erfahrungen im Bostoner Opernhaus, wo er ab 1910 als Office Boy arbeitete und dabei Stars wie Caruso, Calli-Curci, John McCormack und andere hörte. Nebenbei nahm er Klavierunterricht und interessierte sich neben der klassischen auch für die populäre Musik des Tages. Bald arbeitete er als Song Plugger für verschiedene Musikverlage, zuletzt Irving Berlins Verlag, und lernte dabei, was einen erfolgreichen Song ausmachte. 1920 zog es ihn nach New York, wo er auf der Tin Pan Alley dem Song-Plugger-Beruf weiter nachging, dabei aber neben den Kompositionen anderer auch begann, seine eigenen Titel zu promoten. Für eine Weile hatte er quasi drei Berufe: Musiker, Song-Plugger und Komponist, bis er mit “Everything Is Hotsy Totsy Now” und “I Can’t Believe That You’re In Love With Me” erste größere Hits einfuhr. Shipton beschreibt die Überschneidungen zwischen dem Geschäft eines Komponisten im Geschäft des American Popular Song und der Jazzszene jener Jahre — und zwar sowohl der weißen wie auch der schwarzen Jazzszene. 1927 erhielt Duke Ellington seit legendäres Engagement im New Yorker Cotton Club, und Jimmy McHugh war bald einer der Co-Komponisten für die regelmäßig wechselnden Revuen. Er traf die Textdichterin Dorothy Fields, und bald schrieben die beiden ihre Titel zusammen. “I Can’t Give You Anything But Love, Baby” war eine ihrer frühesten Kollaborationen, später dann “Diga Diga Doo” und andere Songs für die Revue “Blackbirds of 1928”. 1929 verließen beide New York und zogen nach Hollywood, wo der aufkommende Tonfilm ihnen viel einträgliche Arbeit versprach. Aus dieser Zeit stammen “Exactly Like You” und “On the Sunny Side of the Street”. 1931 teilten sie ihre Arbeit zwischen Broadway und Hollywood auf und schrieben 1933 eine Operette ein wenig im Stil von Gilbert and Sullivan. Oft wurden die beiden von der Öffentlichkeit wie ein verheiratetes Paar angesehen, obwohl sie beide anderweitig verheiratet waren. Shipton berichtet über das Einkommen, das McHugh mit seinen unterschiedlichen Aktivitäten erzielte. 1935 folgte “I’m in the Mood for Love”; aber etwa zur selben Zeit tat sich Field mit Jerome Kern für ein paar Shows zusammen und die langjährige Zusammenarbeit Fields/McHugh war vorbei. Bald schrieb er für Filme mit dem Kinderstar Shirley Temple, aber auch für die für Carmen Miranda. In den späten 1930er Jahren tat er sich mit dem Textdichter Johnny Mercer zusammen und schrieb Hits wie “That Old Black Magic” oder “Blues in the Night”. Immer noch war es ihm wichtig, dass seine Songs nicht nur auf der Leinwand zu hören waren, sondern auch von Jazz- und Swingbands gespielt wurden. Nach dem Krieg war McHugh weiterhin einer der Stars der New Yorker High Society, insbesondere, da er nun mit der Klatschreporterin Louella Parsons ging. In den 1960er Jahren lebte er vor allem vom vergangenen Ruhm. Shipton portraitiert McHugh als einen zielstrebigen Fließbandarbeiter an der Maschinerie des American Show Business, macht genügend Ausflüge ins Private, um das Bild eines erfolgreichen, aber mit den üblichen privaten Problemen zu kämpfenden Prominenten zu zeichnen und hält sich mit musikalischen Bewertungen oder auch nur Beschreibungen der Musik McHughs zurück. Eine Auflistung der Kompositionen seines Helden fehlt leider, dafür gibt es etliche seltene Fotos aus dem Familienarchiv der McHughs. Das ganze ist in der Detailverliebtheit manchmal etwas langwierig zu lesen, dennoch eine hilfreiche Biographie, in der jede Menge Informationen über die Broadway- und Hollywood-Szene gegeben werden.
Alyn Shipton hat seit Jahren eine erfolgreiche Radioshow. Im Juli 2003 fiel einer seiner Kollegen aus, und er wurde gebeten, eine Show mit einem gewissen Jimmy McHugh” zu machen. Doch nicht der Songwriter!, meinte Shipton, wohl wissend, dass der weit über 100 sein müsste. Tatsächlich handelte es sich um den Enkel des Komponisten, und nach einer lebhaften Show entschieden die beiden, dass Shipton mit dem material, das sich im Privatarchiv der McHughs befand, leicht eine Biographie schreiben ließe. Er beginnt mit McHughs Kindheit in Boston, seine Erfahrungen im Bostoner Opernhaus, wo er ab 1910 als Office Boy arbeitete und dabei Stars wie Caruso, Calli-Curci, John McCormack und andere hörte. Nebenbei nahm er Klavierunterricht und interessierte sich neben der klassischen auch für die populäre Musik des Tages. Bald arbeitete er als Song Plugger für verschiedene Musikverlage, zuletzt Irving Berlins Verlag, und lernte dabei, was einen erfolgreichen Song ausmachte. 1920 zog es ihn nach New York, wo er auf der Tin Pan Alley dem Song-Plugger-Beruf weiter nachging, dabei aber neben den Kompositionen anderer auch begann, seine eigenen Titel zu promoten. Für eine Weile hatte er quasi drei Berufe: Musiker, Song-Plugger und Komponist, bis er mit “Everything Is Hotsy Totsy Now” und “I Can’t Believe That You’re In Love With Me” erste größere Hits einfuhr. Shipton beschreibt die Überschneidungen zwischen dem Geschäft eines Komponisten im Geschäft des American Popular Song und der Jazzszene jener Jahre — und zwar sowohl der weißen wie auch der schwarzen Jazzszene. 1927 erhielt Duke Ellington seit legendäres Engagement im New Yorker Cotton Club, und Jimmy McHugh war bald einer der Co-Komponisten für die regelmäßig wechselnden Revuen. Er traf die Textdichterin Dorothy Fields, und bald schrieben die beiden ihre Titel zusammen. “I Can’t Give You Anything But Love, Baby” war eine ihrer frühesten Kollaborationen, später dann “Diga Diga Doo” und andere Songs für die Revue “Blackbirds of 1928”. 1929 verließen beide New York und zogen nach Hollywood, wo der aufkommende Tonfilm ihnen viel einträgliche Arbeit versprach. Aus dieser Zeit stammen “Exactly Like You” und “On the Sunny Side of the Street”. 1931 teilten sie ihre Arbeit zwischen Broadway und Hollywood auf und schrieben 1933 eine Operette ein wenig im Stil von Gilbert and Sullivan. Oft wurden die beiden von der Öffentlichkeit wie ein verheiratetes Paar angesehen, obwohl sie beide anderweitig verheiratet waren. Shipton berichtet über das Einkommen, das McHugh mit seinen unterschiedlichen Aktivitäten erzielte. 1935 folgte “I’m in the Mood for Love”; aber etwa zur selben Zeit tat sich Field mit Jerome Kern für ein paar Shows zusammen und die langjährige Zusammenarbeit Fields/McHugh war vorbei. Bald schrieb er für Filme mit dem Kinderstar Shirley Temple, aber auch für die für Carmen Miranda. In den späten 1930er Jahren tat er sich mit dem Textdichter Johnny Mercer zusammen und schrieb Hits wie “That Old Black Magic” oder “Blues in the Night”. Immer noch war es ihm wichtig, dass seine Songs nicht nur auf der Leinwand zu hören waren, sondern auch von Jazz- und Swingbands gespielt wurden. Nach dem Krieg war McHugh weiterhin einer der Stars der New Yorker High Society, insbesondere, da er nun mit der Klatschreporterin Louella Parsons ging. In den 1960er Jahren lebte er vor allem vom vergangenen Ruhm. Shipton portraitiert McHugh als einen zielstrebigen Fließbandarbeiter an der Maschinerie des American Show Business, macht genügend Ausflüge ins Private, um das Bild eines erfolgreichen, aber mit den üblichen privaten Problemen zu kämpfenden Prominenten zu zeichnen und hält sich mit musikalischen Bewertungen oder auch nur Beschreibungen der Musik McHughs zurück. Eine Auflistung der Kompositionen seines Helden fehlt leider, dafür gibt es etliche seltene Fotos aus dem Familienarchiv der McHughs. Das ganze ist in der Detailverliebtheit manchmal etwas langwierig zu lesen, dennoch eine hilfreiche Biographie, in der jede Menge Informationen über die Broadway- und Hollywood-Szene gegeben werden.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Traveling Blues. The Life and Music of Tommy Ladnier
Von Bo Lindström und Dan Vernhettes
Paris 2009 (Jazz ‘Edit)
216 Seiten
ISBN 978-2-9534-8310-9
 Tommy Ladnier ist eine Art Rätsel der Jazzgeschichte. Der Ruhm des Trompeters, der mit extrem schönem und antreibendem Sound spielte, seit 1923 auf Platten dokumentiert ist, mehrfach Europa bereiste, sich in den 1930er Jahren zurückzog, um mit einem Schneider- und Bügelgeschäft sein Geld zu verdienen und 1939 an den Folgen von Alkohol und eventuell einer Geschlechtskrankheit verstarb, geht vor allem auf Hugues Pannasié zurück, der ihn zusammen mit Mezz Mezzrow 1938 quasi wiederentdeckte, aus seinem musikalischen Exil holte und erneut Aufnahmen mit ihm machte.
Tommy Ladnier ist eine Art Rätsel der Jazzgeschichte. Der Ruhm des Trompeters, der mit extrem schönem und antreibendem Sound spielte, seit 1923 auf Platten dokumentiert ist, mehrfach Europa bereiste, sich in den 1930er Jahren zurückzog, um mit einem Schneider- und Bügelgeschäft sein Geld zu verdienen und 1939 an den Folgen von Alkohol und eventuell einer Geschlechtskrankheit verstarb, geht vor allem auf Hugues Pannasié zurück, der ihn zusammen mit Mezz Mezzrow 1938 quasi wiederentdeckte, aus seinem musikalischen Exil holte und erneut Aufnahmen mit ihm machte.
Bo Lindström und Dan Vernhettes sind Jazzfans und Privatforscher und haben mit ihrem Buch über Tommy Ladnier eine unglaublich sorgfältig recherchierte und bebilderte Biographie des Trompeters vorgelegt, die in 500 Exemplaren erschienen ist und neben Details zum Leben und zur Musik Ladniers jede Menge Information über die Rahmenbedingungen präsentiert, innerhalb derer Ladnier Musik machte.
Die Autoren beginnen mit der Kolonialgeschichte Louisianas und dem wechselvollen Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß, beschreiben die unterschiedlichen Gesetze, die das Zusammenleben der Sklavenbesitzer und ihrer Sklaven seit Zeiten Louis XIV regeln sollten und das reale Leben in Mandaville, einer Kleinstadt am nordöstlichen Ufer des Lake Pontchatrain, quasi gegenüber von New Orleans, wo Tommy Ladnier 1900 geboren wurde. Sie recherchieren die Familie des Trompeters, deren weiße Linie sie bis in die Schweiz zurückverfolgen, von wo Christian L’Adner stammte, der von Ludwig XV 1719 wegen Schmuggels und Schwarzmarkthandel in die Übersee-Strafkolonien verbannt worden war, und der als Urvater vieler Ladniers in Louisiana gilt. Eine Geburtsurkunde des Trompeters existiert nicht, und Lindström und Vernhettes spekulieren darüber, ob Willa Ladnier, die Frau seines Vaters, wohl wirklich die leibliche Mutter war oder ob Ladnier nicht vielleicht Kind einer Mischbeziehung und seine leibliche Mutter eine Weiße gewesen sei.
Sie beschreiben die Musik, die Ladnier in Mandaville gehört haben mag, den Einfluss durch Trompeter wie Bunk Johnson und Buddy Petit und begleiten Ladnier 1917 nach Chicago, wo er sich auf den Schlachthöfen verdingte, aber nebenbei all die großen Jazzmusiker hörte, die dort spielten, allen voran King Oliver. Ladnier war auch selbst bald als Musiker gefragt und machte 1923 seine ersten Plattenaufnahmen mit der Sängerin Monnette Moore; etwa zur gleichen Zeit außerdem Aufnahmen mit Jelly Roll Morton. Im Herbst des Jahres wurde er Mitglied der Blues Serenaders der Pianistin Lovie Austin, einer Band, mit der er Sängerinnen wie Ida Cox, Ma Rainey, Edmonia Henderson, Edna Hicks und Ethel Waters begleitete und im Dezember 1924 auch einige Instrumentaltitel einspielte.
1925 stieg Ladnier beim Sam Wooding Orchestra in New York ein, das sich kurz darauf zu einer Tournee nach Europa einschiffte. Die Tour begann im Admiralspalast Berlin, dann folgte das Thalia Theater in Hamburg, Stockholm, Kopenhagen, Prag, Budapest, Wien, Barcelona, Madrid, Paris, Zürich, wieder Berlin und schließlich Russland. Erst im Juli 1926 kehrte Ladnier von Danzig aus nach New York zurück. Dort jobbte er eine Weile, bis er als Ersatz von Rex Stewart ins Fletcher Henderson Orchestra engagiert wurde, mit dem er einige Platten einspielte, darunter den “The Chant”. Er reiste mit Henderson durchs Land, nahm nebenher ein paar Seiten mit Bessie Smith auf, und kündigte schließlich, um im Februar 1928 wieder bei Sam Wooding anzufangen. Der hatte bereits neue Europa-Pläne, und Ladnier reiste mit. Es begann ein weiteres Mal in Berlin, führte die Band, der diesmal auch der Trompeter Doc Cheatham angehörte, über Wien nach Konstantinopel, dann nach Hamburg, Bern, Mailand, Florenz und Nizza, wo Ladnier Wooding verließ. In der Folge spielte er mit Benny Peyton’s Band, mit Harry Fleming und in einer Revue des Tänzers Louis Douglas. Immer wieder kehrte er bei seinen Tourneen nach Paris zurück, wo er sich unter anderem mit Hugues Panassié anfreundete, dem französischen Jazzfan und -experten.
1930 stieg Ladnier in die Bigband des Sängers und Bandleaders Noble Sissle ein, der damals in Paris gastierte und mit dem er im Dezember des Jahres in die USA zurückkehrte. Dort gesellte sich der Band auch der Sopransaxophonist Sidney Bechet zu, der ähnliche europäische Erfahrungen gesammelt hatte wie Ladnier und mit dem sich der Trompeter daher schnell anfreundete. Mit Bechet gründete der Ladnier 1932 die Band “The New Orleans Feetwarmers”, die im Savoy Ballroom auftrat und auch Platteneinspielungen machten.Das Geschäft aber war schwer in jenen Jahren kurz nach dem Börsencrash, und 1933 eröffneten Bechet und Ladnier als Alternative zur Musik ein Schneider- und Bügelgeschäft in Harlem. Bechet zog sich bald wieder aus diesem “weltlichen” Beruf zurück, und das Geschäft existierte wohl gerade mal ein Jahr.
Zwischen 1934 und 1938 wird es dunkel in der Biographie Ladniers. Er habe sich nach Connecticut zurückgezogen, heißt es, wo er bei einem Freund gelebt habe. Über musikalische Aktivitäten in diesen Jahren ist jedenfalls nichts bekannt.1938 kam Hugues Panassié nach New York und wollte Aufnahmen im klassischen New-Orleans-Stil produzieren. Er tat sich mit dem Klarinettisten Mezz Mezzrow zusammen, und ihre erste Wahl für die Trompete war Tommy Ladnier. Sie fanden ihn, Pannasié unterhielt sich lange mit ihm, um die Aufnahmesitzung vorzubereiten (und einige Fotos auf der Straße in Harlem zu schießen); dann ging die Band im November und Dezember 1938 für insgesamt drei Plattensitzungen ins Studio. Am 23. Dezember organisierte John Hammond sein “From Spirituals to Swing”-Konzert in der Carnegie Hall und bat Sidney Bechet, eine New-Orleans-Besetzung zusammenzustellen, für die Bechet Ladnier engagierte. Glücklicherweise sind Mitschnitte des Konzerts gemacht und später veröffentlicht worden.
Am 1. Februar 1939 ging Ladnier zum letzten Mal ins Studio, wieder mit Mezz Mezzrow, um die Sängerin Rosetta Crawford zu begleiten. Er wohnte zeitweise bei Bechet, später dann bei Mezzrow in Harlem. Der fand ihn am 3. Juni tot im Sessel sitzend in seiner Wohnung. Ladnier wurde auf dem Frederick Douglas Cemetery in Staten Island, New York, beigesetzt.
Lindström und Vernhettes ist es gelungen, so viel Information wie irgend möglich über Tommy Ladnier zusammenzutragen, um aus den puzzlestein-artigen Versatzstücken ein eindrucksvolles Gesamtbild des Lebens und Wirkens eines schwarzen Musikers in den 1920er und frühen 1930er Jahren zusammenzubasteln. Sie bebildern das ganze mit teilweise seltenen Fotos, beschreiben neben den biographischen Details die Umstände, in denen Ladnier seine Musik machte und gehen mit knappen analytischen Absätzen und einzelnen Transkriptionen seiner Soli auch auf die Musik ein. Beide Autoren sind Fans, aber sie schreiben keine Hagiographie ihres Helden. Ihr Buch ist eine Fundgrube kleiner Informationen, die die Szenen jener Jahre beschreibt, durch die Tommy Ladnier gereist ist: New Orleans, Chicago, Europa, New York. Zum Schluss findet sich eine ausführliche Diskographie des Trompeters, in dem alle 191 Einspielungen, an denen Tommy Ladnier beteiligt war, aufgelistet sind.
Das Buch fast in LP-Format ist eine “labor of love”, eine opulente Dokumentation des Lebens eines Musikers, der scheinbar immer auf Reisen war: “Traveling Blues”.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Jazz et société sous l’Occupation
von Gérard Régnier
Paris 2009 (L’Harmattan)
296 Seiten, 28,00 Euro
ISBN: 978-2-296-10134-0
 Zusammen mit London und Berlin war Paris in den 1920er Jahren die wichtigste Stadt für den noch jungen europäischen Jazz. Frankreich hatte die afro-amerikanische Musik bereits kurz nach dem I. Weltkrieg umarmt, als James Reese Europe mit seiner Hellfighters Band in den befreiten Dörfern und Städten gefeiert wurde. Viele Künstler ließen sich in Paris nieder, das nicht nur eine amerikanische, sondern daneben auch eine afro-amerikanische Szene besaß. Sie lebten dort auch in den 1930er Jahren und planten Tourneen ins benachbarte Ausland, wobei Deutschland mehr und mehr umrundet werden musste, weil die Nazis hier den Jazz unterdrückten und seinen Künstlern die Auftrittsmöglichkeiten nahmen.
Zusammen mit London und Berlin war Paris in den 1920er Jahren die wichtigste Stadt für den noch jungen europäischen Jazz. Frankreich hatte die afro-amerikanische Musik bereits kurz nach dem I. Weltkrieg umarmt, als James Reese Europe mit seiner Hellfighters Band in den befreiten Dörfern und Städten gefeiert wurde. Viele Künstler ließen sich in Paris nieder, das nicht nur eine amerikanische, sondern daneben auch eine afro-amerikanische Szene besaß. Sie lebten dort auch in den 1930er Jahren und planten Tourneen ins benachbarte Ausland, wobei Deutschland mehr und mehr umrundet werden musste, weil die Nazis hier den Jazz unterdrückten und seinen Künstlern die Auftrittsmöglichkeiten nahmen.
Am 10. Mai 1940 begannen die deutschen Streitkräfte ihre Westoffensive; am 25. Mai wurden die “dancings”, Tanzsäle und Cabarets in Paris, geschlossen; am 14. Juni marschierten die Deutschen in Paris ein; am 4. Juli wurde ein fester Wechselkurs zwischen Franc und Reichsmark eingeführt; am 11. Juli waren die meisten Tanzhallen und Cabarets bereits wieder geöffnet. Jazz stand zwar auf der Bannliste der Nazis, aber in den besetzten Gebieten gab es wohl dringendere Aufgaben als ein Verbot dieser Musik durchzusetzen. Auch während der Besatzung jedenfalls konnte man in Frankreich Jazz hören, im Konzert, beim Tanzen, im Radio oder von Schallplatten. Auch hier allerdings wurden die Titel oft genug abgeändert, um die neuen Machthaber nicht zu provozieren. Aus “Lady Be Good” wurde dann “Les Bigoudis” oder “Soyez bonne madame”, aus “In the Mood” “Ambiance” oder “Dans l’ambiance”, aus “Blue and Sentimental” einfach “Bleu et sentimental”.
Eine Überlebensstrategie, die französische Jazzfans sich gleich zu Beginn der Besatzung ausdachten, war die Auslobung eines spezifischen “jazz français”. Gérard Régnier verfolgt die Aktivitäten der Szene um Charles Delaunay, den Hot Club de France und die bisherigen Spielstätten für Jazz insbesondere in Paris. Er beschäftigt sich damit, wie Jazz im Radio präsentiert wurde, beschreibt, wie das Vichy-Regime im Oktober 1942 einen Jazzbann aussprach, woraufhin die regelmäßigen Jazzsendungen etwa von Hugues Panassié von Marseille aus ausgestrahlt wurden. Auch im Schweizer Rundfunk ließen sich Jazzsendungen hören, und Radio Nimes brachte etwa am 18. Mai 1943 eine Sondersendung mit Musik von Django Reinhardt. Es gab zwar Tanzverbote, die aber nicht lange anhielten, wie Régnier aus einer zeitgenössischen Quelle zitiert: “Die Pariser mögen auf Essen und Rauchen verzichten und ein bisschen weniger Wein trinken. Aber sie gehen weiterhin ins Kino und ins Theater.” Die Erlasse trieben den Jazz höchstens noch mehr in die Keller als schon zuvor, in private Clubs, zu sogenannten “Tanzkursen” und subkulturellen Überraschungsparties. Letzten Endes aber verzeichnete das Moulin Rouge 1942 mehr als 60 Prozent mehr Zuschauer als noch 1941. Selbst in der deutschsprachigen “Pariser Zeitung” wurde 1941 “Der weltberühmte Django Reinhardt und das Quintett des Französischen Hot-Club” angekündigt.
Régnier verfolgt die Aktivitäten der beiden Hot-Club-Lenker Hugues Panassié, der auch während der Besatzung weiterhin Rundfunksendungen moderierte und Bücher publizierte (zum Schluss, 1944, in Genf), und Charles Delaunay, der versuchte, das Jazzleben in Paris mit unzähligen Konzerten am Laufen zu halten. Neben der Hauptstadt schaut Régnier aber auch auf andere Zentren, deren Jazzclubs sich im Hot Club de France zusammengeschlossen hatten, auf Bordeaux etwa oder Rennes, auf Le Mans, Angers, Troyes, Valenciennes, Marseille und Strasbourg, das ja nicht nur besetzt, sondern von den Deutschen annektiert worden war. Er wirft einen Blick auf die Konzentrationslager der Deutschen, in denen auch Jazzmusiker inhaftiert waren (die wohl als Soldaten gegen die Deutschen gekämpft hatten). Er berichtet über die Zazous und die “petits swings”, also die Swingfans, die dem Jazz vor allem als Modeerscheinung anhingen.
Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob der Jazz denn nun wirklich offiziell verboten war oder ob es sich dabei vor allem um eine Legende handelt. Régnier schaut sich die Erlasse der Besatzungsmacht durch, beleuchtet die Kontrollen der “Propagandastaffel” bei Konzerten und in Cabarets, berichtet über Zensur im Radio und Behinderungen bei Plattenaufnahmen. Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich mit den jüdischen Musikern in Frankreich, mit der Judenverfolgung in den besetzten Gebieten genauso wie im Vichy-Regime, die viele Menschen – darunter auch Musiker – dazu zwang, sich zu verstecken oder abzusetzen. Einige schwarze amerikanische Musiker waren in Frankreich geblieben; der Trompeter Arthur Briggs etwa wurde verhaftet und leitete in der Kaserne von Saint-Denis ein Orchester britischer Gefangener.
Schließlich befasst sich Régnier auch mit Django Reinhardt, in einem Kapitel, das er “Le cas Django Reinhardt” überschreibt”, “Der Fall Django Reinhardt”. Die Nazis hatten auch die “Zigeuner” in ihr “Endlösungs”-Programm einbeschlossen und Tausende Roma ermordet. Django Reinhardt aber war selbst bei Wehrmachtsoffizieren beliebt. Angeblich wollte der deutsche Kommandant, das Reinhardt auf eine Deutschlandtournee gehen solle, aber der Gitarrist weigerte sich, was ein Grund für seine Verhaftung im November 1943 gewesen sei, als er versuchte, die Schweizer Grenze zu passieren.
Kapitel 4 wendet sich den ideologischen Diskursen zu, die in jenen Jahren um den Jazz geführt wurden. Das Vichy-Regime sah im Jazz ein Zeichen des moralischen Verfalls und hielt ihm die heimische Folklore entgegen. Musiker, die für die deutschen Machthaber spielten oder gar Tourneen durch Deutschland absolvierten wie etwa Raymond Legrand, Charles Trenet oder Édith Piaf, wurden in der Szene schnell als Kollaborateure abgestempelt. Der Jazz war nie formell verboten, schlussfolgert Régnier; wenn überhaupt, dann stellte Jazz vielleicht eine Art “passiver Résistance” dar. 1944 wurde Paris von den Amerikanern befreit, Régnier wirft einen Blick auf die neue musikalische Freiheit, auf Konzerte der Royal Air Force Band, Glenn Millers Aufenthalt in Frankreich und die Sendungen auf AFN.Das Buch endet mit einer chronologischen Zeittafel der Ereignisse, einer ausführlichen Bibliographie sowie Quellendokumenten im Faksimile.
Régniers Arbeit ist ohne Zweifel Grundlagenforschung erster Güte – hervorragend recherchiert, lesenswert geschrieben und bei aller Nüchternheit der Fakten durchaus spannend zu lesen.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Herbie Nichols. A Jazzist’s Life
von Mark Miller
Toronto 2009 (Mercury Press)
224 Seiten, 19,95 US-$
ISBN: 978-1-55128-146-9
 Der Pianist Herbie Nichols war ein “musicians’ musician”, ein Musiker, der vor allem bei seinen Kollegen bewundert war, aber in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt wurde. Bei einem Kneipenbesuch habe er dessen Musik Jahren zufällig gehört, erzählt Miller in seinem Vorwort, und dann Frank Kimbraugh in New York angerufen, von dem er wusste, dass er viel Material über den Pianisten, sein Leben und seine Musik gesammelt hatte, um zu fragen, ob irgendwer sonst dessen Biographie schreibe. Nur wenig schriftliche Quellen standen ihm zur Verfügung und auch von den Musikern, die mit Nichols enger zusammengearbeitet hatten, lebten nicht mehr viele. Die Fakten, die Miller findet, verbindet er in seinem Buch mit einer Einordnung in die gesellschaftlichen und lokalen Verhältnisse der Zeit. Er erzählt, wie Nichols als Sohn von Eltern zur Welt kam, die aus Trinidad in die USA immigriert waren. Nichols nahm Klavierunterricht, entwickelte eine Liebe für russische Komponisten — Tschaikowski, Strawinsky, Rachmaninow — hörte aber auch die Jazzpianisten seiner Zeit, Jelly Roll Morton, Earl Hines, Duke Ellington, und spielte etwa ab 1937 mit den Royal Barons, einer Tanzkapelle. In den frühen 1940er Jahren war er in den Bebop-Kneipen präsent, auch wenn er, wie Leonard Feather berichtete, von den jungen Beboppern nicht ganz anerkannt und schon mal vom Klavierhocker vertrieben wurde. Von 1941 bis 1942 war er in der Army, spielte danach in einem Cabaret in Harlem und schrieb außerdem eine Kolumne für die Zeitschrift “The Music Dial”, in der er die Szene kommentierte und Thelonious Monks seltsame Musik lobte. Es dauerte nicht lang und auch Nichols gehörte zu dem Kreis, der sich um Monk bildete. In den späten 1940er Jahren arbeitete er mit Illinois Jacquet und John Kirby, gab außerdem Unterricht in “Jazz Theory – Bebop”. Er freundete sich mit Mary Lou Williams an, die drei seiner Kompositionen einspielte. Nichols selbst nahm erst im März 1952 sein erstes Album für das Label Hi-Lo auf, das eigentlich den Gospel- und R&B-Markt anpeilte. Seiner Karriere half das wenig — er musste Dixieland- und R&B-Gigs spielen, um sich über Wasser zu halten. 1955 nahm er seine erste Platte für das Blue-Note-Label auf und bekam damit endlich eine größere Sichtbarkeit sowohl in der Fachpresse als auch auf der New Yorker Szene — und zwar mit seiner eigenen Musik. Das Magazin Metronome brachte einen ausführlichen Artikel, in dem Nichols seine musikalische Ästhetik darlegen und erklären konnte, dass seine Definition des Jazz eher eine lockere sei: Jazz sei jede Art von Musik, die mit einem Swing-Beat gespielt werde und irgendeine Art von Improvisation enthalte. 1956 begleitete er für kurze Zeit Billie Holiday, die seinen Song “Serenade” als “Lady Sings the Blues” aufnahm. Nebenbei schrieb er Gedichte, die er an Freunde schickte und von denen Miller einige abdruckt. 1958 war Nichols allerdings schon wieder weitgehend von der Szene verschwunden, tauchte noch einmal kurz bei einer Mainstream-Session des Trompeters Joe Thomas auf, die zugleich seine letzte Einspielung sein sollte. Er trat mit Sheila Jordan auf und gab Roswell Rudd informellen Unterricht. 1961 zeichnete sich allerdings bereits ab, dass es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten bestellt war. Immerhin reiste er 1962 zum ersten Mal nach Europa, wo er mit seinem Trio in Helsinki beim Festival “Young America Presents” mitwirkte. Anfang 1963 ging es ihm immer schlechter, und die Ärzte diagnostizierten Leukämie. Herbie Nichols starb am 12. April. Miller erzählt die Geschichte des Pianisten entlang der Quellen — Zeitungsberichten, Zeitzeugeninterviews, Plattenaufnahmen, Liner Notes. Er beschreibt ein Leben zwischen Avantgarde-Ästhetik und Entertainment zum Brotverdienen, das Leben eines klugen, selbstbewussten Mannes, dem dennoch der populäre Erfolg und die große Anerkennung zu Lebzeiten versagt blieben. Nach seinem Tod wurde er irgendwann wiederentdeckt, von Misha Mengelberg etwa, der zeitlebens ein Nichols-Fan war oder vom New Yorker Pianisten Frank Kimbraugh, der ein eigenes Nichols-Projekt auf die Beine stellte, aber auch von Roswell Rudd und vielen anderen Musikern — aus der ganzen Welt. Millers Buch ist gerade deshalb lesenswert, weil über Nichols so wenig bekannt ist. .A.B. Spellman hatte in seinem Buch “Black Music. Four Lives” die bislang ausführlichste Würdigung Nichols’ verfasst, auf die sich auch Miller immer wieder stützt. Dazu aber sammelt Miller genügend weiteres Material, um seine Biographie zu einem neuen Standardwerk über den Pianisten zu machen. Die musikalische Bewertung überlässt er dabei Musikerkollegen; hier also wäre noch einiges zu leisten, obwohl Roswell Rudd da bereits selbst ein spannendes Büchlein vorgelegt hat. Zum Schluss seines Buchs gibt es eine Diskographie der Aufnahmen, an denen Nichols selbst beteiligt war, sowie von Platten anderer Künstler, auf denen Nichols-Kompositionen gespielt wurden.
Der Pianist Herbie Nichols war ein “musicians’ musician”, ein Musiker, der vor allem bei seinen Kollegen bewundert war, aber in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt wurde. Bei einem Kneipenbesuch habe er dessen Musik Jahren zufällig gehört, erzählt Miller in seinem Vorwort, und dann Frank Kimbraugh in New York angerufen, von dem er wusste, dass er viel Material über den Pianisten, sein Leben und seine Musik gesammelt hatte, um zu fragen, ob irgendwer sonst dessen Biographie schreibe. Nur wenig schriftliche Quellen standen ihm zur Verfügung und auch von den Musikern, die mit Nichols enger zusammengearbeitet hatten, lebten nicht mehr viele. Die Fakten, die Miller findet, verbindet er in seinem Buch mit einer Einordnung in die gesellschaftlichen und lokalen Verhältnisse der Zeit. Er erzählt, wie Nichols als Sohn von Eltern zur Welt kam, die aus Trinidad in die USA immigriert waren. Nichols nahm Klavierunterricht, entwickelte eine Liebe für russische Komponisten — Tschaikowski, Strawinsky, Rachmaninow — hörte aber auch die Jazzpianisten seiner Zeit, Jelly Roll Morton, Earl Hines, Duke Ellington, und spielte etwa ab 1937 mit den Royal Barons, einer Tanzkapelle. In den frühen 1940er Jahren war er in den Bebop-Kneipen präsent, auch wenn er, wie Leonard Feather berichtete, von den jungen Beboppern nicht ganz anerkannt und schon mal vom Klavierhocker vertrieben wurde. Von 1941 bis 1942 war er in der Army, spielte danach in einem Cabaret in Harlem und schrieb außerdem eine Kolumne für die Zeitschrift “The Music Dial”, in der er die Szene kommentierte und Thelonious Monks seltsame Musik lobte. Es dauerte nicht lang und auch Nichols gehörte zu dem Kreis, der sich um Monk bildete. In den späten 1940er Jahren arbeitete er mit Illinois Jacquet und John Kirby, gab außerdem Unterricht in “Jazz Theory – Bebop”. Er freundete sich mit Mary Lou Williams an, die drei seiner Kompositionen einspielte. Nichols selbst nahm erst im März 1952 sein erstes Album für das Label Hi-Lo auf, das eigentlich den Gospel- und R&B-Markt anpeilte. Seiner Karriere half das wenig — er musste Dixieland- und R&B-Gigs spielen, um sich über Wasser zu halten. 1955 nahm er seine erste Platte für das Blue-Note-Label auf und bekam damit endlich eine größere Sichtbarkeit sowohl in der Fachpresse als auch auf der New Yorker Szene — und zwar mit seiner eigenen Musik. Das Magazin Metronome brachte einen ausführlichen Artikel, in dem Nichols seine musikalische Ästhetik darlegen und erklären konnte, dass seine Definition des Jazz eher eine lockere sei: Jazz sei jede Art von Musik, die mit einem Swing-Beat gespielt werde und irgendeine Art von Improvisation enthalte. 1956 begleitete er für kurze Zeit Billie Holiday, die seinen Song “Serenade” als “Lady Sings the Blues” aufnahm. Nebenbei schrieb er Gedichte, die er an Freunde schickte und von denen Miller einige abdruckt. 1958 war Nichols allerdings schon wieder weitgehend von der Szene verschwunden, tauchte noch einmal kurz bei einer Mainstream-Session des Trompeters Joe Thomas auf, die zugleich seine letzte Einspielung sein sollte. Er trat mit Sheila Jordan auf und gab Roswell Rudd informellen Unterricht. 1961 zeichnete sich allerdings bereits ab, dass es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten bestellt war. Immerhin reiste er 1962 zum ersten Mal nach Europa, wo er mit seinem Trio in Helsinki beim Festival “Young America Presents” mitwirkte. Anfang 1963 ging es ihm immer schlechter, und die Ärzte diagnostizierten Leukämie. Herbie Nichols starb am 12. April. Miller erzählt die Geschichte des Pianisten entlang der Quellen — Zeitungsberichten, Zeitzeugeninterviews, Plattenaufnahmen, Liner Notes. Er beschreibt ein Leben zwischen Avantgarde-Ästhetik und Entertainment zum Brotverdienen, das Leben eines klugen, selbstbewussten Mannes, dem dennoch der populäre Erfolg und die große Anerkennung zu Lebzeiten versagt blieben. Nach seinem Tod wurde er irgendwann wiederentdeckt, von Misha Mengelberg etwa, der zeitlebens ein Nichols-Fan war oder vom New Yorker Pianisten Frank Kimbraugh, der ein eigenes Nichols-Projekt auf die Beine stellte, aber auch von Roswell Rudd und vielen anderen Musikern — aus der ganzen Welt. Millers Buch ist gerade deshalb lesenswert, weil über Nichols so wenig bekannt ist. .A.B. Spellman hatte in seinem Buch “Black Music. Four Lives” die bislang ausführlichste Würdigung Nichols’ verfasst, auf die sich auch Miller immer wieder stützt. Dazu aber sammelt Miller genügend weiteres Material, um seine Biographie zu einem neuen Standardwerk über den Pianisten zu machen. Die musikalische Bewertung überlässt er dabei Musikerkollegen; hier also wäre noch einiges zu leisten, obwohl Roswell Rudd da bereits selbst ein spannendes Büchlein vorgelegt hat. Zum Schluss seines Buchs gibt es eine Diskographie der Aufnahmen, an denen Nichols selbst beteiligt war, sowie von Platten anderer Künstler, auf denen Nichols-Kompositionen gespielt wurden.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Das große Buch der Trompete, Band 2
von Friedel Keim
Mainz 2009 (Schott)
482 Seiten, 39,95 Euro
ISBN: 978-3-7957-0677-7
 Friedel Keim veröffentlichte 2005 sein “Großes Buch der Trompete”, das auch auf dieser Website gewürdigt wurde. Nur vier Jahre später legt er einen Ergänzungsband vor, der mehr als halb so dick wie der ursprüngliche Band ist und den in Band 1 enthaltenen 2.043 Biographien noch einmal 757 Kurzbiographien hinzufügt. Wieder ist Keim genreübergreifender Detektiv, forscht nach Geburts- und Sterbedaten selbst von Musikern, die nicht in der ersten Reihe standen, sondern vielleicht eher zu den zweitrangigen Musikern ihres Faches gehörten bzw. gehören. Seine Liebe gilt deutlich dem Jazz, aber klassische Trompeter finden genauso ausführlich Erwähnung wie Musiker aus dem Showgeschäft oder aus dem Rock- und Popbusiness. In Band 2 gibt es nicht mehr die anz großen Stars — die wurden bereits im ersten Band abgefeiert. Dafür finden sich viele Musiker, die einem kaum ein Begriff sind, deren Namen man aber von den Besetzungslisten großer Bands erinnert, wenn man ihre Biographie liest. Außerdem gibt es Ergänzungen und Korrekturen zum ersten Band und einige lesenswerte Kapitel etwa über die Trompete im (insbesondere deutschen) Fernsehen, die Trompete in der Literatur, Weiterentwicklungen des Instruments, eine ausführliche Bibliographie von Trompetenschulen sowie ein “Trompeten-Kuriositäten” überschriebenes Kapitel, in dem Keim etwa über Trompetenärmel in der Mode sinniert oder eine Trompetenwette aus “Wetten Dass…?” beschreibt, ein Lippenmassagegerät vorstellt und über einen Zwischenfall am Pariser Flughafen berichtet, bei dem Valery Ponomarev seine Trompete nicht aufgeben,. sondern als Handgepäck mitnehmen wollte, worauf es zu einem Handgemenge kam, bei dem er sich den Arm brach. Keim ist Mainzer, also ist der Schelm nicht weit, und ein paar Witze gibt’s auch, etwa diesen: “Ein Trompeter übt jeden Tag volle acht Stunden lang. Da sagt ein Kollege zu ihm: ‘Wie schaffst du das nur? Also ich könnte das nicht.’ ‘man muss eben wissen, was man will.’ ‘Und was willst du?’ ‘Die Wohnung nebenan!'” Ein Nachschlagewerk, das es also nicht an Abwechslung mangeln lässt, spannend zu durchblättern und für Trompetenliebhaber — wie schon Band 1 — ein absolutes Muss.
Friedel Keim veröffentlichte 2005 sein “Großes Buch der Trompete”, das auch auf dieser Website gewürdigt wurde. Nur vier Jahre später legt er einen Ergänzungsband vor, der mehr als halb so dick wie der ursprüngliche Band ist und den in Band 1 enthaltenen 2.043 Biographien noch einmal 757 Kurzbiographien hinzufügt. Wieder ist Keim genreübergreifender Detektiv, forscht nach Geburts- und Sterbedaten selbst von Musikern, die nicht in der ersten Reihe standen, sondern vielleicht eher zu den zweitrangigen Musikern ihres Faches gehörten bzw. gehören. Seine Liebe gilt deutlich dem Jazz, aber klassische Trompeter finden genauso ausführlich Erwähnung wie Musiker aus dem Showgeschäft oder aus dem Rock- und Popbusiness. In Band 2 gibt es nicht mehr die anz großen Stars — die wurden bereits im ersten Band abgefeiert. Dafür finden sich viele Musiker, die einem kaum ein Begriff sind, deren Namen man aber von den Besetzungslisten großer Bands erinnert, wenn man ihre Biographie liest. Außerdem gibt es Ergänzungen und Korrekturen zum ersten Band und einige lesenswerte Kapitel etwa über die Trompete im (insbesondere deutschen) Fernsehen, die Trompete in der Literatur, Weiterentwicklungen des Instruments, eine ausführliche Bibliographie von Trompetenschulen sowie ein “Trompeten-Kuriositäten” überschriebenes Kapitel, in dem Keim etwa über Trompetenärmel in der Mode sinniert oder eine Trompetenwette aus “Wetten Dass…?” beschreibt, ein Lippenmassagegerät vorstellt und über einen Zwischenfall am Pariser Flughafen berichtet, bei dem Valery Ponomarev seine Trompete nicht aufgeben,. sondern als Handgepäck mitnehmen wollte, worauf es zu einem Handgemenge kam, bei dem er sich den Arm brach. Keim ist Mainzer, also ist der Schelm nicht weit, und ein paar Witze gibt’s auch, etwa diesen: “Ein Trompeter übt jeden Tag volle acht Stunden lang. Da sagt ein Kollege zu ihm: ‘Wie schaffst du das nur? Also ich könnte das nicht.’ ‘man muss eben wissen, was man will.’ ‘Und was willst du?’ ‘Die Wohnung nebenan!'” Ein Nachschlagewerk, das es also nicht an Abwechslung mangeln lässt, spannend zu durchblättern und für Trompetenliebhaber — wie schon Band 1 — ein absolutes Muss.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Clarinet Bird. Rolf Kühn. Jazzgespräche
von Maxi Sickert
Berlin 2009 (Christian Broecking Verlag), passim (F)
242 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-938763-10-0
 Es ist vielleicht das spannendste deutsche Jazzbuch des Jahres 2009, und man wundert sich, warum niemand früher auf die Idee gekommen ist, die Geschichte des Klarinettisten Rolf Kühn festzuhalten, der in den späten 1940er und den 1950er Jahren als junger Star des deutschen Jazz gefeiert wurde, den es dann nach New York verschlug, wo er mit Benny Goodman und Billie Holiday spielte, bevor er in den 1960er Jahren wieder zurück nach Deutschland kam, sich — auch angespornt durch das Zusammenspiel mit seinem jüngeren Bruder Joachim — avancierteren Stilrichtungen zuwandte, bevor er in den 1980er Jahren vor allem als Dirigent und Filmkomponist in Erscheinung trat. Die Liebe zum Jazz aber ließ ihn nie los, und von ihr handelt dieses Buch. Maxi Sickert lässt Rolf Kühn erzählen, über seine Kindheit in Leipzig, seinen Onkel und seine Tante, die als Juden in Auschwitz ermordet wurden, über seine Eltern und die Arbeit seines Vaters als Zirkusakrobat, über die ersten Klarinettenstunden und den ersten Jazz, über Jutta Hipp, den RIAS und das 1. Deutsche Jazz Festival in Frankfurt. Er traf den amerikanischen Klarinettisten Buddy De Franco und entschied sich, nach Amerika zu gehen, traf dort auf Friedrich Gulda und John Hammond, der seine erste amerikanische Platte produzierte. Ein langes Kapitel befasst sich mit Benny Goodman, in dessen Orchester Kühn von 1958 bis 1960 saß. 1960 spielte er mit Jimmy Garrison im Small’s Paradise; damals wohnte er auf der 87sten Straße im selben Haus wie Billie Holiday. Für Cannonball Adderley schrieb er Streicherarrangements und war danach auch sonst als Arrangeur für Platten und Werbefilme aktiv. 1961 kehrte Kühn zurück nach Deutschland. In den 1960er Jahren trat er oft bei den legendären NDR Jazz-Workshops auf, lernte außerdem Dirigieren. 1966 war Kühn bei der Uraufführung von Gunther Schullers Oper “The Visitation” in Hamburg mit von der Partie, die neben dem klassischen Klangkörper auch ein Jazzensemble verwandte (und hier erzählt neben Kühn auch Schuller persönlich). Ebenfalls 1966 floh Joachim Kühn aus der DDR und die beiden Brüder taten sich in einer neuen Band zusammen. Sie traten 1967 beim Newport Jazz Festival auf und nahmen die Platte “Impressions of New York” auf. (Auch Joachim Kühn kommt ausführlich zu Wort im Buch.) Rolf Kühn erzählt über Joachim Ernst Berendt und das Plattenkabel MPS, über die Tücken seines Instruments, der Klarinette, und seine Begegnung mit Ornette Coleman. Schließlich erzählt er von seiner jüngsten Band, einem Trio mit dem Schlagzeuger Christian Lillinger, dem Gitarristen Ronny Graupe und dem Bassisten Johannes Fink. Und in einem “Letze Fragen” überschrieben Rundumschlag äußert er sich über Drogen, Rassismus, Musicals und die Eigenständigkeit des deutschen Jazz. Ausgespart sind seine Zeiten als musikalischer Leiter des Theater des Westens, Informationen über seine Filmmusiken oder persönlichere Erfahrungen, etwa in seiner Ehe mit der Schauspielerin Judy Winter. Aber dann heißt der Untertitel des Buchs ja auch “Jazzgespräche”. 35 Seiten mit seltenen Fotos runden das Buch ab, das von Maxi Sickert zu einer äußerst lesenswerten und unterhaltsamen Reise durch die deutsche Jazzgeschichte und die Entwicklung eines vielschichtigen Musikers zusammengefasst wurde, ein Buch das vieles erklärt, was in vielleicht sachlicheren Büchern zur Jazzgeschichte nicht erwähnt wird, was aber die Schubladen ein wenig durcheinander rüttelt, weil sich Jazzbiographien nun mal selten in einer einzigen ästhetischen Schublade abspielen. Es ist ein Musterbeispiel einer von der Herausgeberin mit sicherer Hand geführten Autobiographie, die am Schluss neugierig macht auf den Klang des Protagonisten, der dankenswerter Weise zum 80sten Geburtstag Kühns auf etlichen CD-Wiederveröffentlichungen wieder greif- und hörbar ist.
Es ist vielleicht das spannendste deutsche Jazzbuch des Jahres 2009, und man wundert sich, warum niemand früher auf die Idee gekommen ist, die Geschichte des Klarinettisten Rolf Kühn festzuhalten, der in den späten 1940er und den 1950er Jahren als junger Star des deutschen Jazz gefeiert wurde, den es dann nach New York verschlug, wo er mit Benny Goodman und Billie Holiday spielte, bevor er in den 1960er Jahren wieder zurück nach Deutschland kam, sich — auch angespornt durch das Zusammenspiel mit seinem jüngeren Bruder Joachim — avancierteren Stilrichtungen zuwandte, bevor er in den 1980er Jahren vor allem als Dirigent und Filmkomponist in Erscheinung trat. Die Liebe zum Jazz aber ließ ihn nie los, und von ihr handelt dieses Buch. Maxi Sickert lässt Rolf Kühn erzählen, über seine Kindheit in Leipzig, seinen Onkel und seine Tante, die als Juden in Auschwitz ermordet wurden, über seine Eltern und die Arbeit seines Vaters als Zirkusakrobat, über die ersten Klarinettenstunden und den ersten Jazz, über Jutta Hipp, den RIAS und das 1. Deutsche Jazz Festival in Frankfurt. Er traf den amerikanischen Klarinettisten Buddy De Franco und entschied sich, nach Amerika zu gehen, traf dort auf Friedrich Gulda und John Hammond, der seine erste amerikanische Platte produzierte. Ein langes Kapitel befasst sich mit Benny Goodman, in dessen Orchester Kühn von 1958 bis 1960 saß. 1960 spielte er mit Jimmy Garrison im Small’s Paradise; damals wohnte er auf der 87sten Straße im selben Haus wie Billie Holiday. Für Cannonball Adderley schrieb er Streicherarrangements und war danach auch sonst als Arrangeur für Platten und Werbefilme aktiv. 1961 kehrte Kühn zurück nach Deutschland. In den 1960er Jahren trat er oft bei den legendären NDR Jazz-Workshops auf, lernte außerdem Dirigieren. 1966 war Kühn bei der Uraufführung von Gunther Schullers Oper “The Visitation” in Hamburg mit von der Partie, die neben dem klassischen Klangkörper auch ein Jazzensemble verwandte (und hier erzählt neben Kühn auch Schuller persönlich). Ebenfalls 1966 floh Joachim Kühn aus der DDR und die beiden Brüder taten sich in einer neuen Band zusammen. Sie traten 1967 beim Newport Jazz Festival auf und nahmen die Platte “Impressions of New York” auf. (Auch Joachim Kühn kommt ausführlich zu Wort im Buch.) Rolf Kühn erzählt über Joachim Ernst Berendt und das Plattenkabel MPS, über die Tücken seines Instruments, der Klarinette, und seine Begegnung mit Ornette Coleman. Schließlich erzählt er von seiner jüngsten Band, einem Trio mit dem Schlagzeuger Christian Lillinger, dem Gitarristen Ronny Graupe und dem Bassisten Johannes Fink. Und in einem “Letze Fragen” überschrieben Rundumschlag äußert er sich über Drogen, Rassismus, Musicals und die Eigenständigkeit des deutschen Jazz. Ausgespart sind seine Zeiten als musikalischer Leiter des Theater des Westens, Informationen über seine Filmmusiken oder persönlichere Erfahrungen, etwa in seiner Ehe mit der Schauspielerin Judy Winter. Aber dann heißt der Untertitel des Buchs ja auch “Jazzgespräche”. 35 Seiten mit seltenen Fotos runden das Buch ab, das von Maxi Sickert zu einer äußerst lesenswerten und unterhaltsamen Reise durch die deutsche Jazzgeschichte und die Entwicklung eines vielschichtigen Musikers zusammengefasst wurde, ein Buch das vieles erklärt, was in vielleicht sachlicheren Büchern zur Jazzgeschichte nicht erwähnt wird, was aber die Schubladen ein wenig durcheinander rüttelt, weil sich Jazzbiographien nun mal selten in einer einzigen ästhetischen Schublade abspielen. Es ist ein Musterbeispiel einer von der Herausgeberin mit sicherer Hand geführten Autobiographie, die am Schluss neugierig macht auf den Klang des Protagonisten, der dankenswerter Weise zum 80sten Geburtstag Kühns auf etlichen CD-Wiederveröffentlichungen wieder greif- und hörbar ist.
(Wolfram Knauer (Januar 2010)
The Year Before the Flood. A Story of New Orleans
von Ned Sublette
Chicago 2009 (Lawrence Hill Books)
452 Seiten
ISBN: 978-1-55652-824-8
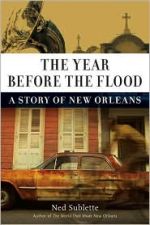 Wo Ned Sublette in seinem bereits besprochenen, vielgerühmten Buch zur Kolonialisierung von New Orleans die Frühgeschichte der Stadt erzählt, in der der Jazz geboren wurde, da beleuchtet er in seinem neuesten Buch die Stadt in der Gegenwart des Jahres 2005, im Jahr vor dem Hurricane Katrina, der die Stadt in ihren Grundfesten erschütterte, nicht nur die architektonische Schäden anrichtete, sondern die Struktur der Stadt als soziales Gebilde, ja sogar ihre bloße Existenz in Frage stellte. Das Manuskript über das Leben in New Orleans war ebreits weit forgeschritten, als der Hurricane am 27. August 2005 auf die Stadt am MississippiDelta zustürmte.Jeder in New Orleans habe gewusst, dass eine Katastrophe bevorstand, und jeder habe es offenen Auges verdrängt. Auch die Armen hätten es gewusst, und sie hätte es am stärksten getroffen. Sie seien schließlich mit OneWayTickets aus der Stadt gebracht worden und ihre Rückkehr sei durch Bürokratie oder die Dampfwalzen der Regierung erschwert oder unmöglich gemachtt worden. Das Buch entstand parallel zu seinen Forschungen zu den kulturellen Verbindungen zwischen New Orleans, Kuba und Santo Domingo im 18. und 19. Jahrhundert. Nach Katrina lag das Manuskript auf seinem Schreibtisch; die Folgen des Hurricanes waren so enorm, dass Sublette das Buchthema änderte und neben den sozialen und kulturellen Bedingungen der Stadt auch deren Bezug zur Gegenwart aufzeigen wollte, zur Zeit vor und zur Zeit nach Katrina. Das Buch enthält viele autobiographische Notizen — Sublette lebte bis zu seinem neunten Lebensjahr in New Orleans — hier finden sich die meisten und eindringlichsten historischen Informationen über den alltäglichen Rassismus der 50er, 60er und 70er Jahre und die Probleme ihn zu überkommen. Ein längerer Exkurs erzählt die Geschichte des rassistischen Films “The Birth of a Nation” von 1915, daneben aber auch Sublettes eigenen Erlebnisse mit dem Rassismus des amerikanischen Süden oder über die Arbeitsmöglichkeiten für schwarze Musiker im New Orleans der 1950er Jahre. Er erzählt Geschichten über seinen Aufenthalt für die Recherchen zu dem Buch, im jahr vor Katrina, über die sozialen Ungleichheiten der Stadt, über den Kulturschock, den er als mittlerweile New Yorker bei der Rückkehr in den Süden empfand, über alte Jazzmusiker und die Hip-Hop-Szene der Stadt, über Mardi Gras und die karribischen Verbindungen, über das JazzFest, Super Sunday und den “mörderischen Sommer” vor dem Hurricane. Schließlich der kürzere dritte Teil des Buchs, geschrieben nach Katrina, im Schock der Ereignisse und der hilflosen Versuche einer Rettung der Stadt. New Orleans sei immer anders als alle anderen Großstädte der USA gewesen, schreibt Sublette: Die Stadt mit dem unsichersten Boden des Landes wurde bewohnt von den Menschen mit den tiefsten Wurzeln. Die meisten der Menschen, die in New Orleans lebten, waren sein Generationen in der Stadt verwurzelt. Genau das ist es, was er in seinem Buch nachzuzeichnen evrsucht, und die persönliche Betroffenheit, mit der er Gegenwart, Geschichte und Autobiographisches verwebt macht das Buch zu einer spannenden Lektüre, die einen zurückläßt einw enig wie der Blues: traurig, aber hoffend und in jedem Fall beeindruckt vond er Stärke der in die Geschichte verwickelten Menschen.
Wo Ned Sublette in seinem bereits besprochenen, vielgerühmten Buch zur Kolonialisierung von New Orleans die Frühgeschichte der Stadt erzählt, in der der Jazz geboren wurde, da beleuchtet er in seinem neuesten Buch die Stadt in der Gegenwart des Jahres 2005, im Jahr vor dem Hurricane Katrina, der die Stadt in ihren Grundfesten erschütterte, nicht nur die architektonische Schäden anrichtete, sondern die Struktur der Stadt als soziales Gebilde, ja sogar ihre bloße Existenz in Frage stellte. Das Manuskript über das Leben in New Orleans war ebreits weit forgeschritten, als der Hurricane am 27. August 2005 auf die Stadt am MississippiDelta zustürmte.Jeder in New Orleans habe gewusst, dass eine Katastrophe bevorstand, und jeder habe es offenen Auges verdrängt. Auch die Armen hätten es gewusst, und sie hätte es am stärksten getroffen. Sie seien schließlich mit OneWayTickets aus der Stadt gebracht worden und ihre Rückkehr sei durch Bürokratie oder die Dampfwalzen der Regierung erschwert oder unmöglich gemachtt worden. Das Buch entstand parallel zu seinen Forschungen zu den kulturellen Verbindungen zwischen New Orleans, Kuba und Santo Domingo im 18. und 19. Jahrhundert. Nach Katrina lag das Manuskript auf seinem Schreibtisch; die Folgen des Hurricanes waren so enorm, dass Sublette das Buchthema änderte und neben den sozialen und kulturellen Bedingungen der Stadt auch deren Bezug zur Gegenwart aufzeigen wollte, zur Zeit vor und zur Zeit nach Katrina. Das Buch enthält viele autobiographische Notizen — Sublette lebte bis zu seinem neunten Lebensjahr in New Orleans — hier finden sich die meisten und eindringlichsten historischen Informationen über den alltäglichen Rassismus der 50er, 60er und 70er Jahre und die Probleme ihn zu überkommen. Ein längerer Exkurs erzählt die Geschichte des rassistischen Films “The Birth of a Nation” von 1915, daneben aber auch Sublettes eigenen Erlebnisse mit dem Rassismus des amerikanischen Süden oder über die Arbeitsmöglichkeiten für schwarze Musiker im New Orleans der 1950er Jahre. Er erzählt Geschichten über seinen Aufenthalt für die Recherchen zu dem Buch, im jahr vor Katrina, über die sozialen Ungleichheiten der Stadt, über den Kulturschock, den er als mittlerweile New Yorker bei der Rückkehr in den Süden empfand, über alte Jazzmusiker und die Hip-Hop-Szene der Stadt, über Mardi Gras und die karribischen Verbindungen, über das JazzFest, Super Sunday und den “mörderischen Sommer” vor dem Hurricane. Schließlich der kürzere dritte Teil des Buchs, geschrieben nach Katrina, im Schock der Ereignisse und der hilflosen Versuche einer Rettung der Stadt. New Orleans sei immer anders als alle anderen Großstädte der USA gewesen, schreibt Sublette: Die Stadt mit dem unsichersten Boden des Landes wurde bewohnt von den Menschen mit den tiefsten Wurzeln. Die meisten der Menschen, die in New Orleans lebten, waren sein Generationen in der Stadt verwurzelt. Genau das ist es, was er in seinem Buch nachzuzeichnen evrsucht, und die persönliche Betroffenheit, mit der er Gegenwart, Geschichte und Autobiographisches verwebt macht das Buch zu einer spannenden Lektüre, die einen zurückläßt einw enig wie der Blues: traurig, aber hoffend und in jedem Fall beeindruckt vond er Stärke der in die Geschichte verwickelten Menschen.
(Wolfram Knauer)
Ellington Uptown. Duke Ellington, James P. Johnson, and the Birth of Cool Jazz
von John Howland
Ann Arbor 2009 (University of Michigan Press)
340 Seiten, 28,95 US-$
ISBN: 978-0-472-03316-4
 Wenn man von “sinfonischem jazz” spricht, so tut man das in Jazzerkreisen meist etwas herablassend und denkt an die Aufnahmen Paul Whitemans, der eine “Lady” aus dem Jazz machen wollte, die raue Musik der Afro-Amerikaner in schöne Kleider verpacken, sie aus den Kaschemmen nehmen und in die Konzertsäle des Landes bringen wollte. Nun ist das schon mit der Verteufelung Paul Whitemans so eine Sache: Nicht nur hatte er in seiner Band immer hervorragende Jazzsolisten (Bix Beiderbecke etwa oder Frank Trumbauer, aber auch Joe Venuti, Jack Tegarden und viele andere). Vor allem aber gehörchte sein ästhetisches Konzept völlig anderen Gesetzen als das des Jazz derselben Zeit — ihn also nach den Maßstäben zu messen, die man an Armstrong, Morton, Ellington, Henderson und andere anlegte, wäre beiden Seiten gegenüber völlig unangemessen. John Howland beleuchtet in seinem Buch eine oft vergessene Seite dieses “sinfonischen Jazz”, die Annäherung von schwarzen Jazzkomponisten ans Oeuvre ihrer klassischen Kollegen. Schon ältere Musiker wie Will Marion Cook, Will Vodery, James Reese Europe und andere hatten mit ihrer Musik nicht nur auf die Tanz-, sondern auch auf die Konzertsäle gezielt, wollten eine Musik schreiben, die nicht nur in die Beine ging, sondern auch als Konzertmusik überdauern konnte. Vor allem der Pianist und Komponist James P. Johnson sowie der Pianist und Bandleader Duke Ellington nahmen sich des Oeuvres eines Konzertjazz ernsthaft und langfristig an und schrieben Kompositionen, die die üblichen formalen und ästhetischen Modelle des Jazz durchbrachen. Howland diskutiert die grundsätzliche Idee eines “sinfonischen Jazz”, wie sie sich erstmals in Paul Whitemans Aeolian-Hall-Konzert “First Experiment in Modern Music” von 1924 zeigte und die Reaktionen auf Jazz und “Kunst-Jazz” von ganz unterschiedlichen Seiten: jener der klassischen Kritiker genauso wie jener der Wortführer der Harlem Renaissance, die jedem künstlerischen Konzept gegenüber weitaus aufgeschlossener waren als einer schwarzen Folklore. In einem ersten Kapitel beschreibt Howland das vielfältige Beziehungsgeflecht zwischen Jazz, Blues und schwarzem Entertainment, innerhalb dessen auch Johnson und Ellington ihre oft für die Bühne konzipierten Werke erarbeiteten. Ein zweites Kapitel ist Johnsons “Yamekraw” gewidmet, einer Komposition, die auf volksmusikalischen Melodien aus den amerikanischen Südstaaten (Georgia, South Carolina) basiert. Im dritten Kapitel beschreibt er, wie die Konzertambitionen und die Bühnenmusikerfahrungen beider Komponisten, Johnson und Ellington, sich gegenseitig beeinflussten, analysisert Ellingtons Cotton-Club-Shows oder seinen Kurzfilm “Symphony in Black”, um dann im vierten Kapitel die “extended compositions” des Duke zu untersuchen, von “Rhapsody Junior” (1926) bis zu “Black, Brown and Beige” (1943) und sie mit Kompositionen aus dem Whiteman’schen Oeuvre zu vergleichen. Für ein Kapitel über Johnsons “Harlem Symphony” greift Howland auf bislang unbekanntes Material im Johnson-Nachlass zurück und betrachtet in einem sechsten Kapitel Ellingtons Carnegie-Hall-Konzerte über die Jahre und die programmatischen Ideen, die ihnen zugrunde lagen. Sein Schlusskapitel vergleicht die unterschiedlichen ästhetischen Ansätze seiner beiden protagonisten und diskutiert ihren ästhetischen wie kompositorischen Einfluss. Howlands Buch deckt damit eine vielfach vernachlässigte Seite der Jazzgeschichte auf, in gründlich recherchierten, mit Notenbeispielen und Formanalysen durchsetzten Argumentationssträngen, die einmal mehr klar machen, dass viele Jazzmusiker, die man allgemein vor allem für ihre gutgelaunte Musik schätzt, ganz andere Motivationen hatten, dass noch hinter dem swingendsten Stück Musik jede Menge ästhetischen Wollens stecken kann — wenn man nur weiß, wo man schauen muss.
Wenn man von “sinfonischem jazz” spricht, so tut man das in Jazzerkreisen meist etwas herablassend und denkt an die Aufnahmen Paul Whitemans, der eine “Lady” aus dem Jazz machen wollte, die raue Musik der Afro-Amerikaner in schöne Kleider verpacken, sie aus den Kaschemmen nehmen und in die Konzertsäle des Landes bringen wollte. Nun ist das schon mit der Verteufelung Paul Whitemans so eine Sache: Nicht nur hatte er in seiner Band immer hervorragende Jazzsolisten (Bix Beiderbecke etwa oder Frank Trumbauer, aber auch Joe Venuti, Jack Tegarden und viele andere). Vor allem aber gehörchte sein ästhetisches Konzept völlig anderen Gesetzen als das des Jazz derselben Zeit — ihn also nach den Maßstäben zu messen, die man an Armstrong, Morton, Ellington, Henderson und andere anlegte, wäre beiden Seiten gegenüber völlig unangemessen. John Howland beleuchtet in seinem Buch eine oft vergessene Seite dieses “sinfonischen Jazz”, die Annäherung von schwarzen Jazzkomponisten ans Oeuvre ihrer klassischen Kollegen. Schon ältere Musiker wie Will Marion Cook, Will Vodery, James Reese Europe und andere hatten mit ihrer Musik nicht nur auf die Tanz-, sondern auch auf die Konzertsäle gezielt, wollten eine Musik schreiben, die nicht nur in die Beine ging, sondern auch als Konzertmusik überdauern konnte. Vor allem der Pianist und Komponist James P. Johnson sowie der Pianist und Bandleader Duke Ellington nahmen sich des Oeuvres eines Konzertjazz ernsthaft und langfristig an und schrieben Kompositionen, die die üblichen formalen und ästhetischen Modelle des Jazz durchbrachen. Howland diskutiert die grundsätzliche Idee eines “sinfonischen Jazz”, wie sie sich erstmals in Paul Whitemans Aeolian-Hall-Konzert “First Experiment in Modern Music” von 1924 zeigte und die Reaktionen auf Jazz und “Kunst-Jazz” von ganz unterschiedlichen Seiten: jener der klassischen Kritiker genauso wie jener der Wortführer der Harlem Renaissance, die jedem künstlerischen Konzept gegenüber weitaus aufgeschlossener waren als einer schwarzen Folklore. In einem ersten Kapitel beschreibt Howland das vielfältige Beziehungsgeflecht zwischen Jazz, Blues und schwarzem Entertainment, innerhalb dessen auch Johnson und Ellington ihre oft für die Bühne konzipierten Werke erarbeiteten. Ein zweites Kapitel ist Johnsons “Yamekraw” gewidmet, einer Komposition, die auf volksmusikalischen Melodien aus den amerikanischen Südstaaten (Georgia, South Carolina) basiert. Im dritten Kapitel beschreibt er, wie die Konzertambitionen und die Bühnenmusikerfahrungen beider Komponisten, Johnson und Ellington, sich gegenseitig beeinflussten, analysisert Ellingtons Cotton-Club-Shows oder seinen Kurzfilm “Symphony in Black”, um dann im vierten Kapitel die “extended compositions” des Duke zu untersuchen, von “Rhapsody Junior” (1926) bis zu “Black, Brown and Beige” (1943) und sie mit Kompositionen aus dem Whiteman’schen Oeuvre zu vergleichen. Für ein Kapitel über Johnsons “Harlem Symphony” greift Howland auf bislang unbekanntes Material im Johnson-Nachlass zurück und betrachtet in einem sechsten Kapitel Ellingtons Carnegie-Hall-Konzerte über die Jahre und die programmatischen Ideen, die ihnen zugrunde lagen. Sein Schlusskapitel vergleicht die unterschiedlichen ästhetischen Ansätze seiner beiden protagonisten und diskutiert ihren ästhetischen wie kompositorischen Einfluss. Howlands Buch deckt damit eine vielfach vernachlässigte Seite der Jazzgeschichte auf, in gründlich recherchierten, mit Notenbeispielen und Formanalysen durchsetzten Argumentationssträngen, die einmal mehr klar machen, dass viele Jazzmusiker, die man allgemein vor allem für ihre gutgelaunte Musik schätzt, ganz andere Motivationen hatten, dass noch hinter dem swingendsten Stück Musik jede Menge ästhetischen Wollens stecken kann — wenn man nur weiß, wo man schauen muss.
(Wolfram Knauer)
Jazz und seine Musiker im Roman. “Vernacular and Sophisticated”
von Alexander Ebert
Hamburg 2009 (Verlag Dr. Kovac)
326 Seiten, 68 Euro
ISBN: 978-3-8300-4567-0
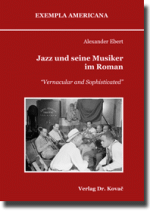 Der Jazz war immer wieder Thema der Literatur, ob in seiner improvisatorischen Faszination oder in der Persönlichkeit von Jazzmusikern, also als ein Idealbild des Künstlers, wie es eh gern in Romanen thematisiert wird. Alexander Ebert untersucht in seiner im Fachbereich Amerikanistik verfassten Dissertation sieben Romane, in denen Jazz oder Jazzmusikern eine wichtige Rolle zukommt: Langston Hughes’ “Not Without Laughter” (1930), Dorothy Bakers “Young Man With a Horn” (1938), Ralph Ellisons “Invisible Man” (1952), John Clellon Holmes “The Horn” (1958), Albert Murrays “Train Whistle Guitar” (1974), Michael Ondaatjes “Coming Through Slaughter” (1979), Toni Morrisons “Jazz” (1992) sowie als Einleitung F. Scott Fitzgeralds “The Great Gatsby”. Ebert untersucht sie auf die unterschiedliche Bedeutung des “vernacular”, also eines spezifisch afro-amerikanischen Umgangs mit Sprache (und Musik) und auf die Beziehung dieses “vernacular” mit Aspekten des Blues oder des Jazz (bzw. besser: des Blues- oder des Jazzspielens, oder gar: des Blues- oder des Jazzlebens). Es ist eine Dissertation, also keineswegs Einführungsliteratur zum Thema, und Eberts Bezüge auf Sekundärliteratur können den ungeübten Leser leicht stärker irritieren als sie ihm die Dinge veranschaulichen, zumal sie in der Regel unkommentiert und höchstens zur Unterstreichung der eigenen Argumentation übernommen werden. Es ist das alte Probelm deutscher Dissertationsordnungen, die Doktoranden dazu verdonnern ihre Dissertationen im Ton der Doktorarbeit zu veröffentlichen statt sie für die Publikation “leserlicher” zu machen. In den USA läuft das anders: Aus Dissertationen entstandene Buchpublikationen müssen grundsätzlich in eine Schriftfassung gebracht werden, von der der Verlag der Meinung ist, dass sie sich sich auch auf dem (Fach-)Markt behaupten kann. Das allerdings wird schwierig mit Sätzen wie: “Die durch das blues idiom transformierten, in das Verhaltensschema der einzelnen Charaktere implantierten affirmativen Selbstdarstellungscharakteristika werden von den hier behandelten afroamerikanischen Autoren in ihrer Wirkung stets basierend auf Erfahrungen der Adoleszenzphase vorgestellt.” Was Ebert in seiner Studie nur am Rande behandelt, ist die Tatsache, dass “Jazz” und “Jazz” auch in Afro-Amerika durchaus unterschiedliche Dinge sind, dass es nicht nur Wechsel im musikalischen, sondern auch im ästhetischen Ansatz gab und damit verbunden Änderungen in der Wahrnehmung sowohl in der Fachwelt wie auch in der breiteren Öffentlichkeit, dass schließlich die Bedeutung von “Jazz” je nach Position des Betrachtenden eine komplett andere sein konnte und selbst bei einzelnen Autoren (Ellison und Murray insbesondere) laufend Positionsverschiebungen stattfinden. Seine Studien belegen, wie Ebert schreibt, “welche unterschiedlichen Annäherungsweisen an den Jazz als Kultur möglich” seien. Sein Buch ist auf jeden Fall eine große Fleißarbeit, die vor allem herausfindet, wie sprachliche Aspekte (also das “vernacular”, für das mir auch bei Ebert aber dann doch noch eine bessere Definition fehlt) unterschiedlich eingesetzt werden, ob als störender Impuls, als eine “sich selbst aus dem Unterbewusstsein heraus ebnende Größe”, als eine prägende Erfahrung oder aber auf abstrakterer Ebene.
Der Jazz war immer wieder Thema der Literatur, ob in seiner improvisatorischen Faszination oder in der Persönlichkeit von Jazzmusikern, also als ein Idealbild des Künstlers, wie es eh gern in Romanen thematisiert wird. Alexander Ebert untersucht in seiner im Fachbereich Amerikanistik verfassten Dissertation sieben Romane, in denen Jazz oder Jazzmusikern eine wichtige Rolle zukommt: Langston Hughes’ “Not Without Laughter” (1930), Dorothy Bakers “Young Man With a Horn” (1938), Ralph Ellisons “Invisible Man” (1952), John Clellon Holmes “The Horn” (1958), Albert Murrays “Train Whistle Guitar” (1974), Michael Ondaatjes “Coming Through Slaughter” (1979), Toni Morrisons “Jazz” (1992) sowie als Einleitung F. Scott Fitzgeralds “The Great Gatsby”. Ebert untersucht sie auf die unterschiedliche Bedeutung des “vernacular”, also eines spezifisch afro-amerikanischen Umgangs mit Sprache (und Musik) und auf die Beziehung dieses “vernacular” mit Aspekten des Blues oder des Jazz (bzw. besser: des Blues- oder des Jazzspielens, oder gar: des Blues- oder des Jazzlebens). Es ist eine Dissertation, also keineswegs Einführungsliteratur zum Thema, und Eberts Bezüge auf Sekundärliteratur können den ungeübten Leser leicht stärker irritieren als sie ihm die Dinge veranschaulichen, zumal sie in der Regel unkommentiert und höchstens zur Unterstreichung der eigenen Argumentation übernommen werden. Es ist das alte Probelm deutscher Dissertationsordnungen, die Doktoranden dazu verdonnern ihre Dissertationen im Ton der Doktorarbeit zu veröffentlichen statt sie für die Publikation “leserlicher” zu machen. In den USA läuft das anders: Aus Dissertationen entstandene Buchpublikationen müssen grundsätzlich in eine Schriftfassung gebracht werden, von der der Verlag der Meinung ist, dass sie sich sich auch auf dem (Fach-)Markt behaupten kann. Das allerdings wird schwierig mit Sätzen wie: “Die durch das blues idiom transformierten, in das Verhaltensschema der einzelnen Charaktere implantierten affirmativen Selbstdarstellungscharakteristika werden von den hier behandelten afroamerikanischen Autoren in ihrer Wirkung stets basierend auf Erfahrungen der Adoleszenzphase vorgestellt.” Was Ebert in seiner Studie nur am Rande behandelt, ist die Tatsache, dass “Jazz” und “Jazz” auch in Afro-Amerika durchaus unterschiedliche Dinge sind, dass es nicht nur Wechsel im musikalischen, sondern auch im ästhetischen Ansatz gab und damit verbunden Änderungen in der Wahrnehmung sowohl in der Fachwelt wie auch in der breiteren Öffentlichkeit, dass schließlich die Bedeutung von “Jazz” je nach Position des Betrachtenden eine komplett andere sein konnte und selbst bei einzelnen Autoren (Ellison und Murray insbesondere) laufend Positionsverschiebungen stattfinden. Seine Studien belegen, wie Ebert schreibt, “welche unterschiedlichen Annäherungsweisen an den Jazz als Kultur möglich” seien. Sein Buch ist auf jeden Fall eine große Fleißarbeit, die vor allem herausfindet, wie sprachliche Aspekte (also das “vernacular”, für das mir auch bei Ebert aber dann doch noch eine bessere Definition fehlt) unterschiedlich eingesetzt werden, ob als störender Impuls, als eine “sich selbst aus dem Unterbewusstsein heraus ebnende Größe”, als eine prägende Erfahrung oder aber auf abstrakterer Ebene.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Fats Waller on the Air. Additions and Corrections
von Stephen Taylor
“Additions and Corrections” update
Stephen Taylors hat Ergänzungen und Korrekturen zu seiner umfassenden Discographie von Livemitschnitten Fats Wallers, “Fats Waller on the Air. The Radio Broadcasts & Discography”, online gestellt. Die 73-seitige pdf-Datei kann direkt auf der Website seines Buchs runtergeladen werden.
Stephen Taylor has updated his comprehensive discography of radio broadcasts, “Fats Waller on the Air. The Radio Broadcasts & Discography”, with “additions and corrections” which can be downloaded for free on the website of his book.
The Jazz Composer. Moving Music Off the Paper
von Graham Collier
London 2009 (Northway Publications)
338 Seiten, 19,99 £
ISBN: 978-09557888-0-2
 Graham Collier war immer ein streitbarer Beobachter der Jazzszene, in der er selbst seit über mehr als vier Jahrzehnten aktiv teilnimmt. Er begann als Kontrabassist, machte sich dann auch als Komponist und Bandleader einen Namen, durch dessen Ensembles viele der wichtigsten britischen Musiker gingen. Er unterrichtete an der Royal Academy in Music, gibt bis heute viele Workshops und schreibt Kompositionen für unterschiedliche Ensembles von kleineren Besetzungen bis hin zur Bigband. Daneben war er immer auch schriftstellerisch tätig, verfasste mehrere Bücher zur Jazzpädagogik sowie eine regelmäßige Kolumne für das Magazin “Jazz Changes” der International Association of Schools of Jazz. Sein neuestes Buch befasst sich in erster Linie mit der Rolle des Jazzkomponisten und seinen Möglichkeiten innerhalb des Metiers. Er fragt, was Arrangements bewirken können und sollen, welche unterschiedlichen Arten von “Komposition” es im Jazz gibt, zwischen originärer Erfindung, Kompilation und Arrangement, geht auf konkrete Beispiele ein, vorrangig Duke Ellington und Miles Davis, daneben aber auch auf Kollegen wie Charles Mingus, Ornette Coleman, Wayne Shorter, Gil Evans, die Idee des Third Stream oder im letzten Kapitel auf seine eigenen Kompositionen. Dazwischen aber, und das macht das Buch wirklich lesenswert, gibt Collier jede Menge Ansichten zum Jazz, seiner Ästhetik, seiner Rezeption und erzählt aus seinen eigenen Erfahrungen. Das Kapitel “It Ain’t Who You Are (It’s the Way That You Do It)” beispielsweise beschäftigt sich sowohl mit den Erfahrungen eines europäischen Musikers in einer ursprünglich amerikanischen Musik, mit sexistischen und homophoben Ansichten von Musikern und Kritikern (Collier ist selbst lebt offen schwul) sowie mit einer seltsamen Art von Rassismus, der man als weißer Musiker in der afro-amerikanischen Musiksprache des Jazz schon mal begegnen kann. Die kleinen polemischen Asides seines Buchs laden zum Nachdenken und Mitargumentieren ein, darüber etwa, welche Rolle die Tradition im Jazz spielt, inwiefern Komponisten im Jazz Kontrolle über ihre Solisten ausüben wollen, wie wichtig und wie frei Improvisation wirklich ist und vieles mehr. Collier schreibt lesens- und nachdenkenswert, nicht aus der Position des Allwissenden Jazzhistorikers, sondern aus der des kritischen Komponisten, des nachfragenden Hörers mit offenen Ohren, des an der Musik und dem Warum hinter ihr Interessierten. Er lässt genüdem Leser genügend Raum, seine eigenen Antworten auf viele der Fragen zu finden. Und komponiert damit quasi einen Diskurs zu Jazzästhetik und Komposition, dessen Solisten im besten Fall seine Leser sind. Absolut empfehlenswert!
Graham Collier war immer ein streitbarer Beobachter der Jazzszene, in der er selbst seit über mehr als vier Jahrzehnten aktiv teilnimmt. Er begann als Kontrabassist, machte sich dann auch als Komponist und Bandleader einen Namen, durch dessen Ensembles viele der wichtigsten britischen Musiker gingen. Er unterrichtete an der Royal Academy in Music, gibt bis heute viele Workshops und schreibt Kompositionen für unterschiedliche Ensembles von kleineren Besetzungen bis hin zur Bigband. Daneben war er immer auch schriftstellerisch tätig, verfasste mehrere Bücher zur Jazzpädagogik sowie eine regelmäßige Kolumne für das Magazin “Jazz Changes” der International Association of Schools of Jazz. Sein neuestes Buch befasst sich in erster Linie mit der Rolle des Jazzkomponisten und seinen Möglichkeiten innerhalb des Metiers. Er fragt, was Arrangements bewirken können und sollen, welche unterschiedlichen Arten von “Komposition” es im Jazz gibt, zwischen originärer Erfindung, Kompilation und Arrangement, geht auf konkrete Beispiele ein, vorrangig Duke Ellington und Miles Davis, daneben aber auch auf Kollegen wie Charles Mingus, Ornette Coleman, Wayne Shorter, Gil Evans, die Idee des Third Stream oder im letzten Kapitel auf seine eigenen Kompositionen. Dazwischen aber, und das macht das Buch wirklich lesenswert, gibt Collier jede Menge Ansichten zum Jazz, seiner Ästhetik, seiner Rezeption und erzählt aus seinen eigenen Erfahrungen. Das Kapitel “It Ain’t Who You Are (It’s the Way That You Do It)” beispielsweise beschäftigt sich sowohl mit den Erfahrungen eines europäischen Musikers in einer ursprünglich amerikanischen Musik, mit sexistischen und homophoben Ansichten von Musikern und Kritikern (Collier ist selbst lebt offen schwul) sowie mit einer seltsamen Art von Rassismus, der man als weißer Musiker in der afro-amerikanischen Musiksprache des Jazz schon mal begegnen kann. Die kleinen polemischen Asides seines Buchs laden zum Nachdenken und Mitargumentieren ein, darüber etwa, welche Rolle die Tradition im Jazz spielt, inwiefern Komponisten im Jazz Kontrolle über ihre Solisten ausüben wollen, wie wichtig und wie frei Improvisation wirklich ist und vieles mehr. Collier schreibt lesens- und nachdenkenswert, nicht aus der Position des Allwissenden Jazzhistorikers, sondern aus der des kritischen Komponisten, des nachfragenden Hörers mit offenen Ohren, des an der Musik und dem Warum hinter ihr Interessierten. Er lässt genüdem Leser genügend Raum, seine eigenen Antworten auf viele der Fragen zu finden. Und komponiert damit quasi einen Diskurs zu Jazzästhetik und Komposition, dessen Solisten im besten Fall seine Leser sind. Absolut empfehlenswert!
(Wolfram Knauer)
Weblink: www.jazzcontinuum.com.
Weblink: www.thejazzcomposer.com.
Jazz
von Gary Giddins & Scott DeVeaux
New York 2009 (W.W. Norton)
704 Seiten, 39,95 US-$
ISBN: 978-0-39306-861-0
 Es ist schon mutig, auf den weiß Gott nicht kleinen Jazzbuchmarkt ein neues dickes Buch zur gesamten Jazzgeschichte zu werfen. Gary Giddins, langjähriger Kritiker amerikanische für Zeitungen und Zeitschriften und Autor etlicher Bücher sowie Scott DeVeaux, Musikwissenschaftler und Autor des vielgelobten Buchs “The Birth of Bebop” haben sich für ihr neues Jazzbuch mit dem simplen Titel “Jazz” daher ein etwas anderes Konzept ausgedacht. Statt die Jazzgeschichte als eine Geschichte von Biographien zu erzählen, erzählen sie sie anhand von konkreten Stücken, von Aufnahmen. Biographische Kommentare sind durchaus auch vorhanden; die Titel aber stehen im Vordergrund, die Giddins und DeVeaux analysieren, beschreiben und in die Jazzgeschichte einordnen. Ihre Analysen bedienen sich dabei keiner Notenbeispiele und auch keiner allzu komplizierten Fachtermini — das Buch wendet sich an interessierte Fans, aber nicht dezidiert an Studenten oder Musikwissenschaftler. Analytische Anmerkungen zu Aufnahmen bestehen vor allem aus kurz gehaltenen Ablaufbeschreibungen, Chorus für Chorus mit vorgeschalteter Sekundenzahl, damit man die Beschreibungen beim Hören mitlesen kann. Das ist eine durchaus sinnvolle Herangehensweise, schult sie doch das Ohr des Lesers und richtet seine Aufmerksamkeit auf das, was in der Musik geschieht. Konkret sieht das dann so aus, dass ein Kapitel mit einer biographischen Einordnung des Künstlers beginnt, dann die Umstände des besprochenen Titels und/oder Albums erlöutert werden, bevor eine übersichtlich-tabellarische Ablaufbeschreibung den Leser zum Mithören/Mitlesen auffordert. Dem schließt sich in der Regel eine kurze Beschreibung des Einflusses des betreffenden Künstlers an. Pro Künstler findet sich meist ein besprochener Titel; und es sind nicht immer die “wichtigsten”, sondern oft solche, die Giddins und DeVeaux einfach als besonders gelungen für das hielten, was sie darstellen wollten. Armstrong, Ellington, Parker, Miles und einige andere Künstler sind mit mehr als einem Titel vertreten, meist, weil sie in ihrem Schaffen so unterschiedliche Seiten zeigten, dass die Beschränkung auf einen einzelnen Titel ihnen nicht gerecht würde. Über die Auswahl sowohl der so herausgestellten Künstler wie auch der Stücke mag man sich streiten; das Problem der Auswahl aber stellt sich bei jedem (insbesonders enzyklopädischen) Werk. Und neben den punktuellen Blicken auf einzelne Entwicklungen des Jazz gelingt es den beiden auch immer wieder Verbindungsschnüre zu ziehen, musikalische Entwicklungen oder Personalstile miteinander zu verknüofen, auf Einflüsse, parallele Entwicklungen etc. hinzuweisen. Natürlich nutzt das Buch so vor allem dann, wenn man die Musik auch wirklich vor sich hat — und am besten eine Auswahl, die genau die im Buch besprochenen Titel enthält. Das aber wird keine noch so gut bestückte Plattensammlung leisten — und so haben die Autoren zusätzlich auch gleich eine CD-Edition kuratiert, in der die 45 im Buch näher analysierten Titel enthalten sind, die allerdings separat erstanden werden muss und fast doppelt so teuer wie das Buch ist. Wer sich beides zulegt hat allerdings wirklich einen erstklassigen “Primer” zur Jazzgeschichte in der Hand: von der Original Dixieland Jass Band über King Oliver, Louis Armstrong, Bessie Smith, Ellington, Basie und Goodman, Parker, Gillespie und Monk, das Modern jazz Quartet und Dave Brubeck, den Free Jazz Ornette Colemans oder Cecil Taylors bis hin zur Avantgarde der 80er und 90er Jahre und selbst Beispielen aus jüngster Zeit. Was fehlt, ist Europa: Einzig Django Reinhardt und Jan Garbarek fanden Eingang in den Olymp von Giddins’ und Deveaux’s Gnaden. Aber dann ist diese Entscheidung wohl verständlich — hier wählten sie zwei Musiker aus, die auch auf den amerikanischen Jazz von nicht unerheblichem Einfluss waren. Und die europäische Jazzgeschichte sollte vielleicht tatsächlich von anderer Seite aufgearbeitet werden … wir arbeiten dran.
Es ist schon mutig, auf den weiß Gott nicht kleinen Jazzbuchmarkt ein neues dickes Buch zur gesamten Jazzgeschichte zu werfen. Gary Giddins, langjähriger Kritiker amerikanische für Zeitungen und Zeitschriften und Autor etlicher Bücher sowie Scott DeVeaux, Musikwissenschaftler und Autor des vielgelobten Buchs “The Birth of Bebop” haben sich für ihr neues Jazzbuch mit dem simplen Titel “Jazz” daher ein etwas anderes Konzept ausgedacht. Statt die Jazzgeschichte als eine Geschichte von Biographien zu erzählen, erzählen sie sie anhand von konkreten Stücken, von Aufnahmen. Biographische Kommentare sind durchaus auch vorhanden; die Titel aber stehen im Vordergrund, die Giddins und DeVeaux analysieren, beschreiben und in die Jazzgeschichte einordnen. Ihre Analysen bedienen sich dabei keiner Notenbeispiele und auch keiner allzu komplizierten Fachtermini — das Buch wendet sich an interessierte Fans, aber nicht dezidiert an Studenten oder Musikwissenschaftler. Analytische Anmerkungen zu Aufnahmen bestehen vor allem aus kurz gehaltenen Ablaufbeschreibungen, Chorus für Chorus mit vorgeschalteter Sekundenzahl, damit man die Beschreibungen beim Hören mitlesen kann. Das ist eine durchaus sinnvolle Herangehensweise, schult sie doch das Ohr des Lesers und richtet seine Aufmerksamkeit auf das, was in der Musik geschieht. Konkret sieht das dann so aus, dass ein Kapitel mit einer biographischen Einordnung des Künstlers beginnt, dann die Umstände des besprochenen Titels und/oder Albums erlöutert werden, bevor eine übersichtlich-tabellarische Ablaufbeschreibung den Leser zum Mithören/Mitlesen auffordert. Dem schließt sich in der Regel eine kurze Beschreibung des Einflusses des betreffenden Künstlers an. Pro Künstler findet sich meist ein besprochener Titel; und es sind nicht immer die “wichtigsten”, sondern oft solche, die Giddins und DeVeaux einfach als besonders gelungen für das hielten, was sie darstellen wollten. Armstrong, Ellington, Parker, Miles und einige andere Künstler sind mit mehr als einem Titel vertreten, meist, weil sie in ihrem Schaffen so unterschiedliche Seiten zeigten, dass die Beschränkung auf einen einzelnen Titel ihnen nicht gerecht würde. Über die Auswahl sowohl der so herausgestellten Künstler wie auch der Stücke mag man sich streiten; das Problem der Auswahl aber stellt sich bei jedem (insbesonders enzyklopädischen) Werk. Und neben den punktuellen Blicken auf einzelne Entwicklungen des Jazz gelingt es den beiden auch immer wieder Verbindungsschnüre zu ziehen, musikalische Entwicklungen oder Personalstile miteinander zu verknüofen, auf Einflüsse, parallele Entwicklungen etc. hinzuweisen. Natürlich nutzt das Buch so vor allem dann, wenn man die Musik auch wirklich vor sich hat — und am besten eine Auswahl, die genau die im Buch besprochenen Titel enthält. Das aber wird keine noch so gut bestückte Plattensammlung leisten — und so haben die Autoren zusätzlich auch gleich eine CD-Edition kuratiert, in der die 45 im Buch näher analysierten Titel enthalten sind, die allerdings separat erstanden werden muss und fast doppelt so teuer wie das Buch ist. Wer sich beides zulegt hat allerdings wirklich einen erstklassigen “Primer” zur Jazzgeschichte in der Hand: von der Original Dixieland Jass Band über King Oliver, Louis Armstrong, Bessie Smith, Ellington, Basie und Goodman, Parker, Gillespie und Monk, das Modern jazz Quartet und Dave Brubeck, den Free Jazz Ornette Colemans oder Cecil Taylors bis hin zur Avantgarde der 80er und 90er Jahre und selbst Beispielen aus jüngster Zeit. Was fehlt, ist Europa: Einzig Django Reinhardt und Jan Garbarek fanden Eingang in den Olymp von Giddins’ und Deveaux’s Gnaden. Aber dann ist diese Entscheidung wohl verständlich — hier wählten sie zwei Musiker aus, die auch auf den amerikanischen Jazz von nicht unerheblichem Einfluss waren. Und die europäische Jazzgeschichte sollte vielleicht tatsächlich von anderer Seite aufgearbeitet werden … wir arbeiten dran.
(Wolfram Knauer)
Weblink: www.garygiddins.com.
Jade Visions. The Life and Music of Scott LaFaro
von Helene LaFaro-Fernández
Denton/TX 2009 (University of North Texas Press)
322 Seiten, 24,95 US-$
ISBN: 978-1-57441-273-4
 Neben Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter und einigen anderen der großen Namen des modernen Jazz ist Scott LaFaro einer der Musiker, über die am häufigsten Diplomarbeiten geschrieben werden — so zumindest scheint es uns im Jazzinstitut, wo wir regelmäßig mit Anfragen zu dem früh verstorbenen Bassisten konfrontiert werden. Jetzt legt seine Schwester eine Biographie vor, die das nur fünfundzwanzigjährige Leben des Kontrabassisten beleuchtet. LaFaro wurde in eine italienisch-schottische Familie geboren, die früh erkannte, dass ihr Sohn musikalisch begabt war. Er spielte bereits mit drei Jahren Mandoline und nahm seine ersten Geigenstunden mit fünf. Im College nahm er Klarinettenunterricht, mit 18 dann kaufte sein Vater ihm einen Kontrabass. Schon in den ersten Bands, mit denen er spielte, wurde klar, dass seine Art Bass zu spielen von dem abwich, was man sonst so hörte; statt nur die Time zu markieren, setzte er Akzente, spielte Linien, setzte Töne zwischen die Beats. In der Band des Posaunisten Buddy Morrow machte er 1956 seine ersten Aufnahmen mit Swing- und Tanzmusik. Bei einer Session traf er auf Chet Baker, der ihn einlud, bei der nächsten Tour seiner Band mitzuwirken. Hier beginnt der Teil der Biographie, in der Helene LaFaro-Fernández auf Zeitzeugen zurückgreift und insbesondere Kollegen interviewt, Walter Norris etwa, Gary Peacock oder Paul Motian. LaFaro arbeitete in der Band von Pat Moran und mit Victor Feldman und spielt 1958 u.a. in Stan Getz’s Quintett an der Westküste. Er nahm Platten auf mit Hampton Hawes, Buddy DeFranco und anderen. 1959 arbeitete er als Bassist des Stan Kenton Orchestra, bis ihm Herb Geller einen Job in der Benny Goodman Band besorgte. Vor allem aber begann in diesem Jahr LaFaros Zusammenarbeit mit Bill Evans. Außerdem er wurde als “Bass New Star” im Down Beat gewürdigt. 1960 trat er vor allem mit Evans’ Trio auf, aber auch mit Ornette Coleman, Booker Littler und Thelonious Monk. Vom Januar 1961 stammen die legendären Trioaufnahmen aus dem Village Vanguard, die bis zum heutigen Tag zu den einflussreichsten Klaviertrioeinspielungen zählen. Am 6. Juli schlief LaFaro am Steuer seines Wagens ein und fuhr gegen einen Baum. Er und sein Freund Frank Ottley waren sofort tot. LaFaros Schwester erzählt die Geschichte ihres Bruders mit vielen Fakten, aber auch mit dem Wissen um seine Bedeutung für die Jazzgeschichte. Sie sammelt Erinnerungen von Mitmusikern und Freunden und bat Gene Lees, Marc Johnson, Jeff Campbell und Phil Palombi um eine musikalische Einschätzung. Barrie Kolstein berichtet im Anhang, wie das Instrument, das beim Autounfall erheblich beschädigt worden war, restauriert wurde und gibt genaue eine Beschreibung des Kontrabasses. Chuck Ralston ergänzt das alles um eine Diskographie, der Aufnahmen, an denen LaFaro teilhatte, von Buddy Morrow über Clifford Brown und Chet Baker, Victor Feldman, Stan Getz, Hampton Hawes, Buddy DeFranco, Harold Land, Pat Moran, Marty Paich, Stan Kenton, Herb Geller, Booker Little, Steve Kuhn, Gunther Schuller, Ornette Coleman bis hin zum legendären Bill Evans Trio. Helene LaFaro-Fernández hat ihrem Bruder mit diesem Buch, in dem auch viele private Fotos enthalten sind, ein würdiges Denkmal gesetzt, persönlich und doch sachlich, die biographischen Detials genauso berücksichtigend wie seine musikalische Entwicklung und seinen Einfluss auf Bassisten bis zum heutigen Tag.
Neben Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter und einigen anderen der großen Namen des modernen Jazz ist Scott LaFaro einer der Musiker, über die am häufigsten Diplomarbeiten geschrieben werden — so zumindest scheint es uns im Jazzinstitut, wo wir regelmäßig mit Anfragen zu dem früh verstorbenen Bassisten konfrontiert werden. Jetzt legt seine Schwester eine Biographie vor, die das nur fünfundzwanzigjährige Leben des Kontrabassisten beleuchtet. LaFaro wurde in eine italienisch-schottische Familie geboren, die früh erkannte, dass ihr Sohn musikalisch begabt war. Er spielte bereits mit drei Jahren Mandoline und nahm seine ersten Geigenstunden mit fünf. Im College nahm er Klarinettenunterricht, mit 18 dann kaufte sein Vater ihm einen Kontrabass. Schon in den ersten Bands, mit denen er spielte, wurde klar, dass seine Art Bass zu spielen von dem abwich, was man sonst so hörte; statt nur die Time zu markieren, setzte er Akzente, spielte Linien, setzte Töne zwischen die Beats. In der Band des Posaunisten Buddy Morrow machte er 1956 seine ersten Aufnahmen mit Swing- und Tanzmusik. Bei einer Session traf er auf Chet Baker, der ihn einlud, bei der nächsten Tour seiner Band mitzuwirken. Hier beginnt der Teil der Biographie, in der Helene LaFaro-Fernández auf Zeitzeugen zurückgreift und insbesondere Kollegen interviewt, Walter Norris etwa, Gary Peacock oder Paul Motian. LaFaro arbeitete in der Band von Pat Moran und mit Victor Feldman und spielt 1958 u.a. in Stan Getz’s Quintett an der Westküste. Er nahm Platten auf mit Hampton Hawes, Buddy DeFranco und anderen. 1959 arbeitete er als Bassist des Stan Kenton Orchestra, bis ihm Herb Geller einen Job in der Benny Goodman Band besorgte. Vor allem aber begann in diesem Jahr LaFaros Zusammenarbeit mit Bill Evans. Außerdem er wurde als “Bass New Star” im Down Beat gewürdigt. 1960 trat er vor allem mit Evans’ Trio auf, aber auch mit Ornette Coleman, Booker Littler und Thelonious Monk. Vom Januar 1961 stammen die legendären Trioaufnahmen aus dem Village Vanguard, die bis zum heutigen Tag zu den einflussreichsten Klaviertrioeinspielungen zählen. Am 6. Juli schlief LaFaro am Steuer seines Wagens ein und fuhr gegen einen Baum. Er und sein Freund Frank Ottley waren sofort tot. LaFaros Schwester erzählt die Geschichte ihres Bruders mit vielen Fakten, aber auch mit dem Wissen um seine Bedeutung für die Jazzgeschichte. Sie sammelt Erinnerungen von Mitmusikern und Freunden und bat Gene Lees, Marc Johnson, Jeff Campbell und Phil Palombi um eine musikalische Einschätzung. Barrie Kolstein berichtet im Anhang, wie das Instrument, das beim Autounfall erheblich beschädigt worden war, restauriert wurde und gibt genaue eine Beschreibung des Kontrabasses. Chuck Ralston ergänzt das alles um eine Diskographie, der Aufnahmen, an denen LaFaro teilhatte, von Buddy Morrow über Clifford Brown und Chet Baker, Victor Feldman, Stan Getz, Hampton Hawes, Buddy DeFranco, Harold Land, Pat Moran, Marty Paich, Stan Kenton, Herb Geller, Booker Little, Steve Kuhn, Gunther Schuller, Ornette Coleman bis hin zum legendären Bill Evans Trio. Helene LaFaro-Fernández hat ihrem Bruder mit diesem Buch, in dem auch viele private Fotos enthalten sind, ein würdiges Denkmal gesetzt, persönlich und doch sachlich, die biographischen Detials genauso berücksichtigend wie seine musikalische Entwicklung und seinen Einfluss auf Bassisten bis zum heutigen Tag.
(Wolfram Knauer)
Bitches Brew. Genesi del capolavoro di Miles Davis
von Enrico Merlin & Veniero Rizzardi
Milano 2009 (ilSaggiatore)
318 Seiten, 35 Euro
ISBN: 978-8-84281-501-3
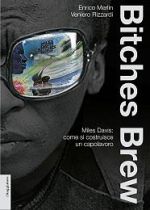 Ashley Kahn hat mit seinen Büchern über Miles Davis’ Album “Kind of Blue” und John Coltranes “A Love Supreme” quasi ein neues Genre der Jazzliteratur begonnen: Bücher, die einzelne Plattensitzungen des Jazz von allen Seiten beleuchten. Das Beispiel hat Schule gemacht: Enrico Merlin und Veniero Rizzardi legen jetzt ein durchaus vergleichbares Werb über Miles’ Album “Bitches Brew” von 1969 vor, sicher ein Meilenstein der Jazzgeschichte, ein großer Wurf, der aufzeigte, wie eine weitsichtige Fusion aus Jazz- und Rockelementen musikalisch spannende Ergebnisse zeitigen konnte. Die beiden Autoren zeichnen Entstehungsgeschichte und Einflüsse auf. Miles sei es immer besonders um Sound gegangen, von seinen Capitol-Nonett-Aufnahmen über die Zusammenarbeit mit Gil Evans bis zum elektrischen Miles. Sie diskutieren einige Vorgängeralben zu “Bitches Brew”, darunter “Circle in the Round” und “Directions”, analysieren die Schneidetechnik etwa auf dem Album “In a Silent Way”, indem sie die ursprünglich veröffentlichte Aufnahmemit den Basterbändern vergleichen. Die Teo Macero-Sammlung landete nach dem Tod des Produzenten in der New York Library for the Performing Arts. Ihr ist zu verdanken, dass die Lead-Sheets für die Plattensitzung genauso erhalten sind wie Notizen, Korrespondenz, Schneideanweisungen und vieles mehr, dass die Autoren zur Analyse der Aufnahmegenese genauso nutzten wie Strudiomitschnitte, auf denen neben der Musik auch die Gespräche zwischen Miles und seinen Musikern und dem Produzenten zu hören sind. Sie vergleichen die verschiedenen Takes der einzelnen Stücke und mutmaßen über Gründe für Änderungen oder Zusammenschnitte. Viele Fotos machen das alles lebendig; Notenbeispiele und analytische Formskizzen führen den Leser näher an den musikalischen Ablauf heran; eine Chronologie der Jahre 1967 bis 1973 fasst die mit dem Album “Bitches Brew” zusammenhängenden Aktivitäten Miles’ übersichtlich zusammen. Das Buch ist bislang nur auf italienisch erhältlich; eine zumindest englische Übersetzung wäre sicher wünschenswert.
Ashley Kahn hat mit seinen Büchern über Miles Davis’ Album “Kind of Blue” und John Coltranes “A Love Supreme” quasi ein neues Genre der Jazzliteratur begonnen: Bücher, die einzelne Plattensitzungen des Jazz von allen Seiten beleuchten. Das Beispiel hat Schule gemacht: Enrico Merlin und Veniero Rizzardi legen jetzt ein durchaus vergleichbares Werb über Miles’ Album “Bitches Brew” von 1969 vor, sicher ein Meilenstein der Jazzgeschichte, ein großer Wurf, der aufzeigte, wie eine weitsichtige Fusion aus Jazz- und Rockelementen musikalisch spannende Ergebnisse zeitigen konnte. Die beiden Autoren zeichnen Entstehungsgeschichte und Einflüsse auf. Miles sei es immer besonders um Sound gegangen, von seinen Capitol-Nonett-Aufnahmen über die Zusammenarbeit mit Gil Evans bis zum elektrischen Miles. Sie diskutieren einige Vorgängeralben zu “Bitches Brew”, darunter “Circle in the Round” und “Directions”, analysieren die Schneidetechnik etwa auf dem Album “In a Silent Way”, indem sie die ursprünglich veröffentlichte Aufnahmemit den Basterbändern vergleichen. Die Teo Macero-Sammlung landete nach dem Tod des Produzenten in der New York Library for the Performing Arts. Ihr ist zu verdanken, dass die Lead-Sheets für die Plattensitzung genauso erhalten sind wie Notizen, Korrespondenz, Schneideanweisungen und vieles mehr, dass die Autoren zur Analyse der Aufnahmegenese genauso nutzten wie Strudiomitschnitte, auf denen neben der Musik auch die Gespräche zwischen Miles und seinen Musikern und dem Produzenten zu hören sind. Sie vergleichen die verschiedenen Takes der einzelnen Stücke und mutmaßen über Gründe für Änderungen oder Zusammenschnitte. Viele Fotos machen das alles lebendig; Notenbeispiele und analytische Formskizzen führen den Leser näher an den musikalischen Ablauf heran; eine Chronologie der Jahre 1967 bis 1973 fasst die mit dem Album “Bitches Brew” zusammenhängenden Aktivitäten Miles’ übersichtlich zusammen. Das Buch ist bislang nur auf italienisch erhältlich; eine zumindest englische Übersetzung wäre sicher wünschenswert.
(Wolfram Knauer)
We Want Miles
herausgegeben von Vincent Bessières
Paris 2009 (Cité de la Musique)
223 Seiten, 39 Euro
ISBN: 978-2-84597-340-4
 “We Want Miles” heißt die oppulente Ausstellung die Vincent Bessières für die Cité de la Musique in Paris zusammengestellt hat, wo sie von Oktober 2009 bis Januar 2010 gezeigt wird (danach von April bis August 2010 im Montréal Museum of Fine Arts. Die Ausstellung in Paris umfasst zwei Stockwerke voll mit Material, das sich auf Miles bezieht: Klangkabinen, in denen man Musik aus den verschiedenen Schaffensperioden seines Lebens hören kann, seltene Filmausschnitte von Konzerten oder Interviews, in denen er über seine Musik spricht, seine Kleidung und Gemälde, vieler seiner Instrumente, originale Notenblätter etlicher Aufnahmesessions, einschließlich der legendären Capitol-Nonett-Aufnahmen von 1949, sowie handschriftliche Notizen über die Aufnahmesitzungen, die oft von seinem langjährigen Produzenten Teo Macero stammen. Dem Kurator der Ausstellung Vincent Bessières und seinen Mitarbeitern von der Cité de la Musique ist es gelungen, ein wenig vom Geist des Trompeters einzufangen, den Besucher langsam in Miles’ Welt eintauchen zu lassen. Sie zeichnen seine musikalische und persönliche Entwicklung über die Jahre in Saal nach Saal nach und geben selbst seinem Rückzug von Musik und Öffentlichkeit in den späten 1970er Jahren einen eigenen Raum: einen dunklen Durchgang mit wenigen Dokumenten an den schwarzen Wänden, die knappe Einblicke in seine Probleme der Zeit geben. Am Anfang der Ausstellung mag man noch meinen, dieses Foto sei einem doch eh bekannt, diese Platten ebenfalls oder jener Zeitungsartikel. Mehr und mehr aber wird man in den Sog der Ausstellung gezogen und erlebt bestimmte Phasen in Miles’ Entwicklung anders als man sie zuvor erlebt hat, einfach durch die Art und Weise, wie die Ausstellungsstücke einander gegenübergestellt sind, wie die Musik aus den Klangkabinen, die Videos und all die anderen Dokumente einander ergänzen und einen die Musik und das Leben von Miles Davis neu entdecken, neu sehen, neu hören lassen. Der Ausstellungskatalog zeigt viele der in der Cité de la Musique zu sehenden Exponate und enthält daneben einen ausführlichen Text von Franck Bergerot sowie kürzere Texte von George Avakian, Laurent Cugny, Ira Gitler, David Liebman, Francis Marmande, John Szwed und Mike Zwerin. Noch ist er nur in Französisch erhältlich; eine englische Fassung wird aber spätestens zur Ausstellung in Montréal erhältlich sein.
“We Want Miles” heißt die oppulente Ausstellung die Vincent Bessières für die Cité de la Musique in Paris zusammengestellt hat, wo sie von Oktober 2009 bis Januar 2010 gezeigt wird (danach von April bis August 2010 im Montréal Museum of Fine Arts. Die Ausstellung in Paris umfasst zwei Stockwerke voll mit Material, das sich auf Miles bezieht: Klangkabinen, in denen man Musik aus den verschiedenen Schaffensperioden seines Lebens hören kann, seltene Filmausschnitte von Konzerten oder Interviews, in denen er über seine Musik spricht, seine Kleidung und Gemälde, vieler seiner Instrumente, originale Notenblätter etlicher Aufnahmesessions, einschließlich der legendären Capitol-Nonett-Aufnahmen von 1949, sowie handschriftliche Notizen über die Aufnahmesitzungen, die oft von seinem langjährigen Produzenten Teo Macero stammen. Dem Kurator der Ausstellung Vincent Bessières und seinen Mitarbeitern von der Cité de la Musique ist es gelungen, ein wenig vom Geist des Trompeters einzufangen, den Besucher langsam in Miles’ Welt eintauchen zu lassen. Sie zeichnen seine musikalische und persönliche Entwicklung über die Jahre in Saal nach Saal nach und geben selbst seinem Rückzug von Musik und Öffentlichkeit in den späten 1970er Jahren einen eigenen Raum: einen dunklen Durchgang mit wenigen Dokumenten an den schwarzen Wänden, die knappe Einblicke in seine Probleme der Zeit geben. Am Anfang der Ausstellung mag man noch meinen, dieses Foto sei einem doch eh bekannt, diese Platten ebenfalls oder jener Zeitungsartikel. Mehr und mehr aber wird man in den Sog der Ausstellung gezogen und erlebt bestimmte Phasen in Miles’ Entwicklung anders als man sie zuvor erlebt hat, einfach durch die Art und Weise, wie die Ausstellungsstücke einander gegenübergestellt sind, wie die Musik aus den Klangkabinen, die Videos und all die anderen Dokumente einander ergänzen und einen die Musik und das Leben von Miles Davis neu entdecken, neu sehen, neu hören lassen. Der Ausstellungskatalog zeigt viele der in der Cité de la Musique zu sehenden Exponate und enthält daneben einen ausführlichen Text von Franck Bergerot sowie kürzere Texte von George Avakian, Laurent Cugny, Ira Gitler, David Liebman, Francis Marmande, John Szwed und Mike Zwerin. Noch ist er nur in Französisch erhältlich; eine englische Fassung wird aber spätestens zur Ausstellung in Montréal erhältlich sein.
(Wolfram Knauer)
Satchmo. The Wonderful World and Art of Louis Armstrong
von Stephen Brower
New York 2009 (Abrams)
256 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-0-8109-9528-4
 Louis Armstrong war ein großartiger Musiker, das ist bekannt. Schon weniger bekannt ist, dass er zeitlebens mit seiner Schreibmaschine reiste und ein fleißiger Briefeschreiber war — viele seiner Briefe erzählten Autobiographisches und waren Grundlage für seine beiden Autobiographien, die 1936 und 1954 erschienen. Vor zehn Jahren brachte Thomas Brothers etliche dieser Briefe und maschienenschriftlichen Manuskripte, die heute im Armstrong Archive in Queens, New York, lagern, in Buchform heraus (“Louis Armstrong In His Own Words”, Oxford University Press, 1999). Im Armstrong Archive aber findet sich noch eine weitere, unerwartete künstlerische Seite des Trompeters. Dieser nämlich war ein großer Tonbandfreund und schnitt Sendungen aus dem Rundfunk genauso mit wie Gespräche zwischen sich und Freunden oder Nachbarn oder auch sich selbst beim Üben oder beim Mitspielen mit Plattenaufnahmen (zum Teil sogar von sich selbst). Ausschnitte aus diesen Bändern sind im letzten Jahr veröffentlicht worden; spannend aber ist an ihnen nicht nur die darauf enthaltene Musik. Armstrong sorgte sich sich nämlich auch um die Verpackung, bastelte mit Schere, Klebstoff und Scotch Tape (der amerikanischen Variante unseres Tesafilms) seltsame Collagen, die teilweise Bezug zu dem auf den Bändern enthaltenen Aufnahmen besaßen, zum Teil aber auch nicht. Fotos von ihm selbst mit bekannten Stars des Jazz oder Showbusiness sind darauf ebenso zu sehen wie Zeitungsausrisse, Fotos, die ihm von Fans zugeschickt wurden, handschriftliche oder maschinenschriftliche Kommentare, die er teilweise Zeile für Zeile, teilweise gar Wort für Wort ausgeschnitten und aufgeklebt hatte. Das alles hatte früh begonnen, mit Scrapbooks, die Clippings, Zeitungsausschnitte über seine Arbeit enthielten. Browers Buch enthält eine Vielzahl an Beispielen, aus den Scrapbooks, aus seinen Briefen, vor allem aber von den beklebten Reel-to-Reel-Tapes aus der Sammlung des Armstrong Archive. Brower setzt die darauf zu sehenden Szenen in seinem Text in Relation zu Armstrongs Leben und Karriere. Das ganze in einem wunderschönen großformatigen, durchwegs farbig gehaltenen, auf Mattglanzpapier gedruckten Buch, das Einblicke in die spielerische Kreativität erlaubt, die Grundlage seiner Musik genauso war wie offenbar überhaupt seines Lebens.
Louis Armstrong war ein großartiger Musiker, das ist bekannt. Schon weniger bekannt ist, dass er zeitlebens mit seiner Schreibmaschine reiste und ein fleißiger Briefeschreiber war — viele seiner Briefe erzählten Autobiographisches und waren Grundlage für seine beiden Autobiographien, die 1936 und 1954 erschienen. Vor zehn Jahren brachte Thomas Brothers etliche dieser Briefe und maschienenschriftlichen Manuskripte, die heute im Armstrong Archive in Queens, New York, lagern, in Buchform heraus (“Louis Armstrong In His Own Words”, Oxford University Press, 1999). Im Armstrong Archive aber findet sich noch eine weitere, unerwartete künstlerische Seite des Trompeters. Dieser nämlich war ein großer Tonbandfreund und schnitt Sendungen aus dem Rundfunk genauso mit wie Gespräche zwischen sich und Freunden oder Nachbarn oder auch sich selbst beim Üben oder beim Mitspielen mit Plattenaufnahmen (zum Teil sogar von sich selbst). Ausschnitte aus diesen Bändern sind im letzten Jahr veröffentlicht worden; spannend aber ist an ihnen nicht nur die darauf enthaltene Musik. Armstrong sorgte sich sich nämlich auch um die Verpackung, bastelte mit Schere, Klebstoff und Scotch Tape (der amerikanischen Variante unseres Tesafilms) seltsame Collagen, die teilweise Bezug zu dem auf den Bändern enthaltenen Aufnahmen besaßen, zum Teil aber auch nicht. Fotos von ihm selbst mit bekannten Stars des Jazz oder Showbusiness sind darauf ebenso zu sehen wie Zeitungsausrisse, Fotos, die ihm von Fans zugeschickt wurden, handschriftliche oder maschinenschriftliche Kommentare, die er teilweise Zeile für Zeile, teilweise gar Wort für Wort ausgeschnitten und aufgeklebt hatte. Das alles hatte früh begonnen, mit Scrapbooks, die Clippings, Zeitungsausschnitte über seine Arbeit enthielten. Browers Buch enthält eine Vielzahl an Beispielen, aus den Scrapbooks, aus seinen Briefen, vor allem aber von den beklebten Reel-to-Reel-Tapes aus der Sammlung des Armstrong Archive. Brower setzt die darauf zu sehenden Szenen in seinem Text in Relation zu Armstrongs Leben und Karriere. Das ganze in einem wunderschönen großformatigen, durchwegs farbig gehaltenen, auf Mattglanzpapier gedruckten Buch, das Einblicke in die spielerische Kreativität erlaubt, die Grundlage seiner Musik genauso war wie offenbar überhaupt seines Lebens.
(Wolfram Knauer)
Go man, go! In de coulissen van de jazz
von Jeroen de Valk
Amsterdam 2009 (Van Gennep)
174 Seiten, 17,50 Euro
ISBN: 978-90-5515-0847
 Jeroen de Valk ist ein international renommierter Jazzjournalist, der bislang zwei wegweisende Biographien vorgelegt hat, eine über Chet Baker sowie eine über Ben Webster. In seinem neuen Buch versammelt er Artikel und Interviews, die er vor allem für die holländische Zeitschrift Jazz Nu geführt hatte. Akkordeonist Johnny Meijer blick ein wenig wehmütig auf die gute alte Zeit zurück, auf die guten Musiker, mit denen er zusammengespielt hat, genauso wie auf die schlechten. Jimmy Rowles erzählt, wie er einst Marilyn Monroe begleitet habe, Dave Brubeck davon, wie Darius Milhaud ihn auf seinem musikalischen Weg ermutigt habe. Illinois Jacquet berichtet, dass er immer noch sein “Flying Home”-Solo spielen müsse, zu dem ihn einst Lionel Hampton angefeuert habe. Sonny Rollins gibt Einblick in seine künstlerischen Selbstzweifel. Branford Marsalis macht deutlich, dass das Wichtigste im Spiel seines Vaters Ellis dessen “Sound” sein, nicht sein Anschlag, nicht seine Voicings, sondern sein “Sound! Sound! SOUND!”. Charlie Haden spricht über seine Zeit bei Ornette Coleman und seine frühere Drogensucht. Weitere Interviews geben Einblick in die musikalische Welt von Künstlern wie Ray Brown, Biig Jay McNeely, Tommy Flanagan, Joe Zawinul, Woody Shaw, Michael Brecker, aber auch von Rita Reys, Cees Slinger, Pim Jacobs, Ruud Brink, Rinus Groeneveld, Hein Van de Geyn und Joris Teepe.
Jeroen de Valk ist ein international renommierter Jazzjournalist, der bislang zwei wegweisende Biographien vorgelegt hat, eine über Chet Baker sowie eine über Ben Webster. In seinem neuen Buch versammelt er Artikel und Interviews, die er vor allem für die holländische Zeitschrift Jazz Nu geführt hatte. Akkordeonist Johnny Meijer blick ein wenig wehmütig auf die gute alte Zeit zurück, auf die guten Musiker, mit denen er zusammengespielt hat, genauso wie auf die schlechten. Jimmy Rowles erzählt, wie er einst Marilyn Monroe begleitet habe, Dave Brubeck davon, wie Darius Milhaud ihn auf seinem musikalischen Weg ermutigt habe. Illinois Jacquet berichtet, dass er immer noch sein “Flying Home”-Solo spielen müsse, zu dem ihn einst Lionel Hampton angefeuert habe. Sonny Rollins gibt Einblick in seine künstlerischen Selbstzweifel. Branford Marsalis macht deutlich, dass das Wichtigste im Spiel seines Vaters Ellis dessen “Sound” sein, nicht sein Anschlag, nicht seine Voicings, sondern sein “Sound! Sound! SOUND!”. Charlie Haden spricht über seine Zeit bei Ornette Coleman und seine frühere Drogensucht. Weitere Interviews geben Einblick in die musikalische Welt von Künstlern wie Ray Brown, Biig Jay McNeely, Tommy Flanagan, Joe Zawinul, Woody Shaw, Michael Brecker, aber auch von Rita Reys, Cees Slinger, Pim Jacobs, Ruud Brink, Rinus Groeneveld, Hein Van de Geyn und Joris Teepe.
(Wolfram Knauer)
Han Bennink. De wereld als trommel
von Erik van den Berg
Amsterdam 2009 (Uitgeverij Thomas Rap)
239 Seiten plus eine beigeheftete CD, 19,90 Euro
ISBN: 978-90-600-5671-4
 Wer international über Jazz in Holland spricht, kommt schnell auf die drei vielleicht einflussreichsten, sicher aber eigenständigsten Musiker des Landes: Willem Breuker, Misha Mengelberg und Han Bennink. Bennink ist seit mehr als 50 Jahren auf der Szene, einer der bedeutendsten europäischen Schlagzeuger des freien Jazz, daneben aber (wie durchaus auch andere große Perkussionisten dieser Richtung) ein begnadeter Swinger, denn er hat in seiner Laufbahn alles durchgemacht, vom traditionellen Jazz über den Swing, Bebop und modene Stilrichtungen bis zur freien Improvisation mit Brötzmann und Konsorten. Eric van den Berg hat nun eine Biographie des Schlagzeugers vorgelegt. Er beginnt mit der Familiengeschichte: Benninks Vater Rein war selbst Jazzmusiker gewesen, spielte Schlagzeug und Saxophon. Han wurde die Musik also quasi in die Wiege gelegt, und mit 15 Jahren trat er bereits mit seinem Vater auf, wie u.a. vier Aufnahmen auf der dem Buch beiliegenden CD belegen. 1959 errang das Quintett des Pianisten Eric van Trigt bei einem Wettbewerb in Bussum den zweiten Platz, dank auch des Schlagzeugsolos des 19jährigen Han Bennink. Bennink hörte amerikanische Bands und ließ sich von deren Schlagzeugern beeinflussen, etwa von Kenny Clarke, Louis Hayes oder Elvin Jones. 1961 fuhr er als Teil einer Schiffscombo nach New York und war von der Musik dieser Stadt beeidnruckt. Ein Jahr später begann seine Zusammenarbeit mit dem Pianisten Misha Mengelberg. Er spielte mit der Sängerin Rita Reys und begleitete amerikanische Stars wie Johnny Griffin und andere. 1964 spielte er mit Eric Dolphy, orientierte sich immer mehr an Musikern des amerikanischen “New Thing”. 1966 trat das Misha Mengelberg Quartet beim Newport Jazz Festival auf. Nebenbei war Bennink immer auch als Maler aktiv; bei seiner ersten Soloausstellung in einer Amsterdamer Galerie spielte auch Willem Breuker mit. Breuker, Mengelberg und Bennink gründeten den Instant Composers Pool (ICP), um der neuen Musik Spielorte zu verschaffen. Mehr und mehr arbeitete Bennink auch mit europäischen Kollegen zusammen, 1966 etwa mit Gunter Hampel und später mit Peter Brötzmann, bei dessen “Machine Gun”-Album von 1968 er mit von der Partie war, wie auch bei späteren Aufnahmen zwischen Duo, Trio und großer Besetzung. 1969 gehörte er zur europäischen Besetzung für Manfred Schoofs “European Echoes”. Die 70er Jahre waren die Zeit der europäischen Zusammenarbeit, ob im Rahmen von ICP oder bei Konzerten oder Aufnahmen für das FMP-Label. Wechselnde Besetzungen auch später, und keine stilistischen Berührungsängste: ob Free Jazz mit Cecil Taylor, freie improvisierte Musik mit Derek Bailey, traditionelle Gigs etwa mit Art Hodes oder Soul mit Percy Sledge. Zusammen mit dem Klarinettisten Michael Moore und dem Cellisten Ernst Reijseger bildete Bennink in den 1990er Jahren das Clusone Trio. Van den Berg beschreibt Benninks Instrumentarium, aber auch den theatralischen Klamauk, den Bennink auf ihnen vollführen kann, ohne jemals den musikalischen Sinn aus dem Blick zu verlieren, etwa wenn er in einer Performance im Museum of Contemporary Art in Toronto 2005 auf Käsetrommeln spielt, was ihm eine Einladung in Jay Lenos Talkshow einbrachte (die er allerdings ablehnte). Van den Berg greift auf Interviews mit Bennink und seinen Musikerkollegen zurück, aber auch auf Benninks Tagebuch. Am Schluss findet sich ein Blindfold Test, eine Liste (nur) der wichtigsten Platten sowie eine Literaturliste. Die beiligende CD enthält neben Aufnahmen mit seinem Vater von 1955 einen Mitschnitt des Zaans Rhythme Quartet von 1960, des Misha Mengelberg/Pieter Noordijk Quartet von 1966, Benninks Schlagzeugsolo vom Newport Jazz Festival 1966, eine Trioaufnahme mit Sonny Sollins, drei Titel mit Art Hodes sowie ein Live-Duomitschnitt mit Misha Mengelberg aus dem Jahr 1978. Ein lobens- und lohnenswertes Buch über einen der spannendsten Schlagzeuger Europas. Zur Lektüre braucht es bislang noch ordentlicher niederländischer Sprachkenntnisse; wir hoffen auf eine englische Übersetzung des Buchs.
Wer international über Jazz in Holland spricht, kommt schnell auf die drei vielleicht einflussreichsten, sicher aber eigenständigsten Musiker des Landes: Willem Breuker, Misha Mengelberg und Han Bennink. Bennink ist seit mehr als 50 Jahren auf der Szene, einer der bedeutendsten europäischen Schlagzeuger des freien Jazz, daneben aber (wie durchaus auch andere große Perkussionisten dieser Richtung) ein begnadeter Swinger, denn er hat in seiner Laufbahn alles durchgemacht, vom traditionellen Jazz über den Swing, Bebop und modene Stilrichtungen bis zur freien Improvisation mit Brötzmann und Konsorten. Eric van den Berg hat nun eine Biographie des Schlagzeugers vorgelegt. Er beginnt mit der Familiengeschichte: Benninks Vater Rein war selbst Jazzmusiker gewesen, spielte Schlagzeug und Saxophon. Han wurde die Musik also quasi in die Wiege gelegt, und mit 15 Jahren trat er bereits mit seinem Vater auf, wie u.a. vier Aufnahmen auf der dem Buch beiliegenden CD belegen. 1959 errang das Quintett des Pianisten Eric van Trigt bei einem Wettbewerb in Bussum den zweiten Platz, dank auch des Schlagzeugsolos des 19jährigen Han Bennink. Bennink hörte amerikanische Bands und ließ sich von deren Schlagzeugern beeinflussen, etwa von Kenny Clarke, Louis Hayes oder Elvin Jones. 1961 fuhr er als Teil einer Schiffscombo nach New York und war von der Musik dieser Stadt beeidnruckt. Ein Jahr später begann seine Zusammenarbeit mit dem Pianisten Misha Mengelberg. Er spielte mit der Sängerin Rita Reys und begleitete amerikanische Stars wie Johnny Griffin und andere. 1964 spielte er mit Eric Dolphy, orientierte sich immer mehr an Musikern des amerikanischen “New Thing”. 1966 trat das Misha Mengelberg Quartet beim Newport Jazz Festival auf. Nebenbei war Bennink immer auch als Maler aktiv; bei seiner ersten Soloausstellung in einer Amsterdamer Galerie spielte auch Willem Breuker mit. Breuker, Mengelberg und Bennink gründeten den Instant Composers Pool (ICP), um der neuen Musik Spielorte zu verschaffen. Mehr und mehr arbeitete Bennink auch mit europäischen Kollegen zusammen, 1966 etwa mit Gunter Hampel und später mit Peter Brötzmann, bei dessen “Machine Gun”-Album von 1968 er mit von der Partie war, wie auch bei späteren Aufnahmen zwischen Duo, Trio und großer Besetzung. 1969 gehörte er zur europäischen Besetzung für Manfred Schoofs “European Echoes”. Die 70er Jahre waren die Zeit der europäischen Zusammenarbeit, ob im Rahmen von ICP oder bei Konzerten oder Aufnahmen für das FMP-Label. Wechselnde Besetzungen auch später, und keine stilistischen Berührungsängste: ob Free Jazz mit Cecil Taylor, freie improvisierte Musik mit Derek Bailey, traditionelle Gigs etwa mit Art Hodes oder Soul mit Percy Sledge. Zusammen mit dem Klarinettisten Michael Moore und dem Cellisten Ernst Reijseger bildete Bennink in den 1990er Jahren das Clusone Trio. Van den Berg beschreibt Benninks Instrumentarium, aber auch den theatralischen Klamauk, den Bennink auf ihnen vollführen kann, ohne jemals den musikalischen Sinn aus dem Blick zu verlieren, etwa wenn er in einer Performance im Museum of Contemporary Art in Toronto 2005 auf Käsetrommeln spielt, was ihm eine Einladung in Jay Lenos Talkshow einbrachte (die er allerdings ablehnte). Van den Berg greift auf Interviews mit Bennink und seinen Musikerkollegen zurück, aber auch auf Benninks Tagebuch. Am Schluss findet sich ein Blindfold Test, eine Liste (nur) der wichtigsten Platten sowie eine Literaturliste. Die beiligende CD enthält neben Aufnahmen mit seinem Vater von 1955 einen Mitschnitt des Zaans Rhythme Quartet von 1960, des Misha Mengelberg/Pieter Noordijk Quartet von 1966, Benninks Schlagzeugsolo vom Newport Jazz Festival 1966, eine Trioaufnahme mit Sonny Sollins, drei Titel mit Art Hodes sowie ein Live-Duomitschnitt mit Misha Mengelberg aus dem Jahr 1978. Ein lobens- und lohnenswertes Buch über einen der spannendsten Schlagzeuger Europas. Zur Lektüre braucht es bislang noch ordentlicher niederländischer Sprachkenntnisse; wir hoffen auf eine englische Übersetzung des Buchs.
(Wolfram Knauer)
Pop. Geschichte eines Konzepts 1955-2009
von Thomas Hecken
Bielefeld 2009 (transkript)
563 Seiten, 35,80 Euro
ISBN: 978-3-89942-982-4
 Mit dem Begriff “Pop” verbinden sich alle möglichen kulturellen Phänomene und Tendenzen, angefangen bei der Popmusik über die Pop-Art, die Popkultur bis hin zu Phänomenen in Underground, New Journalism, Postmoderne und Lifestyle. Thomas Hecken, germanist an der Ruhr-Universität in Bochum, versucht in seinem Buch die verschiedenen Seiten von “Pop” zwischen Underground und Kommerz zu beleuchten. Er beginnt weit vor der Popkultur (nach unserem Verständnis), nämlich bei Herder, Schiller, Kant und dem Reiz des Populären, klopft außerdem Baudelaire, Huysmans, Wilde und Nietzsche mit ihrer Tendenz künstlich zu erregen, den Futurismus, den Expressionismus, den Dadaismus und den Surrealismus sowie das Jazz Age und die Neue Sachlichkeit daraufhin ab, inwiefern sie als Vorläufer oder Einflussgeber der Pop-Idee dienen könnten. In seinem zweiten Kapitel arbeitet er heraus, wie diese Pop-Idee in den 50er und 60er Jahren aus der Pop Art herausgelöst wurde. Er diskutiert Begriffe wie “Massenkultur” und “populäre Kultur”, reflektiert über die englische Independent Group und das Verhältnis von Pop Art zur Tradition der Dekadenz und Avantgarde. Mitte der 60er Jahre also setzte sich der Begriff “Pop” für ein neues Konzept durch, das aber immer noch weit stärker im bildnerisch künstlerischen Bereich als etwa in der Musik angesiedelt war. Daneben wurde “Pop” immer mehr synonym als Träger des zeitgenössisch vorherrschenden Geschmacks verstanden und damit als ein auch jugendkulturelles Phänomen. Hier nun kommt mehr und mehr auch die Musik ins Spiel, von Beatles über Rolling Stones bis The Who, die nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in der Reflektion den Pop-Diskurs beeinflussten. Pop bestimmt mit seiner positiv-jungen Belegung dabei auch die Ästhetik anderer Genres, ob Film, Literatur oder Feuilleton. Parallel entwickelte sich in den 1960er Jahren aber auch eine Art Underground-Popästhetik. In seinem diesbezüglichen Kapitel versucht Hecken eine ausführliche Abgrenzung zwischen Pop und Rock und der mit beiden verbundenen künstlerischen wie ästhetischen Konnotationen. Neben den üblichen anglo-amerikanischen bemüht Hecken auch deutsche Beispiele. War man in den 60er Jahren damit beschäftigt, die ästhetischen Konzepte überhaupt zu entwickeln, so konnte man in den 70er Jahren bereits über sie reflektieren, wie Hecken in seinem Kapitel über die “Pop-Theorie” darlegt. Dieser Diskurs handelt von Oberflächlichkeit oder Gegenkultur, von Kommerz und Konsum-Freiheit, von Manipulation und Populismus. Ein eigenes Kapitel widmet Hecken der Diskussion, wie sich “Pop” in der Postmoderne-Diskussion der 70er Jahre wiederfindet. Konkrete Beispiele liefert der Eklektizismus im Rock (Zappa), Glam (David Bowie) und Punk. In den 80er Jahren dann stellt Hecken die “Vollendung der Pop-Affirmation” fest. Schließlich beschäftigt er sich im Schlusskapitel (aber auch immer wieder zwischendurch) mit seiner eigenen Rolle und der seiner Kollegen: mit der Akademisierung von Pop und der Theoriebildung über Poptheorie. Ein ausführliches Literaturverzeichnis beendet das Buch. Alles in allem: ein dicker Brocken “Pop”, in dem Hecken die Debatten um Begriff und Inhalt nachzeichnet, ein spannendes Buch und ein exzellentes Nachschlagwerk zur Idee des “Pop”-Konzepts, das historisch erläutert und doch auch laufend zum Hinterfragen und zum Selbst-Stellungnehmen auffordert.. Der Jazz übrigens kommt innerhalb des Buchs kaum vor, doch berühren sich die (auch ästhetischen) Welten von Jazz und Pop in den 60er und 70er Jahren so oft, dass Hecken einem auch da den Weg weisen kann, wenn man wieder einmal unreflektiert über “Pop” spricht und ahnt, dass das Phänomen weit vielfältiger ist als der griffige Name.
Mit dem Begriff “Pop” verbinden sich alle möglichen kulturellen Phänomene und Tendenzen, angefangen bei der Popmusik über die Pop-Art, die Popkultur bis hin zu Phänomenen in Underground, New Journalism, Postmoderne und Lifestyle. Thomas Hecken, germanist an der Ruhr-Universität in Bochum, versucht in seinem Buch die verschiedenen Seiten von “Pop” zwischen Underground und Kommerz zu beleuchten. Er beginnt weit vor der Popkultur (nach unserem Verständnis), nämlich bei Herder, Schiller, Kant und dem Reiz des Populären, klopft außerdem Baudelaire, Huysmans, Wilde und Nietzsche mit ihrer Tendenz künstlich zu erregen, den Futurismus, den Expressionismus, den Dadaismus und den Surrealismus sowie das Jazz Age und die Neue Sachlichkeit daraufhin ab, inwiefern sie als Vorläufer oder Einflussgeber der Pop-Idee dienen könnten. In seinem zweiten Kapitel arbeitet er heraus, wie diese Pop-Idee in den 50er und 60er Jahren aus der Pop Art herausgelöst wurde. Er diskutiert Begriffe wie “Massenkultur” und “populäre Kultur”, reflektiert über die englische Independent Group und das Verhältnis von Pop Art zur Tradition der Dekadenz und Avantgarde. Mitte der 60er Jahre also setzte sich der Begriff “Pop” für ein neues Konzept durch, das aber immer noch weit stärker im bildnerisch künstlerischen Bereich als etwa in der Musik angesiedelt war. Daneben wurde “Pop” immer mehr synonym als Träger des zeitgenössisch vorherrschenden Geschmacks verstanden und damit als ein auch jugendkulturelles Phänomen. Hier nun kommt mehr und mehr auch die Musik ins Spiel, von Beatles über Rolling Stones bis The Who, die nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in der Reflektion den Pop-Diskurs beeinflussten. Pop bestimmt mit seiner positiv-jungen Belegung dabei auch die Ästhetik anderer Genres, ob Film, Literatur oder Feuilleton. Parallel entwickelte sich in den 1960er Jahren aber auch eine Art Underground-Popästhetik. In seinem diesbezüglichen Kapitel versucht Hecken eine ausführliche Abgrenzung zwischen Pop und Rock und der mit beiden verbundenen künstlerischen wie ästhetischen Konnotationen. Neben den üblichen anglo-amerikanischen bemüht Hecken auch deutsche Beispiele. War man in den 60er Jahren damit beschäftigt, die ästhetischen Konzepte überhaupt zu entwickeln, so konnte man in den 70er Jahren bereits über sie reflektieren, wie Hecken in seinem Kapitel über die “Pop-Theorie” darlegt. Dieser Diskurs handelt von Oberflächlichkeit oder Gegenkultur, von Kommerz und Konsum-Freiheit, von Manipulation und Populismus. Ein eigenes Kapitel widmet Hecken der Diskussion, wie sich “Pop” in der Postmoderne-Diskussion der 70er Jahre wiederfindet. Konkrete Beispiele liefert der Eklektizismus im Rock (Zappa), Glam (David Bowie) und Punk. In den 80er Jahren dann stellt Hecken die “Vollendung der Pop-Affirmation” fest. Schließlich beschäftigt er sich im Schlusskapitel (aber auch immer wieder zwischendurch) mit seiner eigenen Rolle und der seiner Kollegen: mit der Akademisierung von Pop und der Theoriebildung über Poptheorie. Ein ausführliches Literaturverzeichnis beendet das Buch. Alles in allem: ein dicker Brocken “Pop”, in dem Hecken die Debatten um Begriff und Inhalt nachzeichnet, ein spannendes Buch und ein exzellentes Nachschlagwerk zur Idee des “Pop”-Konzepts, das historisch erläutert und doch auch laufend zum Hinterfragen und zum Selbst-Stellungnehmen auffordert.. Der Jazz übrigens kommt innerhalb des Buchs kaum vor, doch berühren sich die (auch ästhetischen) Welten von Jazz und Pop in den 60er und 70er Jahren so oft, dass Hecken einem auch da den Weg weisen kann, wenn man wieder einmal unreflektiert über “Pop” spricht und ahnt, dass das Phänomen weit vielfältiger ist als der griffige Name.
(Wolfram Knauer)
tell no lies, claim no victories
herausgegeben von Philipp Schmickl & Hans Falb
Nickelsdorf 2009 (Verein Impro 2000)
208 Seiten, 25 Euro
 Gerade in den experimentellen Seiten des Jazz und der improvisierten Musikbedarf es Veranstalter, die vor allem ihrem eigenen Ohr folgen und nicht auf Publikum schielen müssen. Macht man das lang genug und bleibt sich selbst, den Musikern und dem Publikum gegenüber (ästhetisch) ehrlich, dann erreicht man im Idealfall ein eingeschworenes Publikum, das das Möglichmachen von Experimenten zu schätzen weiß. Ein solcher Fall ist das Konfrontationen-Festival im österreichischen Nickelsdorf, das seit 30 Jahren das Experiment eines Festivals improvisierter Musik wagt und damit weit über die Grenzen Österreichs bekannt wurde. Konfrontationen-Gründer Hans Falb und Philipp Schmickl haben nun ein Buch vorgelegt, das verschiedene Seiten der improvisierten Musik dokumentiert, daneben aber immer auch eine Homage an die Freiheit der Performance und damit an das Nickelsdorfer Festival selbst ist. Joe McPhee verneigt sich darin vor Clifford Thornton; Georg Graewe reflektiert über die Spielstätten, in denen Jazzmusiker arbeiten; Hans Falb schreibt über den Klarinettisten John Carter. Falb unterhält sich außerdem mit Roscoe Mitchell über die AACM, und Alexandre Pierrepont reflektiert über jüngere Aktivitäten der AACM. Paul Lovens erzählt übers Schlagzeugspielen, über sein Instrument, über (nicht mur musikalische) Einflüsse auf seine Kunst, über das Gedächtnis,und warum er beim Spielen meist ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte trägt. Auch Hamid Drake erzählt über seine Einflüsse, insbesondere über die Bedeutung Fred Andersons und der Chicagoer Community für seine Entwicklung. Joelle Léandre erklärt, dass das Improvisieren eine ernsthafte Kunst sei, die man nicht improvisiere. Evan Parker reflektiert über aktuelle improvisierte Musik und wie sich ihre Ästhetik ändere. Mircea Streit berichtet über improvisierte Musik in Rumänien. Dazwischen gibt es viele Fotos, die ein wenig den Geist Nickelsdorfs beschwören: musikalisch, nachdenklich, beschaulich, intensiv, kreativ. Eine Labor of Love, ganz wie das Festival. Konfrontationen…
Gerade in den experimentellen Seiten des Jazz und der improvisierten Musikbedarf es Veranstalter, die vor allem ihrem eigenen Ohr folgen und nicht auf Publikum schielen müssen. Macht man das lang genug und bleibt sich selbst, den Musikern und dem Publikum gegenüber (ästhetisch) ehrlich, dann erreicht man im Idealfall ein eingeschworenes Publikum, das das Möglichmachen von Experimenten zu schätzen weiß. Ein solcher Fall ist das Konfrontationen-Festival im österreichischen Nickelsdorf, das seit 30 Jahren das Experiment eines Festivals improvisierter Musik wagt und damit weit über die Grenzen Österreichs bekannt wurde. Konfrontationen-Gründer Hans Falb und Philipp Schmickl haben nun ein Buch vorgelegt, das verschiedene Seiten der improvisierten Musik dokumentiert, daneben aber immer auch eine Homage an die Freiheit der Performance und damit an das Nickelsdorfer Festival selbst ist. Joe McPhee verneigt sich darin vor Clifford Thornton; Georg Graewe reflektiert über die Spielstätten, in denen Jazzmusiker arbeiten; Hans Falb schreibt über den Klarinettisten John Carter. Falb unterhält sich außerdem mit Roscoe Mitchell über die AACM, und Alexandre Pierrepont reflektiert über jüngere Aktivitäten der AACM. Paul Lovens erzählt übers Schlagzeugspielen, über sein Instrument, über (nicht mur musikalische) Einflüsse auf seine Kunst, über das Gedächtnis,und warum er beim Spielen meist ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte trägt. Auch Hamid Drake erzählt über seine Einflüsse, insbesondere über die Bedeutung Fred Andersons und der Chicagoer Community für seine Entwicklung. Joelle Léandre erklärt, dass das Improvisieren eine ernsthafte Kunst sei, die man nicht improvisiere. Evan Parker reflektiert über aktuelle improvisierte Musik und wie sich ihre Ästhetik ändere. Mircea Streit berichtet über improvisierte Musik in Rumänien. Dazwischen gibt es viele Fotos, die ein wenig den Geist Nickelsdorfs beschwören: musikalisch, nachdenklich, beschaulich, intensiv, kreativ. Eine Labor of Love, ganz wie das Festival. Konfrontationen…
(Wolfram Knauer)
Das Buch kann hier bestellt werden: www.konfrontationen.at/ko09/nolies.html
Man of the Light. Życie I twórczość Zigniewa Seiferta,
Aneta Norek
Krakow 2009 (Musica Iagellonica)
168 Seiten plus eine beigeheftete CD, 45 PLN
ISBN: 978-83-7099-166-1
 Aneta Norek schrieb ihre Magisterarbeit über den Einfluss der Musik von Karol Szymanowski auf den Jazzgeiger Zbigniew Seifert. Bei den Recherchen traf sie auf so viele Musiker, die von Seiferts Musik nachhaltig beeinflusst waren, dass sie sich entschloss, eine Biographie des 1979 an Krebs verstorbenen polnischen Violinisten zu schreiben. Sie kontaktierte viele der Musiker, mit denen Seifert seit den frühen 1960er Jahren zusammengespielt hatte, forschte in Archiven vor Ort in Krakau genauso wie beispielsweise beim Jazzinstitut Darmstadt und legt jetzt ein Buch vor, das sein Leben und seine musikalische Entwicklung verfolgt, gespickt ist mit seltenen Fotos und Dokumenten. Diese machen das Buch sicher auch für Leser interessant, die des Polnischen nicht mächtig sind. Auch ohne die notwendigen Sprachkenntnisse merkt man schnell, welch akribische Arbeit in Noreks Recherchen ging, und hofft, dass vielleicht doch eines Tages eine zumindest englische Übersetzung des Buches möglich wird. Die Buchvorstellung fand übrigens im Rahmen eines Seifert gewidmeten Festivals in Krakau statt, bei dem unter anderem Seiferts “Jazzkonzert für Violine, Sinfonieorchester und Rhythmusgruppe” aufgeführt wurde, mit Mateusz Smoczynski (Geige), Joachim Kühn (Piano), Bronislaw Suchanek (Bass), Janusz Stefanski (Drums) und dem Philharmonischen Orchester Krakau. Eine CD mit der Originalaufnahme dieser Komposition heftet dem Buch bei. Kühn war 1974 ebenfalls mit von der Partie, daneben spielten außer Seifert Eberhard Weber, Daniel Humair und das Runfkunkorchester Hannover des NDR.
Aneta Norek schrieb ihre Magisterarbeit über den Einfluss der Musik von Karol Szymanowski auf den Jazzgeiger Zbigniew Seifert. Bei den Recherchen traf sie auf so viele Musiker, die von Seiferts Musik nachhaltig beeinflusst waren, dass sie sich entschloss, eine Biographie des 1979 an Krebs verstorbenen polnischen Violinisten zu schreiben. Sie kontaktierte viele der Musiker, mit denen Seifert seit den frühen 1960er Jahren zusammengespielt hatte, forschte in Archiven vor Ort in Krakau genauso wie beispielsweise beim Jazzinstitut Darmstadt und legt jetzt ein Buch vor, das sein Leben und seine musikalische Entwicklung verfolgt, gespickt ist mit seltenen Fotos und Dokumenten. Diese machen das Buch sicher auch für Leser interessant, die des Polnischen nicht mächtig sind. Auch ohne die notwendigen Sprachkenntnisse merkt man schnell, welch akribische Arbeit in Noreks Recherchen ging, und hofft, dass vielleicht doch eines Tages eine zumindest englische Übersetzung des Buches möglich wird. Die Buchvorstellung fand übrigens im Rahmen eines Seifert gewidmeten Festivals in Krakau statt, bei dem unter anderem Seiferts “Jazzkonzert für Violine, Sinfonieorchester und Rhythmusgruppe” aufgeführt wurde, mit Mateusz Smoczynski (Geige), Joachim Kühn (Piano), Bronislaw Suchanek (Bass), Janusz Stefanski (Drums) und dem Philharmonischen Orchester Krakau. Eine CD mit der Originalaufnahme dieser Komposition heftet dem Buch bei. Kühn war 1974 ebenfalls mit von der Partie, daneben spielten außer Seifert Eberhard Weber, Daniel Humair und das Runfkunkorchester Hannover des NDR.
(Wolfram Knauer)
Art Tatum. Eine Biographie
von Mark Lehmstedt
Leipzig 2009 (Lehmstedt Verlag)
319 Seiten, 39,90 Euro
ISBN: 978-3-937146-80-5
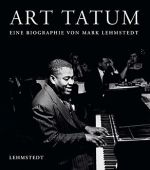 Über Art Tatum ist viel geschrieben worden. Es existiert eine umfassende Diskographie (von Arnold Laubich & Ray Spencer, 1982) und eine Biographie (von James Lester, 1994), außerdem eine Dissertation, die seine frühe Zeit in Toledo untersucht (von Imelda Hunt, 1995). Nun legt ausgerechnet ein deutscher Autor eine umfassende Tatum-Biographie vor, für die er in Archiven gestöbert und alles an Informationen über den Pianisten zusammengeklaubt hat, was er finden konnte. Herausgekommen ist ein überaus lesenswertes Buch, die Lebensgeschichte eines Mannes, der in eine Mittelklassefamilie geboren wurde, mit nur geringster Sehkraft durchs Leben kam und seit den frühen 1930er Jahren zu den bewundertsten Pianisten des Jazz gehörte. “Ich spiele nur Klavier”, soll Fats Waller einmal gesagt haben, als Art Tatum einen Club betrat, in dem er spielte, “aber heute ist Gott im Raum.” Lehmstedt nimmt die veröffentlichten Biographien zum Ausgangspunkt und baut auf ihnen auf, verflicht die Informationen, die er über Tatum erhält, mit denen über andere Musiker oder über soziale oder Lebensumstände der Zeit. Er durchsetzt die Geschichte vor allem stark mit Zeitzeugenberichten, Ausschnitten aus Interviews mit Tatum oder anderen Musikern und muss sich damit nur selten mit eigenen Mutmaßungen begnügen. Er beschreibt den Ruhm, den Tatum als Solist hatte, und zwar nicht nur in der Welt des Jazz, er schreibt über das schlagzeuglose Klaviertrio, das Tatum zwar nicht erfunden, aber ganz sicher besonders bekannt gemacht hatte, über Konzerte in Kaschemmen, mondänen Nightclubs und auf großen Konzertbühnen, über Jam Sessions mit Kollegen, seine Plattenaufnahmen für Norman Granz und über die unendliche Bewunderung, die Tatum, von Musikern aus allen Stilbereichen des Jazz, aber auch aus der Klassik und von anderswo entgegengebracht wurde. Lehmstedt gelingt es, all diese Puzzleteilchen seiner Recherche zu einen spannend zu lesenden Text zusammenzufügen, in dem seine eigene Bewunderung durchscheint ohne zu dominieren. Die Musik kommt bei alledem manchmal etwas kurz: Lehmstedt ist kein Musikschriftsteller, dem es gelingen könnte, die Musik mit Worten zum Klingen zu bringen. Seine musikalischen Einlassungen lassen es meist beim oft-gelesenen Klischeehaften, ohne tiefer in die Musik einzudringen, ohne zu hinterfragen, was genau an Tatums Tastenvirtuosität so fesselnd ist. Er muss sich auf Kollegen stützen, um dies zu tun, aber dafür hat er genügend — und zwar genügend gute — Schriftsteller, die er zitieren kann. Diese Tatsache ist also keineswegs als Kritik zu werten, und eigentlich fehlt die musikalische Einlassung auch nicht wirklich, denn das Buch heißt nun mal “Eine Biographie”, und es ist am besten mit einer Tatum CD (oder zwei oder drei) zu lesen. Und anzuschauen: Viele Fotos nämlich sind auch dabei, wunderbar reproduziert und oft genug großformatig abgedruckt. Am Ende finden sich eine Diskographie sowie eine ausführliche Literaturliste und ein Personenindex. Das ganze ist eindeutig eine “labor of love”, daneben eine Fleißarbeit und schließlich eine spannende Lektüre für jeden, der dem Klaviergott des Jazz näher kommen will.
Über Art Tatum ist viel geschrieben worden. Es existiert eine umfassende Diskographie (von Arnold Laubich & Ray Spencer, 1982) und eine Biographie (von James Lester, 1994), außerdem eine Dissertation, die seine frühe Zeit in Toledo untersucht (von Imelda Hunt, 1995). Nun legt ausgerechnet ein deutscher Autor eine umfassende Tatum-Biographie vor, für die er in Archiven gestöbert und alles an Informationen über den Pianisten zusammengeklaubt hat, was er finden konnte. Herausgekommen ist ein überaus lesenswertes Buch, die Lebensgeschichte eines Mannes, der in eine Mittelklassefamilie geboren wurde, mit nur geringster Sehkraft durchs Leben kam und seit den frühen 1930er Jahren zu den bewundertsten Pianisten des Jazz gehörte. “Ich spiele nur Klavier”, soll Fats Waller einmal gesagt haben, als Art Tatum einen Club betrat, in dem er spielte, “aber heute ist Gott im Raum.” Lehmstedt nimmt die veröffentlichten Biographien zum Ausgangspunkt und baut auf ihnen auf, verflicht die Informationen, die er über Tatum erhält, mit denen über andere Musiker oder über soziale oder Lebensumstände der Zeit. Er durchsetzt die Geschichte vor allem stark mit Zeitzeugenberichten, Ausschnitten aus Interviews mit Tatum oder anderen Musikern und muss sich damit nur selten mit eigenen Mutmaßungen begnügen. Er beschreibt den Ruhm, den Tatum als Solist hatte, und zwar nicht nur in der Welt des Jazz, er schreibt über das schlagzeuglose Klaviertrio, das Tatum zwar nicht erfunden, aber ganz sicher besonders bekannt gemacht hatte, über Konzerte in Kaschemmen, mondänen Nightclubs und auf großen Konzertbühnen, über Jam Sessions mit Kollegen, seine Plattenaufnahmen für Norman Granz und über die unendliche Bewunderung, die Tatum, von Musikern aus allen Stilbereichen des Jazz, aber auch aus der Klassik und von anderswo entgegengebracht wurde. Lehmstedt gelingt es, all diese Puzzleteilchen seiner Recherche zu einen spannend zu lesenden Text zusammenzufügen, in dem seine eigene Bewunderung durchscheint ohne zu dominieren. Die Musik kommt bei alledem manchmal etwas kurz: Lehmstedt ist kein Musikschriftsteller, dem es gelingen könnte, die Musik mit Worten zum Klingen zu bringen. Seine musikalischen Einlassungen lassen es meist beim oft-gelesenen Klischeehaften, ohne tiefer in die Musik einzudringen, ohne zu hinterfragen, was genau an Tatums Tastenvirtuosität so fesselnd ist. Er muss sich auf Kollegen stützen, um dies zu tun, aber dafür hat er genügend — und zwar genügend gute — Schriftsteller, die er zitieren kann. Diese Tatsache ist also keineswegs als Kritik zu werten, und eigentlich fehlt die musikalische Einlassung auch nicht wirklich, denn das Buch heißt nun mal “Eine Biographie”, und es ist am besten mit einer Tatum CD (oder zwei oder drei) zu lesen. Und anzuschauen: Viele Fotos nämlich sind auch dabei, wunderbar reproduziert und oft genug großformatig abgedruckt. Am Ende finden sich eine Diskographie sowie eine ausführliche Literaturliste und ein Personenindex. Das ganze ist eindeutig eine “labor of love”, daneben eine Fleißarbeit und schließlich eine spannende Lektüre für jeden, der dem Klaviergott des Jazz näher kommen will.
(Wolfram Knauer)
The Music and Life of Theodore “Fats” Navarro. Infatuation
von Leif Bo Petersen & Theo Rehak
Lanham/MD 2009 (Scarecrow Press)
378 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-6721-5
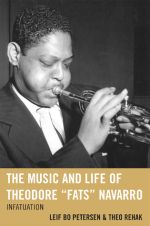 Leif Bo Petersen und Theo Rehak (der Bruder des Posaunisten Frank Rehak) sind beide Amateurtrompeter und seit langem von der Musik Fats Navarros fasziniert. Rehak war 1966 durch den Kritiker George Hoefer, der ein Freund der Familie war, auf Navarro aufmerksam geworden und hatte seither Interviews und Informationen über den Trompeter gesammelt. In der vorliegenden Biographie vereinen sie ihr Fachwissen in einem beispielhaften Unterfangen, biographische Details, musikalische Analyse und diskographische Recherche zusammenzubringen. Rehak fand 1969 die Mutter Navarros und konnte so die Kindheit und Jugend des Trompeters sorgfältig recherchieren. Navarro wurde 1923 in Key West geboren. In der Schule begann er Trompete zu spielen, tourte mit Freunden und spielte in Hotels und Kaschemmen. 1941 wurde er Mitglied der Territory Band von Sol Albright in Orlando, später im selben Jahr spielte er in der Band von Snookum Russell in Indianapolis, in der er neben dem Posaunisten J.J. Johnson saß. Von 1943 bis 1945 wirkte er in Andy Kirks Band, in der auch Howard McGhee spielte, und war 1945 mit Coleman Hawkins auf der 52nd Street in New York zu hören. In New York hörte er Dizzy Gillespie, von dem er so begeistert war, dass er dessen Soli Ton für Ton nachspielen konnte. Im Frühjahr 1945 ersetzte er Gillespie in der Band Billy Eckstines. Nach diversen Bigbands war er ab 1946 in kleineren Besetzungen zu hören, etwa von Hawkins, Kenny Clarke oder Eddie Lockjaw Davis. Anfang 1947 spielte er mit der Illinois Jacquet Big Band, ab Herbst des Jahres erschienen dann seine ersten Aufnahmen unter eigenem Namen, die er für das Blue Note-Label einspielte. Er war mit Tadd Dameron zu hören und mit Allstar-Bands um Hawkins oder Lionel Hampton und wurde 1948 Mitglied des Septetts Benny Goodmans, der damals versuchte auf den Zug des modernen Jazz aufzuspringen. 1949 war Navarro bei Bud Powells legendärer Plattensitzung für Blue Note mit dabei und trat 1949 im Birdland mit Charlie Parker auf. Er war damals bereits schwer heroin-abhängig und litt außerdem an fortgeschrittener Tuberkulose, an der er am 6. Juli 1950 verstarb. Petersen und Rehak teilen sich die Arbeit: Rehak erzählt die Lebensgeschichte, sorgfältig recherchiert, gewürzt mit Interviews von Zeitzeugen und Musikerkollegen, Petersen liefert die zwischen die Kapitel geschaltete Diskographie, die allerdings weit mehr ist als eine herkömmliche Diskographie, nämlich zugleich analytische Anmerkungen und Transkriptionen vieler Soli des Trompeters enthält. Für jeden ist etwas dabei, und besser ist es wohl kaum zu machen. Ein mehr als lobenswerter jazzhistorischer Wurf der Buchrreihe, die vom Institute of Jazz Studies an der Rutgers University betreut und herausgegeben wird.
Leif Bo Petersen und Theo Rehak (der Bruder des Posaunisten Frank Rehak) sind beide Amateurtrompeter und seit langem von der Musik Fats Navarros fasziniert. Rehak war 1966 durch den Kritiker George Hoefer, der ein Freund der Familie war, auf Navarro aufmerksam geworden und hatte seither Interviews und Informationen über den Trompeter gesammelt. In der vorliegenden Biographie vereinen sie ihr Fachwissen in einem beispielhaften Unterfangen, biographische Details, musikalische Analyse und diskographische Recherche zusammenzubringen. Rehak fand 1969 die Mutter Navarros und konnte so die Kindheit und Jugend des Trompeters sorgfältig recherchieren. Navarro wurde 1923 in Key West geboren. In der Schule begann er Trompete zu spielen, tourte mit Freunden und spielte in Hotels und Kaschemmen. 1941 wurde er Mitglied der Territory Band von Sol Albright in Orlando, später im selben Jahr spielte er in der Band von Snookum Russell in Indianapolis, in der er neben dem Posaunisten J.J. Johnson saß. Von 1943 bis 1945 wirkte er in Andy Kirks Band, in der auch Howard McGhee spielte, und war 1945 mit Coleman Hawkins auf der 52nd Street in New York zu hören. In New York hörte er Dizzy Gillespie, von dem er so begeistert war, dass er dessen Soli Ton für Ton nachspielen konnte. Im Frühjahr 1945 ersetzte er Gillespie in der Band Billy Eckstines. Nach diversen Bigbands war er ab 1946 in kleineren Besetzungen zu hören, etwa von Hawkins, Kenny Clarke oder Eddie Lockjaw Davis. Anfang 1947 spielte er mit der Illinois Jacquet Big Band, ab Herbst des Jahres erschienen dann seine ersten Aufnahmen unter eigenem Namen, die er für das Blue Note-Label einspielte. Er war mit Tadd Dameron zu hören und mit Allstar-Bands um Hawkins oder Lionel Hampton und wurde 1948 Mitglied des Septetts Benny Goodmans, der damals versuchte auf den Zug des modernen Jazz aufzuspringen. 1949 war Navarro bei Bud Powells legendärer Plattensitzung für Blue Note mit dabei und trat 1949 im Birdland mit Charlie Parker auf. Er war damals bereits schwer heroin-abhängig und litt außerdem an fortgeschrittener Tuberkulose, an der er am 6. Juli 1950 verstarb. Petersen und Rehak teilen sich die Arbeit: Rehak erzählt die Lebensgeschichte, sorgfältig recherchiert, gewürzt mit Interviews von Zeitzeugen und Musikerkollegen, Petersen liefert die zwischen die Kapitel geschaltete Diskographie, die allerdings weit mehr ist als eine herkömmliche Diskographie, nämlich zugleich analytische Anmerkungen und Transkriptionen vieler Soli des Trompeters enthält. Für jeden ist etwas dabei, und besser ist es wohl kaum zu machen. Ein mehr als lobenswerter jazzhistorischer Wurf der Buchrreihe, die vom Institute of Jazz Studies an der Rutgers University betreut und herausgegeben wird.
(Wolfram Knauer)
Die Stimme im HipHop. Untersuchungen eines intermedialen Phänomens
Herausgegeben von Fernand Hörner & Oliver Kautny
Bielefeld 2009 (transcript)
Reihe Studien zur Popularmusik
210 Seiten, 22,80 Euro
ISBN: 978-3-89942-998-5
 Schon lange ist HipHop kein Jugendphänomen allein mehr, schon lange spielt er nicht mehr nur in der Subkultur Afro-Amerikas ab. HipHop ist ein weltweites genreübergreifendes Phänomen geworden, das insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Kreativität in musikalische Äuzßerungen umzusetzen. Die Beiträge des vorliegenden Bandes untersuchen, welche Rolle dabei die Stimme spielt, und was Stimme über die Worte hinaus, die mit ihr gesungen und gerapt werden, an Informationen gibt. Murray Forman untersucht dabei, wie vokale Intonation im Rap mit der Konstruktuon symbolischer Werte und sozialer Bedeutungen korreliert. Christian Bielefeldt geht auf die konkreten Inhalte ein, die sich klischeehaft in vielen Rap-Lyrics finden und stellt die beiden Narrative von Black Dandy und Bad Nigga gegenüber. Johannes Ismaiel-Wendt und Susanne Stemmler befassen sich mit der Musik des kanadisch-somalischen MCs K’Naan, dessen Lieder den Hörer im Ineinandergreifen von Stimme, Text, Musik und biographischer Information mit einer Vorstellung von Afrika verbinden, die dem Sänger vorschwebt. Fernand Hörner analysiert den Videoclip “Authentik” der französischen HipHop-Band Suprême NTM. Stefan Neumann schaut auf die HipHop-Skits, die gesprochenen Worte, die sich oft zwischen den Tracks von HipHop-Alben finden. Oliver Lautny untersucht “Flow” als ein rhythmisches Phänomen zwischen Worten, Reimen und Musik. Dietmar Elflein untersucht fünf HipHop-Beats auf die Beziehungen zwischen Beat, Sound und Stimme. Das Buch versammelt dabei sowohl musikwissenschaftliche wie auch allgemein kulturwissenschaftliche und soziologische Ansätze, ist nicht als Einführung ins Thema gedacht, bietet stattdessen jede Menge interessanter Einblicke in ein Forschungsgebiet, das dem Jazz gar nicht ganz so entfernt ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.
Schon lange ist HipHop kein Jugendphänomen allein mehr, schon lange spielt er nicht mehr nur in der Subkultur Afro-Amerikas ab. HipHop ist ein weltweites genreübergreifendes Phänomen geworden, das insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Kreativität in musikalische Äuzßerungen umzusetzen. Die Beiträge des vorliegenden Bandes untersuchen, welche Rolle dabei die Stimme spielt, und was Stimme über die Worte hinaus, die mit ihr gesungen und gerapt werden, an Informationen gibt. Murray Forman untersucht dabei, wie vokale Intonation im Rap mit der Konstruktuon symbolischer Werte und sozialer Bedeutungen korreliert. Christian Bielefeldt geht auf die konkreten Inhalte ein, die sich klischeehaft in vielen Rap-Lyrics finden und stellt die beiden Narrative von Black Dandy und Bad Nigga gegenüber. Johannes Ismaiel-Wendt und Susanne Stemmler befassen sich mit der Musik des kanadisch-somalischen MCs K’Naan, dessen Lieder den Hörer im Ineinandergreifen von Stimme, Text, Musik und biographischer Information mit einer Vorstellung von Afrika verbinden, die dem Sänger vorschwebt. Fernand Hörner analysiert den Videoclip “Authentik” der französischen HipHop-Band Suprême NTM. Stefan Neumann schaut auf die HipHop-Skits, die gesprochenen Worte, die sich oft zwischen den Tracks von HipHop-Alben finden. Oliver Lautny untersucht “Flow” als ein rhythmisches Phänomen zwischen Worten, Reimen und Musik. Dietmar Elflein untersucht fünf HipHop-Beats auf die Beziehungen zwischen Beat, Sound und Stimme. Das Buch versammelt dabei sowohl musikwissenschaftliche wie auch allgemein kulturwissenschaftliche und soziologische Ansätze, ist nicht als Einführung ins Thema gedacht, bietet stattdessen jede Menge interessanter Einblicke in ein Forschungsgebiet, das dem Jazz gar nicht ganz so entfernt ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.
(Wolfram Knauer)
Jazz behind the dikes. Vijfenachtig jaar schrijven over jazz in Nederland
von Walter van de Leur
Amsterdam 2009
Vossiuspers UvA / Amsterdam University Press
28 Seiten, 8,50 Euro
ISBN: 978-9-056-29555-4
 Das kleine Büchlein der Amsterdam University Press enthält die Antrittsvorlesung Walter van de Leurs als Professor für Jazz und Improvisationsmusik an der Universität Amsterdam im Juni 2008. In ihr beleuchtet er 85 Jahre Schreiben über Jazz in den Niederlanden. Es begann alles Mitte der 1920er Jahre, als erst James Meyer, später die Original Ramblers in Holland zu Popularität gelangten und der Jazz mehr und mehr zu einem berichtenswerten Thema wurde. 1931 rief der Altsaxophonist Ben Bakema die Zeitschrift “De Jazzwereld” ins Leben, die bis 1940 erschien und sich selbst als holländischer “Melody Maker” verstand. 1949 erschien Hans de Vaals Buch “Jazz, van Oerwoudrhythme tot Hollywoodsymphonie”, das doch eine recht eingeschränkte Vorstellung von dem widerspiegelt, was Jazz ausmacht und insbesondere den Bebop als definitive Degeneration der ursprünglichen Jazzmusik verteufelte. Solche Sichtweisen, meint Van de Leur, sagen dabei ja durchaus etwas über Rezeptionshaltungen und ästhetische Diskussionen der Zeit aus. Zwei jüngere Studien zum Jazz in den Niederlanden von Kees Wouters und Henk Kleinhout untersuchen die Früh- und Nachkriegsgeschichte des Jazz in den Niederlanden; eine Studie zur Jazzkritik in den Niederlande allerdings, die dem entsprechen könnte, was John Gennari in seinem Buch “Blowing Hot and Cool. Jazz and its Critics” für die USA vorgelegt hat, fehle bislang noch. Die letzten vierzig Jahre des niederländischen Jazzlebens seien aber überhaupt kaum wissenschaftlich (oder mit der notwendigen kritischen Distanz) bearbeitet worden, auch Kevin Whitehead’s “New Dutch Swing” enthalte nicht viel mehr als ein atmosphärisches Bild der Amsterdamer Szene. Jazzjournalistik sei in den Niederlanden wie anderswo auch ein oft von Laien und Liebhabern beackertes Feld; Journalisten, die mit tatsächlichem journalistischem Ethos an ihre Arbeit gehen, von der Sache etwas verstehen und zugleich die notwendige kritische Distanz besitzen, seien eher selten. Aber wie solle das auch anders sein, wo doch selbst die Musiker des Jazz anfangs höchstens in anderen Bands, Workshops etc. Unterricht erhalten haben, ihren eigenen Weg aber selbst suchen mussten. Auch auf der Hochschule lerne man höchstens das Handwerk, den eigenen Weg müsse man auch hier selber finden. Nicht anders, scheint sein Fazit, sei es wohl, wenn man über Jazz schreiben wolle. Der Lehrstuhl jedenfalls, den Van de Leur an der Universität von Amsterdam angetreten hat, soll auch dabei helfen, das Denken, Forschen und Schreiben über Jazz und improvisierte Musik in den Niederlanden zu verbessern.
Das kleine Büchlein der Amsterdam University Press enthält die Antrittsvorlesung Walter van de Leurs als Professor für Jazz und Improvisationsmusik an der Universität Amsterdam im Juni 2008. In ihr beleuchtet er 85 Jahre Schreiben über Jazz in den Niederlanden. Es begann alles Mitte der 1920er Jahre, als erst James Meyer, später die Original Ramblers in Holland zu Popularität gelangten und der Jazz mehr und mehr zu einem berichtenswerten Thema wurde. 1931 rief der Altsaxophonist Ben Bakema die Zeitschrift “De Jazzwereld” ins Leben, die bis 1940 erschien und sich selbst als holländischer “Melody Maker” verstand. 1949 erschien Hans de Vaals Buch “Jazz, van Oerwoudrhythme tot Hollywoodsymphonie”, das doch eine recht eingeschränkte Vorstellung von dem widerspiegelt, was Jazz ausmacht und insbesondere den Bebop als definitive Degeneration der ursprünglichen Jazzmusik verteufelte. Solche Sichtweisen, meint Van de Leur, sagen dabei ja durchaus etwas über Rezeptionshaltungen und ästhetische Diskussionen der Zeit aus. Zwei jüngere Studien zum Jazz in den Niederlanden von Kees Wouters und Henk Kleinhout untersuchen die Früh- und Nachkriegsgeschichte des Jazz in den Niederlanden; eine Studie zur Jazzkritik in den Niederlande allerdings, die dem entsprechen könnte, was John Gennari in seinem Buch “Blowing Hot and Cool. Jazz and its Critics” für die USA vorgelegt hat, fehle bislang noch. Die letzten vierzig Jahre des niederländischen Jazzlebens seien aber überhaupt kaum wissenschaftlich (oder mit der notwendigen kritischen Distanz) bearbeitet worden, auch Kevin Whitehead’s “New Dutch Swing” enthalte nicht viel mehr als ein atmosphärisches Bild der Amsterdamer Szene. Jazzjournalistik sei in den Niederlanden wie anderswo auch ein oft von Laien und Liebhabern beackertes Feld; Journalisten, die mit tatsächlichem journalistischem Ethos an ihre Arbeit gehen, von der Sache etwas verstehen und zugleich die notwendige kritische Distanz besitzen, seien eher selten. Aber wie solle das auch anders sein, wo doch selbst die Musiker des Jazz anfangs höchstens in anderen Bands, Workshops etc. Unterricht erhalten haben, ihren eigenen Weg aber selbst suchen mussten. Auch auf der Hochschule lerne man höchstens das Handwerk, den eigenen Weg müsse man auch hier selber finden. Nicht anders, scheint sein Fazit, sei es wohl, wenn man über Jazz schreiben wolle. Der Lehrstuhl jedenfalls, den Van de Leur an der Universität von Amsterdam angetreten hat, soll auch dabei helfen, das Denken, Forschen und Schreiben über Jazz und improvisierte Musik in den Niederlanden zu verbessern.
(Wolfram Knauer)
Blue Note Photography: Francis Wolff / Jimmy Katz
herausgegeben von Rainer Placke & Ingo Wulff
Bad Oeynhausen 2009
jazzprezzo
204 Seiten, 2 CDs, 70 Euro
ISBN: 978-3-9810250-8-8
 Vor 70 Jahren erschien die erste Platte des Labels Blue Note, gegründet von den beiden in Deutschland geborenen Exilanten Alfred Lion und Francis Wolff. In diesem Jahr häufen sich also die Jubelfeierlichkeiten, und es ist irgendwie vielleicht ganz passend, dass das Hauptwerk hierzu aus einem deutschen Verlag stammt, herausgegeben von zwei ästhetischen Überzeugungstätern, die darin den gründern von Blue Note ganz ähnlich sind, die auch nur aufnahmen, was ihnen gefiel. Francis Wolff war nicht nur Eigner des Labels, sondern zugleich Fotograf, und seine sicht der Musiker bestimmt bis zum heutigen Tag die visuelle Vorstellung jener legendären Aufnahmen insbesondere aus den 1950er und 1960er Jahren. Placke und Wulff sichteten hunderte von Kontaktbögen und wählten Fotos aus, in denen sich entweder die Atmosphäre der Aufnahmesitzungen besonders gut mitteilt oder aber in denen Francis Wolff Musiker inner- oder außerhalb des Studios in ungewöhnlichen Settings zeigte. Es sind Fotos, die Jazzgeschichte schrieben, Fotos, die aussehen wie solche, die Jazzgeschichte schrieben (weil sie von derselben Fotosession stammen) und Fotos, die man noch nie gesehen hat, die aber gerade in der Bündelung dieses Buchs die Menschen dahinter, die Musiker, ihre Kunst und künstlerische Verletzlichkeit näherbringen. Eine Aufnahmesitzung von 1946, bei der sich Sidney Bechet und Albert Nicholas gegenüberstehen, aufmerksam, konzentriert, aber offensichtlich noch nicht bei der Aufnahme. Miles Davis mit übereinandergeschlagenen Beinen und leicht zur Seite gelegtem Kopf. Davis, der J.J. Johnson eine Stelle auf dem Klavier vorspielt. Clifford Brown, konzentriert in die Trompete blasend, Bud Powell, aufmerksam zuhörend. Jimmy Smith, rauchend und lachend (einem Playback zuhörend?). Thad Jones in die Ferne blickend zwischen parkenden Autos oder, in einem anderen Bild, an ein Straßenschild lehnend. Paul Chambers mit Bass vor dem Alvin Hotel. Max Roach, konzentriert Stöcke balancierend hinter seinem Schlagzeugset. Sonny Rollins, ein wenig ermüdet im Rudy van Gelder Studio. Mittagsause auf dem Hof des Studios mit Clifford Jordan, Lee Moran und anderen. Donald Byrd, der einem kleinen Kind seine Trompete zeigt. John Coltrane, konzentriert zuhörend. Bud Powell im Auto, Noten studierend, mit seinem Sohn. Lou Donaldson im Park, Jackie McLean mit einem Kapuzineräffchen oder an einer Pariser Metrostation, Dexter Gordon in der Kutsche. Der blutjunge Tony Williams hinterm Schlagzeug, Wayne Shorter, nachdenklich auf seinem Instrumentenkoffer sitzend, Dexter Gordon mit einer Zeitungsverkäuferin flirtend. Elvin Jones mit nacktem Oberkörper und sichtichem Spaß an der Musik, Herbie Hancock auf dem Boden liegend, rauchend, entspannend. Cecil Taylor, Ornette Coleman, Don Cherry, Pharoah Sanders. Namen, Gesichter, Instrumente, Sounds. Es ist erstaunlich von welcher bildlichen Qualität diese Fotos zeugen, die die Musiker als Menschen zeigen, kritisch, meditativ, reflexiv, in einem kreativen Prozess, der dauernde Aufmerksamkeit erfordert. Jimmy Katz hat seit den frühen 1990er Jahren Fotos für das wiederbelebte Blue-Note-Label gemacht. Und auch wenn er nicht vom Fotografen Francis Wolff beeinflusst ist, so stammen seine Bilder doch aus einem ähnlichen Geiste: Auch er versucht die Persönlichkeit einzufangen, die Magie der Musik, wie sie sich in der Haltung und den Gesichtern der Musiker widerspiegelt. Einige Musiker begegnen uns in seinen Bildern wieder, etwa Elvin Jones, Andrew Hill oder Max Roach. Andere lassen uns vergegenwärtigen, dass diese lange Tradition noch immer lebt: dass der Jazz fortbestehen wird, solange es kreative Musiker gibt. Das Buch wird angerundet durch Artikel von Michael Cuscuna, Ashley Kahn, Bruce Lundvall, Rudy Van Gelder und Jimmy Katz. Zwei CDs geben einen Querschnitt durch die Blue-Note-Plattengeschichte von Albert Ammons und Meade Lux Lewis über Sidney Bechet, Thelonious Monk, Bud Powell, Art Blakey, John Coltrane, Herbie Hancock bis zur jungen Blue-Note-Generation, Cassandra Wilson, Jacky Terrasson, Joe Lovano, Greg Osby oder Dianne Reeves. Ein mächtiges Buch, ein schweres Buch, und irgendwie schon jetzt ein Buch des Jahres. Mit Liebe zusammengestellt; von Ingo Wulff verlässlich hervorragend gestaltet, auf schwerem Papier gedruckt. Weihnachtsgeschenk? Weihnachtsgeschenk!
Vor 70 Jahren erschien die erste Platte des Labels Blue Note, gegründet von den beiden in Deutschland geborenen Exilanten Alfred Lion und Francis Wolff. In diesem Jahr häufen sich also die Jubelfeierlichkeiten, und es ist irgendwie vielleicht ganz passend, dass das Hauptwerk hierzu aus einem deutschen Verlag stammt, herausgegeben von zwei ästhetischen Überzeugungstätern, die darin den gründern von Blue Note ganz ähnlich sind, die auch nur aufnahmen, was ihnen gefiel. Francis Wolff war nicht nur Eigner des Labels, sondern zugleich Fotograf, und seine sicht der Musiker bestimmt bis zum heutigen Tag die visuelle Vorstellung jener legendären Aufnahmen insbesondere aus den 1950er und 1960er Jahren. Placke und Wulff sichteten hunderte von Kontaktbögen und wählten Fotos aus, in denen sich entweder die Atmosphäre der Aufnahmesitzungen besonders gut mitteilt oder aber in denen Francis Wolff Musiker inner- oder außerhalb des Studios in ungewöhnlichen Settings zeigte. Es sind Fotos, die Jazzgeschichte schrieben, Fotos, die aussehen wie solche, die Jazzgeschichte schrieben (weil sie von derselben Fotosession stammen) und Fotos, die man noch nie gesehen hat, die aber gerade in der Bündelung dieses Buchs die Menschen dahinter, die Musiker, ihre Kunst und künstlerische Verletzlichkeit näherbringen. Eine Aufnahmesitzung von 1946, bei der sich Sidney Bechet und Albert Nicholas gegenüberstehen, aufmerksam, konzentriert, aber offensichtlich noch nicht bei der Aufnahme. Miles Davis mit übereinandergeschlagenen Beinen und leicht zur Seite gelegtem Kopf. Davis, der J.J. Johnson eine Stelle auf dem Klavier vorspielt. Clifford Brown, konzentriert in die Trompete blasend, Bud Powell, aufmerksam zuhörend. Jimmy Smith, rauchend und lachend (einem Playback zuhörend?). Thad Jones in die Ferne blickend zwischen parkenden Autos oder, in einem anderen Bild, an ein Straßenschild lehnend. Paul Chambers mit Bass vor dem Alvin Hotel. Max Roach, konzentriert Stöcke balancierend hinter seinem Schlagzeugset. Sonny Rollins, ein wenig ermüdet im Rudy van Gelder Studio. Mittagsause auf dem Hof des Studios mit Clifford Jordan, Lee Moran und anderen. Donald Byrd, der einem kleinen Kind seine Trompete zeigt. John Coltrane, konzentriert zuhörend. Bud Powell im Auto, Noten studierend, mit seinem Sohn. Lou Donaldson im Park, Jackie McLean mit einem Kapuzineräffchen oder an einer Pariser Metrostation, Dexter Gordon in der Kutsche. Der blutjunge Tony Williams hinterm Schlagzeug, Wayne Shorter, nachdenklich auf seinem Instrumentenkoffer sitzend, Dexter Gordon mit einer Zeitungsverkäuferin flirtend. Elvin Jones mit nacktem Oberkörper und sichtichem Spaß an der Musik, Herbie Hancock auf dem Boden liegend, rauchend, entspannend. Cecil Taylor, Ornette Coleman, Don Cherry, Pharoah Sanders. Namen, Gesichter, Instrumente, Sounds. Es ist erstaunlich von welcher bildlichen Qualität diese Fotos zeugen, die die Musiker als Menschen zeigen, kritisch, meditativ, reflexiv, in einem kreativen Prozess, der dauernde Aufmerksamkeit erfordert. Jimmy Katz hat seit den frühen 1990er Jahren Fotos für das wiederbelebte Blue-Note-Label gemacht. Und auch wenn er nicht vom Fotografen Francis Wolff beeinflusst ist, so stammen seine Bilder doch aus einem ähnlichen Geiste: Auch er versucht die Persönlichkeit einzufangen, die Magie der Musik, wie sie sich in der Haltung und den Gesichtern der Musiker widerspiegelt. Einige Musiker begegnen uns in seinen Bildern wieder, etwa Elvin Jones, Andrew Hill oder Max Roach. Andere lassen uns vergegenwärtigen, dass diese lange Tradition noch immer lebt: dass der Jazz fortbestehen wird, solange es kreative Musiker gibt. Das Buch wird angerundet durch Artikel von Michael Cuscuna, Ashley Kahn, Bruce Lundvall, Rudy Van Gelder und Jimmy Katz. Zwei CDs geben einen Querschnitt durch die Blue-Note-Plattengeschichte von Albert Ammons und Meade Lux Lewis über Sidney Bechet, Thelonious Monk, Bud Powell, Art Blakey, John Coltrane, Herbie Hancock bis zur jungen Blue-Note-Generation, Cassandra Wilson, Jacky Terrasson, Joe Lovano, Greg Osby oder Dianne Reeves. Ein mächtiges Buch, ein schweres Buch, und irgendwie schon jetzt ein Buch des Jahres. Mit Liebe zusammengestellt; von Ingo Wulff verlässlich hervorragend gestaltet, auf schwerem Papier gedruckt. Weihnachtsgeschenk? Weihnachtsgeschenk!
(Wolfram Knauer)
Heiko Ueberschaer (Herausgeber)
The German Real Book Vol. I
Schiffdorf Wehdel 2009
Nil Edition
keine Seitenzählung, 39,90 Euro
keine ISBN-Nummer
 Das Real Book ist seit Jahrzehnten unverzichtbares Hilfsmittel für Jazzmusiker, wenn sie erfolgreich Gigs oder Jam Sessions bestreiten wollen. Ursprünglich war es eine klug zusammengestellte Sammlung der wichtigsten Standards; bald aber gab es spezielle Real Books, die insbesondere versuchten neben den althergebrachten Musical-Kompositionen auch Kompositionen aktueller Musiker zu präsentieren und so vielleicht auch das allgemein verwendete Repertoire des Jazz ein weing zu aktualisieren und erneuern. Es gab spezielle Real Books, die sich besonderen Stilen zuwandten (Latin Real Book) und solche, die Kompositionen von regionalen Musikern vorstellten. Einige Beispiele für nationale Real Books existieren auch bereits, so etwa ein Swiss Real Book und selbst ein Hamburg Real Book. Nun hat der Nil Verlag mit dem German Real Book nachgezogen. Wo man im originalen Real Book jeden der Titel kennt, weil er sich über Generationen ins Repertoire gebrannt hat, da gehen solche Spezial Real Books den genau umgekehrten Weg: Die in ihnen enthaltenen Kompositionen sind wahrscheinlich den wenigsten bekannt, sollen ja erst durch die Sammlung die Hoffnung darauf, dass das Repertoire bei Sessions oft gespielt wird und sich dadurch Lieblingstitel herausmendeln zu zumindest nationalen Standards werden. Die Komponisten des German Real Books stammen zumeist aus der jüngeren Generation; die Heroen des deutschen Jazz der 1950er, 1960er oder 1970er Jahre also sucht man vergebens. Clemens Orth Jan Klare, Jörg Widmoser, Marco Piludu, Achim Kück, Peter Autschbach, Martin LeJeune, Massoud Goudemann, Dirik Schilgen, Ralph Abelein, Christian Ammann, Andreas Hertel, Michael breotenbach und etliche andere sind mit bis zu drei Titeln vertreten; insbesamt umfast das Buch immerhin 125 Kompositionen deutscher Komponisten und Komponistinnen. Nur elf davon übrigens haben einen deutlich als deutsch erkennbaren Titel; der rest meist englische Überschriften. Es gibt, wie nicht anders zu erwarten, Lead Sheets mit Harmoniesymbolen und einige kleine Arrangements, einfachere Themen, die den üblichen Formschemata gehorchen (Blues, 32-Takte etc.), aber auch komplexere, mehrteilige Stücke, die allerdings eher den kleineren Teil des Buchs ausmachen. Wie gesagt: Was davon wirklich zu deutschen Standards werden kann bleibt abzuwarten und wird sich aus der Akzeptanz bei den Jazz Sessions in den Clubs ergeben. Eine gelungene Edition ist das Buch allemal und es bleibt zu hoffen, dass verschiedene Clubs vielleicht ab und an German Real Book Jam Sessions einführen, bei denen dieses Buch als Vorlage für den Abend dient und die Musiker sich der Musik ihrer Kollegen annehmen.
Das Real Book ist seit Jahrzehnten unverzichtbares Hilfsmittel für Jazzmusiker, wenn sie erfolgreich Gigs oder Jam Sessions bestreiten wollen. Ursprünglich war es eine klug zusammengestellte Sammlung der wichtigsten Standards; bald aber gab es spezielle Real Books, die insbesondere versuchten neben den althergebrachten Musical-Kompositionen auch Kompositionen aktueller Musiker zu präsentieren und so vielleicht auch das allgemein verwendete Repertoire des Jazz ein weing zu aktualisieren und erneuern. Es gab spezielle Real Books, die sich besonderen Stilen zuwandten (Latin Real Book) und solche, die Kompositionen von regionalen Musikern vorstellten. Einige Beispiele für nationale Real Books existieren auch bereits, so etwa ein Swiss Real Book und selbst ein Hamburg Real Book. Nun hat der Nil Verlag mit dem German Real Book nachgezogen. Wo man im originalen Real Book jeden der Titel kennt, weil er sich über Generationen ins Repertoire gebrannt hat, da gehen solche Spezial Real Books den genau umgekehrten Weg: Die in ihnen enthaltenen Kompositionen sind wahrscheinlich den wenigsten bekannt, sollen ja erst durch die Sammlung die Hoffnung darauf, dass das Repertoire bei Sessions oft gespielt wird und sich dadurch Lieblingstitel herausmendeln zu zumindest nationalen Standards werden. Die Komponisten des German Real Books stammen zumeist aus der jüngeren Generation; die Heroen des deutschen Jazz der 1950er, 1960er oder 1970er Jahre also sucht man vergebens. Clemens Orth Jan Klare, Jörg Widmoser, Marco Piludu, Achim Kück, Peter Autschbach, Martin LeJeune, Massoud Goudemann, Dirik Schilgen, Ralph Abelein, Christian Ammann, Andreas Hertel, Michael breotenbach und etliche andere sind mit bis zu drei Titeln vertreten; insbesamt umfast das Buch immerhin 125 Kompositionen deutscher Komponisten und Komponistinnen. Nur elf davon übrigens haben einen deutlich als deutsch erkennbaren Titel; der rest meist englische Überschriften. Es gibt, wie nicht anders zu erwarten, Lead Sheets mit Harmoniesymbolen und einige kleine Arrangements, einfachere Themen, die den üblichen Formschemata gehorchen (Blues, 32-Takte etc.), aber auch komplexere, mehrteilige Stücke, die allerdings eher den kleineren Teil des Buchs ausmachen. Wie gesagt: Was davon wirklich zu deutschen Standards werden kann bleibt abzuwarten und wird sich aus der Akzeptanz bei den Jazz Sessions in den Clubs ergeben. Eine gelungene Edition ist das Buch allemal und es bleibt zu hoffen, dass verschiedene Clubs vielleicht ab und an German Real Book Jam Sessions einführen, bei denen dieses Buch als Vorlage für den Abend dient und die Musiker sich der Musik ihrer Kollegen annehmen.
(Wolfram Knauer)
Heinz Protzer
Attila Zoller. Sein Leben – Seine Zeit – Seine Musik. Mit einer Diskographie von Dr. Michael Frohne
Erftstadt 2009
Selbstverlag des Autors
334 Seiten, 22,50 Euro
ISBN: 978-3-00-026568-6
zu beziehen über den Buchhandel oder direkt beim Autor: zollerbuch@prohei.de.
 Attila Zoller gehört zu wichtigsten europäischen Gitarristen der 1950er und 1960er Jahre und hat auch nach seinem Umzug in die USA konsequent eine ästhetisch suchende Haltung verfolgt, die das Risiko und das Suchen nach neuen Wegen der Sicherheit und den ausgetretenen Pfaden vorzog. Heinz Protzer würdigt Leben und Musik dieses ungaro-austro-deutsch-amerikanischen Musikers in einem umfangreichen Buch, in dem auch Kollegen und Zeitzeugen ausführlich zu Wort kommen. Bis 1948 lebte der 1927 geborene Attila Zoller in Ungarn, wo er traditionelle Musik spielte, aber etwa um 1946/47 auch zum ersten Mal Jazz hörte. 1948 ging er nach Wien, wo er endgültig zum Jazz konvertierte. Er spielte mit Joe Zawinul, Hans Koller und vor allem mit der Vibraphonistin Vera Auer, in deren Quartett er einige Jahre lang mitwirkte. 1954 zog es ihn nach Deutschland, wo es vor allem in den US-Army-Clubs viel Arbeit gab. Zoller wurde in die Frankfurter Jazzszene aufgebommen, mit deren Musikern er auch ästhetisch einiges gemeinsam hatte: das Interesse an musikalischen Experimenten à la Lennie Tristano beispielsweise. Bald spielte er mit Jutta Hipp, dann mit dem New Jazz Ensemble Hans Kollers, lebte ein Nomadenleben im Untergrund der Jazzszene. 1958 gründete er ein Quartett zusammen mit dem damals in Baden-Baden lebenden Bassisten und Cellisten Oscar Pettiford, dem außerdem Koller und der Schlagzeuger Jimmy Pratt angehörten. 1959 erhielt Zoller durch Fürsprache seines Kollegen Jim Hall ein Stipendium für die School of Jazz in Lenox, eine Art Jazz-Sommerakademie und erreichte das Ursprungsland des Jazz im Spätsommer 1959. Dort war er auch seiner Verlobten Jutta Hipp wieder nahe — die Beziehung ging allerdings bald darauf in die Brüche und er spielte sogar mit dem Gedanken, nach Deutschland zurückzukehren. Allerdings lernte er bald darauf eine andere Frau kennen, die er im Februar 1960 heiratete. Er spielte in den New Yorker Clubs, arbeitete als Vertreter für die Gitarrenbaufirma Framus, wirkte in den Bands von Herbie Mann und Dave Pike mit. Zwischendurch reiste er immer wieder mal nach Europa, erhielt 1965 einen Preis für seine Musik zum Film “Das Brot der frühen Jahre” nach Heinrich Böll und spielte die vielgerühmte Platte “Heinrich Heine – Lyrik und Jazz” ein. Ende der 1960er Jahre nahm er ein vielbeachtetes Album mit Albert Mangelsdorff und Martial Solal auf und baute in den 1970er Jahren in Vermont, wo er sich niedergelassen hatte, eine Art Jazzschule auf. In den 1970er bis 1990er Jahren arbeitete er mit vielen unterschiedlichen Musikern, litt aber nach 1994 stark unter einer Krebserkrankung, an der er am 25. Januar 1998 verstarb. Protzer hat die Lebensgeschichte des Gitarristen sorgfältig recherchiert und reichert sie um Interviewausschnitte sowohl mit Zoller als auch ihm verbundenen Musikern an. Ein als “Chronik” überschriebener Teil des Buch stellt die Biographie in Beziehung zu allgemein- und musikgeschichtlichen Ereignissen und Entwicklungen der Zeit. Im Kapitel über seine Musik zitiert er vor allem Kritiken und andere Literaturl, die Zollers musikalische Leistungen würdigt, beschreibt aber nicht wirklich die musikalischen Besonderheiten in seinem Spiel. Es gibt ein Kapitel zur Filmmusik — neben dem “Brot der frühen Tage” schrieb Zoller etwa auch die Musik zu “Katz und Maus” nach Günter Grass –, ein Kapitel über Zoller, den Innovator, und eines über den Pädagogen und Gründer des Vermont Jazz Center. Außerdem finden sich Originalbeiträge von Zeitzeugen und Musikern, Würdigungen von Alexander Schmitz, Gudrun Endress, Jimmy Raney, Sandor Szabo, Klaus Doldinger, Lajos Dudas, Willi Geipel, Helmut Nieberle, Fritz Pauer, Aladar Pege, Werner Wunderlich, Matthias Winckelmann und Ingeborg Drews. Am Ende des Buchs steht eine von Michael Frohne zusammengestellte umfassende Zoller-Diskographie, die Aufnahmen von 1950 bis 1998 verzeichnet. Ein Personenindex und etliche zum Teil seltene und bislang unveröffentlichte Fotos runden das Buch ab, das nicht nur eine große Verbeugung vor Attila Zoller, dem innovativen Gitarristen darstellt, sondern auch ein Beitrag zur europäischen Jazzgeschichte und zur (noch ungeschriebenen) Geschichte europäischer Expatriates in den USA ist.
Attila Zoller gehört zu wichtigsten europäischen Gitarristen der 1950er und 1960er Jahre und hat auch nach seinem Umzug in die USA konsequent eine ästhetisch suchende Haltung verfolgt, die das Risiko und das Suchen nach neuen Wegen der Sicherheit und den ausgetretenen Pfaden vorzog. Heinz Protzer würdigt Leben und Musik dieses ungaro-austro-deutsch-amerikanischen Musikers in einem umfangreichen Buch, in dem auch Kollegen und Zeitzeugen ausführlich zu Wort kommen. Bis 1948 lebte der 1927 geborene Attila Zoller in Ungarn, wo er traditionelle Musik spielte, aber etwa um 1946/47 auch zum ersten Mal Jazz hörte. 1948 ging er nach Wien, wo er endgültig zum Jazz konvertierte. Er spielte mit Joe Zawinul, Hans Koller und vor allem mit der Vibraphonistin Vera Auer, in deren Quartett er einige Jahre lang mitwirkte. 1954 zog es ihn nach Deutschland, wo es vor allem in den US-Army-Clubs viel Arbeit gab. Zoller wurde in die Frankfurter Jazzszene aufgebommen, mit deren Musikern er auch ästhetisch einiges gemeinsam hatte: das Interesse an musikalischen Experimenten à la Lennie Tristano beispielsweise. Bald spielte er mit Jutta Hipp, dann mit dem New Jazz Ensemble Hans Kollers, lebte ein Nomadenleben im Untergrund der Jazzszene. 1958 gründete er ein Quartett zusammen mit dem damals in Baden-Baden lebenden Bassisten und Cellisten Oscar Pettiford, dem außerdem Koller und der Schlagzeuger Jimmy Pratt angehörten. 1959 erhielt Zoller durch Fürsprache seines Kollegen Jim Hall ein Stipendium für die School of Jazz in Lenox, eine Art Jazz-Sommerakademie und erreichte das Ursprungsland des Jazz im Spätsommer 1959. Dort war er auch seiner Verlobten Jutta Hipp wieder nahe — die Beziehung ging allerdings bald darauf in die Brüche und er spielte sogar mit dem Gedanken, nach Deutschland zurückzukehren. Allerdings lernte er bald darauf eine andere Frau kennen, die er im Februar 1960 heiratete. Er spielte in den New Yorker Clubs, arbeitete als Vertreter für die Gitarrenbaufirma Framus, wirkte in den Bands von Herbie Mann und Dave Pike mit. Zwischendurch reiste er immer wieder mal nach Europa, erhielt 1965 einen Preis für seine Musik zum Film “Das Brot der frühen Jahre” nach Heinrich Böll und spielte die vielgerühmte Platte “Heinrich Heine – Lyrik und Jazz” ein. Ende der 1960er Jahre nahm er ein vielbeachtetes Album mit Albert Mangelsdorff und Martial Solal auf und baute in den 1970er Jahren in Vermont, wo er sich niedergelassen hatte, eine Art Jazzschule auf. In den 1970er bis 1990er Jahren arbeitete er mit vielen unterschiedlichen Musikern, litt aber nach 1994 stark unter einer Krebserkrankung, an der er am 25. Januar 1998 verstarb. Protzer hat die Lebensgeschichte des Gitarristen sorgfältig recherchiert und reichert sie um Interviewausschnitte sowohl mit Zoller als auch ihm verbundenen Musikern an. Ein als “Chronik” überschriebener Teil des Buch stellt die Biographie in Beziehung zu allgemein- und musikgeschichtlichen Ereignissen und Entwicklungen der Zeit. Im Kapitel über seine Musik zitiert er vor allem Kritiken und andere Literaturl, die Zollers musikalische Leistungen würdigt, beschreibt aber nicht wirklich die musikalischen Besonderheiten in seinem Spiel. Es gibt ein Kapitel zur Filmmusik — neben dem “Brot der frühen Tage” schrieb Zoller etwa auch die Musik zu “Katz und Maus” nach Günter Grass –, ein Kapitel über Zoller, den Innovator, und eines über den Pädagogen und Gründer des Vermont Jazz Center. Außerdem finden sich Originalbeiträge von Zeitzeugen und Musikern, Würdigungen von Alexander Schmitz, Gudrun Endress, Jimmy Raney, Sandor Szabo, Klaus Doldinger, Lajos Dudas, Willi Geipel, Helmut Nieberle, Fritz Pauer, Aladar Pege, Werner Wunderlich, Matthias Winckelmann und Ingeborg Drews. Am Ende des Buchs steht eine von Michael Frohne zusammengestellte umfassende Zoller-Diskographie, die Aufnahmen von 1950 bis 1998 verzeichnet. Ein Personenindex und etliche zum Teil seltene und bislang unveröffentlichte Fotos runden das Buch ab, das nicht nur eine große Verbeugung vor Attila Zoller, dem innovativen Gitarristen darstellt, sondern auch ein Beitrag zur europäischen Jazzgeschichte und zur (noch ungeschriebenen) Geschichte europäischer Expatriates in den USA ist.
(Wolfram Knauer)
Andrew Wright Hurley
The Return of Jazz. Joachim-Ernst Berendt and West German cultural change
New York 2009
Berghahn Books
296 Seiten, 58 US-Dollar
ISBN: 978-1-84545-566-8
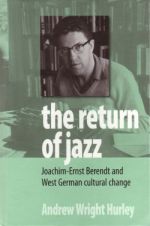 Joachim Ernst Berendt wurde oft als der “Jazzpapst” beschrieben, und tatsächlich war sein Einfluss so allumfassend, dass über all die Jahre keine Veröffentlichung aus Deutschland sich kritisch würdigend mit seiner Rolle in der deutschen Nachkriegs-Jazzgeschichte befasst hat. Vielleicht bedurfte es des Blicks von außen, und vielleicht ist es symptomatisch, dass das erste Buch, die erste Studie über Berendt den Kritiker, Produzenten, Macher und Philosophen von einem Forscher stammt, dessen Arbeitsmittelpunkt so weit von Deutschland entfernt liegt wie nur irgend möglich: vom Australier Andrew Hurley. Hurley hat das Jazzinstitut Darmstadt für das vorliegende Buch öfters und ausgiebig besucht, in Berendts Papieren und Korrespondenz gewühlt und mit vielen Musikern und Kollegen des Jazzpapstes gesprochen. Ihm ist dabei eine Studie gelungen, die sich mit fast allen Aspekten des Berendtschen Schaffens auseinandersetzt: mit Religion, Politik, Rassismus, Antifaschismus, Weltoffenheit, mit musikalischer Neugier, Machtbewusstsein und einem durchaus manchmal übersteigerten Selbstbewusstsein, mit seiner Selbsteinschätzung als Neuerer und Ermöglicher, als Verteidiger einer neuen Kunst gegen den Zopf der alten Meinungen Europas. Hurley beschäftigt sich dabei mit Berendt genauso wie mit seinen Kritikern, klopft die Argumente auf beiden Seiten auf die tatsächlichen Entwicklungen und ihre Folgen ab und zeichnet dabei das Bild eines kreativen Musikimpresarios, dessen Entwicklung folgerichtig von seinen Jugenderfahrungen im kirchlichen Elternhaus und mit den Folgen des Nazi-Reichs über die Entdeckung einer Individualismus predigenden Musik hin zu weltmusikalischer Neugier und schließlich zu einer körper-klang-orientierten Suche nach dem Sinn von Leben und Sein führt, alle Etappen tief in musikalischen Erfahrungen getränkt, aus denen er seine eigenen Erklärungsversuche abzuleiten verstand. Das Buch ist eine historische Dissertation und dennoch spannend zu lesen, vielleicht gerade wegen des Blicks von außen, der manchmal mehr Klarheit erlaubt als es vielleicht uns möglich ist, deren aller erstes Jazzbuch das Berendtsche war. Das Jazzinstitut wird des öfteren erwähnt, weil es Berendt verbunden bleibt und hier der Berendtsche Nachlass seinen Platz fand. Das Vorwort stammt von Dan Morgenstern, dem Direktor des Institute of Jazz Studies, der zugleich Berendts Jazzbuch ins Englische übersetzte. Das Nachwort stammt von Wolfram Knauer, der einen Blick auf die Bedeutung Berendts für den deutschen Jazz bis heute wirft.
Joachim Ernst Berendt wurde oft als der “Jazzpapst” beschrieben, und tatsächlich war sein Einfluss so allumfassend, dass über all die Jahre keine Veröffentlichung aus Deutschland sich kritisch würdigend mit seiner Rolle in der deutschen Nachkriegs-Jazzgeschichte befasst hat. Vielleicht bedurfte es des Blicks von außen, und vielleicht ist es symptomatisch, dass das erste Buch, die erste Studie über Berendt den Kritiker, Produzenten, Macher und Philosophen von einem Forscher stammt, dessen Arbeitsmittelpunkt so weit von Deutschland entfernt liegt wie nur irgend möglich: vom Australier Andrew Hurley. Hurley hat das Jazzinstitut Darmstadt für das vorliegende Buch öfters und ausgiebig besucht, in Berendts Papieren und Korrespondenz gewühlt und mit vielen Musikern und Kollegen des Jazzpapstes gesprochen. Ihm ist dabei eine Studie gelungen, die sich mit fast allen Aspekten des Berendtschen Schaffens auseinandersetzt: mit Religion, Politik, Rassismus, Antifaschismus, Weltoffenheit, mit musikalischer Neugier, Machtbewusstsein und einem durchaus manchmal übersteigerten Selbstbewusstsein, mit seiner Selbsteinschätzung als Neuerer und Ermöglicher, als Verteidiger einer neuen Kunst gegen den Zopf der alten Meinungen Europas. Hurley beschäftigt sich dabei mit Berendt genauso wie mit seinen Kritikern, klopft die Argumente auf beiden Seiten auf die tatsächlichen Entwicklungen und ihre Folgen ab und zeichnet dabei das Bild eines kreativen Musikimpresarios, dessen Entwicklung folgerichtig von seinen Jugenderfahrungen im kirchlichen Elternhaus und mit den Folgen des Nazi-Reichs über die Entdeckung einer Individualismus predigenden Musik hin zu weltmusikalischer Neugier und schließlich zu einer körper-klang-orientierten Suche nach dem Sinn von Leben und Sein führt, alle Etappen tief in musikalischen Erfahrungen getränkt, aus denen er seine eigenen Erklärungsversuche abzuleiten verstand. Das Buch ist eine historische Dissertation und dennoch spannend zu lesen, vielleicht gerade wegen des Blicks von außen, der manchmal mehr Klarheit erlaubt als es vielleicht uns möglich ist, deren aller erstes Jazzbuch das Berendtsche war. Das Jazzinstitut wird des öfteren erwähnt, weil es Berendt verbunden bleibt und hier der Berendtsche Nachlass seinen Platz fand. Das Vorwort stammt von Dan Morgenstern, dem Direktor des Institute of Jazz Studies, der zugleich Berendts Jazzbuch ins Englische übersetzte. Das Nachwort stammt von Wolfram Knauer, der einen Blick auf die Bedeutung Berendts für den deutschen Jazz bis heute wirft.
(Wolfram Knauer)
Roy Nathanson
subway moon
Köln 2009
buddy’s knife jazzedition
135 Seiten, 16,00 Euro
ISBN: 978-3-00-025376-8
 Der kleine Kölner Verlag buddy’s knife hat sich darauf spezialisiert, poetische Texte insbesondere amerikanischer Musiker herauszubringen, die eine andere Seite ihrer Kreativität zeigen. Nach Bänden mit Gedichten von Henry Grimes sowie Gedichten und Texten von William Parker ist jetzt ein Band erschienen, in dem der Saxophonist Roy Nathanson zu Worte kommt. Seine Musik, schreibt Jeff Friedman im Vorwort, sei ohne seine Lyrik nicht vorstellbar und seine Lyrik lebe von den Rhythmen seiner Musik. Man denkt ein wenig an Lester Youngs Diktum, er kenne alle Texte zu den Songs, die er interpretiere und könne sich gar nicht vorstellen, wie man ohne die Kenntnis der Texte kongeniale Geschichten darüber improvisieren könne. Wenn Musik nun das Leben widerspiegelt, dann sind die Texte der Improvisationen Nathansons vielleicht die Worte, die er hier anordnet, um sie lyrisch seine eigene Befindlichkeit beschreiben zu lassen. Nathanson, der aus der Knitting-Factory-Szene New Yorks stammt und mit den Jazz Passengers, mit Projekten mit Anthony Coleman und eigenen Bands arbeitete, schreibt Gedichte über sein Instrument, darüber, wie er Drittklässler unterrichtet oder über die Soundanlagen in Clubs. Er fragt in einem seiner Gedichte, ob es wohl eine Formel gibt, wie man eine Geschichte entwickeln kann, wenn sie sich bereits in voller Geschwindigkeit befindet. Oder er fragt sich, auf welche Tonhöhe wohl die U-Bahn gestimmt sein möge. Andere Gedichte spiegeln sein privates Leben wider oder die politischen Entwicklungen in Nah und Fern. Der Tod seines Bruders, die Bombadierung des Libanons, Freundschaft, geliebte Städte, Menschen, Kollegen. Ein Gedicht ist der Zirkularatmung gewidmet, und am Schluss steht ein längerer Text über seinen Vater, wenige Wochen nach dessen Tod geschrieben. Der war an Alzheimer erkrankt, und Nathanson beschreibt, wie er ihm, der früher selbst als Musiker gearbeitet hatte, bei einem Besuch ein Saxophon mitgebracht habe. Er habe geswingt und die Melodie auf eine Art und Weise gespielt, wie Nathanson es selten gehört habe. Diese Konzentration auf die Melodie, die Reduktion aufs Lyrische, das Zusammenspiel zwischen Lyrik, Rhythmik und Melodie — all das spürt man auch in diesem Buch, das überaus persönlich ist und dabei in jeder Zeile auch der Musik verbunden bleibt.
Der kleine Kölner Verlag buddy’s knife hat sich darauf spezialisiert, poetische Texte insbesondere amerikanischer Musiker herauszubringen, die eine andere Seite ihrer Kreativität zeigen. Nach Bänden mit Gedichten von Henry Grimes sowie Gedichten und Texten von William Parker ist jetzt ein Band erschienen, in dem der Saxophonist Roy Nathanson zu Worte kommt. Seine Musik, schreibt Jeff Friedman im Vorwort, sei ohne seine Lyrik nicht vorstellbar und seine Lyrik lebe von den Rhythmen seiner Musik. Man denkt ein wenig an Lester Youngs Diktum, er kenne alle Texte zu den Songs, die er interpretiere und könne sich gar nicht vorstellen, wie man ohne die Kenntnis der Texte kongeniale Geschichten darüber improvisieren könne. Wenn Musik nun das Leben widerspiegelt, dann sind die Texte der Improvisationen Nathansons vielleicht die Worte, die er hier anordnet, um sie lyrisch seine eigene Befindlichkeit beschreiben zu lassen. Nathanson, der aus der Knitting-Factory-Szene New Yorks stammt und mit den Jazz Passengers, mit Projekten mit Anthony Coleman und eigenen Bands arbeitete, schreibt Gedichte über sein Instrument, darüber, wie er Drittklässler unterrichtet oder über die Soundanlagen in Clubs. Er fragt in einem seiner Gedichte, ob es wohl eine Formel gibt, wie man eine Geschichte entwickeln kann, wenn sie sich bereits in voller Geschwindigkeit befindet. Oder er fragt sich, auf welche Tonhöhe wohl die U-Bahn gestimmt sein möge. Andere Gedichte spiegeln sein privates Leben wider oder die politischen Entwicklungen in Nah und Fern. Der Tod seines Bruders, die Bombadierung des Libanons, Freundschaft, geliebte Städte, Menschen, Kollegen. Ein Gedicht ist der Zirkularatmung gewidmet, und am Schluss steht ein längerer Text über seinen Vater, wenige Wochen nach dessen Tod geschrieben. Der war an Alzheimer erkrankt, und Nathanson beschreibt, wie er ihm, der früher selbst als Musiker gearbeitet hatte, bei einem Besuch ein Saxophon mitgebracht habe. Er habe geswingt und die Melodie auf eine Art und Weise gespielt, wie Nathanson es selten gehört habe. Diese Konzentration auf die Melodie, die Reduktion aufs Lyrische, das Zusammenspiel zwischen Lyrik, Rhythmik und Melodie — all das spürt man auch in diesem Buch, das überaus persönlich ist und dabei in jeder Zeile auch der Musik verbunden bleibt.
(Wolfram Knauer)
Kai Lothwesen
Klang, Struktur, Konzept. Die Bedeutung der Neuen Musuik für Free Jazz und Improvisationsmusik
Bielefeld 2009
transcript Verlag (Studien zur Popularmusik)
261 Seiten, 27,80 Euro
ISBN: 978389942-930-5
 Kai Lothwesens musikwissenschaftliche Dissertation befasst sich mit den Einflüssen der europäischen Kunstmusik auf den Free Jazz und die improvisierte Musik. Er untersucht damit eine musikalische Ausprägung, die immer ein wenig in ihrem Bezug auf die afro-amerikanische Tradition und die europäische zeitgenössische Musik schwankte und schon in ihrer Benennung (Free Jazz, improvisierte Musik) leichte identitätsprobleme andeutete. Er beschreibt die Merkmale der europäischen Improvisationsmusik, untersucht das Verhältnis von Komposition und Improvisation, analysiert die Traditionen der Neuen Musik und des Jazz und wagt eine Positionsbestimmung des Free Jazz und der Improvisierten Musik. Einem theoretisch analysierenden Kapitel folgen dann konkrete praktische Fallbeispiele, namentlich die Pianisten Georg Graewe und Alexander von Schlippenbach sowie der Bassist Barry Guy. Zum Schluss vergleicht er die Parameter “Klang”, “Struktur” und “Konzept” auf Parallelen zwischen Neuer Musik und Free Jazz / Improvisierter Musik. Das Buch bietet eine theoretische Grundlage zur weiteren Auseinandersetzung mit den gegenseitigen Einflüssen zwischen Jazz und Neuer Musik.
Kai Lothwesens musikwissenschaftliche Dissertation befasst sich mit den Einflüssen der europäischen Kunstmusik auf den Free Jazz und die improvisierte Musik. Er untersucht damit eine musikalische Ausprägung, die immer ein wenig in ihrem Bezug auf die afro-amerikanische Tradition und die europäische zeitgenössische Musik schwankte und schon in ihrer Benennung (Free Jazz, improvisierte Musik) leichte identitätsprobleme andeutete. Er beschreibt die Merkmale der europäischen Improvisationsmusik, untersucht das Verhältnis von Komposition und Improvisation, analysiert die Traditionen der Neuen Musik und des Jazz und wagt eine Positionsbestimmung des Free Jazz und der Improvisierten Musik. Einem theoretisch analysierenden Kapitel folgen dann konkrete praktische Fallbeispiele, namentlich die Pianisten Georg Graewe und Alexander von Schlippenbach sowie der Bassist Barry Guy. Zum Schluss vergleicht er die Parameter “Klang”, “Struktur” und “Konzept” auf Parallelen zwischen Neuer Musik und Free Jazz / Improvisierter Musik. Das Buch bietet eine theoretische Grundlage zur weiteren Auseinandersetzung mit den gegenseitigen Einflüssen zwischen Jazz und Neuer Musik.
(Wolfram Knauer)
Erik Kjellberg
Jan Johansson – tiden och musiken
Hedemora – Möklinta/Sweden 2009
Gidlunds förlag
442 pages, accompanying CD
ISBN: 978-91-7844-753-4
 Jan Johansson gehört zu den einflussreichsten schwedischen Musikern des modernen Jazz. In Kopenhagen begleitete er Ende der 1950er Jahre Stan Getz und andere amerikanische Musiker, beschäftigte sich daneben aber auch damit, einen schwedischen Klang in seiner Musik zu verfolgen. Sein Album “Jazz på Svenska” nutzte alte schwedische Volksweisen für die Arrangements und Improvisationen, die in der Stimmung und Klangästhetik bereits viel von dem vorwegnahmen, was später Musiker wie Esbjörn Svensson als neuen schwedischen Sound populär machen sollten. Erik Kjellbergs Biographie verfolgt Johanssons Leben von seinen Anfängen bis zu seinem frühen Tod durch einen Autounfall. Er beschreibt die musikalische Emanzipation und Selbstbewusstwerdung des schwedischen Musikers, aber auch seine Ausflüge in die Filmmusik (etwa als Komponist von Astrid-Lindgren-Verfilmungen), seine Arbeit fürs schwedische Radio und seine Kompositionen für Besetzungen zwischen Trio, Combo und Sinfonieorchester. Der Fließtext, der das Leben des Pianisten und Komponisten chronologisch und die Musik nach Gattungen getrennt beleuchtet verbindet biographische Forschung, Interviews mit Zeitgenossen und Musikerkollegen sowie musikalische Analysen ausgewählter Stücke, die mit leräuternden Notenbeispielen verbunden sind. Bislang unveröffentlichte Fotos, eine ausführliche Diskographie sowie ein Namens- und Titelindex und schließlich eine CD mit Aufnahmen zwischen 1963 und 1968 runden das Buch ab, für das der Leser des Schwedischen schon einigermaßen mächtig sein sollte. Eine eindrucksvolle und beispielhafte Monographie eines bis heute nachwirkenden Musikers.
Jan Johansson gehört zu den einflussreichsten schwedischen Musikern des modernen Jazz. In Kopenhagen begleitete er Ende der 1950er Jahre Stan Getz und andere amerikanische Musiker, beschäftigte sich daneben aber auch damit, einen schwedischen Klang in seiner Musik zu verfolgen. Sein Album “Jazz på Svenska” nutzte alte schwedische Volksweisen für die Arrangements und Improvisationen, die in der Stimmung und Klangästhetik bereits viel von dem vorwegnahmen, was später Musiker wie Esbjörn Svensson als neuen schwedischen Sound populär machen sollten. Erik Kjellbergs Biographie verfolgt Johanssons Leben von seinen Anfängen bis zu seinem frühen Tod durch einen Autounfall. Er beschreibt die musikalische Emanzipation und Selbstbewusstwerdung des schwedischen Musikers, aber auch seine Ausflüge in die Filmmusik (etwa als Komponist von Astrid-Lindgren-Verfilmungen), seine Arbeit fürs schwedische Radio und seine Kompositionen für Besetzungen zwischen Trio, Combo und Sinfonieorchester. Der Fließtext, der das Leben des Pianisten und Komponisten chronologisch und die Musik nach Gattungen getrennt beleuchtet verbindet biographische Forschung, Interviews mit Zeitgenossen und Musikerkollegen sowie musikalische Analysen ausgewählter Stücke, die mit leräuternden Notenbeispielen verbunden sind. Bislang unveröffentlichte Fotos, eine ausführliche Diskographie sowie ein Namens- und Titelindex und schließlich eine CD mit Aufnahmen zwischen 1963 und 1968 runden das Buch ab, für das der Leser des Schwedischen schon einigermaßen mächtig sein sollte. Eine eindrucksvolle und beispielhafte Monographie eines bis heute nachwirkenden Musikers.
(Wolfram Knauer)