[:de]Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
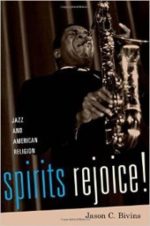 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
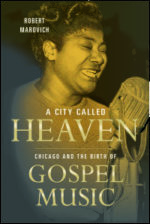 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
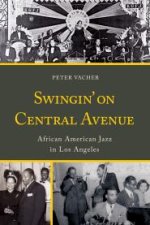 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
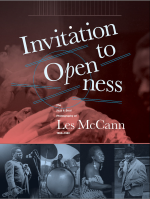 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
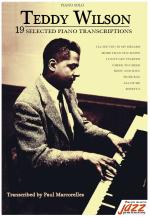 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
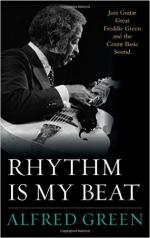 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
 Keith Jarrett. A Biography
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
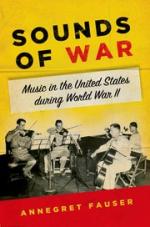 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
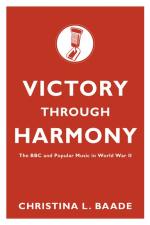 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
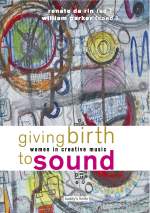 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
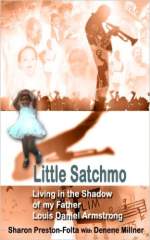 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015[:en][:de][:de]Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
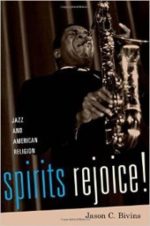 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
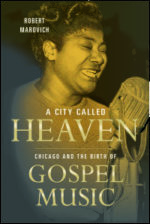 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
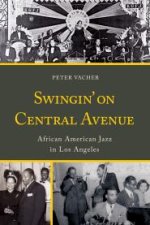 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
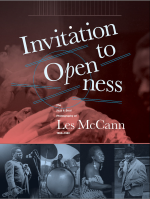 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
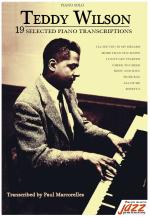 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
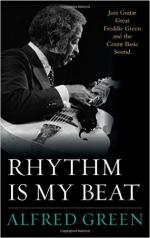 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
 Nachtrag Februar 2021:
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
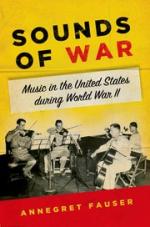 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
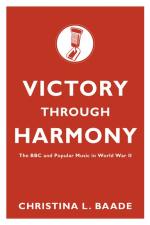 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
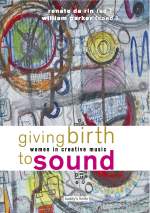 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
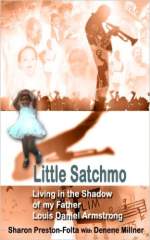 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015[:en]Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
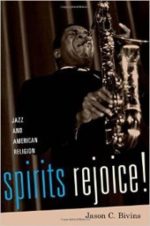 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
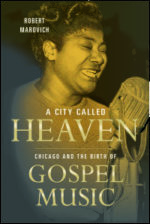 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
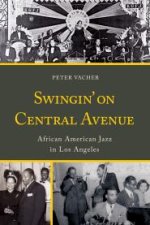 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
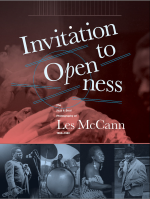 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
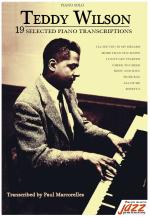 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
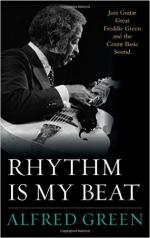 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
 Nachtrag Februar 2021:
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
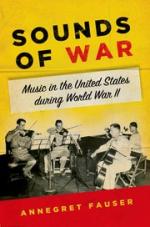 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
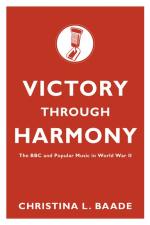 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
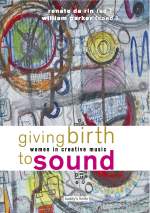 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
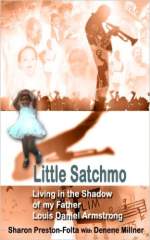 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
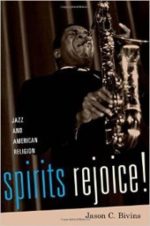 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
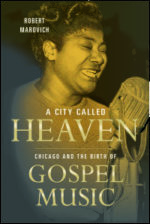 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
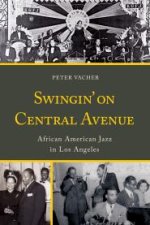 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
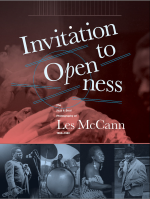 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
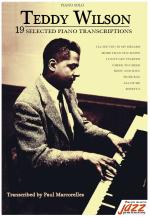 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
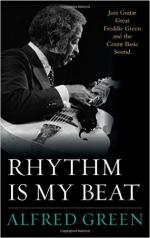 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
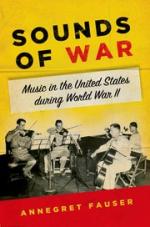 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
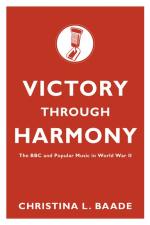 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
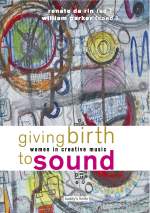 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
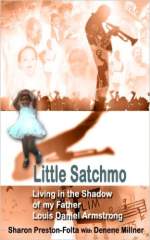 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
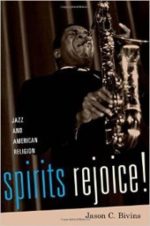 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
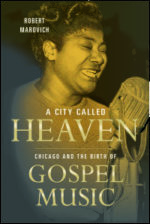 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
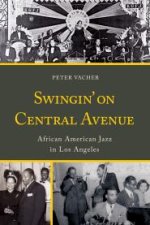 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
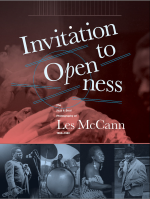 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
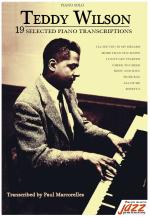 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
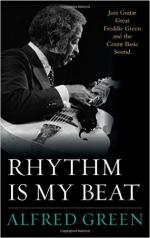 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
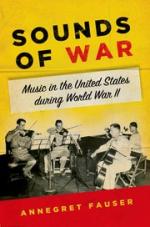 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
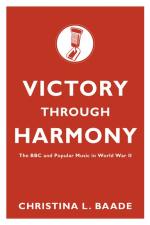 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
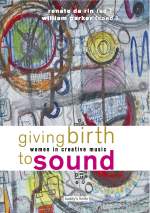 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
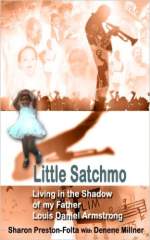 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
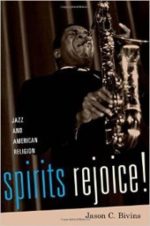 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
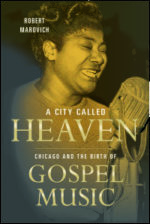 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
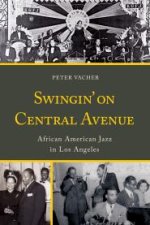 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
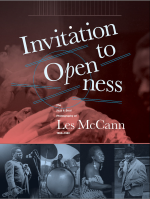 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
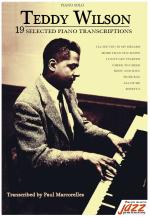 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
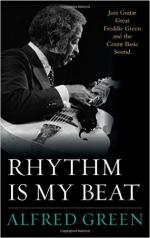 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
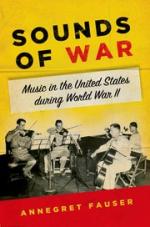 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
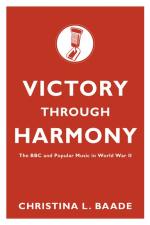 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
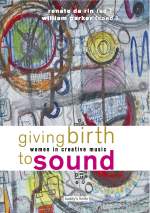 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
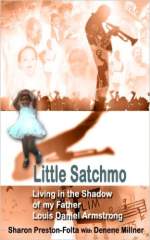 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
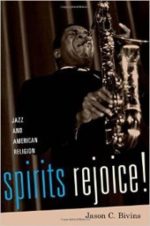 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
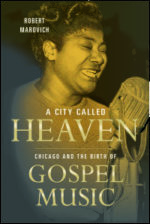 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
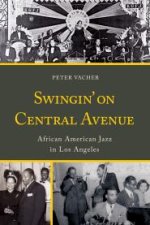 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
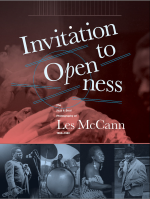 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
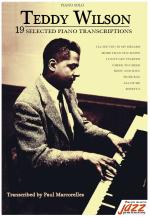 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
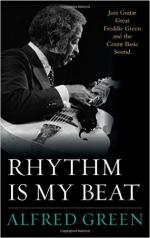 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
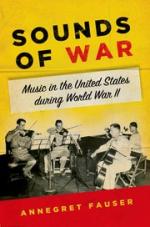 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
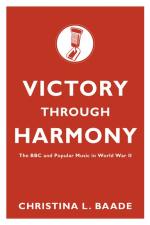 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
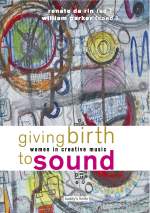 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
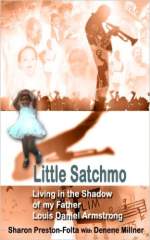 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
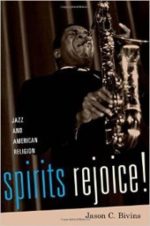 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
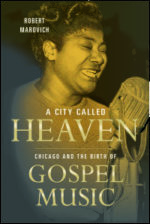 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
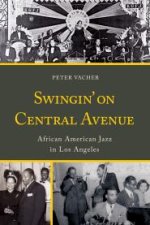 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
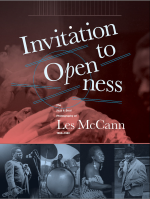 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
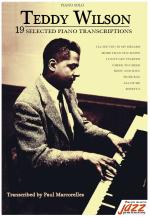 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
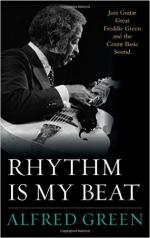 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
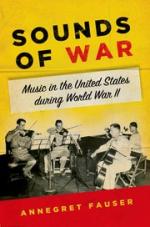 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
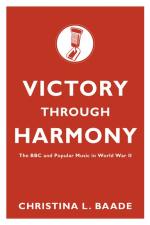 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
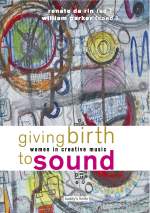 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
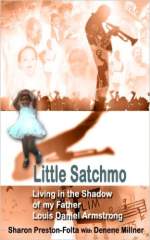 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
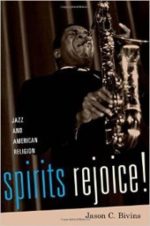 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
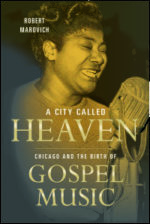 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
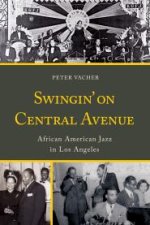 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
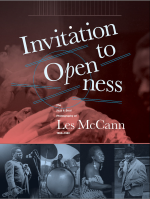 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
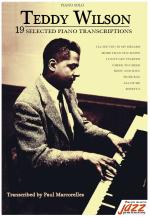 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
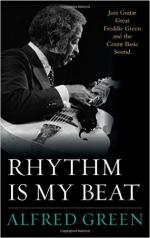 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
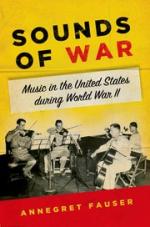 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
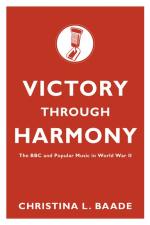 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
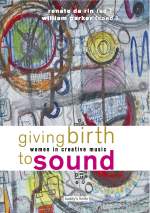 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
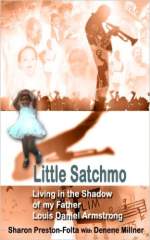 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
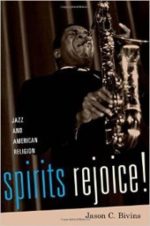 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
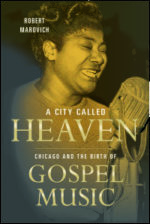 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
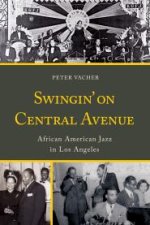 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
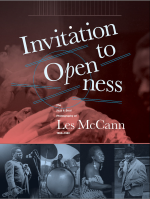 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
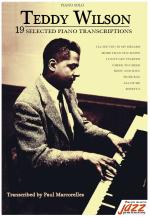 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
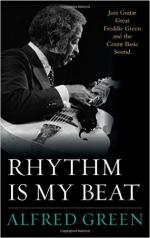 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
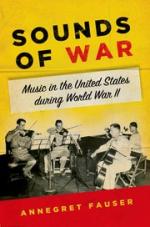 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
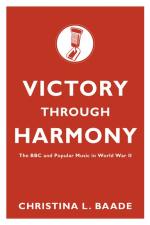 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
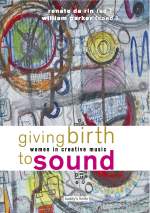 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
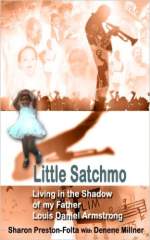 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015[:][:en]Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
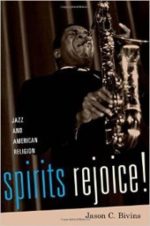 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
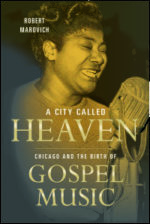 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
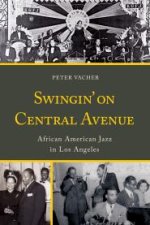 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
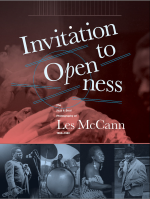 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
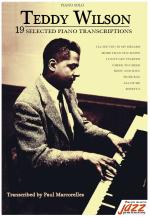 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
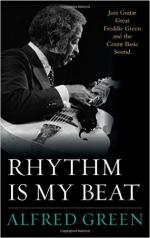 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
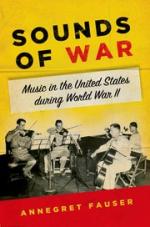 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
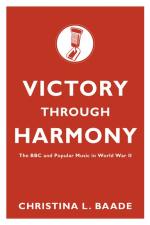 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
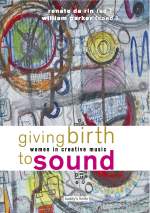 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
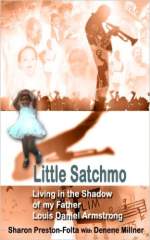 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
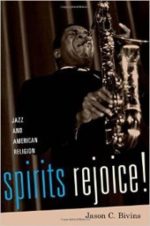 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
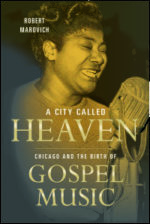 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
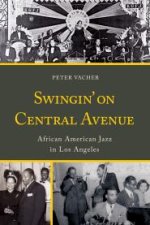 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
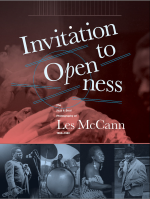 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
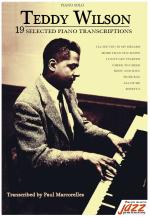 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
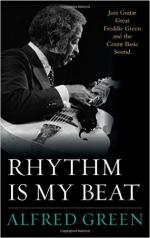 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
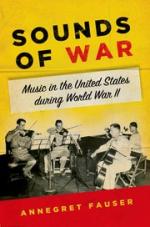 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
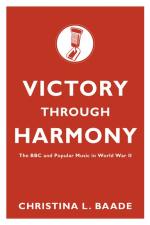 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
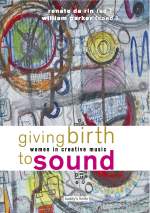 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
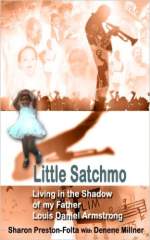 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
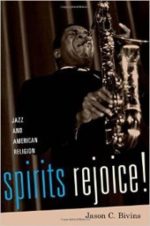 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
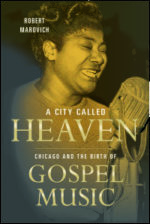 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
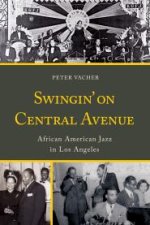 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
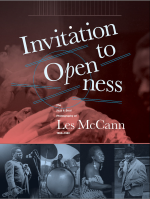 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
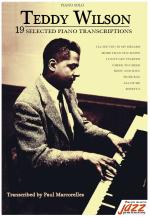 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
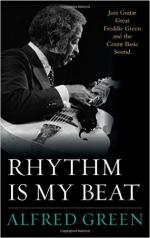 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
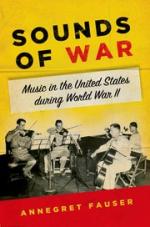 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
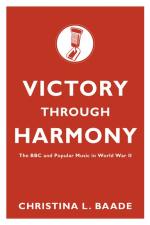 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
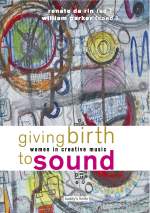 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
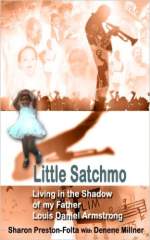 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
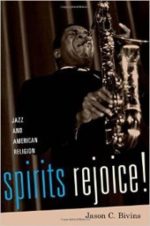 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
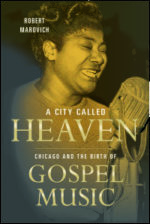 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
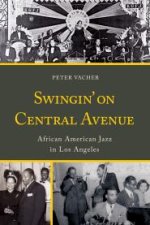 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
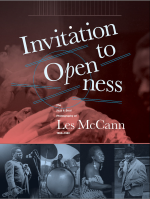 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
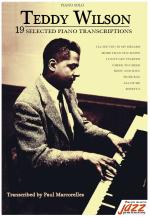 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
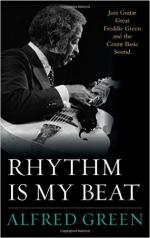 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
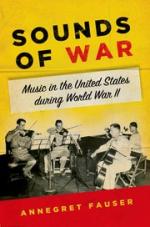 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
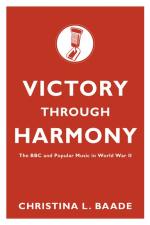 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
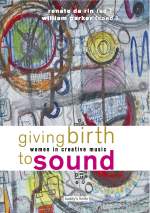 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
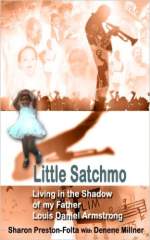 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
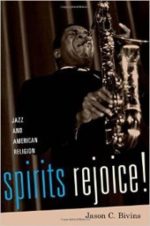 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
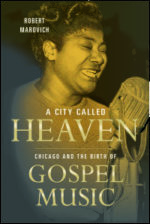 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
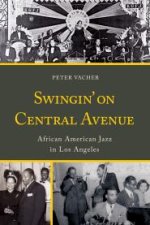 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
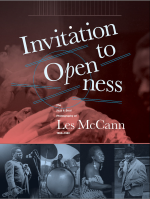 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
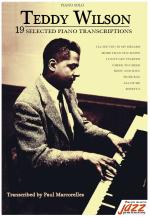 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
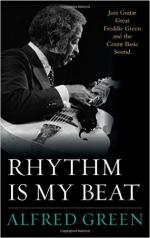 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
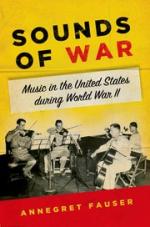 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
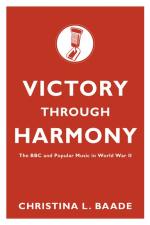 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
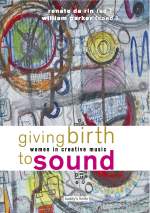 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
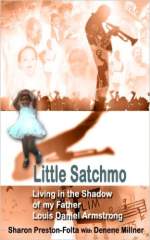 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
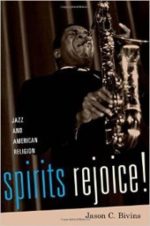 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
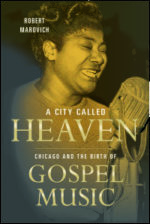 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
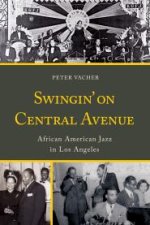 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
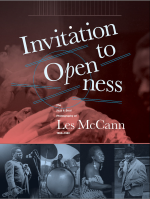 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
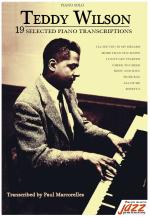 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
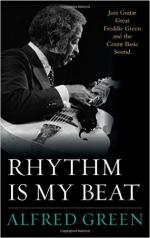 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
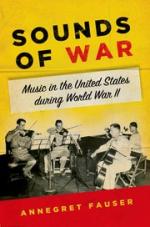 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
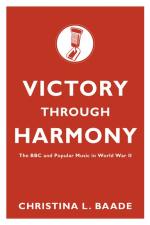 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
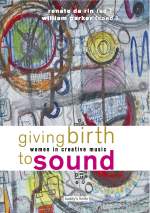 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
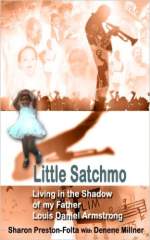 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
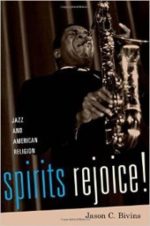 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
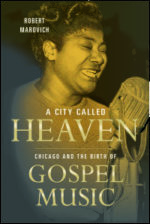 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
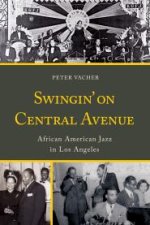 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
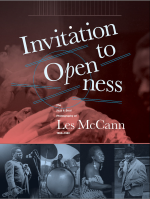 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
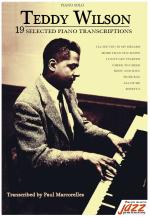 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
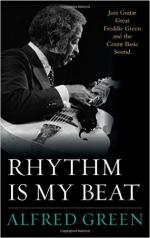 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
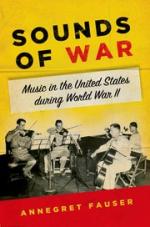 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
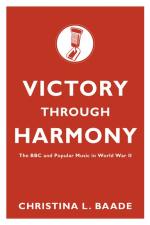 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
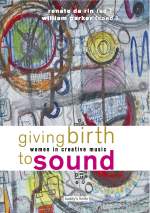 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
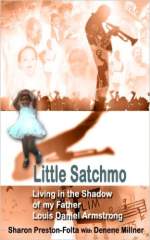 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015Rencontres du jazz et de la musique contemporaine
herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin
Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)
184 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-2-8107-0374-6
 Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.
Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.
Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.
“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.
Wolfram Knauer (März 2018)
Bunk Monk & Funk – and other attractions
von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)
Kopenhagen 2012 (People’s Press)
248 Seiten, 249 Dänische Kronen
ISBN: 978-8771-37035-5
 Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Wolfram Knauer (Januar 2018)
Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation
von Alphonso D. McClendon
London 2015 (Bloomsbury Academic)
194 Seiten, 24,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-85785-127-7
 Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.
Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.
Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.
McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2017)
Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré
von Guillaume Belhomme
Nantes 2015 (Lenka Lente)
44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro
ISBN: 978-2-9545845-9-1
 Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Wolfram Knauer (März 2017)
Spirits Rejoice! Jazz and American Religion
von Jason C. Bivins
New York 2015 (Oxford University Press)
369 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-023091-3
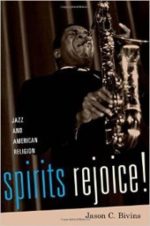 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.
Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.
Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.
Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.
Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.
In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.
Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.
Wolfram Knauer (März 2017)
Omniverse Sun Ra
von Hartmut Geerken & Chris Trent
Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)
304 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-0-9933514-0-2
 Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.
Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.
Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.
“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.
“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.
Wolfram Knauer (März 2017)
A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music
von Robert M. Marovich
Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)
488Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-252-08069-2
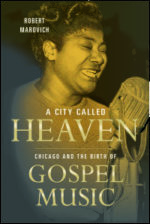 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.
Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.
Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.
Wolfram Knauer (Januar 2017)
La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale
von Alexandre Pierrepont
Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)
443 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-2-86364-669-4
 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.
Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.
Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”
Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College
Von Monk Rowe (& Romy Britell)
Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)
209 Seiten, 20 US-Dollar
ISBN: 978-1-937370-17-6
 Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr
In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.
“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.
Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.
“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.
Wolfram Knauer (Dezember 2016)
Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles
von Peter Vacher
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
331 Seiten, 55 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8832-6
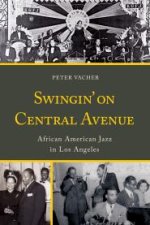 Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.
Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.
Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.
Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.
Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.
Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.
Wolfram Knauer (Juli 2016)
Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980
herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams
Seattle 2015 (Fantagraphics Books)
200 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-786-4
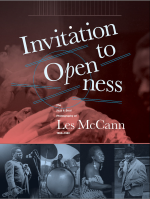 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.
Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.
Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.
Wolfram Knauer (Juni 2016)
Bitches Brew
von George Grella Jr.
New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)
128 Seiten, 14,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-6289-2943-0
D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.
Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.
In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.
In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.
Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.
Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.
Wolfram Knauer (Mai 2016)
Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene
herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher
Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)
180 Seiten, 29 Euro
ISBN: 978-3-85616-695-5
 Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.
Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.
Wolfram Knauer (März 2016)
Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher
von Detlef Siegfried
Göttingen 2015 (Wallstein)
455 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-8353-1673-7
 Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.
Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.
In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.
Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.
Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.
Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.
Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.
Wolfram Knauer (März 2016)
Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)
44,95 Euro
Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions
Transkriptionen von Paul Marcorelles
Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)
46,85 Euro
Zu beziehen über www.blueblackjazz.com
Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.
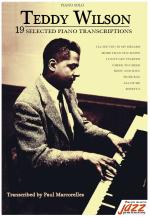 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
 Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Marcorelles’ neue Bände seien jedenfalls jedem interessierten Pianisten empfohlen als Übe- genauso wie Studienmaterial. Marcorelles bietet auf seiner Website übrigens alle insgesamt 202 Transkriptionen dieser wie früher erschienener Bände auch einzeln zum Download als PDF-Datei an
Wolfram Knauer (März 2016)
Hot Music, Ragmentation, and the Bluing of American Literature
von Steven C. Tracy
Tuscaloosa 2015 (The University of Alabama Press)
537 Seiten, 64,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1865-9
 Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Steven C. Tracy ist Literaturwissenschaftler, Professor für Afro-American Studies, aber auch ein Blues-Harp-Spieler, der bereits in Vorgruppen für B.B. King, Muddy Waters und andere Stars der Szene auftrat. In seinem umfangreichen Buch stellt er die afro-amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, also Jazz und Blues, als Referenzpunkt dar, der helfen könne, die amerikanische Literaturgeschichte jener Zeit besser zu verstehen. Es geht ihm dabei nicht einzig um Romane oder Dichtung, die sich konkret und thematisch mit Musik beschäftigen, sondern auch um den Einfluss von Klanglichkeit, von Virtuosität, von improvisatorischer Haltung auf die amerikanische Literatur der Jahre bis 1930. Er greift hierfür immer wieder zurück auf konkrete Aufnahmen, um etwa Beispiele der afro-amerikanischer Stimme, des afro-amerikanischen Rhythmus, der Griot-Funktion des Bluessängers, der Bedeutung von Wiederholungen, der tiefen Doppeldeutigkeit, der politischen Untertöne herauszustreichen, die eben keine rein afro-amerikanischen Untertöne seien, sondern Befunde für den Zustand der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Tracy verbindet die Genres, folkloristischen Blues, modernistischen Jazz, um aus dem Mix der Aufnahmen heraus, auf die er sich bezieht, neue Argumente zu entwickeln, die abseits der üblichen Beschreibung von Jazz-, Blues- oder Kulturgeschichte liegen. Er untersucht daneben auch Film- oder klassische Musikgeschichte nach Einflüssen von oder Analogien zu afro-amerikanischer Musik und findet den nachhaltigsten Widerhall außerhalb der Musik schließlich in der Literatur, bei T.S. Eliot, William Carlos Williams, Hart Crane, Gertrude Stein, Ezra Pount, und bei Abbe Niles, Langston Hughes, Countee Cullen, Zora Neale Hurston und anderen Dichtern und Schriftstellern der Harlem Renaissance.
Tracys schnelle Wechsel zwischen den Diskursen sind dabei sowohl inspirierend wie auch, da sie ein häufiges Vor- und Zurückblättern erfordern, zeitweise ermüdend. Sein intertextueller Ansatz ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie sich aus dem Studium afro-amerikanischer Musik Aussagen über weit mehr als diese treffen lassen, wie stark tatsächlich diese Musik bereits in den ersten 30 Jahren des 20sten Jahrhunderts ihren Niederschlag im Denken, Handeln und Schreiben gefunden hat.
Wolfram Knauer (März 2016)
Friedel Keim
Das große Buch der Trompete (3)
Diskografie, Fotografien, Statistik, Nachträge
Fortsetzung des Trompeter-Lexikons, Band 3
Mainz 2015 [Eigenverlag
554 Seiten, 33,90 Euro
nur direkt zu beziehen über
Friedel Keim, e-mail: ruf.keim@t-online.de
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Keim kennt dabei keine Berührungsängste. Er versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser wieder Erwähnung oder Musiker der aktuellen Szene.
Der lexikalische Teil von Band 3 enthält biographische Artikel von A wie “Abbott, Goivinda” bis Z wie “Zonshine, Michael”. Neben diesen teils ausführlichen Portraits gibt es Anmerkungen zur Interpretation von Werken aus Klassik, Marschmusik und anderen Genres, darunter auch analytische Anmerkungen und Notenbeispiele aus dem Jazzbereich, etwa eine Transkription des “West End Blues” in der Version von Louis Armstrong und seiner Hot Five von 1928, Dizzy Gillespies “Night in Tunisia”, oder Maynard Fergusons Version von “Body and Soul”. Korrekturen und Ergänzungen zu den beiden ersten Bänden erhalten ein eigenes Kapitel, und wieder gibt es den Block “Wissenswertes rund um die Trompete”, der etwa Informationen über das “Gansch-Horn” gibt oder über das flexibrass-Mundstück, über die Vuvuzela oder über die Trompete auf historischen Briefmarken, über den Trompetenbaum oder diverse Filme, in denen die Trompete im Mittelpunkt steht. Schließlich findet sich noch ein umfassendes Kapitel zu Horst Fischer, jenem legendären deutschen Trompeter, dessen Prolog zu einer Autobiographie Keim abdruckt, außerdem eine alphabetische Auflistung aller ihm bekannter Fischer-Aufnahmen.
Wie bereits in den vorherigen Bänden findet sich auch in Band 3 vieles, was sonst kaum irgendwo erierbar wäre. Friedel Keim weiß um Geburts- und Sterbedaten, berichtet über die Stars, aber eben genauso über die “kleinen” Vertretern des Instruments, über Satzspieler oder junge Musiker, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, über Dixieland- und Swingtrompeter, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind, über Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man einmal mehr die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
(Wolfram Knauer, Februar 2016)
Mein Onkel Pö
von Holger Jass
Hamburg 2015 (Offline-Verlag)
137 Seiten, 25,55 Euro
ISBN: 978-3-00-051272-8
 Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
“Jetzt macht Jass den Jazz im Onkel Pö” titelte das Hamburger Abendblatt, als Jass 1979 übernahm. Sein Buch handelt natürlich auch von Jazz. Er beschreibt, wie Michael Naura, damals Jazzredakteur des NDR viele der Jazzabende mitschnitt, die sich das Pö ansonsten kaum hätte leisten können. Den Flügel im Club hatte kein geringerer als Joachim Kühn ausgesucht und eingeweiht. Ansonsten bevölkern Jazzer wie Freddie Hubbard, Elvin Jones, Pat Metheny, Dexter Gordon die Seiten, aber auch Tom Waits, Charlie Watts, Joe Cocker, Hannes Wader, Truck Stop und natürlich Udo Lindenberg, der dem “Pö” in einem seiner Hits ein Denkmal setzte.
“Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband”, hieß es da, “seit 20 Jahren Dixieland” – aber mit Dixieland ließ sich so ein Schuppen nicht finanzieren, bilanziert Jass trocken … obwohl man das Wort “trocken” selbst bei einer Rezension dieses Buchs nicht in den Mund nehmen sollte, denn trocken ging es ganz sicher nicht zu im Pö. Auch davon handelt das Buch, von den skurrilen Erlebnissen mit den Musikern, vom gesteigerten Alkoholkonsum, vom Pflegen einer Szene und davon, dass man, um Wirt zu sein, ein dickes Fell und viel Humor benötigt. Pineau ist das Zauberwort, jene süßliche Mischung aus Traubenmost und Cognac, die Jass als Allheilmittel vieler Probleme genauso beschreibt wie als Ursache anderer. Seine Anekdoten machen klar, dass man als Wirt und täglicher Konzertveranstalter selbst nicht ganz ohne solche “Medizin” auskommt: ein divenhafter Auftritt Freddie Hubbards etwa oder jener Abend mit Dexter Gordon, den Jass allerdings erst aus drogenbedingtem Tiefschlaf im Hotel um die Ecke wecken musste, den er für seine 57 Jahre als “bös klöterich” beschreibt, der dann aber nach einem dreifachen Whiskey ein denkwürdiges Konzert gegeben habe.
Sehr viel tiefer geht es sicher nicht in seinen Erinnerungen, die er mit viel Augenzwinkern und der humorvollen Abgeklärtheit der zeitlichen Distanz schreibt, und bei denen man schon mal über die eine oder andere schlüpfrige Anekdote hinweglesen muss. Bei all denen, die dabei waren in diesem zwischen Alternativszene und Hochkultur angesiedelten Zauberort in Eppendorf, wird er warme Erinnerungen wecken. Man meint den Fusel wieder zu schmecken und die dicke Luft wieder zu riechen, vor allem aber erinnert man sich an die musikalischen Hochgenüsse, die das Onkel Pö so oft und so viel vermittelte. Für diejenigen, die nicht dabei waren, gibt Jass ein launiges Portrait, einschließlich etlicher Fotos, ein Portrait, das stellenweise einer Filmdokumentation über verwunschene Zeiten ähnelt, bei denen man eigentlich gern dabei gewesen wäre.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Rhythm Is My Beat. Jazz Guitar Great Freddie Green and the Count Basie Sound
von Alfred Green
Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)
325 Seiten, 75 US-Dollar
ISBN: 978-1-4422-4246-3
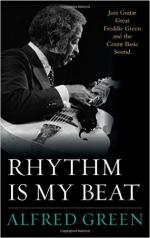 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Jetzt hat Alfred Green, der Sohn des Gitarristen, eine Biographie vorgelegt, die weit mehr ist als die persönliche Erinnerung eines Verwandten. Greens Buch schafft den Spagat zwischen Insiderwissen, persönlicher Betroffenheit und nüchterner Beschreibung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit eines Musikers der Bigbandära.
Die Geschichte beginnt in Charleston, South Carolina, wo Freddie Green 1911 geboren wurde, in einer Stadt mit einer überaus lebendigen schwarzen Musikszene. Nachdem er die erste Ukulele gegen ein viersaitiges Banjo ausgetauscht hatte, sammelte er erste musikalische Erfahrungen mit Freunden aus dem Jenkins Orphanage, einem berühmten Waisenhaus in Charleston, aus dem etliche spätere Musiker hervorgingen. Mit einer dieser Bands reiste er die Küste hoch bis nach Maine, wechselte irgendwann vom Banjo zur Gitarre und spielte mit dem Saxophonisten Lonnie Simmons und dem Stride-Pianisten Willie Gant. Als der Impresario John Hammond ihn hörte, empfahl er seinem Schützling Count Basie, sich den Gitarristen für sein Orchester zu sichern. Im Januar 1937 kam es zum Vorspiel erst in kleinem Kreis, dann mit der Bigband, und am 1. Februar begann sein mehr als 45-jähriges Engagement als Motor des Count Basie Orchestra.
Alfred Green erzählt nicht nur die Lebens- und Arbeitsstationen Greens, sondern nähert sich auch seinem Stil, fragt nach Einflüssen, erklärt die Besonderheit des Green’schen Sounds. Der Autor wurde im Februar 1938 geboren, im selben Jahr beendete seine Mutter ihre Beziehung zu seinem Vater, sicher auch, weil der inzwischen eine Romanze mit Billie Holiday begonnen hatte, die für kurze Zeit mit Basie reiste.
Green beschreibt die verschiedenen Besetzungen der Basie-Band der 1930er und 1940er, die Schwierigkeiten des Musikerlebens, und die zunehmenden Probleme der Musikindustrie, die schließlich dazu führten, dass Basie sein Orchester auflöste und kurze Zeit mit einem Sextett – ohne Gitarre – auftrat. Sein Vater nahm die Entscheidung nicht hin und tauchte einfach beim nächsten Gig des Sextetts mit seiner Gitarre auf. “Was machst du denn hier?”, fragte Basie, und Green antwortete, “Was glaubst du wohl? Du hast hier einen Gig, richtig? Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und du glaubst, mich einfach beiseiteschieben zu können? Keine Chance!”
Während die 1930er- und 1940er-Jahre-Band insbesondere ein Solistenorchester war, wurde der Sound der 1950er Jahre-Band durch ihre Arrangeure geprägt. Alfred Green berichtet, wie Green seinen Platz in den Arrangements fand, wie er sich zu den Schlagzeugern positionierte, und wie er seine Aufgabe immer als die eines Unterstützers der anderen gesehen habe.
Neben den Einsichten in Greens Karriere sind es vor allem die technischeren Kapitel, die im Buch faszinieren. Alfred Green beschreibt etwa die Spannung der Saiten, die besondere Haltung, die Green benutzte, bei der sein Instrument fast auf seinem Schoß lag, spricht über die Tatsache, dass Green kaum je mit nicht-akkordischen Soli zu hören war, über seine wenigen Aufnahmen unter eigenem Namen, über Gigs für andere Bandleader und anderes mehr.
Einem dicken Block mit seltenen Fotos folgen schließlich noch Analysen von Michael Petterson, M.D. Allen und Trevor de Clerq sowie Zitate anderer Gitarristen über Green, schließlich eine ausführliche Diskographie aller seiner Aufnahmen.
Es gibt eine Reihe an Büchern über das Count Basie Orchester, darunter natürlich auch Basies eigene Autobiographie, verfasst mit Hilfe Albert Murrays. Keines dieser Bücher aber bietet einen so persönlichen Einblick in die Band wie das Buch Alfred Greens über seinen Vater. Der Gitarrist Freddie Green war wahrscheinlich der wichtigste Musiker des Basie Orchesters, der nicht nur für den durchgehenden Swing und eine rhythmische Verlässlichkeit stand, sondern der Band auch, was oft übersehen wird, ihren ganz spezifischen Sound verlieh, der sie aus der Menge ihrer Konkurrenten auf dem großen Bigbandmarkt hervorhob. Greens Buch gelingt in diesem Umfeld gleich dreierlei: Er schreibt eine Biographie des Gitarristen Freddie Green, er erzählt Details aus der Bandgeschichte Count Basies (und damit aus dem Alltag der Swingära), und er teilt sehr persönliche Erinnerungen an seinen Vater mit dem Leser.
Ihm gelingt dabei der schwierige Spagat, Beobachter und Sohn zur selben Zeit zu bleiben. Zu Beginn liest sich das alles wie eine interessante, aber eher distanzierte Lebensdarstellung, bis Green aus einem Gespräch zitiert, das er mit seiner Mutter geführt hatte, und bei dem einen schlagartig klar wird, dass der Autor ja Sohn des Objekts seines Berichts ist, dass er mit dem Wissen eines Familienglieds, sicher auch mit eigener Betroffenheit schreibt. Solche Perspektivwechsel gelingen ihm hervorragend, wie man in etlichen bewegenden Passagen erkennen kann. Green verschweigt macht aus seinem Vater nirgends einen Heiligen, sondern stellt ihn als Menschen dar, der nach dem Besten strebte, aber durchaus fehlbar war.
“Rhythm Is My Beat” ist ein sehr empfehlenswertes Buch, über Freddie Green, über Count Basie, über die Swingära und vieles mehr. Alfred Greens Buch gibt einen tieferen Einblick als vieles, was man sonst so liest zu diesem Thema und ist eine spannende Lektüre für Fans, genauso wie für Musiker oder Forscher über diese Musik.
Wolfram Knauer (Februar 2016)
Keith Jarrett. Eine Biographie
von Wolfgang Sandner
Berlin 2015 (rowohlt)
362 Seiten, 22,95 Euro
ISBN: 978-3-87134-780-1
 “Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
“Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet”, beginnt Wolfgang Sandner sein Buch, das er mit Wohlwollen des Pianisten angegangen war, bis er mit diesem nach einem Konzert aneinandergerieten sei, weil es Jarrett nicht gefallen habe, dass Sandner sein “Köln Concert” als einen seiner größten Erfolge bezeichnete. “Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance”, befindet Sandner. In der Folge nämlich habe er sich noch stärker auf die Musik konzentrieren müssen. Das Ergebnis ist ein Buch, das der Musik Jarretts als eines Künstlers gerecht wird, der seine Kraft aus der Improvisation des Jazz zieht, dessen Wirkung aber weit über dieses Genre hinausreicht.
Keith Jarrett wurde am 8. Mai 1945 in Allentown, Pennsylvania, geboren, und Sandner sieht diesen Tag, Kriegsende, als symbolträchtig für die Jahrhundertkarriere des Pianisten. Ohne Europa, das durch den Krieg noch mehr für die Qualitäten des Jazz sensibilisiert war, erklärt Sandner, wäre Jarretts Karriere einerseits so nicht möglich gewesen, auf der anderen Seite habe Jarrett immer tief in den Traditionen der amerikanischen Avantgardeästhetik gestanden, in der Tradition auch eigenbrötlerischer Künstler wie Lou Harrison und Alan Hovhaness, deren Werke er Anfang der 1980er Jahre in Europa uraufführte.
Sandner zeichnet die Kindheit Jarretts in Allentown nach, die Erkenntnis seines Talents, das Trauma der Trennung seiner Eltern, dem er mit dem Rückzug in die Musik begegnete, und die musikalischen Bemühungen seiner Brüder. Jarrett spielte mit lokalen Bands, besuchte Workshops, gewann ein Stipendium fürs Berklee College, mit dessen die Musik eher regulierenden als zur Kreativität ermutigendem Lehrplan er allerdings wenig anzufangen wusste. Da war die Schule von Art Blakeys Jazz Messengers schon eine andere, in denen Jarrett ab Herbst 1965 für vier Monate mitwirkte. Von Blakey wechselte er in die Band des Saxophonisten Charles Lloyd, dem er durch dessen Schlagzeuger Jack DeJohnette empfohlen worden war. Lloyds Quartett war “die erste Supergroup des Rockjazz”, und Sandner hört sich sowohl dessen Studio- wie auch die Liveaufnahmen an. 1967 gründete Jarrett sein erstes Trio mit Charlie Haden und Paul Motian, und als ihm Miles Davis 1969 zum wiederholten Mal anbot, in seiner Band mitzuwirken, sagte Jarrett zu, obwohl Miles mit Herbie Hancock und Chick Corea bereits zwei Pianisten in der Band hatte. Bei Miles musste er elektronische Keyboards und Orgel spielen, Instrumente, die ihm eigentlich zuwider waren. Zugleich setzte er sich noch mehr mit Klang auseinander, mit dem Sound der Instrumente, die er zu bedienen hatte genauso wie den Soundmöglichkeiten der Band, die für Miles im Mittelpunkt seiner “musikalischen Großräume, Klangkunstwerke” standen.
Ein eigenes Kapitel widmet Sandner der Partnerschaft zwischen Keith Jarrett und Manfred Eicher, der weit mehr war als ein Labelgründer und Plattenproduzent. Jarrett stand Anfang der 1970er Jahre eigentlich bei ABC unter Vertrag, ihm wurde aber erlaubt, Produktionen mit “ernster Musik” und ähnliche Aufnahmen ohne Gegenleistung anderswo einzuspielen, das könne sein Ansehen schließlich nur steigern. Dass Jarretts Aufnahmen für Eichers Edition of Contemporary Music zum Zugpferd für das Label ECM werden sollten, hatte niemand vorhergesehen. Im November 1971 also ging Jarrett erstmals in Oslo ins Studio und produzierte mit “Facing You” die erste von bis heute 28 Solo-Produktionen für Eicher, ein Album, das sowohl Jarretts Ruf als Solopianist begründete als auch Eichers Ruf als einer der offenohrigsten Produzenten des Jazz. Sandner erklärt, was die Partnerschaft und das Vertrauen der beiden zueinander begründe, die Tatsache etwa, dass Eicher selbst Musiker sei oder dass sein Interesse neben dem Jazz auch anderen Formen von Musik (oder Literatur oder Kunst oder Film) gelte. Eicher, schlussfolgert Sandner auch nach dem Gespräch mit anderen ECM-Künstlern, sei bei vielen seiner Produktionen der “dritte Mann”, auch wenn man ihn weder sehe noch höre.
Es gäbe etliche Musiker und Musikliebhaber, warnt Sandner schon im Vorwort seines Buchs, die meinen, über Musik solle man nicht so viel schreiben, da diese das Wesentliche doch eh in sich berge. Und dann tut er genau das, kongenial, so nämlich, dass seine Zeilen die Musik zwar heraufbeschwört, aber nirgends zu ersetzen trachtet. Über Jarretts Klavierspiel etwa schreibt er, man könne vielleicht die verschiedenen Techniken benennen, die seinen Personalstil ausmachten, komme dabei aber vor allem an einem Charakteristikum nicht vorbei, das Sandner die “Konzentration aufs Wesentliche” nennt und das er in Jarretts musikalischem Ansatz genauso findet wie in seiner Wahl der Mitmusiker oder in der klaren Gliederung seines Repertoires in Standards, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen.
An anderer Stelle verfolgt er Jarretts Vervollkommnung der authentisch-eigenen Stimme. Er betrachtet die Aufnahmen seines amerikanischen Quartetts mit Dewey Redman und seines europäischen Quartetts mit Jan Garbarek, beschreibt, was an diesen Aufnahmen so besonders sei, obwohl sie doch weder einen unerhörten Klang hervorbrächten noch eine neue Form oder eine außergewöhnliche ästhetische Haltung. Er nennt Jarrett einen “Solist ohne Grenzen”, verfolgt die unterschiedlichen pianistischen Ansätze, die der Künstler über die Jahre entwickelte. Und Sandner ist wie wenige deutsche Autoren ein Meister darin, Musik mit Worten näher zu kommen. Ein Beispiel: Über Jarretts Album “Staircase” schreibt er: “Alles, was Jarrett in den elf Stücken erklingen lässt, besitzt Körperlichkeit. Es gibt keine flachen Töne, nur runde, eckige, kubusartige, voller Tiefenschärfe. Wenn ein Ton verklingt, wird er nicht nur leiser, er verschwindet wie in einem Tunnel, verliert nicht nur sein Volumen, sondern wird augenscheinlich kleiner.” Er benennt die Beziehungen zwischen Jarretts Aufnahmen an der Barockorgel in Ottobeuren und seiner Suche nach Klangfarben einerseits und ähnlichen Suchen europäischer oder amerikanischer Komponisten andererseits, nicht aber, um daraus Einflüsse abzuleiten, sondern um zu zeigen, dass Jarrett sich da inmitten eines breiten Diskurses befindet, in dem seine eine gewichtige Stimme ist.
Zwischen ausführliche Beschreibungen der diversen Plattenprojekte streut Sandner aber auch Informationen über die Selbstzweifel des Künstlers, über persönliche und geschäftliche Krisen, über Rückenschmerzen und das chronische Erschöpfungssyndrom, dass Jarrett für einige Jahre aus dem Verkehr zog. Er beschreibt, wie all diese außermusikalischen Ereignisse ihren Widerhall in Jarretts Musik fanden. Nach seiner Genesung, fasst Sandner zusammen, sei Jarrett ” praktisch nicht mehr in ein Aufnahmestudio zurückgekehrt. Mit Ausnahme einer Duo-Aufnahme mit Charlie Haden und einer Einspielung von Bach-Sonaten für Violine und Klavier sind alle Aufnahmen danach bei Live-Auftritten entstanden.”
Natürlich nimmt das “Köln Concert” ein wichtiges Kapitel seines Buchs ein. Sandner beschreibt die bekannt widrigen Umstände des Konzerts, Rückenschmerzen, ein schlecht intoniertes Instrument, ein Stutzflügel, den die Bühnenarbeiter statt des eigentlich geplanten Bösendorfer Imperial auf die Bühne gestellt hatten, und er erzählt, wie Jarrett aus all diesen Widrigkeiten über sich herauswuchs, die Beschränkungen des Instruments zu Stärken seiner Aufnahme machte. Das “Köln Concert” wurde zu einem Riesenerfolg bei Kritik und Publikum gleichermaßen, und selbst der Perfektionist Jarrett musste später zugeben, dass die Ideen, “diese Klangfarben und diese Stimmführungen”, die auf der Aufnahme zu hören sind, schon einzigartig waren.
In weiteren Kapiteln seziert Sandner die Herangehensweise Jarretts an die Standards des American Popular Song, die er zusammen mit dem Bassisten Gary Peacock und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ab 1983 einspielte und bald auch bei Konzerten spielte, seine Einspielungen klassischer Musik von Bach bis Lou Harrison, sowie Jarretts eigene Kompositionstätigkeit, die sich keinesfalls in der Komposition von Themen für eigene Improvisationen erschöpfte.
Sandners letztes Kapitel heiß “Einspruch” und ist unter all den lesenswerten Kapiteln dieses Buchs vielleicht das lesenswerteste. Sandner beginnt mit einer Eloge auf den kreativen Schöpfer, auf das Genie Keith Jarrett, um dann die Reaktion hervorzuheben, mit der Jarrett so oft, auf so vieles, reagiert, seine “Manie, etwas abzulehnen”. Der wichtigste Einspruch Jarretts gelte dabei musikalischen Trends, kurzlebigen Moden oder selbsternannten Kanonikern. Sandner findet diese Veto-Haltung auch im Klavierspiel des Meisters selbst, das “allen Regeln der traditionellen Klavierkunst widerspricht und wirkt, als sei das Instrument weniger ein Partner, vielmehr ein Gegner, den man bezwingen müsse, bisweilen mit List und Tücke, bisweilen mit tänzerischem Ablenkungsmanöver, manchmal mit brachialer Gewalt, nicht selten aber, indem man sich den Flügel einverleibt, mit ihm verschmilzt.” Es ist dieses Eins-Sein mit seiner Musik, das Jarrett auch außerhalb der Jazzanhängerschaft Wirkung verschafft hat. Henry Miller schrieb ihm einen Brief, nachdem er das “Köln Concert” gehört hatte, Sergiu Celibidache und Marcel Reich-Ranicki zeigten sich begeistert. Sandner argumentiert aber auch, dass diese Verweigerungshaltung neben seinen künstlerischen Entscheidungen auch Jarretts problematisches Bühnenverhalten beeinflusst habe, seine gelegentlichen Publikumsbeschimpfungen, die, wie Sandner schreibt, fast schon zum Ritual geworden seien, das Voyeure unter den Hörern erwarten oder gar herausfordern.
Wolfgang Sandners Buch gelingt es, der Musik Keith Jarretts nahe zu kommen, gerade, weil er sich, wie er im Vorwort erklärt, mit dem Künstler entzweit hat. Sandner besitzt den Überblick nicht nur über Jarretts Schaffen und nicht nur über die Jazzgeschichte, aus der heraus Jarretts Kunst kommt, sondern über die gesamte Kulturgeschichte, in die hinein Jarretts Musik wirkt. Es gelingt ihm, die verschiedenen Positionen zu definieren, die sich in der Musik und ihrer Rezeption widerspiegeln: die musikalische, ästhetische und wirtschaftliche Position Jarretts zu verschiedenen Zeiten, die Position der Labels, der Agenten, der Produzenten, die Position Manfred Eichers, die Position der Kritiker und des Publikums, und nicht zuletzt auch seine eigene Position, die Position Wolfgang Sandners. Dass er aus eigener Begeisterung heraus schreibt, lässt er nicht unerwähnt. Er bezeichnet Jarrett wiederholt als “Genie”, nennt ihn den größten Musiker, der je aus Allentown kam. Doch dient diese eigene Positionsbestimmung letztlich auch dem Vertrauen, das wir als Leser in Sandners Wertung der Musik haben können. Er lässt uns klar wissen, wo er als Autor steht, und so können wir viel leichter unsere eigene Position beziehen, überdenken, revidieren. Wolfgang Sandner ordnet Jarretts Aufnahmen dabei nicht nur in Jazz-, Musik- und Kulturgeschichte ein, er verleitet zum neuen, zum tieferen Hören, und er ermöglicht ein Verständnis – im besten Sinne des Wortes – über die Grenzen des emotionalen Hörens hinaus.
Wolfram Knauer (Dezember 2015)
Nachtrag Februar 2021:
Keith Jarrett. A Biography
by Wolfgang Sandner, translated by Chris Jarrett
Sheffield 2020 (Equinox)
215 Seiten. 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-800500129
 Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Sandners Jarrett-Biographie ist inzwischen auf Englisch erschienen, übersetzt von keinem Geringerem als Jarretts Bruder, dem in Deutschland lebenden Pianisten Chris Jarrett. Für die englische Ausgabe hat Sandner seinen früheren Text erweitert und aktualisiert, hat neuere Aufnahmen und neue Veröffentlichungen aus früheren Jahren berücksichtigt und neue Erkenntnisse über Jarretts familiären Background geteilt. Mit dem Abschied Jarretts von der Bühne im vergangenen Oktober scheint auch seine Karriere abgeschlossen. Sandners Buch vertieft das Wissen und ermuntert zum Nachhören – jetzt vielleicht etwas wehmütiger als bei der ersten (deutschen) Lektüre vor sechs Jahren.
Als der Jazz nach Kassel kam. Streifzüge durch die Szene der ersten Nachkriegsjahre
von Ulrich Riedler
Berlin 2015 (B&S Siebenhaar Verlag)
104 Seiten, 14,80 Euro
ISBN: 978-3-943132-39-7
 Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Die großen Jazzmetropolen – Berlin, Hamburg, Köln, München – sind weitgehend dokumentiert. Auch für kleinere Städte haben sich Historiker und Hobbyhistoriker der Aufbereitung der Jazzgeschichte angenommen. Das kann schon mal seltsam wirken, wenn Provinzzentren wie der Mittelpunkt der Welt erscheinen, wo sie doch meist nur Durchgangsstationen für aufstrebende spätere oder etablierte, sich auf Tournee befindende Jazzstars waren. Tatsächlich aber sind regionalen Szenen bis heute wichtige Brutstätten künstlerischer Ideen, auch wenn viele der Musiker, die hier ihre Anfänge nehmen, irgendwann in die großen Zentren abwandern, in Städte mit bedeutenden Hochschulen etwa oder in solche mit einer lebendigen, großen Jazzszene.
Das nordhessische Kassel, in der Mitte der Republik, und doch kulturell vor allem durch die Brüder Grimm und die documenta bekannt, besitzt bis heute eine lebendige Szene, verschiedene Spielorte für Jazz und improvisierte Musik, und ein langjähriges Festival. Die alle fünf Jahre stattfindende documenta bringt es mit sich, dass die Bürger der Stadt sich sehr bewusst mit ästhetischen Diskursen der Avantgarde auseinandersetzen.
Der Journalist und Jazzfan Ulrich Riedler hat sich in seinem Buch auf die Suche nach den Anfängen des Jazz in der nordhessischen Stadt gemacht und diese im Frühjahr 1940 entdeckt, als sich junge Jazzfreunde im Gasthaus “Ledderhose” trafen, wo sie gemeinsam die neuesten Platten hörten. Irgendwann rückte die Gestapo ihnen auf den Leib, nahm die Jungs mitsamt ihrer Schellackschätze mit und unterzog sie einer gründlichen Befragung. Die Jazzfans wurden bald wieder entlassen, und einer von ihnen kann Riedler nicht nur von damals berichten, sondern ihm sogar noch die kurzfristig konfiszierten Platten zeigen. Die “Ledderhose” blieb auch nach dem Krieg ein Jazztreffpunkt, in dem die Mitglieder zu Platten tanzten, ab und zu aber auch selbst zum Instrument griffen.
Die 1950er Jahre dokumentiert ein Gespräch mit dem späteren Spiegel-Redakteur Alfred Nemeczek, von dem Riedler außerdem einen Bericht über das Jazzkontor Kassel aus dem Jahr 1959 andruckt, den Versuch, in Nordhessen einen Liveclub nach Vorbild des Frankfurter Jazzkellers zu etablieren. In den 1950er Jahren begannen die ersten amerikanischen Stars Deutschland zu erobern. Kassel erlebte Konzerte von Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton oder der Jam-Session-Truppe Jazz at the Philharmonic mit Ella Fitzgerald und vielen anderen.
Einer der Stammgäste der Kasseler Jazzszene war damals der Trompeter Manfred Schoof, der zwei Jahre an der Kasseler Musikakademie studierte, bevor er nach Köln weiterzog. Riedler spricht mit ihm über die Jazzszene jener Zeit, über Musiker und Musikerlegenden der Region, unter anderem den Tenorsaxophonisten Werner Apel, den, wie man sich erzählt, sogar Duke Ellington verpflichten wollte, weil er ihn bei einer Jam Session so beeindruckt habe, und natürlich auch über die GI-Clubs, in denen Schoof die amerikanische Kultur erst richtig kennenlernte.
Die Amerikaner waren im Stadtteil Rothwesten in Fuldatal stationiert und engagierten über die Special Service Agencies jede Menge deutscher Musiker für die Unterhaltung in den verschiedenen Clubs. Riedler blickt auf Orte, aufs Repertoire, auf das Jazzprogramm des örtlichen Amerika-Hauses, beschreibt aber auch andere Veranstaltungsorte der Stadt, deren Programm großteils von Vereinen organisiert, zum Teil auch von der Stadt unterstützt wurde. Er erzählt, wie Arnold Bode, der Vater der documenta, von der Band des Vibraphonisten und Gitarristen Fritz Bönsel so angetan war, dass er im Landesmuseum ein Konzert veranstaltete, das den Jazz endgültig in der Stadt etablierte.
Die Jazzszene jener Jahre beinhaltete traditionelle genauso wie moderne Stile, und so beschreibt auf der einen Seite die Dixieland-Szene der 1950er und 1960er Jahre mit ihren Riverboatshuffles und dem musikalischen Versuch, dem Original so nah wie möglich zu kommen, auf der anderen Seite aber auch, wie andere Musiker, Schoof und Gunter Hampel unter ihnen, dem modernen Jazz in Kassel zu Gehör verhalfen. Und schließlich spricht er mit dem Pianisten Joe Pentzlin, dessen Trio quasi die Hausband des Jazzclubs in der Orangerie gewesen war.
In einem abschließenden Kapitel schlägt Riedler einen knappen Bogen in die Regenwart, zu Musikern wie Matthias Schubert und Ernst Bier, die entweder aus Kassel stammen oder aber hier über längere Zeit Station machten und die Szene der Stadt mitprägten.
Riedlers Buch ist nicht als historische Dokumentation gedacht, denn vielmehr als eine flüssig zu lesende Erinnerung an die 1940er bis 1960er Jahre, ein liebevoll bebildeter Band über die Jazzszene in der deutschen Provinz, die – ähnlich wie die Szenen vieler anderer Städte mittlerer Größe – überaus lebendig war. Die Lektüre macht dem Leser deutlich, dass der Diskurs über den Jazz als aktuelle Kunstform nicht nur in den Metropolen stattfindet.
Wolfram Knauer (November 2015)
Music Wars 1937-1945. Propaganda, Götterfunken, Swing. Musik im Zweiten Weltkrieg
von Patrick Bade
Hamburg 2015 (Laika Verlag)
511 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-944233-41-3
Sounds of War. Music in the United States during World War II
von Annegret Fauser
New York 2013 (Oxford University Press)
366 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-994803-1
Victory Through Harmony. The BBC and Popular Music in World War II
von Christina L. Baade
New York 2012 (Oxford University Press)
275 Seiten, 31,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-537201-4
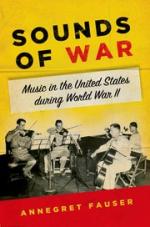 Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Musik war immer schon kriegswichtig. Ob zum Anfeuern der Truppen im Marschrhythmus, ob zum Mobilmachen der Bevölkerung durch patriotische Hymnen, ob als Beruhigung und Selbstbestätigung, ob als Instrument der psychologischen Kriegsführung oder sogar als Foltermethode: Krieg ist ohne Musik – so seltsam diese Idee auch scheinen mag – kaum vorstellbar.
Drei kürzlich erschienene Bücher untersuchen die Rolle der Musik im Zweiten Weltkrieg. Der britische Historiker Patrick Bade berichtet über die verschiedenen musikalischen Strategien und Funktionen direkt vor Ort, in den Gebieten, in denen der Krieg tobte oder die am Krieg beteiligt waren, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Großbritannien, dem nördlichen Afrika und dem Mittleren Osten. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Annegret Fauser beschränkt sich in ihrem Buch auf die klassische Musikszene in den Vereinigten Staaten. Die britische Musikhistorikerin Christina Baade schließlich untersucht, wie der BBC in den Kriegsjahren auf Jazz, Tanz- und Popmusik gesetzt habe, um die Moral der gesamten britischen Öffentlichkeit in den Kriegstagen zu stärken. Baades Studie gibt dabei einen Einblick in Programmentscheidungen eines öffentlichen Rundfunksenders und thematisiert, inwieweit die Öffnung des Senders für Jazz und amerikanische Popmusik auf Widerstände gestoßen sei. Fausers Fokus liegt auf der “concert music”, also der klassischen Musik, und im Umschlagtext heißt es, dass Dinah Shore, Duke Ellington und die Andrews Sisters vielleicht die Zivilisten zuhause und die Soldaten in Übersee unterhalten hätten, es tatsächlich aber vor allem die klassische Musik gewesen sei, die die Menschen für die Kriegsanstrengungen mobilisiert habe. Patrick Bade schließlich wagt den Rundumschlag, lässt also auch die sogenannte leichte Muse, Swing und Jazz, nicht aus. Während er dabei neben dem klassischen Repertoire und dem Swing auch einen Blick auf die Funktion von Radio, Film und Plattenindustrie wirft, außerdem in einem langen Kapitel Kriegslieder aus unterschiedlichen Ländern ins Visier nimmt, finden man in Fausers Buch Informationen über Musiker in der Armee, Auftragskompositionen für den Kriegseinsatz, ein Kapitel über Musik als Beruhigung der Bevölkerung und als Therapie für traumatisierte Soldaten sowie eines über die vielen Exilkomponisten, die durch den Krieg in den USA strandeten. Christina Baade schließlich diskutiert in ihrem Buch auch das Thema von Tanzmusik und Maskulinität, die Sorge um den Erfolg der amerikanische Popmusik und die Verdrängung eigener Traditionen, und die Bedeutung von Rundfunkprogrammen, in denen afro-amerikanische Musik in den Mittelpunkt gestellt wurden, für schwarze britische Musiker. Bei allen drei Autor/innen finden sich Diskussionen der Zuschreibung moralischer Qualitäten zur Musik, der Grundlage letzten Endes dessen, was in den USA später zur “cultural diplomacy”, zur Kulturdiplomatie werden sollte.
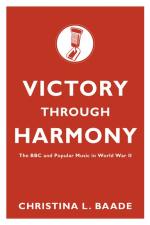 Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Für Christina Baades Argumentationslinie spielt der Jazz eine zentrale Rolle; ihr Buch erlaubt dabei Rückschlüsse auf Entwicklungen des Nachkriegsjazz in Großbritannien, einschließlich der Hinwendung vieler junger Musiker insbesondere zu traditionellen Jazzstilen. Patrick Bade hat neben einem Kapitel über Jazz und Swing im Dritten Reich, in dem er auch auf das Phänomen der Propagandaband Charlie and His Orchestra eingeht, ein eigenes Kapitel über Musik im Feldlager, im Gefangenenlager und im Konzentrationslager. Fauser wiederum diskutiert in ihrem Buch ausführlich musikalischen Ausdruck von Nationalismus, etwa in Werken von Aaron Copland und Roy Harris.
Patrick Bade gibt am Schluss seines Buchs einen Ausblick auf die Nachwirkungen, erzählt etwa, dass Wagner im Bayreuther Festspielhaus kurzzeitig Cole Porter weichen musste, berichtet, wie Sänger/innen und Musiker/innen nach dem Krieg mit ihrer Karriere im Dritten Reich konfrontiert wurden oder diese sehr bewusst aus ihrer Biographie ausblendeten. Er endet mit dem kurzen Hinweis auf Werke, die sich bis ins 21ste Jahrhundert hinein mit den Gräueltaten des Kriegs auseinandersetzen. Christina Baades Buch endet mit der Ankunft der amerikanischen Truppen im August 1944 und der Entscheidungen des BBC, die auch die amerikanischen GIs mit ihrem Programm unterhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Diskussion der Vermischung musikalischer Werte in der populären und Tanzmusik, über “Britishness” oder “Pseudo-American”. Ihr Buch verweist zwischen den Zeilen immer wieder, etwa Kapiteln über das vom Rundfunk mitgeprägte Bild der Frau oder im Versuch, die Ausstrahlung von Musik männlicher übersentimentaler Schlagersänger im Rundfunk zu unterbinden, auf Diskurse, die auch nach dem Krieg weitergingen und auf die letzten Endes BBC-Programmentscheidungen großen Einfluss hatten. Bei Fauser geht der Blick in die Nachkriegszeit über John Cage, dessen experimentelle Ideen sie in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren verortet. Sie verweist darauf, dass Cage und seine Zeitgenossen ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kriegs gezogen hätten, sich nach Ende des Kriegs von ihren nationalistischen Kompositionen distanziert oder aber diese in neue Werke integriert hätten.
 Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Zusammengefasst bietet Patrick Bade im breiteren Ansatz seines Buchs eine Art Rundumschlag über das Thema. Christina Baade wirft Licht auf die Verflechtungen zwischen Musik, Musikindustrie, öffentlicher Meinung und Publikumsgeschmack. Fausers Studie schließlich hätte von einer Erweiterung ihres Schwerpunkts vielleicht profitiert. Fauser begründet ihren eingeschränkten Blick im Vorwort damit, dass die Jazz- und Popmusikszene jener Jahre ja schon ausgiebig genug untersucht worden sei, während Forschungen zur klassischen Musik im Krieg weitgehend fehlten, vergibt sich damit aber die Chance einer differenzierten Darstellung, was vielleicht – nehmen wir einmal an, dass der Einband-Text vom Verlag und nicht von ihr stammte –, eine wertende Aussage wie die, dass Jazz und Popmusik die Bürger zuhause und die GIs in Übersee vielleicht unterhalten hätten, es aber die klassische Musik gewesen sei, die den wirklichen Unterschied gemacht habe, verhindert hätte.
Von solchen Anmerkungen abgesehen, haben alle drei Bücher ihre Meriten. Sie helfen bei der Kontextualisierung von Musikgeschichte in der späten ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts, die letzten Endes Auswirkungen auch darauf hatte, wie Musik heute klingt und wie wir sie wahrnehmen.
Wolfram Knauer (Oktober 2015)
Giving Birth to Sound. Women in Creative Music
herausgegeben von Renate Da Rin & William Parker
Köln 2015 (Buddy’s Knife)
294 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-00-049279-2
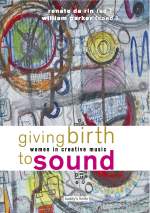 Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Vielleicht müsste am Anfang dieser Rezension erklärt werden, welchen Weg die Bücher durchlaufen, die im Jazzinstitut Darmstadt anlangen. Bevor wir uns die Bücher aussuchen, die wir rezensieren wollen, erfassen wir sie in unserem Jazz Index, einer computergestützten bibliographischen Datenbank, die von Forschern und Journalisten (und Fans) aus aller Welt genutzt wird. Das heißt, wir gehen das Buch von vorn bis hinten durch, ordnen jedes einzelne Kapitel einem Stichwort oder einem Musikernamen zu, tragen biographische Notizen wie etwa Geburtstag oder Geburtsort, nach, sofern sie in unserer Datenbank noch fehlen. Erst dann machen wir uns ans Lesen.
Aber schon bei diesem ersten Schritt des Erfassens fiel einiges auf beim Buch “Giving Birth to Sound”. Etliche der darin befragten Musikerinnen waren nämlich noch gar nicht in unserer Datenbank erfasst oder aber nur mit relativ kurzen bibliographischen Listen. Über sie wurde in der Jazzpresse bislang also nur wenig berichtet. Nun ja, mag man meinen, das hat sicher auch damit zu tun, dass Frauen ja so richtig erst in den letzten Jahren ins Rampenlicht des Jazz getreten sind. Weit gefehlt aber, und das war die zweite Überraschung: Viele Musikerinnen, die im Buch zu Worte kommen, gehören nämlich gar nicht der jungen (sagen wir: unter 40-jährigen) Generation an, sondern sind weit länger auf der Szene unterwegs. Die Gründe für ihre Unsichtbarkeit in der Jazzpresse mögen also doch woanders liegen.
Eine dritte Erkenntnis, die sich beim Durchblättern schnell ergibt, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Jede der Musikerinnen hat einen völlig anderen Zugang zum Thema. Mal analytisch, mal diskursiv, mal ausweichend, mal ablehnend, mal nüchtern gefasst, mal poetisch überhöht, mal kämpferisch, mal verteidigend. Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich schon in den Überschriften der Kapitel, die Renata Da Rin und William Parker aus der Frage “Was bedeutet Musik für Dich” abgeleitet hat. “Jeder Sound und jede Stille”, antwortet Renée Baker; “die Gründe für mein Leben”, sagt Amy Fraser; “ein abstrakter Ort, um das Leben zu teilen und zu fühlen”, meint Marilyn Mazur; “ein Lager der Erinnerungen”, findet Shelley Hirsch, “Leben, Magie, Geist”, beschreibt Maggie Nicols, oder aber, so Erika Stucky, “serious fun – a ‘Schnaps'”.
Oder aber die Einleitung: Nach dem Vorwort von Amina Claudine Myers haben die Herausgeber eine Anzahl von Reaktionen auf den Buchtitel zusammengefasst. “Giving Birth to Sound”? Schrecklicher Titel: Frauen wurden schließlich immer wieder aufs Gebären reduziert, meint eine der Gesprächspartnerinnen, während eine andere findet, der Titel passe, sei auch angenehm mehrdeutig. Naja, und bei allen Bedenken spräche der Titel ja auch vom Schaffen von etwas Neuem. Blödsinn, widerspricht eine weitere Stimme, Gebären sei doch eine passive, rein physische Tätigkeit, jede Kuh könne das. Musik zu erschaffen sei dagegen ein aktiver intellektueller Prozess und damit das exakte Gegenteil.
Das Konzept des Buchs: Ohne weitere Vorgaben schickten die Herausgeber den 48 Musikerinnen 20 Fragen, die vom Faktischen zum Nachdenken über den Prozess des Kreativen gehen, sich dabei immer wieder danach erkundigen, inwieweit das eigene Geschlecht bei musikalischen, ästhetischen oder beruflichen Entscheidungen eine Rolle gespielt habe. Tatsächlich sind nur sechs der Fragen konkret aufs Frau-Sein der Musikerinnen abgezielt: Wie hast Du deine Kreativität als kleines Mädchen ausgelebt? Wie hat die Tatsache, dass Du eine Frau bist, die Entwicklung Deiner musikalischen Karriere behindert? Wie siehst Du Deine Position als Frau in der Musikszene? Hat diese Position Dein Verhältnis zum Sound beeinflusst? Siehst oder spürst Du einen Unterschied im weiblichen und im männlichen Ansatz an Kreativität? Was würdest Du anderen / jungen Frauen empfehlen, die sich bemühen ein kreatives Leben zu führen?
Die Antworten auf diese und allgemeiner gehaltene Fragen fallen so unterschiedlich aus wie die Lebenswege der 48 Interviewten. Es macht nun mal einen Unterschied, ob man Ende der 1970er Jahre in Dänemark zum Jazz kommt wie Lotte Anker oder 1941 in Oklahoma wie Jay Clayton. Haben Männer und Frauen einen anderen kreativen Approach?, fragen die Herausgeber. “NEIN!” ruft Jay Clayton, in Großbuchstaben, keine weitere Diskussion duldend, während Marilyn Mazur einwirft, Frauen würden vielleicht weniger in Wettstreit treten, mehr ans Ganze und Kollektive denken. “Nein, ich sehe da keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen”, findet wiederum Amy X. Neuberg, um gleich anzuschließen, “das heißt aber nicht, dass es keine gäbe.” Klar gibt es einen Unterschied”, erklärt Kali Z. Fasteau, etwa, dass Männer in hierarchischen Systemen besser funktionierten als Frauen. Andererseits, urteilt Nicole Johänntgen, sei diese Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil es nun mal so sehr viel mehr Männer als Frauen auf der Szene gäbe.
Nicole Mitchell beantwortet ihre Fragen in poetischen Erinnerungen und Reflexionen über schwarze Musik, den langen Atem der Bürgerrechtsbewegung und ihren eigenen Weg. Maggie Nicols auf der anderen Seite streicht heraus, dass ihre Musik immer sowohl politische wie auch spirituelle Untertöne besessen habe. Ob sie einen Preis bezahlt habe dafür, dass sie Musik mache, fragen die Herausgeber, und Angelika Niescier findet: Im Gegenteil, sie habe daraus sehr viel für sich gewonnen. Musikerin zu werden, sei nun mal eine Lebensentscheidung, finden auch viele ihrer Kolleginnen, niemand zwinge einen schließlich diesen Weg einzuschlagen.
Die weibliche Kreativität erlaube mehr “Raum”, meint Fay Victor, und zwar “sowohl mehr Raum im Sinn von Zeit und Raum wie auch mehr Raum für die Akzeptanz von Fehlern und Intuition”. Klar habe die Tatsache, dass sie eine Frau sei, ihr Verhältnis zum Sound beeinflusst, erklärt Joëlle Léandre. Frauen seien nun mal anders, sie hätten die Fähigkeit zur Distanz, die in diesem Geschäft wichtig sei, außerdem könne man mit ihnen viel besser lachen.
Sie sehen in dieser springend-vergleichenden Zusammenfassung einzelner Antworten bereits, wie ungemein gewinnbringend sich dieses Buch lesen lässt, wenn man blättert, Themen identifiziert, die die Herausgeber durch ihre Fragen ja nicht festgeklopft, sondern nur angestoßen haben, um dann zu sehen, welchen Kontext die verschiedenen Antworten beleuchten. Man erlebt die ja unabhängig voneinander befragten Musikerinnen bald wie in einer respekt- und kraftvollen Diskussion neugieriger, andere Meinungen (meistens) zulassender, vor allem aber ungemein selbstbewusster Musikerinnen.
Das Fazit des Buchs wusste man vielleicht schon vor der Lektüre: Eine einzelne Antwort auf die Frage nach dem kreativen Unterschied nämlich gibt es nicht. Der künstlerische Ansatz zwischen Männern und Frauen ist genauso unterschiedlich wie jener zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Es gibt jedoch, und das wird in diesem Buch sehr deutlich, ein anderes Diskursverhalten, eine klare Selbstwahrnehmung der Rolle, in die man gesellschaftlich gedrängt wurde.
Unbedingt lesenswert also, ob von Buchdeckel zu Buchdeckel oder im laufenden Vor- und Zurückblättern. “Giving Birth to Sound” erklärt dem interessierten Leser nämlich in der persönlichen Selbstbefragung der Protagonistinnen und oft auch zwischen den Zeilen weit mehr über die Thematik, als man es etwa von wissenschaftlichen Studien erwarten dürfte.
[Naja, wir empfehlen dennoch den Besuch unseres Darmstädter Jazzforums zum Thema “Gender and Identity in Jazz” vom 1.-3. Oktober 2015 oder die spätere Lektüre unserer Beiträge zur Jazzforschung mit den referaten dieser Konferenz. Aber das ist natürlich nur Eigenwerbung…]
Wolfram Knauer (September 2015)
Beyond Jazz. Plink, Plonk & Scratch. The Golden Age of Free Music in London 1966-1972
von Trevor Barre
London 2015 (Compass Publishing)
330 Seiten, 12,99 Britische Pfund
ISBN 978-1-907308-84-0
Zu bestellen über trevorbarre@aol.com
Ekkehard Jost hat die Jahre zwischen 1960 und 1980 als eine Zeit beschrieben, in der Europas Jazz zu sich selbst fand, in der Musiker sich von ihren amerikanischen Vorbildern lösten und eigene Wege gingen. Einige dieser Wege führten fort vom, gingen also “beyond jazz”, und diese Entwicklung will Trevor Barre in seinem Buch mit demselben Titel nachzeichnen. Der Gitarrist Derek Bailey forderte eine Improvisation, die sich aus den idiomatischen Bezügen befreien, und auch andere Musiker begannen statt des Begriffs “Free Jazz” von “improvised music” zu sprechen. Barre interessiert, wie es überhaupt dazu kam, dass eine solch sperrige und alles andere als publikumsfreundliche Musik entstehen konnte und warum sie nicht angesichts ihres kommerziellen Misserfolgs einfach nach ein paar Jahren ausstarb. In seinem Fokus steht dabei die erste Generation der freien Improvisatoren, also Musiker wie Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens, Kenny Wheeler, Barry Guy, Dave Holland, Trevor Watts, Tony Oxley, Paul Rutherford, Howard Riley, Eddie Prévost, Keith Rowe, Gavin Bryars und Cornelius Cardew.
Barre beginnt mit einer Definition seines Themas: Wo die meisten Jazzbücher den Jazz durch seine improvisatorischen Parameter beschreiben würden, sei Free Music, schreibt er, einzig durch den improvisatorischen Gehalt definiert. Er stellt unterschiedliche Formen freier Improvisation vor, solche, die näher am Jazz bleiben und solche, die eher der europäischen Avantgardetradition verpflichtet scheinen. Die beiden Hauptensembles seines Buchs sind das Spontaneous Music Ensemble und die Gruppe AMM. Barre ordnet deren Auftritte in die Jugend- und Protestkultur der 1960er Jahre ein und schildert, wie die globalen Entwicklungen von Pop, Rock und Folk jungen Musikern ein völlig neues Vokabularium an die Hand gab, sie auch zu neuen Herangehensweisen zwischen tiefer Ernsthaftigkeit und unbändigem Humor bewegten. Er beschreibt auch, welchen Platz sie in die Bandbreite des britischen Jazz jener Jahre zwischen Dixieland und Free Jazz hatten.
Barre zeichnet den Weg einzelner Protagonisten zur freien Improvisation nach, schildert insbesondere die Bedeutung des Little Theatre Club, in dem die jungen Musiker mit Kollegen auch aus dem europäischen Ausland experimentieren konnten. Er beschreibt, wie sie nach und nach merkten, dass es außer dem afro-amerikanischen Jazz auch anderes gab, dass beispielsweise südafrikanische Musiker um Chris McGregor dieser Musik eine neue Farbe geben konnten und dass sich Freiheit, wie sie der Free Jazz implizierte, auch ganz mit anderen Mitteln umsetzen ließ. Er diskutiert wichtige Aufnahmen der Zeit, wobei ihn vor allem die interaktiven Prozesse interessieren, die ästhetischen Diskurse, die sich aus der Improvisation der Aufnahmen ergaben. Das alles beleuchtet er anhand von zeitgenössischen genauso wie selbst geführten Interviews mit beteiligten Musikern. Das Spontaneous Music Ensemble und AMM nehmen zwei der umfangreichsten Kapitel ein, in denen Barre neben dein Einflüssen und den ästhetischen Diskussionen auch über Nachwirkungen schreibt, bewusste oder unbewusste Reaktionen auf die Klangexperimente in weit jüngerer Musik, der 1980er, 1990er Jahre und danach. Er betrachtet den Einfluss der Technologie, schaut auch auf die Bedeutung der visuellen Covergestaltung oder der Plattentexte. Das Label Incus nimmt ein eigenes Kapitel ein, wie FMP in Deutschland oder ICP in Holland ein von Musikern gegründetes Label, das Musik seiner Mitglieder nicht so sehr vermarkten als vielmehr dokumentieren wollte. Improvisation ist schließlich weit mehr als komponierte Musik auf das Medium der Tonaufzeichnung angewiesen – sonst verklingt sie.
In seinem Schlusskapitel betrachtet Barre kurz die “zweite Generation” der Free Music in London um das London Musicians’ Collective sowie eine “dritte Generation” um John Edwards, John Butcher und andere und setzt beide Entwicklungen mit jenem von ihm als “erste Generation” betrachteten Grundthema seines Buchs in Beziehung. Im Nachwort schließlich verfolgt er die Aktivitäten seiner Protagonisten bis in die Gegenwart.
Trevor Barres Buch ordnet die Entwicklung der Free Music der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in die kulturelle Szene des “Swinging London” ein. Ihm gelingt dabei vor allem der Blick auf sich wandelnde ästhetische Ideale und eine Begründung derselben aus gesellschaftlichen und politischen Diskussionen heraus. Der Musik selbst kommt er vor allem in Interviews mit den beteiligten Musikern nahe. Die inhaltliche wie organisatorische Unabhängigkeit der britischen Improvisationsszene jener Jahre hat Auswirkungen bis heute. Initiativen wir F-Ire Collective wären ohne das Vordenken und Vormachen der hier beschriebenen Musiker und Gruppen nicht möglich gewesen. Von daher füllt Barres Buch eine Lücke. Dass er bestimmte Themen weitgehend außer Acht lässt – die Auseinandersetzung dieser Szene mit ihrem Publikum beispielsweise oder mit den Mainstream-Medien, der tatsächliche Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Szenen oder die Reaktion amerikanischer Musiker, zeigt nur, wie viele Perspektiven das Thema tatsächlich hat, die bislang kaum beleuchtet wurden. Barre jedenfalls stößt mit “Beyond Jazz” die Tür zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der musikalischen Freiheitsbewegung jener Zeit weit auf.
Wolfram Knauer (August 2015)
Little Satchmo. Living in the Shadow of my Father, Louis Daniel Armstrong
von Sharon Preston-Folta (mit Denene Millner)
Charleston/SC 2015 (self published)
112 Seiten, 12 US-Dollar
ISBN: 978-1-481227-23-7
Zu beziehen über www.littlesatchmo.com
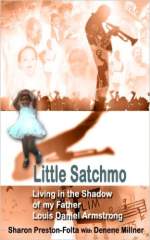 Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Die offizielle Version lautet: Louis Armstrong hatte nie Kinder. Er hätte immer gern welche gehabt, sagte seine letzte Frau und Witwe, Lucille Armstrong, aber er sei zeugungsunfähig gewesen. Nun kommt, 34 Jahre nach Satchmos Tod, Sharon Preston-Folta mit einem Buch heraus, in dem sie kundtut, sie sei die Tochter Louis Armstrongs aus einer außerehelichen Beziehung, die Satchmo in den 1950er Jahren hatte.
Ihr Leben lang habe sie diese Wahrheit herunterschlucken müssen. Sie wolle kein Geld, keinen Ruhm, aber immer selbst auf das öffentliche Wissen um ihren Vater verzichten zu müssen, sei einfach zu viel. In ihren Recherchen habe sie nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf Satchmos Vaterschaft gefunden, einen Brief des Trompeter an seinen Manager, Joe Glaser, aus dem Jahr 1955, in dem er diesen bat, vor der Ankunft seiner Frau Lucille in Las Vegas ein paar Geschäftsdinge zu klären, darunter Zahlungen an eine Freundin, von der er glaubt, dass sie ein Kind von ihm habe. Ihre Mutter habe sie immer beschworen, ihren Vater geheim zu halten, und so habe sie letzten Endes gehorcht und damit auch keine Ansprüche geltend gemacht auf sein physisches, historisches und finanzielles Erbe. Wenn sie etwas gekränkt habe bei ihren Recherchen, sei es, dass Louis Armstrong in seinen Briefen so offen über alles geredet habe, seine Musik, seine Kindheit, seine Liebe zum Essen und zu den Frauen, über Sex, sogar über seine Darmtätigkeit, dass er über seine Tochter aber sein Leben lang geschwiegen habe.
Warum er ihre Existenz verleugnet habe? Nun, erklärt Preston-Folta, Louis Armstrong sei ein gefeierter Künstler seiner Zeit gewesen und habe sich in der besten (weißen) Gesellschaft aufgehalten. Es habe einfach nicht gepasst, in dieser Zeit, wenn Nachrichten über ein uneheliches Kind mit einer Geliebten in die Schlagzeilen gekommen wären.
Prestons Mutter wurde 1921 in New York geboren und arbeitete bereits als 16-Jährige als Chorus Girl in diversen Shows. 1941 heiratete sie einen Tänzerkollegen; 1946 arbeiteten die beiden als Tanzpaar “Slim & Sweets” als Vorgruppen für große Swingorchester, unter ihnen auch Louis Armstrong, der sich mit ihnen anfreundete und in einen launigen Briefwechsel einstieg. 1950 starb Slim, und bei der Trauerfeier war auch Louis Armstrong dabei, der Lucille Preston in den Arm nahm und versprach: “Ich werde mich um dich kümmern.” In den nächsten vier Jahren reiste sie Pops hinterher und tauchte auf, wann immer Armstrongs in New York spielte. 1954 wurde Preston schwanger, und im November schrieb Satchmo ihr einen Brief, in dem er erklärt, wie sehr er sich auf das Kind freue und sogar vorschlägt, sie zu heiraten, sollte seine Frau (mit gleichem Namen Lucille) sich von ihm scheiden lassen. Armstrong war dann aber nicht dabei, als Sharon Louise (nach Louis) Preston am 24. Juni 1955 das Licht der Welt erblickte. Armstrongs rechtmäßige Ehefrau war “not amused” und habe ihm nach der Geburt der Tochter sogar vorgeschlagen, diese zu adoptieren, was ihre leibliche Mutter aber vehement ablehnte. Lucille (die Ehefrau) habe sogar die Alimente überwiesen, bis sie diese Aufgabe irgendwann Joe Glaser übertrug.
In ihrem Buch berichtet Sharon von den viel zu seltenen, sorgfältig geplanten und sehnsuchtsvoll erwarteten Treffen. Sie und ihre Mutter lebten eine Weile bei ihrem Onkel Kenny, der nach außen schon mal als Lucilles Ehemann auftrat und immer wieder auf seine Schwester eindrang, bei Satchmo mehr einzufordern: mehr Geld, mehr Fürsorge, am besten seinen Namen. Bei einzelnen Sommertourneen durfte Sharon mitreisen. Ansonsten aber war Satchmo vor allem durch die monatlichen Unterhaltszahlungen präsent, durch Broadway-Tickets, 1962 durch den Kauf eines Hauses in Mount Vernon, New York. In Harlem hatte sich niemand wirklich darum gekümmert, wie ihre Familienverhältnisse aussahen, erzählt Preston-Folta, in Mount Vernon aber begann eine Zeit der Lügen. Die Liaison dauerte ja bereits 12 Jahre, aber nach wie vor war nicht in Sicht, dass Armstrong auch öffentlich zu seiner Familie stehen würde. Mit zehn Jahren begriff Sharon erstmals, dass ihr Vater eine “andere Lucille” hatte, ein anderes Leben, das mit ihrem aber auch gar nichts zu tun hatte.
Etwas später seien sie gemeinsam in Atlantic City zu einem Auftritt Marvin Gayes gegangen, es habe einen Streit zwischen den Erwachsenen gegeben, bei dem ihre Mutter Satchmo fragte, wann er sie nun endlich zu heiraten gedachte, worauf er laut wurde: “Ich werde dich niemals heiraten” und mit Fingerzeig auf die Tochter fragte: “Sag mir einfach, was es kostet, für sie zu sorgen!” Das war das Ende der Beziehung.
Kaum war Armstrong gestorben, kamen auch die monatlichen Schecks nicht mehr. Ein paar im Voraus geleistete Zahlungen für Sharons Erziehung hielten sie und ihre Mutter über Wasser, mussten bald auch den Zuwachs zur Familie finanzieren, denn Sharon wurde mit 16 selbst Mutter. Sharon erzählt, wie ihr Leben weiterging, immer gezeichnet durch die Narben, die der fehlende Vater hinterlassen hatte. Irgendwann rebellierte sie gegen die eigene Bitterkeit und versuchte, das emotionale Band, das sie mit der verlorenen, nie gehabten Vergangenheit hatte, zu zerschneiden.
Sharon Preston-Foltas Buch endet mit einem Besuch im Armstrong House in Queens. Ein Anwalt hatte ihr empfohlen, einen Blick in Satchmos Testament zu werfen, das eine eidesstattliche Erklärung von Lucille, Armstrongs Frau, enthielt, Armstrong habe nie Kinder gehabt. Als Sharon diese Zeilen las, von Lucille eigenhändig korrigiert von “Der Verstorbene und ich hatten keine Kinder” in “Der Verstorbene hatte keine Kinder”, entschied sie sich, jetzt ihr Geschichte zu erzählen. Ihre Mutter, die sie immer zur Geheimhaltung gedrängt hatte, willigte endlich ein: “Mach, was Du meinst, dass du tun musst.”
Sharon Preston-Foltas Buch ist als eine Liebeserklärung an die von ihr immer vermisste Vaterfigur Louis Armstrong geschrieben, aber es ist eben auch eine leicht verbitterte Liebeserklärung geworden. An genügend Stellen legt man es zur Seite, unterschiedlich berührt von den Schuldzuweisungen, mit denen Preston-Folta ihre eigenen Lebensentscheidungen aus ihrer vaterlosen Kindheit und Jugend ableitet. Ein bedrückendes Schicksal, denkt man, und fragt sich zugleich, warum sie, die immer wieder von der DNA ihres Vaters schreibt, die in ihr fortlebe, nicht irgendwann, spätestens vor der Veröffentlichung dieses Buchs, auf einem DNA-Test bestanden habe. Doch ist es einem Kind, das sein Leben lang sicher ist, seine Eltern zu kennen, überhaupt zuzumuten, von einem auf den anderen Tag an der Tatsache der Vaterschaft zu zweifeln? Auch als skeptischer Leser sollte man jedenfalls für die Zeit der Lektüre erst einmal die Grundbehauptung der Vaterschaft Louis Armstrongs akzeptieren, sonst hat man wenig Spaß am Buch. Armstrong selbst schließlich scheint bis zu seinem Tod überzeugt davon gewesen zu sein, in Sharon eine Tochter gehabt zu haben.
Allen Fragen und sicher auch allen möglichen Zweifeln zum Trotz, die einem bei der überraschenden Enthüllung Sharon Preston-Foltas kommen mögen, lernt man einiges bei der Lektüre, und wenn nur, dass Scheinwerferlicht auch Schatten wirft, dass Stars wie Louis Armstrong das Leben vieler Menschen zum Teil viel direkter berührten, als man es wahrhaben mag, und nicht zuletzt, dass die Persönlichkeit großer Stars aus ihren emotionalen Stärken genauso besteht wie aus ihren emotionalen Unzulänglichkeiten. Am Glorienschein des großen Meisters mag das alles ein wenig kratzen; der Kraft seiner Musik tut es keinen Abbruch.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Theatrical Jazz. Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
von Omi Osun Joni L. Jones
Columbus/OH 2015 (The Ohio State University Press)
270 Seiten, 99,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8142-1282-0
 Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Der Blick über den Tellerrand kann das Wesentliche erhellen, der Blick von außen Dinge erkennen lassen, die man im internen Diskurs oft nicht mehr sieht. Das ist einer der Hintergründe für die sogenannten “new jazz studies”, ein Konzept in der jüngeren Jazzforschung, das sich der untersuchten Materie neben der musikwissenschaftlichen Betrachtung interdisziplinär nähert. Die Feministin Omi Osun Joni L. Jones versucht in ihrem Buch eine Verbindung zwischen Jazzästhetik , theatralischer Performance und auf Yoruba basierender afrikanischer Theologie. Dabei beschreibt sie als eine der zentralen Prinzipien der Jazzästhetik die Fähigkeit, die eigenen intuitiven Kräfte freizusetzen. In ihrer Beschäftigung mit afrikanischer Spiritualität habe sie gelernt, dass auch in wissenschaftlichen Büchern die Auseinandersetzung mit spirituellen Impulsen nicht zu kurz kommen dürfte, ganz ähnlich wie dies auch Jazzgrößen wie John und Alice Coltrane immer gesehen hätten. Sie will mit ihrem Buch den Jazz gegen den Strich bürsten, seine Begriffe, Handlungen, Ausformungen kritisch hinterfragen, und zwar aus der Perspektive aller seiner unterschiedlichen Bedeutungen in musikalischer Ästhetik, Performance, gesellschaftlichem Spiegel, ethnischer Identität oder politischer Haltung. Es gäbe Kollegen, schreibt sie in ihrer Einleitung, die den Jazz als eine polyglotte Form ansähen und damit Gefahr liefen seine Wurzeln in der afro-amerikanischen Kultur zu leugnen. Tatsächlich aber sei die spirituelle Kraft nicht an irgendwelche Identitätsregeln gebunden. Die spirituelle Transzendenz des Jazz brauche keine Abwesenheit ethnischer Identität (“race”), sondern höchstens Abwesenheit solch einer ethnischen Identität (“race”) als Restriktion oder als Prognose.
Tatsächlich handelt ihr Buch allerdings zentral gar nicht von Musik, sondern vom Theater, und hier insbesondere von den drei Theaterautoren Laurie Carlos, Daniel Alexander Jones und Sharon Bridgforth. Jones bedient sich in ihrer Herangehensweisen an das Thema der feministischen und queeren Theorie, erklärt Wirkungen der Theaterperformance aus der Haltung des Jazz heraus und zugleich aus ihrer Interpretation von Yoruba-Traditionen. Als übergeordneten Approach versucht sie ihrem wissenschaftlichen Buch darüber hinaus aber auch improvisatorische Strukturen zu geben, indem sie Bilder, Fotos, Zeichnungen, Zitate einfließen lässt, die wie kurze solistische Kommentare neben ihrem Text stehen.
In ihrer Einleitung zitiert Jones einige Beispiele direkter Bezugnahme von Jazzmusikern wie Dizzy Gillespie und John Coltrane auf Yoruba-Beschwörungen, erinnert außerdem an die lebendige Avantgarde-Theaterszene von Austin, Texas, in der in den 190er Jahren die Verbindungen von Theater und Jazz besonders entwickelt wurden. Im ersten Kapitel betrachtet sie, wie biographische Erfahrungen die drei von ihr untersuchten Autoren prägten, Carlos’ Jugend im New Yorker East Village, Jones’ Aufwachsen im Arbeiterklasse-Milieu von Springfield, Massachusetts, Bridgforths Bustrips durch die verschiedenen Viertel von Los Angeles. Sie analysiert die dem Jazz nahestehenden Praktiken von Lehrer und Schüler im Theater, deren Lernprozesse dabei immer gegenseitig sind. Das zweite Kapitel untersucht Performance-Methoden, Ansätze an Regie, Probenphasen, das Beziehung-Herstellen zum Publikum, die Auswahl der Schauspieler, aber auch das Zulassen spiritueller Erfahrung im Verlauf der Performance. Im dritten Kapitel schließlich fragt sie danach, was die Performance beim Publikum (sie spricht gern von “witnesses” = Zeugen) auslöst, wie sie zu einer Perspektivverschiebung führen kann, einer aktiven Partizipation des Publikums, die das eigentliche Ziel aller Beteiligten sei.
Wenn ich Jones zu Beginn dieser Rezension in die Nähe der “new jazz studies” gestellt habe, so muss ich diese Aussage zumindest zum Teil revidieren. In den New Jazz Studies werden Aspekte des Jazz möglichst von vielen Seiten (und mit unterschiedlichen Methoden) betrachtet. Jones geht den entgegengesetzten Weg: Sie nutzt, was sie vom Jazz gelernt hat, um ihr eigentliches Thema, die Performance im Theater genauer zu definieren. Sie erkennt im Jazz Kommunikations- und Tradierungsmodelle, die so beispielhaft sind, dass sie ein anderes Genre besser verstehen lassen, vielleicht sogar Modell stehen können für neue, weitreichendere Regie- oder Performance-Ansätze. Ihr Buch ist darin so weitsichtig wie der Versuch früherer Literaturwissenschaftler wie Houston Baker, insbesondere den Bereich der afro-amerikanischen Literatur (aber durchaus darüber hinaus) durch die schon von Ralph Ellison oder Albert Murray identifizierte Blues Aesthetic zu beschreiben. Beide nahmen dabei sehr bewusst auf westafrikanische kulturelle Traditionen, Praktiken und Symbole Bezug, für den ungeübten Leser einerseits manchmal etwas schwer nachvollziehbar, gerade dadurch aber die Argumentation auch angenehm schnell aufbrechend und Rückschlüsse erlaubend.
Wenn nämlich die Praxis des Jazz als Erklärungsmodell für andere künstlerische Praktiken taugt, dann wirft das ein ganz anderes Licht auch auf den Stellenwert von Jazz und Improvisation.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
The Long Shadow of the Little Giant. The Life, Work and Legacy of Tubby Hayes
von Simon Spillett
Sheffield 2015 (Equinox)
377 Seiten, 19,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-78179-173-8
 Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Wie Hans Koller oder Lars Gullin war der britische saxophonist Tubby Hayes eine der europäischen Jazzgrößen, die ihren Kollegen genauso wie ihrem Publikum klar machten, dass der Jazz zwar eine afro-amerikanische Musik war, dass aber Europäer das Idiom durchaus beherrschten und ihre eigenen Beiträge zur Tradition des Jazz leisten konnten. Hayes kam aus der Swing-Mainstream-Tradition des Jazz, nahm erst Bebop, Hardbop, schließlich Einflüsse des Spiels John Coltranes in seinen Stil auf und starb 1973, gerademal 38 Jahre alt, in Folge einer Herz-Operation.
Dem Autor und Saxophonisten Simon Spillett gelingt es in seinem Buch “The Long Shadow of the Little Giant” mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews und Material aus Hayes’ persönlichem Archiv das Leben und die musikalische Karriere des Saxophonisten in den Jahren vom bombenerschütterten London der Nachkriegszeit über die jazzigen 1950er Jahre und die Swinging Sixties bis hin zur großen Krise des Jazz Anfang der 1970er Jahre nachzuzeichnen.
Hayes wurde in eine musikalische Familie geboren – sein Vater leitete in den 1930er Jahren verschiedene Tanzorchester, seine Mutter war Revuesängerin und -tänzerin. Schon früh war er vom Saxophon fasziniert, begann aber im Alter von acht Jahren erst einmal mit Geigenunterricht, und bekam schließlich zum elften Geburtstag das langersehnte Saxophon, das er größtenteils autodidaktisch meisterte. Er hatte ein gutes Gehör, und der Geigenunterricht hatte ihn zu einem exzellenten Notisten gemacht. Er hörte Charlie-Parker-Platten und bewegte sich in Kreisen Gleichgesinnter, spielte bald mit Ronnie Scott, Alan Skidmore und Kenny Baker, mit dem er im Juli 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte.
Die Baker Band hatte jede Menge Fans, und die Presse wurde schnell auf Hayes aufmerksam, der bald als “boy wonder tenorist” vermarktet wurde und, noch nicht einmal 20 Jahre alt, mit den Modernisten der britischen Jazzszene spielte. Mit 18 heiratete er zum ersten Mal, hatte schon zuvor alle möglichen Drogen ausprobiert. Er spielte in den populären Bands von Vic Lewis, Jack Parnell, Tony Hall und hatte schließlich auch mit seiner eigenen Band einen vollen Terminkalender.
Spillett beschreibt, wie britische Musiker in jenen Jahren das US-amerikanische Idiom des Hardbop gemeistert hatten, die Musik von Art Blakey und Horace Silver, und wie Kollegen wie Sonny Rollins oder Hank Mobley ihre stilistischen Spuren in Hayes’ Spiel hinterließen. 1958 traten Hayes’ Jazz Couriers neben dem Dave Brubeck Quartet bei einer Tournee durch sechzehn Städte des Vereinigten Königreichs auf; 1959 wurde Hayes vom Melody Maker zum besten Tenorsaxphonisten gewählt.
Andere Musiker hatten die Entwicklung des amerikanischen Jazz genauso interessiert mit verfolgt; und um 1960 kamen erste Versuche “freier Form” auch in England an. Joe Harriott war einer der ersten, die sich an freieren Spielweisen versuchten; Hayes aber blieb skeptisch. Die Eröffnung von Ronnie Scott’s, bis heute einem der wichtigsten Clubs des Königreichs, war sowohl für die Präsenz des amerikanischen Jazz in England wichtig als auch für das Selbstbewusstsein der eigenen Szene. Der BBC schnitt Konzerte mit, und Plattenfirmen widmeten dem heimischen Jazz eigene Alben. 1961 trat Hayes erstmals in New York auf, wo ihn die Größen des amerikanischen Jazz hörten, unter ihnen Zoot Sims, Al Cohn und Miles Davis. Zurück in England erhielt er einerseits eine eigene Fernsehshow, “Tubby Plays Hayes”, hörte er andererseits erstmals John Coltrane, der sein Bild von den Möglichkeiten im Jazz genau wie das vieler anderer Kollegen völlig veränderte.
Als Duke Ellington 1964 in England auftrat, jammte Hayes mit Bandmitgliedern und wurde vom Duke gebeten für Paul Gonsalves einzuspringen, als dieser unpässlich war. In den nächsten Jahren war Hayes international unterwegs, trat im New Yorker Half Note genauso auf wie beim NDR Jazz Workshop in Hamburg. Er arbeitete wie besessen, hatte zugleich gesundheitliche Rückschläge, darunter eine Thrombose, die auch seine Lungenfunktion herabgesetzt hatte.
Ende der 1960er Jahre hatte der britische Jazz zwei Probleme: die Macht der Rockmusik auf der einen Seite und das Verlangen des Publikums nach amerikanischen Künstlern auf der anderen Seite. Hayes erlitt auch persönliche Rückschläge, etwa als seine Freundin starb und er daraufhin noch stärker zu Drogen griff. Er musste wegen Herzproblemen immer häufiger in ärztliche Behandlung, begann aber trotz aller gesundheitlichen Probleme ein musikalisches Comeback. Er spielte mit Musikern der britischen Avantgarde, John Stevens, Trevor Watts, Kenny Wheeler, beteiligte sich bei einem Benefizkonzert für Alan Skidmore, der nach einem Autounfall im Krankenhaus lag, starb aber schließlich nach einer Operation, bei der eine Herzklappe ausgetauscht werden sollte.
“The Long Shadow” heißt das Buch, und so widmet Spillett sein letztes Kapitel der kritischen Aufbereitung seiner musikalischen Bedeutung nach seinem Tod sowie dem Nachwirken Hayes’ auf der britischen Szene. Er schließt mit einer Diskographie die Aufnahmen des Saxophonisten zwischen 1951 bis 1973 verzeichnet.
Simon Spillett hat viel Sorgfalt in seine Recherchen gesteckt. Nebenbei wirft er immer wieder aufschlussreiche Blicke auf die Musik selbst, auf die Aufnahmen, die Hayes’ musikalische Entwicklung dokumentieren. Wenn überhaupt, so mangelt es dem Buch insbesondere in diesem Segment an Tiefe, etwa an Erklärungen, wo sich Einflüsse, ästhetische Umbrüche und anderes konkret festmachen lassen. Eingehend aber beschreibt er den Lebensweg, die persönlichen Probleme, die musikalischen und ästhetischen Entscheidungen und zieht die Verbindungen zu den allgemeinen Entwicklungen des Jazz in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Spillett konnte mit Zeitzeugen sprechen und hatte Zugriff auf Hayes’ persönliche Papiere. Sein Buch ist eine definitive Biographie, die viele Fragen beantwortet und dabei im umfassenden Apparat all die Dokumente benennt, die für eine solche Arbeit notwendig sind.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Musiktraumzimmer Jazzcampus
herausgegeben von Peter Rüedi & Steff Rohrbach
Basel 2015 (Jazzcampus / Echtzeit Verlag)
212 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-905800-78-4
B asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
asels Jazzschule ist zum Jazzcampus geworden, zu einer Hochschule für improvisierte Musik, in der, wie der Titel dieses Buchs suggeriert, jede Menge an Träumen und Visionen wahrgeworden sind. Da ist zuallererst die Vision des Gründers und Gitarristen Bernhard Ley, der erzählt, wie er die Schule in den Räumen eines Jugendkulturzentrums gründete und wie er es dann durch pädagogisches wie politisches Geschick, aber auch durch das Talent der Vernetzung, das die Schule zum Teil des Basler Kulturlebens werden ließ, erreichte, sie zu einem Kompetenzzentrum zu machen, in dem der musikalische Gehalt, die Arbeit von Lehrenden und Schüler/innen, sich auch in der architektonischen Umsetzung spiegelt.
Davon nämlich handelt dieses Buch, vom glücklichen Unterfangen, auf den Grundrissen einer ehemaligen Maschinenfabrik eine Musikschule zu bauen mit all der für eine solche notwendigen Infrastruktur, Club, Konzertsaal, Tonstudio, Probenräume etc. Ein Musiktraumzimmer sei das ganze geworden, eine Raumrealisation also, die dem Thema “Jazz” angemessen sei. Mitgeholfen hätten alle, die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd, der Bauherr Georg Hasler von der Stiftung Levedo sowie Bernhard Ley, der als Studiengangsleiter den zukünftig alltäglichen Gebrauch im Blick behielt. Das Gespräch mit diesen vieren erklärt Fragen der Akustik, Diskussionen im Planungsverlauf, die Außenwirkung genauso wie den inneren Glanz (sprich: Farben, Bodenbeläde, Beleuchtung).
Solch eine theoretische Diskussion lässt sich nur durch Fotos und Raumpläne in Buchform einfangen. Eigentlich gehört Musik dazu, noch wichtiger wäre der tatsächliche Raumeindruck, der aber in der Architektur immer noch einzig durch einen Besuch ermöglicht wird.
Um die tatsächliche musikalische und pädagogische Nutzung der Räume geht es im zweiten, noch umfassenderen Teil des Buchs: um Konzepte der Jazzpädagogik, persönliche Herangehensweisen an Musik, ästhetische Vorstellungen, die Rückwirkung von Unterricht auf die eigene Kunst der unterrichtenden Musiker.
Wolfgang Muthspiel etwa betont, wie wichtig es neben einem festen Lehrerstamm sei, großartige internationale Kollegen als Gastdozenten an die Schule zu holen. Andy Scherrer erzählt, wie er zum Unterrichten wie die Jungfrau zum Kind gekommen sei, und wie er trotz vieler Schüler immer eine gesunde Skepsis gegenüber des Unterrichtens beibehalten habe. Malcolm Braff erklärt, dass er nicht so sehr das Klavier denn vielmehr sich selbst als das wirkliche Instrument empfinde und wie er in den letzten Jahren eine rhythmische Theorie entwickelt habe, die auch Grundlage seines Unterrichts an der Hochschule sei. Lisette Spinnler versteht die Stimme als Instrument und Texte als Ausgangspunkt für musikalische Erkundungen. Adrian Mears plädiert auch beim Lernen für Spielpraxis, egal mit was für Besetzungen. Bänz Oester vertraut auf die Motivation zukünftiger Musiker/innen, auf die Verantwortung für das Selbst, das Eigene. Domenic Landolf mag sich weder verbiegen noch sonderlich in den Vordergrund spielen. Jorge Rossy spricht über die Standards als Basis und über seine Arbeit mit Carla Bley und Steve Swallow. Matthieu Michel überlegt, wie man als junger Musiker neben der Technik vor allem zu einer eigenen Stimme gelangt. Hans Feigenwinter sieht seine analytischen Fähigkeiten als eine Grundlage seines Musikmachens, zugleich aber die Musik auch als laufenden Ansporn, sie analytisch zu begreifen. Gregor Hilbe berichtet über die Bedeutung des Schlagzeugers in einer rhythmischen Kultur, und zugleich über die Idee des Producing / Performance-Studiengangs am Jazzcampus Basel. Daniel Dettmeister hatte die Chance, als Tonmeister selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Aufnahmesaals der Hochschule. Mit Martin Lachmann kommt zum Schluss auch noch der Akustiker selbst zu Wort, der die Räume eingerichtet hat.
Eine bunte Abfolge von Interviews, Reflexionen und Fotos also, die sehr umfassend das Konzept klarmachen, dass hinter dem Jazzcampus Basel steckt: Freiräume schaffen und beste akustische Möglichkeiten. “Musiktraumzimmer Jazzcampus” ist damit zwar vordergründig eine in Buchform gepresste Imagebroschüre der Hochschule, zugleich aber erheblich mehr: ein Manifest für eine Jazzausbildung, in der Kunst und Wirklichkeit, Klang und Akustik, Pädagogik und Freiheit sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
Wolfram Knauer (Juli 2015)
Résume. Eine deutsche Jazz-Geschichte
von Eberhard Weber
Stuttgart 2015 (sagas.edition)
252 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944660-04-2
 Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Der Autor kommt gleich zur Sache: Der Leser wisse ja bereits, dass er, Eberhard Weber, gut 40 Jahre lang als Jazzbassist aktiv war, vielleicht auch, dass er seine aktive Karriere nach einem Schlaganfall 2007 beenden musste. Der Leser wisse wahrscheinlich etliches über seine Karriere, wahrscheinlich auch über den Jazz – was könne er dazu noch beitragen…? Nun, wenn überhaupt, dann könne er aus seinen eigenen Erinnerungen erzählen, sehr persönliche Geschichten, die sich um die Musik drehen, die aber auch sein ästhetisches Weltbild und vieles darüber hinaus berühren. Webers Buch wird so zu seinem “Resumé”. Und es mag vielleicht nicht “die” deutsche Jazzgeschichte sein, aber es ist auf jeden Fall, wie der Untertitel verspricht, “eine deutsche Jazz-Geschichte”, ein Beispiel dafür, wieso ein junger Mann zu dieser Musik kommt, was ihn über all die Jahrzehnte an ihr faszinierte und wie er lernte, in ihr sich selbst auszudrücken.
Eberhard Weber, dem musikalischen Geschichtenerzähler, gelingt der narrative Bogen auch in Worten. Bereits das Eingangskapitel, das vom “Schlag” handelt, der ihn kurz vor einem Konzert mit Jan Garbarek in der Berliner Philharmonie traf, von der Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand, von der Hoffnung, wieder spielen zu können, zeigt seine erzählerischen, auch zur Selbstironie fähigen schriftstellerischen Qualitäten.
Im zweiten Kapitel widmet sich Weber seiner eigenen Vorstellung von Jazz. “Jazz”, schreibt er ironisch, doch nicht ganz falsch, “ist, wenn es der Komponist, der Arrangeur oder der ausführende Musiker dem Hörer so schwer wie möglich macht, der Musik zu folgen – und trotzdem alle Spaß daran haben. Das unterscheidet ihn von der vermeintlich ‘Neuen Musik’.” Doch neben dem Jazz als großer Kunst will Weber in diesem Kapitel auch seiner eigenen Ästhetik auf die Schliche kommen. Wiederholungen, erkennt er, langweilen ihn in der Regel; die Schlüsse von Stücken, findet er, misslingen meist. Er weiß, dass Solisten auch mal ohne Inspiration sein können und weiterspielen müssen. Er weiß auch um seine eigenen Schwächen als Bassist und beschreibt, wie man nur, wenn man um die technischen Probleme des eigenen Spiels oder des eigenen Instruments weiß, diese überkommen und kreativ mit ihnen umgehen könne.
Weber selbst wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater, erzählt er, hatte als Cellist klassische Musik gemacht, daneben aber auch Cello und Banjo im Tanzorchester von Bernard Etté gespielt. Weber kam mitten im Krieg in Esslingen zur Welt. Seine Mutter sang, und “im häuslichen Weber’schen Freundeskreis”, erinnert er sich, “triumphierte Gesang über Instrumentales”– vielleicht eine Vorbereitung auf seine eigene sangliche Haltung beim Instrumentalspiel? Gehörbildung fand im Kinderzimmer statt, wenn seine Schwester und er Automarken am Klang unterschieden und dabei lernten zuzuhören und zu differenzieren. Ein Vetter quartierte sich nach der Kriegsgefangenschaft bei ihnen ein und begann Flöte zu lernen. Man diskutierte über Wagner und spielte Kammermusik. Weber bekam Cellounterricht, dann entdeckte er den Jazz und mit ihm wechselte er zum Kontrabass.
Im Jazz brachte er sich das meiste selbst bei, berichtet von ersten Bühnenerfahrungen, von Stuttgarter Jazzern wie Horst Fischer und Ernst Mosch, vom ersten Einsatz in Erwin Lehns Orchester als Vertretung für dessen regulären Bassisten. Seine musikalische Leidenschaft führte dazu, dass Weber durchs Abitur rasselte, eine Lehre als Fotograf begann und Kameraassistent bei einer Fernsehfirma wurde. Nebenbei spielte er mit gleichaltrigen Musikern, lernte Anfang der 1960er Wolfgang Dauner kennen und wurde bald Mitglied in dessen Trio. Er erzählt von den unterschiedlichsten Auftrittsorten zwischen Nachtclub, Café, Tanz und Ami-Kaserne, von Einflüssen auf sein Bassspiel, davon, wie das Dauner-Trio seinen eigenen Stil fand. Zwischendurch gibt es reichlich Anekdoten, aber auch Einblicke in die technischen Seiten seiner Kunst: Instrumentenwahl, Akustik, Pickups, Verstärker, elektronische Spielereien.
Ende der 1960er Jahre wandten Dauner und Weber sich freieren Spielweisen zu. Weber weiß um seine Beobachtungsgabe, weiß auch, dass er sich gern mal zur Polemik hinreißen lässt. Doch er besitzt eben auch die Erfahrung, Beobachtetes, insbesondere, wenn es um Musik geht, passend einordnen zu können. Und so mag man mit mancher polemischen Äußerung, die seinem eigenen musikalischen Geschmack zuzuschreiben ist, nicht übereinstimmen, wird aber an richtiger Stelle durch ein Augenzwinkern darauf aufmerksam gemacht, dass der Autor zwar eine feste Meinung hat, sich selbst aber auch nicht immer ganz so ernst nimmt.
Weber stand in seiner Karriere bei zwei Plattenfirmen unter Vertrag, die Weltgeltung besaßen, Hans-Georg Brunner Schwers MPS und Manfred Eichers ECM. Er beschreibt die Arbeiten zu “The Colours of Chloë” und den folgenden internationalen Erfolg. Er erzählt vom Zusammenspiel mit Gary Burton, von den Unterschieden zwischen amerikanischen und europäischen Gepflogenheiten in der Jazzszene, von Tourneen mit seiner eigenen Band Colours, durch Deutschland – Ost und West –, die USA und Australien. Er berichtet von seiner Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit dem er auch offizielle Empfänge spielte, bei denen Politiker, Botschafter, Bundespräsidenten, gekrönte Häupter begeistert waren, “endlich mal kein Streichquartett hören zu müssen”.
Eberhard Weber ist ein vielgereister Musiker. Seine Berichte von Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, fasst verpassten Flügen und sonstigen Widrigkeiten sind amüsante Anekdoten, die vor Augen führen, dass das Musikerdasein nicht nur der aus musikalischer Kreativität besteht, die das Publikum erwartet und zumeist auch bekommt. Eine Professur für Musik hatte er nie annehmen wollen. Seine Begründung, die wie ein Tenor seine ungemein flüssige und lesenswerte Autobiographie beendet: “Ich kann nicht Bass spielen. Aber ich weiß, wie’s geht.”
Wolfram Knauer (Juni 2015)
Coltrane sur le Vif
von Luc Bouquet
Nantes 2015 (Lenka Lente)
146 Seiten, 13 Euro
ISBN: 978-2-9545845-8-4
 Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Die Großen des Jazz waren zumeist auch die Meistaufgenommenen, und neben den offiziellen Einspielungen im Studio gehörten über die Jahre Bootlegs dazu, Schwarzpressungen von legalen oder illegalen Mitschnitten, die in mal besserer, mal schlechterer Qualität auf den Markt kamen. Solche Bootlegs haben naturgemäß keine Studioqualität; zum Teil sogar einen unsäglich schlechten Sound. Aber sie sind nicht nur für den Fan, sondern auch für den Experten ein immens wichtiger Teil der Aufnahmegeschichte dieser Musiker. Sie dokumentieren nicht die perfekte Abmischung, sondern den Alltag des Konzerts, in dem das Solo völlig anders klingen kann, in dem die Künstler mit dem Material oder auch mit sich selbst zu kämpfen haben, in dem mal bessere, mal schlechtere Fassungen der großen Titel erklingen, vergleichen mit den auf den im Studio gefertigten Referenzaufnahmen.
Luc Bouquet hatte im französischen Magazin Improjazz eine Reihe über die Liveaufnahmen John Coltranes veröffentlicht und diese jetzt in die zwölf Kapitel des vorliegenden Buchs einfließen lassen. Ein erstes Kapitel beschreibt Coltranes erste Aufnahmen aus dem Jahr 1946 sowie zwei Sessions mit Dizzy Gillespie bzw. Johnny Hodges. Kapitel 2 widmet sich den Jahren 1955-57 und Livemitschnitten mit Miles Davis, Kapitel 3 der Zeit von 1957-58 und den erst jüngst entdeckten und doch schon legendären Aufnahmen Coltranes mit dem Thelonious Monk Quartet. Zwei weitere Miles Davis-Kapitel schließen sich an, 1958-59 in den USA sowie 1960 in Europa, dann beginnt mit Kapitel 6 die Aufnahmegeschichte von Coltranes eigenen Bands: sein klassisches Quartett, Trane und Dolphy, die diversen Besetzungen von 1962, 1963, 1964-65 bis hin zu seiner letzten Liveaufnahme, dem “Olatunji”-Konzert vom April 1967. Jede der Platten wird mit Besetzungs- und Inhaltsangaben gelistet, dazu kommt eine kurze Beschreibung dessen, was auf ihr zu hören ist. Allzu tief versteigt sich Bouquet dabei weder in die Musik noch in die Begleitumstände der Aufnahmen – so wäre etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Entdeckungsgeschichte der Bänder von Tranes Carnegie-Hall-Konzerts mit Thelonious Monk durchaus berichtenswert gewesen.
Bouquets Buch ist als eine Art annotierte Diskographie der Liveaufnahmen John Coltranes ein nützliches Handbuch sowohl beim Hören wie auch bei der Entscheidungsfindung, was man sich vielleicht noch zulegen könnte.
Wolfram Knauer, April 2015[:][:]
 Dennis Pratt und Thom Shaker haben die Jazzliteratur mit diesem Buch um ein biographisches Personenlexikon erweitert, das Musiker:innen listet, die im amerikanischen Bundesstaat Rhode Island geboren oder aktiv sind. Dazu gehören bekannte Namen wie Frankie Carle, Hal Crook, Paul Gonsalves, Bobby Hackett, Scott Hamilton, George Masso, Dave McKenna oder Duke Robillard, daneben zahlreiche Musiker:innen, die wahrscheinlich außerhalb von Rhode Island kaum bekannt sind. Jeder Eintrag enthält eine kurze Biographie, insbesondere das Wer, Wann und Mit Wem, dazu jede Menge Fotos und eine kurze Zusammenfassung der Jazzszene in Rhode Island. Es ist ein auch optisch schönes Buch geworden, das vor allem Jazzfans im Land selbst ansprechen wird, allerdings kaum Informationen über Aufnahmen oder gar den Stil der gelisteten Musiker:innen gibt.
Dennis Pratt und Thom Shaker haben die Jazzliteratur mit diesem Buch um ein biographisches Personenlexikon erweitert, das Musiker:innen listet, die im amerikanischen Bundesstaat Rhode Island geboren oder aktiv sind. Dazu gehören bekannte Namen wie Frankie Carle, Hal Crook, Paul Gonsalves, Bobby Hackett, Scott Hamilton, George Masso, Dave McKenna oder Duke Robillard, daneben zahlreiche Musiker:innen, die wahrscheinlich außerhalb von Rhode Island kaum bekannt sind. Jeder Eintrag enthält eine kurze Biographie, insbesondere das Wer, Wann und Mit Wem, dazu jede Menge Fotos und eine kurze Zusammenfassung der Jazzszene in Rhode Island. Es ist ein auch optisch schönes Buch geworden, das vor allem Jazzfans im Land selbst ansprechen wird, allerdings kaum Informationen über Aufnahmen oder gar den Stil der gelisteten Musiker:innen gibt.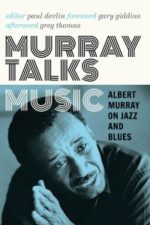 Der 2013 verstorbene Albert Murray war ein bedeutender afro-amerikanischer Philosoph und Kulturtheoretiker, dessen Arbeit und Denken unter anderem Wynton Marsalis nachhaltig beeinflusste, mit dem zusammen er Jazz at Lincoln Center möglich machte. Jazzfans ist er vielleicht am ehesten als Co-Autor der Autobiographie Count Basies bekannt, des 1985 erschienenen Buchs “Good Morning Blues”. Paul Devlin hat nun etliche der Aufsätze und Interviews mit und von Albert Murray in einem Band versammelt, der einen Blick auf die ästhetischen Diskurse der 1980er bis 2000er Jahre gibt, in denen die Bedeutung des Jazz als des kulturellen Gedächtnisses Afro-Amerikas sich mit neuen Konnotationen, aber auch mit neuen Institutionen verfestigte.
Der 2013 verstorbene Albert Murray war ein bedeutender afro-amerikanischer Philosoph und Kulturtheoretiker, dessen Arbeit und Denken unter anderem Wynton Marsalis nachhaltig beeinflusste, mit dem zusammen er Jazz at Lincoln Center möglich machte. Jazzfans ist er vielleicht am ehesten als Co-Autor der Autobiographie Count Basies bekannt, des 1985 erschienenen Buchs “Good Morning Blues”. Paul Devlin hat nun etliche der Aufsätze und Interviews mit und von Albert Murray in einem Band versammelt, der einen Blick auf die ästhetischen Diskurse der 1980er bis 2000er Jahre gibt, in denen die Bedeutung des Jazz als des kulturellen Gedächtnisses Afro-Amerikas sich mit neuen Konnotationen, aber auch mit neuen Institutionen verfestigte. Benjamin Biermans “Listening to Jazz ist eine Jazzgeschichte, die sich an Lehrerinnen und Lehrer richtet sowie an deren Schülerinnen und Schüler, und die dabei nicht bei den “Geschichten” stehenbleibt, die man sonst oft in “textbooks” liest, wie Schulbücher im Englischen genannt werden, sondern tiefer eindringt in die Materie. Bierman nutzt keine Notenbeispiele, wie dies sonst oft und gern getan wird, sondern sogenannte “listening guides” oder “listening focuses”, also kurze textliche Annäherungen, um die Leser/innen durch das Hören konkreter improvisierter Musik zu führen.
Benjamin Biermans “Listening to Jazz ist eine Jazzgeschichte, die sich an Lehrerinnen und Lehrer richtet sowie an deren Schülerinnen und Schüler, und die dabei nicht bei den “Geschichten” stehenbleibt, die man sonst oft in “textbooks” liest, wie Schulbücher im Englischen genannt werden, sondern tiefer eindringt in die Materie. Bierman nutzt keine Notenbeispiele, wie dies sonst oft und gern getan wird, sondern sogenannte “listening guides” oder “listening focuses”, also kurze textliche Annäherungen, um die Leser/innen durch das Hören konkreter improvisierter Musik zu führen.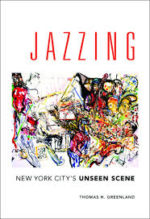 Jazz ist … Musik! Überhaupt ist Musik zuallererst einmal Musik und wenig anderes. Das Publikum erlebt Jazzmusiker in der Regel als Geschöpfe aus einer anderen Welt, als kreative Erfinder, die allabendlich auf der Bühne stehen, um sich jeden Tag auf das Risiko der Improvisation einzulassen, jeden Tag etwas Neues zu spielen. Dass das Musikerdasein sehr viel komplexer ist, dass Musiker in der Regel in eine professionelle genauso wie ehrenamtliche Szene eingebunden sind, zu der die Kollegen genauso gehören wie die Veranstalter, die Kritiker, die Produzenten und das Publikum, darum geht es in Thomas Greenlands Buch “Jazzing. New York City’s Unseen Scene”. Greenland interessieren die Umstände, die das Musikmachen in New York erst ermöglichen, die “Szene”, die den Musikern sowohl Community ist als auch am Diskurs über die musikalische Bedeutung aktueller Projekte mitwirkt.
Jazz ist … Musik! Überhaupt ist Musik zuallererst einmal Musik und wenig anderes. Das Publikum erlebt Jazzmusiker in der Regel als Geschöpfe aus einer anderen Welt, als kreative Erfinder, die allabendlich auf der Bühne stehen, um sich jeden Tag auf das Risiko der Improvisation einzulassen, jeden Tag etwas Neues zu spielen. Dass das Musikerdasein sehr viel komplexer ist, dass Musiker in der Regel in eine professionelle genauso wie ehrenamtliche Szene eingebunden sind, zu der die Kollegen genauso gehören wie die Veranstalter, die Kritiker, die Produzenten und das Publikum, darum geht es in Thomas Greenlands Buch “Jazzing. New York City’s Unseen Scene”. Greenland interessieren die Umstände, die das Musikmachen in New York erst ermöglichen, die “Szene”, die den Musikern sowohl Community ist als auch am Diskurs über die musikalische Bedeutung aktueller Projekte mitwirkt. Ausgerechnet der Jazz wurde in der Tschechoslowakei in der 1980er Jahren als staats- und systemgefährdend angesehen, so sehr, dass das Regime 1987 einen Schauprozess anstrengte, der in langjährigen Haftstrafen für die Vorstandmitglieder der Jazz-Sektion endete. 2016 kuratierte der Historiker Rüdiger Ritter eine Ausstellung über die Jazz-Sektion. Das Begleitbuch zur Ausstellung stellt die Aktivitäten dieser Gruppe von Kulturaktivisten in den Kontext der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung der CSSR in jenen Jahren und dokumentiert damit ein faszinierendes Kapitel europäischer Jazz-, nein europäischer Kulturgeschichte.
Ausgerechnet der Jazz wurde in der Tschechoslowakei in der 1980er Jahren als staats- und systemgefährdend angesehen, so sehr, dass das Regime 1987 einen Schauprozess anstrengte, der in langjährigen Haftstrafen für die Vorstandmitglieder der Jazz-Sektion endete. 2016 kuratierte der Historiker Rüdiger Ritter eine Ausstellung über die Jazz-Sektion. Das Begleitbuch zur Ausstellung stellt die Aktivitäten dieser Gruppe von Kulturaktivisten in den Kontext der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung der CSSR in jenen Jahren und dokumentiert damit ein faszinierendes Kapitel europäischer Jazz-, nein europäischer Kulturgeschichte.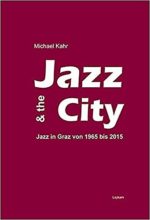 Michael Kahr ist Musiker und Musikwissenschaftler und hat in beiden Funktionen die verschiedenen Einrichtungen der Kunstuniversität Granz besucht und benutzt, die sich mit Jazz beschäftigen, das Institut für Jazz also genauso wie das Institut für Jazzforschung. In seinem Buch “Jazz & the City” setzt er sich mit der Grazer Jazzgeschichte der Gegenwart auseinander und skizziert dabei zugleich den Einfluss einer so ausgewiesenen Jazzausbildung auf die Jazzszene einer Stadt.
Michael Kahr ist Musiker und Musikwissenschaftler und hat in beiden Funktionen die verschiedenen Einrichtungen der Kunstuniversität Granz besucht und benutzt, die sich mit Jazz beschäftigen, das Institut für Jazz also genauso wie das Institut für Jazzforschung. In seinem Buch “Jazz & the City” setzt er sich mit der Grazer Jazzgeschichte der Gegenwart auseinander und skizziert dabei zugleich den Einfluss einer so ausgewiesenen Jazzausbildung auf die Jazzszene einer Stadt. 10. bis 12. Juni 1976: In Leipzig finden zum ersten Mal die Jazztage statt. Helmut Sachse spielt mit seinem Quartett, Ulrich Gumpert mit Günter Sommer im Duo, Luten Petrowski mit Sextet, Manfred Schulzes Ensemble und Synopsis, das spätere Zentralquartett. Es war ein identitätsstiftendes Festival, für die Musiker, die anfangs vor allem unter Landsleuten blieben, dann erste Kontakte in die “sozialistischen Bruderländer” machten und ab 1978 immer auch Musiker aus dem Westen einluden.
10. bis 12. Juni 1976: In Leipzig finden zum ersten Mal die Jazztage statt. Helmut Sachse spielt mit seinem Quartett, Ulrich Gumpert mit Günter Sommer im Duo, Luten Petrowski mit Sextet, Manfred Schulzes Ensemble und Synopsis, das spätere Zentralquartett. Es war ein identitätsstiftendes Festival, für die Musiker, die anfangs vor allem unter Landsleuten blieben, dann erste Kontakte in die “sozialistischen Bruderländer” machten und ab 1978 immer auch Musiker aus dem Westen einluden. Das Nachwort gehört eigentlich an den Beginn der Geschichte: Wie der Grafiker Thomas Rautenberg auf einem Münchner Flohmarkt ein Fotoalbum einer Sängerin vor unterschiedlichen Bands entdeckte und bei dem Händler weitere 500 Fotos und zahlreiche Tonbänder. Wie er, nachdem er eine Produktion über Bert Kaempfert im Fernsehen sah, den Filmemacher ausfindig machte und anschrieb, ob er sich nicht vorstellen könne, das Leben der Inge Brandenburg zu verfilmen. Dieser Filmemacher war Marc Boettcher, und der war nach kurzem fasziniert von der Sängerin, die zu den ganz Großen im deutschen Jazz zählte, aber weitgehend vergessen schien. Den inzwischen mehrfach preisgekrönten Film produzierte er trotz erheblicher Hürden, und weil das Material, das er für die Dokumentation ausgewertet hatte, so viel mehr hergab, entschloss er sich, ein Buch zu schreiben, das die vergessene Inge Brandenburg zumindest zurück auf die Bühne der Erinnerung holt.
Das Nachwort gehört eigentlich an den Beginn der Geschichte: Wie der Grafiker Thomas Rautenberg auf einem Münchner Flohmarkt ein Fotoalbum einer Sängerin vor unterschiedlichen Bands entdeckte und bei dem Händler weitere 500 Fotos und zahlreiche Tonbänder. Wie er, nachdem er eine Produktion über Bert Kaempfert im Fernsehen sah, den Filmemacher ausfindig machte und anschrieb, ob er sich nicht vorstellen könne, das Leben der Inge Brandenburg zu verfilmen. Dieser Filmemacher war Marc Boettcher, und der war nach kurzem fasziniert von der Sängerin, die zu den ganz Großen im deutschen Jazz zählte, aber weitgehend vergessen schien. Den inzwischen mehrfach preisgekrönten Film produzierte er trotz erheblicher Hürden, und weil das Material, das er für die Dokumentation ausgewertet hatte, so viel mehr hergab, entschloss er sich, ein Buch zu schreiben, das die vergessene Inge Brandenburg zumindest zurück auf die Bühne der Erinnerung holt. Jazzfreunde kannten Eric Hobsbawm lange Jahre vor allem unter einem Pseudonym: Als Francis Newton veröffentlichte er 1959 seine Studie “The Jazz Scene”, die den Jazz einmal nicht einzig nach dem gängigen Muster einer klar gegliederten Stilgeschichte beschreibt, sondern daneben Themenfelder wie “Music, Business, People” abdeckt und damit kulturgeschichtliche Ansätze vorlegt, die bis dahin in Bezug auf den Jazz kaum existierten.
Jazzfreunde kannten Eric Hobsbawm lange Jahre vor allem unter einem Pseudonym: Als Francis Newton veröffentlichte er 1959 seine Studie “The Jazz Scene”, die den Jazz einmal nicht einzig nach dem gängigen Muster einer klar gegliederten Stilgeschichte beschreibt, sondern daneben Themenfelder wie “Music, Business, People” abdeckt und damit kulturgeschichtliche Ansätze vorlegt, die bis dahin in Bezug auf den Jazz kaum existierten. Konrad Heiland ist Psychotherapeut, zugleich Autor von Musikfeatures für den Bayerischen Rundfunk. In seinem jüngsten Buch versammelt er Artikel, die sich mit beiden Bereichen seiner Tätigkeit befassen, der Psychotherapie, in der, wie es im Klappentext heißt, “freie Assoziationen fruchtbar gemacht” werden, und dem Jazz, in dem sich “die musikalischen Möglichkeiten gerade durch die Improvisation” entfalten, oder, wie er zusammenfasst: “beide profitieren von kreativer Freiheit innerhalb klarer Strukturen”.
Konrad Heiland ist Psychotherapeut, zugleich Autor von Musikfeatures für den Bayerischen Rundfunk. In seinem jüngsten Buch versammelt er Artikel, die sich mit beiden Bereichen seiner Tätigkeit befassen, der Psychotherapie, in der, wie es im Klappentext heißt, “freie Assoziationen fruchtbar gemacht” werden, und dem Jazz, in dem sich “die musikalischen Möglichkeiten gerade durch die Improvisation” entfalten, oder, wie er zusammenfasst: “beide profitieren von kreativer Freiheit innerhalb klarer Strukturen”. Wenn etwas die Musik des 20sten Jahrhunderts bestimmte, dann die Kategorisierung von Genres. Von Anfang erhielten Schallplatten Empfehlungen dafür, in welcher Abteilung des Plattenladens sie stehen sollten, damit die Kundschaft sie auch gezielt suchen und finden kann. “File under” aber ist eine Schublade, die einbezieht und zugleich ausschließt.
Wenn etwas die Musik des 20sten Jahrhunderts bestimmte, dann die Kategorisierung von Genres. Von Anfang erhielten Schallplatten Empfehlungen dafür, in welcher Abteilung des Plattenladens sie stehen sollten, damit die Kundschaft sie auch gezielt suchen und finden kann. “File under” aber ist eine Schublade, die einbezieht und zugleich ausschließt. Ein großer schwarzer Klecks über einer dicken geschwungenen Linie. Darunter, rot, wie aufgestempelt auf den dicken packpapierfarbenen Umschlag: der Buchtitel. “Brötzmann. Graphic Works 1959-2016”. Reduktion, Abstraktion, Information; Kriterien also, die einen Rahmen geben und zugleich die Fantasie anregen. Peter Brötzmanns grafisches Werk ist das Thema dieses neuen Buchs, das pro Seite mindestens eine Abbildung enthält und nur von kurzen Texten unterbrochen ist. Im ersten dieser Beiträge stellt David Keenan Bezüge zwischen der grafischen Arbeit des Saxophonisten und seiner Musik her. Jost Gebers erinnert sich an ein Plakat fürs Total Music Meeting 1979 mit einem Foto, das Gebers anfangs absurd fand, das sich später aber als das nachgefragteste Poster des Festivals erwies. John Corbett diskutiert Brötzmanns “Design-Konzept” und reißt die Frage an, inwieweit die Wahrnehmung des Musikers nicht auch durch seine bildnerische Kunst geprägt ist, da Brötzmann viele seiner Cover selbst gestalten konnte. Corbett beschreibt außerdem die Designanweisungen, die in der Regel mit den Entwürfen des Saxophonisten kommen. Und er fragt sich, was Brötzmann wohl von den Kopien seiner Entwürfe hält, die er beispielsweise in Klaus Untiets Design der JazzWerkStatt-Cover erkennt (nebenbei: Untiet ist auch für die Gestaltung dieses Buchs zuständig). Lasse Marhaug betont das Spielerische in Brötzmanns bildnerischen Arbeiten. Und im längsten Textbeitrag zum Buch nähert sich Karl Lippegaus erst der Plattencover-Gestaltung im Jazz seit Einführung der Langspielplatte, und erklärt dann, dass Brötzmanns Entwürfe für Platten und Poster durchaus auch die künstlerische Haltung seiner Musik widerspiegeln.
Ein großer schwarzer Klecks über einer dicken geschwungenen Linie. Darunter, rot, wie aufgestempelt auf den dicken packpapierfarbenen Umschlag: der Buchtitel. “Brötzmann. Graphic Works 1959-2016”. Reduktion, Abstraktion, Information; Kriterien also, die einen Rahmen geben und zugleich die Fantasie anregen. Peter Brötzmanns grafisches Werk ist das Thema dieses neuen Buchs, das pro Seite mindestens eine Abbildung enthält und nur von kurzen Texten unterbrochen ist. Im ersten dieser Beiträge stellt David Keenan Bezüge zwischen der grafischen Arbeit des Saxophonisten und seiner Musik her. Jost Gebers erinnert sich an ein Plakat fürs Total Music Meeting 1979 mit einem Foto, das Gebers anfangs absurd fand, das sich später aber als das nachgefragteste Poster des Festivals erwies. John Corbett diskutiert Brötzmanns “Design-Konzept” und reißt die Frage an, inwieweit die Wahrnehmung des Musikers nicht auch durch seine bildnerische Kunst geprägt ist, da Brötzmann viele seiner Cover selbst gestalten konnte. Corbett beschreibt außerdem die Designanweisungen, die in der Regel mit den Entwürfen des Saxophonisten kommen. Und er fragt sich, was Brötzmann wohl von den Kopien seiner Entwürfe hält, die er beispielsweise in Klaus Untiets Design der JazzWerkStatt-Cover erkennt (nebenbei: Untiet ist auch für die Gestaltung dieses Buchs zuständig). Lasse Marhaug betont das Spielerische in Brötzmanns bildnerischen Arbeiten. Und im längsten Textbeitrag zum Buch nähert sich Karl Lippegaus erst der Plattencover-Gestaltung im Jazz seit Einführung der Langspielplatte, und erklärt dann, dass Brötzmanns Entwürfe für Platten und Poster durchaus auch die künstlerische Haltung seiner Musik widerspiegeln. Es sei keine Autobiographie, insistiert Siegfried Schmidt-Joos, angesprochen auf sein jüngstes Buch, das schließlich nur einen Teil seines Lebens beschreibe, von seiner Geburt, 1936 in Gotha, bis zum Beginn seiner Laufbahn bei der ARD, 1960 bei Radio Bremen. Es ist auch keine Jazzgeschichte Deutschlands – dafür ist der Ausschnitt genauso zu knapp. Und doch stimmt beides: Schmidt-Joos begleitete schließlich die Musik des 20sten Jahrhunderts durch eine Vielzahl and Genres und Stilen, und seine Liebe zur Musik war geprägt von seinen Erfahrungen in zwei (und in der Erinnerung sogar drei) Systemen. Diese Erinnerungen prägten seinen Blick auf den Jazz und die populäre Musik. Sein Buch ist damit eine Standortbestimmung im Rückblick, eine bewusst gewählte subjektive Perspektive auf die Stellung des Jazz und seine Rezeption in der DDR und im Westdeutschland der Nachkriegszeit. Und das ist, um es schon vorweg zu sagen, erhellend und lesenswert wie wenig, was bislang über die deutsche Jazzgeschichte geschrieben wurde.
Es sei keine Autobiographie, insistiert Siegfried Schmidt-Joos, angesprochen auf sein jüngstes Buch, das schließlich nur einen Teil seines Lebens beschreibe, von seiner Geburt, 1936 in Gotha, bis zum Beginn seiner Laufbahn bei der ARD, 1960 bei Radio Bremen. Es ist auch keine Jazzgeschichte Deutschlands – dafür ist der Ausschnitt genauso zu knapp. Und doch stimmt beides: Schmidt-Joos begleitete schließlich die Musik des 20sten Jahrhunderts durch eine Vielzahl and Genres und Stilen, und seine Liebe zur Musik war geprägt von seinen Erfahrungen in zwei (und in der Erinnerung sogar drei) Systemen. Diese Erinnerungen prägten seinen Blick auf den Jazz und die populäre Musik. Sein Buch ist damit eine Standortbestimmung im Rückblick, eine bewusst gewählte subjektive Perspektive auf die Stellung des Jazz und seine Rezeption in der DDR und im Westdeutschland der Nachkriegszeit. Und das ist, um es schon vorweg zu sagen, erhellend und lesenswert wie wenig, was bislang über die deutsche Jazzgeschichte geschrieben wurde. Johannes Beringer ist ein Schweizer Publizist, Herausgeber und Übersetzer. Während er meist über Film schrieb, galt seine Leidenschaft nebenbei auch dem Jazz; im vorliegenden selbst-verlegten Band fasst er seine diesbezüglichen “unbeauftragten aber nicht nebenbei” entstandenen Texte zusammen. In fünf Kapiteln lässt er Eindrücke von Aufnahmen, Konzerten, Erlebnissen mit der Musik Revue passieren, eigene, also durchaus autobiographisch lesbare Erfahrungen, gebrochen durch Autoren, die sein Jazzverständnis mit prägen halfen, durch Filme, die sein Bild der Musik beeinflussten, und durch Anekdoten, die verständlich machen, wie sich sein Jazzgeschmack entwickelte.
Johannes Beringer ist ein Schweizer Publizist, Herausgeber und Übersetzer. Während er meist über Film schrieb, galt seine Leidenschaft nebenbei auch dem Jazz; im vorliegenden selbst-verlegten Band fasst er seine diesbezüglichen “unbeauftragten aber nicht nebenbei” entstandenen Texte zusammen. In fünf Kapiteln lässt er Eindrücke von Aufnahmen, Konzerten, Erlebnissen mit der Musik Revue passieren, eigene, also durchaus autobiographisch lesbare Erfahrungen, gebrochen durch Autoren, die sein Jazzverständnis mit prägen halfen, durch Filme, die sein Bild der Musik beeinflussten, und durch Anekdoten, die verständlich machen, wie sich sein Jazzgeschmack entwickelte. “Jazz im Film”, das ist eine ganz eigene Thematik. Es gibt Filme, die das Thema “Jazz” behandeln, Filmbiographien realer oder fiktiver Musiker, Filme, in denen Jazz eine dramaturgische Rolle spielt, oder Filme, die sich vor allem durch ihre Soundtrack als Jazzfilme definieren. Klaus Huckert und Edgar Huckert, die seit langem die Website Jazz im Film betreiben, haben ihr Wissen für eine Sonderausgabe des Filmmagazins “35MM” zusammengefasst.
“Jazz im Film”, das ist eine ganz eigene Thematik. Es gibt Filme, die das Thema “Jazz” behandeln, Filmbiographien realer oder fiktiver Musiker, Filme, in denen Jazz eine dramaturgische Rolle spielt, oder Filme, die sich vor allem durch ihre Soundtrack als Jazzfilme definieren. Klaus Huckert und Edgar Huckert, die seit langem die Website Jazz im Film betreiben, haben ihr Wissen für eine Sonderausgabe des Filmmagazins “35MM” zusammengefasst. Im Februar 2013 fuhr Christian Broecking erstmals nach Zürich, um sich mit Irène Schweizer zu unterhalten. Die Pianistin zeigt sich eher wortkarg; da gäbe es doch ein paar schöne Artikel, sagt sie und gibt Broecking einige Zeitungsausschnitte, mehr bräuchte es doch nicht. Überhaupt, über sie zu erzählen, das könnten andere doch viel besser als sie. In den folgenden Jahren ist Broecking immer wieder bei ihr, und nach und nach öffnet sich Schweizer, erzählt von ihrem langen Musikerleben, daneben aber auch von ihren politischen und gesellschaftlichen Überzeugungen. Zwischendurch trifft sich der Autor mit vielen ihrer Kolleg/innen über die Jahre, fragt sie nach der Pianistin aus, konfrontiert Schweizer dann mit diesen Erinnerungen und gelangt schließlich zu einer umfassenden Biographie, die tatsächlich viel mehr ist: nämlich eine Geschichte des europäischen Jazz seit den 1960er Jahren, erzählt aus der Perspektive eine seiner wichtigsten Protagonistinnen.
Im Februar 2013 fuhr Christian Broecking erstmals nach Zürich, um sich mit Irène Schweizer zu unterhalten. Die Pianistin zeigt sich eher wortkarg; da gäbe es doch ein paar schöne Artikel, sagt sie und gibt Broecking einige Zeitungsausschnitte, mehr bräuchte es doch nicht. Überhaupt, über sie zu erzählen, das könnten andere doch viel besser als sie. In den folgenden Jahren ist Broecking immer wieder bei ihr, und nach und nach öffnet sich Schweizer, erzählt von ihrem langen Musikerleben, daneben aber auch von ihren politischen und gesellschaftlichen Überzeugungen. Zwischendurch trifft sich der Autor mit vielen ihrer Kolleg/innen über die Jahre, fragt sie nach der Pianistin aus, konfrontiert Schweizer dann mit diesen Erinnerungen und gelangt schließlich zu einer umfassenden Biographie, die tatsächlich viel mehr ist: nämlich eine Geschichte des europäischen Jazz seit den 1960er Jahren, erzählt aus der Perspektive eine seiner wichtigsten Protagonistinnen. Ende der 1950er Jahre nahm Irène mit den Modern Jazz Preachers, die Art Blakeys Jazz Messengers nacheiferten, mehrfach am Amateur-Jazz-Festival Zürich teil. Mit ihrem eigenem Trio trat sie ab 1963 auf, wurde bald von der südafrikanischen Exil-Musiker-Szene in Zürich beeinflusst, und wechselte nach und nach vom Amateur- ins Profilager. Schweizer traf auf Peter Brötzmann und Peter Kowald, und sie hörte Cecil Taylor, der sie erst in eine Krise stürzte, letzten Endes aber zur Neubesinnung des eigenen Stils brachte. Sie wurde Teil einer europäischen Free-Music-Szene, wirkte im Kreis um das Label Free Music Production (FMP) mit, spielte auf den großen Festivals von Berlin oder Willisau. 1976 begann sie neben der Ensemblearbeit ihre “Solo-Karriere”, wirkte daneben in Bands und bei Veranstaltungen mit, die der Frauenbewegung nahestanden, etwa der Feminist Improvising Group FIG.
Ende der 1950er Jahre nahm Irène mit den Modern Jazz Preachers, die Art Blakeys Jazz Messengers nacheiferten, mehrfach am Amateur-Jazz-Festival Zürich teil. Mit ihrem eigenem Trio trat sie ab 1963 auf, wurde bald von der südafrikanischen Exil-Musiker-Szene in Zürich beeinflusst, und wechselte nach und nach vom Amateur- ins Profilager. Schweizer traf auf Peter Brötzmann und Peter Kowald, und sie hörte Cecil Taylor, der sie erst in eine Krise stürzte, letzten Endes aber zur Neubesinnung des eigenen Stils brachte. Sie wurde Teil einer europäischen Free-Music-Szene, wirkte im Kreis um das Label Free Music Production (FMP) mit, spielte auf den großen Festivals von Berlin oder Willisau. 1976 begann sie neben der Ensemblearbeit ihre “Solo-Karriere”, wirkte daneben in Bands und bei Veranstaltungen mit, die der Frauenbewegung nahestanden, etwa der Feminist Improvising Group FIG. Rainer Haarmann ist ein Überzeugungstäter. Er gründete und leitete über lange Jahre das Festival Jazz Baltica, mit dem er jedes Jahr die verschlafene schleswig-holsteinische Provinz für ein paar Tage zum Zentrum des internationalen Jazzlebens machte. Nachdem Haarmann Im Sommer 2011 sein letztes Festival leitete, überlegte er, wie es nun weiter gehen könnte. Der Zufall kam ihm zu Hilfe, aber eigentlich war es gar kein Zufall, sondern eher das lange überfällige Zusammenfallen der unterschiedlichen Interessen, die ihn immer schon umtrieben: die Musik, die Bildende Kunst und die Leidenschaft für das Medium der Langspielplatte. Im Herbst 2011 also traf Haarmann zusammen mit der Pianistin Clara Haberkamp bei einer Kunstmesse in Berlin die Malerin Rosilene Ludovico, die ihn auf die Idee brachte, Kunst, Musik und Schallplatte miteinander zu verbinden. Er machte sich mit dem Procedere der Vinyl-Plattenherstellung vertraut und produzierte im Frühjahr 2012 die erste LP der neuen Edition Longplay: “Don Friedman Plays Don Friedman”, aufgenommen bei der letzten von Haarmann verantworteten Jazz Baltica. Es folgen 14 weitere Platten, und ein Ende ist nicht in Sicht.
Rainer Haarmann ist ein Überzeugungstäter. Er gründete und leitete über lange Jahre das Festival Jazz Baltica, mit dem er jedes Jahr die verschlafene schleswig-holsteinische Provinz für ein paar Tage zum Zentrum des internationalen Jazzlebens machte. Nachdem Haarmann Im Sommer 2011 sein letztes Festival leitete, überlegte er, wie es nun weiter gehen könnte. Der Zufall kam ihm zu Hilfe, aber eigentlich war es gar kein Zufall, sondern eher das lange überfällige Zusammenfallen der unterschiedlichen Interessen, die ihn immer schon umtrieben: die Musik, die Bildende Kunst und die Leidenschaft für das Medium der Langspielplatte. Im Herbst 2011 also traf Haarmann zusammen mit der Pianistin Clara Haberkamp bei einer Kunstmesse in Berlin die Malerin Rosilene Ludovico, die ihn auf die Idee brachte, Kunst, Musik und Schallplatte miteinander zu verbinden. Er machte sich mit dem Procedere der Vinyl-Plattenherstellung vertraut und produzierte im Frühjahr 2012 die erste LP der neuen Edition Longplay: “Don Friedman Plays Don Friedman”, aufgenommen bei der letzten von Haarmann verantworteten Jazz Baltica. Es folgen 14 weitere Platten, und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Jazzgeschichte Deutschlands wurde über lange Jahre vor allem von Sammlern und Jazzfans erzählt. Das hat viel für sich, waren doch gerade die Sammler lange Jahre die wirklichen Experten für dieses Thema. Horst H. Lange erstmals 1966 erschienenes Buch “Jazz in Deutschland” war insofern ein Pionierwerk. Wo diese Privatforscher anfangs vor allem auf ihre eigene Sammlung sowie auf Dokumente von Sammlerfreunden zurückgriffen, entwickelte sich über die Jahre und meist in sehr speziellen Sammlergazetten (die britische Zeitschrift “Storyville” ist dafür wahrscheinlich das beste Beispiel) ein weniger persönlicher und dafür historisch-nüchternerer Zugang zur Jazzgeschichte, für den neben den Anekdoten und den diskographischen Angaben auch die Quellenforschung immer wichtiger wurde.
Die Jazzgeschichte Deutschlands wurde über lange Jahre vor allem von Sammlern und Jazzfans erzählt. Das hat viel für sich, waren doch gerade die Sammler lange Jahre die wirklichen Experten für dieses Thema. Horst H. Lange erstmals 1966 erschienenes Buch “Jazz in Deutschland” war insofern ein Pionierwerk. Wo diese Privatforscher anfangs vor allem auf ihre eigene Sammlung sowie auf Dokumente von Sammlerfreunden zurückgriffen, entwickelte sich über die Jahre und meist in sehr speziellen Sammlergazetten (die britische Zeitschrift “Storyville” ist dafür wahrscheinlich das beste Beispiel) ein weniger persönlicher und dafür historisch-nüchternerer Zugang zur Jazzgeschichte, für den neben den Anekdoten und den diskographischen Angaben auch die Quellenforschung immer wichtiger wurde. Großartig! Anders kann man dieses Büchlein nicht preisen. John Corbett schreibt ein Buch nicht etwa über Free Jazz oder freie improvisierte Musik, sondern eine aufmerksame, selbstironische und dabei ungemein nützliche Anleitung, wie man selbst ohne weitere Vorkenntnisse freier Improvisation näher kommen kann. Und seine Anleitung allein öffnet die Ohren und macht neugierig, nicht nur auf die Musik, sondern – eigentlich vor allem – auf das eigene Hören und Hörvermögen, auf die vielen Experimente, die er vorschlägt, um sich des Hörsinns neu zu versichern und sich von den Routinen des gewohnt strukturellen Hörens zu befreien. Und damit ist sein “Listener’s Guide to Free Improvisation” eigentlich viel mehr: nämlich eine Anleitung zum Hören – ganz allgemein!
Großartig! Anders kann man dieses Büchlein nicht preisen. John Corbett schreibt ein Buch nicht etwa über Free Jazz oder freie improvisierte Musik, sondern eine aufmerksame, selbstironische und dabei ungemein nützliche Anleitung, wie man selbst ohne weitere Vorkenntnisse freier Improvisation näher kommen kann. Und seine Anleitung allein öffnet die Ohren und macht neugierig, nicht nur auf die Musik, sondern – eigentlich vor allem – auf das eigene Hören und Hörvermögen, auf die vielen Experimente, die er vorschlägt, um sich des Hörsinns neu zu versichern und sich von den Routinen des gewohnt strukturellen Hörens zu befreien. Und damit ist sein “Listener’s Guide to Free Improvisation” eigentlich viel mehr: nämlich eine Anleitung zum Hören – ganz allgemein! Marco Paysan ist Historiker, Plattensammler und Autor etlicher Aufsätze über die Frühzeit von Jazz und Tanzmusik in Deutschland. Jetzt hat er ein umfassendes Kompendium über Berlin zwischen den Jahren 1920 und 1950 vorgelegt. Das LP-große, durchgängig zweisprachig (deutsch und englisch) gehaltene Buch mit seinen beiheftenden drei CDs will nichts weniger als eine historische Einordnung jener Epoche, in der Jazz noch als Tanzmusik fungierte.
Marco Paysan ist Historiker, Plattensammler und Autor etlicher Aufsätze über die Frühzeit von Jazz und Tanzmusik in Deutschland. Jetzt hat er ein umfassendes Kompendium über Berlin zwischen den Jahren 1920 und 1950 vorgelegt. Das LP-große, durchgängig zweisprachig (deutsch und englisch) gehaltene Buch mit seinen beiheftenden drei CDs will nichts weniger als eine historische Einordnung jener Epoche, in der Jazz noch als Tanzmusik fungierte. Dulfer… Dulfer…. Candy Dulfer? – in Deutschland kennt man seine Tochter besser als ihren Vater. Hans Dulfer aber ist ein in den Niederlanden überaus beliebter und einflussreicher Saxophonist, ein Musiker, der die offenen Ohren unserer holländischen Nachbarn in seiner Musik und in Projekten verkörpert, in denen er seine ursprüngliche Liebe, den Jazz, mit Rock, Soul oder gar Punk verbindet. Nun ist ein schwergewichtiges Buch erschienen, das seine Tochter im Vorwort schlicht “das große Hans Dulfer Buch” nennt, und das ist es fürwahr. 400 schwere Seiten im LP-Format, mehr als 4 cm dick das Ganze, Hochglanzfotos.
Dulfer… Dulfer…. Candy Dulfer? – in Deutschland kennt man seine Tochter besser als ihren Vater. Hans Dulfer aber ist ein in den Niederlanden überaus beliebter und einflussreicher Saxophonist, ein Musiker, der die offenen Ohren unserer holländischen Nachbarn in seiner Musik und in Projekten verkörpert, in denen er seine ursprüngliche Liebe, den Jazz, mit Rock, Soul oder gar Punk verbindet. Nun ist ein schwergewichtiges Buch erschienen, das seine Tochter im Vorwort schlicht “das große Hans Dulfer Buch” nennt, und das ist es fürwahr. 400 schwere Seiten im LP-Format, mehr als 4 cm dick das Ganze, Hochglanzfotos. Full disclosure vorneweg: Dies ist natürlich keine Buchbesprechung, sondern parteiische Werbung. Wir sind stolz auf die jüngste Publikation in der vom Jazzinstitut herausgegebenen Reihe “Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung”, die wie immer das letzte Darmstädter Jazzforum dokumentiert. Als Thema hatten wir uns im Oktober 2015 “Gender und Identität im Jazz” vorgenommen und dazu Referent/innen eingeladen, um das Thema von möglichst unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten.
Full disclosure vorneweg: Dies ist natürlich keine Buchbesprechung, sondern parteiische Werbung. Wir sind stolz auf die jüngste Publikation in der vom Jazzinstitut herausgegebenen Reihe “Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung”, die wie immer das letzte Darmstädter Jazzforum dokumentiert. Als Thema hatten wir uns im Oktober 2015 “Gender und Identität im Jazz” vorgenommen und dazu Referent/innen eingeladen, um das Thema von möglichst unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten.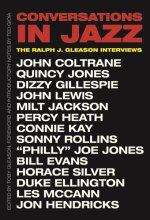 Ralph Gleason gehört zu den Legenden der amerikanischen Jazzkritik. Früh entdeckte er, dass die neuen Medien, also Rundfunk und Fernsehen, zu mehr taugten als die Musik “nur” zu spielen. In der inzwischen auf DVD wiederveröffentlichten Fernsehserie “Jazz Casual” bittet er die Musiker zwischendrin zum Gespräch, um mit ihnen über ihre Erfahrungen, aber auch die Besonderheit ihres eigenen Stils zu sprechen. In diesem Buch versammelt Ted Gioia aus dem Nachlass Gleasons vierzehn Interviews, die dieser in erster Linie aus persönlichem Interesse führte, die meisten in seinem Haus in Berkeley bei San Francisco. Alle Interviews stammen aus den Jahren 1959 bis 1961, einer Zeit also, in welcher der Jazz sich im Wandel befand. Gioia versieht jedes der Interviews mit einer kurzen Einleitung, die das folgende Gespräch kontextualisiert.
Ralph Gleason gehört zu den Legenden der amerikanischen Jazzkritik. Früh entdeckte er, dass die neuen Medien, also Rundfunk und Fernsehen, zu mehr taugten als die Musik “nur” zu spielen. In der inzwischen auf DVD wiederveröffentlichten Fernsehserie “Jazz Casual” bittet er die Musiker zwischendrin zum Gespräch, um mit ihnen über ihre Erfahrungen, aber auch die Besonderheit ihres eigenen Stils zu sprechen. In diesem Buch versammelt Ted Gioia aus dem Nachlass Gleasons vierzehn Interviews, die dieser in erster Linie aus persönlichem Interesse führte, die meisten in seinem Haus in Berkeley bei San Francisco. Alle Interviews stammen aus den Jahren 1959 bis 1961, einer Zeit also, in welcher der Jazz sich im Wandel befand. Gioia versieht jedes der Interviews mit einer kurzen Einleitung, die das folgende Gespräch kontextualisiert. Der vor drei Jahren erschienene erste Band von “American Jazz Heroes” war bereits ein großer Wurf: Einer der renommiertesten deutschen Jazzfotografen fährt zu Musikerlegenden in die USA, um sie in ihrem heimischen Umfeld abzulichten und zu interviewen. Die begeisterten Rezensionen animierten Arne Reimer dazu, ein zweites Buch nachzuschieben. Wieder machte er sich auf in die USA, reiste von der Ost- bis zur Westküste, vom hohen Norden bis in den tiefen Süden und bringt seinen Lesern eine Sammlung der wohl menschlichsten Einblicke in die Welt all dieser Jazzlegenden mit, wie sie in der Jazzliteratur so bislang nirgends zu finden ist. Die Portraits der Musiker in ihrer vertrauten Umgebung stehen im Vordergrund, daneben aber gibt es reichlich atmosphärische Eindrücke, von Haus oder Wohnung, von Musikecken, Plattensammlungen, von Menschen, für die Musik zwar im Mittelpunkt ihres Wirkens steht, die darüber hinaus aber ein Leben wie jeder andere führen, die in ihrer Karriere mal mehr, mal weniger erfolgreich waren, sich ganz unterschiedliche Lebensstandards erarbeiten konnten, die mal optimistisch, mal frustriert auf die komplexe Gegenwart reagieren.
Der vor drei Jahren erschienene erste Band von “American Jazz Heroes” war bereits ein großer Wurf: Einer der renommiertesten deutschen Jazzfotografen fährt zu Musikerlegenden in die USA, um sie in ihrem heimischen Umfeld abzulichten und zu interviewen. Die begeisterten Rezensionen animierten Arne Reimer dazu, ein zweites Buch nachzuschieben. Wieder machte er sich auf in die USA, reiste von der Ost- bis zur Westküste, vom hohen Norden bis in den tiefen Süden und bringt seinen Lesern eine Sammlung der wohl menschlichsten Einblicke in die Welt all dieser Jazzlegenden mit, wie sie in der Jazzliteratur so bislang nirgends zu finden ist. Die Portraits der Musiker in ihrer vertrauten Umgebung stehen im Vordergrund, daneben aber gibt es reichlich atmosphärische Eindrücke, von Haus oder Wohnung, von Musikecken, Plattensammlungen, von Menschen, für die Musik zwar im Mittelpunkt ihres Wirkens steht, die darüber hinaus aber ein Leben wie jeder andere führen, die in ihrer Karriere mal mehr, mal weniger erfolgreich waren, sich ganz unterschiedliche Lebensstandards erarbeiten konnten, die mal optimistisch, mal frustriert auf die komplexe Gegenwart reagieren. Uwe Ladwig hat die 4. Auflage seines Saxophon-Kompendiums veröffentlicht. Im Vergleich zur ersten Auflage wurden alle Artikel überarbeitet und zum Teil neu angeordnet. Insbesondere die Geschichte einzelner Saxophonbauer wurde ergänzt; neu sind zusätzliche Kapitel zum Saxophonbau in Rumänien und den Niederlanden. Außerdem enthält die neue Auflage eine CD mit Klangbeispielen vom Sopranino bis zum Subkontrabasssaxophon, vom Couenophone in C und dem Slide-Saxophon.
Uwe Ladwig hat die 4. Auflage seines Saxophon-Kompendiums veröffentlicht. Im Vergleich zur ersten Auflage wurden alle Artikel überarbeitet und zum Teil neu angeordnet. Insbesondere die Geschichte einzelner Saxophonbauer wurde ergänzt; neu sind zusätzliche Kapitel zum Saxophonbau in Rumänien und den Niederlanden. Außerdem enthält die neue Auflage eine CD mit Klangbeispielen vom Sopranino bis zum Subkontrabasssaxophon, vom Couenophone in C und dem Slide-Saxophon. In den 1980er Jahren war Martin Feldmann immer wieder in den USA unterwegs. seit einigen Jahren stellt er aus den Blues-Erkundungen seiner Reisen Fotokalender zusammen, die den Blues als eine Musik des schwarzen Amerikas dokumentieren. Der vierte Kalender dieser Art zeigt für 2016 zwölf Fotos von der Maxwell Street sowie vor Blues-Clubs in der South und der West Side Chicagos. der exzentrische Tänzer und Sänger Muck Muck Man ist dabei, J.B. Hutto, Andrew Odom , Jimmy Davis, Little Pat Rushing, John Hendry Davis Jr. sowie weitere, unbekannte Musiker und wichtige Sites der so bedeutenden Chicagoer Bluesszene.
In den 1980er Jahren war Martin Feldmann immer wieder in den USA unterwegs. seit einigen Jahren stellt er aus den Blues-Erkundungen seiner Reisen Fotokalender zusammen, die den Blues als eine Musik des schwarzen Amerikas dokumentieren. Der vierte Kalender dieser Art zeigt für 2016 zwölf Fotos von der Maxwell Street sowie vor Blues-Clubs in der South und der West Side Chicagos. der exzentrische Tänzer und Sänger Muck Muck Man ist dabei, J.B. Hutto, Andrew Odom , Jimmy Davis, Little Pat Rushing, John Hendry Davis Jr. sowie weitere, unbekannte Musiker und wichtige Sites der so bedeutenden Chicagoer Bluesszene. Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.
Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet. Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.
Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre. Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.
Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten. Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.
Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.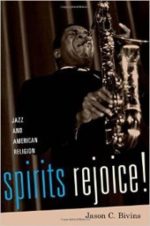 Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.
Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker. Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.
Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.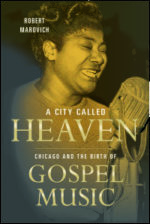 Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.
Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte. 2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.
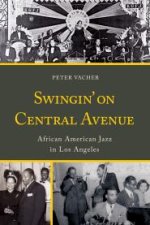
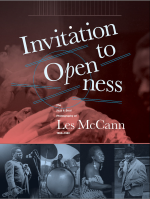 Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.
Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird. ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.
ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte. Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.
Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen. Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.
Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.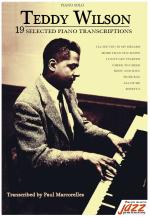 Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.
Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören. Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.
 Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht.
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat nach den ersten beiden Auflagen von 2005 und 2009 nun den dritten Band seiner Trompeterbibel vorgelegt, ein sorgfältig recherchiertes Kompendium, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet und dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht. Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.
Einen ersten Hinweis auf den Inhalt dieses Buchs gibt bereits der Preis: 25,55 Euro, entsprechend einem Cent pro Nacht im legendären Club, wie Holger Jass in der Presseankündigung zum Buch erklärt. Holger Jass hatte das Onkel Pö (Onkel Pö’s Carnegie Hall, wie es damals offiziell hieß) Anfang 1979 vom Vorbesitzer Peter Marxen übernommen, der ihn bei der Übergabe warnte: “Ich muss dich warnen. Pö-Jahre sind wie Hundejahre. Die zählen siebenfach.” Jass hielt es bis Anfang 1986 aus, führte das “Pö” im Sinne seines Kultstatus’ weiter und hat jetzt ein kurzweilig-amüsantes Buch über seine Erlebnisse mit Musikern, Medienmenschen, Kollegen und dem Publikum geschrieben, das ihm die ganzen Jahre über treu blieb, aus dessen Reihen sich aber partout kein Interessent für eine Nachfolge finden ließ.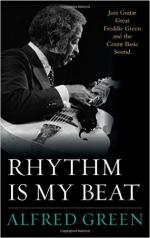 Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
Count Basies All American Rhythm Section gilt als die swingendste Rhythmusgruppe des Jazz. Die Art, wie Pianist Basie, Gitarrist Freddie Green, Bassist Walter Page und Schlagzeuger Jo Jones rhythmisch und harmonisch ineinandergriffen, um den vorwärtstreibenden Schwung zu schaffen, der zu ihrem Markenzeichen wurde, besaß so viel an Energie, dass Rhythmusgruppen überall auf der Welt sie zum Vorbild nahmen. Den wichtigsten Anteil an dieser Energie hatte, wie Basie selbst, aber auch zahllose andere Musiker bezeugen, Freddie Green, der dem Count Basie Orchester von 1937 bis zu Basies Tod im Jahr 1983 und der Band noch ein paar Jahre danach bis zu seinem eigenen Tod 1987 angehörte. Von Nichtmusikern wurde Green schon mal dafür bemitleidet, ein ganzes Leben lang nie ein wirkliches Solo gespielt, dafür immer nur “schrumm schrumm” gemacht zu haben, vier Schläge pro Takt, durchgehend vom ersten Akkord bis zum letzten; und doch ist ihm jemand kaum in der Kunst des Rhythmus nahegekommen, den dieser Vierschlag erzeugen konnte.
 Keith Jarrett. A Biography
Keith Jarrett. A Biography
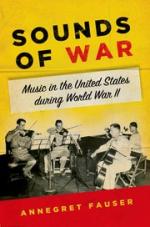
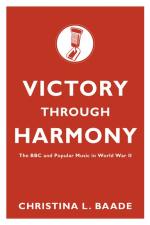

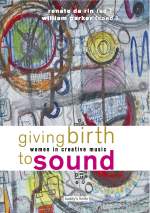
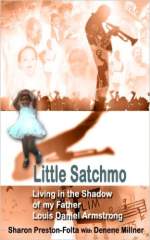






 Die Herausgeber dieses Bandes und Mitorganisatoren des Symposiums haben aus Referaten, die bei der Jahrestagung der Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung im Oktober 2011 gehalten wurden sowie weiterführenden Artikeln von Autoren, die in Kiel nicht dabei sein konnten, eine facettenreiche Dokumentation über die Funktion von Jazz im Film auf der einen Seite und seine Repräsentation auf der anderen Seite vorgelegt. In ihrer Einleitung verweisen sie auf die verschiedenen Situationen, in denen Jazz mit der Leinwand in Verbindung tritt, auf die Stummfilmbegleitung etwa, auf Musik-Kurz- und Animationsfilme, auf die Verbindung von Jazz und Experimentalfilmen, auf Dokumentar- und Konzertfilme, auf den Jazz im Live-Fernsehen, auf Jazz als Soundtrack, sowie auf Biopics und auf “Scenopics”, die die Jazzwelt als Thema nimmt.
Die Herausgeber dieses Bandes und Mitorganisatoren des Symposiums haben aus Referaten, die bei der Jahrestagung der Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung im Oktober 2011 gehalten wurden sowie weiterführenden Artikeln von Autoren, die in Kiel nicht dabei sein konnten, eine facettenreiche Dokumentation über die Funktion von Jazz im Film auf der einen Seite und seine Repräsentation auf der anderen Seite vorgelegt. In ihrer Einleitung verweisen sie auf die verschiedenen Situationen, in denen Jazz mit der Leinwand in Verbindung tritt, auf die Stummfilmbegleitung etwa, auf Musik-Kurz- und Animationsfilme, auf die Verbindung von Jazz und Experimentalfilmen, auf Dokumentar- und Konzertfilme, auf den Jazz im Live-Fernsehen, auf Jazz als Soundtrack, sowie auf Biopics und auf “Scenopics”, die die Jazzwelt als Thema nimmt. Jackie McLean war irgendwie zeitlebens ein “musicians’ musician”, ein Musiker, der unter Kollegen bekannt, beliebt und einflussreich war und doch außer einem Kennerpublikum eher mäßigen populären Erfolg hatte. In seiner Biographie spürt Guillaume Belhomme dem Leben und Schaffen des Saxophonisten nach, identifiziert Einflüsse auf ihn und erklärt die Bedeutung seines musikalischen Schaffens. Wie Sonny Rollins spielte McLean Ende der 1940er Jahre kurzzeitig mit dem Gedanken, vom Altsaxophon, das durch Charlie Parkers Wirken doch sehr vorbelastet war, auf ein anderes Instrument umzusteigen, und tatsächlich machte er, wie wir lernen, seine erste Aufnahme 1949 mit einer Rhythm-and-Blues-Band auf dem Baritonsaxophon.
Jackie McLean war irgendwie zeitlebens ein “musicians’ musician”, ein Musiker, der unter Kollegen bekannt, beliebt und einflussreich war und doch außer einem Kennerpublikum eher mäßigen populären Erfolg hatte. In seiner Biographie spürt Guillaume Belhomme dem Leben und Schaffen des Saxophonisten nach, identifiziert Einflüsse auf ihn und erklärt die Bedeutung seines musikalischen Schaffens. Wie Sonny Rollins spielte McLean Ende der 1940er Jahre kurzzeitig mit dem Gedanken, vom Altsaxophon, das durch Charlie Parkers Wirken doch sehr vorbelastet war, auf ein anderes Instrument umzusteigen, und tatsächlich machte er, wie wir lernen, seine erste Aufnahme 1949 mit einer Rhythm-and-Blues-Band auf dem Baritonsaxophon. Dave Gelly ist Autor von Biographien etwa über Stan Getz und Lester Young, schreibt für britische Fachzeitschriften und Tageszeitungen und moderierte eine wöchentliche Rundfunksendung im BBC. Der Untertitel seines neuestes Buchs liest sich, als handele es sich dabei um eine soziologische Studie über “den Jazz in Großbritannien und sein Publikum” in der Nachkriegszeit. Tatsächlich besteht das Publikum, das Gelly meint, zu einem großen Teil auch aus britischen Musikern. Gelly berichtet von den unterschiedlichen Weisen, auf die diese mit dem Jazz in Berührung kamen, in Clubs und bei Tanzveranstaltungen, im Rundfunk, in der Armee, in halb-öffentlichen Expertenzirkeln oder bei Tourneen der amerikanischen Heroen, für die London allein der mangelnden Sprachbarriere wegen immer einer der ersten und wichtigsten Anlaufpunkte war.
Dave Gelly ist Autor von Biographien etwa über Stan Getz und Lester Young, schreibt für britische Fachzeitschriften und Tageszeitungen und moderierte eine wöchentliche Rundfunksendung im BBC. Der Untertitel seines neuestes Buchs liest sich, als handele es sich dabei um eine soziologische Studie über “den Jazz in Großbritannien und sein Publikum” in der Nachkriegszeit. Tatsächlich besteht das Publikum, das Gelly meint, zu einem großen Teil auch aus britischen Musikern. Gelly berichtet von den unterschiedlichen Weisen, auf die diese mit dem Jazz in Berührung kamen, in Clubs und bei Tanzveranstaltungen, im Rundfunk, in der Armee, in halb-öffentlichen Expertenzirkeln oder bei Tourneen der amerikanischen Heroen, für die London allein der mangelnden Sprachbarriere wegen immer einer der ersten und wichtigsten Anlaufpunkte war.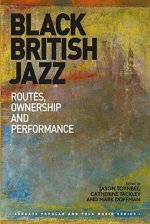 Im Vorwort zu “Black British Jazz” skizzieren die Herausgeber fünf prägende Momente in dieser Geschichte: (1.) die Tournee des Southern Syncopated Orchestra 1919 in England, das dem Land zum ersten Mal das Bewusstsein brachte, dass es da eine aus schwarzer Ästhetik geborene neue Musikrichtung gab; (2.) eine Musikszene um Musiker aus Jamaika und anderen karibischen Ländern, die oft genug ihre Instrumente in den Militärkapellen der Kolonialherren gelernt hatten; (3.) die Bebopszene im London der 1950er Jahre, die deutlich das schwarze Element der Improvisation in den Vordergrund stellte; (4.) die Anwesenheit südafrikanischer Expatriates in den 1960er Jahren, sowie (5.) das Erwachen eines auch politischen afro-britischen Bewusstseins spätestens in den 1980er Jahren.
Im Vorwort zu “Black British Jazz” skizzieren die Herausgeber fünf prägende Momente in dieser Geschichte: (1.) die Tournee des Southern Syncopated Orchestra 1919 in England, das dem Land zum ersten Mal das Bewusstsein brachte, dass es da eine aus schwarzer Ästhetik geborene neue Musikrichtung gab; (2.) eine Musikszene um Musiker aus Jamaika und anderen karibischen Ländern, die oft genug ihre Instrumente in den Militärkapellen der Kolonialherren gelernt hatten; (3.) die Bebopszene im London der 1950er Jahre, die deutlich das schwarze Element der Improvisation in den Vordergrund stellte; (4.) die Anwesenheit südafrikanischer Expatriates in den 1960er Jahren, sowie (5.) das Erwachen eines auch politischen afro-britischen Bewusstseins spätestens in den 1980er Jahren. “Black Popular Music in Britain since 1945” verfolgt einen stilistisch breiteren Ansatz. Hier fragt Catherine Tackley etwa nach der nationalen Identität west-indischer Musiker, die sich selbst als britische Jazzmusiker verstanden und wohl auch waren, weil die spezifische Art von Musik, die sie machten, nur in der Londoner Szene sich entwickeln konnte. Jon Stratton untersucht den Einfluss afrikanischer Musik sowie der Tourneen afro-amerikanischer Bluesmusiker in den 1950er und 1960er Jahre auf die britische Musikszene. Markus Coester hinterfragt die Klischees, die in der musikalischen Mode des “Afro Trend” der 1960er und 1970er Jahre zu finden sind, ästhetische Stereotype irgendwo zwischen Authentizität, Diversität und Happiness.
“Black Popular Music in Britain since 1945” verfolgt einen stilistisch breiteren Ansatz. Hier fragt Catherine Tackley etwa nach der nationalen Identität west-indischer Musiker, die sich selbst als britische Jazzmusiker verstanden und wohl auch waren, weil die spezifische Art von Musik, die sie machten, nur in der Londoner Szene sich entwickeln konnte. Jon Stratton untersucht den Einfluss afrikanischer Musik sowie der Tourneen afro-amerikanischer Bluesmusiker in den 1950er und 1960er Jahre auf die britische Musikszene. Markus Coester hinterfragt die Klischees, die in der musikalischen Mode des “Afro Trend” der 1960er und 1970er Jahre zu finden sind, ästhetische Stereotype irgendwo zwischen Authentizität, Diversität und Happiness. Eine besondere Facette des britischen Jazz stellt die Canterbury Scene der 1960er Jahre dar, eine musikalische Haltung, die sich aus einem Musikerkreis um Daevid Allen, Hugh Hopper und Robert Wyatt entwickelte, die ihrerseits mit der Verbindung experimenteller Rock- und experimenteller Jazzmusik experimentierten. Bands wie Soft Machine, Caravan, Henry Cow, Hatfield and the North und andere waren selbst in den 1970er Jahren nur Eingeweihten bekannt, sind aber für das Verständnis der Rock- und auch der Jazzentwicklung unverzichtbar, fügten sie doch, wie Bernward Halbscheffel im Vorwort seines Buchs zur “Canterbury Scene” schreibt, “dem Jazz der 1980er und 1990er Jahre einige europäische Farben hinzu”.
Eine besondere Facette des britischen Jazz stellt die Canterbury Scene der 1960er Jahre dar, eine musikalische Haltung, die sich aus einem Musikerkreis um Daevid Allen, Hugh Hopper und Robert Wyatt entwickelte, die ihrerseits mit der Verbindung experimenteller Rock- und experimenteller Jazzmusik experimentierten. Bands wie Soft Machine, Caravan, Henry Cow, Hatfield and the North und andere waren selbst in den 1970er Jahren nur Eingeweihten bekannt, sind aber für das Verständnis der Rock- und auch der Jazzentwicklung unverzichtbar, fügten sie doch, wie Bernward Halbscheffel im Vorwort seines Buchs zur “Canterbury Scene” schreibt, “dem Jazz der 1980er und 1990er Jahre einige europäische Farben hinzu”. Wenn ein Musiker den Weg des Jazz nach Europa symbolisiert, dann ist es Sidney Bechet. Der Klarinettist und Sopransaxophonist kam 1919 zum ersten Mal in die “Alte Welt”, als er mit dem Southern Syncopated Orchestra hier tourte. Bei einem Konzert in Lausanne beeindruckte sein Klarinettensolo über den Blues den klassischen Dirigenten Ernest Ansermet so sehr, dass dieser eine viel zitierte Kritik in der “Revue Romande” verfasste, die erste ernsthafte Würdigung eines Jazzsolisten überhaupt. Mit einem Faksimile dieser Kritik beginnt das Buch “Sidney Bechet in Switzerland”, das akribisch – und zweisprachig, also auf Englisch und Französisch – Bechets Besuche in der Schweiz von 1919 bis 1958 dokumentiert.
Wenn ein Musiker den Weg des Jazz nach Europa symbolisiert, dann ist es Sidney Bechet. Der Klarinettist und Sopransaxophonist kam 1919 zum ersten Mal in die “Alte Welt”, als er mit dem Southern Syncopated Orchestra hier tourte. Bei einem Konzert in Lausanne beeindruckte sein Klarinettensolo über den Blues den klassischen Dirigenten Ernest Ansermet so sehr, dass dieser eine viel zitierte Kritik in der “Revue Romande” verfasste, die erste ernsthafte Würdigung eines Jazzsolisten überhaupt. Mit einem Faksimile dieser Kritik beginnt das Buch “Sidney Bechet in Switzerland”, das akribisch – und zweisprachig, also auf Englisch und Französisch – Bechets Besuche in der Schweiz von 1919 bis 1958 dokumentiert. Im Vorwort zu dieser Biographie des Schlagzeugers Mel Lewis betont John Mosca, dass dem einen oder anderen vielleicht bewusst sein mag, wie wichtig ein Drummer für die Energie einer Bigband ist, dass er selbst allerdings, als er Lewis zum ersten Mal hörte, vor allem beeindruckt davon war, was Lewis entschied NICHT zu spielen. Mosca erwähnt auch, dass, wenn das vorliegende Buch zwar eine Biographie Mel Lewis’ sei, man die beiden Partner der Thad Jones / Mel Lewis Big Band immer zusammen denken müsse, weil sie beide das Talent des jeweils anderen so gut komplementierten, und dass man insbesondere an ihrer Zusammenarbeit die Größe eines jeden einzelnen erkenne.
Im Vorwort zu dieser Biographie des Schlagzeugers Mel Lewis betont John Mosca, dass dem einen oder anderen vielleicht bewusst sein mag, wie wichtig ein Drummer für die Energie einer Bigband ist, dass er selbst allerdings, als er Lewis zum ersten Mal hörte, vor allem beeindruckt davon war, was Lewis entschied NICHT zu spielen. Mosca erwähnt auch, dass, wenn das vorliegende Buch zwar eine Biographie Mel Lewis’ sei, man die beiden Partner der Thad Jones / Mel Lewis Big Band immer zusammen denken müsse, weil sie beide das Talent des jeweils anderen so gut komplementierten, und dass man insbesondere an ihrer Zusammenarbeit die Größe eines jeden einzelnen erkenne.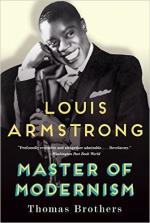 Dieses Buch ist bereits das dritte, das Thomas Brothers über Louis Armstrong geschrieben hat. In “Louis Armstrong. In His Own Words” legte er eine Dokumentation diverser Korrespondenzen und selbstverfasster Manuskripte des Vielschreibers und Trompeters vor, In “Louis Armstong’s New Orleans” portraitierte er Satchmos Jugendjahre in seiner Heimatstadt. Mit “Louis Armstrong. Master of Modernism” erfährt letzteres Buch nun eine Art Fortsetzung, in der Brothers vor allem Armstrongs Aktivitäten in den 1920er Jahren betrachtet. Er verfolgt dabei die Zusammenarbeit Armstrongs mit King Oliver’s Creole Jazz Band, die Ausbildung eines eigenen Stils, den Brothers als “modernen Stil” bezeichnet und Armstrong damit zu einem “Meister der Moderne” kürt und in eine Reihe mit anderen Ausprägungen der Moderne stellt, Erfindungen der frühen Unterhaltungsindustrie genauso wie einer wachsenden Distanz zum sittenstrengen Konventionen des Viktorianismus. Armstrong aber, so Brothers, erfand nicht nur einen, sondern gleich zwei moderne Kunstformen, von denen eine vor allem auf sein schwarzes Publikum, die andere an den Mainstream-Markt der weißen Fans gerichtet war. Er veränderte die traditionellen Herangehensweisen ans Zusammenspiel in der Band, und er wandte Methoden des Showbusiness auf die Musik an und beeinflusste damit den Jazz als Kunstrichtung, daneben aber auch die Musik ganz allgemein nachhaltig. Mit dieser Interpretation von Armstrongs Kunst als einem großen Beitrag zur intellektuellen Kulturgeschichte des 20sten Jahrhunderts will Brothers ganz bewusst von jenen im Rassismus der Vereinigten Staaten begründeten Lesarten abrücken, die das Bild eines ungelernten Musikers hochhalten, der nicht viel über das nachdenke, was er da spiele, sondern stattdessen einfach intuitiv Musik macht. Für Armstrongs Kunst, schreibt Brothers, war eine künstlerische Disziplin notwendig, die der eines Beethoven, Strawinsky usw. in nichts nachstünde. Zur Akzeptanz dieser Seite der Moderne gehöre aber auch zu verstehen, dass sich Armstrongs Kreativität zuallererst in seiner Kunst ausdrückte und damit einen nicht-verbalen Diskurs der Moderne wiedergebe.
Dieses Buch ist bereits das dritte, das Thomas Brothers über Louis Armstrong geschrieben hat. In “Louis Armstrong. In His Own Words” legte er eine Dokumentation diverser Korrespondenzen und selbstverfasster Manuskripte des Vielschreibers und Trompeters vor, In “Louis Armstong’s New Orleans” portraitierte er Satchmos Jugendjahre in seiner Heimatstadt. Mit “Louis Armstrong. Master of Modernism” erfährt letzteres Buch nun eine Art Fortsetzung, in der Brothers vor allem Armstrongs Aktivitäten in den 1920er Jahren betrachtet. Er verfolgt dabei die Zusammenarbeit Armstrongs mit King Oliver’s Creole Jazz Band, die Ausbildung eines eigenen Stils, den Brothers als “modernen Stil” bezeichnet und Armstrong damit zu einem “Meister der Moderne” kürt und in eine Reihe mit anderen Ausprägungen der Moderne stellt, Erfindungen der frühen Unterhaltungsindustrie genauso wie einer wachsenden Distanz zum sittenstrengen Konventionen des Viktorianismus. Armstrong aber, so Brothers, erfand nicht nur einen, sondern gleich zwei moderne Kunstformen, von denen eine vor allem auf sein schwarzes Publikum, die andere an den Mainstream-Markt der weißen Fans gerichtet war. Er veränderte die traditionellen Herangehensweisen ans Zusammenspiel in der Band, und er wandte Methoden des Showbusiness auf die Musik an und beeinflusste damit den Jazz als Kunstrichtung, daneben aber auch die Musik ganz allgemein nachhaltig. Mit dieser Interpretation von Armstrongs Kunst als einem großen Beitrag zur intellektuellen Kulturgeschichte des 20sten Jahrhunderts will Brothers ganz bewusst von jenen im Rassismus der Vereinigten Staaten begründeten Lesarten abrücken, die das Bild eines ungelernten Musikers hochhalten, der nicht viel über das nachdenke, was er da spiele, sondern stattdessen einfach intuitiv Musik macht. Für Armstrongs Kunst, schreibt Brothers, war eine künstlerische Disziplin notwendig, die der eines Beethoven, Strawinsky usw. in nichts nachstünde. Zur Akzeptanz dieser Seite der Moderne gehöre aber auch zu verstehen, dass sich Armstrongs Kreativität zuallererst in seiner Kunst ausdrückte und damit einen nicht-verbalen Diskurs der Moderne wiedergebe.

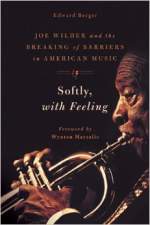

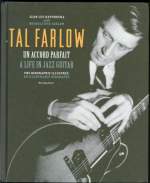



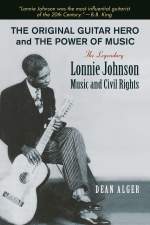





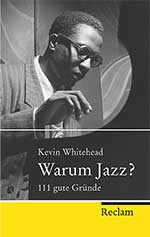

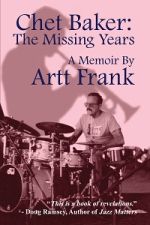





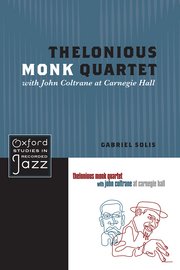




 Roberta Freund Schwartz’s Buch hat zwar vordergründig die Rezeption des afro-amerikanischen Blues in Großbritannien zum Thema, doch lassen sich viele ihrer Erkenntnisse zum einen auf den Rest des (zumindest westlichen) Kontinents und zum zweiten bedingt auch auf den Jazz übertragen. Tatsächlich beginnt sie ihre Abhandlung mit einem Kapitel über die Missverständnisse der frühen Jazzrezeption. Sie beschreibt, wie in den 1880er Jahren Tourneen von Minstrelgruppen die Briten neugierig auf schwarze Kultur machten, wie die ersten britischen Tanzkapellen bereits 1898 Ragtimestücke aufnahmen. Sie beschreibt die Auswirkungen, die die Faszination mit dem Jazz spätestens nach dem Besuch der Original Dixieland Jazz Band im Jahr 1919 hatte, dass die Jazzrezeption aber trotz der vielen Swingmusiker im Land weitgehend eine hörende blieb.
Roberta Freund Schwartz’s Buch hat zwar vordergründig die Rezeption des afro-amerikanischen Blues in Großbritannien zum Thema, doch lassen sich viele ihrer Erkenntnisse zum einen auf den Rest des (zumindest westlichen) Kontinents und zum zweiten bedingt auch auf den Jazz übertragen. Tatsächlich beginnt sie ihre Abhandlung mit einem Kapitel über die Missverständnisse der frühen Jazzrezeption. Sie beschreibt, wie in den 1880er Jahren Tourneen von Minstrelgruppen die Briten neugierig auf schwarze Kultur machten, wie die ersten britischen Tanzkapellen bereits 1898 Ragtimestücke aufnahmen. Sie beschreibt die Auswirkungen, die die Faszination mit dem Jazz spätestens nach dem Besuch der Original Dixieland Jazz Band im Jahr 1919 hatte, dass die Jazzrezeption aber trotz der vielen Swingmusiker im Land weitgehend eine hörende blieb.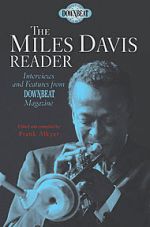 Down Beat ist seit den Mitt-1930er Jahren die wichtigste amerikanische Jazzzeitschrift. Sie begleitete den Mainstream der Jazzentwicklung genauso wie die Umbrüche. Auf ihren Seiten wurden Debatten über die musikalischen Veränderungen genauso geführt wie solche über die soziale und politische Bedeutung des Jazz. Miles Davis begleitete Down Beat seit 1946, als er das erste Mal in einer Besprechung einer Charlie-Parker-Platte erwähnt wurde. Die vielen Features, Interviews, Platten- und Konzertrezensionen und selbst die kleinen Randerwähnungen wurden jetzt in einem Buch zusammengefasst, das durchaus die unterschiedlichen Seiten des Miles Davis wiedergibt: den freundlich-jovialen Menschen (eher selten) genauso wie den zornig-genervten Star. Blindfold-Tests, in denen er die Kollegen herunterputzt, gehören genauso dazu wie recht offenherzige Gespräche über seine musikalische Ästhetik, die sich seiner Meinung nach die Jahre über weit weniger gewandelt hat als manche Jazzfans meinen mögen. In seiner Vollständigkeit ist dieses Buch dabei genauso eine beredte Reflektion über Leben und Werk des Trompeters wie ein Beispiel amerikanischer Jazzkritik und ihres Umgangs mit einem der sicher kontroversesten Figuren, mit den sie es zu tun hatte: einem genialen Musiker, der in seiner Musik Ruhe, in seinem Leben oft genug Unzufriedenheit und Aggression ausstrahlte. Man kann darüber reflektieren, ob das nicht vielleicht zwei notwendige Seiten einer Medaille – zumindest dieser Medaille – sind. Als Aufsatzsammlung lässt das Buch dem Leser die Freiheit, den jeweiligen Standpunkt der Autoren zu erkennen. Die Herausgeber kommentieren nicht weiter, müssen auch nicht weiter kommentieren. Das Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube und ein wunderbares Nachschlagewerk zur Rezeption des großen Miles.
Down Beat ist seit den Mitt-1930er Jahren die wichtigste amerikanische Jazzzeitschrift. Sie begleitete den Mainstream der Jazzentwicklung genauso wie die Umbrüche. Auf ihren Seiten wurden Debatten über die musikalischen Veränderungen genauso geführt wie solche über die soziale und politische Bedeutung des Jazz. Miles Davis begleitete Down Beat seit 1946, als er das erste Mal in einer Besprechung einer Charlie-Parker-Platte erwähnt wurde. Die vielen Features, Interviews, Platten- und Konzertrezensionen und selbst die kleinen Randerwähnungen wurden jetzt in einem Buch zusammengefasst, das durchaus die unterschiedlichen Seiten des Miles Davis wiedergibt: den freundlich-jovialen Menschen (eher selten) genauso wie den zornig-genervten Star. Blindfold-Tests, in denen er die Kollegen herunterputzt, gehören genauso dazu wie recht offenherzige Gespräche über seine musikalische Ästhetik, die sich seiner Meinung nach die Jahre über weit weniger gewandelt hat als manche Jazzfans meinen mögen. In seiner Vollständigkeit ist dieses Buch dabei genauso eine beredte Reflektion über Leben und Werk des Trompeters wie ein Beispiel amerikanischer Jazzkritik und ihres Umgangs mit einem der sicher kontroversesten Figuren, mit den sie es zu tun hatte: einem genialen Musiker, der in seiner Musik Ruhe, in seinem Leben oft genug Unzufriedenheit und Aggression ausstrahlte. Man kann darüber reflektieren, ob das nicht vielleicht zwei notwendige Seiten einer Medaille – zumindest dieser Medaille – sind. Als Aufsatzsammlung lässt das Buch dem Leser die Freiheit, den jeweiligen Standpunkt der Autoren zu erkennen. Die Herausgeber kommentieren nicht weiter, müssen auch nicht weiter kommentieren. Das Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube und ein wunderbares Nachschlagewerk zur Rezeption des großen Miles. Gene Andersons Studie über Louis Armstrongs Hot Five-Aufnahmen wurde in einer Reihe von Quellentexten der College Music Society veröffentlicht, richtet sich aber nicht nur an Lehrer oder Studenten, sondern genauso an den interessierten und musikalisch vorgebildeten Fan. Vorbildung jedenfalls ist hilfreich, da Andersons Buch keine Biographie ist, sondern vor allem die Musik beschreibt und das durchaus in musikalischen Termini, mit unterschiedlichen analytischen Ansätzen und untermauert mit Transkriptionen von Themen und Soli.
Gene Andersons Studie über Louis Armstrongs Hot Five-Aufnahmen wurde in einer Reihe von Quellentexten der College Music Society veröffentlicht, richtet sich aber nicht nur an Lehrer oder Studenten, sondern genauso an den interessierten und musikalisch vorgebildeten Fan. Vorbildung jedenfalls ist hilfreich, da Andersons Buch keine Biographie ist, sondern vor allem die Musik beschreibt und das durchaus in musikalischen Termini, mit unterschiedlichen analytischen Ansätzen und untermauert mit Transkriptionen von Themen und Soli.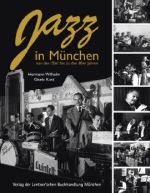
 Der Jazzclub Nienburg wurde am 2. November 1957 offiziell gegründet, und zu seinem 50sten Geburtstag gönnte er sich eine Chronik. Solche Jazzclub-Memoiren gibt es mittlerweile für etliche Clubs und Städte, und jedes dieser Bücher hat seinen eigenen Charakter – teils kritisch-professionell, teils wohlwollend-familiär, teilweise eine reine Sammlung an Daten und Anekdoten, teilweise der Versuch eines zusammenhängenden Erzählstrangs. Die Geschichte des Jazz-Clubs Nienburg folgt dem letztgenannten Schema. Der Club hat das Glück zu seinen Mitgliedern einen ausgewiesenen Schriftsteller zu zählen, Horst Friedrich, der als Jazzfan und Hobbyposaunist seit 1960 aktives Mitglied des Clubs ist, sein Geld aber mit dem Verfassen von “Spannungsromanen” verdiente, eine hübsche Umschreibung für die Jerry-Cotton-Hefte, die in den 1960er und 1970er Jahren an jedem Kiosk erhältlich waren und auch ihren Weg auf die Filmleinwand fanden. Friedrich also weiß zu erzählen, und er weiß nüchterne Daten mit Leben zu füllen, neben den geschichtlichen Tatsachen auch Atmosphäre zu schildern, die Begeisterung der Fans oder den Umgang mit Bedenken der Anwohner des Vereinslokals. Er erzählt von Konzerten in der Aula der Staatsbauschule und die anschließenden Jam Sessions im Club. Er zeigt Plakate der Zeit und natürlich Fotos der auftretenden Bands, meist Amateurcombos unterschiedlicher Stilrichtungen aus der Region oder aus der Landeshauptstadt Hannover. Der Club organisierte Fahrten zu Konzerten insbesondere amerikanischer Stars in Hannover oder Bremen, manchmal auch nach Hamburg, richtete 1959 aber auch die “Erste Norddeutsche Jazztagung” aus, bei der unter anderem das Gunter Hampel Quartett und die George Maycock Combo spielten. Wie in anderen Clubs auch, gab es Jazz Band Balls. 1966 wurde der erste Jazzkeller des Clubs unter der Nienburger Markthalle abgerissen. Hardy Banzer aber, seit 1960 Vorsitzender des Clubs, plante gerade den Neubau seines eigenen Hauses und plante einfach einen Jazzkeller hinzu. Schon im Dezember 1967 ging es weiter mit dem Konzertleben der Stadt. Neben den Hausbands des Clubs trat hier beispielsweise Monty Sunshine auf. Doch Hausbesitzer Banzer starb 1970, und seine Erben konnten sich mit dem Club nicht über eine Fortführung des Betriebs einigen. Die Mitglieder gingen auf erneute Kellersuche und fanden ein über 350 Jahre altes Gewölbe, das die Stadt dem Club überließ und in dem ab Dezember 1970 Musik erklang. In der Folge gab es Hochs und Tiefs: wunderbare Konzerte, unerwartete Nebenkostennachzahlungen, die zu stemmen waren, 20- und 30-jähriges Jubiläum, den Tod aktiver Mitglieder. 1990 wurde der Kellerraum mit finanzieller Hilfe der Stadt erweitert und erneuert. Nach Friedrichs geschichtlichem Großkapitel folgen persönliche Erinnerungen von Wolfgang Bühmann, Gero Sommerfeld und Peter Lenzner. Eine Bandliste der Internationalen Folk- und Jazztage Nienburg, der Hot Jazz Meetings und anderer Konzertreihen des Clubs gibt einen Überblick über die Programmpolitik. Und ein gesondertes Kapitel widmet sich der Begegnung von Mitgliedern des Jazzclubs im niedersächsischen Nienburg mit Jazzfreunden aus Nienburg an der Saale, mit denen sie kurz nach der Wende ein gemeinsames Jazzfest feierten. Erinnerungen an Konzerte von Fats Domino und Ray Charles beschließen das Buch, das sicher vor allem die Jazzfreunde der niedersächsischen Stadt interessieren wird, daneben aber auch ein wenig zur Dokumentation des Jazzlebens im Nachkriegs-Deutschland beiträgt.
Der Jazzclub Nienburg wurde am 2. November 1957 offiziell gegründet, und zu seinem 50sten Geburtstag gönnte er sich eine Chronik. Solche Jazzclub-Memoiren gibt es mittlerweile für etliche Clubs und Städte, und jedes dieser Bücher hat seinen eigenen Charakter – teils kritisch-professionell, teils wohlwollend-familiär, teilweise eine reine Sammlung an Daten und Anekdoten, teilweise der Versuch eines zusammenhängenden Erzählstrangs. Die Geschichte des Jazz-Clubs Nienburg folgt dem letztgenannten Schema. Der Club hat das Glück zu seinen Mitgliedern einen ausgewiesenen Schriftsteller zu zählen, Horst Friedrich, der als Jazzfan und Hobbyposaunist seit 1960 aktives Mitglied des Clubs ist, sein Geld aber mit dem Verfassen von “Spannungsromanen” verdiente, eine hübsche Umschreibung für die Jerry-Cotton-Hefte, die in den 1960er und 1970er Jahren an jedem Kiosk erhältlich waren und auch ihren Weg auf die Filmleinwand fanden. Friedrich also weiß zu erzählen, und er weiß nüchterne Daten mit Leben zu füllen, neben den geschichtlichen Tatsachen auch Atmosphäre zu schildern, die Begeisterung der Fans oder den Umgang mit Bedenken der Anwohner des Vereinslokals. Er erzählt von Konzerten in der Aula der Staatsbauschule und die anschließenden Jam Sessions im Club. Er zeigt Plakate der Zeit und natürlich Fotos der auftretenden Bands, meist Amateurcombos unterschiedlicher Stilrichtungen aus der Region oder aus der Landeshauptstadt Hannover. Der Club organisierte Fahrten zu Konzerten insbesondere amerikanischer Stars in Hannover oder Bremen, manchmal auch nach Hamburg, richtete 1959 aber auch die “Erste Norddeutsche Jazztagung” aus, bei der unter anderem das Gunter Hampel Quartett und die George Maycock Combo spielten. Wie in anderen Clubs auch, gab es Jazz Band Balls. 1966 wurde der erste Jazzkeller des Clubs unter der Nienburger Markthalle abgerissen. Hardy Banzer aber, seit 1960 Vorsitzender des Clubs, plante gerade den Neubau seines eigenen Hauses und plante einfach einen Jazzkeller hinzu. Schon im Dezember 1967 ging es weiter mit dem Konzertleben der Stadt. Neben den Hausbands des Clubs trat hier beispielsweise Monty Sunshine auf. Doch Hausbesitzer Banzer starb 1970, und seine Erben konnten sich mit dem Club nicht über eine Fortführung des Betriebs einigen. Die Mitglieder gingen auf erneute Kellersuche und fanden ein über 350 Jahre altes Gewölbe, das die Stadt dem Club überließ und in dem ab Dezember 1970 Musik erklang. In der Folge gab es Hochs und Tiefs: wunderbare Konzerte, unerwartete Nebenkostennachzahlungen, die zu stemmen waren, 20- und 30-jähriges Jubiläum, den Tod aktiver Mitglieder. 1990 wurde der Kellerraum mit finanzieller Hilfe der Stadt erweitert und erneuert. Nach Friedrichs geschichtlichem Großkapitel folgen persönliche Erinnerungen von Wolfgang Bühmann, Gero Sommerfeld und Peter Lenzner. Eine Bandliste der Internationalen Folk- und Jazztage Nienburg, der Hot Jazz Meetings und anderer Konzertreihen des Clubs gibt einen Überblick über die Programmpolitik. Und ein gesondertes Kapitel widmet sich der Begegnung von Mitgliedern des Jazzclubs im niedersächsischen Nienburg mit Jazzfreunden aus Nienburg an der Saale, mit denen sie kurz nach der Wende ein gemeinsames Jazzfest feierten. Erinnerungen an Konzerte von Fats Domino und Ray Charles beschließen das Buch, das sicher vor allem die Jazzfreunde der niedersächsischen Stadt interessieren wird, daneben aber auch ein wenig zur Dokumentation des Jazzlebens im Nachkriegs-Deutschland beiträgt.
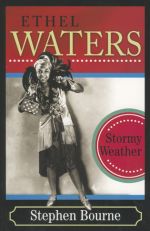 Ethel Waters was eine Sängerin, die irgendwie zwischen allen stilistischen Stühlen der populären Musik des frühen 20sten Jahrhunderts saß: Jazz, Blues, Ragtime, Musical. Autor Stephen Bourne hat bislang vor allem über die schwarze Präsenz auf Leinwand und Bildschirm veröffentlicht und wurde vor allem durch den Film “Cabin in the Sky” von 1940, in dem die Waters eine Hauptrolle hatte, sowie durch andere, sich immer wieder auf Ethel Waters beziehende Bühnenkünstlerinnen auf die Sängerin aufmerksam, etwa Lena Horne oder Eartha Kitt. Ethel Waters selbst hatte zu Lebzeiten zwei Autobiographien verfasst, “”His Eye Is on the Sparrow” und “To Me It’s Wonderful”. Bournes Aufgabe also war auch ein wenig, die dort enthaltenen Fakten und Geschichten zu verifizieren, in die Gegenwart der gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Situation zu übersetzen. Er lässt auch die Homosexualität der Waters nicht aus und widmet einen kurzen Absatz dem Thema, wie die Homophobie der Gesellschaft auch das Leben schwuler und lesbischer Bühnenkünstler beeinflusste. Waters war zugleich eine der herausragenden musikalischen Figuren der Harlem renaissance der 1920er Jahre wie auch einer der ersten schwarzen Bühnenstars, die über Hautfarben hinweg ein großes Publikum zog und in den USA wie in England lerühmt und beliebt war. Da Bourne vor allem Filmkritiker ist, sind seine Kapitel zum Filmschaffen der Sängerin die vielleicht interessanteste. Seine Anmerkungen zur Musik sind dagegen eher spärlich, was insbesodnere deshalb schade ist, weil er in seinem Umschlagtext neugierig darauf macht, wie es ihr denn gelungen sei, Songs wie “Dinah”, “Am I Blue”, Stormy Weather” oder “Heat Wave” zu Klassikern zu machen und was genau in ihrem Stil Sängerinnen der nächsten Generation beeinflusst hat. “She gave sophistication and class to the blues and American popular song”, schreibt Bourne im Covertext, doch im Buch selbst finden sich höchstens Daten, Fakten und Histörchen, keine Erklärungen der musikalischen Meisterschaft, kein Zurückverfolgen des gerollten “rrr”s, kein Bezug des Waterschen Stils zum Broadway-Shouter der Vor-1920er Jahre, kein Vergleich ihres Stils etwa mit dem von Bessie Smith. So interessant also auch ihre Karriere als Bühnen- und Filmkünstlerin war, über die Sängerin Ethel Waters bleibt noch genügend Stoff zu schreiben für Forscher, die sich den Kreuzbeziehungen zwischen Blues, Jazz, Musical und frühem Tonfilm annehmen wollen.
Ethel Waters was eine Sängerin, die irgendwie zwischen allen stilistischen Stühlen der populären Musik des frühen 20sten Jahrhunderts saß: Jazz, Blues, Ragtime, Musical. Autor Stephen Bourne hat bislang vor allem über die schwarze Präsenz auf Leinwand und Bildschirm veröffentlicht und wurde vor allem durch den Film “Cabin in the Sky” von 1940, in dem die Waters eine Hauptrolle hatte, sowie durch andere, sich immer wieder auf Ethel Waters beziehende Bühnenkünstlerinnen auf die Sängerin aufmerksam, etwa Lena Horne oder Eartha Kitt. Ethel Waters selbst hatte zu Lebzeiten zwei Autobiographien verfasst, “”His Eye Is on the Sparrow” und “To Me It’s Wonderful”. Bournes Aufgabe also war auch ein wenig, die dort enthaltenen Fakten und Geschichten zu verifizieren, in die Gegenwart der gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Situation zu übersetzen. Er lässt auch die Homosexualität der Waters nicht aus und widmet einen kurzen Absatz dem Thema, wie die Homophobie der Gesellschaft auch das Leben schwuler und lesbischer Bühnenkünstler beeinflusste. Waters war zugleich eine der herausragenden musikalischen Figuren der Harlem renaissance der 1920er Jahre wie auch einer der ersten schwarzen Bühnenstars, die über Hautfarben hinweg ein großes Publikum zog und in den USA wie in England lerühmt und beliebt war. Da Bourne vor allem Filmkritiker ist, sind seine Kapitel zum Filmschaffen der Sängerin die vielleicht interessanteste. Seine Anmerkungen zur Musik sind dagegen eher spärlich, was insbesodnere deshalb schade ist, weil er in seinem Umschlagtext neugierig darauf macht, wie es ihr denn gelungen sei, Songs wie “Dinah”, “Am I Blue”, Stormy Weather” oder “Heat Wave” zu Klassikern zu machen und was genau in ihrem Stil Sängerinnen der nächsten Generation beeinflusst hat. “She gave sophistication and class to the blues and American popular song”, schreibt Bourne im Covertext, doch im Buch selbst finden sich höchstens Daten, Fakten und Histörchen, keine Erklärungen der musikalischen Meisterschaft, kein Zurückverfolgen des gerollten “rrr”s, kein Bezug des Waterschen Stils zum Broadway-Shouter der Vor-1920er Jahre, kein Vergleich ihres Stils etwa mit dem von Bessie Smith. So interessant also auch ihre Karriere als Bühnen- und Filmkünstlerin war, über die Sängerin Ethel Waters bleibt noch genügend Stoff zu schreiben für Forscher, die sich den Kreuzbeziehungen zwischen Blues, Jazz, Musical und frühem Tonfilm annehmen wollen. In den 50er und 60er Jahren waren Joachim Ernst Berendts Fotokalender Kult. Das Jazz Calendiary könnte ähnlich kultig werden, diesmal nicht als Wand-, sondern als Tischkalender. Das handliche, dank der Spiralbindung leicht zu blätternde Buch enthält auf der linken Seite Schwarzweiß-Fotos des Fotografen Detlev Schilke, für jede Woche eines, und auf der rechten Seite genügend Platz für Termine, Anmerkungen, Notizen. Dickes Papier haben die Kalendermacher benutzt, angenehm rauh und beschreibbar und zugleich hochwertig glossy und damit fotogerecht. Es beginnt mit Junior Cook beim JazzFest Berlin 1990 und endet mit Woody Shaw bei den Leipziger Jazztagen 1987, und zwischendrin findet sich alles, was Rang und Namen hat in der Jazzszene zwischen den späten 80er Jahren und heute. Gary Lucas sitzt mit seiner Gitarre vor einem Wirrwarr an Fußschaltern, Joelle Léandres Schatten spielt ins Mikrophon, Dietmar Diesner dreht sein Saxophon um, Peter Kowald lauscht den eigenen Basstönen (gleich zweimal), Aki Takase entspannt und raucht, ebenso Lester Bowie, Joe Lovano probiert sein Mundstück aus, Bill Dixon seine Trompeten, Archie Shepp denkt nach, Tomasz Stanko prüft das Clip-On-Mikro, von Von Freeman sehen wir nur Instrument und Hosenträger, von Markus Stockhausen die Trompete, Regina Carter und Carla Kihlstedt geigen, Michel Portal und Richard Galliano üben sich in zwiefacher Akkordeonistik, und Wadada Leo Smith spielt Trompete, während er zugleich die Elektronik bedient, mit einem Fußpedal der Marke “Cry Baby”. Genügend Bilder, um durchs Jahr zu kommen, jeden Tag daran erinnert zu werden, dass auch die grauen Tage des Jahres durch Jazz lebendig werden können. Und ich bin mir sicher, dass (was die Buchmacher vielleicht nicht so freut) im Jahr 2008 etliche der wunderbaren Fotos gerahmt an der einen oder anderen Wand ihren Platz finden werden. (Wolfram Knauer)
In den 50er und 60er Jahren waren Joachim Ernst Berendts Fotokalender Kult. Das Jazz Calendiary könnte ähnlich kultig werden, diesmal nicht als Wand-, sondern als Tischkalender. Das handliche, dank der Spiralbindung leicht zu blätternde Buch enthält auf der linken Seite Schwarzweiß-Fotos des Fotografen Detlev Schilke, für jede Woche eines, und auf der rechten Seite genügend Platz für Termine, Anmerkungen, Notizen. Dickes Papier haben die Kalendermacher benutzt, angenehm rauh und beschreibbar und zugleich hochwertig glossy und damit fotogerecht. Es beginnt mit Junior Cook beim JazzFest Berlin 1990 und endet mit Woody Shaw bei den Leipziger Jazztagen 1987, und zwischendrin findet sich alles, was Rang und Namen hat in der Jazzszene zwischen den späten 80er Jahren und heute. Gary Lucas sitzt mit seiner Gitarre vor einem Wirrwarr an Fußschaltern, Joelle Léandres Schatten spielt ins Mikrophon, Dietmar Diesner dreht sein Saxophon um, Peter Kowald lauscht den eigenen Basstönen (gleich zweimal), Aki Takase entspannt und raucht, ebenso Lester Bowie, Joe Lovano probiert sein Mundstück aus, Bill Dixon seine Trompeten, Archie Shepp denkt nach, Tomasz Stanko prüft das Clip-On-Mikro, von Von Freeman sehen wir nur Instrument und Hosenträger, von Markus Stockhausen die Trompete, Regina Carter und Carla Kihlstedt geigen, Michel Portal und Richard Galliano üben sich in zwiefacher Akkordeonistik, und Wadada Leo Smith spielt Trompete, während er zugleich die Elektronik bedient, mit einem Fußpedal der Marke “Cry Baby”. Genügend Bilder, um durchs Jahr zu kommen, jeden Tag daran erinnert zu werden, dass auch die grauen Tage des Jahres durch Jazz lebendig werden können. Und ich bin mir sicher, dass (was die Buchmacher vielleicht nicht so freut) im Jahr 2008 etliche der wunderbaren Fotos gerahmt an der einen oder anderen Wand ihren Platz finden werden. (Wolfram Knauer) Siena Jazz ist eine große Jazzschule, ein regelmäßiger Workshop, ein Festival und ein Forschungszentrum mit angeschlossenem Archiv. Getragen von der Stiftung Siena Jazz ist es eine Art italienisches Äquivalent zum Jazzinstitut Darmstadt oder zum Institute of Jazz Studies in Newark, New Jersey, großzügig gefördert durch Mittel der lokalen Bank Monte dei Paschi di Siena.
Siena Jazz ist eine große Jazzschule, ein regelmäßiger Workshop, ein Festival und ein Forschungszentrum mit angeschlossenem Archiv. Getragen von der Stiftung Siena Jazz ist es eine Art italienisches Äquivalent zum Jazzinstitut Darmstadt oder zum Institute of Jazz Studies in Newark, New Jersey, großzügig gefördert durch Mittel der lokalen Bank Monte dei Paschi di Siena.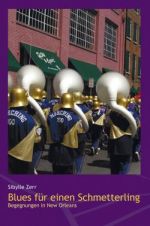 Sibylle Zerr war im Frühjahr 2004 als Botschafterin des Weinheimer Muddy’s Club in New Orleans, um dort das Jazz & Heritage Festival zu besuchen. Zurück kommt sie mit einem Sack voll Geschichte. Wie sie fast nicht reingekommen wäre in das Geburtsland des Jazz beispielsweise, weil die Einreiseformalitäten einen leicht das falsche Kreuz machen lassen. Von Blues und Jazz hat sie zu berichten und von den Mardi Gras Indians, von Typen wie dem Posaunisten Troy Andrews oder dem Gitarristen Larry Garner. Mit Irvin Mayfield unterhält sie sich über die Bedeutung des Jazz für das heutige New Orleans (von 2004), mit Michael Rae über die so ganz unterschiedlichen Traditionen der Crescent City – von Musik über Essen bis Voodoo. Dem ausführlichen Gespräch mit Allen Toussaint dann folgt der Epilog des Buchs, eine Reflektion über die Geschehnisse am 29. August 2005, als Hurricane Katrina die Stadt am Mississippi mit aller Wucht traf, weit über tausend Menschen ums Leben kamen, Hunderttausende obdachlos wurden. Die Nachwehen von Katrina sind auch heute, ein Jahr nach der Katastrophe zu spüren, die Zukunft der Geburtstadt des Jazz nach wie vor ungewiss. Etliche farbige Fotos zeigen die Stadt fernab des Glamours für die Tagestouristen.Sibylle Zerr hat sich bei ihrem Besuch in die Stadt verliebt, und ihr Buch zeugt von diesem sehr persönlichen Gefühl, mit einem Blick für Details, fürs Skurrile, für das alltägliche Leben von Menschen mit der Geschichte ihrer Stadt.
Sibylle Zerr war im Frühjahr 2004 als Botschafterin des Weinheimer Muddy’s Club in New Orleans, um dort das Jazz & Heritage Festival zu besuchen. Zurück kommt sie mit einem Sack voll Geschichte. Wie sie fast nicht reingekommen wäre in das Geburtsland des Jazz beispielsweise, weil die Einreiseformalitäten einen leicht das falsche Kreuz machen lassen. Von Blues und Jazz hat sie zu berichten und von den Mardi Gras Indians, von Typen wie dem Posaunisten Troy Andrews oder dem Gitarristen Larry Garner. Mit Irvin Mayfield unterhält sie sich über die Bedeutung des Jazz für das heutige New Orleans (von 2004), mit Michael Rae über die so ganz unterschiedlichen Traditionen der Crescent City – von Musik über Essen bis Voodoo. Dem ausführlichen Gespräch mit Allen Toussaint dann folgt der Epilog des Buchs, eine Reflektion über die Geschehnisse am 29. August 2005, als Hurricane Katrina die Stadt am Mississippi mit aller Wucht traf, weit über tausend Menschen ums Leben kamen, Hunderttausende obdachlos wurden. Die Nachwehen von Katrina sind auch heute, ein Jahr nach der Katastrophe zu spüren, die Zukunft der Geburtstadt des Jazz nach wie vor ungewiss. Etliche farbige Fotos zeigen die Stadt fernab des Glamours für die Tagestouristen.Sibylle Zerr hat sich bei ihrem Besuch in die Stadt verliebt, und ihr Buch zeugt von diesem sehr persönlichen Gefühl, mit einem Blick für Details, fürs Skurrile, für das alltägliche Leben von Menschen mit der Geschichte ihrer Stadt.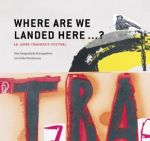 Zehn Jahre Traumzeit – ein Jubiläum, das sich unterschiedlich feiern lässt. Mit Musik natürlich, aber auch mit Erinnerungen. Viele Erinnerungen finden sich in diesem kleinen, geschmackvoll aufgemachten, hardcover.gebundenen, CD-großen Büchlein, das Farbfotos von Volker Beuxhausen enthält, die die Atmosphäre des Duisburger Festivals einfangen. Das Publikum ist genauso zu sehen wie die Künstler – auf der Bühne oder, selbstdarstellerisch, off-stage. Ein buntes Sammelsurium, das auch die stilistische Offenheit des Festivals widerspiegelt: Jazzer und Folk-Artisten und alles mögliche sonst zwischen Jazz, Blues, Welt- und avancierter Popmusik. Der Buchtitel ist Zitat der französischen Chansonette Juliette Gréco, die aus dem Bus stieg, die Bühne vor den Hochöfen Duisburgs sah und irritiert war von der ganzen Atmosphäre des Festivals. Doch bald merkte sie, dass hier Profis am Werke waren, mehr noch, dass Traumzeit eine ebensolche für ihr Publikum bedeutete. Man spricht alle Naslang von Industriekultur, auch deshalb, weil lange Zeit niemand wusste, was man mit den in der heutigen Welt scheinbar unnötigen Bunkern einer vergangenen Produktionswelt anfangen sollte. Man war von der seltsamen Schönheit der Architektur fasziniert und konnte doch nicht in jeder Zeche ein neues Museum für Industriekultur eröffnen. Duisburg hat ein Festival daraus gemacht, das seinesgleichen sucht, in der Atmosphäre genauso wie in der Qualität. Das Jubiläumsbuch vermittelt die Begeisterung der Konzerte, die ungewöhnliche Location, ein wenig auch, wie angetan viele der Künstler von dieser ungewohnten Kulisse waren. Auch für den, der nicht dabei war, gibt es da viel zu entdecken. Ruben Gonzalez, Bojan Z, Jan Garbarek, Dr. John, Chick Corea, Al Jarreau, die Mard Gras BB, Archie Shepp, Cassandra Wilson, Louis Sclavis, Herbie Hancock, Toots Thielemans, Wayne Shorter, Omar Sosa, Miriam Makeba, Rabih Abou-Khalil, Joachim Kühn, McCoy Tyner und so viele andere – schöne Fotos sind es, und irgendwie ist man ein wenig wehmütig, dass man nicht dabei war. Oder erinnert sich, wenn man dabei war. Happy birthday Traumzeit… (Wolfram Knauer)
Zehn Jahre Traumzeit – ein Jubiläum, das sich unterschiedlich feiern lässt. Mit Musik natürlich, aber auch mit Erinnerungen. Viele Erinnerungen finden sich in diesem kleinen, geschmackvoll aufgemachten, hardcover.gebundenen, CD-großen Büchlein, das Farbfotos von Volker Beuxhausen enthält, die die Atmosphäre des Duisburger Festivals einfangen. Das Publikum ist genauso zu sehen wie die Künstler – auf der Bühne oder, selbstdarstellerisch, off-stage. Ein buntes Sammelsurium, das auch die stilistische Offenheit des Festivals widerspiegelt: Jazzer und Folk-Artisten und alles mögliche sonst zwischen Jazz, Blues, Welt- und avancierter Popmusik. Der Buchtitel ist Zitat der französischen Chansonette Juliette Gréco, die aus dem Bus stieg, die Bühne vor den Hochöfen Duisburgs sah und irritiert war von der ganzen Atmosphäre des Festivals. Doch bald merkte sie, dass hier Profis am Werke waren, mehr noch, dass Traumzeit eine ebensolche für ihr Publikum bedeutete. Man spricht alle Naslang von Industriekultur, auch deshalb, weil lange Zeit niemand wusste, was man mit den in der heutigen Welt scheinbar unnötigen Bunkern einer vergangenen Produktionswelt anfangen sollte. Man war von der seltsamen Schönheit der Architektur fasziniert und konnte doch nicht in jeder Zeche ein neues Museum für Industriekultur eröffnen. Duisburg hat ein Festival daraus gemacht, das seinesgleichen sucht, in der Atmosphäre genauso wie in der Qualität. Das Jubiläumsbuch vermittelt die Begeisterung der Konzerte, die ungewöhnliche Location, ein wenig auch, wie angetan viele der Künstler von dieser ungewohnten Kulisse waren. Auch für den, der nicht dabei war, gibt es da viel zu entdecken. Ruben Gonzalez, Bojan Z, Jan Garbarek, Dr. John, Chick Corea, Al Jarreau, die Mard Gras BB, Archie Shepp, Cassandra Wilson, Louis Sclavis, Herbie Hancock, Toots Thielemans, Wayne Shorter, Omar Sosa, Miriam Makeba, Rabih Abou-Khalil, Joachim Kühn, McCoy Tyner und so viele andere – schöne Fotos sind es, und irgendwie ist man ein wenig wehmütig, dass man nicht dabei war. Oder erinnert sich, wenn man dabei war. Happy birthday Traumzeit… (Wolfram Knauer) Unter den Ländern des ehemaligen Ostblocks ragen im Jazz besonders zwei heraus: Polen und die ehemalige Tschechoslovakei. In Prag hatte sich in den 60er Jahren ein lebendiges, durchaus auch politisches Jazzleben entwickelt, Mitglieder der Jazzsektion waren gar 1968 Ziel staatlicher Repression. Zugleich war Prag (ähnlich wie Warschau) Ziel beispielsweise für viele Jazzliebhaber aus der DDR, da der Umgang mit Jazztradition und mit einer eigenen nationalen Jazzstimme über lange Jahre freier war als in Ostdeutschland. Das Buch der vier Autoren präsentiert allerdings nicht die Prager Jazzgeschichte, sondern vielmehr die Gegenwart des Jazz in der Tschechischen Republik, insbesondere in seiner Hauptstadt. Vierzehn Künstler werden vorgestellt, in Foto-Portraits, Essays und Interviews. Sie berichten über ihre eigene Geschichte und ihre musikalische Ästhetik, über Einflüsse und eigene Projekte, über das Leben in der Stadt Prag und die Arbeits- und Spielmöglichkeiten. Die Fotos von Christian Gerber zeigen die Künstler in Portraitstudien oder bei der Arbeit, auf der Bühne oder im Probenraum. Nachdenkliche Szenen genauso wie konzentriert-aktive Bilder, schwarz-weiß, zum Teil über volle Doppelseiten ausgebreitet. Ein Buch, das zum Blättern einlädt, eine Bereicherung an Informationen über den Jazz in unserem Nachbarland, über eine Szene, die sich den Ruhm erhalten hat, etwas Besonderes zu sein.
Unter den Ländern des ehemaligen Ostblocks ragen im Jazz besonders zwei heraus: Polen und die ehemalige Tschechoslovakei. In Prag hatte sich in den 60er Jahren ein lebendiges, durchaus auch politisches Jazzleben entwickelt, Mitglieder der Jazzsektion waren gar 1968 Ziel staatlicher Repression. Zugleich war Prag (ähnlich wie Warschau) Ziel beispielsweise für viele Jazzliebhaber aus der DDR, da der Umgang mit Jazztradition und mit einer eigenen nationalen Jazzstimme über lange Jahre freier war als in Ostdeutschland. Das Buch der vier Autoren präsentiert allerdings nicht die Prager Jazzgeschichte, sondern vielmehr die Gegenwart des Jazz in der Tschechischen Republik, insbesondere in seiner Hauptstadt. Vierzehn Künstler werden vorgestellt, in Foto-Portraits, Essays und Interviews. Sie berichten über ihre eigene Geschichte und ihre musikalische Ästhetik, über Einflüsse und eigene Projekte, über das Leben in der Stadt Prag und die Arbeits- und Spielmöglichkeiten. Die Fotos von Christian Gerber zeigen die Künstler in Portraitstudien oder bei der Arbeit, auf der Bühne oder im Probenraum. Nachdenkliche Szenen genauso wie konzentriert-aktive Bilder, schwarz-weiß, zum Teil über volle Doppelseiten ausgebreitet. Ein Buch, das zum Blättern einlädt, eine Bereicherung an Informationen über den Jazz in unserem Nachbarland, über eine Szene, die sich den Ruhm erhalten hat, etwas Besonderes zu sein. Klaus Doldinger ist mit Sicherheit eine der ganz wichtigen Figuren des deutschen Jazz. Sein Weg führt vom Dixielandklarinettisten über den Fusionvorreiter, den Partymusiker (unter seinem Pseudonym Paul Nero) bis hin zum erfolgreichen Film- und Fernsehkomponisten. Eine Biographie dieses vielfältigen und ertragreichen Musikerschaffens fehlt bislang noch, die Diskographie, zusammengetragen von Rainer Thieme, liegt jetzt in zweiter, aktualisierter Ausgabe vor. Chronologisch mit eingescannten Coverabbildungen (die Qualität der Scans bzw. Ausdrucke könnte brillanter sein). Diskographisch nüchtern-solide Informationen: Plattentitel, Einzeltitel, Aufnahmeort und -datum, Besetzung, Wiederveröffentlichungen, Anmerkungen. Wo bekannt finden sich Angaben zum Produzenten, zum Studio oder zur Live-Location. Ein Vorwort fehlt, im kurzen Nachwort verweist Thieme auf viele bislang unveröffentlichte Aufnahmen, beispielsweise aus der Reihe der NDR-Jazzworkshops. Angesichts der mittlerweile erhältlichen Großdiskographien zum Jazz (Walter Bruyninckx, Tom Lord) wäre es vielleicht eine Anregung an all die so wichtigen “Klein-Diskographen” im Land — also all jene, die wie Thieme Name- oder Label-Diskographien recherchieren –, wenn sie zusätzliche Informationen aufnehmen könnten, die in den Großdiskographien eben nicht enthalten sind: Composers Credits beispielsweise, die Länge der einzelnen Tracks, Matrixnummern, sofern vorhanden. Und bei aller sympathischen Nüchternheit der reinen Informationsgabe wäre ein inhaltliches Vorwort auf den Künstler, seine Musik und sein Plattenschaffen bestimmt auch eine willkommene Ergänzung. Thiemes Diskographie ist auf jeden Fall ein Standard-Nachschlagewerk zu Klaus Doldinger, für Fans und Sammler unentbehrlich. (Wolfram Knauer)
Klaus Doldinger ist mit Sicherheit eine der ganz wichtigen Figuren des deutschen Jazz. Sein Weg führt vom Dixielandklarinettisten über den Fusionvorreiter, den Partymusiker (unter seinem Pseudonym Paul Nero) bis hin zum erfolgreichen Film- und Fernsehkomponisten. Eine Biographie dieses vielfältigen und ertragreichen Musikerschaffens fehlt bislang noch, die Diskographie, zusammengetragen von Rainer Thieme, liegt jetzt in zweiter, aktualisierter Ausgabe vor. Chronologisch mit eingescannten Coverabbildungen (die Qualität der Scans bzw. Ausdrucke könnte brillanter sein). Diskographisch nüchtern-solide Informationen: Plattentitel, Einzeltitel, Aufnahmeort und -datum, Besetzung, Wiederveröffentlichungen, Anmerkungen. Wo bekannt finden sich Angaben zum Produzenten, zum Studio oder zur Live-Location. Ein Vorwort fehlt, im kurzen Nachwort verweist Thieme auf viele bislang unveröffentlichte Aufnahmen, beispielsweise aus der Reihe der NDR-Jazzworkshops. Angesichts der mittlerweile erhältlichen Großdiskographien zum Jazz (Walter Bruyninckx, Tom Lord) wäre es vielleicht eine Anregung an all die so wichtigen “Klein-Diskographen” im Land — also all jene, die wie Thieme Name- oder Label-Diskographien recherchieren –, wenn sie zusätzliche Informationen aufnehmen könnten, die in den Großdiskographien eben nicht enthalten sind: Composers Credits beispielsweise, die Länge der einzelnen Tracks, Matrixnummern, sofern vorhanden. Und bei aller sympathischen Nüchternheit der reinen Informationsgabe wäre ein inhaltliches Vorwort auf den Künstler, seine Musik und sein Plattenschaffen bestimmt auch eine willkommene Ergänzung. Thiemes Diskographie ist auf jeden Fall ein Standard-Nachschlagewerk zu Klaus Doldinger, für Fans und Sammler unentbehrlich. (Wolfram Knauer)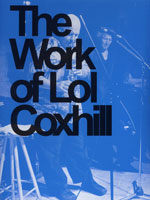 Books about experimental musicians often are done as labor of love by enthusiasts who follow their beloved artists around, collect their recordings as well as essays, interviews, articles about them. Resulting discographies tend to be for the cognoscenti only, for fellow enthusiasts, for the ones in-the-know. Lol Coxhill, though, is one of those avantgarde musicians who always was able to relate to his audiences because while taking his art and music seriously he knew that he wanted to reach the heart of the listeners. He used musical and extramusical elements of humor in his performances. His concerts are entertaining as well as engaged, serious fun, if you will. Barbara Schwarz tries to capture some of that spirit, which may be kind of hard to do in the form of a fact collection.
Books about experimental musicians often are done as labor of love by enthusiasts who follow their beloved artists around, collect their recordings as well as essays, interviews, articles about them. Resulting discographies tend to be for the cognoscenti only, for fellow enthusiasts, for the ones in-the-know. Lol Coxhill, though, is one of those avantgarde musicians who always was able to relate to his audiences because while taking his art and music seriously he knew that he wanted to reach the heart of the listeners. He used musical and extramusical elements of humor in his performances. His concerts are entertaining as well as engaged, serious fun, if you will. Barbara Schwarz tries to capture some of that spirit, which may be kind of hard to do in the form of a fact collection.
 David Redfern gehört zu den großen Fotografen der europäischen Jazzszene. Sein Fotobuch “The Unclosed Eye” ist eine Art fotografischer Autobiographie, denn nicht nur enthält es wunderbare Abbildungen aus über 40 Jahren Berufserfahrung, sondern daneben auch etliche Anekdoten, Begegnungen, die Redfern mit feinem britischem Humor gewürzt erzählt und die die Bilder aus dem bloßen Dokument heraus- und ins wirkliche Leben hineinholen. Er berichtet von seiner ersten Schallplatte (Humphrey Lytteltons “Bad Penny Blues”, seiner ersten Kamera (einer Voigtländer Bessa 66 (120)), seinem ersten selbstgeschusterten Studio, und von seiner fotografischen Ästhetik: Er habe früh gelernt, wie wichtig es sei, auch das Auge geöffnet zu haben, das nicht durch den Sucher blicke, um eine Überanstrengung des arbeitenden Auges zu vermeiden. Redfern fotografierte weit mehr als nur Jazzmusiker. Mit seiner Hasselblad lichtete er die Beatles ab und John Lee Hooker, die Rolling Stones, Bill Haley und Sandy Shaw, Rockstars und Popsternchen sowie die Größen des Jazz, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans und so viele mehr. Redfern hatte sich einen Namen gemacht als exzellenter Schwarzweiß- genauso wie Farbfotograf und schoss Bilder für Plattencover, Magazinartikel und die Band-Promotion. Manchmal hatte der Auftraggeber das Sagen, manchmal ließ man ihm freie Hand. So wechseln Bilder von Konzerten ab mit Studioshots, Außenaufnahmen, Fotos, bei denen man zum Teil raten mag, wer den Künstler wohl so sehen wollte, wie er abgebildet ist: der Auftraggeber, der Künstler selbst oder der Fotograf. In den 1960er Jahren reiste Redfern jedes Jahr zum Newport Jazz Festival, bis es 1971 seine Pforten schloss. In den 1970er Jahren machte George Wein ihn zum Hausfotografen des Newport in New York Festival, um so die Armada an Pressefotografen zu vermeiden und der Presse dennoch genügend Hintergrundbilder zur Verfügung stellen zu können. Redfern erzählt, wie Miles Davis ihn einmal fast wütend rausschmiss, um ihn gleich darauf freundlich wieder reinzubitten. Er berichtet von Partyfotos, die von der Presse in der Discoära nachgefragt wurden. Er berichtet von einem Konzert, das Dexter Gordon vor Gefangenen auf Rikers Island gab. Neben all den Geschichten aber stehen die Bilder, Big Joe Turner, eine Zigarette rauchend backstage in New Orleans, Josephine Baker oder Sun Ra in völlig unterschiedlichen und doch so ähnlich exotischen Kostümen, James Brown, und immer wieder Miles, Dizzy Gillespie in der Badehose in Havanna und und und. Ich selbst erlebte Dave Redfern in den 1970er und 1980er Jahren ab und zu bei Festivals, und erinnere ihn als einen jener Fotografen, die man kaum bemerkte, weil er mit seiner Hasselblad zugleich ein Freund der Musik war, weil er die Musik dokumentierte, aber wusste, dass er damit nur ein Mittler war und nicht der eigentliche Star. Sein Buch ist eine launig-spaßige Reise durch viereinhalb Jahrzehnte Musikgeschichte, die zugleich seine eigene Berufsgeschichte ist. Lesens- wie sehenswert!
David Redfern gehört zu den großen Fotografen der europäischen Jazzszene. Sein Fotobuch “The Unclosed Eye” ist eine Art fotografischer Autobiographie, denn nicht nur enthält es wunderbare Abbildungen aus über 40 Jahren Berufserfahrung, sondern daneben auch etliche Anekdoten, Begegnungen, die Redfern mit feinem britischem Humor gewürzt erzählt und die die Bilder aus dem bloßen Dokument heraus- und ins wirkliche Leben hineinholen. Er berichtet von seiner ersten Schallplatte (Humphrey Lytteltons “Bad Penny Blues”, seiner ersten Kamera (einer Voigtländer Bessa 66 (120)), seinem ersten selbstgeschusterten Studio, und von seiner fotografischen Ästhetik: Er habe früh gelernt, wie wichtig es sei, auch das Auge geöffnet zu haben, das nicht durch den Sucher blicke, um eine Überanstrengung des arbeitenden Auges zu vermeiden. Redfern fotografierte weit mehr als nur Jazzmusiker. Mit seiner Hasselblad lichtete er die Beatles ab und John Lee Hooker, die Rolling Stones, Bill Haley und Sandy Shaw, Rockstars und Popsternchen sowie die Größen des Jazz, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans und so viele mehr. Redfern hatte sich einen Namen gemacht als exzellenter Schwarzweiß- genauso wie Farbfotograf und schoss Bilder für Plattencover, Magazinartikel und die Band-Promotion. Manchmal hatte der Auftraggeber das Sagen, manchmal ließ man ihm freie Hand. So wechseln Bilder von Konzerten ab mit Studioshots, Außenaufnahmen, Fotos, bei denen man zum Teil raten mag, wer den Künstler wohl so sehen wollte, wie er abgebildet ist: der Auftraggeber, der Künstler selbst oder der Fotograf. In den 1960er Jahren reiste Redfern jedes Jahr zum Newport Jazz Festival, bis es 1971 seine Pforten schloss. In den 1970er Jahren machte George Wein ihn zum Hausfotografen des Newport in New York Festival, um so die Armada an Pressefotografen zu vermeiden und der Presse dennoch genügend Hintergrundbilder zur Verfügung stellen zu können. Redfern erzählt, wie Miles Davis ihn einmal fast wütend rausschmiss, um ihn gleich darauf freundlich wieder reinzubitten. Er berichtet von Partyfotos, die von der Presse in der Discoära nachgefragt wurden. Er berichtet von einem Konzert, das Dexter Gordon vor Gefangenen auf Rikers Island gab. Neben all den Geschichten aber stehen die Bilder, Big Joe Turner, eine Zigarette rauchend backstage in New Orleans, Josephine Baker oder Sun Ra in völlig unterschiedlichen und doch so ähnlich exotischen Kostümen, James Brown, und immer wieder Miles, Dizzy Gillespie in der Badehose in Havanna und und und. Ich selbst erlebte Dave Redfern in den 1970er und 1980er Jahren ab und zu bei Festivals, und erinnere ihn als einen jener Fotografen, die man kaum bemerkte, weil er mit seiner Hasselblad zugleich ein Freund der Musik war, weil er die Musik dokumentierte, aber wusste, dass er damit nur ein Mittler war und nicht der eigentliche Star. Sein Buch ist eine launig-spaßige Reise durch viereinhalb Jahrzehnte Musikgeschichte, die zugleich seine eigene Berufsgeschichte ist. Lesens- wie sehenswert! 15 Jahre nach dem Mauerfall ist offenbar genügend Zeit ins Land gegangen, um die Geschichte des Jazz in der DDR angemessen aufzuarbeiten. Rainer Bratfisch hat die ehrenwerte Aufgabe der Jazz-Abwicklung übernommen, mit einem Buch, dass die Geschichte der Musik, ihrer musikalischen wie politischen Bedeutung erzählt ohne zu verklären. Nischenkultur bedeutete im totalitären Staat nun mal etwas vollkommen anderes als im westlichen Deutschland. Und so kommen in diesem Buch Vertreter der unterschiedlichsten Bereiche des DDR-Jazz zu Wort. Neben dem historischen Fließtext finden sich Kapitel zu Teilbereichen der DDR-Jazzkultur. Manfred Krug, Karlheinz Drechsel, Ernst Ludwig Petrowsky, Joachim Kühn, Ruth Hohmann, Hannes Zerbe, Conny Bauer, Joe Sachse werden in Features und Interviews vorgestellt, über Konzertreihen wie “Jazz in der Kammer” oder die Festivals in Peitz und Eldena reflektiert, über Jazz-und-Lyrik-Projekte, die Westerfahrungen renommierter Ost-Jazzer, Jazzfans und das Publikum als solches, über das staatseigene Schallplattenlabel Amiga, den Jazzkeller Treptow, regionale Szenen in Jena, Weimar, Eisenach und Potsadam berichtet. Eine angemessene Mischung aus objektiven und höchst subjektiven Sichtweisen, in der die Betroffenheit der Autoren und Musiker durchscheint, die ja alle dabei waren, für die 40 Jahre DDR eben auch ihre musikalische Sozialisation betraf. Hilfreich: Die Chronologie, die wichtige Ereignisse des DDR-Jazz von 1949 bis 1990 festhält. Besonders interessant: Die Antworten bedeutender Musiker auf die Frage: “Was war das Besondere am jazz in der DDR?”. Bratfischs Buch schließt eine Lücke und wird zum wichtigsten Nachschlagewerk über eine scheinbar abgeschlossene Geschichte. Scheinbar? Nun, die Musiker spielen schließlich noch. Und der DDR hat im Jazzbereich durchaus Musiker hervorgebracht, die im Westen ihresgleichen suchte, die eigenständig war, einen eigenen Charakter besaß. Wer die letzte CD des Zentralquartetts hört, “Aus teutschen Landen” (Intakt, 2006) , weiß darum, dass sie Erfahrungen der DDR-Musiker, die ihre eigene Kunst so prägten, weiterleben und aus dem kreativen gesamtdeutschen Jazz nicht wegzudenken sind.
15 Jahre nach dem Mauerfall ist offenbar genügend Zeit ins Land gegangen, um die Geschichte des Jazz in der DDR angemessen aufzuarbeiten. Rainer Bratfisch hat die ehrenwerte Aufgabe der Jazz-Abwicklung übernommen, mit einem Buch, dass die Geschichte der Musik, ihrer musikalischen wie politischen Bedeutung erzählt ohne zu verklären. Nischenkultur bedeutete im totalitären Staat nun mal etwas vollkommen anderes als im westlichen Deutschland. Und so kommen in diesem Buch Vertreter der unterschiedlichsten Bereiche des DDR-Jazz zu Wort. Neben dem historischen Fließtext finden sich Kapitel zu Teilbereichen der DDR-Jazzkultur. Manfred Krug, Karlheinz Drechsel, Ernst Ludwig Petrowsky, Joachim Kühn, Ruth Hohmann, Hannes Zerbe, Conny Bauer, Joe Sachse werden in Features und Interviews vorgestellt, über Konzertreihen wie “Jazz in der Kammer” oder die Festivals in Peitz und Eldena reflektiert, über Jazz-und-Lyrik-Projekte, die Westerfahrungen renommierter Ost-Jazzer, Jazzfans und das Publikum als solches, über das staatseigene Schallplattenlabel Amiga, den Jazzkeller Treptow, regionale Szenen in Jena, Weimar, Eisenach und Potsadam berichtet. Eine angemessene Mischung aus objektiven und höchst subjektiven Sichtweisen, in der die Betroffenheit der Autoren und Musiker durchscheint, die ja alle dabei waren, für die 40 Jahre DDR eben auch ihre musikalische Sozialisation betraf. Hilfreich: Die Chronologie, die wichtige Ereignisse des DDR-Jazz von 1949 bis 1990 festhält. Besonders interessant: Die Antworten bedeutender Musiker auf die Frage: “Was war das Besondere am jazz in der DDR?”. Bratfischs Buch schließt eine Lücke und wird zum wichtigsten Nachschlagewerk über eine scheinbar abgeschlossene Geschichte. Scheinbar? Nun, die Musiker spielen schließlich noch. Und der DDR hat im Jazzbereich durchaus Musiker hervorgebracht, die im Westen ihresgleichen suchte, die eigenständig war, einen eigenen Charakter besaß. Wer die letzte CD des Zentralquartetts hört, “Aus teutschen Landen” (Intakt, 2006) , weiß darum, dass sie Erfahrungen der DDR-Musiker, die ihre eigene Kunst so prägten, weiterleben und aus dem kreativen gesamtdeutschen Jazz nicht wegzudenken sind. Das Festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz 2004” in Sardinien widmete sich der Musik Eric Dolphys. Wie es sich für einen Giganten des modernen Jazz gehört, war die Musik auf dem Festival allerdings keinesfalls Dolphy-Nostalgie, sondern die Reaktion aktueller Musiker auf seinen Einfluss. Zeitgenössische italienische Musiker waren genauso mit dabei wie amerikanische Künstler, Tim Berne beispielsweise im Duo mit Umberto Petrin, die Gruppe Nexus, ICP aus Holland mit Misha Mengelberg und Han Bennink, die auf Dolphys letzter Einspielungen zu hören sind, eine spezielle Memorial Band, die sich Dolphys Kompositionen widmetet, das David S. Ware Quartet mit Matthew Shipp und William Parker sowie Musiker wie Roy Campbell, Henry Grimes und Hamid Drake. Nun ist ein Buch erschienen, das das Festival in vielen Bildern dokumentiert und die Dolphy zugleich in Beiträgen von Musikern und Musikwissenschaftlern näher beleuchtet. Claudio Sessa beschäftigt sich in seinem Beitrag mit dem Einfluss von Thelonious Monk auf den Saxophonisten und Bassklarinettisten sowie mit dem Einfluss Dolphys auf die Chicagoer Schule, auf AACM-Musiker, insbesondere Anthony Braxton. Gérard Rouy befragt etliche zeitgenössische Musiker nach Dolphys Bedeutung für sie. Zu Wort kommen dabei vor allem Saxophonisten, Joe McPhee, Peter Brötzmann, Ken Vandermark, Michel Portal, François Jeanneau, Louis Sclavis, Carlo Actis Dato, daneben aber auch Mengelberg und Bennink und andere. Paul Karting zeichnet die letzte Tournee Dolphys nach, die er selbst von April bis Juni 1964 organisiert hatte. Graham Connah beleuchtet Dolphys kompositorisches Schaffen. Eine ausführliche Disko- und Filmographie von Alan Saul sowie eine Bibliographie vom Jazzinstitut Darmstadt beschließen das Buch, das etliche (auch seltene) Fotos enthält, sehr ansprechend aufgemacht, Bekanntes mit neuen Blickwinkeln auf die Arbeit des Musikers verbindet. Und im Buchdeckel findet sich dann noch eine CD, die einzelne der Programmpunkte des Festivals dokumentiert, und am Schluss eine bislang unveröffentlichte Dolphy-Aufnahme enthält, “Strength and Unity” aus einem Konzert in Ann Arbor, Michigan vom 1./2. März 1964. (Wolfram Knauer)
Das Festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz 2004” in Sardinien widmete sich der Musik Eric Dolphys. Wie es sich für einen Giganten des modernen Jazz gehört, war die Musik auf dem Festival allerdings keinesfalls Dolphy-Nostalgie, sondern die Reaktion aktueller Musiker auf seinen Einfluss. Zeitgenössische italienische Musiker waren genauso mit dabei wie amerikanische Künstler, Tim Berne beispielsweise im Duo mit Umberto Petrin, die Gruppe Nexus, ICP aus Holland mit Misha Mengelberg und Han Bennink, die auf Dolphys letzter Einspielungen zu hören sind, eine spezielle Memorial Band, die sich Dolphys Kompositionen widmetet, das David S. Ware Quartet mit Matthew Shipp und William Parker sowie Musiker wie Roy Campbell, Henry Grimes und Hamid Drake. Nun ist ein Buch erschienen, das das Festival in vielen Bildern dokumentiert und die Dolphy zugleich in Beiträgen von Musikern und Musikwissenschaftlern näher beleuchtet. Claudio Sessa beschäftigt sich in seinem Beitrag mit dem Einfluss von Thelonious Monk auf den Saxophonisten und Bassklarinettisten sowie mit dem Einfluss Dolphys auf die Chicagoer Schule, auf AACM-Musiker, insbesondere Anthony Braxton. Gérard Rouy befragt etliche zeitgenössische Musiker nach Dolphys Bedeutung für sie. Zu Wort kommen dabei vor allem Saxophonisten, Joe McPhee, Peter Brötzmann, Ken Vandermark, Michel Portal, François Jeanneau, Louis Sclavis, Carlo Actis Dato, daneben aber auch Mengelberg und Bennink und andere. Paul Karting zeichnet die letzte Tournee Dolphys nach, die er selbst von April bis Juni 1964 organisiert hatte. Graham Connah beleuchtet Dolphys kompositorisches Schaffen. Eine ausführliche Disko- und Filmographie von Alan Saul sowie eine Bibliographie vom Jazzinstitut Darmstadt beschließen das Buch, das etliche (auch seltene) Fotos enthält, sehr ansprechend aufgemacht, Bekanntes mit neuen Blickwinkeln auf die Arbeit des Musikers verbindet. Und im Buchdeckel findet sich dann noch eine CD, die einzelne der Programmpunkte des Festivals dokumentiert, und am Schluss eine bislang unveröffentlichte Dolphy-Aufnahme enthält, “Strength and Unity” aus einem Konzert in Ann Arbor, Michigan vom 1./2. März 1964. (Wolfram Knauer) Das “Real Book” ist aus der Reisetasche des Jazzmusikers nicht wegzudenken – sei es das legendäre illegale Real Book früherer Jahre, das nach wie vor in zahllosen Kopien von Kopien herumgeistert, seien es die diversen “legalen” Real Books, die vor allem Sher Music in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat. In ihnen sind Standards der Jazzgeschichte genauso enthalten wie modernere Stücke, denen die Herausgeber Standardqualitäten zutrauen. Shers neuestes Real Book nun wendet sich an den europäischen Markt, sicher auch besonders an europäische Musiker, die nach nicht ganz so bekannten Stücken suchen und die vielleicht auch in ihrem Repertoire ihre eigene Herkunft widergespiegelt sehen möchten. Europa ist dabei weit gefasst wenn sich neben den tatsächlich in Europa tätigen Musikern auch Exileuropäer finden wie George Shearing (“And Then I Wrote”), Valery Ponomarev (“Messenger from Russia”), George Mraz” (“Wisteria”) oder Claus Ogerman (“Favors”, “In the Presence & Absence of Each Other”). Am ältesten sind wohl die drei Django-Reinhardt-Klassiker “Nuages”, “Swing ’42” und “Manoir de mes rêves”, der Rest sind Titel, die wohl kaum jemand sofort ansummen könnte. Immerhin: Geographisch ist nichts ausgespart: Frankreich, England, Deutschland, Italien sind genauso vertreten wie Vertreter aus osteuropäischen Ländern oder aus Skandinavien. Joe Zawinul mag als Österreicher durchgehen, auch wenn die hier enthaltenen Titel (“In a Silent Way”, “Midnight Mood”, “Man in the Green Shirt”) eher seine amerikanische Sozialisation zeigen. Michel Petrucciani ist mit drei Titeln vertreten (“Home”, “Looking Up”, “La Champagne”), Tommy Smith, David Linx, Kenny Wheeler und der polnische Pianist Michal Tokaj gar mit vier. Aus Deutschland stammen Peter Bolte (“Miss J.”), Barbara Dennerlein (“Bo-Peep”, “Birthday Blues”), Johannes Enders (“Little Peace Waltz”), Paul Heller (“Vista”, “Relaxation”), Gregor Hübner (“910 Columbus Ave.”), Peter Lehel (“Elegie”), Hendrik Meurkens (“A Summer in San Francisco”, “Bolero Para Paquito”), Ludwig Nuss (“Night Over Lake Tarawera”) und Florian Ross (“Hal”, “Platypus”, “By Any Means Necessary”, “Getting There (Is Half The Fun)”. Bobo Stenson, NHOP, Enrico Pieranunzi, Perico Sambeat, John Dankworth, Michiel Borstlap, Anders Bergcrantz oder Stefano Di Battista sind weitere Namen hinter den mehr als 180 Kompositionen. Sicher, es ist eine willkürliche Auswahl,Lücken bleiben da nicht aus. Esbjörn Svensson, Tomasz Stanko, Michel Portal, Chano Dominguez, aber auch viele deutsche Namen kommen einem in den Sinn, die durchaus in das Buch gepasst hätten. Aber alles ließe sich eh nicht unterbringen, und es ist ein Beginn. Das Repertoire hält sich im konventionellen Bereich: Latin-Stücke, Balladen, medium und schnelle Swingnummern, Jazz-Rock, sogar Gesangstitel (Tony Lakatos’ “A Dream Come True” mit einem Text von Masha Bijlsma), etliche komplexer aufgebaute Arrangements, die sicher weniger zur Jam Session taugen als viel mehr zur Repertoireerweiterung. Alle Titel sind in Lead-Sheet-Form abgedruckt, mit Akkordsymbolen, eventuell Hinweisen zur Aufführung und Urheberrechtsverweisen. Viele der Titel lassen sich auf der Website von Sher Music (
Das “Real Book” ist aus der Reisetasche des Jazzmusikers nicht wegzudenken – sei es das legendäre illegale Real Book früherer Jahre, das nach wie vor in zahllosen Kopien von Kopien herumgeistert, seien es die diversen “legalen” Real Books, die vor allem Sher Music in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat. In ihnen sind Standards der Jazzgeschichte genauso enthalten wie modernere Stücke, denen die Herausgeber Standardqualitäten zutrauen. Shers neuestes Real Book nun wendet sich an den europäischen Markt, sicher auch besonders an europäische Musiker, die nach nicht ganz so bekannten Stücken suchen und die vielleicht auch in ihrem Repertoire ihre eigene Herkunft widergespiegelt sehen möchten. Europa ist dabei weit gefasst wenn sich neben den tatsächlich in Europa tätigen Musikern auch Exileuropäer finden wie George Shearing (“And Then I Wrote”), Valery Ponomarev (“Messenger from Russia”), George Mraz” (“Wisteria”) oder Claus Ogerman (“Favors”, “In the Presence & Absence of Each Other”). Am ältesten sind wohl die drei Django-Reinhardt-Klassiker “Nuages”, “Swing ’42” und “Manoir de mes rêves”, der Rest sind Titel, die wohl kaum jemand sofort ansummen könnte. Immerhin: Geographisch ist nichts ausgespart: Frankreich, England, Deutschland, Italien sind genauso vertreten wie Vertreter aus osteuropäischen Ländern oder aus Skandinavien. Joe Zawinul mag als Österreicher durchgehen, auch wenn die hier enthaltenen Titel (“In a Silent Way”, “Midnight Mood”, “Man in the Green Shirt”) eher seine amerikanische Sozialisation zeigen. Michel Petrucciani ist mit drei Titeln vertreten (“Home”, “Looking Up”, “La Champagne”), Tommy Smith, David Linx, Kenny Wheeler und der polnische Pianist Michal Tokaj gar mit vier. Aus Deutschland stammen Peter Bolte (“Miss J.”), Barbara Dennerlein (“Bo-Peep”, “Birthday Blues”), Johannes Enders (“Little Peace Waltz”), Paul Heller (“Vista”, “Relaxation”), Gregor Hübner (“910 Columbus Ave.”), Peter Lehel (“Elegie”), Hendrik Meurkens (“A Summer in San Francisco”, “Bolero Para Paquito”), Ludwig Nuss (“Night Over Lake Tarawera”) und Florian Ross (“Hal”, “Platypus”, “By Any Means Necessary”, “Getting There (Is Half The Fun)”. Bobo Stenson, NHOP, Enrico Pieranunzi, Perico Sambeat, John Dankworth, Michiel Borstlap, Anders Bergcrantz oder Stefano Di Battista sind weitere Namen hinter den mehr als 180 Kompositionen. Sicher, es ist eine willkürliche Auswahl,Lücken bleiben da nicht aus. Esbjörn Svensson, Tomasz Stanko, Michel Portal, Chano Dominguez, aber auch viele deutsche Namen kommen einem in den Sinn, die durchaus in das Buch gepasst hätten. Aber alles ließe sich eh nicht unterbringen, und es ist ein Beginn. Das Repertoire hält sich im konventionellen Bereich: Latin-Stücke, Balladen, medium und schnelle Swingnummern, Jazz-Rock, sogar Gesangstitel (Tony Lakatos’ “A Dream Come True” mit einem Text von Masha Bijlsma), etliche komplexer aufgebaute Arrangements, die sicher weniger zur Jam Session taugen als viel mehr zur Repertoireerweiterung. Alle Titel sind in Lead-Sheet-Form abgedruckt, mit Akkordsymbolen, eventuell Hinweisen zur Aufführung und Urheberrechtsverweisen. Viele der Titel lassen sich auf der Website von Sher Music ( Reisende Jazzfreunde fragen sich immer wieder, wo es wohl in der Stadt, in der sie gerade sind, auch ein Jazzlokal geben könnte. Die lokale Wochenzeitung, in der das abendliche Clubprogramm abgedruckt sein könnte, findet sich nicht in jedem Hotel. “Jazz & Blues USA” will dem abhelfen. Auf über 200 Seiten präsentiert das Buch eine Auflistung von Veranstaltungsorten in New York, Chicago, New Orleans und vielen anderen Städten der Vereinigten Staaten. Der Druck des Buches ist eher einfach, die wenigen enthaltenen Bilder in minderer Qualität. Wie bei allen solchen Führern muss man sich darüber bewusst sein, dass sich die Clubszene rasend schnell verändert – und so gibt es keine Garantie dafür, dass die im Führer enthaltenen Angaben auch noch in Jahren stimmen werden. Solche Auflistungen sind immer nur eine Bestandsaufnahme. Die bedeutendsten Clubs stehen zu Beginn mit ausführlichen Beschreibungen und Berichten über Besuche der Autoren. Da finden sich Informationen zur Geschichte des Clubs, kritische Anmerkungen zu Programm, Ausstattung und Service, Hinweise auf die zu erwartenden Kosten sowie die Telefonnummern für Reservierungen. Unter “Other Places” findet sich des weiteren eine Auflistung weiterer Veranstaltungsorte, diesmal ohne jede weitere Beschreibung, einzig mit Adressangaben, Telefonnummern und Website. Für den Touristen interessant auch das Festivalverzeichnis, vor allem aber die Rubrik “Other Information”, die für New York beispielsweise diverse Jazz-bezogene Sightseeing-Tours auflistet, Plattenläden, öffentliche Archive etc. New York, Chicago, New Orleans werden ausführlich abgehandelt, der Rest der Vereinigten Staaten nur in Kurzlistungen. Ein Index fehlt, auch gibt es keine Karten der wichtigsten Stadtkerne oder Hinweise darauf, wie man sich am besten in den jeweiligen Gegenden bewegt. Es ist klar, dass die Autoren nicht alle Clubs, nicht einmal alle Städte besuchen konnten, aber etwas mehr wäre da schon wünschenswert. Christine Bird hatte es vor Jahren mit ihrem “Jazz & Blues Lovers’ Guide” vorgemacht. An den reicht “Jazz & Blues USA” nicht heran. Zur Vorbereitung einer USA-Reise taugt das Buch aber auf jeden Fall, animiert zu Besuchen in Clubs, von denen man noch nie gehört hat. Und beim Durchblättern daheim macht es Sehnsucht auf die große weite Welt, auf musikalische Ausflüge in die Nacht.
Reisende Jazzfreunde fragen sich immer wieder, wo es wohl in der Stadt, in der sie gerade sind, auch ein Jazzlokal geben könnte. Die lokale Wochenzeitung, in der das abendliche Clubprogramm abgedruckt sein könnte, findet sich nicht in jedem Hotel. “Jazz & Blues USA” will dem abhelfen. Auf über 200 Seiten präsentiert das Buch eine Auflistung von Veranstaltungsorten in New York, Chicago, New Orleans und vielen anderen Städten der Vereinigten Staaten. Der Druck des Buches ist eher einfach, die wenigen enthaltenen Bilder in minderer Qualität. Wie bei allen solchen Führern muss man sich darüber bewusst sein, dass sich die Clubszene rasend schnell verändert – und so gibt es keine Garantie dafür, dass die im Führer enthaltenen Angaben auch noch in Jahren stimmen werden. Solche Auflistungen sind immer nur eine Bestandsaufnahme. Die bedeutendsten Clubs stehen zu Beginn mit ausführlichen Beschreibungen und Berichten über Besuche der Autoren. Da finden sich Informationen zur Geschichte des Clubs, kritische Anmerkungen zu Programm, Ausstattung und Service, Hinweise auf die zu erwartenden Kosten sowie die Telefonnummern für Reservierungen. Unter “Other Places” findet sich des weiteren eine Auflistung weiterer Veranstaltungsorte, diesmal ohne jede weitere Beschreibung, einzig mit Adressangaben, Telefonnummern und Website. Für den Touristen interessant auch das Festivalverzeichnis, vor allem aber die Rubrik “Other Information”, die für New York beispielsweise diverse Jazz-bezogene Sightseeing-Tours auflistet, Plattenläden, öffentliche Archive etc. New York, Chicago, New Orleans werden ausführlich abgehandelt, der Rest der Vereinigten Staaten nur in Kurzlistungen. Ein Index fehlt, auch gibt es keine Karten der wichtigsten Stadtkerne oder Hinweise darauf, wie man sich am besten in den jeweiligen Gegenden bewegt. Es ist klar, dass die Autoren nicht alle Clubs, nicht einmal alle Städte besuchen konnten, aber etwas mehr wäre da schon wünschenswert. Christine Bird hatte es vor Jahren mit ihrem “Jazz & Blues Lovers’ Guide” vorgemacht. An den reicht “Jazz & Blues USA” nicht heran. Zur Vorbereitung einer USA-Reise taugt das Buch aber auf jeden Fall, animiert zu Besuchen in Clubs, von denen man noch nie gehört hat. Und beim Durchblättern daheim macht es Sehnsucht auf die große weite Welt, auf musikalische Ausflüge in die Nacht. Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat mit dem großen Buch der Trompete wirklich ein umfassendes Kompendium vorgelegt, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet. Von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht das Spektrum. Keim kennt keine Berührungsängste, versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser Erwähnung oder Modernisten wie Axel Dörner. Neben den vielen ausführlichen Portraits gibt es eher lexikalisch-biographische Einträge, ein Trompeten-Kreuzworträtsel, Trompeter-Witze und -Cartoons und jede Menge an Wissenswertem rund um die Trompete. Preisspannen verschiedener Trompetenmodelle finden sich da genauso wie Kommentare zu Neuentwicklungen. Keim ist ein akribischer Dokumentar seines Instruments, in seinem Buch finden sich Instrumentalisten, die kaum irgendwo sonst erwähnt werden. So hat Keim Geburtsdaten eruiert, die sich in keinem anderen Lexikon nachschlagen lassen. Die großen Namen werden natürlich auch abgehandelt, aber man merkt schnell, dass Keims Herz eben auch den “kleinen” Vertretern des Instruments gehört, Satzspielern, jungen Musikern, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, Dixieland- und Swingmusikern, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind. Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches und mit 860 Seiten mehr als umfangreiches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr!
Der Ur-Maizer Trompeter Friedel Keim hat mit dem großen Buch der Trompete wirklich ein umfassendes Kompendium vorgelegt, das die verschiedensten Seiten des Instruments und seiner Musiker beleuchtet. Von Klassik über Jazz bis zur volkstümlichen Musik reicht das Spektrum. Keim kennt keine Berührungsängste, versteht es genauso, sich über die Kunst der Barocktrompete auszulassen wie über die Probleme, die viele Jazzer mit der Ästhetik eines Wynton Marsalis haben. Und neben den großen Stars finden auch die Satzbläser Erwähnung oder Modernisten wie Axel Dörner. Neben den vielen ausführlichen Portraits gibt es eher lexikalisch-biographische Einträge, ein Trompeten-Kreuzworträtsel, Trompeter-Witze und -Cartoons und jede Menge an Wissenswertem rund um die Trompete. Preisspannen verschiedener Trompetenmodelle finden sich da genauso wie Kommentare zu Neuentwicklungen. Keim ist ein akribischer Dokumentar seines Instruments, in seinem Buch finden sich Instrumentalisten, die kaum irgendwo sonst erwähnt werden. So hat Keim Geburtsdaten eruiert, die sich in keinem anderen Lexikon nachschlagen lassen. Die großen Namen werden natürlich auch abgehandelt, aber man merkt schnell, dass Keims Herz eben auch den “kleinen” Vertretern des Instruments gehört, Satzspielern, jungen Musikern, die durchaus auch zwischen den stilistischen Welten leben und arbeiten, Dixieland- und Swingmusikern, die eher der Amateur- als der Profiszene angehören, aber dennoch gute Musiker sind. Musiker von denen man noch nie gehört hat oder aber auch Musiker, die man persönlich kennt, aber nie in einem Lexikon vermutet hätte, weil ihr Arbeitsschwerpunkt doch eher regional begrenzt ist. Keim hat sich ihnen allen angenommen mit einem Vollständigkeitsanspruch, der jede Kritik an der Auswahl im Keim ersticken ließe (man entschuldige das Wortspiel). Und gerade in den Einträgen zu den kleinen Vertretern der Trompete erkennt man die “labor of love” dieses Buches, das zu alledem noch exzellent lesbar ist. Kein kritisches Buch vielleicht, dafür ein verlässliches und mit 860 Seiten mehr als umfangreiches Nachschlagewerk für jeden, der sich für die Trompete interessiert: eine Trompeterbibel fürwahr! Eine Biographie über einen ja doch noch relativ jungen europäischen Jazzmusiker? Nun, wenn dies überhaupt über jemanden möglich ist, so mag es wohl tatsächlich Nils Landgren sein, der die Grenzen zwischen Jazz, Soul und Pop munter überschritt, als Musiker, bandleader und sogar künstlerischer Leiter des Berliner Jazzfestes Furore machte und zu den vielleicht populärsten Musikern seines Genres hierzulande gehört. Die einen mögen die Nase rümpfen, weil Landgren sicher keiner der intellektuellen Avantgardisten ist, die die Vorhut des Jazz so oft ausmachen. Aber Landgren hat dieser Musik ein Publikum zugeführt, das von seinem erdigen Posaunenspiel genauso begeistert ist wie von den Liedern, die er im Repertoire hat und die sich in der Jazztradition genauso bedienen wie im großen Pool globaler Popmusik. Ingo Wulff und Rainer Placke ist ein schönes Buch gelungen, voll mit Beiträgen von Journalisten und Musikerkollegen des Posaunisten, die ihrem Kollegen Reverenz erweisen. Eine kritische Biographie ist dies sicher nicht, aber das Buch kann sehr wohl helfen, Landgrens Musik zu verstehen, seine Herkunft, seine Entwicklung, seinen Musikgeschmack über den Jazz hinaus. Und die Fotos allein sind den Preis des Buchs wert: Schnappschüsse und Fotos, die hinter die Kulissen blicken auf den Musiker, den Kollegen, den Macher Landgren. Zu beziehen über den Buchhandel oder direkt beim Verlag:
Eine Biographie über einen ja doch noch relativ jungen europäischen Jazzmusiker? Nun, wenn dies überhaupt über jemanden möglich ist, so mag es wohl tatsächlich Nils Landgren sein, der die Grenzen zwischen Jazz, Soul und Pop munter überschritt, als Musiker, bandleader und sogar künstlerischer Leiter des Berliner Jazzfestes Furore machte und zu den vielleicht populärsten Musikern seines Genres hierzulande gehört. Die einen mögen die Nase rümpfen, weil Landgren sicher keiner der intellektuellen Avantgardisten ist, die die Vorhut des Jazz so oft ausmachen. Aber Landgren hat dieser Musik ein Publikum zugeführt, das von seinem erdigen Posaunenspiel genauso begeistert ist wie von den Liedern, die er im Repertoire hat und die sich in der Jazztradition genauso bedienen wie im großen Pool globaler Popmusik. Ingo Wulff und Rainer Placke ist ein schönes Buch gelungen, voll mit Beiträgen von Journalisten und Musikerkollegen des Posaunisten, die ihrem Kollegen Reverenz erweisen. Eine kritische Biographie ist dies sicher nicht, aber das Buch kann sehr wohl helfen, Landgrens Musik zu verstehen, seine Herkunft, seine Entwicklung, seinen Musikgeschmack über den Jazz hinaus. Und die Fotos allein sind den Preis des Buchs wert: Schnappschüsse und Fotos, die hinter die Kulissen blicken auf den Musiker, den Kollegen, den Macher Landgren. Zu beziehen über den Buchhandel oder direkt beim Verlag:  Jazzkalender sind seit den 1960er Jahren beliebte Spielwiesen für Fotografen, die hier eine Präsentation ihrer Bilder mit dem Nützlichen verbinden können: Wo man ein Fotobuch schnell durchsieht und dann in den Schrank stellt, da nutzt man einen Kalender täglich. Und so erhalten die Fotos in Fotokalendern die Chance, immer wieder neu entdeckt zu werden, den Besitzer durch den tag, durch die Woche zu begleiten. Das Jazz Calendiary aus dem jungen jazzprezzo-Verlag lehnt sich in der Gestaltung an das Jazz Diary an, das Layouter Ingo Wulff vor einigen Jahren im Kieler Nieswandt-Verlag herausbrachte. Und dieser Tatsache allein bürgt für Qualität: gutes Papier, exzellente Druckqualität, saubere und nützliche Spiralbindung (der Kalender lässt sich tatsächlich flach auf den Schreibtisch legen). Neben dem Nützlichen dann das Schöne: Schwarzweiß- und Farbfotos von Arne Reimer, entstanden auf und hinter der Bühne, in Hamburg, Schleswig-Holstein, Nürnberg, Dresden, Leipzig und anderswo in der Welt des Jazz. Reimer hat einen Blick für die Menschen hinter der Musik, und so sind die Fotos Bilder von Menschen, die ihrem Beruf nachkommen, proben, sich unterhalten, sich auf den bevorstehenden Auftritt vorbereiten, ihre e-Mail auf dem Laptop abholen, Noten sortieren, sich konzentrieren oder einfach nur in die Kamera blicken. Die 53 Duoton- und Farbfotografien zeigen unter anderem: Geri Allen, Brian Blade, Philip Catherine, Ornette Coleman, Dave Douglas, Harry »Sweets« Edison, Bill Frisell, Johnny Griffin, Herbie Hancock, Roy Hargrove, Charlie Hunter, Abdullah Ibrahim, Hank Jones, Joachim Kühn, Nils Landgren, Abbey Lincoln, Charles Lloyd, Joe Lovano, Wynton Marsalis, Brad Mehldau, Paul Motian, Enrico Rava, Pharoah Sanders, John Scofield, Wayne Shorter, Esbjörn Svensson, Viktoria Tolstoy, Ralph Towner, Mal Waldron und viele andere. Eine limitierte Auflage von je fünfundzwanzig Exemplaren ist direkt beim Verlag erhältlich und enthält jeweils ein Original-Color-Print von Brian Blade und Hank Jones, signiert und nummeriert. Zu beziehen über den Buchhandel oder direkt beim Verlag:
Jazzkalender sind seit den 1960er Jahren beliebte Spielwiesen für Fotografen, die hier eine Präsentation ihrer Bilder mit dem Nützlichen verbinden können: Wo man ein Fotobuch schnell durchsieht und dann in den Schrank stellt, da nutzt man einen Kalender täglich. Und so erhalten die Fotos in Fotokalendern die Chance, immer wieder neu entdeckt zu werden, den Besitzer durch den tag, durch die Woche zu begleiten. Das Jazz Calendiary aus dem jungen jazzprezzo-Verlag lehnt sich in der Gestaltung an das Jazz Diary an, das Layouter Ingo Wulff vor einigen Jahren im Kieler Nieswandt-Verlag herausbrachte. Und dieser Tatsache allein bürgt für Qualität: gutes Papier, exzellente Druckqualität, saubere und nützliche Spiralbindung (der Kalender lässt sich tatsächlich flach auf den Schreibtisch legen). Neben dem Nützlichen dann das Schöne: Schwarzweiß- und Farbfotos von Arne Reimer, entstanden auf und hinter der Bühne, in Hamburg, Schleswig-Holstein, Nürnberg, Dresden, Leipzig und anderswo in der Welt des Jazz. Reimer hat einen Blick für die Menschen hinter der Musik, und so sind die Fotos Bilder von Menschen, die ihrem Beruf nachkommen, proben, sich unterhalten, sich auf den bevorstehenden Auftritt vorbereiten, ihre e-Mail auf dem Laptop abholen, Noten sortieren, sich konzentrieren oder einfach nur in die Kamera blicken. Die 53 Duoton- und Farbfotografien zeigen unter anderem: Geri Allen, Brian Blade, Philip Catherine, Ornette Coleman, Dave Douglas, Harry »Sweets« Edison, Bill Frisell, Johnny Griffin, Herbie Hancock, Roy Hargrove, Charlie Hunter, Abdullah Ibrahim, Hank Jones, Joachim Kühn, Nils Landgren, Abbey Lincoln, Charles Lloyd, Joe Lovano, Wynton Marsalis, Brad Mehldau, Paul Motian, Enrico Rava, Pharoah Sanders, John Scofield, Wayne Shorter, Esbjörn Svensson, Viktoria Tolstoy, Ralph Towner, Mal Waldron und viele andere. Eine limitierte Auflage von je fünfundzwanzig Exemplaren ist direkt beim Verlag erhältlich und enthält jeweils ein Original-Color-Print von Brian Blade und Hank Jones, signiert und nummeriert. Zu beziehen über den Buchhandel oder direkt beim Verlag:  Der Jazz in der DDR hatte über die vier Jahrzehnte realsozialistischer Existenz seine eigene Stimme entwickelt. Von den Anfängen der Amiga-Star-Bands bis zu den Klängen eines oft augenzwinkernden, recht eigenwilligen DDR-Free Jazz dokumentiert Werner Josh Sellhorn diese Szene in seinem Buch, das vor allem eine Diskographie der DDR-Jazzgeschichte darstellt. Kein historischer Abriss also, kein Fließtext, sondern einzig Plattenverzeichnis, mit Besetzungen, Ort und Datum, Titelliste, Titellänge, Veröffentlichungsdaten und eventuell erklärenden Anmerkungen. Das Buch gliedert sich dabei in sechs Abschnitte: “Jazz und Swing in der Nachkriegszeit auf Amiga”; “Aufnahmen der DDR-Jazzmusiker”; “Aufnahmen von Nicht-DDR-Musikern mit Beteiligung von DDR-Musikern”; “Aufnahmen von Nicht-DDR-Musikern in der DDR”; “Aufnahmen von Verbindungen Jazz und Literatur” sowie “Amiga-Editionen”. Ein Personen- und ein Titelregister schließt das Buch ab, das damit auf jeden Fall Grundlagen für jede weitere Erforschung zum DDR-Jazz bieten dürfte. Einziges Manko dürfte der fehlende chronologische Index sein (innerhalb der Abschnitte sind die diskographischen Kapitel nach Ensembles sortiert), aber so etwas wäre vielleicht nachzuliefern (und wenn im Internet). Viele zum Teil seltene Fotos bebildern diese Dokumentation, die für den Sammler und den Interessenten am europäischen Nachkriegsjazz interessant sein dürfte. Und der Sampler mit Aufnahmen von 1962 bis 1988, von Manfred Krug und den Jazz-Optimisten bis zu den Fun Horns erlaubt auch einen hörenden Einblick in die Besonderheiten dieser kreativen Szene.
Der Jazz in der DDR hatte über die vier Jahrzehnte realsozialistischer Existenz seine eigene Stimme entwickelt. Von den Anfängen der Amiga-Star-Bands bis zu den Klängen eines oft augenzwinkernden, recht eigenwilligen DDR-Free Jazz dokumentiert Werner Josh Sellhorn diese Szene in seinem Buch, das vor allem eine Diskographie der DDR-Jazzgeschichte darstellt. Kein historischer Abriss also, kein Fließtext, sondern einzig Plattenverzeichnis, mit Besetzungen, Ort und Datum, Titelliste, Titellänge, Veröffentlichungsdaten und eventuell erklärenden Anmerkungen. Das Buch gliedert sich dabei in sechs Abschnitte: “Jazz und Swing in der Nachkriegszeit auf Amiga”; “Aufnahmen der DDR-Jazzmusiker”; “Aufnahmen von Nicht-DDR-Musikern mit Beteiligung von DDR-Musikern”; “Aufnahmen von Nicht-DDR-Musikern in der DDR”; “Aufnahmen von Verbindungen Jazz und Literatur” sowie “Amiga-Editionen”. Ein Personen- und ein Titelregister schließt das Buch ab, das damit auf jeden Fall Grundlagen für jede weitere Erforschung zum DDR-Jazz bieten dürfte. Einziges Manko dürfte der fehlende chronologische Index sein (innerhalb der Abschnitte sind die diskographischen Kapitel nach Ensembles sortiert), aber so etwas wäre vielleicht nachzuliefern (und wenn im Internet). Viele zum Teil seltene Fotos bebildern diese Dokumentation, die für den Sammler und den Interessenten am europäischen Nachkriegsjazz interessant sein dürfte. Und der Sampler mit Aufnahmen von 1962 bis 1988, von Manfred Krug und den Jazz-Optimisten bis zu den Fun Horns erlaubt auch einen hörenden Einblick in die Besonderheiten dieser kreativen Szene. Jazzstatements verspricht das von Dietmar Hoscher herausgegebene Buch mit Fotos von Wolfgang Gonaus. Von (John) Abercrombie bis (Joe) Zawinul sind alle dabei, die im letzten Jahrzehnt in Europa zu hören waren. Die Fotos sind farbige Konzertimpressionen, Stilleben und Actionbilder der Musiker, die kurzen Texte Statements der Musiker aus Interviews zu ihrer musikalischen Haltung, zu New York, der Jazzgeschichte, den Problemen der Gegenwart, zu ihren letzten Alben etc. Kurze Statements, knappe Lektüre, zum Blättern einladend und zum Betrachten und Weiterblättern und Zurückblättern. Und ein Vorwort vom Bundespräsidenten… Felix Austria!
Jazzstatements verspricht das von Dietmar Hoscher herausgegebene Buch mit Fotos von Wolfgang Gonaus. Von (John) Abercrombie bis (Joe) Zawinul sind alle dabei, die im letzten Jahrzehnt in Europa zu hören waren. Die Fotos sind farbige Konzertimpressionen, Stilleben und Actionbilder der Musiker, die kurzen Texte Statements der Musiker aus Interviews zu ihrer musikalischen Haltung, zu New York, der Jazzgeschichte, den Problemen der Gegenwart, zu ihren letzten Alben etc. Kurze Statements, knappe Lektüre, zum Blättern einladend und zum Betrachten und Weiterblättern und Zurückblättern. Und ein Vorwort vom Bundespräsidenten… Felix Austria! Als Miles Davis 1969 “Bitches Brew” einspielte, regte sich die Jazzwelt auf: Die Verbindung jazzmusikalischer Improvisation mit Sounds, die aus dem Umfeld von Rock- und Popmusik stammten, schien wie ein Verrat an der langen Tradition afro-amerikanischer Musik. Heute ist die Fusion der 1970er Jahre ein historischer Stil, eine Entwicklung der Jazzgeschichte, die ihre Meriten hat, spannende genauso wie langweilige Ergebnisse zeitigte, Einfluss hatte oder auch nicht, eine Facette eben unter vielen anderen. Immerhin hat sie einmal mehr bewusst gemacht, dass der Jazz als Kunstmusik auf den dauernden Kontakt, die Kommunikation mit anderen musikalischen Genres zurückgreifen kann (wenn nicht gar muss, um up-to-date zu bleiben). Franz Ertls Buch “Lost grooves” ist eine Art Wegweiser durch die Welt von Fusion, JazzRock, Soul-Jazz, Jazz-Funk oder wie immer die Verbindungen aus Jazz und der Popmusik der 1950er bis 1980er Jahre genannt wurden. Es ist ein Buch für Fans: alphabetisch gegliedert nach den Künstlern und Bands, die in dieser Musik eine Rolle spielten. Von “A” wie “John Abercrombie” bis “Z” wie “Joe Zawinul” geht es da querbeet: Cannonball Adderley ist genauso dabei wie Stanley Clarke, George Duke findet sich, aber auch Steve Gadd, Herbie Hancock oder Bob James, Nils Landgreen und Kool & The Gang, Herbie Mann und Wes Montgomery, Maceo Parker, Esther Phillips, Tom Scott und Gabor Szabo. Wie immer bei solchen Sammelwerken lässt sich trefflich über die Auswahl der Künstler streiten: Walter Bishops “Fusion”-Ausflüge in den 1970er Jahren waren wohl eher stilistische Ausrutscher des Pianisten, Albert Ayler aber beispielsweise fehlt, obwohl der mit “New Grass” ein durchaus diskutierenswertes Album im Metier zwischen Free Jazz und Soul vorgelegt hatte. Aber da wird jeder Leser seine eigenen Lücken entdecken oder über Namen streiten: Ein solches Buch kann nicht dem Geschmack und Detailwissen eines jeden Lesers gerecht werden. Ertl gibt jedem der Musiker zwischen einer und drei Seiten, eine kurze musikalische Biographie, die Namen von Band- und Plattenprojekten enthält, bei denen diejenigen Musiker mitgewirkt haben, eine kurze musikalische Einschätzung und eine “CD-Auswahl” mit Plattentitel und Label. Seine Texte sind nüchtern, selten kritisch, beschreibend, kaum wertend. Nur selten setzt er musikalische Entwicklungen miteinander in Beziehung, versäumt dabei ein wenig die Chance, den Leser zum gezielten Weiterblättern zu verleiten. Vielleicht auch wäre statt der etwas sehr knappen Plattenliste eine wenigstens ein wenig ausführlichere Diskographie wünschenswert gewesen (wenigstens das Jahr der Veröffentlichung und die Original-Plattennummern gehören eigentlich dazu). Ein nützliches Nachschlagewerk ist Ertls Buch allemal, auch wenn man für weiterführende Informationen dann doch wieder auf andere Quellen zurückgreifen muss.
Als Miles Davis 1969 “Bitches Brew” einspielte, regte sich die Jazzwelt auf: Die Verbindung jazzmusikalischer Improvisation mit Sounds, die aus dem Umfeld von Rock- und Popmusik stammten, schien wie ein Verrat an der langen Tradition afro-amerikanischer Musik. Heute ist die Fusion der 1970er Jahre ein historischer Stil, eine Entwicklung der Jazzgeschichte, die ihre Meriten hat, spannende genauso wie langweilige Ergebnisse zeitigte, Einfluss hatte oder auch nicht, eine Facette eben unter vielen anderen. Immerhin hat sie einmal mehr bewusst gemacht, dass der Jazz als Kunstmusik auf den dauernden Kontakt, die Kommunikation mit anderen musikalischen Genres zurückgreifen kann (wenn nicht gar muss, um up-to-date zu bleiben). Franz Ertls Buch “Lost grooves” ist eine Art Wegweiser durch die Welt von Fusion, JazzRock, Soul-Jazz, Jazz-Funk oder wie immer die Verbindungen aus Jazz und der Popmusik der 1950er bis 1980er Jahre genannt wurden. Es ist ein Buch für Fans: alphabetisch gegliedert nach den Künstlern und Bands, die in dieser Musik eine Rolle spielten. Von “A” wie “John Abercrombie” bis “Z” wie “Joe Zawinul” geht es da querbeet: Cannonball Adderley ist genauso dabei wie Stanley Clarke, George Duke findet sich, aber auch Steve Gadd, Herbie Hancock oder Bob James, Nils Landgreen und Kool & The Gang, Herbie Mann und Wes Montgomery, Maceo Parker, Esther Phillips, Tom Scott und Gabor Szabo. Wie immer bei solchen Sammelwerken lässt sich trefflich über die Auswahl der Künstler streiten: Walter Bishops “Fusion”-Ausflüge in den 1970er Jahren waren wohl eher stilistische Ausrutscher des Pianisten, Albert Ayler aber beispielsweise fehlt, obwohl der mit “New Grass” ein durchaus diskutierenswertes Album im Metier zwischen Free Jazz und Soul vorgelegt hatte. Aber da wird jeder Leser seine eigenen Lücken entdecken oder über Namen streiten: Ein solches Buch kann nicht dem Geschmack und Detailwissen eines jeden Lesers gerecht werden. Ertl gibt jedem der Musiker zwischen einer und drei Seiten, eine kurze musikalische Biographie, die Namen von Band- und Plattenprojekten enthält, bei denen diejenigen Musiker mitgewirkt haben, eine kurze musikalische Einschätzung und eine “CD-Auswahl” mit Plattentitel und Label. Seine Texte sind nüchtern, selten kritisch, beschreibend, kaum wertend. Nur selten setzt er musikalische Entwicklungen miteinander in Beziehung, versäumt dabei ein wenig die Chance, den Leser zum gezielten Weiterblättern zu verleiten. Vielleicht auch wäre statt der etwas sehr knappen Plattenliste eine wenigstens ein wenig ausführlichere Diskographie wünschenswert gewesen (wenigstens das Jahr der Veröffentlichung und die Original-Plattennummern gehören eigentlich dazu). Ein nützliches Nachschlagewerk ist Ertls Buch allemal, auch wenn man für weiterführende Informationen dann doch wieder auf andere Quellen zurückgreifen muss. Im Jazz ist die dauernde Überarbeitung kompositorischen Materials gang und gäbe. Standards werden zwar nach wie vor mit ihren Komponisten identifiziert, vor allem aber mit exzellenten Interpretationen von Jazzmusikern. Wer weiß schon, dass “Body and Soul” eine Komposition von John W. Green ist – Jazzer kennen das Stück vor allem als Tenorsaxophon-Feature und durch die legendäre Aufnahme, die Coleman Hawkins 1939 einspielte. Das Phänomen der Coverversion in der Popmusik ist nur auf den ersten Blick ähnlich, tatsächlich geht es beim “Covern” im Pop aber um ganz anderes als beim Improvisieren über Standards im Jazz. Während der Jazzmusiker sich die thematische Grundlage aneignet, um daraus Eigenes zu machen, scheint beim Covern das ursprüngliche Original, das gecovert wird, immer wieder durch, geht der Cover-Künstler einen bewussten und offenen Dialog mit diesem ein. Marc Pendzichs Dissertation diskutiert das Phänomen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Er beginnt mit einer Definition des Begriffs. Ein erstes Großkapitel widmet sich der rechtlichen Seite insbesondere in den USA. Coverversionen tangieren schließlich immer das Urheberrecht. Im nächsten Kapitel beschäftigt sich Pendzich mit dem Forschungsstand, berichtet über den wisschenschaftlichen Diskurs zum Begriff, über musikalische Bearbeitungen in der abendländischen Musik wie im Jazz sowie über das Phänomen der “Vielfachaufnahme” in der Frühzeit der Schallplattenproduktion. Im Kapitel über die Coverversion in den 50er Jahren geht es um den Markt jener Zeit, in dem Coverversionen eine Art Reaktion der Major Companies auf die Coverversionen auf das Rock ‘n’ Roll-Fieber darstellte. Konkretes Beispiel in diesem Kapitel ist “Rock Around the Clock”, das Pendzich in der Erstaufnahme durch Sonny Dae and his Knights und der bekannten Version von Bill Haley untersucht und vergleicht. Für die 60er Jahre beschreibt der Autor den britischen Musikmarkt, das Phänomen kultureller Einflüsse und analysiert die Coverversion “Please Mr. Postman” von den Beatles. Innerhalb dieses Kapitels beleuchtet er auch einen Plagiatsprozess um George Harrisons “My Sweet Lord”, der erst nach 28 Jahren beigelegt wurde. Ein Zwischenkapitel wirft einen Blick auf die rechtliche Situation bezüglich Coverversionen in der Bundesrepublik, auf Urheberrecht und Rechtsauffassungen zu “Bearbeitung”, “Freie Nutzung”, “Änderung des Werks” und “Coverversion”. Für die 70er Jahre befasst Pendzich sich mit der Entiwkclung des Konzeptalbums und analysiert Walter Murphy’s “A Fifth of Beethoven” und berichtet über die Rechtspraxis anhand des Beispiels “Song of Joy”, einer Klassikadaption, die 1970 15 Wochen lang in den deutschen Single-Charts stand. Für die 80er Jahre beleuchtet er musikalische Ansätze anhand von Kylie Minogues “The Loco-Motion” und die rechtliche Diskussion um Weltmusik und die Ausbeutung ethnischer Drittwelt-Kulturen. Für die 90er dann geht es um Techno und Dance-Covers und das Hit-Recycling beispielsweise in den deutschen Charts. Ein eigenes Kapitel erhalten Coverversionen, die tatsächlich fremdsprachliche Übersetzungen internationaler Hits sind sowie Sonderformen des Covers, modernisierte Re-Releases, Re-Recordings, Nachproduktionen und ähnliches. Ein wichtiges Kapitel beschäftigt sich mit der “Ursachenanalyse der gegenwärtigen Coverversionen-Flut auf dem deutschen Musikmarkt”. Hier setzt sich Pendzich mit dem Zeitgeist der “Postmoderne” genauso auseinander wie mit Entwicklungen in der Musikindustrie, mit der ökonomischen Situation der Musikwirtschaft, der medialen Vermittlung und mit der Rechtswirklichkeit in der Bundesrepublik seit Anfang der 90er Jahre. Pendzichs Buch ist ein wirklicher Rundumschlag über das Phänomen – musikalisch, wirtschaftlich, rechtlich abgeklopft nach allen Seiten. Von den USA bis ins bundesdeutsche Wohnzimmer, von Plagiat bis zum Superstar-Phänomen kann man in diesen Seiten jede Menge Anregungen zum Nachdenken erhalten. Über das Phänomen der “Coverversion” im jazz wurde beim letzten Darmstädter Jazzforum ausführlich diskutiert – hierbei ging es um Musikalisches genauso wie Terminologisches. Pendzich streift das Jazzgeschehen nur am Rande – wohl zu Recht, denn die Aneignung der Jazzer macht deren Covers oft zu eigenständigen und vor allem individuellen Versionen, die mit dem reinen Cover der Popmusik wenig gemein haben. Eine CD-ROM heftet dem Buch bei und enthält weiterführende Informationen, darunter eine Datenbank “Coverversionen in den deutschen Single-Charts seit 1980”, eine quantitative Auswertung dieser Datenbank, ein Zusatzkapitel “DDR-Coverversionen von West-Titel” sowie ein ausführliches Literatur- und Quellenverzeichnis, und das Register zum Buch. “Von der Coverversion zum Hit-Recycling” ist eine gelungene Studie zwischen historischer Aufarbeitung und Festhalten des Status Quo, ein umfangreiches, scheinbar erschöpfendes Buch, das dennoch viel Anregung zum Weiterforschen im Detail vermitteln kann.
Im Jazz ist die dauernde Überarbeitung kompositorischen Materials gang und gäbe. Standards werden zwar nach wie vor mit ihren Komponisten identifiziert, vor allem aber mit exzellenten Interpretationen von Jazzmusikern. Wer weiß schon, dass “Body and Soul” eine Komposition von John W. Green ist – Jazzer kennen das Stück vor allem als Tenorsaxophon-Feature und durch die legendäre Aufnahme, die Coleman Hawkins 1939 einspielte. Das Phänomen der Coverversion in der Popmusik ist nur auf den ersten Blick ähnlich, tatsächlich geht es beim “Covern” im Pop aber um ganz anderes als beim Improvisieren über Standards im Jazz. Während der Jazzmusiker sich die thematische Grundlage aneignet, um daraus Eigenes zu machen, scheint beim Covern das ursprüngliche Original, das gecovert wird, immer wieder durch, geht der Cover-Künstler einen bewussten und offenen Dialog mit diesem ein. Marc Pendzichs Dissertation diskutiert das Phänomen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Er beginnt mit einer Definition des Begriffs. Ein erstes Großkapitel widmet sich der rechtlichen Seite insbesondere in den USA. Coverversionen tangieren schließlich immer das Urheberrecht. Im nächsten Kapitel beschäftigt sich Pendzich mit dem Forschungsstand, berichtet über den wisschenschaftlichen Diskurs zum Begriff, über musikalische Bearbeitungen in der abendländischen Musik wie im Jazz sowie über das Phänomen der “Vielfachaufnahme” in der Frühzeit der Schallplattenproduktion. Im Kapitel über die Coverversion in den 50er Jahren geht es um den Markt jener Zeit, in dem Coverversionen eine Art Reaktion der Major Companies auf die Coverversionen auf das Rock ‘n’ Roll-Fieber darstellte. Konkretes Beispiel in diesem Kapitel ist “Rock Around the Clock”, das Pendzich in der Erstaufnahme durch Sonny Dae and his Knights und der bekannten Version von Bill Haley untersucht und vergleicht. Für die 60er Jahre beschreibt der Autor den britischen Musikmarkt, das Phänomen kultureller Einflüsse und analysiert die Coverversion “Please Mr. Postman” von den Beatles. Innerhalb dieses Kapitels beleuchtet er auch einen Plagiatsprozess um George Harrisons “My Sweet Lord”, der erst nach 28 Jahren beigelegt wurde. Ein Zwischenkapitel wirft einen Blick auf die rechtliche Situation bezüglich Coverversionen in der Bundesrepublik, auf Urheberrecht und Rechtsauffassungen zu “Bearbeitung”, “Freie Nutzung”, “Änderung des Werks” und “Coverversion”. Für die 70er Jahre befasst Pendzich sich mit der Entiwkclung des Konzeptalbums und analysiert Walter Murphy’s “A Fifth of Beethoven” und berichtet über die Rechtspraxis anhand des Beispiels “Song of Joy”, einer Klassikadaption, die 1970 15 Wochen lang in den deutschen Single-Charts stand. Für die 80er Jahre beleuchtet er musikalische Ansätze anhand von Kylie Minogues “The Loco-Motion” und die rechtliche Diskussion um Weltmusik und die Ausbeutung ethnischer Drittwelt-Kulturen. Für die 90er dann geht es um Techno und Dance-Covers und das Hit-Recycling beispielsweise in den deutschen Charts. Ein eigenes Kapitel erhalten Coverversionen, die tatsächlich fremdsprachliche Übersetzungen internationaler Hits sind sowie Sonderformen des Covers, modernisierte Re-Releases, Re-Recordings, Nachproduktionen und ähnliches. Ein wichtiges Kapitel beschäftigt sich mit der “Ursachenanalyse der gegenwärtigen Coverversionen-Flut auf dem deutschen Musikmarkt”. Hier setzt sich Pendzich mit dem Zeitgeist der “Postmoderne” genauso auseinander wie mit Entwicklungen in der Musikindustrie, mit der ökonomischen Situation der Musikwirtschaft, der medialen Vermittlung und mit der Rechtswirklichkeit in der Bundesrepublik seit Anfang der 90er Jahre. Pendzichs Buch ist ein wirklicher Rundumschlag über das Phänomen – musikalisch, wirtschaftlich, rechtlich abgeklopft nach allen Seiten. Von den USA bis ins bundesdeutsche Wohnzimmer, von Plagiat bis zum Superstar-Phänomen kann man in diesen Seiten jede Menge Anregungen zum Nachdenken erhalten. Über das Phänomen der “Coverversion” im jazz wurde beim letzten Darmstädter Jazzforum ausführlich diskutiert – hierbei ging es um Musikalisches genauso wie Terminologisches. Pendzich streift das Jazzgeschehen nur am Rande – wohl zu Recht, denn die Aneignung der Jazzer macht deren Covers oft zu eigenständigen und vor allem individuellen Versionen, die mit dem reinen Cover der Popmusik wenig gemein haben. Eine CD-ROM heftet dem Buch bei und enthält weiterführende Informationen, darunter eine Datenbank “Coverversionen in den deutschen Single-Charts seit 1980”, eine quantitative Auswertung dieser Datenbank, ein Zusatzkapitel “DDR-Coverversionen von West-Titel” sowie ein ausführliches Literatur- und Quellenverzeichnis, und das Register zum Buch. “Von der Coverversion zum Hit-Recycling” ist eine gelungene Studie zwischen historischer Aufarbeitung und Festhalten des Status Quo, ein umfangreiches, scheinbar erschöpfendes Buch, das dennoch viel Anregung zum Weiterforschen im Detail vermitteln kann. Bill Evans war der wohl einflussreichste Pianist des modernen Jazz. Seine harmonische Sprache, das Interplay der Musiker seines Trios beeinflussten ganze Generationen von Pianisten und Klaviertrios bis in die heutigen Tage. “Das klingt wie Bill Evans” mag dabei sowohl als Lob als auch als Tadel verstanden werden – Lob für eine harmonische Abenteuerlust, die die Akkorde der ursprünglichen Komposition verlässt und sich in entlegene Gebiete aufmacht, Lob für ein intuitives Zusammenspiel, Kritik an klischeehaften Harmoniefortschreitungen, die sich am Muster Evans’scher Voicings orientieren. Bill Evans Trioaufnahmen mit Scott LaFaro und Paul Motion aus dem Village Vanguard von 1961 sind Legende, sie allein würden den Ruf des Pianisten belegen. Wer aber über die ganz unterschiedlichen Seiten des Pianisten erfahren will, dem sei die Lektüre des Buchs von Enrico Pieranunzi empfohlen. Pieranunzi ist selbst ein namhafter Pianist, von Evans beeinflusst, sein Buch also eine Annäherung an eines seiner Vorbilder. Sein Buch beginnt mit biografischen Notizen, über ersten Klavierunterricht oder das Studium am Southeastern Louisiana College. 1955 zog der Pianist nach New York, schrieb sich an der Mannes School of Music ein, wirkte schon kurz darauf auf der Platte “The Jazz Workshop” mit Kompositionen von George Russell mit. Und in dieser Szene machte er sich zuerst einen Namen: als swingender, harmonisch weitsichtiger Pianist, der schwierigste Partituren aus dem Kreis der damals aktuellen Third-Stream-Komponisten spielen und leichthändig interpretieren konnte. Evans wirkte in der Folge bei vielen Third-Stream-Aufführungen mit: mit Russell genauso wie mit Gunther Schuller, der ihn für das Brandeis Festival engagierte, bei dem Werke diverser Third-Stream-Komponisten uraufgeführt wurden. Spätestens hier wurde Charles Mingus auf den jungen Pianisten aufmerksam, der ihn für die Aufnahmesession zu “East Coasting” ins Studio holte. Anfang 1958 lud Miles Davis Evans ein, ein Wochenende mit ihm in Philadelphia zu verbringen. Davis suchte einen Pianisten, der dazu in der Lage war, seine neue Idee einer modalen Spielweise im Jazz zu realisieren, und Evans war ihm von Russell empfohlen worden. Von Februar bis November 1958 war Evans Davis’ Pianist, und im Februar 1959 spielte diese Besetzung mit Cannonball Adderley, John Coltrane, Paul Chambers und Jimmy Cobb das legendäre Album “Kind of Blue” ein, Etwa zur gleichen Zeit beginnt Evans seine eigenen Projekte, Trioaufnahmen, in denen er eine stärkere Verflechtung der einzelnen Stimmen anstrebt. Pieranunzi vollzieht diese Entwicklungen nach, erwähnt und diskutiert die wichtigsten Aufnahmen, in einer Sprache, die sich durchaus den technischen Details der Interpretationen annähert ohne für den musikalisch interessierten Laien unverständlich zu sein. Er konzentriert sich in der Hauptsache auf die Musik – Persönliches der einzelnen Musiker, der Tod Scott LaFaros etwa oder die dauernden Drogenprobleme des Pianisten, wird nur am Rande erwähnt. Die Trios mit Chuck Israels, Eddie Gomez und Marc Johnson finden Erwähnung, ein Schlusskapitel schließlich bringt ein Interview mit Pieranunzi über den Einfluss Evans’ und die Bedeutung dieses Buchs für ihn sowie ein Schlusswort von Marc Johnson, Evans’ letztem Bassisten. “Bill Evans. Portrait de l’artiste au piano” ist 2001 in der Originalversion in italienischer und englischer Sprache beim Stampa-Verlag (einschließlich einer CD, eingespielt vom Autoren). Die französische Übersetzung des Buchs liegt jetzt vom Verlag “rouge profond” vor. Eine deutsche Fassung gibt es bislang nicht, wäre aber durchaus wünschenswert.
Bill Evans war der wohl einflussreichste Pianist des modernen Jazz. Seine harmonische Sprache, das Interplay der Musiker seines Trios beeinflussten ganze Generationen von Pianisten und Klaviertrios bis in die heutigen Tage. “Das klingt wie Bill Evans” mag dabei sowohl als Lob als auch als Tadel verstanden werden – Lob für eine harmonische Abenteuerlust, die die Akkorde der ursprünglichen Komposition verlässt und sich in entlegene Gebiete aufmacht, Lob für ein intuitives Zusammenspiel, Kritik an klischeehaften Harmoniefortschreitungen, die sich am Muster Evans’scher Voicings orientieren. Bill Evans Trioaufnahmen mit Scott LaFaro und Paul Motion aus dem Village Vanguard von 1961 sind Legende, sie allein würden den Ruf des Pianisten belegen. Wer aber über die ganz unterschiedlichen Seiten des Pianisten erfahren will, dem sei die Lektüre des Buchs von Enrico Pieranunzi empfohlen. Pieranunzi ist selbst ein namhafter Pianist, von Evans beeinflusst, sein Buch also eine Annäherung an eines seiner Vorbilder. Sein Buch beginnt mit biografischen Notizen, über ersten Klavierunterricht oder das Studium am Southeastern Louisiana College. 1955 zog der Pianist nach New York, schrieb sich an der Mannes School of Music ein, wirkte schon kurz darauf auf der Platte “The Jazz Workshop” mit Kompositionen von George Russell mit. Und in dieser Szene machte er sich zuerst einen Namen: als swingender, harmonisch weitsichtiger Pianist, der schwierigste Partituren aus dem Kreis der damals aktuellen Third-Stream-Komponisten spielen und leichthändig interpretieren konnte. Evans wirkte in der Folge bei vielen Third-Stream-Aufführungen mit: mit Russell genauso wie mit Gunther Schuller, der ihn für das Brandeis Festival engagierte, bei dem Werke diverser Third-Stream-Komponisten uraufgeführt wurden. Spätestens hier wurde Charles Mingus auf den jungen Pianisten aufmerksam, der ihn für die Aufnahmesession zu “East Coasting” ins Studio holte. Anfang 1958 lud Miles Davis Evans ein, ein Wochenende mit ihm in Philadelphia zu verbringen. Davis suchte einen Pianisten, der dazu in der Lage war, seine neue Idee einer modalen Spielweise im Jazz zu realisieren, und Evans war ihm von Russell empfohlen worden. Von Februar bis November 1958 war Evans Davis’ Pianist, und im Februar 1959 spielte diese Besetzung mit Cannonball Adderley, John Coltrane, Paul Chambers und Jimmy Cobb das legendäre Album “Kind of Blue” ein, Etwa zur gleichen Zeit beginnt Evans seine eigenen Projekte, Trioaufnahmen, in denen er eine stärkere Verflechtung der einzelnen Stimmen anstrebt. Pieranunzi vollzieht diese Entwicklungen nach, erwähnt und diskutiert die wichtigsten Aufnahmen, in einer Sprache, die sich durchaus den technischen Details der Interpretationen annähert ohne für den musikalisch interessierten Laien unverständlich zu sein. Er konzentriert sich in der Hauptsache auf die Musik – Persönliches der einzelnen Musiker, der Tod Scott LaFaros etwa oder die dauernden Drogenprobleme des Pianisten, wird nur am Rande erwähnt. Die Trios mit Chuck Israels, Eddie Gomez und Marc Johnson finden Erwähnung, ein Schlusskapitel schließlich bringt ein Interview mit Pieranunzi über den Einfluss Evans’ und die Bedeutung dieses Buchs für ihn sowie ein Schlusswort von Marc Johnson, Evans’ letztem Bassisten. “Bill Evans. Portrait de l’artiste au piano” ist 2001 in der Originalversion in italienischer und englischer Sprache beim Stampa-Verlag (einschließlich einer CD, eingespielt vom Autoren). Die französische Übersetzung des Buchs liegt jetzt vom Verlag “rouge profond” vor. Eine deutsche Fassung gibt es bislang nicht, wäre aber durchaus wünschenswert.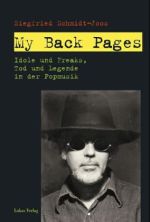 Siegfried Schmidt-Joos trägt verschiedene Paar Schuhe. Als Abteilungsleiter “Leichte Musik” beim RIAS, später in selber Funktion beim SFB, als Zuarbeiter zu fast allen Musikredaktionen der ARD, als Buchautor über Jazz, Rock, Musical und Schlager ist er seit 1959 ein wortgewandter Begleiter der populären Musikentwicklung. Er gehörte vor seiner Flucht in den Westen zu den Mitgründern des ersten offiziellen Jazzclubs in der DDR, war Konzertreferent der Deutschen Jazz Föderation, Jazzredakteur bei Radio Bremen, arbeitete für den Spiegel, interviewte viele maßgebliche Künstler, schrieb Plattentexte, Artikel, verfasste Rundfunksendungen und TV-Dokumentationen. Nun erschien mit “My Back Pages” eine Sammlung einiger seiner Texte zu Idolen der Pop-Geschichte. Die achtzehn Kapitel des Buchs berichten über Ray Charles, Sarah Vaughan und B.B. King, über die Stones, Elvis Presley, John Lennon und Bob Dylan, über Judy Garland, Barbra Streisand, Liza Minelli und andere Heroen der Popgeschichte. Sie stammen ursprünglich aus Zeitschriften wie dem Spiegel, Twen und DU sowie aus Büchern, die lange vergriffen sind. Es sind Biographien, Lebens- und Stilbeschreibungen, es ist immer der Versuch, die Menschen hinter den Idolen zu entdecken. Es sind kurze und lange Essays, unter letzteren beispielsweise seine umfassenden Darstellungen über Alexis Korner und Frank Sinatra, er lobt, kritisiert, hinterfragt, er lässt auch seine ganz persönliche Betroffenheit nicht aus dem Spiel – eine Tatsache, die ihm oft vorgeworfen wurde, die aber tatsächlich dieses Buch so überaus lesenswert machen: Objektive Tatsache, gespiegelt durch die subjektive Brille des Autors mit seiner eigenen Hörerfahrung und Meinung. Schmidt-Joos lässt uns teilhaben an seinen eigenen Erlebnissen, seinen Recherchen, seinen Begegnungen mit den Großen der Popmusik oder mit ihren Pressesprechern. Die Essays hat er teilweise überarbeitet, mit Aktualisierungen versehen. Und Schmidt-Joos’ Frau, Kathrin Brigl, hat ihren eigenen Aufsatz über Michael Jackson beigesteuert. “My Back Pages” ist eine lesenswerte Sammlung eines der überzeugendsten Autoren der deutschen Popmusikjournalistik. Und wenn es auch kein Jazzbuch ist, so kommen doch Jazzfreunde mit einer offenen Auffassung afro-amerikanischer Musikgeschichte auf ihre Kosten: Zu sehr ist Schmidt-Joos’ eigenes Musikverständnis in der afro-amerikanischen Tradition verwurzelt, aus der heraus er die popmusikalischen Entwicklungen an den Beispielen der hier herausgegriffenen “Idole” erklärt.
Siegfried Schmidt-Joos trägt verschiedene Paar Schuhe. Als Abteilungsleiter “Leichte Musik” beim RIAS, später in selber Funktion beim SFB, als Zuarbeiter zu fast allen Musikredaktionen der ARD, als Buchautor über Jazz, Rock, Musical und Schlager ist er seit 1959 ein wortgewandter Begleiter der populären Musikentwicklung. Er gehörte vor seiner Flucht in den Westen zu den Mitgründern des ersten offiziellen Jazzclubs in der DDR, war Konzertreferent der Deutschen Jazz Föderation, Jazzredakteur bei Radio Bremen, arbeitete für den Spiegel, interviewte viele maßgebliche Künstler, schrieb Plattentexte, Artikel, verfasste Rundfunksendungen und TV-Dokumentationen. Nun erschien mit “My Back Pages” eine Sammlung einiger seiner Texte zu Idolen der Pop-Geschichte. Die achtzehn Kapitel des Buchs berichten über Ray Charles, Sarah Vaughan und B.B. King, über die Stones, Elvis Presley, John Lennon und Bob Dylan, über Judy Garland, Barbra Streisand, Liza Minelli und andere Heroen der Popgeschichte. Sie stammen ursprünglich aus Zeitschriften wie dem Spiegel, Twen und DU sowie aus Büchern, die lange vergriffen sind. Es sind Biographien, Lebens- und Stilbeschreibungen, es ist immer der Versuch, die Menschen hinter den Idolen zu entdecken. Es sind kurze und lange Essays, unter letzteren beispielsweise seine umfassenden Darstellungen über Alexis Korner und Frank Sinatra, er lobt, kritisiert, hinterfragt, er lässt auch seine ganz persönliche Betroffenheit nicht aus dem Spiel – eine Tatsache, die ihm oft vorgeworfen wurde, die aber tatsächlich dieses Buch so überaus lesenswert machen: Objektive Tatsache, gespiegelt durch die subjektive Brille des Autors mit seiner eigenen Hörerfahrung und Meinung. Schmidt-Joos lässt uns teilhaben an seinen eigenen Erlebnissen, seinen Recherchen, seinen Begegnungen mit den Großen der Popmusik oder mit ihren Pressesprechern. Die Essays hat er teilweise überarbeitet, mit Aktualisierungen versehen. Und Schmidt-Joos’ Frau, Kathrin Brigl, hat ihren eigenen Aufsatz über Michael Jackson beigesteuert. “My Back Pages” ist eine lesenswerte Sammlung eines der überzeugendsten Autoren der deutschen Popmusikjournalistik. Und wenn es auch kein Jazzbuch ist, so kommen doch Jazzfreunde mit einer offenen Auffassung afro-amerikanischer Musikgeschichte auf ihre Kosten: Zu sehr ist Schmidt-Joos’ eigenes Musikverständnis in der afro-amerikanischen Tradition verwurzelt, aus der heraus er die popmusikalischen Entwicklungen an den Beispielen der hier herausgegriffenen “Idole” erklärt. Der 1953 geborene Dramatiker Enzo Cormann gehört zu den angesehensten Stimmen des zeitgenössischen französischen Theaters. In “Mingus, Cuernavaca” setzt er sich mit den letzten Tagen des Charles Mingus auseinander, der sich, 56-jährig, schwer am Lou-Gehrig-Syndrom erkrankt, im mexikanischen Cuernavaca niederlässt, zum Sterben. Fiktive Szenen sind es, in denen Cormann Mingus in Gespräche mit seiner Krankenschwester verwickelt, über das Leben und den Tod, das Hinübergehen, den Ganges und den indische Totenkult. Mingus’ Monologe reflektieren über seine Arbeit und seinen dauernden Kampf mit der Musik, mit sich selbst, mit den Kritikern, den Mitmusikern, den Clubbesitzern, der Welt. Er spricht über seine Bands, die Kompositionen, über Rassismus und die Frauen, über Eric Dolphy und Präsident Jimmy Carter, über Liebe, Glaube, Geburt und den kalten Atem des Todes, “The Chill of Death”. Das 1991 von Cormann verfasste Theaterstück ist für (mindestens) einen Schauspieler und einen Musiker gedacht. Es streicht auf lyrische Art und Weise die morbiden Tendenzen des Menschen Charles Mingus heraus, ohne die Stärke zu verleugnen, die in Mingus als Mann wie Musiker genauso vorhanden waren. Cormann macht die Dualität des Charakters deutlich, Kraft und Schmerz, Wut und Aussichtslosigkeit, wie sie sich auch in der Krankheit wiederfinden, an der Mingus letzten Endes starb.
Der 1953 geborene Dramatiker Enzo Cormann gehört zu den angesehensten Stimmen des zeitgenössischen französischen Theaters. In “Mingus, Cuernavaca” setzt er sich mit den letzten Tagen des Charles Mingus auseinander, der sich, 56-jährig, schwer am Lou-Gehrig-Syndrom erkrankt, im mexikanischen Cuernavaca niederlässt, zum Sterben. Fiktive Szenen sind es, in denen Cormann Mingus in Gespräche mit seiner Krankenschwester verwickelt, über das Leben und den Tod, das Hinübergehen, den Ganges und den indische Totenkult. Mingus’ Monologe reflektieren über seine Arbeit und seinen dauernden Kampf mit der Musik, mit sich selbst, mit den Kritikern, den Mitmusikern, den Clubbesitzern, der Welt. Er spricht über seine Bands, die Kompositionen, über Rassismus und die Frauen, über Eric Dolphy und Präsident Jimmy Carter, über Liebe, Glaube, Geburt und den kalten Atem des Todes, “The Chill of Death”. Das 1991 von Cormann verfasste Theaterstück ist für (mindestens) einen Schauspieler und einen Musiker gedacht. Es streicht auf lyrische Art und Weise die morbiden Tendenzen des Menschen Charles Mingus heraus, ohne die Stärke zu verleugnen, die in Mingus als Mann wie Musiker genauso vorhanden waren. Cormann macht die Dualität des Charakters deutlich, Kraft und Schmerz, Wut und Aussichtslosigkeit, wie sie sich auch in der Krankheit wiederfinden, an der Mingus letzten Endes starb. André Hodeir ist einer der Väter der Jazzwissenschaft. Sein Buch “Hommes et problèmes du jazz” von 1954 war vielleicht das erste wissenschaftlich angelegte analytische Buch zum Jazz überhaupt. Hodeir ist außerdem Komponist von Third-Stream-Werken, und seine schriftstellerischen Bemühungen gehen über analytische Bücher hinaus auch hinein ins literarische Oeuvre. “Le B-A-Be du Bop” erschien zuerst Ende der 1980er Jahre in der Zeitschrift “Jazz Magazine”. Es sind seine Reflektionen über die Entstehung des Bebop, mit denen er – mit 50 Jahren Abstand – der Geburt des modernen Jazz ein weiteres Mal nähert. Der Bebop, so Hodeir, sei aus der Jam Session geboren. Hodeir hält dabei durchaus Legenden hoch: die beispielsweise von der Unzufriedenheit der jungen Musiker über ihre Arbeit in den Bigbands, in denen sie eben nicht genügend Raum für ihre Improvisationen gehabt hätten. Sie seien dann etwas gefrustet nach den Tanzveranstaltungen dieser Bigbands in die kleinen Clubs von Harlem gegangen und hätten dort ihren Experimenten frönen können: “le bebop est un enfant de la nuit”. Eine andere Legende, die Hodeir zitiert ist die, dass viele der komplexen harmonischen Umdeutungen von Standards auch zum Ziel gehabt hätten, unerwünschte Einsteiger bei Sessions fernzuhalten. Solche Geschichten sind bunt und besitzen gewiss auch ein Körnchen Wahrheit, aber man würde sich wünschen, Hodeir würde sie nicht so prominent wiederkäuen, da sie sich festsetzen und die Klischee-Geschichte von der Entstehung des Bebop als einer Art Revolte gegen Bigband und weiße Musiker festzurrt anstatt die Evolution aus der harmonischen, rhythmischen und improvisatorischen Entwicklung der Jahre zuvor näher zu beleuchten. Wichtiger sind da schon die Hinweise auf die afro-amerikanische Tradition des Wettstreits, der sich im Sport genauso wie in den Jam Sessions findet (obwohl auch hier zu fragen bliebe, in welchen Verbindungen diese Traditionen mit dem gesamtgesellschaftlichen Klima, oder genauer, mit dem Rassismus in den Vereinigten Staaten steht). Im zweiten Kapitel beschreibt Hodeir die Szene der 52sten Straße, die Auftrittsmöglichkeiten für kleine Bands, die steuerlichen Erschwernisse, die mit zum Niedergang der Bigbandmode führten, den Recording Bann der American Federation of Musicians. Er nennt die beiden herausragenden Namen: Dizzy Gillespie, den harmonischen Experimentator und Erneuerer des Trompetenspiels im Jazz, und Charlie Parker, der aus Kansas City nach New York kam und ein völlig neues Konzept mitbrachte: andere Ideen, ein andere Ton, eine andere Art der Phrasierung, und bald zum Vorbild einer ganzen Generaton von Saxophonisten wurde. Es sei durchaus auch ein glücklicher Zufall im Spiel gewesen, so meint Hodeir, dass Parkers Stil so gut zu Monks und Dizzys harmonischen Einfällen passte, dass sich zu all dem Kenny Clarkes perkussive Neuerungen so hervorragend eigneten. Ein Zufall, der die Musikgeschichte verändern sollte. Im dritten Kapitel geht Hodeir auf musikalische Änderungen ein. Er beschreibt zum einen die Änderung von Hörgewohnheiten, die Tatsache, dass Jazz Mitte der 40er Jahre plötzlich nicht mehr nur Tanz-, sondern auch Hör-, Konzertmusik war. Die Tänzer hatte der Jazz mit dem Aufkommen des Bebop für immer verloren, sie wandten sich nach anfänglicher Neugier dem Mambo zu oder dem Samba, dem Cha-Cha-Cha, bevor sie in den 50er Jahren im Rock ‘n’ Roll eine neue Mode-Tanzmusik fanden. Parker entwickelte in der Hochzeit des Bebop, der zweiten Hälfte der 40er Jahre, einen virtuos-kunstvollen eigenen Stil, Gillespie schuf mit seiner Bigband eine neue Klangästhetik, aber auch ein neues Bigbandrepertoire, sorgte außerdem mit dem Engagement des kubanischen Perkussionisten Chano Pozo für den Beginn des Afro Cuban Jazz-Movement. Sein viertes Kapitel widmet Hodeir Thelonious Monk, dem so unvergleichlichen Komponisten und Pianisten. Seine Beschreibung des Monkschen Klavierspiels zeigt, wie gut Hodeir, der Analytiker, hören kann: in wenigen Worten beschreibt er die Kantigkeit und doch Stringenz melodischern, harmonischer und rhythmischer Entwicklungen in Monks Spiel. Er analysiert “Misterioso” und beschreibt die Modernität des Pianisten. Im fünften Kapitel geht Hodeir auf das Konzept der Rhythmusgruppe ein und wie es sich von Swing zum Bebop wandelte. Hier führt er die neuen Bebopthemen, die die jungen Musiker über Broadwayschlager schrieben, darauf zurück, dass sie die Tempo und Atmosphäre der Improvisationen der Themenatmosphäre angleichen wollten. Er beschreibt Charlie Parkers Improvisationsmanier – in “Koko” beispielsweise oder in “Embraceable You” und setzt sie in Vergleich zu Lester Youngs durchaus nicht minder epochaler Interpretation von “These Foolish Things”. Im letzten Kapitel schließlich beschreibt Hodeir die Gegenreaktion: den Cool Jazz der Four Brothers, Miles Davis’, die kompositorischen Wege George Russells, Charles Mingus, die Ästhetik des Modern Jazz Quartet, den Weg zum Free Jazz der 60er Jahre. Alles in allem, eine kurze nachdenkenswerte Abhandlung über den Bebop. Man hätte sich stellenweise gewünscht, Hodeir hätte für die Buchpublikation weiter ausgeholt; auch lassen sich viele Dinge in seinen anderen Büchern ausführlicher nachlesen. Und doch zeigt Hodeir, dass zu einem guten Jazzkritiker mehr gehört als ein guter Schreiber: Das Ohr muss man besitzen, den Überblick und das Talent beides mit einer exzellenten Schreibe zusammenzubringen. Und dies gelingt André Hodeir besser als vielen anderen analytischen Autoren.
André Hodeir ist einer der Väter der Jazzwissenschaft. Sein Buch “Hommes et problèmes du jazz” von 1954 war vielleicht das erste wissenschaftlich angelegte analytische Buch zum Jazz überhaupt. Hodeir ist außerdem Komponist von Third-Stream-Werken, und seine schriftstellerischen Bemühungen gehen über analytische Bücher hinaus auch hinein ins literarische Oeuvre. “Le B-A-Be du Bop” erschien zuerst Ende der 1980er Jahre in der Zeitschrift “Jazz Magazine”. Es sind seine Reflektionen über die Entstehung des Bebop, mit denen er – mit 50 Jahren Abstand – der Geburt des modernen Jazz ein weiteres Mal nähert. Der Bebop, so Hodeir, sei aus der Jam Session geboren. Hodeir hält dabei durchaus Legenden hoch: die beispielsweise von der Unzufriedenheit der jungen Musiker über ihre Arbeit in den Bigbands, in denen sie eben nicht genügend Raum für ihre Improvisationen gehabt hätten. Sie seien dann etwas gefrustet nach den Tanzveranstaltungen dieser Bigbands in die kleinen Clubs von Harlem gegangen und hätten dort ihren Experimenten frönen können: “le bebop est un enfant de la nuit”. Eine andere Legende, die Hodeir zitiert ist die, dass viele der komplexen harmonischen Umdeutungen von Standards auch zum Ziel gehabt hätten, unerwünschte Einsteiger bei Sessions fernzuhalten. Solche Geschichten sind bunt und besitzen gewiss auch ein Körnchen Wahrheit, aber man würde sich wünschen, Hodeir würde sie nicht so prominent wiederkäuen, da sie sich festsetzen und die Klischee-Geschichte von der Entstehung des Bebop als einer Art Revolte gegen Bigband und weiße Musiker festzurrt anstatt die Evolution aus der harmonischen, rhythmischen und improvisatorischen Entwicklung der Jahre zuvor näher zu beleuchten. Wichtiger sind da schon die Hinweise auf die afro-amerikanische Tradition des Wettstreits, der sich im Sport genauso wie in den Jam Sessions findet (obwohl auch hier zu fragen bliebe, in welchen Verbindungen diese Traditionen mit dem gesamtgesellschaftlichen Klima, oder genauer, mit dem Rassismus in den Vereinigten Staaten steht). Im zweiten Kapitel beschreibt Hodeir die Szene der 52sten Straße, die Auftrittsmöglichkeiten für kleine Bands, die steuerlichen Erschwernisse, die mit zum Niedergang der Bigbandmode führten, den Recording Bann der American Federation of Musicians. Er nennt die beiden herausragenden Namen: Dizzy Gillespie, den harmonischen Experimentator und Erneuerer des Trompetenspiels im Jazz, und Charlie Parker, der aus Kansas City nach New York kam und ein völlig neues Konzept mitbrachte: andere Ideen, ein andere Ton, eine andere Art der Phrasierung, und bald zum Vorbild einer ganzen Generaton von Saxophonisten wurde. Es sei durchaus auch ein glücklicher Zufall im Spiel gewesen, so meint Hodeir, dass Parkers Stil so gut zu Monks und Dizzys harmonischen Einfällen passte, dass sich zu all dem Kenny Clarkes perkussive Neuerungen so hervorragend eigneten. Ein Zufall, der die Musikgeschichte verändern sollte. Im dritten Kapitel geht Hodeir auf musikalische Änderungen ein. Er beschreibt zum einen die Änderung von Hörgewohnheiten, die Tatsache, dass Jazz Mitte der 40er Jahre plötzlich nicht mehr nur Tanz-, sondern auch Hör-, Konzertmusik war. Die Tänzer hatte der Jazz mit dem Aufkommen des Bebop für immer verloren, sie wandten sich nach anfänglicher Neugier dem Mambo zu oder dem Samba, dem Cha-Cha-Cha, bevor sie in den 50er Jahren im Rock ‘n’ Roll eine neue Mode-Tanzmusik fanden. Parker entwickelte in der Hochzeit des Bebop, der zweiten Hälfte der 40er Jahre, einen virtuos-kunstvollen eigenen Stil, Gillespie schuf mit seiner Bigband eine neue Klangästhetik, aber auch ein neues Bigbandrepertoire, sorgte außerdem mit dem Engagement des kubanischen Perkussionisten Chano Pozo für den Beginn des Afro Cuban Jazz-Movement. Sein viertes Kapitel widmet Hodeir Thelonious Monk, dem so unvergleichlichen Komponisten und Pianisten. Seine Beschreibung des Monkschen Klavierspiels zeigt, wie gut Hodeir, der Analytiker, hören kann: in wenigen Worten beschreibt er die Kantigkeit und doch Stringenz melodischern, harmonischer und rhythmischer Entwicklungen in Monks Spiel. Er analysiert “Misterioso” und beschreibt die Modernität des Pianisten. Im fünften Kapitel geht Hodeir auf das Konzept der Rhythmusgruppe ein und wie es sich von Swing zum Bebop wandelte. Hier führt er die neuen Bebopthemen, die die jungen Musiker über Broadwayschlager schrieben, darauf zurück, dass sie die Tempo und Atmosphäre der Improvisationen der Themenatmosphäre angleichen wollten. Er beschreibt Charlie Parkers Improvisationsmanier – in “Koko” beispielsweise oder in “Embraceable You” und setzt sie in Vergleich zu Lester Youngs durchaus nicht minder epochaler Interpretation von “These Foolish Things”. Im letzten Kapitel schließlich beschreibt Hodeir die Gegenreaktion: den Cool Jazz der Four Brothers, Miles Davis’, die kompositorischen Wege George Russells, Charles Mingus, die Ästhetik des Modern Jazz Quartet, den Weg zum Free Jazz der 60er Jahre. Alles in allem, eine kurze nachdenkenswerte Abhandlung über den Bebop. Man hätte sich stellenweise gewünscht, Hodeir hätte für die Buchpublikation weiter ausgeholt; auch lassen sich viele Dinge in seinen anderen Büchern ausführlicher nachlesen. Und doch zeigt Hodeir, dass zu einem guten Jazzkritiker mehr gehört als ein guter Schreiber: Das Ohr muss man besitzen, den Überblick und das Talent beides mit einer exzellenten Schreibe zusammenzubringen. Und dies gelingt André Hodeir besser als vielen anderen analytischen Autoren.