[:de]Jazz Lives. Till We Shall Meet and Never Part
von Jaap van de Klomp & Scott Yanow
Utrecht 2008 (A.W. Bruna Uitgebers)
223 Seiten
ISBN: 978-90-229-9353-8
Freier Download über
www.jaapvandeklomp.nl/jazzlives.pdf
 Enzyklopädische Bücher über Jazz gibt es zuhauf, und sieht man sich das Inhaltsverzeichnis von Jaap van de Klomps opulentem “Jazz Lives” an, so scheint es sich nicht von anderen Werken zu unterscheiden, die knappe Biographien wichtiger Jazzinterpreten versammeln. Dann aber stolpert man über die Fotos, wobei die Wortwahl gefährlich ist, denn mit diesen Fotos “stolpert” man gewissermaßen über Grabsteine. Von denen nämlich handelt dieses Buch genauso wie von den Protagonisten des Jazz. Van de Klomp hat sich aufgemacht, das Gedächtnis an Jazzmusiker zu dokumentieren, wie es sich auf Friedhöfen insbesondere in den Vereinigten Staaten zeigt. Nach Instrumenten sortiert finden sich kurze biographische Skizzen des renommierten Jazzhistorikers Scott Yanow, vor allem aber Fotos und Angaben zur Grabstelle des betreffenden Künstlers. Von Buddy Bolden bis zu Michel Petrucciani und Niels-Henning Ørsted Pedersen reicht die Bandbreite der dabei berücksichtigten Musiker, und neben den großen Stars der Jazzgeschichte, Ellington, Armstrong, Miles, Bird, Coltrane, Basie, Goodman und vielen anderen finden sich etliche in der Öffentlichkeit weit weniger bekannte Sidemen.
Enzyklopädische Bücher über Jazz gibt es zuhauf, und sieht man sich das Inhaltsverzeichnis von Jaap van de Klomps opulentem “Jazz Lives” an, so scheint es sich nicht von anderen Werken zu unterscheiden, die knappe Biographien wichtiger Jazzinterpreten versammeln. Dann aber stolpert man über die Fotos, wobei die Wortwahl gefährlich ist, denn mit diesen Fotos “stolpert” man gewissermaßen über Grabsteine. Von denen nämlich handelt dieses Buch genauso wie von den Protagonisten des Jazz. Van de Klomp hat sich aufgemacht, das Gedächtnis an Jazzmusiker zu dokumentieren, wie es sich auf Friedhöfen insbesondere in den Vereinigten Staaten zeigt. Nach Instrumenten sortiert finden sich kurze biographische Skizzen des renommierten Jazzhistorikers Scott Yanow, vor allem aber Fotos und Angaben zur Grabstelle des betreffenden Künstlers. Von Buddy Bolden bis zu Michel Petrucciani und Niels-Henning Ørsted Pedersen reicht die Bandbreite der dabei berücksichtigten Musiker, und neben den großen Stars der Jazzgeschichte, Ellington, Armstrong, Miles, Bird, Coltrane, Basie, Goodman und vielen anderen finden sich etliche in der Öffentlichkeit weit weniger bekannte Sidemen.
Yanows Texte bieten Standardkost: kurze Einführungen in Leben und Wirken der betreffenden Musiker. Es sind die Bilder der Grabstätten, die tatsächlich eine neue Sicht auf die Musiker erlauben. Da sieht man auf Charlie Parkers aktuellem Grabstein ein Tenorsaxophon. Sun Ras Grabplatte ist fast von Gras zugewachsen; Billy Strayhorns Asche wurde über dem Wasser verstreut. Die Grabsteine von Tommy Dorsey und Vic Dickenson zeigen eine Posaune, der von W.C. Handy ein Kornett. Sarah Vaughans Stein verweist auf die Sängerin als “The Devine One”, Dinah Washingtons Stein zeigt eine Krone und ihren Geburtsnamen “Ruth Jones”. Es gibt Grabsteine mit Erinnerungen an das künstlerische Wirken der dort begrabenen Musiker, andere, die einfach nur schlicht den Namen und die Lebensdaten enthalten. Es gibt Gräber, in denen auch andere Familienmitglieder beigesetzt sind, sowie Ehrengräber der Armee der Vereinigten Staaten (Zutty Singleton, Willie ‘The Lion’ Smith, Joe Henderson, Paul Gonsalves). Es gibt Gräber, die einen zusätzlichen “historical marker” erhalten haben (Charlie Christian) und andere, die eher wie Monumente wirken (Django Reinhardt, Eddie Lang). Ein simples Holzkreuz markiert das Grab Joe Zawinuls, der während der Arbeiten an dem Buch gestorben und dessen Wiener Ehrengrab noch nicht fertig war; der Grabstein für Andrew Hill steht angelehnt noch in der Werkstatt des Steinmetzes. Lionel Hamptons Grab trägt einzig die Inschrift “Hampton. Flying Home”; Clifford Jordans Urne steht im Bücherregal seiner Witwe. Ben Websters Name steht auf einem großen Findling; Kid Ory wird als “Father of Dixieland Jazz” gepriesen. Miles Davis wird als “Sir Miles Davis” erinnert und sein Grabstein ist mit der Melodie von “Solar” verziert, dessen Urheber, wie jüngst entdeckt wurde, in Wahrheit der Gitarrist Chuck Wayne war.
In seinem eigenen Vorwort beschreibt Van de Klomp die zum Teil schwierige Suche nach den Gräbern. Anfangs war es eher ein kurioses Interesse, bald dann fast eine Obsession. Einige Gräber waren einfacher zu finden, andere benötigten intensiver Recherchen, Nachfragen bei Verwandten, Stadtverwaltungen oder Spezialisten. Die meisten der amerikanischen Fotos entstanden innerhalb von drei Monaten im Jahr 2007, die Van de Klamp damit verbrachte, einigermaßen systematisch die Vereinigten Staaten abzureisen. Er beschreibt anschaulich die durchaus emotionalen Momente, die das Entdecken vieler dieser Gedenksteine für ihn bedeutete.
“Jazz Lives” erschien in der opulenten Originalausgabe im Jahr 2008. Nachdem das Buch ausverkauft und dem Autor klar war, dass es keine Neuausgabe erfahren würde, entschloss Van de Klomp sich, eine PDF-Version online frei zugängig zu machen und gestattete uns, einen Link auf das Buch zu veröffentlichen.
Wolfram Knauer (Februar 2014)
Eric Dolphy
von Guillaume Belhomme
Marseille 2008 (Le mot et le reste)
136 Seiten, 15 Euro
ISBN: 978-2-915378-535
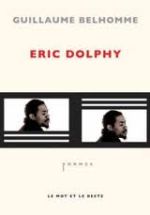 Guillaume Behommes Buch ist weniger Biographie als kommentiertes Plattenverzeichnis des Saxophonisten und Bassklarinettisten. Ein
Guillaume Behommes Buch ist weniger Biographie als kommentiertes Plattenverzeichnis des Saxophonisten und Bassklarinettisten. Ein
kurzes Anfangskapitel verfolgt Kindheit und Jugend Dolphys, dann gliedert der Autor das Buch chronologisch nach den Aufnahmen, die Dolphy vorlegte: mit Chico Hamilton, Charles Mingus, John Coltrane, Gunther Schuller, vor allem aber unter eigenem Namen. Belhomme zitiert – leider ohne genaue Verweise – aus zeitgenössischen Kritiken, ordnet die Musik ins Gesamtwerk des Künstlers ein und beendet das Buch mit einer Chronologie seines Lebens.
Wer musikalisch tiefer in Dolphys Kunst einsteigen will, wird anderswo fündig etwa im Buch “Tender Warrior. L’eredita’ musicale di Eric Dolphy”; als grundständige Biographie ist Vladimir Simosko und Barry Teppermans Buch von 1974 unübertroffen.
Für den französisch lesenden Dolphy-Einsteiger ist Belhommes Büchlein aber sicher kein Fehler.
Wolfram Knauer (Juli 2013)
Sounds of the Metropolis. The 19th-Century Popular Music Revolution in London, New York, Paris, and Vienna
von Derek B. Scott
New York 2008 (Oxford University Press)
304 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-989187-0
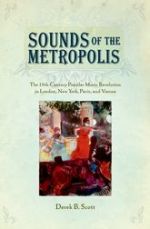 Allgemein verbindet man das Aufkommen der Idee von Popularmusik mit der Erfindung der Tonaufzeichnung, mit der Industrialisierung der Musikvermarktung, datiert die große Zeit der Unterhaltungsmusik also in den Beginn des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich aber begann die “Popularmusik-Revolution” bereits im 19. Jahrhundert und ist ein Nebeneffekt der sozialen Veränderungen, der Verstädterung der Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung.
Allgemein verbindet man das Aufkommen der Idee von Popularmusik mit der Erfindung der Tonaufzeichnung, mit der Industrialisierung der Musikvermarktung, datiert die große Zeit der Unterhaltungsmusik also in den Beginn des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich aber begann die “Popularmusik-Revolution” bereits im 19. Jahrhundert und ist ein Nebeneffekt der sozialen Veränderungen, der Verstädterung der Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung.
Im ersten Kapitel untersucht der britische Musikwissenschaftler Derek B. Scott die Zusammenhänge zwischen Professionalisierung und Kommerzialisierung des Konzertlebens im 19. Jahrhundert. Er verweist auf die zunehmende Bedeutung von Hausmusik und Notenhandel, über die Entwicklung des Klavierhandels und die ersten Urheberrechtsvereine. Im zweiten Kapitel betrachtet er die neuen Märkte (also das neue Publikum) für Kultur, die auch zu neuen Präsentationsformen führten, etwa den Promenadenkonzerten, zur Music-Hall bzw. zum Café-Concert, zu Minstrelsy, Vaudeville und Operette. Die Popularisierung von Musik ließ Kritiker an der Moral der beliebten Stücke zweifeln, und so widmet Scott Kapitel 3 seines Buchs dem Thema “Musik, Moral und soziale Ordnung”. Die große Diskussion bis in unsere Tage ist die, dass das Auseinanderdriften von populärer und Kunstmusik zu einer Konkurrenz der beiden Bereiche führte, die Scott im vierten Kapitel behandelt. Er fragt danach, wie Kunst, Geschmack und Status zusammenhängen und betrachtet die Unterschiede zwischen Oper und Operette.
Im zweiten Teil des Buchs geht es dann um konkrete musikalische Stile: den Wiener Walzer (Kapitel 5), Blackface Minstrelsy und ihre Rezeption in Europa (Kapitel 6), die englische Music Hall (Kapitel 7) sowie das Pariser Cabaret (Kapitel 8). In diesen Kapiteln verweist Scott durchaus auf spätere Entwicklungen und die Bedeutung der spezifischen Genres für die Musikgeschichte des 20sten Jahrhunderts; dabei fehlt dem Buch allerdings ein abschließend zusammenfassendes Kapitel, das die Verbindungsstränge des vom Autor Aufgezeigten in die jüngere Vergangenheit des letzten Jahrhunderts aufzeigen könnte. Auch wäre durchaus zu diskutieren, inwieweit, die in den Metropolen entwickelten Präsentationsformen von Popularmusik ihren Widerhall in anderen Städten, im Land, über die Grenzen hinweg hatten und inwieweit sie sich gegenseitig beeinflussten bzw. bedingten – es gab schließlich im 19. Jahrhundert durchaus bereits grenzüberschreitende Tourneen.
Alles in allem präsentiert “Sounds of the Metropolis” einen wichtigen Blick auf die Vorgeschichte von Popmusik und Jazz; dem Leser bleibt es überlassen zu eruieren, wo spätere Entwicklungen populärer Musik auf diese Vorgeschichte aufsetzen, wie sie sich miteinander verzahnen. Ein ausführlicher Apparat inklusive Bibliographie und Index beschließt das Buch.
Wolfram Knauer (März 2012)
Backstory in Blue. Ellington at Newport ’56
von John Fass Morton
New Brunswick 2008 (Rutgers University Press)
304 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8135-4282-9
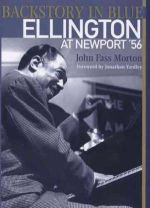 In Duke Ellingtons Karriere gab es Aufs und Abs, Erfolge und Missverständnisse. Vor allem aber ein Ereignis scheint sich ins kollektive Gedächtnis der Jazzgeschichte eingegraben zu haben: Paul Gonsalves’ legendäres Solo über “Crescendo and Decrescendo in Blue” vom 7. Juli 1956, live gespielt beim Openair-Festival in Newport, Rhode Island, eingefangen von den Mikrophonen der Voice of America und der Plattengesellschaft Columbia Records. Ellingtons Performance dieses alten Schlachtrosses und Gonsalves’ sagenumwobene 27 Chorusse umfassende Improvisation über den Blues rissen die Karriere der Band herum, machten einem großen Publikum deutlich, wie modern Ellington war und welche Kraft hinter seinem, Orchester steckte.
In Duke Ellingtons Karriere gab es Aufs und Abs, Erfolge und Missverständnisse. Vor allem aber ein Ereignis scheint sich ins kollektive Gedächtnis der Jazzgeschichte eingegraben zu haben: Paul Gonsalves’ legendäres Solo über “Crescendo and Decrescendo in Blue” vom 7. Juli 1956, live gespielt beim Openair-Festival in Newport, Rhode Island, eingefangen von den Mikrophonen der Voice of America und der Plattengesellschaft Columbia Records. Ellingtons Performance dieses alten Schlachtrosses und Gonsalves’ sagenumwobene 27 Chorusse umfassende Improvisation über den Blues rissen die Karriere der Band herum, machten einem großen Publikum deutlich, wie modern Ellington war und welche Kraft hinter seinem, Orchester steckte.
John Fass Morton hat sich in einem Buch aufgemacht, die verschiedenen Narrative hinter dem Newport-Auftritt von Duke Ellington zu erzählen, und sein Buch reiht sich ein in Studien über einflussreiche Alben, wichtige Kompositionen oder Improvisation, Monographien über akustische Momentaufnahmen der Jazzgeschichte.
Morton beginnt mit einem Rückblick auf Ellingtons Karriere, seine Bedeutung fürs schwarze Amerika, seine erste Aufnahme von “Diminuendo and Crescendo in Blue” von 1938, Erfolge in den 1920er und 1930er Jahren, ambitionierte Werke in den 1940ern und Schwierigkeiten in den 1950ern. 1955 hatte Ellington noch versucht, das langsam zum Rock ‘n’ Roll abdriftende Publikum davon zu überzeugen, dass dieser doch auch nur eine Art von Jazz sei. Im selben Jahr gelangte er am Tiefpunkt seiner Karriere an, als er ein Engagement im New Yorker Aquacades annehmen musste, um die Band am Leben zu halten, einen Gig, bei dem er unter anderem Kunstschwimmer und Eisläufer begleiten musste.
Morton betrachtet Ellingtons Band, “Dukes Instrument”, wie man sie gern bezeichnete, geht die Musiker durch, die 1956 im Orchester saßen und teilweise schon auf eine lange Zusammenarbeit mit dem Komponisten, Pianisten und Bandleader zurückblicken konnten. Er widmet ein eigenes Kapitel der Geschichte des Columbia-Labels, ein weiteres dem Produzenten George Avakian, der nicht nur einige der ersten Wiederveröffentlichungen klassischer Jazzaufnahmen für Columbia zu verantworten hatte, sondern auch an der Entwicklung des LP-Formats beteiligt war. George Wein und die Idee des Newport-Festivals sind natürlich ein Thema, und auch den Newport-Gastgebern Elaine und Louis Lorillard widmet Morton ein eigenes Kapitel. Er beschreibt das Festival von 1954 und 1955, musikalische Höhepunkte und die kritische Reflexion auf die Großveranstaltung.
Dann sind wir beim Programm für 1956, und Morton sortiert die Dramatis Personae noch einmal neu: die Rundfunkmikrophone, den Veranstalter, die auftretenden Bands, die Plattenfirma, das Publikum. Norman George Wein habe Duke gewarnt: Komm mir bloß swingend!, und die Abende zuvor hatten genau das geliefert: mitreißenden Swing, der selbst dem regnerischen Wetter trotzte. 20:30 Uhr: Ellington wird angesagt, die Band kommt auf die Bühne, wärmt sich mit ein paar Nummern auf, aber die Band blieb relativ steif. Bud Shank und Anita O’Day folgten, Friedrich Gulda und Chico Hamilton. Erst kurz vor Mitternacht kommt die Ellington-Band wieder dran, beginnt swingend, verliert dann aber langsam ihr Publikum, das Stück für Stück dem Ausgang zustrebt. Dann sagt der Duke das alte Schlachtross an, “Diminuendo in Blue” und “Crescendo in Blue”…
Morton versteht etwas von Dramaturgie, und so unterbricht er hier und schiebt erst einmal Biographisches zu Paul Gonsalves nach, bevor er schließlich die Spannung des Tenorsaxophonsolos beschreibt, das die beiden Stücke miteinander verbinden sollte und eigentlich nur als kurzes Interlude gedacht war, nicht als 27-chorus-langer Höhepunkt. Er beschreibt die Reaktionen der Zuhörer, wie Jo Jones mit der Zeitung auf die Bühne schlug und seinen Kollegen anfeuerte, wie eine junge Frau anfing zu tanzen und plötzlich auch andere im Publikum tanzten, wie das Publikum auf seine Plätze zurückstrebte, weil es merkte, dass hier irgend etwas Besonderes geschah.
Und wieder unterbricht er und erzählt die Geschichte jener unbekannten reichen Blondine, die damals Schlagzeilen machte, weil sie aufstand und einfach wild tanzte zu Gonsalves’ Solo.
Es folgt der Nachschlag: LP-Veröffentlichung; der soziale Abstieg jener reichen Blondine, die weitere Zusammenarbeit zwischen Ellington und Gonsalves, die Rolle der Voice of America für den Kalten Krieg, die weitere Entwicklung des Newport Jazz Festivals.
John Fass Morton gelingt es in seinem Buch mit den ganz unterschiedlichen Facetten, die er beleuchtet, ein lebendiges Bild der Dramatik jenes Solos zu zeichnen, dramatisch für Ellington genauso wie für die Anwesenden, für die Plattenfirma, die Fotografen und die Geschichte des Jazz. Man liest sich fest, und ich bin mir sicher, dass man im Laufe der Lektüre wiederholt die ganze Platte des Newport-Konzerts hören möchte, weil Fotos, Worte, Interviews einem das Gefühl der gemeinsamen Erinnerung geben. Als sei man dabei gewesen, damals, am 7. Juli 1956, als Paul Gonsalves die Karriere Ellingtons ein weiteres Mal drehte.
Wolfram Knauer (Oktober 2011)
Jazz für Kinder. Carla lernt Instrumente, Interpreten und Musikstile kennen
von Oliver Steger & Peter Friedl
Wien 2008 (Annette Betz)
29 Seiten, 19,95 Euro
ISBN: 978-3-219-11357-0
 Über Musik, heißt es, sollte man in jungen Jahren lernen. Das Schaffen musikalischer Neugier ist in den ersten Lebensjahren so viel erfolgversprechender als später, wenn die Musikindustrie über musikalische Mode und Hitparaden den musikalischen Geschmack weit stärker bestimmt als die eigene Neugier. Der Verlag Annette Betz hat sich auf musikalische Kinderbücher spezialisiert, Bilderbücher mit Geschichten, die ihre jungen Leser erzählerisch in die Welt der Musik einführen. In Oliver Stegers “Jazz für Kinder” entdeckt die kleine Carla in einem Pavillon im Garten des neuen Hauses, in das sie mit ihrer Familie gezogen ist, lauter verstaubte Instrumente. Diese, erzählen sie Carla, spielen gerne Jazz, und Carla fragt nach: “Was ist denn das, Jazz?” Papa erzählt ihr auf ihre Frage von den Wurzeln des Jazz in Afro-Amerika, von Jazz als Musik der Freiheit und Musik zum Tanzen. Am nächsten Tag erklärt das Schlagzeug ihr die Geheimnisse des Rhythmus und des swing, das Klavier jene der Harmonik, der Bass die der Improvisation. Um ihr das alles näher zu bringen, improvisieren die drei ein wenig über “Bruder Jakob”, das Carla gerade in der Schule singt. Carlas Neugier ist geweckt, bald erfährt sie etwas über Bebop, das solistische Spiel, über Ragtime, Fats Waller, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Ellington, Basie, die Bigband, den Wandel des Jazz von einer Unterhaltungsmusik zu einer Kunstform. Sie lernt das Blue-Note-Label kennen, den Unterschied zwischen Cool Jazz und Hard Bop, hört von Westcoast- und modalem Jazz, Free Jazz, der Fusion des JazzRock in den 1970er, dem New Bop in den 1980er und dem Nu Jazz in den 1990er Jahren – und den jeweiligen Protagonisten dieser Stile. Und weil es nun mal weit anschaulicher ist, all das auch zu hören, spielen die drei Instrumente “Bruder Jakob” in den unterschiedlichsten Stilarten. Die dem Buch beiheftende CD enthält all diese Varianten à la Charlie Parker, Louis Armstrong, Ellington, Chet Baker, John Coltrane, Bill Evans, Stan Getz, Charlie Haden, Herbie Hancock, Chick Corea, Dave Holland und sogar – “als “Bruder Manfred” – ECM. Die drei Musiker der CD sind die Pianistin Julia Siedl, der Schlagzeuger Hans Tanschek sowie der Autor selbst am Kontrabass; in zwei Stücken kommt noch der Trompeter Lorenz Raab hinzu. Das von Peter Friedl reich illustrierte Buch gibt dabei auf 29 Seiten weit eingehendere Informationen als sie viele dem Jazz nicht nahe stehende Erwachsene haben – das alles auf eine so angenehm spielerische und spannende Weise, dass zu hoffen ist, dass wer immer dieses Buch als Kind liest oder vorgelesen bekommt, dabei bleibt, dass ihm oder ihr die Türen zum Jazz damit geöffnet wurden.
Über Musik, heißt es, sollte man in jungen Jahren lernen. Das Schaffen musikalischer Neugier ist in den ersten Lebensjahren so viel erfolgversprechender als später, wenn die Musikindustrie über musikalische Mode und Hitparaden den musikalischen Geschmack weit stärker bestimmt als die eigene Neugier. Der Verlag Annette Betz hat sich auf musikalische Kinderbücher spezialisiert, Bilderbücher mit Geschichten, die ihre jungen Leser erzählerisch in die Welt der Musik einführen. In Oliver Stegers “Jazz für Kinder” entdeckt die kleine Carla in einem Pavillon im Garten des neuen Hauses, in das sie mit ihrer Familie gezogen ist, lauter verstaubte Instrumente. Diese, erzählen sie Carla, spielen gerne Jazz, und Carla fragt nach: “Was ist denn das, Jazz?” Papa erzählt ihr auf ihre Frage von den Wurzeln des Jazz in Afro-Amerika, von Jazz als Musik der Freiheit und Musik zum Tanzen. Am nächsten Tag erklärt das Schlagzeug ihr die Geheimnisse des Rhythmus und des swing, das Klavier jene der Harmonik, der Bass die der Improvisation. Um ihr das alles näher zu bringen, improvisieren die drei ein wenig über “Bruder Jakob”, das Carla gerade in der Schule singt. Carlas Neugier ist geweckt, bald erfährt sie etwas über Bebop, das solistische Spiel, über Ragtime, Fats Waller, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Ellington, Basie, die Bigband, den Wandel des Jazz von einer Unterhaltungsmusik zu einer Kunstform. Sie lernt das Blue-Note-Label kennen, den Unterschied zwischen Cool Jazz und Hard Bop, hört von Westcoast- und modalem Jazz, Free Jazz, der Fusion des JazzRock in den 1970er, dem New Bop in den 1980er und dem Nu Jazz in den 1990er Jahren – und den jeweiligen Protagonisten dieser Stile. Und weil es nun mal weit anschaulicher ist, all das auch zu hören, spielen die drei Instrumente “Bruder Jakob” in den unterschiedlichsten Stilarten. Die dem Buch beiheftende CD enthält all diese Varianten à la Charlie Parker, Louis Armstrong, Ellington, Chet Baker, John Coltrane, Bill Evans, Stan Getz, Charlie Haden, Herbie Hancock, Chick Corea, Dave Holland und sogar – “als “Bruder Manfred” – ECM. Die drei Musiker der CD sind die Pianistin Julia Siedl, der Schlagzeuger Hans Tanschek sowie der Autor selbst am Kontrabass; in zwei Stücken kommt noch der Trompeter Lorenz Raab hinzu. Das von Peter Friedl reich illustrierte Buch gibt dabei auf 29 Seiten weit eingehendere Informationen als sie viele dem Jazz nicht nahe stehende Erwachsene haben – das alles auf eine so angenehm spielerische und spannende Weise, dass zu hoffen ist, dass wer immer dieses Buch als Kind liest oder vorgelesen bekommt, dabei bleibt, dass ihm oder ihr die Türen zum Jazz damit geöffnet wurden.
Wolfram Knauer (Januar 2011)
Giorgio Gaslini. Lo Sciamano del jazz
von Lucrezia De Domizio Durini
Milano 2008 (Silvana Editoriale)
200 Seiten, 30,00 Euro
ISBN: 9-788836-612727
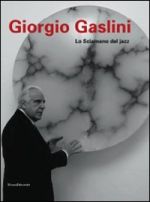 Giorgio Gaslini ist einer der führenden italienischen Jazzer, ein Musiker, der seit den 1950er Jahren die afro-amerikanischen Traditionen des Jazz mit den eigenen Traditionen der italienischen Kultur, aber auch der italienischen und europäischen Moderne zu verbinden trachtete. Er ist Pianist, Komponist, Maler, Intellektueller und kreativ Suchender, und so ist das vorliegende Buch, eine von mehreren Publikationen, die um seinen 80sten Geburtstag im Jahr 2009 erschienen, nicht so sehr eine klassische Biographie als vielmehr ein Einlassen auf all die verschiedenen kreativen Eingriffe, die Gaslini durch seine Musik und seine Kunst ins Leben, in die Wirklichkeit vornehmen wollte. Gleich im ersten Satz stellt Lucrezia de Domizio Durini den Pianisten und Komponisten bewundernd in eine Reihe mit “großen Persönlichkeiten, denen ich in meinem Leben begegnet bin”: Pier Paolo Pasolini, Joseph Beuys, Hans Georg Gadamer, Harald Szeemann, Andy Warhol und Pierre Restany. Sie scheint so den Ton für die Biographie eines Intellektuellen zu setzen. Typische Jazzfotos fehlen fast gänzlich, Bilder von Gaslini in verrauchten Clubs etwa, bei Festivals, mit amerikanischen Kollegen oder ähnlichen jazz-typischen Themen. Stattdessen nahm die Autorin einen eigenen Fotografen mit zu den Gesprächen, Gino Di Paolo, dessen Bilder Gaslini am Schreibtisch zeigen, beim tiefen Gespräch, immer irgendwie entspannt-konzentriert, ob beim Essen, Lesen, Spazierengehen, Reden, Rauchen oder Komponieren. Am persönlichsten wirkt da noch ein gestelltes Bild mit Boxhandschuhen am Sparringball.
Giorgio Gaslini ist einer der führenden italienischen Jazzer, ein Musiker, der seit den 1950er Jahren die afro-amerikanischen Traditionen des Jazz mit den eigenen Traditionen der italienischen Kultur, aber auch der italienischen und europäischen Moderne zu verbinden trachtete. Er ist Pianist, Komponist, Maler, Intellektueller und kreativ Suchender, und so ist das vorliegende Buch, eine von mehreren Publikationen, die um seinen 80sten Geburtstag im Jahr 2009 erschienen, nicht so sehr eine klassische Biographie als vielmehr ein Einlassen auf all die verschiedenen kreativen Eingriffe, die Gaslini durch seine Musik und seine Kunst ins Leben, in die Wirklichkeit vornehmen wollte. Gleich im ersten Satz stellt Lucrezia de Domizio Durini den Pianisten und Komponisten bewundernd in eine Reihe mit “großen Persönlichkeiten, denen ich in meinem Leben begegnet bin”: Pier Paolo Pasolini, Joseph Beuys, Hans Georg Gadamer, Harald Szeemann, Andy Warhol und Pierre Restany. Sie scheint so den Ton für die Biographie eines Intellektuellen zu setzen. Typische Jazzfotos fehlen fast gänzlich, Bilder von Gaslini in verrauchten Clubs etwa, bei Festivals, mit amerikanischen Kollegen oder ähnlichen jazz-typischen Themen. Stattdessen nahm die Autorin einen eigenen Fotografen mit zu den Gesprächen, Gino Di Paolo, dessen Bilder Gaslini am Schreibtisch zeigen, beim tiefen Gespräch, immer irgendwie entspannt-konzentriert, ob beim Essen, Lesen, Spazierengehen, Reden, Rauchen oder Komponieren. Am persönlichsten wirkt da noch ein gestelltes Bild mit Boxhandschuhen am Sparringball.
Das Interesse der Autorin an Gaslini aber beginnt erst einmal scheinbar abseits des Jazz: mit einem Essay über seine Aquarelle und mit der Abbildung einer jüngeren Aquarellserie von 1997. Die Autorin ist beeindruckt von dem Mann und ihren Begegnungen mit ihm, und ihr Kapitel über seine “charmante Physiognomie” liest sich wie eine Liebeserklärung, die, um nicht zu persönlich zu werden, plötzlich die Daten aus seinem Pass einstreuen muss, aber gleich darauf Querverbindungen zwischen Physiognomie und Geist zieht. Er sei wie ein Schamane, meint sie (so auch der Untertitel des Buchs), habe als Kind entdeckt, dass er durch das Klavier, dass er durch Musik Dinge ausdrücken konnte, die anders nicht zu formulieren waren. Musik sei für ihn therapeutisch gewesen, aber zugleich eine Möglichkeit, Menschen aller Nationen oder sozialer Gruppen ansprechen zu können.
Die Baroness Lucrezia De Domizio Durini, sollte man an dieser Stelle erwähnen, ist von Haus aus keine Jazz-, sondern eine renommierte Kunstexpertin, Kuratorin vielbeachteter Ausstellungen, Kunstsammlerin mit Schwerpunkt aktueller Kunst sowie Autorin etwa von 20 Büchern über Joseph Beuys’ Philosophie. Und so nimmt es nicht Wunder, dass sie auf diesen immer wieder zurückkommt, nicht nur, wenn sie sich ausführlich mit Gaslini über ein neues Werk unterhält, das den Titel trägt “Il Bosco di Beuys” (Der Wald von Beuys) und auf dessen 7.000 Eichen bei der Dokumenta 1982 in Kassel Bezug nimmt. Ihr Text bleibt persönlich, wechselt zwischen Erinnerungen an andere Künstler, denen sie begegnet ist, detaillierten Beschreibungen der Gesprächssituationen (zu Hause, im Büro, im Restaurant), Einordnungen in die Kunstgeschichte (mehr als in die Jazzgeschichte, von der die Baroness Durini nicht ganz so viel versteht). Doch soll all das Giorgio Gaslini vor allem für das Interview vorbereiten, bei dem er dann recht offenherzig über seine Kindheit und seine Familie Auskunft gibt oder über das Kulturverständnis seines Vaters… Dann heißt es, um ihren Stil ein wenig zu erklären: “Wir entschlossen uns eine Pause zu machen. Lino bot uns einen guten Kaffee an, wir rauchten still eine Zigarette. Giorgio ging zum Fenster und schaute in das Tor der Träume…”
Gaslini berichtet über den Krieg und seine erste Faszination durch den Jazz. Vielleicht weil Durini von Jazz aber wirklich nicht so viel weiß, unterhalten sie sich lieber über Philosophie, über klassische Musik, Adorno, die Liebe, seine Frau, ein klein wenig über Stan Kenton. Ein kurzes Liebesbekenntnis zum Jazz folgt, wieder eingeleitet durch den Rückbezug auf Bach, Mozart, Wagner, und ein Benennen der afro-amerikanischen Einflüsse: Duke Ellington an erster Stelle, Max Roach, Lennie Tristano, Oscar Peterson, Bill Evans, Cecil Taylor, Ornette Coleman, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, John Coltrane, Miles Davis…
Vielleicht ist das Unwissen der Autorin über den Jazz Grund für die vielen seltsamen Schreib- (bzw. Transkriptions-)fehler, die sich in ihrem Buch finden, die aber gerade bei einem so renommierten Verlag eigentlich einem Lektor hätten auffallen müssen. So liest man etwa von “Buddy Golden” (statt “Buddy Bolden”, S. 24), von “Jene” statt “Gene” Krupa (S. 83), von “Hornet” Coleman (S. 88), einem gewissen Herrn “Shoemberg” (Arnold Schönberg, S. 103) oder einer (einer???) “Riga” Polillo (S. 145) – gemeint ist der italienische Joachim Ernst Berendt, Jazzautor Arrigo Polillo. Am lustigsten liest sich in dieser mehr zufällig zusammengestellten Liste von Schreibfehlern der offenbar berühmte Bigbandleiter “Towm Besi” (S. 129) – der Rezensent braucht eine Weile, um hinter diesem “Count Basie” zu erkennen. Von solchen Ärgernissen abgesehen ist das Buch eine liebevolle, äußerst literarische und in ihrer Art und Weise überaus persönliche Annäherung an den Menschen und Künstler Giorgio Gaslini, und wenn man der Autorin auch ein besseres Lektorat gewünscht hätte, so würde man sich unter Jazzautoren tatsächlich auch öfters “Fachfremde” wünschen, die offenbar ganz andere Dinge aus ihren Subjekten herauszukitzeln vermögen als wir Experten.
Wolfram Knauer (September 2010)
Jazz Lyrik Prosa. Zur Geschichte von drei Kultserien
Von Werner Josh Sellhorn
Berlin 2008 (Ch. Links Verlag)
158 Seiten, 14,90 Euro
ISBN: 978-3-86153-581-2
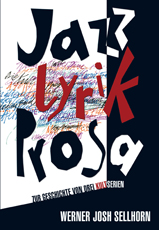 Jazz, Lyrik und Prosa waren in DDR populäre Genres, sicher auch, weil in ihnen Befindlichkeiten mitteilbar waren, die offen auszudrücken im System eher schwierig, wenn nicht gar gefährlich war. Werner Josh Sellhorn arbeitete Anfang der 1960er Jahre als Lektor im Verlag Kultur und Fortschritt, dem führenden Verlag des Landes für internationale Literatur. 1964 kam der Verlag auf die Idee eine Veranstaltungsreihe “Lyrik und Jazz” zu etablieren, bei der etwa die Jazz-Optimisten auftraten und Schauspieler wie Manfred Krug, Angelika Domröse oder Eva-Maria Hagen. Der Auftritt Wolf Biermanns und eine ein Jahr später veröffentlichte Platte des Dichters und Sängers machten den Veranstaltern zwar Ärger, steigerten aber nur die Popularität der Reihe. Bald kam neben älterem auch zeitgenössischer Jazz hinzu (etwa in Person des Pianisten Joachim Kühn) und neben Lyrik auch Prosa. 1967/67 ging die Reihe “Lyrik – Jazz – Prosa” zu Ende und wurde von verschiedenen anderen Reihen gefolgt, etwa “Jazz und Tanz” oder “Jazz & Folksongs”. Nach einer Einführung in die eben beschriebene Genese der drei Reihen machen den Hauptteil des vom 2009 verstorbenen Reihengründers Sellhorn verfassten Buchs biographische Skizzen der beim Musikteil der Veranstaltung aufgetretenen Interpreten aus – Musiker und Bands genauso wie Schauspieler. Zum Schluss listet Sellhorn noch eine Übersicht über Sonderprogramme seit 1999 auf sowie LP- und CD-Veröffentlichungen, die aus der Reihe hervorgegangen sind. “Jazz Lyrik Prosa” wirft ein sehr direktes Licht auf die Jazzszene der DDR, die Möglichkeiten und die Probleme, mit denen Macher umzugehen hatten, wenn sie kreative Projekte realisieren wollten. Lesenswert und mit etlichen kleinen Informationen, die sich wahrscheinlich nirgends sonst finden.
Jazz, Lyrik und Prosa waren in DDR populäre Genres, sicher auch, weil in ihnen Befindlichkeiten mitteilbar waren, die offen auszudrücken im System eher schwierig, wenn nicht gar gefährlich war. Werner Josh Sellhorn arbeitete Anfang der 1960er Jahre als Lektor im Verlag Kultur und Fortschritt, dem führenden Verlag des Landes für internationale Literatur. 1964 kam der Verlag auf die Idee eine Veranstaltungsreihe “Lyrik und Jazz” zu etablieren, bei der etwa die Jazz-Optimisten auftraten und Schauspieler wie Manfred Krug, Angelika Domröse oder Eva-Maria Hagen. Der Auftritt Wolf Biermanns und eine ein Jahr später veröffentlichte Platte des Dichters und Sängers machten den Veranstaltern zwar Ärger, steigerten aber nur die Popularität der Reihe. Bald kam neben älterem auch zeitgenössischer Jazz hinzu (etwa in Person des Pianisten Joachim Kühn) und neben Lyrik auch Prosa. 1967/67 ging die Reihe “Lyrik – Jazz – Prosa” zu Ende und wurde von verschiedenen anderen Reihen gefolgt, etwa “Jazz und Tanz” oder “Jazz & Folksongs”. Nach einer Einführung in die eben beschriebene Genese der drei Reihen machen den Hauptteil des vom 2009 verstorbenen Reihengründers Sellhorn verfassten Buchs biographische Skizzen der beim Musikteil der Veranstaltung aufgetretenen Interpreten aus – Musiker und Bands genauso wie Schauspieler. Zum Schluss listet Sellhorn noch eine Übersicht über Sonderprogramme seit 1999 auf sowie LP- und CD-Veröffentlichungen, die aus der Reihe hervorgegangen sind. “Jazz Lyrik Prosa” wirft ein sehr direktes Licht auf die Jazzszene der DDR, die Möglichkeiten und die Probleme, mit denen Macher umzugehen hatten, wenn sie kreative Projekte realisieren wollten. Lesenswert und mit etlichen kleinen Informationen, die sich wahrscheinlich nirgends sonst finden.
Wolfram Knauer (August 2010)
Images of Live Jazz Performances
von Albert Kösbauer
Landsberg 2008 (Balaena Verlag)
214 Seiten, 19,80 Euro
ISBN: 978-3-00-024673-9
 Albert Kösbauer erzählt im Vorwort seines Bildbandes, dass er seit langem bei Regensburger Jazzkonzerten fotografiere. Sein Platz sei in der vordersten Stuhlreihe, links oder rechts von der Bühne. Er wahre Abstand, halte sich im Hintergrund und habe immer wieder mit der Lichtsituation zu kämpfen. Auf Blitzlicht habe er dennoch immer verzichtet und lieber Geduld und wachsende Erfahrung genutzt, um von jedem Musiker “wenigstens ein brauchbares Bild einzufangen”. Auf über 200 Seiten sieht man derer etliche, “brauchbare”, aussagestarke Bilder, solche, die wie Stillleben wirken und solche, die Bewegung ausstrahlen – bis hin in verzerrte Details, weil die Künstler nun mal nicht stillhielten während der Belichtungsphase der Kamera. Ein buntes Buch ist es geworden, möchte man sagen, auch wenn alle Fotos schwarz-weiß sind und man beim Durchblättern eher den Eindruck von Grautönen erhält. Die abgelichteten Künstler aufzuzählen macht wenig Sinn, aber vielleicht gibt ein zufälliges Durchblättern etwas Aufschluss über den Inhalt: Aladar Pegè mit ruhigem Blick, aber augenscheinlich flinken Fingern am Kontrabass; Christy Doran mit konzentriertem Blick auf … Noten? die Technik am Boden?; Carsten Daerr am Flügel, den Blick lauschend zur Seite nach unten gerichtet; Carola Gray durch die Lichteffekte ihrer Beckenarbeit hindurch fotografiert; Joachim Ulrich, nicht spielend, zuhörend, das Instrument umarmend; Lajos Dudas mit angewinkeltem Knie; Arkady Shilkloper am nicht enden wollenden Alphorn; Lisa Wahlandt, skandinavische Schönheit ohne Schminke; William Parker, abgeklärt an Kontrabass und afrikanischer Gitarre (guimbri); Maria Joaos Intensität und so viele andere Momente, die den Live-Charakter des Konzerts einfangen, wie es Kösbauer ja auch im Buchtitel benennt. Keine Bilder abseits der Bühne – alle Musiker sind bei der Arbeit, konzentriert, nachdenklich, ekstatisch, mit befreitem Lachen, mit großen Ohren. Die Musiker, die man selbst erlebt hat, erkennt man wieder, man meint ihren Sound zu hören, weil Kösbauer die Erinnerung an genau jene Momente einfängt, die einen selbst fasziniert hatten. Für Fotoliebhaber also ein schönes Buch im quadratischen Softcoverumschlag, mit einem hilfreichen Namensindex der abgelichteten Künstler am Schluss und … mit jeder Menge Respekt vor der Musik.
Albert Kösbauer erzählt im Vorwort seines Bildbandes, dass er seit langem bei Regensburger Jazzkonzerten fotografiere. Sein Platz sei in der vordersten Stuhlreihe, links oder rechts von der Bühne. Er wahre Abstand, halte sich im Hintergrund und habe immer wieder mit der Lichtsituation zu kämpfen. Auf Blitzlicht habe er dennoch immer verzichtet und lieber Geduld und wachsende Erfahrung genutzt, um von jedem Musiker “wenigstens ein brauchbares Bild einzufangen”. Auf über 200 Seiten sieht man derer etliche, “brauchbare”, aussagestarke Bilder, solche, die wie Stillleben wirken und solche, die Bewegung ausstrahlen – bis hin in verzerrte Details, weil die Künstler nun mal nicht stillhielten während der Belichtungsphase der Kamera. Ein buntes Buch ist es geworden, möchte man sagen, auch wenn alle Fotos schwarz-weiß sind und man beim Durchblättern eher den Eindruck von Grautönen erhält. Die abgelichteten Künstler aufzuzählen macht wenig Sinn, aber vielleicht gibt ein zufälliges Durchblättern etwas Aufschluss über den Inhalt: Aladar Pegè mit ruhigem Blick, aber augenscheinlich flinken Fingern am Kontrabass; Christy Doran mit konzentriertem Blick auf … Noten? die Technik am Boden?; Carsten Daerr am Flügel, den Blick lauschend zur Seite nach unten gerichtet; Carola Gray durch die Lichteffekte ihrer Beckenarbeit hindurch fotografiert; Joachim Ulrich, nicht spielend, zuhörend, das Instrument umarmend; Lajos Dudas mit angewinkeltem Knie; Arkady Shilkloper am nicht enden wollenden Alphorn; Lisa Wahlandt, skandinavische Schönheit ohne Schminke; William Parker, abgeklärt an Kontrabass und afrikanischer Gitarre (guimbri); Maria Joaos Intensität und so viele andere Momente, die den Live-Charakter des Konzerts einfangen, wie es Kösbauer ja auch im Buchtitel benennt. Keine Bilder abseits der Bühne – alle Musiker sind bei der Arbeit, konzentriert, nachdenklich, ekstatisch, mit befreitem Lachen, mit großen Ohren. Die Musiker, die man selbst erlebt hat, erkennt man wieder, man meint ihren Sound zu hören, weil Kösbauer die Erinnerung an genau jene Momente einfängt, die einen selbst fasziniert hatten. Für Fotoliebhaber also ein schönes Buch im quadratischen Softcoverumschlag, mit einem hilfreichen Namensindex der abgelichteten Künstler am Schluss und … mit jeder Menge Respekt vor der Musik.
Wolfram Knauer (Juli 2010)
Three Wishes. An Intimate Look at Jazz Greats
Von Pannonica de Koenigswarter
New York 2008 (Abrams Image)
ISBN 978-0-81097-2-353 (9,99 Dollar)
 Diese Rezension stammt vom April 2007, aber da es sich sowohl bei der deutschen Fassung des Buchs von 2007 wie auch bei der englischen Fassung von 2008 um bloße Übersetzungen handelt, gilt das darin gesagte noch immer. Für die vorliegende englische Fassung kommt allerdings hinzu: Gary Giddins hat ein lesenswertes Vorwort geschrieben, und die Antworten hier in der Originalsprache gehalten sind. Albert Mangelsdorff, so lernen wir hier, wurde von der Baronin so notiert wie sie ihn gehört hatte, mit einem typisch deutschen Akzent (“I vish that people all over the vorld vould get smart enough that there vould be peace forever”).
Diese Rezension stammt vom April 2007, aber da es sich sowohl bei der deutschen Fassung des Buchs von 2007 wie auch bei der englischen Fassung von 2008 um bloße Übersetzungen handelt, gilt das darin gesagte noch immer. Für die vorliegende englische Fassung kommt allerdings hinzu: Gary Giddins hat ein lesenswertes Vorwort geschrieben, und die Antworten hier in der Originalsprache gehalten sind. Albert Mangelsdorff, so lernen wir hier, wurde von der Baronin so notiert wie sie ihn gehört hatte, mit einem typisch deutschen Akzent (“I vish that people all over the vorld vould get smart enough that there vould be peace forever”).
Wenn man früh im Jahr ein Buch auf den Tisch bekommt, das man sofort als das Weihnachtsgeschenk des Jahres empfindet, dann ist das sicher beste Voraussetzung für eine positive Buchempfehlung. So jedenfalls ging es diesem Rezensenten, als das Buch der drei Wünsche von Pannonica de Koenigswarter auf seinem Schreibtisch landete. Die Baroness war Freundin und Muse vieler Jazzmusiker, allen voran Thelonious Monk, der ihr (wie andere Musiker auch) eine Komposition widmete. Die Baroness wurde 1913 in die Bankiersfamilie der Rothschilds hineingeboren. 1954 hörte sie Monk in Paris und zog bald darauf nach New York. Traurige Berühmtheit erlangte sie durch die Tatsache, dass Charlie Parker, ein weiterer ihrer guten Freunde, in ihrem Apartment verstarb. Über die Jahre blieb sie ihren Musikerfreunden treu, half, wo immer sie konnte, insbesondere Monk, dem sie bei Streits um die Cabaret Card und bei anderen Krisen beistand. Nica, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, starb im November 1988. Über all die Jahre hatte sie ihren Musikerfreunden bei passender Gelegenheit jene legendäre Frage nach den drei Wünschen gestellt: Wenn Du drei Wünsche frei hättest, welche wären das. 300 Antworten finden sich in diesem Buch, teils kurz, teils etwas länger, teils lapidar, teils bezeichnend. Geld wünschen sich etliche, Gesundheit, Weltfrieden und privates Glück. Dass er sich nicht länger verpflichtet fühle, für Geld zu spielen (Dizzy Gillespie), dass er sich selbst besser kennenlerne (Johnny Griffin), dass seine Söhne sich endlich benehmen würden und Koenigswarter ihn heirate (Art Blakey), all das auf seinem Instrument zu erreichen, was er sich vorstelle (Sonny Rollins), ein Apartment mit einem guten Steinway und einer guten Stereoanlage (Barry Harris), Unsterblichkeit, Reichtum und ein Kind (Horace Silver), der weltbeste Künstler auf seinem Instrument zu sein (Hank Jones), dass er sein Asthma loswerde (Lou Donaldson), dass Charlie Parker wieder lebe (Art Taylor), sein Leben lang Musik spielen zu können, außerdem ein Apartment und ein Auto in New York (Eric Dolphy), eine Villa in Göteborg (Babs Gonsalves), dass die Clubs eine bessere Akustik und bessere Klaviere hätten (Mal Waldron), Reichtum, Glück und drei weitere Wünsche (Roy Brooks), ein neues Schlagzeug (Clifford Jarvis), die anstehenden Rechnungen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren (Anita O’Day), der beste Trompeter der Welt zu sein (Lonnie Hollyer), das Genie von Thelonious Monk zu besitzen (Billy Higgins), eine Flasche kühlen Biers (Giggy Coggins), eine Zeitmaschine (John Ore), dass die Kriegsetats in die intellektuelle Bildung gesteckt würden (Steve Lacy), Gerechtigkeit, Wahrheit und Schönheit (Stan Getz), ein gutes Leben zu leben ohne Scheiße spielen zu müssen (Joe Zawinul), Freiheit für Südafrika (Miriam Makeba), weiß zu sein (Miles Davis), Drillinge (Dinah Washington), keine weitere Medizin einnehmen und nicht wieder ins Krankenhaus gehen zu müssen (Bud Powell), spielen, spielen, Liebe machen (Kenny Drew). Albert Mangelsdorff ist der einzige Deutsche (und einer der wenigen Europäer), die von der Baroness befragt wurden. Er antwortete: “Zuerst einmal möchte ich lang genug leben, um in meinem Spiel zu einem für mich befriedigenden Resultat zu gelangen. Ich wünsche mir, dass das Leben eines Musikers nicht sein Familienleben stört. Ich wünsche mir, dass die Menschen auf der Welt endlich vernünftig genug werden, Frieden für alle zu schaffen! (Und ich wünsche mir, dass dieser Wunsch als erster erfüllt wird!).” Angereichert sind die Texte mit Fotos aus dem Privatarchiv der Baroness – private Bilder vom tanzenden Monk, von Miles und Coltrane, Dexter Gordon und all den anderen Freunden der Autorin. Farbbilder und Schwarzweißfotos – oft sieht man den Bildern an, dass sie über Jahre in der Schublade gelegen haben. Aber gerade die Privatheit dieser Aufnahmen macht ihre Besonderheit aus, eine Intimität, in der man kaum sonst diese Jazzheroen gesehen hat.
Wolfram Knauer (April 2007)
Benny Goodman. The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert
von Jon Hancock
Shrewsbury 2008 (Prancing Fish)
218 Seiten, 24,99 Britische Pfund
ISBN: 978-0-9562404-08
 Ashley Kahn hat mit seinen Büchern über Miles Davis’ “Kind of Blue” und John Coltranes “A Love Supreme” ein Beispiel gesetzt, wie man Jazzgeschichte auch aus dem Augenblick heraus schreiben kann, mit dem Fokus auf einen spezifischen Punkt des geschichtlichen Ablaufs. Er hat gezeigt, dass sich aus Archiven und Erinnerungen die komplexen Entwicklungen nachzeichnen lassen, die zu jenen legendären und einflussreichen Alben führten. Wenige Momente der Jazzgeschichte sind so genau beleuchtet worden – und außer spezifischen Alben handelt es sich bei solchen Fokus-Abhandlungen meist um besondere Konzerte: Paul Whitemans Aeolian Hall Concert erhielt erhöhte Aufmerksamkeit genauso wie Charlie Parkers Massey Hall Concert. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand dem lange Jahre erfolgreichsten Livekonzert des Jazz annahm, dem Konzert, das Benny Goodman am 16. Januar 1938 in der New Yorker Carnegie Hall gab und bei dem er mit seiner Bigband, mit Trio und Quartett sowie mit renommierten Kollegen aus anderen Bands in einer Jam Session zu hören war. Das Konzert hat Jazzgeschichte geschrieben, auch deshalb, weil es damals mitgeschnitten und der Mitschnitt später in guter Qualität veröffentlicht wurde, so dass fast jeder Programmpunkt des Abends auch im hörenden Gedächtnis der Jazzgemeinde erhalten blieb. Immer wieder wurde über das Konzert geschrieben, doch mit diesem Buch hat Jon Hancock die ultimative Monographie zum 16. Januar 1938 verfasst. In seinem Buch finden sich jede Menge Originaldokumente, Fotos von Eintrittskarten genauso wie ein Faksimile des Programmheftes, Vertragsvereinbarungen über die Plattenveröffentlichung und wahrscheinlich sämtliche Fotos, die von jenem Abend in der Carnegie Hall aufzutreiben waren. Hancocks Kapitel beleuchten die Umstände des Konzerts. Er erzählt kurz die Geschichte des Konzertsaals, erklärt, wie Goodman überhaupt auf die Idee eines Konzerts im ehrwürdigen Saal kam und wie sich die Pläne langsam verdichteten. Er berichtet von Problemen und Diskussionen über den Ablauf genauso wie die Bühnenbeleuchtung. Er weiß Geschichten über die Proben zu erzählen (auch hiervon gibt es Fotos), über den Ticketverkauf und die Abendplanung: Auf die Frage, wie lang denn die Pause sein solle, antwortete Goodman damals angeblich: “Oh, ich weiß nicht… Wie lang macht denn Herr Toscanini gewöhnlich?” Schließlich das Konzert selbst, das Hancock Stück für Stück kommentiert und dabei sowohl auf zeitgenössische Kritiken wie auch auf spätere Berichte zurückgreift. Er erzählt die Geschichte des Konzertmitschnitts sowie eines Newsreel-Filmdokuments des Konzerts. Er diskutiert das Album-Design der in den 1950er Jahren erstveröffentlichten Aufnahmen und schreibt über das Restaurations-Projekt von Phil Schaap, dem es 1997 gelang, das Konzert in kompletter Länge zusammenzustellen. Zum Schluss wirft er noch einen Blick auf die Jubiläumsveranstaltungen von 1958, 1968, 1978, 1988, 1998 und 2008. Eine ausführliche Bibliographie zum Konzert folgt, die ausführlichen Programmnotizen von Irving Kolodin sowie eine Auflistung sämtlicher Auftritte Goodmans in der Carnegie Hall von 1938 bis 1982. Eingeleitet wird das Buch von einer liebevollen Würdigung ihres Vaters durch Rachel Edelson, die Tochter des Klarinettisten, die davon erzählt, wie ihr Vater immer auf der Suche nach dem perfekten Klarinettenblättchen gewesen sei. Alles in allem: Eine “labor of love”, kurzweilig geschrieben, reich bebildert und nicht nur für Goodman-Fans zu empfehlen.
Ashley Kahn hat mit seinen Büchern über Miles Davis’ “Kind of Blue” und John Coltranes “A Love Supreme” ein Beispiel gesetzt, wie man Jazzgeschichte auch aus dem Augenblick heraus schreiben kann, mit dem Fokus auf einen spezifischen Punkt des geschichtlichen Ablaufs. Er hat gezeigt, dass sich aus Archiven und Erinnerungen die komplexen Entwicklungen nachzeichnen lassen, die zu jenen legendären und einflussreichen Alben führten. Wenige Momente der Jazzgeschichte sind so genau beleuchtet worden – und außer spezifischen Alben handelt es sich bei solchen Fokus-Abhandlungen meist um besondere Konzerte: Paul Whitemans Aeolian Hall Concert erhielt erhöhte Aufmerksamkeit genauso wie Charlie Parkers Massey Hall Concert. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand dem lange Jahre erfolgreichsten Livekonzert des Jazz annahm, dem Konzert, das Benny Goodman am 16. Januar 1938 in der New Yorker Carnegie Hall gab und bei dem er mit seiner Bigband, mit Trio und Quartett sowie mit renommierten Kollegen aus anderen Bands in einer Jam Session zu hören war. Das Konzert hat Jazzgeschichte geschrieben, auch deshalb, weil es damals mitgeschnitten und der Mitschnitt später in guter Qualität veröffentlicht wurde, so dass fast jeder Programmpunkt des Abends auch im hörenden Gedächtnis der Jazzgemeinde erhalten blieb. Immer wieder wurde über das Konzert geschrieben, doch mit diesem Buch hat Jon Hancock die ultimative Monographie zum 16. Januar 1938 verfasst. In seinem Buch finden sich jede Menge Originaldokumente, Fotos von Eintrittskarten genauso wie ein Faksimile des Programmheftes, Vertragsvereinbarungen über die Plattenveröffentlichung und wahrscheinlich sämtliche Fotos, die von jenem Abend in der Carnegie Hall aufzutreiben waren. Hancocks Kapitel beleuchten die Umstände des Konzerts. Er erzählt kurz die Geschichte des Konzertsaals, erklärt, wie Goodman überhaupt auf die Idee eines Konzerts im ehrwürdigen Saal kam und wie sich die Pläne langsam verdichteten. Er berichtet von Problemen und Diskussionen über den Ablauf genauso wie die Bühnenbeleuchtung. Er weiß Geschichten über die Proben zu erzählen (auch hiervon gibt es Fotos), über den Ticketverkauf und die Abendplanung: Auf die Frage, wie lang denn die Pause sein solle, antwortete Goodman damals angeblich: “Oh, ich weiß nicht… Wie lang macht denn Herr Toscanini gewöhnlich?” Schließlich das Konzert selbst, das Hancock Stück für Stück kommentiert und dabei sowohl auf zeitgenössische Kritiken wie auch auf spätere Berichte zurückgreift. Er erzählt die Geschichte des Konzertmitschnitts sowie eines Newsreel-Filmdokuments des Konzerts. Er diskutiert das Album-Design der in den 1950er Jahren erstveröffentlichten Aufnahmen und schreibt über das Restaurations-Projekt von Phil Schaap, dem es 1997 gelang, das Konzert in kompletter Länge zusammenzustellen. Zum Schluss wirft er noch einen Blick auf die Jubiläumsveranstaltungen von 1958, 1968, 1978, 1988, 1998 und 2008. Eine ausführliche Bibliographie zum Konzert folgt, die ausführlichen Programmnotizen von Irving Kolodin sowie eine Auflistung sämtlicher Auftritte Goodmans in der Carnegie Hall von 1938 bis 1982. Eingeleitet wird das Buch von einer liebevollen Würdigung ihres Vaters durch Rachel Edelson, die Tochter des Klarinettisten, die davon erzählt, wie ihr Vater immer auf der Suche nach dem perfekten Klarinettenblättchen gewesen sei. Alles in allem: Eine “labor of love”, kurzweilig geschrieben, reich bebildert und nicht nur für Goodman-Fans zu empfehlen.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Ron Carter. Finding the Right Notes
von Dan Ouellette
New York 2008 (artistShare)
434 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-615-26526-1
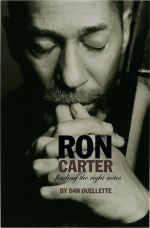 Bassisten sind die Grundstützen des Jazz, von Walter Page und Jimmy Blanton über Ray Brown, Charles Mingus bis zu Charlie Haden. Ron Carter, mittlerweile 72 Jahre alt, gehört mit zu den ganz großen seines Instruments: immer verlässlich im Hintergrund, immer präsent, wenn man ihn herausstellte, ein Musiker, der die Kollegen stützte, egal ob sie eigene Projekte realisieren wollten oder an seinen Projekten teilhatten. Dan Ouellette hat sich mit dem Bassisten zusammengesetzt, um seine Erinnerungen niederzuschreiben, die Erfahrungen eines der meistaufgenommenen Musiker des Jazz. Carter wuchs in Ferndale, einem Vorort von Detroit, auf, und wurde von seinem Vater ermutigt, Cello zu spielen. Er studierte Cello, dann Kontrabass an der Cass Technical High School und danach vier Jahre lang an der renommierten Eastman School of Music in Rochester, New York. Hier lernte er auch, dass, so gut er auch als Instrumentalist war, ihm in der klassischen Welt die Hautfarbe im Weg stand. Kein geringerer als Leopold Stokowski lobte ihn für sein Bassspiel, erklärte aber zugleich, dass er ihn als Schwarzen in Houston, wo er dirigierte, niemals im Orchester durchbringen könne. Neben dem Studium spielte Carter in einem lokalen Jazztrio, aber auch mit Gap und Chuck Mangione oder dem Saxophonisten Pee Wee Ellis, die alle damals in Rochester lebten. 1959 ging Carter nach New York, arbeitete mit Chico Hamilton, Randy Weston, Eric Dolphy, Benny Golson und vielen anderen. Er studierte an der Manhattan School of Music, und war abends ein gefragter Bassist in unterschiedlichsten Ensembles. 1963 engagierte ihn Miles Davis für seine Band, mit der Carter über die Jahre einflussreiche Alben einspielen sollte: “E.S.P.”, “Miles Smiles”, “Sorcerer”, “Nefertiti”, “Water Babies”, “Miles in the Sky” und “Filles de Kilimanjaro”. Carter erzählt über die Zeit bei Miles, über Aufnahmesitzungen und Konzerte und kommentiert einige der Einspielungen, die er mit Miles machte. In den 1970er Jahren spielte er mit dem Great Jazz Trio und mit Herbie Hancocks V.S.O.P., wirkte daneben über die Jahre immer wieder in Tributprojekten an seinen früheren Chef mit, ob auf Platte oder bei Konzerten. Daneben aber verfolgte er auch seine Karriere als Bandleader, insbesondere auf Alben, die er in den 1970er Jahren für das Label CTI aufnahm. 1976 wechselte er zu Milestone Records, später dann zu Blue Note. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Carter, dem Sideman, ein weiteres mit seiner Studioarbeit für Werbemusik sowie ein drittes mit seiner Mitwirkung bei Filmen wie “Bird” oder “Kansas City”. Carters Ausflüge in brasilianische Musik finden genauso Erwähnung wie jene in die Welt der klassischen Musik oder seine Arbeit als Jazzpädagoge. Sein Duo mit Jim Hall kommt genauso zur Sprache wie Carters jüngste eigene Bands, sein Cello Choir und sein Ausflug in des Welt des HipHop. Zum Schluss findet sich noch ein Live-Blindfold-Test, bei dem Carter 2007 bei der Tagung der International Association of Jazz Educators Aufnahmen von Kollegen kommentierte, sowie ausführliche Kommentare zu seinem gewählten Instrument, dem Kontrabass. Ein Appendix versammelt Interviewausschnitte anderer Musiker zu Ron Carter, etwa von Buster Williams, Chick Corea, Gonzalo Rubalcaba, Stanley Clarke, Esperanza Spalding, Charlie Haden, Dave Holland, Grady Tate, Javon Jackson, John Patitucci, Jacky Terrasson, Wynton Marsalis, Jimmy Heath und Billy Taylor. Ein zweiter Appendix erteilt Auskünfte aus dem eher privaten Bereich, etwa, welches Auto Carter fährt, welche Pfeife er raucht, wo er seine Kleidung kauft, welche Stereoanlage er zuhause hat und welche Platten er auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Oullette greift auf Carters Erinnerungen zurück, zitiert aber auch ausführlich aus zuvor veröffentlichten Interviews. Das Buch ist eine würdige Hommage an einen der ganz Großen seines Instruments, überaus lesenswert, voll mit Insiderinformationen und jedem empfohlen, der sich für Carter, Miles Davis oder den Jazz der 60er bis 80er Jahre interessiert.
Bassisten sind die Grundstützen des Jazz, von Walter Page und Jimmy Blanton über Ray Brown, Charles Mingus bis zu Charlie Haden. Ron Carter, mittlerweile 72 Jahre alt, gehört mit zu den ganz großen seines Instruments: immer verlässlich im Hintergrund, immer präsent, wenn man ihn herausstellte, ein Musiker, der die Kollegen stützte, egal ob sie eigene Projekte realisieren wollten oder an seinen Projekten teilhatten. Dan Ouellette hat sich mit dem Bassisten zusammengesetzt, um seine Erinnerungen niederzuschreiben, die Erfahrungen eines der meistaufgenommenen Musiker des Jazz. Carter wuchs in Ferndale, einem Vorort von Detroit, auf, und wurde von seinem Vater ermutigt, Cello zu spielen. Er studierte Cello, dann Kontrabass an der Cass Technical High School und danach vier Jahre lang an der renommierten Eastman School of Music in Rochester, New York. Hier lernte er auch, dass, so gut er auch als Instrumentalist war, ihm in der klassischen Welt die Hautfarbe im Weg stand. Kein geringerer als Leopold Stokowski lobte ihn für sein Bassspiel, erklärte aber zugleich, dass er ihn als Schwarzen in Houston, wo er dirigierte, niemals im Orchester durchbringen könne. Neben dem Studium spielte Carter in einem lokalen Jazztrio, aber auch mit Gap und Chuck Mangione oder dem Saxophonisten Pee Wee Ellis, die alle damals in Rochester lebten. 1959 ging Carter nach New York, arbeitete mit Chico Hamilton, Randy Weston, Eric Dolphy, Benny Golson und vielen anderen. Er studierte an der Manhattan School of Music, und war abends ein gefragter Bassist in unterschiedlichsten Ensembles. 1963 engagierte ihn Miles Davis für seine Band, mit der Carter über die Jahre einflussreiche Alben einspielen sollte: “E.S.P.”, “Miles Smiles”, “Sorcerer”, “Nefertiti”, “Water Babies”, “Miles in the Sky” und “Filles de Kilimanjaro”. Carter erzählt über die Zeit bei Miles, über Aufnahmesitzungen und Konzerte und kommentiert einige der Einspielungen, die er mit Miles machte. In den 1970er Jahren spielte er mit dem Great Jazz Trio und mit Herbie Hancocks V.S.O.P., wirkte daneben über die Jahre immer wieder in Tributprojekten an seinen früheren Chef mit, ob auf Platte oder bei Konzerten. Daneben aber verfolgte er auch seine Karriere als Bandleader, insbesondere auf Alben, die er in den 1970er Jahren für das Label CTI aufnahm. 1976 wechselte er zu Milestone Records, später dann zu Blue Note. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Carter, dem Sideman, ein weiteres mit seiner Studioarbeit für Werbemusik sowie ein drittes mit seiner Mitwirkung bei Filmen wie “Bird” oder “Kansas City”. Carters Ausflüge in brasilianische Musik finden genauso Erwähnung wie jene in die Welt der klassischen Musik oder seine Arbeit als Jazzpädagoge. Sein Duo mit Jim Hall kommt genauso zur Sprache wie Carters jüngste eigene Bands, sein Cello Choir und sein Ausflug in des Welt des HipHop. Zum Schluss findet sich noch ein Live-Blindfold-Test, bei dem Carter 2007 bei der Tagung der International Association of Jazz Educators Aufnahmen von Kollegen kommentierte, sowie ausführliche Kommentare zu seinem gewählten Instrument, dem Kontrabass. Ein Appendix versammelt Interviewausschnitte anderer Musiker zu Ron Carter, etwa von Buster Williams, Chick Corea, Gonzalo Rubalcaba, Stanley Clarke, Esperanza Spalding, Charlie Haden, Dave Holland, Grady Tate, Javon Jackson, John Patitucci, Jacky Terrasson, Wynton Marsalis, Jimmy Heath und Billy Taylor. Ein zweiter Appendix erteilt Auskünfte aus dem eher privaten Bereich, etwa, welches Auto Carter fährt, welche Pfeife er raucht, wo er seine Kleidung kauft, welche Stereoanlage er zuhause hat und welche Platten er auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Oullette greift auf Carters Erinnerungen zurück, zitiert aber auch ausführlich aus zuvor veröffentlichten Interviews. Das Buch ist eine würdige Hommage an einen der ganz Großen seines Instruments, überaus lesenswert, voll mit Insiderinformationen und jedem empfohlen, der sich für Carter, Miles Davis oder den Jazz der 60er bis 80er Jahre interessiert.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Swing Is the Thing. Hengelo en de Jazz 1920-1960
von Henk Kleinhout
Hengelo 2008 (Uitgiverij Smit)
157 Seiten, 23,85 Euro
ISBN: 978-90-6289-626-4
 Henk Kleinhout spielte Posaune in verschiedenen traditionellen Jazzbands, beschäftigte sich in seinen Studien allerdings genauso mit der Black-Power-Bewegung und der amerikanischen Jazzavantgarde. 2006 promovierte er sich mit einer Arbeit über die Rezeption des Jazz in den Niederlanden der Wiederaufbauzeit und legt in diesem Buch eine Geschichte des Jazz in Hengelo vor, einer Mittelstadt nahe Enschede, nicht weit von der deutschen Grenze. Ein Einleitungskapitel macht auf die erste Jazzrezeption in den Niederlanden aufmerksam, Konzerte Paul Whitemans in Scheveningen und Amsterdam, Tourneestops von Armstrong, Ellington, Benny Carter und Coleman Hawkins. Dann geht es in die Stadtgeschichte. Die ersten Belege für Jazz in Hengelo findet Kleinhout bereits 1916, als die “Timbertown Follies”, eine Varietégruppe, in Hengelo auftraten. 1919 stand das Wort Jazz (noch geschrieben als “jasz”) zum ersten Mal in der Lokalzeitung, in der Anzeige einer Tanzschule. (Kurz darauf erschien die Anzeige offenbar mit korrigierter Schreibweise, wie ein Faksimile im Buch deutlich macht). Von 1923 gibt es Anzeigen für “Jazz Band Balls”, also Tanzveranstaltungen, bei denen auch eine “Original Jazz-Band” zu hören war. Ob daran irgendwelche Hengelo’schen Musiker beteiligt waren, kann auch Kleinhout nicht beantworten. Es gab in den 1920er Jahren Konzerte und Tanzveranstaltungen und in der Tagespresse außerdem Berichte beispielsweise über britische Bands, die in Hengelo im Rundfunk zu hören waren. In den 1930er Jahren sah es dann bereits anders aus. Im Hotel Eulderink gastierte das Appleton Trio; andere Bands wie die Rhythm Kings aus Leeuwarden oder die Blue Ramblers waren ebenfalls viel in der Stadt zu hören. Kleinhout dokumentiert akribisch Engagements und Tanzveranstaltungen, immer mit einem Seitenblick auf anderswo in den Niederlanden stattfindende Jazzaktivitäten, die Ramblers etwa oder den landesweit spürbaren Eindruck, den Duke Ellingtons Orchester bei einem Konzert in Amsterdam auf die niederländische Jazzszene machte. In den 1940er Jahren war das Land von den Nazis besetzt, aber Jazz gab es trotzdem, gespielt etwa von den Bands von Ernst van’t Hoff oder Dick Willebrandts. Hengeloer Lokalmatadoren wie Manny Oets dürfen im Buch nicht fehlen, genauso wenig wie Verweise auf Gastspiele der Ramblers 1946 oder von Nat Gonella 1949. In den 1950er Jahren dann stellt Kleinhout Ensembles wie das Vokalensemble The Vocal Touches heraus, das Harry Banning Quartet, das sich in Besetzung und Repertoire am Modern Jazz Quartet orientierte, das Quartett des Pianisten Fred van de Ven oder die Band Hotclub d’Hengelo. “Swing Is the Thing” beschreibt, wie eine Musik langsam aber sicher Fuß fasst in einer Mittelstadt der Niederlande, wie aus Zuhörern und Unterhaltungssüchtigen Fans werden und wie sich eine Szene herausbildet, die nach wie vor zwischen Spaß und Bewusstsein um den Ernst der Musik schwankt. Kleinhout hat in nationalen Jazzblättern genauso wie in lokalen und regionalen Zeitungsarchiven recherchiert. Ein Personenregister rundet das vordergründig vielleicht vor allem für Hengeloer Jazzfreunde interessante Buch ab, das aber zugleich ein Puzzlestein zur Dokumentation des niederländischen jazz darstellt.
Henk Kleinhout spielte Posaune in verschiedenen traditionellen Jazzbands, beschäftigte sich in seinen Studien allerdings genauso mit der Black-Power-Bewegung und der amerikanischen Jazzavantgarde. 2006 promovierte er sich mit einer Arbeit über die Rezeption des Jazz in den Niederlanden der Wiederaufbauzeit und legt in diesem Buch eine Geschichte des Jazz in Hengelo vor, einer Mittelstadt nahe Enschede, nicht weit von der deutschen Grenze. Ein Einleitungskapitel macht auf die erste Jazzrezeption in den Niederlanden aufmerksam, Konzerte Paul Whitemans in Scheveningen und Amsterdam, Tourneestops von Armstrong, Ellington, Benny Carter und Coleman Hawkins. Dann geht es in die Stadtgeschichte. Die ersten Belege für Jazz in Hengelo findet Kleinhout bereits 1916, als die “Timbertown Follies”, eine Varietégruppe, in Hengelo auftraten. 1919 stand das Wort Jazz (noch geschrieben als “jasz”) zum ersten Mal in der Lokalzeitung, in der Anzeige einer Tanzschule. (Kurz darauf erschien die Anzeige offenbar mit korrigierter Schreibweise, wie ein Faksimile im Buch deutlich macht). Von 1923 gibt es Anzeigen für “Jazz Band Balls”, also Tanzveranstaltungen, bei denen auch eine “Original Jazz-Band” zu hören war. Ob daran irgendwelche Hengelo’schen Musiker beteiligt waren, kann auch Kleinhout nicht beantworten. Es gab in den 1920er Jahren Konzerte und Tanzveranstaltungen und in der Tagespresse außerdem Berichte beispielsweise über britische Bands, die in Hengelo im Rundfunk zu hören waren. In den 1930er Jahren sah es dann bereits anders aus. Im Hotel Eulderink gastierte das Appleton Trio; andere Bands wie die Rhythm Kings aus Leeuwarden oder die Blue Ramblers waren ebenfalls viel in der Stadt zu hören. Kleinhout dokumentiert akribisch Engagements und Tanzveranstaltungen, immer mit einem Seitenblick auf anderswo in den Niederlanden stattfindende Jazzaktivitäten, die Ramblers etwa oder den landesweit spürbaren Eindruck, den Duke Ellingtons Orchester bei einem Konzert in Amsterdam auf die niederländische Jazzszene machte. In den 1940er Jahren war das Land von den Nazis besetzt, aber Jazz gab es trotzdem, gespielt etwa von den Bands von Ernst van’t Hoff oder Dick Willebrandts. Hengeloer Lokalmatadoren wie Manny Oets dürfen im Buch nicht fehlen, genauso wenig wie Verweise auf Gastspiele der Ramblers 1946 oder von Nat Gonella 1949. In den 1950er Jahren dann stellt Kleinhout Ensembles wie das Vokalensemble The Vocal Touches heraus, das Harry Banning Quartet, das sich in Besetzung und Repertoire am Modern Jazz Quartet orientierte, das Quartett des Pianisten Fred van de Ven oder die Band Hotclub d’Hengelo. “Swing Is the Thing” beschreibt, wie eine Musik langsam aber sicher Fuß fasst in einer Mittelstadt der Niederlande, wie aus Zuhörern und Unterhaltungssüchtigen Fans werden und wie sich eine Szene herausbildet, die nach wie vor zwischen Spaß und Bewusstsein um den Ernst der Musik schwankt. Kleinhout hat in nationalen Jazzblättern genauso wie in lokalen und regionalen Zeitungsarchiven recherchiert. Ein Personenregister rundet das vordergründig vielleicht vor allem für Hengeloer Jazzfreunde interessante Buch ab, das aber zugleich ein Puzzlestein zur Dokumentation des niederländischen jazz darstellt.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Lutzemann’s Jatzkapelle. Alltag & Abenteuer einer “German Jazzband”
von Lutz Eikelmann
Berlin 2008 (Verlag Pro Business)
118 Seiten
ISBN: 978-3-86805-239-8
 “Lutzemanns Jatzkapelle” wurde 1993 gegründet und ist, wie schon der Bandname dem eingeweihten Jazzkenner verrät, in den traditionellen Stilarten des Jazz zu Hause. Eikelmann ist abwechselnd Tubist, Bassist und Schlagzeuger der Kapelle und erzählt in seinem Buch Anekdoten aus 15 Jahren Bandgeschichte. Es sind Anekdoten von Reisen in nähere und weiter entfernte Regionen, von musikalischen und menschlichen Höhepunkten und Zwischenfällen. Es sind Geschichten aus Clubs, von Festivals oder über Gigs in Einkaufszentren, von Kollegen wie etwa dem 2002 verstorbenen Saxophonisten Fitz Gore oder über den Posaunisten Hawe Schneider. Im Mittelpunkt des Buchs stehen eine Reise nach New Orleans, eine Jazzkreuzfahrt durch die Karibik und eine weitere (“Jazz Meets Klassik”) durchs Mittelmeer. Dann kommen Lobreden aus der Presse, Erinnerungen an die erste CD, an einen Drehtag für eine Fernsehsendung mit Marie-Luise Marjan (“Mutter Beimer”), und an das Lonnie Donegan Projekt, das Eikelmann 2003 nach dem Tod des britischen Gitarristen, Banjospielers und Sängers ins Leben rief. Das Buch ist ein Sammelsurium vieler unterschiedlich interessanter Anekdoten und damit vor allem für Freunde des “Oldtime-Jazz”, wie Eikelmann seine Musik selbst bezeichnet, ein nettes Erinnerungsbüchlein. Editorisch lässt es zu wünschen übrig; zu zusammenhanglos liegen die Anekdoten nebeneinander; zu banal (und zu pointenarm) sind etliche der Anekdoten, zu fragwürdig einige der Witzchen, die im Männergespräch vielleicht durchgehen und auch beim Erzählen am Stammtisch witzig wirken mögen , auf Papier gedruckt aber doch eher peinlich anmuten. Schließlich steckt zu wenig Struktur in dem allen; das Buch wirkt stellenweise mehr wie eine Werbebroschüre als wie eine Dokumentation. Wenn überhaupt, so macht “Lutzemann’s Jatzkapelle” allerdings eines bewusst: dass nämlich die Szene des traditionellen Jazz, ob New Orleans, Dixieland oder “Oldtime” in Deutschland einer kritischen Bestandsaufnahme harrt, die die Geschichten der Musiker, also auch Eikelmanns Erfahrungen, bündelt und in Beziehung setzt zu den politischen, kulturellen und ökonomischen Entwicklungen in Deutschland von 1945 bis heute, die die ästhetischen Implikationen des Stils vorbehaltlos analysieren und damit vielleicht eine ähnliche Neubewertung der Szene erreichen könnte wie sie George McKay in Kapiteln seines Buchs “Circular Breathing. The Cultural Politics of Jazz in Britain” gelungen ist.
“Lutzemanns Jatzkapelle” wurde 1993 gegründet und ist, wie schon der Bandname dem eingeweihten Jazzkenner verrät, in den traditionellen Stilarten des Jazz zu Hause. Eikelmann ist abwechselnd Tubist, Bassist und Schlagzeuger der Kapelle und erzählt in seinem Buch Anekdoten aus 15 Jahren Bandgeschichte. Es sind Anekdoten von Reisen in nähere und weiter entfernte Regionen, von musikalischen und menschlichen Höhepunkten und Zwischenfällen. Es sind Geschichten aus Clubs, von Festivals oder über Gigs in Einkaufszentren, von Kollegen wie etwa dem 2002 verstorbenen Saxophonisten Fitz Gore oder über den Posaunisten Hawe Schneider. Im Mittelpunkt des Buchs stehen eine Reise nach New Orleans, eine Jazzkreuzfahrt durch die Karibik und eine weitere (“Jazz Meets Klassik”) durchs Mittelmeer. Dann kommen Lobreden aus der Presse, Erinnerungen an die erste CD, an einen Drehtag für eine Fernsehsendung mit Marie-Luise Marjan (“Mutter Beimer”), und an das Lonnie Donegan Projekt, das Eikelmann 2003 nach dem Tod des britischen Gitarristen, Banjospielers und Sängers ins Leben rief. Das Buch ist ein Sammelsurium vieler unterschiedlich interessanter Anekdoten und damit vor allem für Freunde des “Oldtime-Jazz”, wie Eikelmann seine Musik selbst bezeichnet, ein nettes Erinnerungsbüchlein. Editorisch lässt es zu wünschen übrig; zu zusammenhanglos liegen die Anekdoten nebeneinander; zu banal (und zu pointenarm) sind etliche der Anekdoten, zu fragwürdig einige der Witzchen, die im Männergespräch vielleicht durchgehen und auch beim Erzählen am Stammtisch witzig wirken mögen , auf Papier gedruckt aber doch eher peinlich anmuten. Schließlich steckt zu wenig Struktur in dem allen; das Buch wirkt stellenweise mehr wie eine Werbebroschüre als wie eine Dokumentation. Wenn überhaupt, so macht “Lutzemann’s Jatzkapelle” allerdings eines bewusst: dass nämlich die Szene des traditionellen Jazz, ob New Orleans, Dixieland oder “Oldtime” in Deutschland einer kritischen Bestandsaufnahme harrt, die die Geschichten der Musiker, also auch Eikelmanns Erfahrungen, bündelt und in Beziehung setzt zu den politischen, kulturellen und ökonomischen Entwicklungen in Deutschland von 1945 bis heute, die die ästhetischen Implikationen des Stils vorbehaltlos analysieren und damit vielleicht eine ähnliche Neubewertung der Szene erreichen könnte wie sie George McKay in Kapiteln seines Buchs “Circular Breathing. The Cultural Politics of Jazz in Britain” gelungen ist.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Ich hab den Blues schon etwas länger. Spuren einer Musik in Deutschland
Herausgegeben von Michael Rauhut und Reinhard Lorenz
Berlin 2008 (Ch. Links-Verlag)
412 Seiten, 29,90 Euo
ISBN 978-3-86153-495-2
 2008 begaben sich Michael Rauhut und Reinhard Lorenz mit ihrem Buch “Ich hab den Blues schon etwas länger“ auf die “Spuren des Blues in Deutschland“ (Ch. Links-Verlag). Herausgekommen ist ein hervorragend lesbarer Reader mit Texten zu regionalen Bluesszenen in Ost und West, historischen Anrissen zur afroamerikanischen Musiktradition in Deutschland und persönlichen Anekdoten “Bluesbetroffener“.
2008 begaben sich Michael Rauhut und Reinhard Lorenz mit ihrem Buch “Ich hab den Blues schon etwas länger“ auf die “Spuren des Blues in Deutschland“ (Ch. Links-Verlag). Herausgekommen ist ein hervorragend lesbarer Reader mit Texten zu regionalen Bluesszenen in Ost und West, historischen Anrissen zur afroamerikanischen Musiktradition in Deutschland und persönlichen Anekdoten “Bluesbetroffener“.
Das meiste ist kurzweilig zu lesen, zwar selten wirklich neu, doch in der Kombination der Texte originell zusammengestellt. So folgen die einzelnen Kapitel den Wochentagen, beginnend bei Montag, um jedem Kapitel eine Textzeile des Bluesklassikers “Stormy Monday“ von T-Bone Walker voranzustellen. Das scheint zwar inhaltlich nicht sonderlich viel Sinn zu machen, ist aber – in der positiven Wendung, die die Strophe gegen Ende nimmt (“Eagle flies on Friday“) – vielleicht eine Allegorie für die Hoffnung, die die Herausgeber in Bezug auf die künftige Entwicklung des Blues in Deutschland hegen. Da verschmerzt man, dass viele der Texte Zweitverwertungen der Autoren sind, die so oder in leicht geänderter Form an anderer Stelle bereits veröffentlicht wurden. Besonders beachtlich darunter ohne Zweifel – und das Vergnügen beim Lesen erheblich steigernd – die kurzen Reminiszenzen prominenter, lebender oder bereits verstorbener Bluesfans wie Peter Maffay, Eric Burdon, Götz Alsmann, Wim Wenders (entrichtet ein Geleitwort), Joachim-Ernst Berendt, Olaf Hudtwalcker, Emil Mangelsdorff und anderer.
Analytische Artikel zur Situation des Blues in Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart sucht man in diesem Buch allerdings meist vergebens, bekommt sie lediglich dort, wo man das auch erwarten darf – bei den Professoren Michael Rauhut (Vergleich der Blues-Diskurse in Ost und West) und Peter Wicke (Blues und Authentizität). Alles in allem handelt es sich bei diesem Werk um ein pralles Lesebuch für jene, die den Blues schon etwas länger haben und eigene Erinnerungen an ein Leben mit ihm gerne noch einmal aufwärmen möchten, und für jene, die immer schon einmal wissen wollten, was der Blues verdammt noch mal mit Deutschland zu tun hat.
(Arndt Weidler, Dezember 2011)
Barney Kessel. A Jazz Legend
von Maurice J. Summerfield
Blaydon on Tyne 2008 (Ashley Mark Publishing Company)
distributed by Hal Leonard Corporation
303 Seiten, 39,50 US-$
ISBN: 978-1-872639-69-7
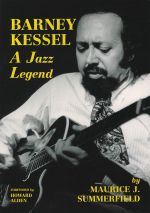 Mit 12 Jahren faszinierte Barney Kessel die Gitarre im Fenster eines Musikgeschäfts in Muskogee, Oklahoma, so sehr, dass er sich das Instrument vom selbstverdienten Geld kaufte, obwohl sein Vater etwas dagegen hatte, weil Gitarre seiner Ansicht nach nur Bettler spielten. Er machte auf dem Instrument allerdings schnell solche Fortschritte, dass seine Mutter ihm 1939 eine elektrische Gitarre mit Verstärker kaufte. Er kaufte sich all die neuesten Platten Charlie Christians, und als der sich 1940 in Oklahoma City aufhielt, verbrachte Barney drei Tage mit seinem Idol, spielte mit ihm und ließ sich Tricks beibringen. 1942 zog es den 19-jährigen nach Los Angeles und wurde bald Gitarrist des Orchesters von Chico Marx, geleitet von Ben Pollack. Er teilte das Zimmer auf Tourneen meist mit Mel Torme, der nicht nur für die Band sang, sondern ab und zu auch Schlagzeug spielte. 1944 spielte er mit Charlie Barnet und machte 1945 seine erste Platte unter eigenem Namen. 1947 spielte er sowohl mit Benny Goodman wie auch mit den Charlie Parker All Stars. Ende der 1940er Jahre dann als Studiomusiker für Capitol Records in Hollywood, eine Funktion, in der er Jazz- genauso wie andere Stars begleitete, darunter auch Marlene Dietrich, Doris Day oder Maurice Chevalier. 1952 bat Norman Granz ihn, beim (klassischen) Oscar Peterson Trio mitzumachen; ansonsten wirkte er in den 50er Jahren bei vielen Alben für das Label Contemporary mit, die teilweise auch unter seinem Namen erschienen. Summerfield beschreibt Kessels Arbeit als Studiomusiker. Ende der 60er Jahre lebte Kessel eine Weile in London und kehrte in der Folge immer wieder zu Tourneen nach Europa zurück. 1974 trat er erstmals mit Charly Byrd und Herb Ellis in der Band “The Great Guitars” auf, die in wechselnden Besetzungen bis in die 190er Jahre bestand. Im Alter von 68 Jahren erlitt Kessel im Mai 1962 einen Schlaganfall, nach dem er nicht mehr Gitarre spielen konnte. 2004 starb er an den Folgen eines Gehirntumors. Summerfields Buch zeichnet Kessels Lebensgeschichte nüchtern nach, mit vielen Daten und Fakten sowie etlichen Interviewauszügen. Ein eigenes umfangreiches Kapitel ist seinen Gitarren und seiner Ausrüstung gewidmet. “Thoughts on Music & Life” ist ein Kapitel überschrieben, das Interviewausschnitte des Gitarristen sammelt. In einer Fotogalerie finden sich unzählige seltene Fotos, einschließlich seiner Geburts- und Todesurkunden. Schließlich enthält das Buch eine 150 Seiten umfassende Diskographie des Gitarristen. Für Kessel-Fans ein Muss, das in seinen biographischen Kapiteln vielleicht manchmal etwas trocken zu lesen ist, aber durch die vielen Einsprengsel von Auszügen aus Interviews genügend Stoff enthält, um ein umfassendes Bild des Wirkens von Barney Kessel geben zu können.
Mit 12 Jahren faszinierte Barney Kessel die Gitarre im Fenster eines Musikgeschäfts in Muskogee, Oklahoma, so sehr, dass er sich das Instrument vom selbstverdienten Geld kaufte, obwohl sein Vater etwas dagegen hatte, weil Gitarre seiner Ansicht nach nur Bettler spielten. Er machte auf dem Instrument allerdings schnell solche Fortschritte, dass seine Mutter ihm 1939 eine elektrische Gitarre mit Verstärker kaufte. Er kaufte sich all die neuesten Platten Charlie Christians, und als der sich 1940 in Oklahoma City aufhielt, verbrachte Barney drei Tage mit seinem Idol, spielte mit ihm und ließ sich Tricks beibringen. 1942 zog es den 19-jährigen nach Los Angeles und wurde bald Gitarrist des Orchesters von Chico Marx, geleitet von Ben Pollack. Er teilte das Zimmer auf Tourneen meist mit Mel Torme, der nicht nur für die Band sang, sondern ab und zu auch Schlagzeug spielte. 1944 spielte er mit Charlie Barnet und machte 1945 seine erste Platte unter eigenem Namen. 1947 spielte er sowohl mit Benny Goodman wie auch mit den Charlie Parker All Stars. Ende der 1940er Jahre dann als Studiomusiker für Capitol Records in Hollywood, eine Funktion, in der er Jazz- genauso wie andere Stars begleitete, darunter auch Marlene Dietrich, Doris Day oder Maurice Chevalier. 1952 bat Norman Granz ihn, beim (klassischen) Oscar Peterson Trio mitzumachen; ansonsten wirkte er in den 50er Jahren bei vielen Alben für das Label Contemporary mit, die teilweise auch unter seinem Namen erschienen. Summerfield beschreibt Kessels Arbeit als Studiomusiker. Ende der 60er Jahre lebte Kessel eine Weile in London und kehrte in der Folge immer wieder zu Tourneen nach Europa zurück. 1974 trat er erstmals mit Charly Byrd und Herb Ellis in der Band “The Great Guitars” auf, die in wechselnden Besetzungen bis in die 190er Jahre bestand. Im Alter von 68 Jahren erlitt Kessel im Mai 1962 einen Schlaganfall, nach dem er nicht mehr Gitarre spielen konnte. 2004 starb er an den Folgen eines Gehirntumors. Summerfields Buch zeichnet Kessels Lebensgeschichte nüchtern nach, mit vielen Daten und Fakten sowie etlichen Interviewauszügen. Ein eigenes umfangreiches Kapitel ist seinen Gitarren und seiner Ausrüstung gewidmet. “Thoughts on Music & Life” ist ein Kapitel überschrieben, das Interviewausschnitte des Gitarristen sammelt. In einer Fotogalerie finden sich unzählige seltene Fotos, einschließlich seiner Geburts- und Todesurkunden. Schließlich enthält das Buch eine 150 Seiten umfassende Diskographie des Gitarristen. Für Kessel-Fans ein Muss, das in seinen biographischen Kapiteln vielleicht manchmal etwas trocken zu lesen ist, aber durch die vielen Einsprengsel von Auszügen aus Interviews genügend Stoff enthält, um ein umfassendes Bild des Wirkens von Barney Kessel geben zu können.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
The World That Made New Orleans. From Spanish Silver to Congo Square
von Ned Sublette
Chicago 2008 (Lawrence Hill Books)
360 Seiten
ISBN: 978-1-55652-730-2
 New Orleans hat viele Geschichten. Da ist die Geschichte der nördlichsten Stadt der Karibik, die Geschichte der französischen Kolonie, die Geschichte einer gut funktionierenden Vielvölkerstadt, die Geschichte der Sklaverei, die Geschichte der Hafenstadt mit allen dazugehörigen Subgeschichten, von Schifffahrt bis Prostitution, und natürlich die Geschichte der Musik, von Oper, Gesangsvereinen, Marschkapellen, Ragtime und Jazz. Ned Sublette zeichnet in seinem Buch die Frühgeschichte der Stadt nach, von den Anfängen als französische Siedlung bis etwa 1820, als die Stadt mit ihren unterschiedlichen Traditionen fest in die Vereinigten Staaten von Amerika eingemeindet worden war. Ihm geht es um kulturelle Einflüsse, die sich nicht nur in der Musik niederschlagen (die allerdings immer wieder ausgiebig Erwähnung findet), sondern auch in Sitten und Gebräuchen, im Lebensgefühl der Menschen und auch in politischen Entscheidungen, die die Crescent City bis heute wie eine so gar nicht wirklich amerikanische Stadt erscheinen lassen. Straßennamen in New Orleans erzählen die Geschichte der Stadt, erklärt Sublette, Straßen, die nach Generälen und Präsidenten benannt seien, nach “Mystery”, “Music” und “Pleasure”. Sublette recherchiert die Geschichte der Stadt als Historiker, aber er erzählt sie als ein kritischer Geist von heute, verbindet die geschichtlichen Erkenntnisse immer mit den Erfahrungen der Gegenwart. Reisende hätten sich immer schon gewundert, wie man eine Stadt auf so unfestem Grund bauen könne, berichtet er. 1492 entdeckte Kolumbus teile Amerikas, und im 16. Jahrhundert kolonialisierten die Spanier viele Gebiete der Karibik. Sublette erzählt die Geschichte des Wettstreits der europäischen Mächte um die Kolonien in der Neuen Welt, insbesondere die wechselnden Erfolge der Spanier, der Briten und der Franzosen, und wie aus dieser Konkurrenz heraus der französische Gesandte Pierre Le Moyne, Sieur d’Iberville, verschiedene Posten nahe der Mississippi-Mündung gründete, bevor er in den frühen Jahren des 18. Jahrhunderts eine Siedlung gründete, die gegen 1718, dem Herzog zu Orléans zu Ehren, Nouvelle Orléans genannt wurde. Sublette beschreibt die wirtschaftliche Entwicklung der frühen französischen Siedlung und ihre politische Stellung, die etwa der “Sibiriens im 20. Jahrhunderts” glich. Er beschreibt, wie man versuchte neue Einwohner auch aus anderen Ländern als Frankreich anzuwerben, Deutsche beispielsweise, und wie dann, bereits ab 1719, der Sklavenhandel aufblühte. Man liest, woher die Sklaven anfangs kamen und welche Akkulturationsprozesse sie in der neuen Heimat durchmachten (durchmachen mussten). 1762 schenkte Louis XV Louisiana an seinen Cousin Carlos III von Spanien. Die Spanier führten neue Gesetze ein, die auch die Sklaven betrafen und weniger streng waren als der französische Code Noir. Schon damals hatte New Orleans ein ausgeprägtes Nachtleben und Bedarf an Musik. Sublette schreibt in diesem Zusammenhang auch über die Bedeutung des Congo Square, die noch auf französische Zeiten zurückging, über die Tänze der Schwarzen dort, die nicht nur von Durchreisenden wahrgenommen wurden, sondern auch von der spanischen Regierung geregelt wurden — übrigens unter dem Namen “tangos”; Grund genug, kurz auf die Verbindungen zwischen Habanera- und Tangorhythmen in der Karibik und New Orleans einzugehen, Louis Moreau Gottschalk, Jelly Roll Morton, W.C. Handy und den Spanish Tinge zu erwähnen, der bis heute in der Stadt eine wichtige Rolle spielt. Am Karfreitag 1788 fing ein Altar auf der Chartres Street Feuer und setzte nach und nach die ganze Stadt in Brand. Ihr Wiederaufbau geriet im spanischen Kolonialstil, der bis heute das Straßenbild der Stadt, auch ihres paradoxerweise als “French Quarter” bezeichneten berühmtesten Stadtteils, prägt. Sublette beschreibt die Sklavenrevolten in dem unter französischer Herrschaft stehenden Santo Domingo, die Auswirkungen auf New Orleans hatten, weil viele der ehemaligen Sklaven dorthin flohen, als nach der Französischen Revolution die Sklaverei in der gesamten französischen Einflusssphäre abgeschafftt wurde. Mit den vielen freien Schwarzen aus Santo Domingo kam auch die revolutionäre Idee von Freiheit für alle Sklaven in die Stadt. Die Französen wollten ihre ehemalige Kolonie zurück, und Napoleon Bonaparte bestand 1802 darauf, Louisiana wieder als französisches Gebiet zu akquirieren. Ein Jahr später allerdings bot er das ganze Land Louisiana bereits wieder dem amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson für 60 Millionen Francs zum Kauf an. Die USA mussten nun mit der Tatsache umgehen, dass aus historischen Gründen in Louisiana Schwarze verschiedener sozialer Klassen existierten: frisch “importierte” Sklaven, in Amerika geborene und bereits teilweise akkulturierte Sklaven sowie freie Schwarze insbesondere aus Santo Domingo. Sublette diskutiert kurz die Haltung des Präsidenten zur schwarzen Bevölkerung seines Landes — er war ein strikter Verfechter der Sklaverei, sah Sklaven als frei verfügbares Kapital, besaß selbst über die Zeit seines Lebens mehr als sechshundert Sklavenund hatte zugleich ein enges Verhältnis zu einer seiner Sklavinnen. Ihm war zugleich bewusst, dass die Tage der Sklaverei gezählt waren und eine kluge Regierung Gesetze in Angriff nehmen musste, um die Zeit danach vorzubereiten. Unter Jeffersons Regierung allerdings wurde New Orleans erst einmal zum größten Sklavenmarkt der Vereinigten Staaten. Sublette beschreibt, wie Sklaven für die weiße Bevölkerung sozialen Status bedeuteten und wie Louisiana nachgerade die “Züchtung” neuer Sklaven unterstützte. In New Orleans durchdrangen sich inzwischen die verschiedenen kulturellen Traditionen, insbesondere der französischen und britischen Bevölkerung. Es gab Bälle zuhauf; 1805 wurde die erste Oper in der Stadt aufgeführt; es gab zwei Theater und daneben ein lebendiges afro-amerikanisches religiöses Leben. Die schwarze Bevölkerung der Stadt war größer als die weiße, aber nach und nach wurden die neuen Gesetze der Vereinigten Staaten durchgesetzt, die weitaus strenger durchgriffen und insbesondere viele der freien Schwazen ihrer zuvor zugestandenen Rechte beraubten. 1809 erklärte Kuba sich solidarisch mit dem spanischen König, der gerade Frankreich den Krieg erklärt hatte. Kuba wies alle Franzosen aus, zählte dazu aber grundsätzlich all jene, die keinen Eid auf Spanien geschworen hatten, also auch viele der zuvor aus Santo Domingo nach Kuba gekommenen Schwarzen, die in der Folge vor allem nach New Orleans flüchteten. Diese meist französisch sprechenden Einwanderer wurden bald ein wichtiger Teil der Gesellschaft, politische Bürger mit Einfluss, Zeitungsverleger, Anwälte und Kaufleute. Hier nun ended Sublettes Geschichte, noch lang vor der Abschaffung der Sklaverei also, lang vor den musikalischen Auswirkungen, die der Melting Pot New Orleans im Jazz des 20sten Jahrhunderts zeitigen sollte. Doch Musik spielt überall in seinem Buch eine wichtige Rolle, und die Art, wie er historische Entwicklungen, ihre Auswirkungen auf die Menschen mit verschiedenem sozialen Status und letzten Endes auf den Lauf der Dinge bis heute schildert, erklärt viel auch über das Faszinosum des Jazz in späteren Jahren. Macht und vielfache Machtwechsel, Akkulturation auf verschiedenen Ebenen und die kulturelle Vermischung, die bei alledem zwangsweise geschah, sind die bunte kulturelle Mischung, die so großen Einfluss auf die afro-amerikanische Musik des 20sten Jahrhunderts haben sollte. Sublettes Buch ist dabei kenntnisreich und spannend geschrieben, erklärt Zusammenhänge und lässt nie die persönliche Betroffenheit außer Acht, auch die persönliche Betroffenheit des Autors, der in seiner Erzählung immer wieder auf eigene Vorfahren trifft.
New Orleans hat viele Geschichten. Da ist die Geschichte der nördlichsten Stadt der Karibik, die Geschichte der französischen Kolonie, die Geschichte einer gut funktionierenden Vielvölkerstadt, die Geschichte der Sklaverei, die Geschichte der Hafenstadt mit allen dazugehörigen Subgeschichten, von Schifffahrt bis Prostitution, und natürlich die Geschichte der Musik, von Oper, Gesangsvereinen, Marschkapellen, Ragtime und Jazz. Ned Sublette zeichnet in seinem Buch die Frühgeschichte der Stadt nach, von den Anfängen als französische Siedlung bis etwa 1820, als die Stadt mit ihren unterschiedlichen Traditionen fest in die Vereinigten Staaten von Amerika eingemeindet worden war. Ihm geht es um kulturelle Einflüsse, die sich nicht nur in der Musik niederschlagen (die allerdings immer wieder ausgiebig Erwähnung findet), sondern auch in Sitten und Gebräuchen, im Lebensgefühl der Menschen und auch in politischen Entscheidungen, die die Crescent City bis heute wie eine so gar nicht wirklich amerikanische Stadt erscheinen lassen. Straßennamen in New Orleans erzählen die Geschichte der Stadt, erklärt Sublette, Straßen, die nach Generälen und Präsidenten benannt seien, nach “Mystery”, “Music” und “Pleasure”. Sublette recherchiert die Geschichte der Stadt als Historiker, aber er erzählt sie als ein kritischer Geist von heute, verbindet die geschichtlichen Erkenntnisse immer mit den Erfahrungen der Gegenwart. Reisende hätten sich immer schon gewundert, wie man eine Stadt auf so unfestem Grund bauen könne, berichtet er. 1492 entdeckte Kolumbus teile Amerikas, und im 16. Jahrhundert kolonialisierten die Spanier viele Gebiete der Karibik. Sublette erzählt die Geschichte des Wettstreits der europäischen Mächte um die Kolonien in der Neuen Welt, insbesondere die wechselnden Erfolge der Spanier, der Briten und der Franzosen, und wie aus dieser Konkurrenz heraus der französische Gesandte Pierre Le Moyne, Sieur d’Iberville, verschiedene Posten nahe der Mississippi-Mündung gründete, bevor er in den frühen Jahren des 18. Jahrhunderts eine Siedlung gründete, die gegen 1718, dem Herzog zu Orléans zu Ehren, Nouvelle Orléans genannt wurde. Sublette beschreibt die wirtschaftliche Entwicklung der frühen französischen Siedlung und ihre politische Stellung, die etwa der “Sibiriens im 20. Jahrhunderts” glich. Er beschreibt, wie man versuchte neue Einwohner auch aus anderen Ländern als Frankreich anzuwerben, Deutsche beispielsweise, und wie dann, bereits ab 1719, der Sklavenhandel aufblühte. Man liest, woher die Sklaven anfangs kamen und welche Akkulturationsprozesse sie in der neuen Heimat durchmachten (durchmachen mussten). 1762 schenkte Louis XV Louisiana an seinen Cousin Carlos III von Spanien. Die Spanier führten neue Gesetze ein, die auch die Sklaven betrafen und weniger streng waren als der französische Code Noir. Schon damals hatte New Orleans ein ausgeprägtes Nachtleben und Bedarf an Musik. Sublette schreibt in diesem Zusammenhang auch über die Bedeutung des Congo Square, die noch auf französische Zeiten zurückging, über die Tänze der Schwarzen dort, die nicht nur von Durchreisenden wahrgenommen wurden, sondern auch von der spanischen Regierung geregelt wurden — übrigens unter dem Namen “tangos”; Grund genug, kurz auf die Verbindungen zwischen Habanera- und Tangorhythmen in der Karibik und New Orleans einzugehen, Louis Moreau Gottschalk, Jelly Roll Morton, W.C. Handy und den Spanish Tinge zu erwähnen, der bis heute in der Stadt eine wichtige Rolle spielt. Am Karfreitag 1788 fing ein Altar auf der Chartres Street Feuer und setzte nach und nach die ganze Stadt in Brand. Ihr Wiederaufbau geriet im spanischen Kolonialstil, der bis heute das Straßenbild der Stadt, auch ihres paradoxerweise als “French Quarter” bezeichneten berühmtesten Stadtteils, prägt. Sublette beschreibt die Sklavenrevolten in dem unter französischer Herrschaft stehenden Santo Domingo, die Auswirkungen auf New Orleans hatten, weil viele der ehemaligen Sklaven dorthin flohen, als nach der Französischen Revolution die Sklaverei in der gesamten französischen Einflusssphäre abgeschafftt wurde. Mit den vielen freien Schwarzen aus Santo Domingo kam auch die revolutionäre Idee von Freiheit für alle Sklaven in die Stadt. Die Französen wollten ihre ehemalige Kolonie zurück, und Napoleon Bonaparte bestand 1802 darauf, Louisiana wieder als französisches Gebiet zu akquirieren. Ein Jahr später allerdings bot er das ganze Land Louisiana bereits wieder dem amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson für 60 Millionen Francs zum Kauf an. Die USA mussten nun mit der Tatsache umgehen, dass aus historischen Gründen in Louisiana Schwarze verschiedener sozialer Klassen existierten: frisch “importierte” Sklaven, in Amerika geborene und bereits teilweise akkulturierte Sklaven sowie freie Schwarze insbesondere aus Santo Domingo. Sublette diskutiert kurz die Haltung des Präsidenten zur schwarzen Bevölkerung seines Landes — er war ein strikter Verfechter der Sklaverei, sah Sklaven als frei verfügbares Kapital, besaß selbst über die Zeit seines Lebens mehr als sechshundert Sklavenund hatte zugleich ein enges Verhältnis zu einer seiner Sklavinnen. Ihm war zugleich bewusst, dass die Tage der Sklaverei gezählt waren und eine kluge Regierung Gesetze in Angriff nehmen musste, um die Zeit danach vorzubereiten. Unter Jeffersons Regierung allerdings wurde New Orleans erst einmal zum größten Sklavenmarkt der Vereinigten Staaten. Sublette beschreibt, wie Sklaven für die weiße Bevölkerung sozialen Status bedeuteten und wie Louisiana nachgerade die “Züchtung” neuer Sklaven unterstützte. In New Orleans durchdrangen sich inzwischen die verschiedenen kulturellen Traditionen, insbesondere der französischen und britischen Bevölkerung. Es gab Bälle zuhauf; 1805 wurde die erste Oper in der Stadt aufgeführt; es gab zwei Theater und daneben ein lebendiges afro-amerikanisches religiöses Leben. Die schwarze Bevölkerung der Stadt war größer als die weiße, aber nach und nach wurden die neuen Gesetze der Vereinigten Staaten durchgesetzt, die weitaus strenger durchgriffen und insbesondere viele der freien Schwazen ihrer zuvor zugestandenen Rechte beraubten. 1809 erklärte Kuba sich solidarisch mit dem spanischen König, der gerade Frankreich den Krieg erklärt hatte. Kuba wies alle Franzosen aus, zählte dazu aber grundsätzlich all jene, die keinen Eid auf Spanien geschworen hatten, also auch viele der zuvor aus Santo Domingo nach Kuba gekommenen Schwarzen, die in der Folge vor allem nach New Orleans flüchteten. Diese meist französisch sprechenden Einwanderer wurden bald ein wichtiger Teil der Gesellschaft, politische Bürger mit Einfluss, Zeitungsverleger, Anwälte und Kaufleute. Hier nun ended Sublettes Geschichte, noch lang vor der Abschaffung der Sklaverei also, lang vor den musikalischen Auswirkungen, die der Melting Pot New Orleans im Jazz des 20sten Jahrhunderts zeitigen sollte. Doch Musik spielt überall in seinem Buch eine wichtige Rolle, und die Art, wie er historische Entwicklungen, ihre Auswirkungen auf die Menschen mit verschiedenem sozialen Status und letzten Endes auf den Lauf der Dinge bis heute schildert, erklärt viel auch über das Faszinosum des Jazz in späteren Jahren. Macht und vielfache Machtwechsel, Akkulturation auf verschiedenen Ebenen und die kulturelle Vermischung, die bei alledem zwangsweise geschah, sind die bunte kulturelle Mischung, die so großen Einfluss auf die afro-amerikanische Musik des 20sten Jahrhunderts haben sollte. Sublettes Buch ist dabei kenntnisreich und spannend geschrieben, erklärt Zusammenhänge und lässt nie die persönliche Betroffenheit außer Acht, auch die persönliche Betroffenheit des Autors, der in seiner Erzählung immer wieder auf eigene Vorfahren trifft.
(Wolfram Knauer)
60 ans de Jazz au Caveau de la Huchette
von Dany Doriz & Christian Mars
Paris 2008
l’Archipel
160 Seiten, 29,95 Euro
ISBN 978-2-8098-0033-3
 Die Caveau de la Huchette feierte 2006 seinen 60sten Geburtstag, und sie ist bis heute ein Unikum geblieben: einer jener Pariser Keller, in denen der Jazz zum Mittelpunkt der Existentialistenkultur wurde, mit Blues, Boogie und Tanz eine nächtliche Alternative zu den sonstigen Treffpunkten der Intellektuellen und Möchtegernintellektuellen darstellte. Wer nie in der Caveau de la Huchette gewesen ist, sollte dies nachholen, denn noch heute wird der Jazz dort auf jenes motorische Element zurückgeholt, aus dem er letzten Endes mit entstanden ist. Der Vibraphonist Dany Doriz hat oft genug im Club gespielt und jetzt zusammen mit dem Journalisten Christian Mars eine Dokumentation über die Geschichte des Clubs und seiner Atmosphäre vorgelegt. Jede Menge historische Fotos zeigen den Raum und die unterschiedlichen Acts, die über die Jahrzehnte dort auftraten. Neben den Jazzmusikern waren das durchaus auch mal Magier, die Tauben aus einer Cloche zauberten. Die Tänzer aber sind es vor allem, die neben den Musikern den Keller in der Rue de la Huchette beherrschten. Lindy Hop, R&B, Rock ‘n’ Roll, irgendwie ähnelten sich die Tänze, und neben den Paartänzen gab es auch Gruppentänze und Stepptanz. Die Musiker sind reichlich dokumentiert in Fotos und Geschichten, Boris Vian etwa oder Claude Luter, der mit seinen Lorientais hier und anderswo im Viertel zuhause war; Sidney Bechet, der in den 1950er Jahren als großer Star in Frankreich lebte; Claude Bolling, Maxim Saury, Raymon Fonsèque, Irakli und viele andere Musiker und Bands, für die die Caveau ein zweites Zuhause war. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit dem Streit zwischen Traditionalisten und Modernisten. Natürlich erzählt auch Dany Doriz seine Geschichte; und auch die oft in der Caveau auftretenden Amerikaner kommen nicht zu kurz: Bill Coleman, Hal Singer, Benny Waters, Memphis Slim, Sam Woodyard, Milt Buckner, Art Blakey, Wild Bill Davis, Al Grey, Cat Anderson sowie Doriz’s Vorbild, der große Lionel Hampton, der 1976, zum 30sten Geburtstag des Clubs, zugegen war. Das Buch ist voller schöner und seltener Fotos, denen es gelingt die Atmosphäre im Kellergewölbe von Saint Germain-des-Pres widerzugeben. Am Schluss gibt es eine Programmliste der zwischen 1971 und 2007 im Club aufgetretenen Künstler. Ein schönes Andenken für jeden, der die Caveau schon einmal besucht hat — und für alle anderen eine Anregung, wenn auch spät, so wenigstens jetzt noch einmal in die Keller der Existentialisten abzutauchen.
Die Caveau de la Huchette feierte 2006 seinen 60sten Geburtstag, und sie ist bis heute ein Unikum geblieben: einer jener Pariser Keller, in denen der Jazz zum Mittelpunkt der Existentialistenkultur wurde, mit Blues, Boogie und Tanz eine nächtliche Alternative zu den sonstigen Treffpunkten der Intellektuellen und Möchtegernintellektuellen darstellte. Wer nie in der Caveau de la Huchette gewesen ist, sollte dies nachholen, denn noch heute wird der Jazz dort auf jenes motorische Element zurückgeholt, aus dem er letzten Endes mit entstanden ist. Der Vibraphonist Dany Doriz hat oft genug im Club gespielt und jetzt zusammen mit dem Journalisten Christian Mars eine Dokumentation über die Geschichte des Clubs und seiner Atmosphäre vorgelegt. Jede Menge historische Fotos zeigen den Raum und die unterschiedlichen Acts, die über die Jahrzehnte dort auftraten. Neben den Jazzmusikern waren das durchaus auch mal Magier, die Tauben aus einer Cloche zauberten. Die Tänzer aber sind es vor allem, die neben den Musikern den Keller in der Rue de la Huchette beherrschten. Lindy Hop, R&B, Rock ‘n’ Roll, irgendwie ähnelten sich die Tänze, und neben den Paartänzen gab es auch Gruppentänze und Stepptanz. Die Musiker sind reichlich dokumentiert in Fotos und Geschichten, Boris Vian etwa oder Claude Luter, der mit seinen Lorientais hier und anderswo im Viertel zuhause war; Sidney Bechet, der in den 1950er Jahren als großer Star in Frankreich lebte; Claude Bolling, Maxim Saury, Raymon Fonsèque, Irakli und viele andere Musiker und Bands, für die die Caveau ein zweites Zuhause war. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit dem Streit zwischen Traditionalisten und Modernisten. Natürlich erzählt auch Dany Doriz seine Geschichte; und auch die oft in der Caveau auftretenden Amerikaner kommen nicht zu kurz: Bill Coleman, Hal Singer, Benny Waters, Memphis Slim, Sam Woodyard, Milt Buckner, Art Blakey, Wild Bill Davis, Al Grey, Cat Anderson sowie Doriz’s Vorbild, der große Lionel Hampton, der 1976, zum 30sten Geburtstag des Clubs, zugegen war. Das Buch ist voller schöner und seltener Fotos, denen es gelingt die Atmosphäre im Kellergewölbe von Saint Germain-des-Pres widerzugeben. Am Schluss gibt es eine Programmliste der zwischen 1971 und 2007 im Club aufgetretenen Künstler. Ein schönes Andenken für jeden, der die Caveau schon einmal besucht hat — und für alle anderen eine Anregung, wenn auch spät, so wenigstens jetzt noch einmal in die Keller der Existentialisten abzutauchen.
(Wolfram Knauer)
Ben van Melick
Han Bennink. Cover Art for ICP and other labels
Rimburg/Niederlande 2008
Uitgeverij Huis Clos
64 Seiten, 15 Euro
ISBN: 90-1234-4568-9
 Erstaunlich viele Schlagzeuger besitzen eine zweite künstlerische Ader als Maler — George Wettling, Daniel Humair, Joe Hackbarth, Ralf Hübner, Tony Oxley, Vladimir Tarasov sind bekannte Beispiele, aber auch der Niederländer Han Bennink gehört in diese Riege. Seine Cover Art prangt auf vielen Schallplattencovern für seine eigenen Projekte genauso wie für befreundete Musiker. Ben van Melick hat in diesem kleinen Büchlein die graphischen Ideen des Schlagzeugers für das ICP Label der Instant Composers Collective sowie für andere Labels gesammelt. In seinem Vorwort beschreibt van Melick biographische Stationen Benninks, der Grafik studiert und schon früh Bildende Kunst und Musik in seinen Performances gemischt habe, etwa bei einer Galerieeröffnung im Jahr 1966. Er habe sich dann lange Jahre vor allem um die Musik gekümmert und erst in den 1980er Jahren wieder verstärkt auch der visuellen Kunst zugewandt. Die Cover, die in dem Büchlein abgedruckt sind stammen aus den Jahren 1967 bis 2008. Witz, das Spiel mit der Irritation, künstlerische Rätsel und Vexierspiele finden sich darunter und erinnern im Charakter an den Schlagzeuger, der sein Publikum genauo gern in die Irre führt, bei dem oft scheinbar rein zufällige Gesten sich im Höreindruck als komplexe musikalische Statements entpuppen. Da bringt er Bilder aus einem Kindermalbuch in seltsam anmutende Bezüge zueinander, da arbeitet er mit Fotos und Collagen, mit Text und der Anordnung von Text (etwa dem rhythmischen Verteilen der Besetzungsnamen auf dem Plattencover). Collageartig zusammengeklebte Schreibmaschinentexte finden sich genauso wie kalligraphisch gestaltete Texte. Eine Schiedsrichterpfeife taucht öfters auf, und das “o” im letzen Wort des Albums “Bospaadje konijnehol” (Forest path rabbit hole) hat er im Original mit einem echten Hasenkötel markiert. Während anfangs Schwarz-Weiß-Cover überwiegen (sicher auch aus Kostengründen; die Auflage der Platten war gewiss nicht allzu hoch), finden sich spätestens ab dem neuen Jahrtausend Farbnuancen, die den Bildern noch mehr Tiefe und oft auch Doppeldeutigkeit verleihen. Immer wieder spielt Bennink dabei auch mit Selbstzitaten, erkennt man Elemente früherer Covergestaltungen wieder, ob dies nun konkrete Motive sind oder Gestaltungsmethoden. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass zwischen Bennink, dem Künstler, und Bennink, dem Musiker, gar kein so großer Unterschied besteht, dass die ästhetische Grundhaltung der hintersinnigen Umdeutung des Alltäglichen bei beiden eine ideelle Grundhaltung ist.
Erstaunlich viele Schlagzeuger besitzen eine zweite künstlerische Ader als Maler — George Wettling, Daniel Humair, Joe Hackbarth, Ralf Hübner, Tony Oxley, Vladimir Tarasov sind bekannte Beispiele, aber auch der Niederländer Han Bennink gehört in diese Riege. Seine Cover Art prangt auf vielen Schallplattencovern für seine eigenen Projekte genauso wie für befreundete Musiker. Ben van Melick hat in diesem kleinen Büchlein die graphischen Ideen des Schlagzeugers für das ICP Label der Instant Composers Collective sowie für andere Labels gesammelt. In seinem Vorwort beschreibt van Melick biographische Stationen Benninks, der Grafik studiert und schon früh Bildende Kunst und Musik in seinen Performances gemischt habe, etwa bei einer Galerieeröffnung im Jahr 1966. Er habe sich dann lange Jahre vor allem um die Musik gekümmert und erst in den 1980er Jahren wieder verstärkt auch der visuellen Kunst zugewandt. Die Cover, die in dem Büchlein abgedruckt sind stammen aus den Jahren 1967 bis 2008. Witz, das Spiel mit der Irritation, künstlerische Rätsel und Vexierspiele finden sich darunter und erinnern im Charakter an den Schlagzeuger, der sein Publikum genauo gern in die Irre führt, bei dem oft scheinbar rein zufällige Gesten sich im Höreindruck als komplexe musikalische Statements entpuppen. Da bringt er Bilder aus einem Kindermalbuch in seltsam anmutende Bezüge zueinander, da arbeitet er mit Fotos und Collagen, mit Text und der Anordnung von Text (etwa dem rhythmischen Verteilen der Besetzungsnamen auf dem Plattencover). Collageartig zusammengeklebte Schreibmaschinentexte finden sich genauso wie kalligraphisch gestaltete Texte. Eine Schiedsrichterpfeife taucht öfters auf, und das “o” im letzen Wort des Albums “Bospaadje konijnehol” (Forest path rabbit hole) hat er im Original mit einem echten Hasenkötel markiert. Während anfangs Schwarz-Weiß-Cover überwiegen (sicher auch aus Kostengründen; die Auflage der Platten war gewiss nicht allzu hoch), finden sich spätestens ab dem neuen Jahrtausend Farbnuancen, die den Bildern noch mehr Tiefe und oft auch Doppeldeutigkeit verleihen. Immer wieder spielt Bennink dabei auch mit Selbstzitaten, erkennt man Elemente früherer Covergestaltungen wieder, ob dies nun konkrete Motive sind oder Gestaltungsmethoden. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass zwischen Bennink, dem Künstler, und Bennink, dem Musiker, gar kein so großer Unterschied besteht, dass die ästhetische Grundhaltung der hintersinnigen Umdeutung des Alltäglichen bei beiden eine ideelle Grundhaltung ist.
(Wolfram Knauer)
Michel Prodeau
La Musique de Don Ellis
Montalzat 2008
Éditions Boutik Pro
199 Seiten, 16 Euro
ISBN: 978-2-9532237-0-5
 Der Trompeter Don Ellis hatte eine kurze, aber einflussreiche Karriere. Nur 20 Jahre dokumentieren Plattenaufnahmen den 1978 im Alter von gerade mal 44 Jahren verstorbenen Musiker, der immer mit zu den Experimentierern seines Metiers gehörte: ob mit ungeraden Metren, Zwölftonskalen, ethnischen Einflüssen aus indischer Musik oder solcher aus dem Balkan, elektronischer Klängen, dem Zusammenkommen von Jazz, Rock und Pop. Michel Prodeau versucht in seinem Buch eine Annäherung an den 1934 in Los Angeles geborenen Trompeter. Ihn interessieren dabei weniger biographische Details als vielmehr vor allem die auf Schallplatte dokumentierten Aufnahmen. Er erwähnt den Einfluss des Pianisten und Komponisten George Russell oder jenen der Third-Stream-Bewegung der 1950er und 1960er Jahre, die Experimente mit großem Orchester, neuen klanglichen wie metrischen Möglichkeiten, sein allgemeines Interesse am, Sprengen der Genregrenzen. Das Buch hangelt sich dabei von Album zu Album und wirkt damit wie eine gut kommentierte Diskographie, nennt Details der Kompositionsstrategien und Besonderheiten der Aufnahmesituationen, zieht allerdings nur wenig Querverweise und reicht auch in den angedeuteten Analysen nur selten über das hinaus, was auf den Platten zu hören und in den Plattentexten (in anderen Worten) nachzulesen wäre. Da merkt man dann Füllabsätze, etwa, wenn Prodeau sämtliche Aufführungsorte des Dokumentarfilms “Electric Heart, Don Ellis” auflistet und bleibt etwas enttäuscht zurück, dass die Aufzählung von namen im Text nicht mit Inhalt gefüllt wird, es also nicht nur wichtig ist, mit wem Ellis oder seine Mitmusiker zusammengespielt haben, sondern viel eher, welche musikalischen Erfahrungen sich mit solchen biographischen Details verbinden, die wiederum auf die Musik Ellis’ Einfluss haben. Eine Diskographie schließt das Buch ab; ein gerade in einer solch personen- und titelbetonten Monographie besonders nützlicher Namens- oder Titelindex fehlt leider. Auch in der Bibliographie fehlen Hinweise auf mehrere fachkundige amerikanische Dissertationen, die sich insbesondere mit Ellis’ metrisch-rhythmischen Experimenten, aber auch mit seinen weltmusikalischen Ansätzen und seiner Interpretation des Blues auseinandergesetzt haben. Prodeaus Buch ist allerdings zur Zeit die einzige auf dem Markt befindliche Monographie über den Trompeter.
Der Trompeter Don Ellis hatte eine kurze, aber einflussreiche Karriere. Nur 20 Jahre dokumentieren Plattenaufnahmen den 1978 im Alter von gerade mal 44 Jahren verstorbenen Musiker, der immer mit zu den Experimentierern seines Metiers gehörte: ob mit ungeraden Metren, Zwölftonskalen, ethnischen Einflüssen aus indischer Musik oder solcher aus dem Balkan, elektronischer Klängen, dem Zusammenkommen von Jazz, Rock und Pop. Michel Prodeau versucht in seinem Buch eine Annäherung an den 1934 in Los Angeles geborenen Trompeter. Ihn interessieren dabei weniger biographische Details als vielmehr vor allem die auf Schallplatte dokumentierten Aufnahmen. Er erwähnt den Einfluss des Pianisten und Komponisten George Russell oder jenen der Third-Stream-Bewegung der 1950er und 1960er Jahre, die Experimente mit großem Orchester, neuen klanglichen wie metrischen Möglichkeiten, sein allgemeines Interesse am, Sprengen der Genregrenzen. Das Buch hangelt sich dabei von Album zu Album und wirkt damit wie eine gut kommentierte Diskographie, nennt Details der Kompositionsstrategien und Besonderheiten der Aufnahmesituationen, zieht allerdings nur wenig Querverweise und reicht auch in den angedeuteten Analysen nur selten über das hinaus, was auf den Platten zu hören und in den Plattentexten (in anderen Worten) nachzulesen wäre. Da merkt man dann Füllabsätze, etwa, wenn Prodeau sämtliche Aufführungsorte des Dokumentarfilms “Electric Heart, Don Ellis” auflistet und bleibt etwas enttäuscht zurück, dass die Aufzählung von namen im Text nicht mit Inhalt gefüllt wird, es also nicht nur wichtig ist, mit wem Ellis oder seine Mitmusiker zusammengespielt haben, sondern viel eher, welche musikalischen Erfahrungen sich mit solchen biographischen Details verbinden, die wiederum auf die Musik Ellis’ Einfluss haben. Eine Diskographie schließt das Buch ab; ein gerade in einer solch personen- und titelbetonten Monographie besonders nützlicher Namens- oder Titelindex fehlt leider. Auch in der Bibliographie fehlen Hinweise auf mehrere fachkundige amerikanische Dissertationen, die sich insbesondere mit Ellis’ metrisch-rhythmischen Experimenten, aber auch mit seinen weltmusikalischen Ansätzen und seiner Interpretation des Blues auseinandergesetzt haben. Prodeaus Buch ist allerdings zur Zeit die einzige auf dem Markt befindliche Monographie über den Trompeter.
(Wolfram Knauer)
Christian Béthune
Le Jazz et l’Occident
Paris 2008
Klinksieck
337 Seiten
ISBN: 978-2-252-03674-7
 Der französische Philosoph und Jazzkritiker Christian Béthune beschäftigt sich in seinem neuesten Buch mit dem Verhältnis zwischen dem Jazz und der Philosophie und Ästhetik des 20sten Jahrhunderts.
Der französische Philosoph und Jazzkritiker Christian Béthune beschäftigt sich in seinem neuesten Buch mit dem Verhältnis zwischen dem Jazz und der Philosophie und Ästhetik des 20sten Jahrhunderts.
Konkret fragt er danach, in welche philosophischen und ästhetischen Diskurse der westlichen Welt der Jazz im 20sten Jahrhundert gelangte, und welche philosophischen und ästhetischen Diskurse er beeinflusste. War der Erfolg des Jazz ein Zeichen dafür, dass die Kunst (im alten Sinne) an ihrem Ende angelangt sei oder aber war er eine Weltanschauung ganz eigener Art?
Der Jazz sei in eine ästhetische Welt geboren worden, an deren Zustandekommen er selbst zwar keinen Anteil hatte, die ihn aber in seiner eigenen Entwicklung nachhaltig beeinflussen sollte. Die Musik der schwarzen Amerikaner habe allerdings immer mit ihrer ganz eigenen historischen Situation gelebt, also der, eine Musik zu sein, deren Wurzeln sowohl in der westlichen Tradition wie auch im erzwungenen Traditionsverlust der Sklaverei steckten.
Die Schwarzen in Nordamerika hätten durch ihre Stellung als Sklaven, als eine Art “Untermenschen” zugleich auch eine Freiheit von Traditionen besessen oder zumindest die Chance der Umdeutung von Traditionen, wie dies auch Ralph Ellison in seinem Roman “Invisible man” angedeutet habe. Diese Negation der Menschlichkeit mache einen erheblichen Teil der Kraft des Jazz (und seiner Vorformen) aus, in dem die schwarzen Amerikaner nämlich genau diese ihre Menschlichkeit, ihre “humanité” deutlich manifestierten: Individualität als Beweis des Menschlich-Sein.
Und irgendwie, argumentiert, Béthune, sei der Erfolg des Jazz in Europa nach zwei Weltkriegen eben nicht nur der Präsenz amerikanischer Soldaten in Europa zu verdanken, sondern auch der Tatsache, dass auch die Europäer einer Negation von Geschichte ausgesetzt waren, einer Negation des Horrors. Für sie habe der Jazz eine essentiell humane Musik dargestellt, die es ihnen erleichterte, sich im Angesicht des Unmenschlichen wieder auf das Menschliche zu besinnen.
Jazz biete uns eine Art historischer Utopie, die Utopie der “zweiten Chance”. Für die Sklaven sei die Musik eine Überlebensstrategie gewesen. Und eine ähnliche Funktion räumt Béthune dem Jazz auch in seiner Beziehung zum Okzident ein. Ja, der Jazz besitze eine gewisse “Zeitlosigkeit” (hier wie anderswo nimmt Béthune deutlich Bezug auf Adorno), doch sei eben gerade diese Zeitlosigkeit höchst willkommen, wenn die Zeit selbst in ihrer Instabilität, ihrer Multiplizität, ihrer Endlichkeit in Frage stünde.
Inzwischen allerdings sei der Jazz selbst im Okzident angelangt, Teil der westlichen Kultur und Philosophie geworden. Diesen Weg verfolgt Béthune dann in seinem Buch in zwei Teilen. In ersten Teil versucht er eine Einordnung des “champ jazzistique”, wie er die Traditionen umschreibt, die im Jazz mündeten und den Jazz ausmachen. Seine Argumentation beschreibt die Auswirkungen der Sklaverei, die Arbeitsgesänge, Spirituals, Gospel und Blues, die Minstrelsy und das “Jazzzeitalter” der 1920er Jahre, die Ankunft des Jazz in Europa sowie seine Darstellung im Film und die langsame Entwicklung einer dezidierten Jazzästhetik (“De l’implicite à l’explicite”).
In einem zweiten Teil seines Buchs untersucht er dann die verschiedenen Bezüge jazzspezifischer Ausprägungen zur westlichen Tradition: Improvisation, Oralität, das gemeinschaftliche Entstehen von Kunst (also im Gegensatz zum uni-auktorialen Schaffensprozess), die verschiedenen Zeitkriterien, in die der Jazz eingreift (Form, Rhythmus, swing), das Verlangen danach, sich selbst auszudrücken, sowie nicht zuletzt die Körperlichkeit des Jazz sind Argumente für die vielfältigen Gegenmodelle, die der Jazz in die okzidentale Ästhetik und Philosophie einbringe.
Man muss sich sowohl auf Béthunes Thesen einlassen wie sie auch ein wenig vergessen bei der Lektüre, um ihnen zu folgen und vielleicht eigene Wege in der Deutung jazzhistorischer Entwicklungen und des Bezugs jazzspezifischer Herangehensweisen zur ästhetischen Tradition in Europa zu gehen. Das aber lohnt sich und zeigt, dass dieses Thema, so historisch Béthune es auch angeht (seine Beispiele stammen größtenteils aus der Vor-Free-Jazz, ja sogar noch Vor-Bebop-Zeit) ästhetisch ungemein aktuell und bei weitem nicht ausdiskutiert ist.
(Wolfram Knauer)
Mission Impossible. My Life in Music
von Lalo Schifrin: Mission Impossible. My Life in Music,
Lanham/MD 2008 (Scarecrow Press)
219 Seiten + 1 CD, 35 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-5946-3
 Der Pianist Lalo Schifrin hat mindestens drei Karrieren hinter sich: als Jazzmusiker, als klassischer Komponist und als Komponist und Arrangeur für Film und Fernsehen. In allen drei Bereichen hat er Riesenerfolge gefeiert, spielte von 1958 bis 1963 mit Dizzy Gillespie, komponierte Werke für klassische Ensembles und schrieb die Musik etwa für “The Sting II”, “The Man from U.N.C.L.E.” oder eben “Mission Impossible”. In seiner Autobiographie erzählt er seine Geschichte. Er wurde 1932 in Buenos Aires in eine musikalische Familie geboren und war eine Art Kinderstar — mit neun Jahren spielte er Gershwins “Rhapsody in Blue” mit dem Philharmonischen Orchester unter Leitung von Erich Kleiber. In den 50er Jahren traf er oft mit Friedrich Gulda zusammen, den er als Bruder im geiste sieht, einen “Amphibienmusiker” zwischen Jazz und Klassik. 1954 zog es ihn nach Paris, wo er mit Bobby Jaspar und Chet Baker spielte. Zurück in Buenos Aires hörte Dizzy Gillespie ihn und lud ihn 1958 ein, Mitglied seiner Band zu werden. Schifrin erzählt einige schöne Anekdoten aus seinen Erlebnissen mit Gillespie, aber auch über Duke Ellington, Oscar Peterson, Sarah Vaughan, Stan Getz, Quincy Jones, Thelonious Monk, Miles Davis und John Coltrane, aber auch über Barbra Streisand und Luciano Pavarotti oder über Filmgrößen wie Orson Welles und Marlon Brando. 1964 schrieb Schifrin eine Jazzmesse für den Flötisten Paul Horn, bald folgten auch sinfonische Werke, die meist mit Jazz durchmischt waren. Seine Biographie wurde Richard Palmer in Form gebracht, aber etwas mehr editorische Arbeit hätte dem ganzen gut getan: Die Geschichten stehen manchmal etwas zusammenhanglos nebeneinander, und auch inhaltlich gibt es Unstimmigkeiten: falsche Schreibweisen (Frankfort), falsche Zuweisungen (Hugues Panassié habe angeblich die umfassendste Biographie Duke Ellingtons geschrieben) lassen das alles dann eben doch ein wenig zu sehr ins Unfaktische, rein Anekdotische abgleiten. Das liest sich leicht, ist aber eben auch mit Vorsicht zu genießen.
Der Pianist Lalo Schifrin hat mindestens drei Karrieren hinter sich: als Jazzmusiker, als klassischer Komponist und als Komponist und Arrangeur für Film und Fernsehen. In allen drei Bereichen hat er Riesenerfolge gefeiert, spielte von 1958 bis 1963 mit Dizzy Gillespie, komponierte Werke für klassische Ensembles und schrieb die Musik etwa für “The Sting II”, “The Man from U.N.C.L.E.” oder eben “Mission Impossible”. In seiner Autobiographie erzählt er seine Geschichte. Er wurde 1932 in Buenos Aires in eine musikalische Familie geboren und war eine Art Kinderstar — mit neun Jahren spielte er Gershwins “Rhapsody in Blue” mit dem Philharmonischen Orchester unter Leitung von Erich Kleiber. In den 50er Jahren traf er oft mit Friedrich Gulda zusammen, den er als Bruder im geiste sieht, einen “Amphibienmusiker” zwischen Jazz und Klassik. 1954 zog es ihn nach Paris, wo er mit Bobby Jaspar und Chet Baker spielte. Zurück in Buenos Aires hörte Dizzy Gillespie ihn und lud ihn 1958 ein, Mitglied seiner Band zu werden. Schifrin erzählt einige schöne Anekdoten aus seinen Erlebnissen mit Gillespie, aber auch über Duke Ellington, Oscar Peterson, Sarah Vaughan, Stan Getz, Quincy Jones, Thelonious Monk, Miles Davis und John Coltrane, aber auch über Barbra Streisand und Luciano Pavarotti oder über Filmgrößen wie Orson Welles und Marlon Brando. 1964 schrieb Schifrin eine Jazzmesse für den Flötisten Paul Horn, bald folgten auch sinfonische Werke, die meist mit Jazz durchmischt waren. Seine Biographie wurde Richard Palmer in Form gebracht, aber etwas mehr editorische Arbeit hätte dem ganzen gut getan: Die Geschichten stehen manchmal etwas zusammenhanglos nebeneinander, und auch inhaltlich gibt es Unstimmigkeiten: falsche Schreibweisen (Frankfort), falsche Zuweisungen (Hugues Panassié habe angeblich die umfassendste Biographie Duke Ellingtons geschrieben) lassen das alles dann eben doch ein wenig zu sehr ins Unfaktische, rein Anekdotische abgleiten. Das liest sich leicht, ist aber eben auch mit Vorsicht zu genießen.
(Wolfram Knauer)
Jimmy Katz
Joe Lovano – The Cat with the Hat
(herausgegeben von Rainer Placke und Ingo Wulff)
99 Duoton-Fotografien von Jimmy Katz. Mit Textbeiträgen
von Bruce Lundvall, Michael Cuscuna, John Scofield,
Greg Osby, Hank Jones, Gunther Schuller, Judi Silvano,
Joe Lovano u.a.
Bad Oeynhausen 2008 (Jazzprezzo)
deutsch/englisch, 152 Seiten, Fadenheftung, 22,5 x 27,5 cm
Zusammen mit einer CD “Joe’s Choice”
Preis: 52 Euro
ISBN: 978-3-9810250-6-4
 Im Zentrum des diesjährigen „Weihnachtsfotobuches“ des Jazzprezzo-Verlages steht der amerikanische Tenorsaxophonist Joe Lovano fotografiert von Jimmy Katz, der bereits im letzten Jahr mit “Jimmy Katz in New York“ sein großes Debüt als amerikanischer Starfotograf hatte. Eine lange Freundschaft und Seelenverwandtschaft prägen die Beziehung dieser beiden Künstler. “Meine Sessions sind warm, entspannt und spirituell. Jimmy fängt diese Energie ein, dieses warme Gefühl, das auch in der Musik spürbar wird. Jimmy Katz hält die Freude fest, die in der Musik mitklingt.“ Diese gegenseitige Achtung und künstlerische Sensibilität kennzeichnet auch die Haltung von Jimmy Katz. “Als Fotograf veranstalte ich nie eine Fotosession im Studio, sondern halte fest, wie Musik gemacht wird. Mit meiner Arbeit möchte ich dem Betrachter das Gefühl geben, die Entstehung der Musik gemeinsam mir den Musikern zu erleben. Bei Joe Lovano waren dies insbesondere die “einzigartige Energie und Kreativität“, die Jimmy Katz beeindruckt haben.
Im Zentrum des diesjährigen „Weihnachtsfotobuches“ des Jazzprezzo-Verlages steht der amerikanische Tenorsaxophonist Joe Lovano fotografiert von Jimmy Katz, der bereits im letzten Jahr mit “Jimmy Katz in New York“ sein großes Debüt als amerikanischer Starfotograf hatte. Eine lange Freundschaft und Seelenverwandtschaft prägen die Beziehung dieser beiden Künstler. “Meine Sessions sind warm, entspannt und spirituell. Jimmy fängt diese Energie ein, dieses warme Gefühl, das auch in der Musik spürbar wird. Jimmy Katz hält die Freude fest, die in der Musik mitklingt.“ Diese gegenseitige Achtung und künstlerische Sensibilität kennzeichnet auch die Haltung von Jimmy Katz. “Als Fotograf veranstalte ich nie eine Fotosession im Studio, sondern halte fest, wie Musik gemacht wird. Mit meiner Arbeit möchte ich dem Betrachter das Gefühl geben, die Entstehung der Musik gemeinsam mir den Musikern zu erleben. Bei Joe Lovano waren dies insbesondere die “einzigartige Energie und Kreativität“, die Jimmy Katz beeindruckt haben.
“…über den Mut zum Risiko, …über Lieblingsaufnahmen, …über Einflüsse, …über Unfälle, und über vieles mehr gibt Joe Lovano Auskunft. Diese über das Buch verstreuten, kurzen, unangestrengten Texte, bringen uns Joe Lavano als Künstler und Mensch sehr nahe.
Sessionfotografien, Gruppenaufnahmen, Aufnahmestudios: diese Foto-locations lassen den Betrachter hinter die Kulissen schauen. Sie machen den Part des Musikerlebens sichtbar, den sonst nur Eingeweihte erleben können. Jimmy Katz dokumentiert ganz unprätentiös die Tatsache, dass ein Jazzer eigentlich immer an seiner Musik arbeitet. Die Energie, Konzentriertheit, aber auch das starke Verbundensein der Musiker untereinander schleicht sich in die Szenenfotos von Jimmy Katz wie von selbst. Seine wahre Meisterschaft aber feiert er wie auch schon in seinem letztjährigen Bildband, in den Einzelaufnahmen. Hier zeigt sich seine Fotokunst in zeitlosem klassischem Charakter. Aus der Untersichtsperspektive verleiht er beispielsweise Joe Lovano im Duo mit Gonzalo Rubalcaba seine besondere Aura, als personifizierte Musik, die über den Dingen steht.
Der Jazzprezzo-Verlag ist gerade bei seinen Fotobüchern bekannt für außergewöhnlich gelungenes künstlerisches Design. Auch dieses Mal haben Rainer Placke und Ingo Wulff es wieder einmal geschafft, in kompaktem Format ein großes Fotobuch zu gestalten. Als Bonus gibt es dann auch noch eine CD mit den Lieblingsstücken Joe Lovanos, so dass dem Genuss mit allen Sinnen nichts mehr entgegensteht.
(Doris Schröder)
Jazz in Trier
von Karl-Heinz Breidt & Peter Heinbücher: Jazz in Trier,
Trier 2008 (Verlag Michael Weyand)
ISBN: 978-3-93528-61-4
Preis: 29,80 Euro
 “Jazz ist nicht in Trier entstanden” lautet der erste Satz des Buches, das sich dennoch zum Ziel gesetzt hat, die Geschichte in der ältesten Stadt Deutschlands nachzuzeichnen. Es sammelt unterschiedliche Geschichten, wirft Schlaglichter auf verschiedene Szenen, dokumentiert Erinnerungen in Fotos, Schriftstücken und Interviews. Der erste Jazzkeller wurde 1953 im Keller der Schaabs-Villa gegründet und in dem sich der Jazzclub Evergreen traf. 1959 mussten die Jazzfans in andere Räumlichkeiten ausweichen. Andere Spielstätten kamen und gingen, und 1978 gründete sich der Jazz-Club Trier als eingetragener Verein und neuer Motor der Szene. 1999 kam es zum Bruch der Mitglieder des Vereins, und ein weiterer Club mit einem etwas sperrigeren Namen kam hinzu: der “Jazzclub EuroCore im Saar-Lor-Lux-Trier Musik e.V.”, der sich zum Ziel setzte, nicht nur lokale, sondern regionale, und zwar grenzübergreifend-regionale Jazzprojekte zu fördern. Thomas Schmitt war an der Gründung beider Clubs verantwortlich beteiligt. Die Luxemburger Jazzszene wird genauso beleuchtet wie die Jazzaktivitäten in Koblenz. Das Buch stellt Persönlichkeiten vor wie den Klarinettisten Klaus Muggel Weissroth, den Pianisten und Klarinettisten Gangold Brähler, den Posaunisten Michael Trierweiler, den Saxophonisten Joe Schwarz, den Trompeter Ralf Schmitt-Fassbinder, den Saxophonisten Stefan Reinholz, den Trompeter Helmut Becker, den trompeter Alb Hardy, den Pianisten Ben Heit, den Sänger Wolfgang Kernbach, den Bassisten Jürgen Laux oder den Schlagzeuger Benedikt Kündgen. Dieter Manderscheid und Georg Ruby erinnern sich an die 1970er Jahre in ihrer Heimatstadt. Die junge Jazzszene wird genauso beleuchtet wie die Schwierigkeiten, die sich anfangs aus der Existenz zweier Jazzclubs ergaben. Viele Fotos runden den aufwendig gestalteten Band ab. Ob man den kulturpolitischen Ansichten oder den jazzhistorischen Vereinfachungen der beiden Autoren überall folgen mag, die oft fast schon bezugslos ins Buch verstreut sind, bleibt jedem Leser selbst überlassen. Die Interviews und regionalen Geschichten wären allemal spannender als die Einordnung Trierer Jazzhistorie in die Weltgeschichte dieser Musik. Im Vorwort erklären die Breidt und Heinbücher etwas umständlich, wie Interviews die Grundlage für ihr Buch bildeten. Diese allerdings machen dann doch nur einen kleinen Ausschnitt des Textes aus und werden stilistisch eher holprig eingesetzt. Der Lektor hätte dem ganzen vielleicht ein wenig mehr an Lesefluss verleihen können. Ein Namensregister — für solche Bücher eigentlich Pflicht — fehlt aus unerklärlichen Gründen. Die allgemeine “Geschichte des Jazz als Kunstform des 20. Jahrhunderts”, das Kapitel über das “Phänomen Louis Armstrong” oder das seltsame Kapitel “Jazz als kulturelle Herausforderung” — in dem in der Hauptsache Ernst Jünger und Sidney Bechet zitiert werden, aber warum, weiß man nicht so genau –, hätte man sicher durch Trier-bezogenere Kapitel ersetzen können. Und statt einer seltsamen Plattenliste über “30 Jazz Tonträger, die in keiner Sammlung fehlen sollten” und in der Miles Davis und Duke Ellington neben Rod Mason und eher unbekannteren Trierer Musikern stehen, wäre eine Diskographie des Trierer Jazz dem Thema wahrscheinlich angemessener gewesen. So bleibt vor allem ein dokumentarische Wert der in dem Buch enthaltenen Daten, Fotos und sonstigen Dokumente. Immerhin dieses Buch eine weitere Lücke der Regionaldokumentation deutscher Jazzgeschichte. Nach Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Wuppertal und etlichen anderen Städten nun also auch Trier: Glückwunsch!
“Jazz ist nicht in Trier entstanden” lautet der erste Satz des Buches, das sich dennoch zum Ziel gesetzt hat, die Geschichte in der ältesten Stadt Deutschlands nachzuzeichnen. Es sammelt unterschiedliche Geschichten, wirft Schlaglichter auf verschiedene Szenen, dokumentiert Erinnerungen in Fotos, Schriftstücken und Interviews. Der erste Jazzkeller wurde 1953 im Keller der Schaabs-Villa gegründet und in dem sich der Jazzclub Evergreen traf. 1959 mussten die Jazzfans in andere Räumlichkeiten ausweichen. Andere Spielstätten kamen und gingen, und 1978 gründete sich der Jazz-Club Trier als eingetragener Verein und neuer Motor der Szene. 1999 kam es zum Bruch der Mitglieder des Vereins, und ein weiterer Club mit einem etwas sperrigeren Namen kam hinzu: der “Jazzclub EuroCore im Saar-Lor-Lux-Trier Musik e.V.”, der sich zum Ziel setzte, nicht nur lokale, sondern regionale, und zwar grenzübergreifend-regionale Jazzprojekte zu fördern. Thomas Schmitt war an der Gründung beider Clubs verantwortlich beteiligt. Die Luxemburger Jazzszene wird genauso beleuchtet wie die Jazzaktivitäten in Koblenz. Das Buch stellt Persönlichkeiten vor wie den Klarinettisten Klaus Muggel Weissroth, den Pianisten und Klarinettisten Gangold Brähler, den Posaunisten Michael Trierweiler, den Saxophonisten Joe Schwarz, den Trompeter Ralf Schmitt-Fassbinder, den Saxophonisten Stefan Reinholz, den Trompeter Helmut Becker, den trompeter Alb Hardy, den Pianisten Ben Heit, den Sänger Wolfgang Kernbach, den Bassisten Jürgen Laux oder den Schlagzeuger Benedikt Kündgen. Dieter Manderscheid und Georg Ruby erinnern sich an die 1970er Jahre in ihrer Heimatstadt. Die junge Jazzszene wird genauso beleuchtet wie die Schwierigkeiten, die sich anfangs aus der Existenz zweier Jazzclubs ergaben. Viele Fotos runden den aufwendig gestalteten Band ab. Ob man den kulturpolitischen Ansichten oder den jazzhistorischen Vereinfachungen der beiden Autoren überall folgen mag, die oft fast schon bezugslos ins Buch verstreut sind, bleibt jedem Leser selbst überlassen. Die Interviews und regionalen Geschichten wären allemal spannender als die Einordnung Trierer Jazzhistorie in die Weltgeschichte dieser Musik. Im Vorwort erklären die Breidt und Heinbücher etwas umständlich, wie Interviews die Grundlage für ihr Buch bildeten. Diese allerdings machen dann doch nur einen kleinen Ausschnitt des Textes aus und werden stilistisch eher holprig eingesetzt. Der Lektor hätte dem ganzen vielleicht ein wenig mehr an Lesefluss verleihen können. Ein Namensregister — für solche Bücher eigentlich Pflicht — fehlt aus unerklärlichen Gründen. Die allgemeine “Geschichte des Jazz als Kunstform des 20. Jahrhunderts”, das Kapitel über das “Phänomen Louis Armstrong” oder das seltsame Kapitel “Jazz als kulturelle Herausforderung” — in dem in der Hauptsache Ernst Jünger und Sidney Bechet zitiert werden, aber warum, weiß man nicht so genau –, hätte man sicher durch Trier-bezogenere Kapitel ersetzen können. Und statt einer seltsamen Plattenliste über “30 Jazz Tonträger, die in keiner Sammlung fehlen sollten” und in der Miles Davis und Duke Ellington neben Rod Mason und eher unbekannteren Trierer Musikern stehen, wäre eine Diskographie des Trierer Jazz dem Thema wahrscheinlich angemessener gewesen. So bleibt vor allem ein dokumentarische Wert der in dem Buch enthaltenen Daten, Fotos und sonstigen Dokumente. Immerhin dieses Buch eine weitere Lücke der Regionaldokumentation deutscher Jazzgeschichte. Nach Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Wuppertal und etlichen anderen Städten nun also auch Trier: Glückwunsch!
Dass Trier nach wie vor eine lebendige Jazzstadt ist, lässt sich übrigens auch aus der Tatsache ersehen, das die Publikation des Buchs sofort für einigen Wirbel in der Trierer Musikszene sorgte. Dieser oder jener Musiker, diese oder jene Lokalität, diese oder jene Entwicklung seien zu stark, zu wenig oder falsch dargestellt, hieß es da. Fast wirkt das wie die Aufforderung zu einem zweiten Buch…
(Wolfram Knauer)
50 Jahre Jazzkeller Krefeld
herausgegeben von Günter Holthoff & Mojo Mendiola
Krefeld 2008 (Leporello Verlag)
ISBN 978-3-936783-29-2
208 Seiten, Preis: 16,80 Euro
 Lokalgeschichte ist für den Jazz mittlerweile fast genauso wichtig wie Globalgeschichte. Man lebt schließlich im eigenen Viertel und will auch da die Musik hören. Aber mehr noch: Man wird beeinflusst durch das, was um die Ecke geschieht, dadurch, wie die große weite Welt einem ganz nah bei zu Hause begegnet. So war es und so ist es selbst im Zeitalter des Internets nach wie vor. Mittlerweile gibt es viele Stadt-Jazz-Geschichten aus Deutschland, Bücher, in denen die lokalen und regionalen Entwicklungen nachverfolgt und dokumentiert werden.
Lokalgeschichte ist für den Jazz mittlerweile fast genauso wichtig wie Globalgeschichte. Man lebt schließlich im eigenen Viertel und will auch da die Musik hören. Aber mehr noch: Man wird beeinflusst durch das, was um die Ecke geschieht, dadurch, wie die große weite Welt einem ganz nah bei zu Hause begegnet. So war es und so ist es selbst im Zeitalter des Internets nach wie vor. Mittlerweile gibt es viele Stadt-Jazz-Geschichten aus Deutschland, Bücher, in denen die lokalen und regionalen Entwicklungen nachverfolgt und dokumentiert werden.
Krefeld war auf jeden Fall ein gutes Pflaster für den Jazz. Vor 50 Jahren wurde dort der Jazzkeller Krefeld eröffnet, in dem unter wechselnder Leitung durchgängig Jazz erklang. Dieses Buch beleuchtet die Geschichte des Clubs und seiner Pächter und wirft Schlaglichter auf die vielen Musiker, die mindestens einen Abend hier zu Hause waren. Natürlich ist das zu allererst eine Namensschlacht, denn keiner soll vergessen werden, die Stars nicht und die lokalen Größen (oder weniger Großen) genausowenig. Das könnte die umfangreiche, liebevoll gestaltete und reich bebilderte Dokumentation zu einer etwas anstrengenden Lektüre machen. Aber so soll man es wohl auch gar nicht lesen, sondern lieber blättern und sich gefangen nehmen lassen von den sehr unterschiedlichen Eindrücken, die sich einem mitteilen. Eine bunte Jazzgeschichte ist das allemal, die sich in den Bildern und kurzen Texten wiederfindet: von Blueslegenden über TradJazz, Mainstream bis hin zur deutschen und europäischen Avantgarde. Spannend vor allem die vielen zeitgenössischen Konzertberichte, insbesondere von Dita von Szadkowski, die als Faksimile abgedruckt sind und einem auch als Außenstehender die Zeit, die Atmosphäre und auch die Probleme einer meist mit viel ehrenamtlichem Engagement organisierten Jazzszene näher bringen.
Happy Birthday, Jazzkeller Krefeld. Ein halbes Jahrhundert habt Ihr hinter Euch — da geht doch noch was!
(Wolfram Knauer)
Jazz Calendiary 2008
von Patrick Hinely
Mit einem Vorwort von Tad Hershorn; deutsch/englisch
Bad Oeynhausen 2006 (jazzprezzo)
116 Seiten, fester Einband mit Wire-O-Bindung,
17,5 x 23,5 cm, ISBN 978-3-9810250-3-3, 16,80 Euro
In Kooperation mit dem Nieswand Verlag
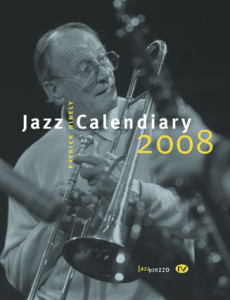 Auch in diesem Jahr beglückt uns der Jazzprezzo Verlag mit seinem neuen Jazz Calendiary 2008, das schon kultverdächtig ist. Man hat sich an das handliche, dank der Spiralbindung leicht zu blätternde Buch im täglichen Einsatz liebevoll gewöhnt. Auf der linken Seite finden sich wie gehabt Schwarzweiß-Fotos, in diesem Jahr des amerikanischen Fotografen Patrick Hinely, für jede Woche eines, und auf der rechten Seite genügend Platz für Termine, Anmerkungen, Notizen. Dickes Papier haben die Kalendermacher benutzt, angenehm rauh und beschreibbar und zugleich hochwertig glossy und damit fotogerecht. Mit den eindrücklichen Jazzbildern von Patrik Hinely erlebt man die Persönlichkeit der Musiker, sowohl „on stage“, wie beispielsweise eine dynamische Dee Dee Bridgewater beim Berliner Jazzfest oder Charlie Haden , der eins zu werden scheint mit seinem Bass. Aber es sind gerade auch die eher leiseren „Field-Fotos“, wie die eines nachdenklich-träumerischen Klaus Königs oder Lol Coxhill beim Kaffeetrinken in London, die einen mindestens für eine Woche in den Bann ziehen. Patrick Hinely arbeitet seit den 1970er Jahren als selbständiger Fotograf. Seine Bilder erscheinen in Zeitungen, Büchern, LPs und CDs weltweit. Jazz Calendiary 2008 – ein Schmuckstück für den Schreibtisch und nicht nur zum Verschenken.
Auch in diesem Jahr beglückt uns der Jazzprezzo Verlag mit seinem neuen Jazz Calendiary 2008, das schon kultverdächtig ist. Man hat sich an das handliche, dank der Spiralbindung leicht zu blätternde Buch im täglichen Einsatz liebevoll gewöhnt. Auf der linken Seite finden sich wie gehabt Schwarzweiß-Fotos, in diesem Jahr des amerikanischen Fotografen Patrick Hinely, für jede Woche eines, und auf der rechten Seite genügend Platz für Termine, Anmerkungen, Notizen. Dickes Papier haben die Kalendermacher benutzt, angenehm rauh und beschreibbar und zugleich hochwertig glossy und damit fotogerecht. Mit den eindrücklichen Jazzbildern von Patrik Hinely erlebt man die Persönlichkeit der Musiker, sowohl „on stage“, wie beispielsweise eine dynamische Dee Dee Bridgewater beim Berliner Jazzfest oder Charlie Haden , der eins zu werden scheint mit seinem Bass. Aber es sind gerade auch die eher leiseren „Field-Fotos“, wie die eines nachdenklich-träumerischen Klaus Königs oder Lol Coxhill beim Kaffeetrinken in London, die einen mindestens für eine Woche in den Bann ziehen. Patrick Hinely arbeitet seit den 1970er Jahren als selbständiger Fotograf. Seine Bilder erscheinen in Zeitungen, Büchern, LPs und CDs weltweit. Jazz Calendiary 2008 – ein Schmuckstück für den Schreibtisch und nicht nur zum Verschenken.
(Doris Schröder)
soeben erschienen:
 Rolf Kissling
Rolf Kissling
Jazz Calendiary 2009
Kalenderbuch mit
53 Duoton-Fotografien
Mit einem Vorwort von Hans-Jürgen Schaal
deutsch/englisch, 114 Seiten, fester Einband mit Wire-O-Bindung,
17,5 x 23,5 cm, ISBN 978-3-9810250-5-7, 16,80 Euro
Zu beziehen über den Buchhandel oder über www.jazzprezzo.de
Ronnie Scott’s Jazz Farrago. Compilation of Features from Jazz at Ronnie Scott’s Magazine
Herausgegeben von Jim Godbolt
London 2008, Hampstead Press
ISBN 978-0-9557628-0-2, Preis: £ 19,95

Der britische Jazzhistoriker Jim Godbolt ist seit 1979 Herausgeber der Clubzeitschrift des Londoner Ronnie Scott’s Club. Seine eigenen Kolumnen sind kenntnisreich genauso wie skuril-witzig und geizen nicht mit Selbstironie. Ein “Best of” der Anekdoten, Features und Interviews erschien nun in Buchform. “Jazz Farrago” enthält lesenswerte historische Berichte, etwa zum ersten Europabesuch Duke Ellingtons im Jahr 1933, zu Benny Goodmans Londoner Konzerten im Jahr 1949, zum legendären Club Eleven, in dem sich Ende der 1940er Jahre die Anhänger des modernen jazz in London trafen. Alun Morgan beleuchtet genau diese Szene in einem kurzen Beitrag, und Alain Presencer erinnert sich daran, wie er 1953 das legendäre Massey Hall Concert in Toronto besuchte, bei dem Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus und Max Roach mitwirkten. Interviews mit George Melly, John Dankworth, Spike Milligan, Charlie Watts und anderen geben weitere Einblicke in die britische Jazzszene, und Godbolt druckt außerdem ein legendäres Interview mit Ruby Braff ab, in dem Braff, der eh keine Lust auf ein interview hatte, irgendwann den Spieß umdreht und Godbolt die Fragepistole auf die Brust setzt. Ronnie Scott kommt selbst etliche Male zu Wort, erzählt davon, wie er einmal eine Bigband geleitet habe, von einem Besuch in Hongkong oder wie er einmal den Buckingham-Palast besucht habe. Weitere Profile stellen Zoot Sims, Tubby Hayes, Tony Crombie, Alan Clare und Bruce Turner, Wally Fawkes, Cleo Laine und Humphrey Lyttelton vor. Ein buntes Sammelsurium ist das alles, auch im Layout des Buchs – kurze Notizen genauso wie ein Tratsch aus der Szene und launige Kommentare über Gott und den Jazz. Unterhaltsam, kurzweilig und gespickt mit seltenen Fotos und Karikaturen.
(Wolfram Knauer)
Inside British Jazz.
Crossing Borders of Race, Nation and Class
Von Hilary Moore
Aldershot/Hampshire 2007
Ashgate Popular and Folk Music Series
ISBN 978-0-7546-5744-6
157 Seiten, 50 Britische Pfund
 Die Aufarbeitung der europäischen Jazzgeschichte geschieht immer noch vor allem regional. Ein Buch über die europäische Jazzgeschichte in all ihrer Diversität steht bislang aus. Doch die unterschiedlichen Monographien zu nationalen Jazzentwicklungen sind mittlerweile recht seriös geworden. Es geht nicht mehr bloß um Nennung von Namen und den Abgleich des Spielenkönnens “wie die Amerikaner”. Die Autoren arbeiten mittlerweile die spezifischen Besonderheiten der Jazzentwicklungen heraus, diskutieren Unterschiede und legen das neue Selbstbewusstsein der jungen Jazzmusiker auch an die Jazzgeschichte ihrer Länder an.
Die Aufarbeitung der europäischen Jazzgeschichte geschieht immer noch vor allem regional. Ein Buch über die europäische Jazzgeschichte in all ihrer Diversität steht bislang aus. Doch die unterschiedlichen Monographien zu nationalen Jazzentwicklungen sind mittlerweile recht seriös geworden. Es geht nicht mehr bloß um Nennung von Namen und den Abgleich des Spielenkönnens “wie die Amerikaner”. Die Autoren arbeiten mittlerweile die spezifischen Besonderheiten der Jazzentwicklungen heraus, diskutieren Unterschiede und legen das neue Selbstbewusstsein der jungen Jazzmusiker auch an die Jazzgeschichte ihrer Länder an.
“Inside British Jazz” ist ein Beispiel solch einer neuen, selbstbewussten Geschichtsschreibung. Die schottische Musik- und Kulturwissenschaftlerin Hilary Moore untersucht die Querbeziehungen afro-amerikanischer Musik mit der britischen Kultur des 20. Jahrhunderts. Sie fragt nach der sozialen Relevanz dieser Musik, nach Ansatzmöglichkeiten für jedwede Identifikation, nach der Bedeutung von Hautfarbe und Klassenzugehörigkeit für die musikalische Entwicklung der Protagonisten. Moore teilt ihr Buch dabei in vier Schwerpunktkapitel: Sie untersucht (1.) die frühen Jahre des Jazz in Großbritannien, fragt nach Konnotationen wie Umsturz, Befreiung und Krieg (den Folgen des I. Weltkriegs); (2.) die in der Arbeiterbewegung verankerte Trad-Jazz-Bewegung der Nachkriegszeit, die er auf Authentizität und Nostalgie abklopft; (3.) Free-Jazz-Versuche der 1960er Jahre, als Joe Harriott und andere sich in ihrer Art einer freien Improvisation deutlich von den amerikanischen Vorbildern wie beispielsweise Ornette Coleman unterschieden; und (4.) die Musiker des jungen Selbstbewusstseins der 1980er Jahre, insbesondere die Jazz Warriors um Courtney Pine, eine Bewegung junger schwarzer Musiker in Großbritannien mit oft afrikanischen oder karibischen Wurzeln. Moore hinterfragt die Behauptung, Hautfarbe würde heute doch keine Rolle mehr spielen und stellt insbesondere auch für die 1980er Jahre fest, dass Gruppenzugehörigkeit als Identifikationsfaktor nach wie vor sehr wichtig ist.
Moores Buch ist eine wenig veränderte Fassung ihrer Doktorarbeit, die sie 2004 an der University of Pennsylvania abgelegt hatte. Ihr Buch ist also ein Fachbuch, das immer wieder auf den wissenschaftlichen Diskurs verweist, innerhalb dessen auch sie sich bewegt. Moores Buch ergänzt zwei bereits veröffentlichte Studien – von Catherine Parsonage und von George McKay – zur Geschichte des Jazz in Großbritannien. Ihr gelingt es, einige neue Fäden zu spinnen, Verbindungen und Bedingtheiten aufzuzeigen. Und sie nimmt sich wenigstens ansatzweise einer Geschichte des aktuellen schwarzen Jazz in Großbritannien an, ein Thema, das sich zwangsläufig mit Rassismus, Kolonialismus und den sozial- und kulturpolitischen Entscheidungen der letzten Jahre beschäftigt. Eine willkommene Bereicherung der Literatur zum Jazz in Europa!
(Wolfram Knauer)
The Little Giant. The Story of Johnny Griffin
Von Mike Hennessey
London 2008 (Northway Publication)
19,99 Englische Pfund
ISBN: 978-0-9550908-5-1

Wenn er in Amerika geblieben wäre, wäre er schon lange tot, erzählt Johnny Griffin seinem Biographen Mike Hennessey in der neuen Biographie, die um den achtzigsten Geburtstag des Tenorsaxophonisten beim englischen Verlag Northway erschien. Er sei ein bekiffter Zombie gewesen, als er die USA verließ. Griffin lebt seit Mitte der 60er Jahre in Europa, hatte sich zusammen mit seiner Frau 1984 ein altes Schloss zwischen Poitiers und Limoges gekauft. Griffin gehört mit zu jenen amerikanischen Musikern, die Europa nicht nur als einen exzellenten Markt für ihre Musik, sondern auch als angenehmes Pflaster zum Leben entdeckten. Im Dezember 1962 war er zum ersten Mal nach Europa gekommen, auf einer Tour fürs Plattenlabel Riverside. In Paris traf er Bud Powell, und auch anderswo fühlte er sich wohl — er habe sich zum ersten Mal wirklich entspannen können. Die Europäer liebten ihn, und in Paris fand er auch jede Menge anderer Exilamerikaner vor, Musiker wie Kenny Clarke, Kenny Drew, Donald Byrd oder Jimmy Gourley. Er spielte in Schweden, Belgien, England und kehrte im März 1963 in die USA zurück und fragte sich sofort, was er dort eigentlich wolle. So entschied er sich, endgültig nach Europa zu ziehen und bestieg zusammen mit dem Sänger Babs Gonzales im Mai 1963 ein Schiff nach Rotterdam. Bis 1973 lebte er in Paris, dann zog er in die Nähe von Rotterdam, bis er 1984 ins schon erwähnte Chateau Bellevue zog. Mike Hennessey beschreibt das Leben Griffins lebendig und mit vielen Erinnerungseinschüben des Saxophonisten. Der berichtet über seine frühen Einflüsse und seine Jugend in Chicago, wo er an der DuSable High School Musikunterricht bei Captain Walter Henri Dyett erhielt, einem renomierten Lehrer, der auch etliche andere später berühmte Jazzmusiker auf ihren Weg gebracht hatte. Mit 15 arbeitete er mit dem Bluesgitarristen und -sänger T-Bone Walker, zwei Jahre später wurde er Mitglied in Lionel Hamptons Orchester. Er spielte mit Sonny Stitt, mit Gene Ammons und Lester Young, war in den 50er Jahren ein gefragter Saxophonist, gerade weil sein Stil als so antreibend und Kollegen herausfordernd rüberkam, insbesondere wenn er mit dem Eddie ‘Lockjaw’ Davis als “Tough Tenors” in Erscheinung trat. 1957 machte er Aufnahmen mit Art Blakey’s Jazz Messengers und wurde im März darauf Mitglied in der Band des Pianisten Thelonious Monk, den er bereits Ende der 40er Jahre kennengelernt hatte und der ihn für einen langen Gig im New Yorker Club Five Spot engagierte. Hennessey kann bei seinen Exkursen zu vielen Musikern, mit denen Griffin zusammengespielt hatte, zu Monk, Kenny Clarke und vielen anderen, auf eigene Interviews zurückgreifen. Auch Griffin spricht über diese Kollegen, die er bewundert. Und er spricht über Musik, die ihn eher abtörnt, die von Archie Shepp etwa oder von Ornette Coleman und Cecil Taylor. Und er äußert sich freimütig auch über die Tiefpunkte seines Lebens, vor allem über seine Probleme mit Alkohol, zeitweisen Gebrauch von Kokain und Heroin. Wäre er in Amerika geblieben, wäre er schon lange tot, sagt er (siehe oben). Glücklicherweise konnte Johnny Griffin am 24. April seine n 80sten Geburtstag feiern. Und Mike Hennesseys Buch feiert sein Leben. Eine Diskographie der Alben, bei denen Griffin als Bandleader verantwortlich zeichnet, ein Verzeichnis der Kompositionen des Saxophonisten sowie ein Namensregister beschließen das Buch, das weniger eine kritische Würdigung sein will als vielmehr faktische Lebensgeschichte eines Musikers zwischen den Welten.
(Wolfram Knauer)
[:en]Jazz Lives. Till We Shall Meet and Never Part
von Jaap van de Klomp & Scott Yanow
Utrecht 2008 (A.W. Bruna Uitgebers)
223 Seiten
ISBN: 978-90-229-9353-8
Freier Download über
www.jaapvandeklomp.nl/jazzlives.pdf
 Enzyklopädische Bücher über Jazz gibt es zuhauf, und sieht man sich das Inhaltsverzeichnis von Jaap van de Klomps opulentem “Jazz Lives” an, so scheint es sich nicht von anderen Werken zu unterscheiden, die knappe Biographien wichtiger Jazzinterpreten versammeln. Dann aber stolpert man über die Fotos, wobei die Wortwahl gefährlich ist, denn mit diesen Fotos “stolpert” man gewissermaßen über Grabsteine. Von denen nämlich handelt dieses Buch genauso wie von den Protagonisten des Jazz. Van de Klomp hat sich aufgemacht, das Gedächtnis an Jazzmusiker zu dokumentieren, wie es sich auf Friedhöfen insbesondere in den Vereinigten Staaten zeigt. Nach Instrumenten sortiert finden sich kurze biographische Skizzen des renommierten Jazzhistorikers Scott Yanow, vor allem aber Fotos und Angaben zur Grabstelle des betreffenden Künstlers. Von Buddy Bolden bis zu Michel Petrucciani und Niels-Henning Ørsted Pedersen reicht die Bandbreite der dabei berücksichtigten Musiker, und neben den großen Stars der Jazzgeschichte, Ellington, Armstrong, Miles, Bird, Coltrane, Basie, Goodman und vielen anderen finden sich etliche in der Öffentlichkeit weit weniger bekannte Sidemen.
Enzyklopädische Bücher über Jazz gibt es zuhauf, und sieht man sich das Inhaltsverzeichnis von Jaap van de Klomps opulentem “Jazz Lives” an, so scheint es sich nicht von anderen Werken zu unterscheiden, die knappe Biographien wichtiger Jazzinterpreten versammeln. Dann aber stolpert man über die Fotos, wobei die Wortwahl gefährlich ist, denn mit diesen Fotos “stolpert” man gewissermaßen über Grabsteine. Von denen nämlich handelt dieses Buch genauso wie von den Protagonisten des Jazz. Van de Klomp hat sich aufgemacht, das Gedächtnis an Jazzmusiker zu dokumentieren, wie es sich auf Friedhöfen insbesondere in den Vereinigten Staaten zeigt. Nach Instrumenten sortiert finden sich kurze biographische Skizzen des renommierten Jazzhistorikers Scott Yanow, vor allem aber Fotos und Angaben zur Grabstelle des betreffenden Künstlers. Von Buddy Bolden bis zu Michel Petrucciani und Niels-Henning Ørsted Pedersen reicht die Bandbreite der dabei berücksichtigten Musiker, und neben den großen Stars der Jazzgeschichte, Ellington, Armstrong, Miles, Bird, Coltrane, Basie, Goodman und vielen anderen finden sich etliche in der Öffentlichkeit weit weniger bekannte Sidemen.
Yanows Texte bieten Standardkost: kurze Einführungen in Leben und Wirken der betreffenden Musiker. Es sind die Bilder der Grabstätten, die tatsächlich eine neue Sicht auf die Musiker erlauben. Da sieht man auf Charlie Parkers aktuellem Grabstein ein Tenorsaxophon. Sun Ras Grabplatte ist fast von Gras zugewachsen; Billy Strayhorns Asche wurde über dem Wasser verstreut. Die Grabsteine von Tommy Dorsey und Vic Dickenson zeigen eine Posaune, der von W.C. Handy ein Kornett. Sarah Vaughans Stein verweist auf die Sängerin als “The Devine One”, Dinah Washingtons Stein zeigt eine Krone und ihren Geburtsnamen “Ruth Jones”. Es gibt Grabsteine mit Erinnerungen an das künstlerische Wirken der dort begrabenen Musiker, andere, die einfach nur schlicht den Namen und die Lebensdaten enthalten. Es gibt Gräber, in denen auch andere Familienmitglieder beigesetzt sind, sowie Ehrengräber der Armee der Vereinigten Staaten (Zutty Singleton, Willie ‘The Lion’ Smith, Joe Henderson, Paul Gonsalves). Es gibt Gräber, die einen zusätzlichen “historical marker” erhalten haben (Charlie Christian) und andere, die eher wie Monumente wirken (Django Reinhardt, Eddie Lang). Ein simples Holzkreuz markiert das Grab Joe Zawinuls, der während der Arbeiten an dem Buch gestorben und dessen Wiener Ehrengrab noch nicht fertig war; der Grabstein für Andrew Hill steht angelehnt noch in der Werkstatt des Steinmetzes. Lionel Hamptons Grab trägt einzig die Inschrift “Hampton. Flying Home”; Clifford Jordans Urne steht im Bücherregal seiner Witwe. Ben Websters Name steht auf einem großen Findling; Kid Ory wird als “Father of Dixieland Jazz” gepriesen. Miles Davis wird als “Sir Miles Davis” erinnert und sein Grabstein ist mit der Melodie von “Solar” verziert, dessen Urheber, wie jüngst entdeckt wurde, in Wahrheit der Gitarrist Chuck Wayne war.
In seinem eigenen Vorwort beschreibt Van de Klomp die zum Teil schwierige Suche nach den Gräbern. Anfangs war es eher ein kurioses Interesse, bald dann fast eine Obsession. Einige Gräber waren einfacher zu finden, andere benötigten intensiver Recherchen, Nachfragen bei Verwandten, Stadtverwaltungen oder Spezialisten. Die meisten der amerikanischen Fotos entstanden innerhalb von drei Monaten im Jahr 2007, die Van de Klamp damit verbrachte, einigermaßen systematisch die Vereinigten Staaten abzureisen. Er beschreibt anschaulich die durchaus emotionalen Momente, die das Entdecken vieler dieser Gedenksteine für ihn bedeutete.
“Jazz Lives” erschien in der opulenten Originalausgabe im Jahr 2008. Nachdem das Buch ausverkauft und dem Autor klar war, dass es keine Neuausgabe erfahren würde, entschloss Van de Klomp sich, eine PDF-Version online frei zugängig zu machen und gestattete uns, einen Link auf das Buch zu veröffentlichen.
Wolfram Knauer (Februar 2014)
Eric Dolphy
von Guillaume Belhomme
Marseille 2008 (Le mot et le reste)
136 Seiten, 15 Euro
ISBN: 978-2-915378-535
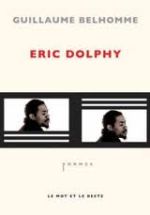 Guillaume Behommes Buch ist weniger Biographie als kommentiertes Plattenverzeichnis des Saxophonisten und Bassklarinettisten. Ein
Guillaume Behommes Buch ist weniger Biographie als kommentiertes Plattenverzeichnis des Saxophonisten und Bassklarinettisten. Ein
kurzes Anfangskapitel verfolgt Kindheit und Jugend Dolphys, dann gliedert der Autor das Buch chronologisch nach den Aufnahmen, die Dolphy vorlegte: mit Chico Hamilton, Charles Mingus, John Coltrane, Gunther Schuller, vor allem aber unter eigenem Namen. Belhomme zitiert – leider ohne genaue Verweise – aus zeitgenössischen Kritiken, ordnet die Musik ins Gesamtwerk des Künstlers ein und beendet das Buch mit einer Chronologie seines Lebens.
Wer musikalisch tiefer in Dolphys Kunst einsteigen will, wird anderswo fündig etwa im Buch “Tender Warrior. L’eredita’ musicale di Eric Dolphy”; als grundständige Biographie ist Vladimir Simosko und Barry Teppermans Buch von 1974 unübertroffen.
Für den französisch lesenden Dolphy-Einsteiger ist Belhommes Büchlein aber sicher kein Fehler.
Wolfram Knauer (Juli 2013)
Sounds of the Metropolis. The 19th-Century Popular Music Revolution in London, New York, Paris, and Vienna
von Derek B. Scott
New York 2008 (Oxford University Press)
304 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-989187-0
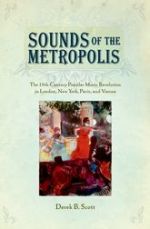 Allgemein verbindet man das Aufkommen der Idee von Popularmusik mit der Erfindung der Tonaufzeichnung, mit der Industrialisierung der Musikvermarktung, datiert die große Zeit der Unterhaltungsmusik also in den Beginn des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich aber begann die “Popularmusik-Revolution” bereits im 19. Jahrhundert und ist ein Nebeneffekt der sozialen Veränderungen, der Verstädterung der Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung.
Allgemein verbindet man das Aufkommen der Idee von Popularmusik mit der Erfindung der Tonaufzeichnung, mit der Industrialisierung der Musikvermarktung, datiert die große Zeit der Unterhaltungsmusik also in den Beginn des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich aber begann die “Popularmusik-Revolution” bereits im 19. Jahrhundert und ist ein Nebeneffekt der sozialen Veränderungen, der Verstädterung der Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung.
Im ersten Kapitel untersucht der britische Musikwissenschaftler Derek B. Scott die Zusammenhänge zwischen Professionalisierung und Kommerzialisierung des Konzertlebens im 19. Jahrhundert. Er verweist auf die zunehmende Bedeutung von Hausmusik und Notenhandel, über die Entwicklung des Klavierhandels und die ersten Urheberrechtsvereine. Im zweiten Kapitel betrachtet er die neuen Märkte (also das neue Publikum) für Kultur, die auch zu neuen Präsentationsformen führten, etwa den Promenadenkonzerten, zur Music-Hall bzw. zum Café-Concert, zu Minstrelsy, Vaudeville und Operette. Die Popularisierung von Musik ließ Kritiker an der Moral der beliebten Stücke zweifeln, und so widmet Scott Kapitel 3 seines Buchs dem Thema “Musik, Moral und soziale Ordnung”. Die große Diskussion bis in unsere Tage ist die, dass das Auseinanderdriften von populärer und Kunstmusik zu einer Konkurrenz der beiden Bereiche führte, die Scott im vierten Kapitel behandelt. Er fragt danach, wie Kunst, Geschmack und Status zusammenhängen und betrachtet die Unterschiede zwischen Oper und Operette.
Im zweiten Teil des Buchs geht es dann um konkrete musikalische Stile: den Wiener Walzer (Kapitel 5), Blackface Minstrelsy und ihre Rezeption in Europa (Kapitel 6), die englische Music Hall (Kapitel 7) sowie das Pariser Cabaret (Kapitel 8). In diesen Kapiteln verweist Scott durchaus auf spätere Entwicklungen und die Bedeutung der spezifischen Genres für die Musikgeschichte des 20sten Jahrhunderts; dabei fehlt dem Buch allerdings ein abschließend zusammenfassendes Kapitel, das die Verbindungsstränge des vom Autor Aufgezeigten in die jüngere Vergangenheit des letzten Jahrhunderts aufzeigen könnte. Auch wäre durchaus zu diskutieren, inwieweit, die in den Metropolen entwickelten Präsentationsformen von Popularmusik ihren Widerhall in anderen Städten, im Land, über die Grenzen hinweg hatten und inwieweit sie sich gegenseitig beeinflussten bzw. bedingten – es gab schließlich im 19. Jahrhundert durchaus bereits grenzüberschreitende Tourneen.
Alles in allem präsentiert “Sounds of the Metropolis” einen wichtigen Blick auf die Vorgeschichte von Popmusik und Jazz; dem Leser bleibt es überlassen zu eruieren, wo spätere Entwicklungen populärer Musik auf diese Vorgeschichte aufsetzen, wie sie sich miteinander verzahnen. Ein ausführlicher Apparat inklusive Bibliographie und Index beschließt das Buch.
Wolfram Knauer (März 2012)
Backstory in Blue. Ellington at Newport ’56
von John Fass Morton
New Brunswick 2008 (Rutgers University Press)
304 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8135-4282-9
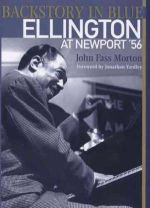 In Duke Ellingtons Karriere gab es Aufs und Abs, Erfolge und Missverständnisse. Vor allem aber ein Ereignis scheint sich ins kollektive Gedächtnis der Jazzgeschichte eingegraben zu haben: Paul Gonsalves’ legendäres Solo über “Crescendo and Decrescendo in Blue” vom 7. Juli 1956, live gespielt beim Openair-Festival in Newport, Rhode Island, eingefangen von den Mikrophonen der Voice of America und der Plattengesellschaft Columbia Records. Ellingtons Performance dieses alten Schlachtrosses und Gonsalves’ sagenumwobene 27 Chorusse umfassende Improvisation über den Blues rissen die Karriere der Band herum, machten einem großen Publikum deutlich, wie modern Ellington war und welche Kraft hinter seinem, Orchester steckte.
In Duke Ellingtons Karriere gab es Aufs und Abs, Erfolge und Missverständnisse. Vor allem aber ein Ereignis scheint sich ins kollektive Gedächtnis der Jazzgeschichte eingegraben zu haben: Paul Gonsalves’ legendäres Solo über “Crescendo and Decrescendo in Blue” vom 7. Juli 1956, live gespielt beim Openair-Festival in Newport, Rhode Island, eingefangen von den Mikrophonen der Voice of America und der Plattengesellschaft Columbia Records. Ellingtons Performance dieses alten Schlachtrosses und Gonsalves’ sagenumwobene 27 Chorusse umfassende Improvisation über den Blues rissen die Karriere der Band herum, machten einem großen Publikum deutlich, wie modern Ellington war und welche Kraft hinter seinem, Orchester steckte.
John Fass Morton hat sich in einem Buch aufgemacht, die verschiedenen Narrative hinter dem Newport-Auftritt von Duke Ellington zu erzählen, und sein Buch reiht sich ein in Studien über einflussreiche Alben, wichtige Kompositionen oder Improvisation, Monographien über akustische Momentaufnahmen der Jazzgeschichte.
Morton beginnt mit einem Rückblick auf Ellingtons Karriere, seine Bedeutung fürs schwarze Amerika, seine erste Aufnahme von “Diminuendo and Crescendo in Blue” von 1938, Erfolge in den 1920er und 1930er Jahren, ambitionierte Werke in den 1940ern und Schwierigkeiten in den 1950ern. 1955 hatte Ellington noch versucht, das langsam zum Rock ‘n’ Roll abdriftende Publikum davon zu überzeugen, dass dieser doch auch nur eine Art von Jazz sei. Im selben Jahr gelangte er am Tiefpunkt seiner Karriere an, als er ein Engagement im New Yorker Aquacades annehmen musste, um die Band am Leben zu halten, einen Gig, bei dem er unter anderem Kunstschwimmer und Eisläufer begleiten musste.
Morton betrachtet Ellingtons Band, “Dukes Instrument”, wie man sie gern bezeichnete, geht die Musiker durch, die 1956 im Orchester saßen und teilweise schon auf eine lange Zusammenarbeit mit dem Komponisten, Pianisten und Bandleader zurückblicken konnten. Er widmet ein eigenes Kapitel der Geschichte des Columbia-Labels, ein weiteres dem Produzenten George Avakian, der nicht nur einige der ersten Wiederveröffentlichungen klassischer Jazzaufnahmen für Columbia zu verantworten hatte, sondern auch an der Entwicklung des LP-Formats beteiligt war. George Wein und die Idee des Newport-Festivals sind natürlich ein Thema, und auch den Newport-Gastgebern Elaine und Louis Lorillard widmet Morton ein eigenes Kapitel. Er beschreibt das Festival von 1954 und 1955, musikalische Höhepunkte und die kritische Reflexion auf die Großveranstaltung.
Dann sind wir beim Programm für 1956, und Morton sortiert die Dramatis Personae noch einmal neu: die Rundfunkmikrophone, den Veranstalter, die auftretenden Bands, die Plattenfirma, das Publikum. Norman George Wein habe Duke gewarnt: Komm mir bloß swingend!, und die Abende zuvor hatten genau das geliefert: mitreißenden Swing, der selbst dem regnerischen Wetter trotzte. 20:30 Uhr: Ellington wird angesagt, die Band kommt auf die Bühne, wärmt sich mit ein paar Nummern auf, aber die Band blieb relativ steif. Bud Shank und Anita O’Day folgten, Friedrich Gulda und Chico Hamilton. Erst kurz vor Mitternacht kommt die Ellington-Band wieder dran, beginnt swingend, verliert dann aber langsam ihr Publikum, das Stück für Stück dem Ausgang zustrebt. Dann sagt der Duke das alte Schlachtross an, “Diminuendo in Blue” und “Crescendo in Blue”…
Morton versteht etwas von Dramaturgie, und so unterbricht er hier und schiebt erst einmal Biographisches zu Paul Gonsalves nach, bevor er schließlich die Spannung des Tenorsaxophonsolos beschreibt, das die beiden Stücke miteinander verbinden sollte und eigentlich nur als kurzes Interlude gedacht war, nicht als 27-chorus-langer Höhepunkt. Er beschreibt die Reaktionen der Zuhörer, wie Jo Jones mit der Zeitung auf die Bühne schlug und seinen Kollegen anfeuerte, wie eine junge Frau anfing zu tanzen und plötzlich auch andere im Publikum tanzten, wie das Publikum auf seine Plätze zurückstrebte, weil es merkte, dass hier irgend etwas Besonderes geschah.
Und wieder unterbricht er und erzählt die Geschichte jener unbekannten reichen Blondine, die damals Schlagzeilen machte, weil sie aufstand und einfach wild tanzte zu Gonsalves’ Solo.
Es folgt der Nachschlag: LP-Veröffentlichung; der soziale Abstieg jener reichen Blondine, die weitere Zusammenarbeit zwischen Ellington und Gonsalves, die Rolle der Voice of America für den Kalten Krieg, die weitere Entwicklung des Newport Jazz Festivals.
John Fass Morton gelingt es in seinem Buch mit den ganz unterschiedlichen Facetten, die er beleuchtet, ein lebendiges Bild der Dramatik jenes Solos zu zeichnen, dramatisch für Ellington genauso wie für die Anwesenden, für die Plattenfirma, die Fotografen und die Geschichte des Jazz. Man liest sich fest, und ich bin mir sicher, dass man im Laufe der Lektüre wiederholt die ganze Platte des Newport-Konzerts hören möchte, weil Fotos, Worte, Interviews einem das Gefühl der gemeinsamen Erinnerung geben. Als sei man dabei gewesen, damals, am 7. Juli 1956, als Paul Gonsalves die Karriere Ellingtons ein weiteres Mal drehte.
Wolfram Knauer (Oktober 2011)
Jazz für Kinder. Carla lernt Instrumente, Interpreten und Musikstile kennen
von Oliver Steger & Peter Friedl
Wien 2008 (Annette Betz)
29 Seiten, 19,95 Euro
ISBN: 978-3-219-11357-0
 Über Musik, heißt es, sollte man in jungen Jahren lernen. Das Schaffen musikalischer Neugier ist in den ersten Lebensjahren so viel erfolgversprechender als später, wenn die Musikindustrie über musikalische Mode und Hitparaden den musikalischen Geschmack weit stärker bestimmt als die eigene Neugier. Der Verlag Annette Betz hat sich auf musikalische Kinderbücher spezialisiert, Bilderbücher mit Geschichten, die ihre jungen Leser erzählerisch in die Welt der Musik einführen. In Oliver Stegers “Jazz für Kinder” entdeckt die kleine Carla in einem Pavillon im Garten des neuen Hauses, in das sie mit ihrer Familie gezogen ist, lauter verstaubte Instrumente. Diese, erzählen sie Carla, spielen gerne Jazz, und Carla fragt nach: “Was ist denn das, Jazz?” Papa erzählt ihr auf ihre Frage von den Wurzeln des Jazz in Afro-Amerika, von Jazz als Musik der Freiheit und Musik zum Tanzen. Am nächsten Tag erklärt das Schlagzeug ihr die Geheimnisse des Rhythmus und des swing, das Klavier jene der Harmonik, der Bass die der Improvisation. Um ihr das alles näher zu bringen, improvisieren die drei ein wenig über “Bruder Jakob”, das Carla gerade in der Schule singt. Carlas Neugier ist geweckt, bald erfährt sie etwas über Bebop, das solistische Spiel, über Ragtime, Fats Waller, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Ellington, Basie, die Bigband, den Wandel des Jazz von einer Unterhaltungsmusik zu einer Kunstform. Sie lernt das Blue-Note-Label kennen, den Unterschied zwischen Cool Jazz und Hard Bop, hört von Westcoast- und modalem Jazz, Free Jazz, der Fusion des JazzRock in den 1970er, dem New Bop in den 1980er und dem Nu Jazz in den 1990er Jahren – und den jeweiligen Protagonisten dieser Stile. Und weil es nun mal weit anschaulicher ist, all das auch zu hören, spielen die drei Instrumente “Bruder Jakob” in den unterschiedlichsten Stilarten. Die dem Buch beiheftende CD enthält all diese Varianten à la Charlie Parker, Louis Armstrong, Ellington, Chet Baker, John Coltrane, Bill Evans, Stan Getz, Charlie Haden, Herbie Hancock, Chick Corea, Dave Holland und sogar – “als “Bruder Manfred” – ECM. Die drei Musiker der CD sind die Pianistin Julia Siedl, der Schlagzeuger Hans Tanschek sowie der Autor selbst am Kontrabass; in zwei Stücken kommt noch der Trompeter Lorenz Raab hinzu. Das von Peter Friedl reich illustrierte Buch gibt dabei auf 29 Seiten weit eingehendere Informationen als sie viele dem Jazz nicht nahe stehende Erwachsene haben – das alles auf eine so angenehm spielerische und spannende Weise, dass zu hoffen ist, dass wer immer dieses Buch als Kind liest oder vorgelesen bekommt, dabei bleibt, dass ihm oder ihr die Türen zum Jazz damit geöffnet wurden.
Über Musik, heißt es, sollte man in jungen Jahren lernen. Das Schaffen musikalischer Neugier ist in den ersten Lebensjahren so viel erfolgversprechender als später, wenn die Musikindustrie über musikalische Mode und Hitparaden den musikalischen Geschmack weit stärker bestimmt als die eigene Neugier. Der Verlag Annette Betz hat sich auf musikalische Kinderbücher spezialisiert, Bilderbücher mit Geschichten, die ihre jungen Leser erzählerisch in die Welt der Musik einführen. In Oliver Stegers “Jazz für Kinder” entdeckt die kleine Carla in einem Pavillon im Garten des neuen Hauses, in das sie mit ihrer Familie gezogen ist, lauter verstaubte Instrumente. Diese, erzählen sie Carla, spielen gerne Jazz, und Carla fragt nach: “Was ist denn das, Jazz?” Papa erzählt ihr auf ihre Frage von den Wurzeln des Jazz in Afro-Amerika, von Jazz als Musik der Freiheit und Musik zum Tanzen. Am nächsten Tag erklärt das Schlagzeug ihr die Geheimnisse des Rhythmus und des swing, das Klavier jene der Harmonik, der Bass die der Improvisation. Um ihr das alles näher zu bringen, improvisieren die drei ein wenig über “Bruder Jakob”, das Carla gerade in der Schule singt. Carlas Neugier ist geweckt, bald erfährt sie etwas über Bebop, das solistische Spiel, über Ragtime, Fats Waller, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Ellington, Basie, die Bigband, den Wandel des Jazz von einer Unterhaltungsmusik zu einer Kunstform. Sie lernt das Blue-Note-Label kennen, den Unterschied zwischen Cool Jazz und Hard Bop, hört von Westcoast- und modalem Jazz, Free Jazz, der Fusion des JazzRock in den 1970er, dem New Bop in den 1980er und dem Nu Jazz in den 1990er Jahren – und den jeweiligen Protagonisten dieser Stile. Und weil es nun mal weit anschaulicher ist, all das auch zu hören, spielen die drei Instrumente “Bruder Jakob” in den unterschiedlichsten Stilarten. Die dem Buch beiheftende CD enthält all diese Varianten à la Charlie Parker, Louis Armstrong, Ellington, Chet Baker, John Coltrane, Bill Evans, Stan Getz, Charlie Haden, Herbie Hancock, Chick Corea, Dave Holland und sogar – “als “Bruder Manfred” – ECM. Die drei Musiker der CD sind die Pianistin Julia Siedl, der Schlagzeuger Hans Tanschek sowie der Autor selbst am Kontrabass; in zwei Stücken kommt noch der Trompeter Lorenz Raab hinzu. Das von Peter Friedl reich illustrierte Buch gibt dabei auf 29 Seiten weit eingehendere Informationen als sie viele dem Jazz nicht nahe stehende Erwachsene haben – das alles auf eine so angenehm spielerische und spannende Weise, dass zu hoffen ist, dass wer immer dieses Buch als Kind liest oder vorgelesen bekommt, dabei bleibt, dass ihm oder ihr die Türen zum Jazz damit geöffnet wurden.
Wolfram Knauer (Januar 2011)
Giorgio Gaslini. Lo Sciamano del jazz
von Lucrezia De Domizio Durini
Milano 2008 (Silvana Editoriale)
200 Seiten, 30,00 Euro
ISBN: 9-788836-612727
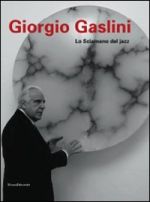 Giorgio Gaslini ist einer der führenden italienischen Jazzer, ein Musiker, der seit den 1950er Jahren die afro-amerikanischen Traditionen des Jazz mit den eigenen Traditionen der italienischen Kultur, aber auch der italienischen und europäischen Moderne zu verbinden trachtete. Er ist Pianist, Komponist, Maler, Intellektueller und kreativ Suchender, und so ist das vorliegende Buch, eine von mehreren Publikationen, die um seinen 80sten Geburtstag im Jahr 2009 erschienen, nicht so sehr eine klassische Biographie als vielmehr ein Einlassen auf all die verschiedenen kreativen Eingriffe, die Gaslini durch seine Musik und seine Kunst ins Leben, in die Wirklichkeit vornehmen wollte. Gleich im ersten Satz stellt Lucrezia de Domizio Durini den Pianisten und Komponisten bewundernd in eine Reihe mit “großen Persönlichkeiten, denen ich in meinem Leben begegnet bin”: Pier Paolo Pasolini, Joseph Beuys, Hans Georg Gadamer, Harald Szeemann, Andy Warhol und Pierre Restany. Sie scheint so den Ton für die Biographie eines Intellektuellen zu setzen. Typische Jazzfotos fehlen fast gänzlich, Bilder von Gaslini in verrauchten Clubs etwa, bei Festivals, mit amerikanischen Kollegen oder ähnlichen jazz-typischen Themen. Stattdessen nahm die Autorin einen eigenen Fotografen mit zu den Gesprächen, Gino Di Paolo, dessen Bilder Gaslini am Schreibtisch zeigen, beim tiefen Gespräch, immer irgendwie entspannt-konzentriert, ob beim Essen, Lesen, Spazierengehen, Reden, Rauchen oder Komponieren. Am persönlichsten wirkt da noch ein gestelltes Bild mit Boxhandschuhen am Sparringball.
Giorgio Gaslini ist einer der führenden italienischen Jazzer, ein Musiker, der seit den 1950er Jahren die afro-amerikanischen Traditionen des Jazz mit den eigenen Traditionen der italienischen Kultur, aber auch der italienischen und europäischen Moderne zu verbinden trachtete. Er ist Pianist, Komponist, Maler, Intellektueller und kreativ Suchender, und so ist das vorliegende Buch, eine von mehreren Publikationen, die um seinen 80sten Geburtstag im Jahr 2009 erschienen, nicht so sehr eine klassische Biographie als vielmehr ein Einlassen auf all die verschiedenen kreativen Eingriffe, die Gaslini durch seine Musik und seine Kunst ins Leben, in die Wirklichkeit vornehmen wollte. Gleich im ersten Satz stellt Lucrezia de Domizio Durini den Pianisten und Komponisten bewundernd in eine Reihe mit “großen Persönlichkeiten, denen ich in meinem Leben begegnet bin”: Pier Paolo Pasolini, Joseph Beuys, Hans Georg Gadamer, Harald Szeemann, Andy Warhol und Pierre Restany. Sie scheint so den Ton für die Biographie eines Intellektuellen zu setzen. Typische Jazzfotos fehlen fast gänzlich, Bilder von Gaslini in verrauchten Clubs etwa, bei Festivals, mit amerikanischen Kollegen oder ähnlichen jazz-typischen Themen. Stattdessen nahm die Autorin einen eigenen Fotografen mit zu den Gesprächen, Gino Di Paolo, dessen Bilder Gaslini am Schreibtisch zeigen, beim tiefen Gespräch, immer irgendwie entspannt-konzentriert, ob beim Essen, Lesen, Spazierengehen, Reden, Rauchen oder Komponieren. Am persönlichsten wirkt da noch ein gestelltes Bild mit Boxhandschuhen am Sparringball.
Das Interesse der Autorin an Gaslini aber beginnt erst einmal scheinbar abseits des Jazz: mit einem Essay über seine Aquarelle und mit der Abbildung einer jüngeren Aquarellserie von 1997. Die Autorin ist beeindruckt von dem Mann und ihren Begegnungen mit ihm, und ihr Kapitel über seine “charmante Physiognomie” liest sich wie eine Liebeserklärung, die, um nicht zu persönlich zu werden, plötzlich die Daten aus seinem Pass einstreuen muss, aber gleich darauf Querverbindungen zwischen Physiognomie und Geist zieht. Er sei wie ein Schamane, meint sie (so auch der Untertitel des Buchs), habe als Kind entdeckt, dass er durch das Klavier, dass er durch Musik Dinge ausdrücken konnte, die anders nicht zu formulieren waren. Musik sei für ihn therapeutisch gewesen, aber zugleich eine Möglichkeit, Menschen aller Nationen oder sozialer Gruppen ansprechen zu können.
Die Baroness Lucrezia De Domizio Durini, sollte man an dieser Stelle erwähnen, ist von Haus aus keine Jazz-, sondern eine renommierte Kunstexpertin, Kuratorin vielbeachteter Ausstellungen, Kunstsammlerin mit Schwerpunkt aktueller Kunst sowie Autorin etwa von 20 Büchern über Joseph Beuys’ Philosophie. Und so nimmt es nicht Wunder, dass sie auf diesen immer wieder zurückkommt, nicht nur, wenn sie sich ausführlich mit Gaslini über ein neues Werk unterhält, das den Titel trägt “Il Bosco di Beuys” (Der Wald von Beuys) und auf dessen 7.000 Eichen bei der Dokumenta 1982 in Kassel Bezug nimmt. Ihr Text bleibt persönlich, wechselt zwischen Erinnerungen an andere Künstler, denen sie begegnet ist, detaillierten Beschreibungen der Gesprächssituationen (zu Hause, im Büro, im Restaurant), Einordnungen in die Kunstgeschichte (mehr als in die Jazzgeschichte, von der die Baroness Durini nicht ganz so viel versteht). Doch soll all das Giorgio Gaslini vor allem für das Interview vorbereiten, bei dem er dann recht offenherzig über seine Kindheit und seine Familie Auskunft gibt oder über das Kulturverständnis seines Vaters… Dann heißt es, um ihren Stil ein wenig zu erklären: “Wir entschlossen uns eine Pause zu machen. Lino bot uns einen guten Kaffee an, wir rauchten still eine Zigarette. Giorgio ging zum Fenster und schaute in das Tor der Träume…”
Gaslini berichtet über den Krieg und seine erste Faszination durch den Jazz. Vielleicht weil Durini von Jazz aber wirklich nicht so viel weiß, unterhalten sie sich lieber über Philosophie, über klassische Musik, Adorno, die Liebe, seine Frau, ein klein wenig über Stan Kenton. Ein kurzes Liebesbekenntnis zum Jazz folgt, wieder eingeleitet durch den Rückbezug auf Bach, Mozart, Wagner, und ein Benennen der afro-amerikanischen Einflüsse: Duke Ellington an erster Stelle, Max Roach, Lennie Tristano, Oscar Peterson, Bill Evans, Cecil Taylor, Ornette Coleman, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, John Coltrane, Miles Davis…
Vielleicht ist das Unwissen der Autorin über den Jazz Grund für die vielen seltsamen Schreib- (bzw. Transkriptions-)fehler, die sich in ihrem Buch finden, die aber gerade bei einem so renommierten Verlag eigentlich einem Lektor hätten auffallen müssen. So liest man etwa von “Buddy Golden” (statt “Buddy Bolden”, S. 24), von “Jene” statt “Gene” Krupa (S. 83), von “Hornet” Coleman (S. 88), einem gewissen Herrn “Shoemberg” (Arnold Schönberg, S. 103) oder einer (einer???) “Riga” Polillo (S. 145) – gemeint ist der italienische Joachim Ernst Berendt, Jazzautor Arrigo Polillo. Am lustigsten liest sich in dieser mehr zufällig zusammengestellten Liste von Schreibfehlern der offenbar berühmte Bigbandleiter “Towm Besi” (S. 129) – der Rezensent braucht eine Weile, um hinter diesem “Count Basie” zu erkennen. Von solchen Ärgernissen abgesehen ist das Buch eine liebevolle, äußerst literarische und in ihrer Art und Weise überaus persönliche Annäherung an den Menschen und Künstler Giorgio Gaslini, und wenn man der Autorin auch ein besseres Lektorat gewünscht hätte, so würde man sich unter Jazzautoren tatsächlich auch öfters “Fachfremde” wünschen, die offenbar ganz andere Dinge aus ihren Subjekten herauszukitzeln vermögen als wir Experten.
Wolfram Knauer (September 2010)
Jazz Lyrik Prosa. Zur Geschichte von drei Kultserien
Von Werner Josh Sellhorn
Berlin 2008 (Ch. Links Verlag)
158 Seiten, 14,90 Euro
ISBN: 978-3-86153-581-2
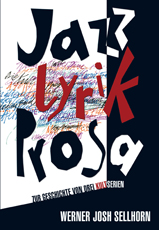 Jazz, Lyrik und Prosa waren in DDR populäre Genres, sicher auch, weil in ihnen Befindlichkeiten mitteilbar waren, die offen auszudrücken im System eher schwierig, wenn nicht gar gefährlich war. Werner Josh Sellhorn arbeitete Anfang der 1960er Jahre als Lektor im Verlag Kultur und Fortschritt, dem führenden Verlag des Landes für internationale Literatur. 1964 kam der Verlag auf die Idee eine Veranstaltungsreihe “Lyrik und Jazz” zu etablieren, bei der etwa die Jazz-Optimisten auftraten und Schauspieler wie Manfred Krug, Angelika Domröse oder Eva-Maria Hagen. Der Auftritt Wolf Biermanns und eine ein Jahr später veröffentlichte Platte des Dichters und Sängers machten den Veranstaltern zwar Ärger, steigerten aber nur die Popularität der Reihe. Bald kam neben älterem auch zeitgenössischer Jazz hinzu (etwa in Person des Pianisten Joachim Kühn) und neben Lyrik auch Prosa. 1967/67 ging die Reihe “Lyrik – Jazz – Prosa” zu Ende und wurde von verschiedenen anderen Reihen gefolgt, etwa “Jazz und Tanz” oder “Jazz & Folksongs”. Nach einer Einführung in die eben beschriebene Genese der drei Reihen machen den Hauptteil des vom 2009 verstorbenen Reihengründers Sellhorn verfassten Buchs biographische Skizzen der beim Musikteil der Veranstaltung aufgetretenen Interpreten aus – Musiker und Bands genauso wie Schauspieler. Zum Schluss listet Sellhorn noch eine Übersicht über Sonderprogramme seit 1999 auf sowie LP- und CD-Veröffentlichungen, die aus der Reihe hervorgegangen sind. “Jazz Lyrik Prosa” wirft ein sehr direktes Licht auf die Jazzszene der DDR, die Möglichkeiten und die Probleme, mit denen Macher umzugehen hatten, wenn sie kreative Projekte realisieren wollten. Lesenswert und mit etlichen kleinen Informationen, die sich wahrscheinlich nirgends sonst finden.
Jazz, Lyrik und Prosa waren in DDR populäre Genres, sicher auch, weil in ihnen Befindlichkeiten mitteilbar waren, die offen auszudrücken im System eher schwierig, wenn nicht gar gefährlich war. Werner Josh Sellhorn arbeitete Anfang der 1960er Jahre als Lektor im Verlag Kultur und Fortschritt, dem führenden Verlag des Landes für internationale Literatur. 1964 kam der Verlag auf die Idee eine Veranstaltungsreihe “Lyrik und Jazz” zu etablieren, bei der etwa die Jazz-Optimisten auftraten und Schauspieler wie Manfred Krug, Angelika Domröse oder Eva-Maria Hagen. Der Auftritt Wolf Biermanns und eine ein Jahr später veröffentlichte Platte des Dichters und Sängers machten den Veranstaltern zwar Ärger, steigerten aber nur die Popularität der Reihe. Bald kam neben älterem auch zeitgenössischer Jazz hinzu (etwa in Person des Pianisten Joachim Kühn) und neben Lyrik auch Prosa. 1967/67 ging die Reihe “Lyrik – Jazz – Prosa” zu Ende und wurde von verschiedenen anderen Reihen gefolgt, etwa “Jazz und Tanz” oder “Jazz & Folksongs”. Nach einer Einführung in die eben beschriebene Genese der drei Reihen machen den Hauptteil des vom 2009 verstorbenen Reihengründers Sellhorn verfassten Buchs biographische Skizzen der beim Musikteil der Veranstaltung aufgetretenen Interpreten aus – Musiker und Bands genauso wie Schauspieler. Zum Schluss listet Sellhorn noch eine Übersicht über Sonderprogramme seit 1999 auf sowie LP- und CD-Veröffentlichungen, die aus der Reihe hervorgegangen sind. “Jazz Lyrik Prosa” wirft ein sehr direktes Licht auf die Jazzszene der DDR, die Möglichkeiten und die Probleme, mit denen Macher umzugehen hatten, wenn sie kreative Projekte realisieren wollten. Lesenswert und mit etlichen kleinen Informationen, die sich wahrscheinlich nirgends sonst finden.
Wolfram Knauer (August 2010)
Images of Live Jazz Performances
von Albert Kösbauer
Landsberg 2008 (Balaena Verlag)
214 Seiten, 19,80 Euro
ISBN: 978-3-00-024673-9
 Albert Kösbauer erzählt im Vorwort seines Bildbandes, dass er seit langem bei Regensburger Jazzkonzerten fotografiere. Sein Platz sei in der vordersten Stuhlreihe, links oder rechts von der Bühne. Er wahre Abstand, halte sich im Hintergrund und habe immer wieder mit der Lichtsituation zu kämpfen. Auf Blitzlicht habe er dennoch immer verzichtet und lieber Geduld und wachsende Erfahrung genutzt, um von jedem Musiker “wenigstens ein brauchbares Bild einzufangen”. Auf über 200 Seiten sieht man derer etliche, “brauchbare”, aussagestarke Bilder, solche, die wie Stillleben wirken und solche, die Bewegung ausstrahlen – bis hin in verzerrte Details, weil die Künstler nun mal nicht stillhielten während der Belichtungsphase der Kamera. Ein buntes Buch ist es geworden, möchte man sagen, auch wenn alle Fotos schwarz-weiß sind und man beim Durchblättern eher den Eindruck von Grautönen erhält. Die abgelichteten Künstler aufzuzählen macht wenig Sinn, aber vielleicht gibt ein zufälliges Durchblättern etwas Aufschluss über den Inhalt: Aladar Pegè mit ruhigem Blick, aber augenscheinlich flinken Fingern am Kontrabass; Christy Doran mit konzentriertem Blick auf … Noten? die Technik am Boden?; Carsten Daerr am Flügel, den Blick lauschend zur Seite nach unten gerichtet; Carola Gray durch die Lichteffekte ihrer Beckenarbeit hindurch fotografiert; Joachim Ulrich, nicht spielend, zuhörend, das Instrument umarmend; Lajos Dudas mit angewinkeltem Knie; Arkady Shilkloper am nicht enden wollenden Alphorn; Lisa Wahlandt, skandinavische Schönheit ohne Schminke; William Parker, abgeklärt an Kontrabass und afrikanischer Gitarre (guimbri); Maria Joaos Intensität und so viele andere Momente, die den Live-Charakter des Konzerts einfangen, wie es Kösbauer ja auch im Buchtitel benennt. Keine Bilder abseits der Bühne – alle Musiker sind bei der Arbeit, konzentriert, nachdenklich, ekstatisch, mit befreitem Lachen, mit großen Ohren. Die Musiker, die man selbst erlebt hat, erkennt man wieder, man meint ihren Sound zu hören, weil Kösbauer die Erinnerung an genau jene Momente einfängt, die einen selbst fasziniert hatten. Für Fotoliebhaber also ein schönes Buch im quadratischen Softcoverumschlag, mit einem hilfreichen Namensindex der abgelichteten Künstler am Schluss und … mit jeder Menge Respekt vor der Musik.
Albert Kösbauer erzählt im Vorwort seines Bildbandes, dass er seit langem bei Regensburger Jazzkonzerten fotografiere. Sein Platz sei in der vordersten Stuhlreihe, links oder rechts von der Bühne. Er wahre Abstand, halte sich im Hintergrund und habe immer wieder mit der Lichtsituation zu kämpfen. Auf Blitzlicht habe er dennoch immer verzichtet und lieber Geduld und wachsende Erfahrung genutzt, um von jedem Musiker “wenigstens ein brauchbares Bild einzufangen”. Auf über 200 Seiten sieht man derer etliche, “brauchbare”, aussagestarke Bilder, solche, die wie Stillleben wirken und solche, die Bewegung ausstrahlen – bis hin in verzerrte Details, weil die Künstler nun mal nicht stillhielten während der Belichtungsphase der Kamera. Ein buntes Buch ist es geworden, möchte man sagen, auch wenn alle Fotos schwarz-weiß sind und man beim Durchblättern eher den Eindruck von Grautönen erhält. Die abgelichteten Künstler aufzuzählen macht wenig Sinn, aber vielleicht gibt ein zufälliges Durchblättern etwas Aufschluss über den Inhalt: Aladar Pegè mit ruhigem Blick, aber augenscheinlich flinken Fingern am Kontrabass; Christy Doran mit konzentriertem Blick auf … Noten? die Technik am Boden?; Carsten Daerr am Flügel, den Blick lauschend zur Seite nach unten gerichtet; Carola Gray durch die Lichteffekte ihrer Beckenarbeit hindurch fotografiert; Joachim Ulrich, nicht spielend, zuhörend, das Instrument umarmend; Lajos Dudas mit angewinkeltem Knie; Arkady Shilkloper am nicht enden wollenden Alphorn; Lisa Wahlandt, skandinavische Schönheit ohne Schminke; William Parker, abgeklärt an Kontrabass und afrikanischer Gitarre (guimbri); Maria Joaos Intensität und so viele andere Momente, die den Live-Charakter des Konzerts einfangen, wie es Kösbauer ja auch im Buchtitel benennt. Keine Bilder abseits der Bühne – alle Musiker sind bei der Arbeit, konzentriert, nachdenklich, ekstatisch, mit befreitem Lachen, mit großen Ohren. Die Musiker, die man selbst erlebt hat, erkennt man wieder, man meint ihren Sound zu hören, weil Kösbauer die Erinnerung an genau jene Momente einfängt, die einen selbst fasziniert hatten. Für Fotoliebhaber also ein schönes Buch im quadratischen Softcoverumschlag, mit einem hilfreichen Namensindex der abgelichteten Künstler am Schluss und … mit jeder Menge Respekt vor der Musik.
Wolfram Knauer (Juli 2010)
Three Wishes. An Intimate Look at Jazz Greats
Von Pannonica de Koenigswarter
New York 2008 (Abrams Image)
ISBN 978-0-81097-2-353 (9,99 Dollar)
 Diese Rezension stammt vom April 2007, aber da es sich sowohl bei der deutschen Fassung des Buchs von 2007 wie auch bei der englischen Fassung von 2008 um bloße Übersetzungen handelt, gilt das darin gesagte noch immer. Für die vorliegende englische Fassung kommt allerdings hinzu: Gary Giddins hat ein lesenswertes Vorwort geschrieben, und die Antworten hier in der Originalsprache gehalten sind. Albert Mangelsdorff, so lernen wir hier, wurde von der Baronin so notiert wie sie ihn gehört hatte, mit einem typisch deutschen Akzent (“I vish that people all over the vorld vould get smart enough that there vould be peace forever”).
Diese Rezension stammt vom April 2007, aber da es sich sowohl bei der deutschen Fassung des Buchs von 2007 wie auch bei der englischen Fassung von 2008 um bloße Übersetzungen handelt, gilt das darin gesagte noch immer. Für die vorliegende englische Fassung kommt allerdings hinzu: Gary Giddins hat ein lesenswertes Vorwort geschrieben, und die Antworten hier in der Originalsprache gehalten sind. Albert Mangelsdorff, so lernen wir hier, wurde von der Baronin so notiert wie sie ihn gehört hatte, mit einem typisch deutschen Akzent (“I vish that people all over the vorld vould get smart enough that there vould be peace forever”).
Wenn man früh im Jahr ein Buch auf den Tisch bekommt, das man sofort als das Weihnachtsgeschenk des Jahres empfindet, dann ist das sicher beste Voraussetzung für eine positive Buchempfehlung. So jedenfalls ging es diesem Rezensenten, als das Buch der drei Wünsche von Pannonica de Koenigswarter auf seinem Schreibtisch landete. Die Baroness war Freundin und Muse vieler Jazzmusiker, allen voran Thelonious Monk, der ihr (wie andere Musiker auch) eine Komposition widmete. Die Baroness wurde 1913 in die Bankiersfamilie der Rothschilds hineingeboren. 1954 hörte sie Monk in Paris und zog bald darauf nach New York. Traurige Berühmtheit erlangte sie durch die Tatsache, dass Charlie Parker, ein weiterer ihrer guten Freunde, in ihrem Apartment verstarb. Über die Jahre blieb sie ihren Musikerfreunden treu, half, wo immer sie konnte, insbesondere Monk, dem sie bei Streits um die Cabaret Card und bei anderen Krisen beistand. Nica, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, starb im November 1988. Über all die Jahre hatte sie ihren Musikerfreunden bei passender Gelegenheit jene legendäre Frage nach den drei Wünschen gestellt: Wenn Du drei Wünsche frei hättest, welche wären das. 300 Antworten finden sich in diesem Buch, teils kurz, teils etwas länger, teils lapidar, teils bezeichnend. Geld wünschen sich etliche, Gesundheit, Weltfrieden und privates Glück. Dass er sich nicht länger verpflichtet fühle, für Geld zu spielen (Dizzy Gillespie), dass er sich selbst besser kennenlerne (Johnny Griffin), dass seine Söhne sich endlich benehmen würden und Koenigswarter ihn heirate (Art Blakey), all das auf seinem Instrument zu erreichen, was er sich vorstelle (Sonny Rollins), ein Apartment mit einem guten Steinway und einer guten Stereoanlage (Barry Harris), Unsterblichkeit, Reichtum und ein Kind (Horace Silver), der weltbeste Künstler auf seinem Instrument zu sein (Hank Jones), dass er sein Asthma loswerde (Lou Donaldson), dass Charlie Parker wieder lebe (Art Taylor), sein Leben lang Musik spielen zu können, außerdem ein Apartment und ein Auto in New York (Eric Dolphy), eine Villa in Göteborg (Babs Gonsalves), dass die Clubs eine bessere Akustik und bessere Klaviere hätten (Mal Waldron), Reichtum, Glück und drei weitere Wünsche (Roy Brooks), ein neues Schlagzeug (Clifford Jarvis), die anstehenden Rechnungen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren (Anita O’Day), der beste Trompeter der Welt zu sein (Lonnie Hollyer), das Genie von Thelonious Monk zu besitzen (Billy Higgins), eine Flasche kühlen Biers (Giggy Coggins), eine Zeitmaschine (John Ore), dass die Kriegsetats in die intellektuelle Bildung gesteckt würden (Steve Lacy), Gerechtigkeit, Wahrheit und Schönheit (Stan Getz), ein gutes Leben zu leben ohne Scheiße spielen zu müssen (Joe Zawinul), Freiheit für Südafrika (Miriam Makeba), weiß zu sein (Miles Davis), Drillinge (Dinah Washington), keine weitere Medizin einnehmen und nicht wieder ins Krankenhaus gehen zu müssen (Bud Powell), spielen, spielen, Liebe machen (Kenny Drew). Albert Mangelsdorff ist der einzige Deutsche (und einer der wenigen Europäer), die von der Baroness befragt wurden. Er antwortete: “Zuerst einmal möchte ich lang genug leben, um in meinem Spiel zu einem für mich befriedigenden Resultat zu gelangen. Ich wünsche mir, dass das Leben eines Musikers nicht sein Familienleben stört. Ich wünsche mir, dass die Menschen auf der Welt endlich vernünftig genug werden, Frieden für alle zu schaffen! (Und ich wünsche mir, dass dieser Wunsch als erster erfüllt wird!).” Angereichert sind die Texte mit Fotos aus dem Privatarchiv der Baroness – private Bilder vom tanzenden Monk, von Miles und Coltrane, Dexter Gordon und all den anderen Freunden der Autorin. Farbbilder und Schwarzweißfotos – oft sieht man den Bildern an, dass sie über Jahre in der Schublade gelegen haben. Aber gerade die Privatheit dieser Aufnahmen macht ihre Besonderheit aus, eine Intimität, in der man kaum sonst diese Jazzheroen gesehen hat.
Wolfram Knauer (April 2007)
Benny Goodman. The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert
von Jon Hancock
Shrewsbury 2008 (Prancing Fish)
218 Seiten, 24,99 Britische Pfund
ISBN: 978-0-9562404-08
 Ashley Kahn hat mit seinen Büchern über Miles Davis’ “Kind of Blue” und John Coltranes “A Love Supreme” ein Beispiel gesetzt, wie man Jazzgeschichte auch aus dem Augenblick heraus schreiben kann, mit dem Fokus auf einen spezifischen Punkt des geschichtlichen Ablaufs. Er hat gezeigt, dass sich aus Archiven und Erinnerungen die komplexen Entwicklungen nachzeichnen lassen, die zu jenen legendären und einflussreichen Alben führten. Wenige Momente der Jazzgeschichte sind so genau beleuchtet worden – und außer spezifischen Alben handelt es sich bei solchen Fokus-Abhandlungen meist um besondere Konzerte: Paul Whitemans Aeolian Hall Concert erhielt erhöhte Aufmerksamkeit genauso wie Charlie Parkers Massey Hall Concert. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand dem lange Jahre erfolgreichsten Livekonzert des Jazz annahm, dem Konzert, das Benny Goodman am 16. Januar 1938 in der New Yorker Carnegie Hall gab und bei dem er mit seiner Bigband, mit Trio und Quartett sowie mit renommierten Kollegen aus anderen Bands in einer Jam Session zu hören war. Das Konzert hat Jazzgeschichte geschrieben, auch deshalb, weil es damals mitgeschnitten und der Mitschnitt später in guter Qualität veröffentlicht wurde, so dass fast jeder Programmpunkt des Abends auch im hörenden Gedächtnis der Jazzgemeinde erhalten blieb. Immer wieder wurde über das Konzert geschrieben, doch mit diesem Buch hat Jon Hancock die ultimative Monographie zum 16. Januar 1938 verfasst. In seinem Buch finden sich jede Menge Originaldokumente, Fotos von Eintrittskarten genauso wie ein Faksimile des Programmheftes, Vertragsvereinbarungen über die Plattenveröffentlichung und wahrscheinlich sämtliche Fotos, die von jenem Abend in der Carnegie Hall aufzutreiben waren. Hancocks Kapitel beleuchten die Umstände des Konzerts. Er erzählt kurz die Geschichte des Konzertsaals, erklärt, wie Goodman überhaupt auf die Idee eines Konzerts im ehrwürdigen Saal kam und wie sich die Pläne langsam verdichteten. Er berichtet von Problemen und Diskussionen über den Ablauf genauso wie die Bühnenbeleuchtung. Er weiß Geschichten über die Proben zu erzählen (auch hiervon gibt es Fotos), über den Ticketverkauf und die Abendplanung: Auf die Frage, wie lang denn die Pause sein solle, antwortete Goodman damals angeblich: “Oh, ich weiß nicht… Wie lang macht denn Herr Toscanini gewöhnlich?” Schließlich das Konzert selbst, das Hancock Stück für Stück kommentiert und dabei sowohl auf zeitgenössische Kritiken wie auch auf spätere Berichte zurückgreift. Er erzählt die Geschichte des Konzertmitschnitts sowie eines Newsreel-Filmdokuments des Konzerts. Er diskutiert das Album-Design der in den 1950er Jahren erstveröffentlichten Aufnahmen und schreibt über das Restaurations-Projekt von Phil Schaap, dem es 1997 gelang, das Konzert in kompletter Länge zusammenzustellen. Zum Schluss wirft er noch einen Blick auf die Jubiläumsveranstaltungen von 1958, 1968, 1978, 1988, 1998 und 2008. Eine ausführliche Bibliographie zum Konzert folgt, die ausführlichen Programmnotizen von Irving Kolodin sowie eine Auflistung sämtlicher Auftritte Goodmans in der Carnegie Hall von 1938 bis 1982. Eingeleitet wird das Buch von einer liebevollen Würdigung ihres Vaters durch Rachel Edelson, die Tochter des Klarinettisten, die davon erzählt, wie ihr Vater immer auf der Suche nach dem perfekten Klarinettenblättchen gewesen sei. Alles in allem: Eine “labor of love”, kurzweilig geschrieben, reich bebildert und nicht nur für Goodman-Fans zu empfehlen.
Ashley Kahn hat mit seinen Büchern über Miles Davis’ “Kind of Blue” und John Coltranes “A Love Supreme” ein Beispiel gesetzt, wie man Jazzgeschichte auch aus dem Augenblick heraus schreiben kann, mit dem Fokus auf einen spezifischen Punkt des geschichtlichen Ablaufs. Er hat gezeigt, dass sich aus Archiven und Erinnerungen die komplexen Entwicklungen nachzeichnen lassen, die zu jenen legendären und einflussreichen Alben führten. Wenige Momente der Jazzgeschichte sind so genau beleuchtet worden – und außer spezifischen Alben handelt es sich bei solchen Fokus-Abhandlungen meist um besondere Konzerte: Paul Whitemans Aeolian Hall Concert erhielt erhöhte Aufmerksamkeit genauso wie Charlie Parkers Massey Hall Concert. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand dem lange Jahre erfolgreichsten Livekonzert des Jazz annahm, dem Konzert, das Benny Goodman am 16. Januar 1938 in der New Yorker Carnegie Hall gab und bei dem er mit seiner Bigband, mit Trio und Quartett sowie mit renommierten Kollegen aus anderen Bands in einer Jam Session zu hören war. Das Konzert hat Jazzgeschichte geschrieben, auch deshalb, weil es damals mitgeschnitten und der Mitschnitt später in guter Qualität veröffentlicht wurde, so dass fast jeder Programmpunkt des Abends auch im hörenden Gedächtnis der Jazzgemeinde erhalten blieb. Immer wieder wurde über das Konzert geschrieben, doch mit diesem Buch hat Jon Hancock die ultimative Monographie zum 16. Januar 1938 verfasst. In seinem Buch finden sich jede Menge Originaldokumente, Fotos von Eintrittskarten genauso wie ein Faksimile des Programmheftes, Vertragsvereinbarungen über die Plattenveröffentlichung und wahrscheinlich sämtliche Fotos, die von jenem Abend in der Carnegie Hall aufzutreiben waren. Hancocks Kapitel beleuchten die Umstände des Konzerts. Er erzählt kurz die Geschichte des Konzertsaals, erklärt, wie Goodman überhaupt auf die Idee eines Konzerts im ehrwürdigen Saal kam und wie sich die Pläne langsam verdichteten. Er berichtet von Problemen und Diskussionen über den Ablauf genauso wie die Bühnenbeleuchtung. Er weiß Geschichten über die Proben zu erzählen (auch hiervon gibt es Fotos), über den Ticketverkauf und die Abendplanung: Auf die Frage, wie lang denn die Pause sein solle, antwortete Goodman damals angeblich: “Oh, ich weiß nicht… Wie lang macht denn Herr Toscanini gewöhnlich?” Schließlich das Konzert selbst, das Hancock Stück für Stück kommentiert und dabei sowohl auf zeitgenössische Kritiken wie auch auf spätere Berichte zurückgreift. Er erzählt die Geschichte des Konzertmitschnitts sowie eines Newsreel-Filmdokuments des Konzerts. Er diskutiert das Album-Design der in den 1950er Jahren erstveröffentlichten Aufnahmen und schreibt über das Restaurations-Projekt von Phil Schaap, dem es 1997 gelang, das Konzert in kompletter Länge zusammenzustellen. Zum Schluss wirft er noch einen Blick auf die Jubiläumsveranstaltungen von 1958, 1968, 1978, 1988, 1998 und 2008. Eine ausführliche Bibliographie zum Konzert folgt, die ausführlichen Programmnotizen von Irving Kolodin sowie eine Auflistung sämtlicher Auftritte Goodmans in der Carnegie Hall von 1938 bis 1982. Eingeleitet wird das Buch von einer liebevollen Würdigung ihres Vaters durch Rachel Edelson, die Tochter des Klarinettisten, die davon erzählt, wie ihr Vater immer auf der Suche nach dem perfekten Klarinettenblättchen gewesen sei. Alles in allem: Eine “labor of love”, kurzweilig geschrieben, reich bebildert und nicht nur für Goodman-Fans zu empfehlen.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Ron Carter. Finding the Right Notes
von Dan Ouellette
New York 2008 (artistShare)
434 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-615-26526-1
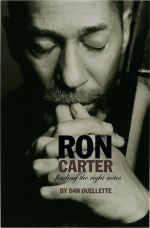 Bassisten sind die Grundstützen des Jazz, von Walter Page und Jimmy Blanton über Ray Brown, Charles Mingus bis zu Charlie Haden. Ron Carter, mittlerweile 72 Jahre alt, gehört mit zu den ganz großen seines Instruments: immer verlässlich im Hintergrund, immer präsent, wenn man ihn herausstellte, ein Musiker, der die Kollegen stützte, egal ob sie eigene Projekte realisieren wollten oder an seinen Projekten teilhatten. Dan Ouellette hat sich mit dem Bassisten zusammengesetzt, um seine Erinnerungen niederzuschreiben, die Erfahrungen eines der meistaufgenommenen Musiker des Jazz. Carter wuchs in Ferndale, einem Vorort von Detroit, auf, und wurde von seinem Vater ermutigt, Cello zu spielen. Er studierte Cello, dann Kontrabass an der Cass Technical High School und danach vier Jahre lang an der renommierten Eastman School of Music in Rochester, New York. Hier lernte er auch, dass, so gut er auch als Instrumentalist war, ihm in der klassischen Welt die Hautfarbe im Weg stand. Kein geringerer als Leopold Stokowski lobte ihn für sein Bassspiel, erklärte aber zugleich, dass er ihn als Schwarzen in Houston, wo er dirigierte, niemals im Orchester durchbringen könne. Neben dem Studium spielte Carter in einem lokalen Jazztrio, aber auch mit Gap und Chuck Mangione oder dem Saxophonisten Pee Wee Ellis, die alle damals in Rochester lebten. 1959 ging Carter nach New York, arbeitete mit Chico Hamilton, Randy Weston, Eric Dolphy, Benny Golson und vielen anderen. Er studierte an der Manhattan School of Music, und war abends ein gefragter Bassist in unterschiedlichsten Ensembles. 1963 engagierte ihn Miles Davis für seine Band, mit der Carter über die Jahre einflussreiche Alben einspielen sollte: “E.S.P.”, “Miles Smiles”, “Sorcerer”, “Nefertiti”, “Water Babies”, “Miles in the Sky” und “Filles de Kilimanjaro”. Carter erzählt über die Zeit bei Miles, über Aufnahmesitzungen und Konzerte und kommentiert einige der Einspielungen, die er mit Miles machte. In den 1970er Jahren spielte er mit dem Great Jazz Trio und mit Herbie Hancocks V.S.O.P., wirkte daneben über die Jahre immer wieder in Tributprojekten an seinen früheren Chef mit, ob auf Platte oder bei Konzerten. Daneben aber verfolgte er auch seine Karriere als Bandleader, insbesondere auf Alben, die er in den 1970er Jahren für das Label CTI aufnahm. 1976 wechselte er zu Milestone Records, später dann zu Blue Note. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Carter, dem Sideman, ein weiteres mit seiner Studioarbeit für Werbemusik sowie ein drittes mit seiner Mitwirkung bei Filmen wie “Bird” oder “Kansas City”. Carters Ausflüge in brasilianische Musik finden genauso Erwähnung wie jene in die Welt der klassischen Musik oder seine Arbeit als Jazzpädagoge. Sein Duo mit Jim Hall kommt genauso zur Sprache wie Carters jüngste eigene Bands, sein Cello Choir und sein Ausflug in des Welt des HipHop. Zum Schluss findet sich noch ein Live-Blindfold-Test, bei dem Carter 2007 bei der Tagung der International Association of Jazz Educators Aufnahmen von Kollegen kommentierte, sowie ausführliche Kommentare zu seinem gewählten Instrument, dem Kontrabass. Ein Appendix versammelt Interviewausschnitte anderer Musiker zu Ron Carter, etwa von Buster Williams, Chick Corea, Gonzalo Rubalcaba, Stanley Clarke, Esperanza Spalding, Charlie Haden, Dave Holland, Grady Tate, Javon Jackson, John Patitucci, Jacky Terrasson, Wynton Marsalis, Jimmy Heath und Billy Taylor. Ein zweiter Appendix erteilt Auskünfte aus dem eher privaten Bereich, etwa, welches Auto Carter fährt, welche Pfeife er raucht, wo er seine Kleidung kauft, welche Stereoanlage er zuhause hat und welche Platten er auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Oullette greift auf Carters Erinnerungen zurück, zitiert aber auch ausführlich aus zuvor veröffentlichten Interviews. Das Buch ist eine würdige Hommage an einen der ganz Großen seines Instruments, überaus lesenswert, voll mit Insiderinformationen und jedem empfohlen, der sich für Carter, Miles Davis oder den Jazz der 60er bis 80er Jahre interessiert.
Bassisten sind die Grundstützen des Jazz, von Walter Page und Jimmy Blanton über Ray Brown, Charles Mingus bis zu Charlie Haden. Ron Carter, mittlerweile 72 Jahre alt, gehört mit zu den ganz großen seines Instruments: immer verlässlich im Hintergrund, immer präsent, wenn man ihn herausstellte, ein Musiker, der die Kollegen stützte, egal ob sie eigene Projekte realisieren wollten oder an seinen Projekten teilhatten. Dan Ouellette hat sich mit dem Bassisten zusammengesetzt, um seine Erinnerungen niederzuschreiben, die Erfahrungen eines der meistaufgenommenen Musiker des Jazz. Carter wuchs in Ferndale, einem Vorort von Detroit, auf, und wurde von seinem Vater ermutigt, Cello zu spielen. Er studierte Cello, dann Kontrabass an der Cass Technical High School und danach vier Jahre lang an der renommierten Eastman School of Music in Rochester, New York. Hier lernte er auch, dass, so gut er auch als Instrumentalist war, ihm in der klassischen Welt die Hautfarbe im Weg stand. Kein geringerer als Leopold Stokowski lobte ihn für sein Bassspiel, erklärte aber zugleich, dass er ihn als Schwarzen in Houston, wo er dirigierte, niemals im Orchester durchbringen könne. Neben dem Studium spielte Carter in einem lokalen Jazztrio, aber auch mit Gap und Chuck Mangione oder dem Saxophonisten Pee Wee Ellis, die alle damals in Rochester lebten. 1959 ging Carter nach New York, arbeitete mit Chico Hamilton, Randy Weston, Eric Dolphy, Benny Golson und vielen anderen. Er studierte an der Manhattan School of Music, und war abends ein gefragter Bassist in unterschiedlichsten Ensembles. 1963 engagierte ihn Miles Davis für seine Band, mit der Carter über die Jahre einflussreiche Alben einspielen sollte: “E.S.P.”, “Miles Smiles”, “Sorcerer”, “Nefertiti”, “Water Babies”, “Miles in the Sky” und “Filles de Kilimanjaro”. Carter erzählt über die Zeit bei Miles, über Aufnahmesitzungen und Konzerte und kommentiert einige der Einspielungen, die er mit Miles machte. In den 1970er Jahren spielte er mit dem Great Jazz Trio und mit Herbie Hancocks V.S.O.P., wirkte daneben über die Jahre immer wieder in Tributprojekten an seinen früheren Chef mit, ob auf Platte oder bei Konzerten. Daneben aber verfolgte er auch seine Karriere als Bandleader, insbesondere auf Alben, die er in den 1970er Jahren für das Label CTI aufnahm. 1976 wechselte er zu Milestone Records, später dann zu Blue Note. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Carter, dem Sideman, ein weiteres mit seiner Studioarbeit für Werbemusik sowie ein drittes mit seiner Mitwirkung bei Filmen wie “Bird” oder “Kansas City”. Carters Ausflüge in brasilianische Musik finden genauso Erwähnung wie jene in die Welt der klassischen Musik oder seine Arbeit als Jazzpädagoge. Sein Duo mit Jim Hall kommt genauso zur Sprache wie Carters jüngste eigene Bands, sein Cello Choir und sein Ausflug in des Welt des HipHop. Zum Schluss findet sich noch ein Live-Blindfold-Test, bei dem Carter 2007 bei der Tagung der International Association of Jazz Educators Aufnahmen von Kollegen kommentierte, sowie ausführliche Kommentare zu seinem gewählten Instrument, dem Kontrabass. Ein Appendix versammelt Interviewausschnitte anderer Musiker zu Ron Carter, etwa von Buster Williams, Chick Corea, Gonzalo Rubalcaba, Stanley Clarke, Esperanza Spalding, Charlie Haden, Dave Holland, Grady Tate, Javon Jackson, John Patitucci, Jacky Terrasson, Wynton Marsalis, Jimmy Heath und Billy Taylor. Ein zweiter Appendix erteilt Auskünfte aus dem eher privaten Bereich, etwa, welches Auto Carter fährt, welche Pfeife er raucht, wo er seine Kleidung kauft, welche Stereoanlage er zuhause hat und welche Platten er auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Oullette greift auf Carters Erinnerungen zurück, zitiert aber auch ausführlich aus zuvor veröffentlichten Interviews. Das Buch ist eine würdige Hommage an einen der ganz Großen seines Instruments, überaus lesenswert, voll mit Insiderinformationen und jedem empfohlen, der sich für Carter, Miles Davis oder den Jazz der 60er bis 80er Jahre interessiert.
(Wolfram Knauer, Februar 2010)
Swing Is the Thing. Hengelo en de Jazz 1920-1960
von Henk Kleinhout
Hengelo 2008 (Uitgiverij Smit)
157 Seiten, 23,85 Euro
ISBN: 978-90-6289-626-4
 Henk Kleinhout spielte Posaune in verschiedenen traditionellen Jazzbands, beschäftigte sich in seinen Studien allerdings genauso mit der Black-Power-Bewegung und der amerikanischen Jazzavantgarde. 2006 promovierte er sich mit einer Arbeit über die Rezeption des Jazz in den Niederlanden der Wiederaufbauzeit und legt in diesem Buch eine Geschichte des Jazz in Hengelo vor, einer Mittelstadt nahe Enschede, nicht weit von der deutschen Grenze. Ein Einleitungskapitel macht auf die erste Jazzrezeption in den Niederlanden aufmerksam, Konzerte Paul Whitemans in Scheveningen und Amsterdam, Tourneestops von Armstrong, Ellington, Benny Carter und Coleman Hawkins. Dann geht es in die Stadtgeschichte. Die ersten Belege für Jazz in Hengelo findet Kleinhout bereits 1916, als die “Timbertown Follies”, eine Varietégruppe, in Hengelo auftraten. 1919 stand das Wort Jazz (noch geschrieben als “jasz”) zum ersten Mal in der Lokalzeitung, in der Anzeige einer Tanzschule. (Kurz darauf erschien die Anzeige offenbar mit korrigierter Schreibweise, wie ein Faksimile im Buch deutlich macht). Von 1923 gibt es Anzeigen für “Jazz Band Balls”, also Tanzveranstaltungen, bei denen auch eine “Original Jazz-Band” zu hören war. Ob daran irgendwelche Hengelo’schen Musiker beteiligt waren, kann auch Kleinhout nicht beantworten. Es gab in den 1920er Jahren Konzerte und Tanzveranstaltungen und in der Tagespresse außerdem Berichte beispielsweise über britische Bands, die in Hengelo im Rundfunk zu hören waren. In den 1930er Jahren sah es dann bereits anders aus. Im Hotel Eulderink gastierte das Appleton Trio; andere Bands wie die Rhythm Kings aus Leeuwarden oder die Blue Ramblers waren ebenfalls viel in der Stadt zu hören. Kleinhout dokumentiert akribisch Engagements und Tanzveranstaltungen, immer mit einem Seitenblick auf anderswo in den Niederlanden stattfindende Jazzaktivitäten, die Ramblers etwa oder den landesweit spürbaren Eindruck, den Duke Ellingtons Orchester bei einem Konzert in Amsterdam auf die niederländische Jazzszene machte. In den 1940er Jahren war das Land von den Nazis besetzt, aber Jazz gab es trotzdem, gespielt etwa von den Bands von Ernst van’t Hoff oder Dick Willebrandts. Hengeloer Lokalmatadoren wie Manny Oets dürfen im Buch nicht fehlen, genauso wenig wie Verweise auf Gastspiele der Ramblers 1946 oder von Nat Gonella 1949. In den 1950er Jahren dann stellt Kleinhout Ensembles wie das Vokalensemble The Vocal Touches heraus, das Harry Banning Quartet, das sich in Besetzung und Repertoire am Modern Jazz Quartet orientierte, das Quartett des Pianisten Fred van de Ven oder die Band Hotclub d’Hengelo. “Swing Is the Thing” beschreibt, wie eine Musik langsam aber sicher Fuß fasst in einer Mittelstadt der Niederlande, wie aus Zuhörern und Unterhaltungssüchtigen Fans werden und wie sich eine Szene herausbildet, die nach wie vor zwischen Spaß und Bewusstsein um den Ernst der Musik schwankt. Kleinhout hat in nationalen Jazzblättern genauso wie in lokalen und regionalen Zeitungsarchiven recherchiert. Ein Personenregister rundet das vordergründig vielleicht vor allem für Hengeloer Jazzfreunde interessante Buch ab, das aber zugleich ein Puzzlestein zur Dokumentation des niederländischen jazz darstellt.
Henk Kleinhout spielte Posaune in verschiedenen traditionellen Jazzbands, beschäftigte sich in seinen Studien allerdings genauso mit der Black-Power-Bewegung und der amerikanischen Jazzavantgarde. 2006 promovierte er sich mit einer Arbeit über die Rezeption des Jazz in den Niederlanden der Wiederaufbauzeit und legt in diesem Buch eine Geschichte des Jazz in Hengelo vor, einer Mittelstadt nahe Enschede, nicht weit von der deutschen Grenze. Ein Einleitungskapitel macht auf die erste Jazzrezeption in den Niederlanden aufmerksam, Konzerte Paul Whitemans in Scheveningen und Amsterdam, Tourneestops von Armstrong, Ellington, Benny Carter und Coleman Hawkins. Dann geht es in die Stadtgeschichte. Die ersten Belege für Jazz in Hengelo findet Kleinhout bereits 1916, als die “Timbertown Follies”, eine Varietégruppe, in Hengelo auftraten. 1919 stand das Wort Jazz (noch geschrieben als “jasz”) zum ersten Mal in der Lokalzeitung, in der Anzeige einer Tanzschule. (Kurz darauf erschien die Anzeige offenbar mit korrigierter Schreibweise, wie ein Faksimile im Buch deutlich macht). Von 1923 gibt es Anzeigen für “Jazz Band Balls”, also Tanzveranstaltungen, bei denen auch eine “Original Jazz-Band” zu hören war. Ob daran irgendwelche Hengelo’schen Musiker beteiligt waren, kann auch Kleinhout nicht beantworten. Es gab in den 1920er Jahren Konzerte und Tanzveranstaltungen und in der Tagespresse außerdem Berichte beispielsweise über britische Bands, die in Hengelo im Rundfunk zu hören waren. In den 1930er Jahren sah es dann bereits anders aus. Im Hotel Eulderink gastierte das Appleton Trio; andere Bands wie die Rhythm Kings aus Leeuwarden oder die Blue Ramblers waren ebenfalls viel in der Stadt zu hören. Kleinhout dokumentiert akribisch Engagements und Tanzveranstaltungen, immer mit einem Seitenblick auf anderswo in den Niederlanden stattfindende Jazzaktivitäten, die Ramblers etwa oder den landesweit spürbaren Eindruck, den Duke Ellingtons Orchester bei einem Konzert in Amsterdam auf die niederländische Jazzszene machte. In den 1940er Jahren war das Land von den Nazis besetzt, aber Jazz gab es trotzdem, gespielt etwa von den Bands von Ernst van’t Hoff oder Dick Willebrandts. Hengeloer Lokalmatadoren wie Manny Oets dürfen im Buch nicht fehlen, genauso wenig wie Verweise auf Gastspiele der Ramblers 1946 oder von Nat Gonella 1949. In den 1950er Jahren dann stellt Kleinhout Ensembles wie das Vokalensemble The Vocal Touches heraus, das Harry Banning Quartet, das sich in Besetzung und Repertoire am Modern Jazz Quartet orientierte, das Quartett des Pianisten Fred van de Ven oder die Band Hotclub d’Hengelo. “Swing Is the Thing” beschreibt, wie eine Musik langsam aber sicher Fuß fasst in einer Mittelstadt der Niederlande, wie aus Zuhörern und Unterhaltungssüchtigen Fans werden und wie sich eine Szene herausbildet, die nach wie vor zwischen Spaß und Bewusstsein um den Ernst der Musik schwankt. Kleinhout hat in nationalen Jazzblättern genauso wie in lokalen und regionalen Zeitungsarchiven recherchiert. Ein Personenregister rundet das vordergründig vielleicht vor allem für Hengeloer Jazzfreunde interessante Buch ab, das aber zugleich ein Puzzlestein zur Dokumentation des niederländischen jazz darstellt.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Lutzemann’s Jatzkapelle. Alltag & Abenteuer einer “German Jazzband”
von Lutz Eikelmann
Berlin 2008 (Verlag Pro Business)
118 Seiten
ISBN: 978-3-86805-239-8
 “Lutzemanns Jatzkapelle” wurde 1993 gegründet und ist, wie schon der Bandname dem eingeweihten Jazzkenner verrät, in den traditionellen Stilarten des Jazz zu Hause. Eikelmann ist abwechselnd Tubist, Bassist und Schlagzeuger der Kapelle und erzählt in seinem Buch Anekdoten aus 15 Jahren Bandgeschichte. Es sind Anekdoten von Reisen in nähere und weiter entfernte Regionen, von musikalischen und menschlichen Höhepunkten und Zwischenfällen. Es sind Geschichten aus Clubs, von Festivals oder über Gigs in Einkaufszentren, von Kollegen wie etwa dem 2002 verstorbenen Saxophonisten Fitz Gore oder über den Posaunisten Hawe Schneider. Im Mittelpunkt des Buchs stehen eine Reise nach New Orleans, eine Jazzkreuzfahrt durch die Karibik und eine weitere (“Jazz Meets Klassik”) durchs Mittelmeer. Dann kommen Lobreden aus der Presse, Erinnerungen an die erste CD, an einen Drehtag für eine Fernsehsendung mit Marie-Luise Marjan (“Mutter Beimer”), und an das Lonnie Donegan Projekt, das Eikelmann 2003 nach dem Tod des britischen Gitarristen, Banjospielers und Sängers ins Leben rief. Das Buch ist ein Sammelsurium vieler unterschiedlich interessanter Anekdoten und damit vor allem für Freunde des “Oldtime-Jazz”, wie Eikelmann seine Musik selbst bezeichnet, ein nettes Erinnerungsbüchlein. Editorisch lässt es zu wünschen übrig; zu zusammenhanglos liegen die Anekdoten nebeneinander; zu banal (und zu pointenarm) sind etliche der Anekdoten, zu fragwürdig einige der Witzchen, die im Männergespräch vielleicht durchgehen und auch beim Erzählen am Stammtisch witzig wirken mögen , auf Papier gedruckt aber doch eher peinlich anmuten. Schließlich steckt zu wenig Struktur in dem allen; das Buch wirkt stellenweise mehr wie eine Werbebroschüre als wie eine Dokumentation. Wenn überhaupt, so macht “Lutzemann’s Jatzkapelle” allerdings eines bewusst: dass nämlich die Szene des traditionellen Jazz, ob New Orleans, Dixieland oder “Oldtime” in Deutschland einer kritischen Bestandsaufnahme harrt, die die Geschichten der Musiker, also auch Eikelmanns Erfahrungen, bündelt und in Beziehung setzt zu den politischen, kulturellen und ökonomischen Entwicklungen in Deutschland von 1945 bis heute, die die ästhetischen Implikationen des Stils vorbehaltlos analysieren und damit vielleicht eine ähnliche Neubewertung der Szene erreichen könnte wie sie George McKay in Kapiteln seines Buchs “Circular Breathing. The Cultural Politics of Jazz in Britain” gelungen ist.
“Lutzemanns Jatzkapelle” wurde 1993 gegründet und ist, wie schon der Bandname dem eingeweihten Jazzkenner verrät, in den traditionellen Stilarten des Jazz zu Hause. Eikelmann ist abwechselnd Tubist, Bassist und Schlagzeuger der Kapelle und erzählt in seinem Buch Anekdoten aus 15 Jahren Bandgeschichte. Es sind Anekdoten von Reisen in nähere und weiter entfernte Regionen, von musikalischen und menschlichen Höhepunkten und Zwischenfällen. Es sind Geschichten aus Clubs, von Festivals oder über Gigs in Einkaufszentren, von Kollegen wie etwa dem 2002 verstorbenen Saxophonisten Fitz Gore oder über den Posaunisten Hawe Schneider. Im Mittelpunkt des Buchs stehen eine Reise nach New Orleans, eine Jazzkreuzfahrt durch die Karibik und eine weitere (“Jazz Meets Klassik”) durchs Mittelmeer. Dann kommen Lobreden aus der Presse, Erinnerungen an die erste CD, an einen Drehtag für eine Fernsehsendung mit Marie-Luise Marjan (“Mutter Beimer”), und an das Lonnie Donegan Projekt, das Eikelmann 2003 nach dem Tod des britischen Gitarristen, Banjospielers und Sängers ins Leben rief. Das Buch ist ein Sammelsurium vieler unterschiedlich interessanter Anekdoten und damit vor allem für Freunde des “Oldtime-Jazz”, wie Eikelmann seine Musik selbst bezeichnet, ein nettes Erinnerungsbüchlein. Editorisch lässt es zu wünschen übrig; zu zusammenhanglos liegen die Anekdoten nebeneinander; zu banal (und zu pointenarm) sind etliche der Anekdoten, zu fragwürdig einige der Witzchen, die im Männergespräch vielleicht durchgehen und auch beim Erzählen am Stammtisch witzig wirken mögen , auf Papier gedruckt aber doch eher peinlich anmuten. Schließlich steckt zu wenig Struktur in dem allen; das Buch wirkt stellenweise mehr wie eine Werbebroschüre als wie eine Dokumentation. Wenn überhaupt, so macht “Lutzemann’s Jatzkapelle” allerdings eines bewusst: dass nämlich die Szene des traditionellen Jazz, ob New Orleans, Dixieland oder “Oldtime” in Deutschland einer kritischen Bestandsaufnahme harrt, die die Geschichten der Musiker, also auch Eikelmanns Erfahrungen, bündelt und in Beziehung setzt zu den politischen, kulturellen und ökonomischen Entwicklungen in Deutschland von 1945 bis heute, die die ästhetischen Implikationen des Stils vorbehaltlos analysieren und damit vielleicht eine ähnliche Neubewertung der Szene erreichen könnte wie sie George McKay in Kapiteln seines Buchs “Circular Breathing. The Cultural Politics of Jazz in Britain” gelungen ist.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
Ich hab den Blues schon etwas länger. Spuren einer Musik in Deutschland
Herausgegeben von Michael Rauhut und Reinhard Lorenz
Berlin 2008 (Ch. Links-Verlag)
412 Seiten, 29,90 Euo
ISBN 978-3-86153-495-2
 2008 begaben sich Michael Rauhut und Reinhard Lorenz mit ihrem Buch “Ich hab den Blues schon etwas länger“ auf die “Spuren des Blues in Deutschland“ (Ch. Links-Verlag). Herausgekommen ist ein hervorragend lesbarer Reader mit Texten zu regionalen Bluesszenen in Ost und West, historischen Anrissen zur afroamerikanischen Musiktradition in Deutschland und persönlichen Anekdoten “Bluesbetroffener“.
2008 begaben sich Michael Rauhut und Reinhard Lorenz mit ihrem Buch “Ich hab den Blues schon etwas länger“ auf die “Spuren des Blues in Deutschland“ (Ch. Links-Verlag). Herausgekommen ist ein hervorragend lesbarer Reader mit Texten zu regionalen Bluesszenen in Ost und West, historischen Anrissen zur afroamerikanischen Musiktradition in Deutschland und persönlichen Anekdoten “Bluesbetroffener“.
Das meiste ist kurzweilig zu lesen, zwar selten wirklich neu, doch in der Kombination der Texte originell zusammengestellt. So folgen die einzelnen Kapitel den Wochentagen, beginnend bei Montag, um jedem Kapitel eine Textzeile des Bluesklassikers “Stormy Monday“ von T-Bone Walker voranzustellen. Das scheint zwar inhaltlich nicht sonderlich viel Sinn zu machen, ist aber – in der positiven Wendung, die die Strophe gegen Ende nimmt (“Eagle flies on Friday“) – vielleicht eine Allegorie für die Hoffnung, die die Herausgeber in Bezug auf die künftige Entwicklung des Blues in Deutschland hegen. Da verschmerzt man, dass viele der Texte Zweitverwertungen der Autoren sind, die so oder in leicht geänderter Form an anderer Stelle bereits veröffentlicht wurden. Besonders beachtlich darunter ohne Zweifel – und das Vergnügen beim Lesen erheblich steigernd – die kurzen Reminiszenzen prominenter, lebender oder bereits verstorbener Bluesfans wie Peter Maffay, Eric Burdon, Götz Alsmann, Wim Wenders (entrichtet ein Geleitwort), Joachim-Ernst Berendt, Olaf Hudtwalcker, Emil Mangelsdorff und anderer.
Analytische Artikel zur Situation des Blues in Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart sucht man in diesem Buch allerdings meist vergebens, bekommt sie lediglich dort, wo man das auch erwarten darf – bei den Professoren Michael Rauhut (Vergleich der Blues-Diskurse in Ost und West) und Peter Wicke (Blues und Authentizität). Alles in allem handelt es sich bei diesem Werk um ein pralles Lesebuch für jene, die den Blues schon etwas länger haben und eigene Erinnerungen an ein Leben mit ihm gerne noch einmal aufwärmen möchten, und für jene, die immer schon einmal wissen wollten, was der Blues verdammt noch mal mit Deutschland zu tun hat.
(Arndt Weidler, Dezember 2011)
Barney Kessel. A Jazz Legend
von Maurice J. Summerfield
Blaydon on Tyne 2008 (Ashley Mark Publishing Company)
distributed by Hal Leonard Corporation
303 Seiten, 39,50 US-$
ISBN: 978-1-872639-69-7
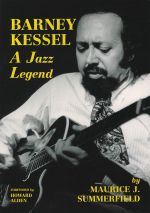 Mit 12 Jahren faszinierte Barney Kessel die Gitarre im Fenster eines Musikgeschäfts in Muskogee, Oklahoma, so sehr, dass er sich das Instrument vom selbstverdienten Geld kaufte, obwohl sein Vater etwas dagegen hatte, weil Gitarre seiner Ansicht nach nur Bettler spielten. Er machte auf dem Instrument allerdings schnell solche Fortschritte, dass seine Mutter ihm 1939 eine elektrische Gitarre mit Verstärker kaufte. Er kaufte sich all die neuesten Platten Charlie Christians, und als der sich 1940 in Oklahoma City aufhielt, verbrachte Barney drei Tage mit seinem Idol, spielte mit ihm und ließ sich Tricks beibringen. 1942 zog es den 19-jährigen nach Los Angeles und wurde bald Gitarrist des Orchesters von Chico Marx, geleitet von Ben Pollack. Er teilte das Zimmer auf Tourneen meist mit Mel Torme, der nicht nur für die Band sang, sondern ab und zu auch Schlagzeug spielte. 1944 spielte er mit Charlie Barnet und machte 1945 seine erste Platte unter eigenem Namen. 1947 spielte er sowohl mit Benny Goodman wie auch mit den Charlie Parker All Stars. Ende der 1940er Jahre dann als Studiomusiker für Capitol Records in Hollywood, eine Funktion, in der er Jazz- genauso wie andere Stars begleitete, darunter auch Marlene Dietrich, Doris Day oder Maurice Chevalier. 1952 bat Norman Granz ihn, beim (klassischen) Oscar Peterson Trio mitzumachen; ansonsten wirkte er in den 50er Jahren bei vielen Alben für das Label Contemporary mit, die teilweise auch unter seinem Namen erschienen. Summerfield beschreibt Kessels Arbeit als Studiomusiker. Ende der 60er Jahre lebte Kessel eine Weile in London und kehrte in der Folge immer wieder zu Tourneen nach Europa zurück. 1974 trat er erstmals mit Charly Byrd und Herb Ellis in der Band “The Great Guitars” auf, die in wechselnden Besetzungen bis in die 190er Jahre bestand. Im Alter von 68 Jahren erlitt Kessel im Mai 1962 einen Schlaganfall, nach dem er nicht mehr Gitarre spielen konnte. 2004 starb er an den Folgen eines Gehirntumors. Summerfields Buch zeichnet Kessels Lebensgeschichte nüchtern nach, mit vielen Daten und Fakten sowie etlichen Interviewauszügen. Ein eigenes umfangreiches Kapitel ist seinen Gitarren und seiner Ausrüstung gewidmet. “Thoughts on Music & Life” ist ein Kapitel überschrieben, das Interviewausschnitte des Gitarristen sammelt. In einer Fotogalerie finden sich unzählige seltene Fotos, einschließlich seiner Geburts- und Todesurkunden. Schließlich enthält das Buch eine 150 Seiten umfassende Diskographie des Gitarristen. Für Kessel-Fans ein Muss, das in seinen biographischen Kapiteln vielleicht manchmal etwas trocken zu lesen ist, aber durch die vielen Einsprengsel von Auszügen aus Interviews genügend Stoff enthält, um ein umfassendes Bild des Wirkens von Barney Kessel geben zu können.
Mit 12 Jahren faszinierte Barney Kessel die Gitarre im Fenster eines Musikgeschäfts in Muskogee, Oklahoma, so sehr, dass er sich das Instrument vom selbstverdienten Geld kaufte, obwohl sein Vater etwas dagegen hatte, weil Gitarre seiner Ansicht nach nur Bettler spielten. Er machte auf dem Instrument allerdings schnell solche Fortschritte, dass seine Mutter ihm 1939 eine elektrische Gitarre mit Verstärker kaufte. Er kaufte sich all die neuesten Platten Charlie Christians, und als der sich 1940 in Oklahoma City aufhielt, verbrachte Barney drei Tage mit seinem Idol, spielte mit ihm und ließ sich Tricks beibringen. 1942 zog es den 19-jährigen nach Los Angeles und wurde bald Gitarrist des Orchesters von Chico Marx, geleitet von Ben Pollack. Er teilte das Zimmer auf Tourneen meist mit Mel Torme, der nicht nur für die Band sang, sondern ab und zu auch Schlagzeug spielte. 1944 spielte er mit Charlie Barnet und machte 1945 seine erste Platte unter eigenem Namen. 1947 spielte er sowohl mit Benny Goodman wie auch mit den Charlie Parker All Stars. Ende der 1940er Jahre dann als Studiomusiker für Capitol Records in Hollywood, eine Funktion, in der er Jazz- genauso wie andere Stars begleitete, darunter auch Marlene Dietrich, Doris Day oder Maurice Chevalier. 1952 bat Norman Granz ihn, beim (klassischen) Oscar Peterson Trio mitzumachen; ansonsten wirkte er in den 50er Jahren bei vielen Alben für das Label Contemporary mit, die teilweise auch unter seinem Namen erschienen. Summerfield beschreibt Kessels Arbeit als Studiomusiker. Ende der 60er Jahre lebte Kessel eine Weile in London und kehrte in der Folge immer wieder zu Tourneen nach Europa zurück. 1974 trat er erstmals mit Charly Byrd und Herb Ellis in der Band “The Great Guitars” auf, die in wechselnden Besetzungen bis in die 190er Jahre bestand. Im Alter von 68 Jahren erlitt Kessel im Mai 1962 einen Schlaganfall, nach dem er nicht mehr Gitarre spielen konnte. 2004 starb er an den Folgen eines Gehirntumors. Summerfields Buch zeichnet Kessels Lebensgeschichte nüchtern nach, mit vielen Daten und Fakten sowie etlichen Interviewauszügen. Ein eigenes umfangreiches Kapitel ist seinen Gitarren und seiner Ausrüstung gewidmet. “Thoughts on Music & Life” ist ein Kapitel überschrieben, das Interviewausschnitte des Gitarristen sammelt. In einer Fotogalerie finden sich unzählige seltene Fotos, einschließlich seiner Geburts- und Todesurkunden. Schließlich enthält das Buch eine 150 Seiten umfassende Diskographie des Gitarristen. Für Kessel-Fans ein Muss, das in seinen biographischen Kapiteln vielleicht manchmal etwas trocken zu lesen ist, aber durch die vielen Einsprengsel von Auszügen aus Interviews genügend Stoff enthält, um ein umfassendes Bild des Wirkens von Barney Kessel geben zu können.
(Wolfram Knauer, Januar 2010)
The World That Made New Orleans. From Spanish Silver to Congo Square
von Ned Sublette
Chicago 2008 (Lawrence Hill Books)
360 Seiten
ISBN: 978-1-55652-730-2
 New Orleans hat viele Geschichten. Da ist die Geschichte der nördlichsten Stadt der Karibik, die Geschichte der französischen Kolonie, die Geschichte einer gut funktionierenden Vielvölkerstadt, die Geschichte der Sklaverei, die Geschichte der Hafenstadt mit allen dazugehörigen Subgeschichten, von Schifffahrt bis Prostitution, und natürlich die Geschichte der Musik, von Oper, Gesangsvereinen, Marschkapellen, Ragtime und Jazz. Ned Sublette zeichnet in seinem Buch die Frühgeschichte der Stadt nach, von den Anfängen als französische Siedlung bis etwa 1820, als die Stadt mit ihren unterschiedlichen Traditionen fest in die Vereinigten Staaten von Amerika eingemeindet worden war. Ihm geht es um kulturelle Einflüsse, die sich nicht nur in der Musik niederschlagen (die allerdings immer wieder ausgiebig Erwähnung findet), sondern auch in Sitten und Gebräuchen, im Lebensgefühl der Menschen und auch in politischen Entscheidungen, die die Crescent City bis heute wie eine so gar nicht wirklich amerikanische Stadt erscheinen lassen. Straßennamen in New Orleans erzählen die Geschichte der Stadt, erklärt Sublette, Straßen, die nach Generälen und Präsidenten benannt seien, nach “Mystery”, “Music” und “Pleasure”. Sublette recherchiert die Geschichte der Stadt als Historiker, aber er erzählt sie als ein kritischer Geist von heute, verbindet die geschichtlichen Erkenntnisse immer mit den Erfahrungen der Gegenwart. Reisende hätten sich immer schon gewundert, wie man eine Stadt auf so unfestem Grund bauen könne, berichtet er. 1492 entdeckte Kolumbus teile Amerikas, und im 16. Jahrhundert kolonialisierten die Spanier viele Gebiete der Karibik. Sublette erzählt die Geschichte des Wettstreits der europäischen Mächte um die Kolonien in der Neuen Welt, insbesondere die wechselnden Erfolge der Spanier, der Briten und der Franzosen, und wie aus dieser Konkurrenz heraus der französische Gesandte Pierre Le Moyne, Sieur d’Iberville, verschiedene Posten nahe der Mississippi-Mündung gründete, bevor er in den frühen Jahren des 18. Jahrhunderts eine Siedlung gründete, die gegen 1718, dem Herzog zu Orléans zu Ehren, Nouvelle Orléans genannt wurde. Sublette beschreibt die wirtschaftliche Entwicklung der frühen französischen Siedlung und ihre politische Stellung, die etwa der “Sibiriens im 20. Jahrhunderts” glich. Er beschreibt, wie man versuchte neue Einwohner auch aus anderen Ländern als Frankreich anzuwerben, Deutsche beispielsweise, und wie dann, bereits ab 1719, der Sklavenhandel aufblühte. Man liest, woher die Sklaven anfangs kamen und welche Akkulturationsprozesse sie in der neuen Heimat durchmachten (durchmachen mussten). 1762 schenkte Louis XV Louisiana an seinen Cousin Carlos III von Spanien. Die Spanier führten neue Gesetze ein, die auch die Sklaven betrafen und weniger streng waren als der französische Code Noir. Schon damals hatte New Orleans ein ausgeprägtes Nachtleben und Bedarf an Musik. Sublette schreibt in diesem Zusammenhang auch über die Bedeutung des Congo Square, die noch auf französische Zeiten zurückging, über die Tänze der Schwarzen dort, die nicht nur von Durchreisenden wahrgenommen wurden, sondern auch von der spanischen Regierung geregelt wurden — übrigens unter dem Namen “tangos”; Grund genug, kurz auf die Verbindungen zwischen Habanera- und Tangorhythmen in der Karibik und New Orleans einzugehen, Louis Moreau Gottschalk, Jelly Roll Morton, W.C. Handy und den Spanish Tinge zu erwähnen, der bis heute in der Stadt eine wichtige Rolle spielt. Am Karfreitag 1788 fing ein Altar auf der Chartres Street Feuer und setzte nach und nach die ganze Stadt in Brand. Ihr Wiederaufbau geriet im spanischen Kolonialstil, der bis heute das Straßenbild der Stadt, auch ihres paradoxerweise als “French Quarter” bezeichneten berühmtesten Stadtteils, prägt. Sublette beschreibt die Sklavenrevolten in dem unter französischer Herrschaft stehenden Santo Domingo, die Auswirkungen auf New Orleans hatten, weil viele der ehemaligen Sklaven dorthin flohen, als nach der Französischen Revolution die Sklaverei in der gesamten französischen Einflusssphäre abgeschafftt wurde. Mit den vielen freien Schwarzen aus Santo Domingo kam auch die revolutionäre Idee von Freiheit für alle Sklaven in die Stadt. Die Französen wollten ihre ehemalige Kolonie zurück, und Napoleon Bonaparte bestand 1802 darauf, Louisiana wieder als französisches Gebiet zu akquirieren. Ein Jahr später allerdings bot er das ganze Land Louisiana bereits wieder dem amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson für 60 Millionen Francs zum Kauf an. Die USA mussten nun mit der Tatsache umgehen, dass aus historischen Gründen in Louisiana Schwarze verschiedener sozialer Klassen existierten: frisch “importierte” Sklaven, in Amerika geborene und bereits teilweise akkulturierte Sklaven sowie freie Schwarze insbesondere aus Santo Domingo. Sublette diskutiert kurz die Haltung des Präsidenten zur schwarzen Bevölkerung seines Landes — er war ein strikter Verfechter der Sklaverei, sah Sklaven als frei verfügbares Kapital, besaß selbst über die Zeit seines Lebens mehr als sechshundert Sklavenund hatte zugleich ein enges Verhältnis zu einer seiner Sklavinnen. Ihm war zugleich bewusst, dass die Tage der Sklaverei gezählt waren und eine kluge Regierung Gesetze in Angriff nehmen musste, um die Zeit danach vorzubereiten. Unter Jeffersons Regierung allerdings wurde New Orleans erst einmal zum größten Sklavenmarkt der Vereinigten Staaten. Sublette beschreibt, wie Sklaven für die weiße Bevölkerung sozialen Status bedeuteten und wie Louisiana nachgerade die “Züchtung” neuer Sklaven unterstützte. In New Orleans durchdrangen sich inzwischen die verschiedenen kulturellen Traditionen, insbesondere der französischen und britischen Bevölkerung. Es gab Bälle zuhauf; 1805 wurde die erste Oper in der Stadt aufgeführt; es gab zwei Theater und daneben ein lebendiges afro-amerikanisches religiöses Leben. Die schwarze Bevölkerung der Stadt war größer als die weiße, aber nach und nach wurden die neuen Gesetze der Vereinigten Staaten durchgesetzt, die weitaus strenger durchgriffen und insbesondere viele der freien Schwazen ihrer zuvor zugestandenen Rechte beraubten. 1809 erklärte Kuba sich solidarisch mit dem spanischen König, der gerade Frankreich den Krieg erklärt hatte. Kuba wies alle Franzosen aus, zählte dazu aber grundsätzlich all jene, die keinen Eid auf Spanien geschworen hatten, also auch viele der zuvor aus Santo Domingo nach Kuba gekommenen Schwarzen, die in der Folge vor allem nach New Orleans flüchteten. Diese meist französisch sprechenden Einwanderer wurden bald ein wichtiger Teil der Gesellschaft, politische Bürger mit Einfluss, Zeitungsverleger, Anwälte und Kaufleute. Hier nun ended Sublettes Geschichte, noch lang vor der Abschaffung der Sklaverei also, lang vor den musikalischen Auswirkungen, die der Melting Pot New Orleans im Jazz des 20sten Jahrhunderts zeitigen sollte. Doch Musik spielt überall in seinem Buch eine wichtige Rolle, und die Art, wie er historische Entwicklungen, ihre Auswirkungen auf die Menschen mit verschiedenem sozialen Status und letzten Endes auf den Lauf der Dinge bis heute schildert, erklärt viel auch über das Faszinosum des Jazz in späteren Jahren. Macht und vielfache Machtwechsel, Akkulturation auf verschiedenen Ebenen und die kulturelle Vermischung, die bei alledem zwangsweise geschah, sind die bunte kulturelle Mischung, die so großen Einfluss auf die afro-amerikanische Musik des 20sten Jahrhunderts haben sollte. Sublettes Buch ist dabei kenntnisreich und spannend geschrieben, erklärt Zusammenhänge und lässt nie die persönliche Betroffenheit außer Acht, auch die persönliche Betroffenheit des Autors, der in seiner Erzählung immer wieder auf eigene Vorfahren trifft.
New Orleans hat viele Geschichten. Da ist die Geschichte der nördlichsten Stadt der Karibik, die Geschichte der französischen Kolonie, die Geschichte einer gut funktionierenden Vielvölkerstadt, die Geschichte der Sklaverei, die Geschichte der Hafenstadt mit allen dazugehörigen Subgeschichten, von Schifffahrt bis Prostitution, und natürlich die Geschichte der Musik, von Oper, Gesangsvereinen, Marschkapellen, Ragtime und Jazz. Ned Sublette zeichnet in seinem Buch die Frühgeschichte der Stadt nach, von den Anfängen als französische Siedlung bis etwa 1820, als die Stadt mit ihren unterschiedlichen Traditionen fest in die Vereinigten Staaten von Amerika eingemeindet worden war. Ihm geht es um kulturelle Einflüsse, die sich nicht nur in der Musik niederschlagen (die allerdings immer wieder ausgiebig Erwähnung findet), sondern auch in Sitten und Gebräuchen, im Lebensgefühl der Menschen und auch in politischen Entscheidungen, die die Crescent City bis heute wie eine so gar nicht wirklich amerikanische Stadt erscheinen lassen. Straßennamen in New Orleans erzählen die Geschichte der Stadt, erklärt Sublette, Straßen, die nach Generälen und Präsidenten benannt seien, nach “Mystery”, “Music” und “Pleasure”. Sublette recherchiert die Geschichte der Stadt als Historiker, aber er erzählt sie als ein kritischer Geist von heute, verbindet die geschichtlichen Erkenntnisse immer mit den Erfahrungen der Gegenwart. Reisende hätten sich immer schon gewundert, wie man eine Stadt auf so unfestem Grund bauen könne, berichtet er. 1492 entdeckte Kolumbus teile Amerikas, und im 16. Jahrhundert kolonialisierten die Spanier viele Gebiete der Karibik. Sublette erzählt die Geschichte des Wettstreits der europäischen Mächte um die Kolonien in der Neuen Welt, insbesondere die wechselnden Erfolge der Spanier, der Briten und der Franzosen, und wie aus dieser Konkurrenz heraus der französische Gesandte Pierre Le Moyne, Sieur d’Iberville, verschiedene Posten nahe der Mississippi-Mündung gründete, bevor er in den frühen Jahren des 18. Jahrhunderts eine Siedlung gründete, die gegen 1718, dem Herzog zu Orléans zu Ehren, Nouvelle Orléans genannt wurde. Sublette beschreibt die wirtschaftliche Entwicklung der frühen französischen Siedlung und ihre politische Stellung, die etwa der “Sibiriens im 20. Jahrhunderts” glich. Er beschreibt, wie man versuchte neue Einwohner auch aus anderen Ländern als Frankreich anzuwerben, Deutsche beispielsweise, und wie dann, bereits ab 1719, der Sklavenhandel aufblühte. Man liest, woher die Sklaven anfangs kamen und welche Akkulturationsprozesse sie in der neuen Heimat durchmachten (durchmachen mussten). 1762 schenkte Louis XV Louisiana an seinen Cousin Carlos III von Spanien. Die Spanier führten neue Gesetze ein, die auch die Sklaven betrafen und weniger streng waren als der französische Code Noir. Schon damals hatte New Orleans ein ausgeprägtes Nachtleben und Bedarf an Musik. Sublette schreibt in diesem Zusammenhang auch über die Bedeutung des Congo Square, die noch auf französische Zeiten zurückging, über die Tänze der Schwarzen dort, die nicht nur von Durchreisenden wahrgenommen wurden, sondern auch von der spanischen Regierung geregelt wurden — übrigens unter dem Namen “tangos”; Grund genug, kurz auf die Verbindungen zwischen Habanera- und Tangorhythmen in der Karibik und New Orleans einzugehen, Louis Moreau Gottschalk, Jelly Roll Morton, W.C. Handy und den Spanish Tinge zu erwähnen, der bis heute in der Stadt eine wichtige Rolle spielt. Am Karfreitag 1788 fing ein Altar auf der Chartres Street Feuer und setzte nach und nach die ganze Stadt in Brand. Ihr Wiederaufbau geriet im spanischen Kolonialstil, der bis heute das Straßenbild der Stadt, auch ihres paradoxerweise als “French Quarter” bezeichneten berühmtesten Stadtteils, prägt. Sublette beschreibt die Sklavenrevolten in dem unter französischer Herrschaft stehenden Santo Domingo, die Auswirkungen auf New Orleans hatten, weil viele der ehemaligen Sklaven dorthin flohen, als nach der Französischen Revolution die Sklaverei in der gesamten französischen Einflusssphäre abgeschafftt wurde. Mit den vielen freien Schwarzen aus Santo Domingo kam auch die revolutionäre Idee von Freiheit für alle Sklaven in die Stadt. Die Französen wollten ihre ehemalige Kolonie zurück, und Napoleon Bonaparte bestand 1802 darauf, Louisiana wieder als französisches Gebiet zu akquirieren. Ein Jahr später allerdings bot er das ganze Land Louisiana bereits wieder dem amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson für 60 Millionen Francs zum Kauf an. Die USA mussten nun mit der Tatsache umgehen, dass aus historischen Gründen in Louisiana Schwarze verschiedener sozialer Klassen existierten: frisch “importierte” Sklaven, in Amerika geborene und bereits teilweise akkulturierte Sklaven sowie freie Schwarze insbesondere aus Santo Domingo. Sublette diskutiert kurz die Haltung des Präsidenten zur schwarzen Bevölkerung seines Landes — er war ein strikter Verfechter der Sklaverei, sah Sklaven als frei verfügbares Kapital, besaß selbst über die Zeit seines Lebens mehr als sechshundert Sklavenund hatte zugleich ein enges Verhältnis zu einer seiner Sklavinnen. Ihm war zugleich bewusst, dass die Tage der Sklaverei gezählt waren und eine kluge Regierung Gesetze in Angriff nehmen musste, um die Zeit danach vorzubereiten. Unter Jeffersons Regierung allerdings wurde New Orleans erst einmal zum größten Sklavenmarkt der Vereinigten Staaten. Sublette beschreibt, wie Sklaven für die weiße Bevölkerung sozialen Status bedeuteten und wie Louisiana nachgerade die “Züchtung” neuer Sklaven unterstützte. In New Orleans durchdrangen sich inzwischen die verschiedenen kulturellen Traditionen, insbesondere der französischen und britischen Bevölkerung. Es gab Bälle zuhauf; 1805 wurde die erste Oper in der Stadt aufgeführt; es gab zwei Theater und daneben ein lebendiges afro-amerikanisches religiöses Leben. Die schwarze Bevölkerung der Stadt war größer als die weiße, aber nach und nach wurden die neuen Gesetze der Vereinigten Staaten durchgesetzt, die weitaus strenger durchgriffen und insbesondere viele der freien Schwazen ihrer zuvor zugestandenen Rechte beraubten. 1809 erklärte Kuba sich solidarisch mit dem spanischen König, der gerade Frankreich den Krieg erklärt hatte. Kuba wies alle Franzosen aus, zählte dazu aber grundsätzlich all jene, die keinen Eid auf Spanien geschworen hatten, also auch viele der zuvor aus Santo Domingo nach Kuba gekommenen Schwarzen, die in der Folge vor allem nach New Orleans flüchteten. Diese meist französisch sprechenden Einwanderer wurden bald ein wichtiger Teil der Gesellschaft, politische Bürger mit Einfluss, Zeitungsverleger, Anwälte und Kaufleute. Hier nun ended Sublettes Geschichte, noch lang vor der Abschaffung der Sklaverei also, lang vor den musikalischen Auswirkungen, die der Melting Pot New Orleans im Jazz des 20sten Jahrhunderts zeitigen sollte. Doch Musik spielt überall in seinem Buch eine wichtige Rolle, und die Art, wie er historische Entwicklungen, ihre Auswirkungen auf die Menschen mit verschiedenem sozialen Status und letzten Endes auf den Lauf der Dinge bis heute schildert, erklärt viel auch über das Faszinosum des Jazz in späteren Jahren. Macht und vielfache Machtwechsel, Akkulturation auf verschiedenen Ebenen und die kulturelle Vermischung, die bei alledem zwangsweise geschah, sind die bunte kulturelle Mischung, die so großen Einfluss auf die afro-amerikanische Musik des 20sten Jahrhunderts haben sollte. Sublettes Buch ist dabei kenntnisreich und spannend geschrieben, erklärt Zusammenhänge und lässt nie die persönliche Betroffenheit außer Acht, auch die persönliche Betroffenheit des Autors, der in seiner Erzählung immer wieder auf eigene Vorfahren trifft.
(Wolfram Knauer)
60 ans de Jazz au Caveau de la Huchette
von Dany Doriz & Christian Mars
Paris 2008
l’Archipel
160 Seiten, 29,95 Euro
ISBN 978-2-8098-0033-3
 Die Caveau de la Huchette feierte 2006 seinen 60sten Geburtstag, und sie ist bis heute ein Unikum geblieben: einer jener Pariser Keller, in denen der Jazz zum Mittelpunkt der Existentialistenkultur wurde, mit Blues, Boogie und Tanz eine nächtliche Alternative zu den sonstigen Treffpunkten der Intellektuellen und Möchtegernintellektuellen darstellte. Wer nie in der Caveau de la Huchette gewesen ist, sollte dies nachholen, denn noch heute wird der Jazz dort auf jenes motorische Element zurückgeholt, aus dem er letzten Endes mit entstanden ist. Der Vibraphonist Dany Doriz hat oft genug im Club gespielt und jetzt zusammen mit dem Journalisten Christian Mars eine Dokumentation über die Geschichte des Clubs und seiner Atmosphäre vorgelegt. Jede Menge historische Fotos zeigen den Raum und die unterschiedlichen Acts, die über die Jahrzehnte dort auftraten. Neben den Jazzmusikern waren das durchaus auch mal Magier, die Tauben aus einer Cloche zauberten. Die Tänzer aber sind es vor allem, die neben den Musikern den Keller in der Rue de la Huchette beherrschten. Lindy Hop, R&B, Rock ‘n’ Roll, irgendwie ähnelten sich die Tänze, und neben den Paartänzen gab es auch Gruppentänze und Stepptanz. Die Musiker sind reichlich dokumentiert in Fotos und Geschichten, Boris Vian etwa oder Claude Luter, der mit seinen Lorientais hier und anderswo im Viertel zuhause war; Sidney Bechet, der in den 1950er Jahren als großer Star in Frankreich lebte; Claude Bolling, Maxim Saury, Raymon Fonsèque, Irakli und viele andere Musiker und Bands, für die die Caveau ein zweites Zuhause war. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit dem Streit zwischen Traditionalisten und Modernisten. Natürlich erzählt auch Dany Doriz seine Geschichte; und auch die oft in der Caveau auftretenden Amerikaner kommen nicht zu kurz: Bill Coleman, Hal Singer, Benny Waters, Memphis Slim, Sam Woodyard, Milt Buckner, Art Blakey, Wild Bill Davis, Al Grey, Cat Anderson sowie Doriz’s Vorbild, der große Lionel Hampton, der 1976, zum 30sten Geburtstag des Clubs, zugegen war. Das Buch ist voller schöner und seltener Fotos, denen es gelingt die Atmosphäre im Kellergewölbe von Saint Germain-des-Pres widerzugeben. Am Schluss gibt es eine Programmliste der zwischen 1971 und 2007 im Club aufgetretenen Künstler. Ein schönes Andenken für jeden, der die Caveau schon einmal besucht hat — und für alle anderen eine Anregung, wenn auch spät, so wenigstens jetzt noch einmal in die Keller der Existentialisten abzutauchen.
Die Caveau de la Huchette feierte 2006 seinen 60sten Geburtstag, und sie ist bis heute ein Unikum geblieben: einer jener Pariser Keller, in denen der Jazz zum Mittelpunkt der Existentialistenkultur wurde, mit Blues, Boogie und Tanz eine nächtliche Alternative zu den sonstigen Treffpunkten der Intellektuellen und Möchtegernintellektuellen darstellte. Wer nie in der Caveau de la Huchette gewesen ist, sollte dies nachholen, denn noch heute wird der Jazz dort auf jenes motorische Element zurückgeholt, aus dem er letzten Endes mit entstanden ist. Der Vibraphonist Dany Doriz hat oft genug im Club gespielt und jetzt zusammen mit dem Journalisten Christian Mars eine Dokumentation über die Geschichte des Clubs und seiner Atmosphäre vorgelegt. Jede Menge historische Fotos zeigen den Raum und die unterschiedlichen Acts, die über die Jahrzehnte dort auftraten. Neben den Jazzmusikern waren das durchaus auch mal Magier, die Tauben aus einer Cloche zauberten. Die Tänzer aber sind es vor allem, die neben den Musikern den Keller in der Rue de la Huchette beherrschten. Lindy Hop, R&B, Rock ‘n’ Roll, irgendwie ähnelten sich die Tänze, und neben den Paartänzen gab es auch Gruppentänze und Stepptanz. Die Musiker sind reichlich dokumentiert in Fotos und Geschichten, Boris Vian etwa oder Claude Luter, der mit seinen Lorientais hier und anderswo im Viertel zuhause war; Sidney Bechet, der in den 1950er Jahren als großer Star in Frankreich lebte; Claude Bolling, Maxim Saury, Raymon Fonsèque, Irakli und viele andere Musiker und Bands, für die die Caveau ein zweites Zuhause war. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit dem Streit zwischen Traditionalisten und Modernisten. Natürlich erzählt auch Dany Doriz seine Geschichte; und auch die oft in der Caveau auftretenden Amerikaner kommen nicht zu kurz: Bill Coleman, Hal Singer, Benny Waters, Memphis Slim, Sam Woodyard, Milt Buckner, Art Blakey, Wild Bill Davis, Al Grey, Cat Anderson sowie Doriz’s Vorbild, der große Lionel Hampton, der 1976, zum 30sten Geburtstag des Clubs, zugegen war. Das Buch ist voller schöner und seltener Fotos, denen es gelingt die Atmosphäre im Kellergewölbe von Saint Germain-des-Pres widerzugeben. Am Schluss gibt es eine Programmliste der zwischen 1971 und 2007 im Club aufgetretenen Künstler. Ein schönes Andenken für jeden, der die Caveau schon einmal besucht hat — und für alle anderen eine Anregung, wenn auch spät, so wenigstens jetzt noch einmal in die Keller der Existentialisten abzutauchen.
(Wolfram Knauer)
Ben van Melick
Han Bennink. Cover Art for ICP and other labels
Rimburg/Niederlande 2008
Uitgeverij Huis Clos
64 Seiten, 15 Euro
ISBN: 90-1234-4568-9
 Erstaunlich viele Schlagzeuger besitzen eine zweite künstlerische Ader als Maler — George Wettling, Daniel Humair, Joe Hackbarth, Ralf Hübner, Tony Oxley, Vladimir Tarasov sind bekannte Beispiele, aber auch der Niederländer Han Bennink gehört in diese Riege. Seine Cover Art prangt auf vielen Schallplattencovern für seine eigenen Projekte genauso wie für befreundete Musiker. Ben van Melick hat in diesem kleinen Büchlein die graphischen Ideen des Schlagzeugers für das ICP Label der Instant Composers Collective sowie für andere Labels gesammelt. In seinem Vorwort beschreibt van Melick biographische Stationen Benninks, der Grafik studiert und schon früh Bildende Kunst und Musik in seinen Performances gemischt habe, etwa bei einer Galerieeröffnung im Jahr 1966. Er habe sich dann lange Jahre vor allem um die Musik gekümmert und erst in den 1980er Jahren wieder verstärkt auch der visuellen Kunst zugewandt. Die Cover, die in dem Büchlein abgedruckt sind stammen aus den Jahren 1967 bis 2008. Witz, das Spiel mit der Irritation, künstlerische Rätsel und Vexierspiele finden sich darunter und erinnern im Charakter an den Schlagzeuger, der sein Publikum genauo gern in die Irre führt, bei dem oft scheinbar rein zufällige Gesten sich im Höreindruck als komplexe musikalische Statements entpuppen. Da bringt er Bilder aus einem Kindermalbuch in seltsam anmutende Bezüge zueinander, da arbeitet er mit Fotos und Collagen, mit Text und der Anordnung von Text (etwa dem rhythmischen Verteilen der Besetzungsnamen auf dem Plattencover). Collageartig zusammengeklebte Schreibmaschinentexte finden sich genauso wie kalligraphisch gestaltete Texte. Eine Schiedsrichterpfeife taucht öfters auf, und das “o” im letzen Wort des Albums “Bospaadje konijnehol” (Forest path rabbit hole) hat er im Original mit einem echten Hasenkötel markiert. Während anfangs Schwarz-Weiß-Cover überwiegen (sicher auch aus Kostengründen; die Auflage der Platten war gewiss nicht allzu hoch), finden sich spätestens ab dem neuen Jahrtausend Farbnuancen, die den Bildern noch mehr Tiefe und oft auch Doppeldeutigkeit verleihen. Immer wieder spielt Bennink dabei auch mit Selbstzitaten, erkennt man Elemente früherer Covergestaltungen wieder, ob dies nun konkrete Motive sind oder Gestaltungsmethoden. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass zwischen Bennink, dem Künstler, und Bennink, dem Musiker, gar kein so großer Unterschied besteht, dass die ästhetische Grundhaltung der hintersinnigen Umdeutung des Alltäglichen bei beiden eine ideelle Grundhaltung ist.
Erstaunlich viele Schlagzeuger besitzen eine zweite künstlerische Ader als Maler — George Wettling, Daniel Humair, Joe Hackbarth, Ralf Hübner, Tony Oxley, Vladimir Tarasov sind bekannte Beispiele, aber auch der Niederländer Han Bennink gehört in diese Riege. Seine Cover Art prangt auf vielen Schallplattencovern für seine eigenen Projekte genauso wie für befreundete Musiker. Ben van Melick hat in diesem kleinen Büchlein die graphischen Ideen des Schlagzeugers für das ICP Label der Instant Composers Collective sowie für andere Labels gesammelt. In seinem Vorwort beschreibt van Melick biographische Stationen Benninks, der Grafik studiert und schon früh Bildende Kunst und Musik in seinen Performances gemischt habe, etwa bei einer Galerieeröffnung im Jahr 1966. Er habe sich dann lange Jahre vor allem um die Musik gekümmert und erst in den 1980er Jahren wieder verstärkt auch der visuellen Kunst zugewandt. Die Cover, die in dem Büchlein abgedruckt sind stammen aus den Jahren 1967 bis 2008. Witz, das Spiel mit der Irritation, künstlerische Rätsel und Vexierspiele finden sich darunter und erinnern im Charakter an den Schlagzeuger, der sein Publikum genauo gern in die Irre führt, bei dem oft scheinbar rein zufällige Gesten sich im Höreindruck als komplexe musikalische Statements entpuppen. Da bringt er Bilder aus einem Kindermalbuch in seltsam anmutende Bezüge zueinander, da arbeitet er mit Fotos und Collagen, mit Text und der Anordnung von Text (etwa dem rhythmischen Verteilen der Besetzungsnamen auf dem Plattencover). Collageartig zusammengeklebte Schreibmaschinentexte finden sich genauso wie kalligraphisch gestaltete Texte. Eine Schiedsrichterpfeife taucht öfters auf, und das “o” im letzen Wort des Albums “Bospaadje konijnehol” (Forest path rabbit hole) hat er im Original mit einem echten Hasenkötel markiert. Während anfangs Schwarz-Weiß-Cover überwiegen (sicher auch aus Kostengründen; die Auflage der Platten war gewiss nicht allzu hoch), finden sich spätestens ab dem neuen Jahrtausend Farbnuancen, die den Bildern noch mehr Tiefe und oft auch Doppeldeutigkeit verleihen. Immer wieder spielt Bennink dabei auch mit Selbstzitaten, erkennt man Elemente früherer Covergestaltungen wieder, ob dies nun konkrete Motive sind oder Gestaltungsmethoden. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass zwischen Bennink, dem Künstler, und Bennink, dem Musiker, gar kein so großer Unterschied besteht, dass die ästhetische Grundhaltung der hintersinnigen Umdeutung des Alltäglichen bei beiden eine ideelle Grundhaltung ist.
(Wolfram Knauer)
Michel Prodeau
La Musique de Don Ellis
Montalzat 2008
Éditions Boutik Pro
199 Seiten, 16 Euro
ISBN: 978-2-9532237-0-5
 Der Trompeter Don Ellis hatte eine kurze, aber einflussreiche Karriere. Nur 20 Jahre dokumentieren Plattenaufnahmen den 1978 im Alter von gerade mal 44 Jahren verstorbenen Musiker, der immer mit zu den Experimentierern seines Metiers gehörte: ob mit ungeraden Metren, Zwölftonskalen, ethnischen Einflüssen aus indischer Musik oder solcher aus dem Balkan, elektronischer Klängen, dem Zusammenkommen von Jazz, Rock und Pop. Michel Prodeau versucht in seinem Buch eine Annäherung an den 1934 in Los Angeles geborenen Trompeter. Ihn interessieren dabei weniger biographische Details als vielmehr vor allem die auf Schallplatte dokumentierten Aufnahmen. Er erwähnt den Einfluss des Pianisten und Komponisten George Russell oder jenen der Third-Stream-Bewegung der 1950er und 1960er Jahre, die Experimente mit großem Orchester, neuen klanglichen wie metrischen Möglichkeiten, sein allgemeines Interesse am, Sprengen der Genregrenzen. Das Buch hangelt sich dabei von Album zu Album und wirkt damit wie eine gut kommentierte Diskographie, nennt Details der Kompositionsstrategien und Besonderheiten der Aufnahmesituationen, zieht allerdings nur wenig Querverweise und reicht auch in den angedeuteten Analysen nur selten über das hinaus, was auf den Platten zu hören und in den Plattentexten (in anderen Worten) nachzulesen wäre. Da merkt man dann Füllabsätze, etwa, wenn Prodeau sämtliche Aufführungsorte des Dokumentarfilms “Electric Heart, Don Ellis” auflistet und bleibt etwas enttäuscht zurück, dass die Aufzählung von namen im Text nicht mit Inhalt gefüllt wird, es also nicht nur wichtig ist, mit wem Ellis oder seine Mitmusiker zusammengespielt haben, sondern viel eher, welche musikalischen Erfahrungen sich mit solchen biographischen Details verbinden, die wiederum auf die Musik Ellis’ Einfluss haben. Eine Diskographie schließt das Buch ab; ein gerade in einer solch personen- und titelbetonten Monographie besonders nützlicher Namens- oder Titelindex fehlt leider. Auch in der Bibliographie fehlen Hinweise auf mehrere fachkundige amerikanische Dissertationen, die sich insbesondere mit Ellis’ metrisch-rhythmischen Experimenten, aber auch mit seinen weltmusikalischen Ansätzen und seiner Interpretation des Blues auseinandergesetzt haben. Prodeaus Buch ist allerdings zur Zeit die einzige auf dem Markt befindliche Monographie über den Trompeter.
Der Trompeter Don Ellis hatte eine kurze, aber einflussreiche Karriere. Nur 20 Jahre dokumentieren Plattenaufnahmen den 1978 im Alter von gerade mal 44 Jahren verstorbenen Musiker, der immer mit zu den Experimentierern seines Metiers gehörte: ob mit ungeraden Metren, Zwölftonskalen, ethnischen Einflüssen aus indischer Musik oder solcher aus dem Balkan, elektronischer Klängen, dem Zusammenkommen von Jazz, Rock und Pop. Michel Prodeau versucht in seinem Buch eine Annäherung an den 1934 in Los Angeles geborenen Trompeter. Ihn interessieren dabei weniger biographische Details als vielmehr vor allem die auf Schallplatte dokumentierten Aufnahmen. Er erwähnt den Einfluss des Pianisten und Komponisten George Russell oder jenen der Third-Stream-Bewegung der 1950er und 1960er Jahre, die Experimente mit großem Orchester, neuen klanglichen wie metrischen Möglichkeiten, sein allgemeines Interesse am, Sprengen der Genregrenzen. Das Buch hangelt sich dabei von Album zu Album und wirkt damit wie eine gut kommentierte Diskographie, nennt Details der Kompositionsstrategien und Besonderheiten der Aufnahmesituationen, zieht allerdings nur wenig Querverweise und reicht auch in den angedeuteten Analysen nur selten über das hinaus, was auf den Platten zu hören und in den Plattentexten (in anderen Worten) nachzulesen wäre. Da merkt man dann Füllabsätze, etwa, wenn Prodeau sämtliche Aufführungsorte des Dokumentarfilms “Electric Heart, Don Ellis” auflistet und bleibt etwas enttäuscht zurück, dass die Aufzählung von namen im Text nicht mit Inhalt gefüllt wird, es also nicht nur wichtig ist, mit wem Ellis oder seine Mitmusiker zusammengespielt haben, sondern viel eher, welche musikalischen Erfahrungen sich mit solchen biographischen Details verbinden, die wiederum auf die Musik Ellis’ Einfluss haben. Eine Diskographie schließt das Buch ab; ein gerade in einer solch personen- und titelbetonten Monographie besonders nützlicher Namens- oder Titelindex fehlt leider. Auch in der Bibliographie fehlen Hinweise auf mehrere fachkundige amerikanische Dissertationen, die sich insbesondere mit Ellis’ metrisch-rhythmischen Experimenten, aber auch mit seinen weltmusikalischen Ansätzen und seiner Interpretation des Blues auseinandergesetzt haben. Prodeaus Buch ist allerdings zur Zeit die einzige auf dem Markt befindliche Monographie über den Trompeter.
(Wolfram Knauer)
Christian Béthune
Le Jazz et l’Occident
Paris 2008
Klinksieck
337 Seiten
ISBN: 978-2-252-03674-7
 Der französische Philosoph und Jazzkritiker Christian Béthune beschäftigt sich in seinem neuesten Buch mit dem Verhältnis zwischen dem Jazz und der Philosophie und Ästhetik des 20sten Jahrhunderts.
Der französische Philosoph und Jazzkritiker Christian Béthune beschäftigt sich in seinem neuesten Buch mit dem Verhältnis zwischen dem Jazz und der Philosophie und Ästhetik des 20sten Jahrhunderts.
Konkret fragt er danach, in welche philosophischen und ästhetischen Diskurse der westlichen Welt der Jazz im 20sten Jahrhundert gelangte, und welche philosophischen und ästhetischen Diskurse er beeinflusste. War der Erfolg des Jazz ein Zeichen dafür, dass die Kunst (im alten Sinne) an ihrem Ende angelangt sei oder aber war er eine Weltanschauung ganz eigener Art?
Der Jazz sei in eine ästhetische Welt geboren worden, an deren Zustandekommen er selbst zwar keinen Anteil hatte, die ihn aber in seiner eigenen Entwicklung nachhaltig beeinflussen sollte. Die Musik der schwarzen Amerikaner habe allerdings immer mit ihrer ganz eigenen historischen Situation gelebt, also der, eine Musik zu sein, deren Wurzeln sowohl in der westlichen Tradition wie auch im erzwungenen Traditionsverlust der Sklaverei steckten.
Die Schwarzen in Nordamerika hätten durch ihre Stellung als Sklaven, als eine Art “Untermenschen” zugleich auch eine Freiheit von Traditionen besessen oder zumindest die Chance der Umdeutung von Traditionen, wie dies auch Ralph Ellison in seinem Roman “Invisible man” angedeutet habe. Diese Negation der Menschlichkeit mache einen erheblichen Teil der Kraft des Jazz (und seiner Vorformen) aus, in dem die schwarzen Amerikaner nämlich genau diese ihre Menschlichkeit, ihre “humanité” deutlich manifestierten: Individualität als Beweis des Menschlich-Sein.
Und irgendwie, argumentiert, Béthune, sei der Erfolg des Jazz in Europa nach zwei Weltkriegen eben nicht nur der Präsenz amerikanischer Soldaten in Europa zu verdanken, sondern auch der Tatsache, dass auch die Europäer einer Negation von Geschichte ausgesetzt waren, einer Negation des Horrors. Für sie habe der Jazz eine essentiell humane Musik dargestellt, die es ihnen erleichterte, sich im Angesicht des Unmenschlichen wieder auf das Menschliche zu besinnen.
Jazz biete uns eine Art historischer Utopie, die Utopie der “zweiten Chance”. Für die Sklaven sei die Musik eine Überlebensstrategie gewesen. Und eine ähnliche Funktion räumt Béthune dem Jazz auch in seiner Beziehung zum Okzident ein. Ja, der Jazz besitze eine gewisse “Zeitlosigkeit” (hier wie anderswo nimmt Béthune deutlich Bezug auf Adorno), doch sei eben gerade diese Zeitlosigkeit höchst willkommen, wenn die Zeit selbst in ihrer Instabilität, ihrer Multiplizität, ihrer Endlichkeit in Frage stünde.
Inzwischen allerdings sei der Jazz selbst im Okzident angelangt, Teil der westlichen Kultur und Philosophie geworden. Diesen Weg verfolgt Béthune dann in seinem Buch in zwei Teilen. In ersten Teil versucht er eine Einordnung des “champ jazzistique”, wie er die Traditionen umschreibt, die im Jazz mündeten und den Jazz ausmachen. Seine Argumentation beschreibt die Auswirkungen der Sklaverei, die Arbeitsgesänge, Spirituals, Gospel und Blues, die Minstrelsy und das “Jazzzeitalter” der 1920er Jahre, die Ankunft des Jazz in Europa sowie seine Darstellung im Film und die langsame Entwicklung einer dezidierten Jazzästhetik (“De l’implicite à l’explicite”).
In einem zweiten Teil seines Buchs untersucht er dann die verschiedenen Bezüge jazzspezifischer Ausprägungen zur westlichen Tradition: Improvisation, Oralität, das gemeinschaftliche Entstehen von Kunst (also im Gegensatz zum uni-auktorialen Schaffensprozess), die verschiedenen Zeitkriterien, in die der Jazz eingreift (Form, Rhythmus, swing), das Verlangen danach, sich selbst auszudrücken, sowie nicht zuletzt die Körperlichkeit des Jazz sind Argumente für die vielfältigen Gegenmodelle, die der Jazz in die okzidentale Ästhetik und Philosophie einbringe.
Man muss sich sowohl auf Béthunes Thesen einlassen wie sie auch ein wenig vergessen bei der Lektüre, um ihnen zu folgen und vielleicht eigene Wege in der Deutung jazzhistorischer Entwicklungen und des Bezugs jazzspezifischer Herangehensweisen zur ästhetischen Tradition in Europa zu gehen. Das aber lohnt sich und zeigt, dass dieses Thema, so historisch Béthune es auch angeht (seine Beispiele stammen größtenteils aus der Vor-Free-Jazz, ja sogar noch Vor-Bebop-Zeit) ästhetisch ungemein aktuell und bei weitem nicht ausdiskutiert ist.
(Wolfram Knauer)
Mission Impossible. My Life in Music
von Lalo Schifrin: Mission Impossible. My Life in Music,
Lanham/MD 2008 (Scarecrow Press)
219 Seiten + 1 CD, 35 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-5946-3
 Der Pianist Lalo Schifrin hat mindestens drei Karrieren hinter sich: als Jazzmusiker, als klassischer Komponist und als Komponist und Arrangeur für Film und Fernsehen. In allen drei Bereichen hat er Riesenerfolge gefeiert, spielte von 1958 bis 1963 mit Dizzy Gillespie, komponierte Werke für klassische Ensembles und schrieb die Musik etwa für “The Sting II”, “The Man from U.N.C.L.E.” oder eben “Mission Impossible”. In seiner Autobiographie erzählt er seine Geschichte. Er wurde 1932 in Buenos Aires in eine musikalische Familie geboren und war eine Art Kinderstar — mit neun Jahren spielte er Gershwins “Rhapsody in Blue” mit dem Philharmonischen Orchester unter Leitung von Erich Kleiber. In den 50er Jahren traf er oft mit Friedrich Gulda zusammen, den er als Bruder im geiste sieht, einen “Amphibienmusiker” zwischen Jazz und Klassik. 1954 zog es ihn nach Paris, wo er mit Bobby Jaspar und Chet Baker spielte. Zurück in Buenos Aires hörte Dizzy Gillespie ihn und lud ihn 1958 ein, Mitglied seiner Band zu werden. Schifrin erzählt einige schöne Anekdoten aus seinen Erlebnissen mit Gillespie, aber auch über Duke Ellington, Oscar Peterson, Sarah Vaughan, Stan Getz, Quincy Jones, Thelonious Monk, Miles Davis und John Coltrane, aber auch über Barbra Streisand und Luciano Pavarotti oder über Filmgrößen wie Orson Welles und Marlon Brando. 1964 schrieb Schifrin eine Jazzmesse für den Flötisten Paul Horn, bald folgten auch sinfonische Werke, die meist mit Jazz durchmischt waren. Seine Biographie wurde Richard Palmer in Form gebracht, aber etwas mehr editorische Arbeit hätte dem ganzen gut getan: Die Geschichten stehen manchmal etwas zusammenhanglos nebeneinander, und auch inhaltlich gibt es Unstimmigkeiten: falsche Schreibweisen (Frankfort), falsche Zuweisungen (Hugues Panassié habe angeblich die umfassendste Biographie Duke Ellingtons geschrieben) lassen das alles dann eben doch ein wenig zu sehr ins Unfaktische, rein Anekdotische abgleiten. Das liest sich leicht, ist aber eben auch mit Vorsicht zu genießen.
Der Pianist Lalo Schifrin hat mindestens drei Karrieren hinter sich: als Jazzmusiker, als klassischer Komponist und als Komponist und Arrangeur für Film und Fernsehen. In allen drei Bereichen hat er Riesenerfolge gefeiert, spielte von 1958 bis 1963 mit Dizzy Gillespie, komponierte Werke für klassische Ensembles und schrieb die Musik etwa für “The Sting II”, “The Man from U.N.C.L.E.” oder eben “Mission Impossible”. In seiner Autobiographie erzählt er seine Geschichte. Er wurde 1932 in Buenos Aires in eine musikalische Familie geboren und war eine Art Kinderstar — mit neun Jahren spielte er Gershwins “Rhapsody in Blue” mit dem Philharmonischen Orchester unter Leitung von Erich Kleiber. In den 50er Jahren traf er oft mit Friedrich Gulda zusammen, den er als Bruder im geiste sieht, einen “Amphibienmusiker” zwischen Jazz und Klassik. 1954 zog es ihn nach Paris, wo er mit Bobby Jaspar und Chet Baker spielte. Zurück in Buenos Aires hörte Dizzy Gillespie ihn und lud ihn 1958 ein, Mitglied seiner Band zu werden. Schifrin erzählt einige schöne Anekdoten aus seinen Erlebnissen mit Gillespie, aber auch über Duke Ellington, Oscar Peterson, Sarah Vaughan, Stan Getz, Quincy Jones, Thelonious Monk, Miles Davis und John Coltrane, aber auch über Barbra Streisand und Luciano Pavarotti oder über Filmgrößen wie Orson Welles und Marlon Brando. 1964 schrieb Schifrin eine Jazzmesse für den Flötisten Paul Horn, bald folgten auch sinfonische Werke, die meist mit Jazz durchmischt waren. Seine Biographie wurde Richard Palmer in Form gebracht, aber etwas mehr editorische Arbeit hätte dem ganzen gut getan: Die Geschichten stehen manchmal etwas zusammenhanglos nebeneinander, und auch inhaltlich gibt es Unstimmigkeiten: falsche Schreibweisen (Frankfort), falsche Zuweisungen (Hugues Panassié habe angeblich die umfassendste Biographie Duke Ellingtons geschrieben) lassen das alles dann eben doch ein wenig zu sehr ins Unfaktische, rein Anekdotische abgleiten. Das liest sich leicht, ist aber eben auch mit Vorsicht zu genießen.
(Wolfram Knauer)
Jimmy Katz
Joe Lovano – The Cat with the Hat
(herausgegeben von Rainer Placke und Ingo Wulff)
99 Duoton-Fotografien von Jimmy Katz. Mit Textbeiträgen
von Bruce Lundvall, Michael Cuscuna, John Scofield,
Greg Osby, Hank Jones, Gunther Schuller, Judi Silvano,
Joe Lovano u.a.
Bad Oeynhausen 2008 (Jazzprezzo)
deutsch/englisch, 152 Seiten, Fadenheftung, 22,5 x 27,5 cm
Zusammen mit einer CD “Joe’s Choice”
Preis: 52 Euro
ISBN: 978-3-9810250-6-4
 Im Zentrum des diesjährigen „Weihnachtsfotobuches“ des Jazzprezzo-Verlages steht der amerikanische Tenorsaxophonist Joe Lovano fotografiert von Jimmy Katz, der bereits im letzten Jahr mit “Jimmy Katz in New York“ sein großes Debüt als amerikanischer Starfotograf hatte. Eine lange Freundschaft und Seelenverwandtschaft prägen die Beziehung dieser beiden Künstler. “Meine Sessions sind warm, entspannt und spirituell. Jimmy fängt diese Energie ein, dieses warme Gefühl, das auch in der Musik spürbar wird. Jimmy Katz hält die Freude fest, die in der Musik mitklingt.“ Diese gegenseitige Achtung und künstlerische Sensibilität kennzeichnet auch die Haltung von Jimmy Katz. “Als Fotograf veranstalte ich nie eine Fotosession im Studio, sondern halte fest, wie Musik gemacht wird. Mit meiner Arbeit möchte ich dem Betrachter das Gefühl geben, die Entstehung der Musik gemeinsam mir den Musikern zu erleben. Bei Joe Lovano waren dies insbesondere die “einzigartige Energie und Kreativität“, die Jimmy Katz beeindruckt haben.
Im Zentrum des diesjährigen „Weihnachtsfotobuches“ des Jazzprezzo-Verlages steht der amerikanische Tenorsaxophonist Joe Lovano fotografiert von Jimmy Katz, der bereits im letzten Jahr mit “Jimmy Katz in New York“ sein großes Debüt als amerikanischer Starfotograf hatte. Eine lange Freundschaft und Seelenverwandtschaft prägen die Beziehung dieser beiden Künstler. “Meine Sessions sind warm, entspannt und spirituell. Jimmy fängt diese Energie ein, dieses warme Gefühl, das auch in der Musik spürbar wird. Jimmy Katz hält die Freude fest, die in der Musik mitklingt.“ Diese gegenseitige Achtung und künstlerische Sensibilität kennzeichnet auch die Haltung von Jimmy Katz. “Als Fotograf veranstalte ich nie eine Fotosession im Studio, sondern halte fest, wie Musik gemacht wird. Mit meiner Arbeit möchte ich dem Betrachter das Gefühl geben, die Entstehung der Musik gemeinsam mir den Musikern zu erleben. Bei Joe Lovano waren dies insbesondere die “einzigartige Energie und Kreativität“, die Jimmy Katz beeindruckt haben.
“…über den Mut zum Risiko, …über Lieblingsaufnahmen, …über Einflüsse, …über Unfälle, und über vieles mehr gibt Joe Lovano Auskunft. Diese über das Buch verstreuten, kurzen, unangestrengten Texte, bringen uns Joe Lavano als Künstler und Mensch sehr nahe.
Sessionfotografien, Gruppenaufnahmen, Aufnahmestudios: diese Foto-locations lassen den Betrachter hinter die Kulissen schauen. Sie machen den Part des Musikerlebens sichtbar, den sonst nur Eingeweihte erleben können. Jimmy Katz dokumentiert ganz unprätentiös die Tatsache, dass ein Jazzer eigentlich immer an seiner Musik arbeitet. Die Energie, Konzentriertheit, aber auch das starke Verbundensein der Musiker untereinander schleicht sich in die Szenenfotos von Jimmy Katz wie von selbst. Seine wahre Meisterschaft aber feiert er wie auch schon in seinem letztjährigen Bildband, in den Einzelaufnahmen. Hier zeigt sich seine Fotokunst in zeitlosem klassischem Charakter. Aus der Untersichtsperspektive verleiht er beispielsweise Joe Lovano im Duo mit Gonzalo Rubalcaba seine besondere Aura, als personifizierte Musik, die über den Dingen steht.
Der Jazzprezzo-Verlag ist gerade bei seinen Fotobüchern bekannt für außergewöhnlich gelungenes künstlerisches Design. Auch dieses Mal haben Rainer Placke und Ingo Wulff es wieder einmal geschafft, in kompaktem Format ein großes Fotobuch zu gestalten. Als Bonus gibt es dann auch noch eine CD mit den Lieblingsstücken Joe Lovanos, so dass dem Genuss mit allen Sinnen nichts mehr entgegensteht.
(Doris Schröder)
Jazz in Trier
von Karl-Heinz Breidt & Peter Heinbücher: Jazz in Trier,
Trier 2008 (Verlag Michael Weyand)
ISBN: 978-3-93528-61-4
Preis: 29,80 Euro
 “Jazz ist nicht in Trier entstanden” lautet der erste Satz des Buches, das sich dennoch zum Ziel gesetzt hat, die Geschichte in der ältesten Stadt Deutschlands nachzuzeichnen. Es sammelt unterschiedliche Geschichten, wirft Schlaglichter auf verschiedene Szenen, dokumentiert Erinnerungen in Fotos, Schriftstücken und Interviews. Der erste Jazzkeller wurde 1953 im Keller der Schaabs-Villa gegründet und in dem sich der Jazzclub Evergreen traf. 1959 mussten die Jazzfans in andere Räumlichkeiten ausweichen. Andere Spielstätten kamen und gingen, und 1978 gründete sich der Jazz-Club Trier als eingetragener Verein und neuer Motor der Szene. 1999 kam es zum Bruch der Mitglieder des Vereins, und ein weiterer Club mit einem etwas sperrigeren Namen kam hinzu: der “Jazzclub EuroCore im Saar-Lor-Lux-Trier Musik e.V.”, der sich zum Ziel setzte, nicht nur lokale, sondern regionale, und zwar grenzübergreifend-regionale Jazzprojekte zu fördern. Thomas Schmitt war an der Gründung beider Clubs verantwortlich beteiligt. Die Luxemburger Jazzszene wird genauso beleuchtet wie die Jazzaktivitäten in Koblenz. Das Buch stellt Persönlichkeiten vor wie den Klarinettisten Klaus Muggel Weissroth, den Pianisten und Klarinettisten Gangold Brähler, den Posaunisten Michael Trierweiler, den Saxophonisten Joe Schwarz, den Trompeter Ralf Schmitt-Fassbinder, den Saxophonisten Stefan Reinholz, den Trompeter Helmut Becker, den trompeter Alb Hardy, den Pianisten Ben Heit, den Sänger Wolfgang Kernbach, den Bassisten Jürgen Laux oder den Schlagzeuger Benedikt Kündgen. Dieter Manderscheid und Georg Ruby erinnern sich an die 1970er Jahre in ihrer Heimatstadt. Die junge Jazzszene wird genauso beleuchtet wie die Schwierigkeiten, die sich anfangs aus der Existenz zweier Jazzclubs ergaben. Viele Fotos runden den aufwendig gestalteten Band ab. Ob man den kulturpolitischen Ansichten oder den jazzhistorischen Vereinfachungen der beiden Autoren überall folgen mag, die oft fast schon bezugslos ins Buch verstreut sind, bleibt jedem Leser selbst überlassen. Die Interviews und regionalen Geschichten wären allemal spannender als die Einordnung Trierer Jazzhistorie in die Weltgeschichte dieser Musik. Im Vorwort erklären die Breidt und Heinbücher etwas umständlich, wie Interviews die Grundlage für ihr Buch bildeten. Diese allerdings machen dann doch nur einen kleinen Ausschnitt des Textes aus und werden stilistisch eher holprig eingesetzt. Der Lektor hätte dem ganzen vielleicht ein wenig mehr an Lesefluss verleihen können. Ein Namensregister — für solche Bücher eigentlich Pflicht — fehlt aus unerklärlichen Gründen. Die allgemeine “Geschichte des Jazz als Kunstform des 20. Jahrhunderts”, das Kapitel über das “Phänomen Louis Armstrong” oder das seltsame Kapitel “Jazz als kulturelle Herausforderung” — in dem in der Hauptsache Ernst Jünger und Sidney Bechet zitiert werden, aber warum, weiß man nicht so genau –, hätte man sicher durch Trier-bezogenere Kapitel ersetzen können. Und statt einer seltsamen Plattenliste über “30 Jazz Tonträger, die in keiner Sammlung fehlen sollten” und in der Miles Davis und Duke Ellington neben Rod Mason und eher unbekannteren Trierer Musikern stehen, wäre eine Diskographie des Trierer Jazz dem Thema wahrscheinlich angemessener gewesen. So bleibt vor allem ein dokumentarische Wert der in dem Buch enthaltenen Daten, Fotos und sonstigen Dokumente. Immerhin dieses Buch eine weitere Lücke der Regionaldokumentation deutscher Jazzgeschichte. Nach Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Wuppertal und etlichen anderen Städten nun also auch Trier: Glückwunsch!
“Jazz ist nicht in Trier entstanden” lautet der erste Satz des Buches, das sich dennoch zum Ziel gesetzt hat, die Geschichte in der ältesten Stadt Deutschlands nachzuzeichnen. Es sammelt unterschiedliche Geschichten, wirft Schlaglichter auf verschiedene Szenen, dokumentiert Erinnerungen in Fotos, Schriftstücken und Interviews. Der erste Jazzkeller wurde 1953 im Keller der Schaabs-Villa gegründet und in dem sich der Jazzclub Evergreen traf. 1959 mussten die Jazzfans in andere Räumlichkeiten ausweichen. Andere Spielstätten kamen und gingen, und 1978 gründete sich der Jazz-Club Trier als eingetragener Verein und neuer Motor der Szene. 1999 kam es zum Bruch der Mitglieder des Vereins, und ein weiterer Club mit einem etwas sperrigeren Namen kam hinzu: der “Jazzclub EuroCore im Saar-Lor-Lux-Trier Musik e.V.”, der sich zum Ziel setzte, nicht nur lokale, sondern regionale, und zwar grenzübergreifend-regionale Jazzprojekte zu fördern. Thomas Schmitt war an der Gründung beider Clubs verantwortlich beteiligt. Die Luxemburger Jazzszene wird genauso beleuchtet wie die Jazzaktivitäten in Koblenz. Das Buch stellt Persönlichkeiten vor wie den Klarinettisten Klaus Muggel Weissroth, den Pianisten und Klarinettisten Gangold Brähler, den Posaunisten Michael Trierweiler, den Saxophonisten Joe Schwarz, den Trompeter Ralf Schmitt-Fassbinder, den Saxophonisten Stefan Reinholz, den Trompeter Helmut Becker, den trompeter Alb Hardy, den Pianisten Ben Heit, den Sänger Wolfgang Kernbach, den Bassisten Jürgen Laux oder den Schlagzeuger Benedikt Kündgen. Dieter Manderscheid und Georg Ruby erinnern sich an die 1970er Jahre in ihrer Heimatstadt. Die junge Jazzszene wird genauso beleuchtet wie die Schwierigkeiten, die sich anfangs aus der Existenz zweier Jazzclubs ergaben. Viele Fotos runden den aufwendig gestalteten Band ab. Ob man den kulturpolitischen Ansichten oder den jazzhistorischen Vereinfachungen der beiden Autoren überall folgen mag, die oft fast schon bezugslos ins Buch verstreut sind, bleibt jedem Leser selbst überlassen. Die Interviews und regionalen Geschichten wären allemal spannender als die Einordnung Trierer Jazzhistorie in die Weltgeschichte dieser Musik. Im Vorwort erklären die Breidt und Heinbücher etwas umständlich, wie Interviews die Grundlage für ihr Buch bildeten. Diese allerdings machen dann doch nur einen kleinen Ausschnitt des Textes aus und werden stilistisch eher holprig eingesetzt. Der Lektor hätte dem ganzen vielleicht ein wenig mehr an Lesefluss verleihen können. Ein Namensregister — für solche Bücher eigentlich Pflicht — fehlt aus unerklärlichen Gründen. Die allgemeine “Geschichte des Jazz als Kunstform des 20. Jahrhunderts”, das Kapitel über das “Phänomen Louis Armstrong” oder das seltsame Kapitel “Jazz als kulturelle Herausforderung” — in dem in der Hauptsache Ernst Jünger und Sidney Bechet zitiert werden, aber warum, weiß man nicht so genau –, hätte man sicher durch Trier-bezogenere Kapitel ersetzen können. Und statt einer seltsamen Plattenliste über “30 Jazz Tonträger, die in keiner Sammlung fehlen sollten” und in der Miles Davis und Duke Ellington neben Rod Mason und eher unbekannteren Trierer Musikern stehen, wäre eine Diskographie des Trierer Jazz dem Thema wahrscheinlich angemessener gewesen. So bleibt vor allem ein dokumentarische Wert der in dem Buch enthaltenen Daten, Fotos und sonstigen Dokumente. Immerhin dieses Buch eine weitere Lücke der Regionaldokumentation deutscher Jazzgeschichte. Nach Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Wuppertal und etlichen anderen Städten nun also auch Trier: Glückwunsch!
Dass Trier nach wie vor eine lebendige Jazzstadt ist, lässt sich übrigens auch aus der Tatsache ersehen, das die Publikation des Buchs sofort für einigen Wirbel in der Trierer Musikszene sorgte. Dieser oder jener Musiker, diese oder jene Lokalität, diese oder jene Entwicklung seien zu stark, zu wenig oder falsch dargestellt, hieß es da. Fast wirkt das wie die Aufforderung zu einem zweiten Buch…
(Wolfram Knauer)
50 Jahre Jazzkeller Krefeld
herausgegeben von Günter Holthoff & Mojo Mendiola
Krefeld 2008 (Leporello Verlag)
ISBN 978-3-936783-29-2
208 Seiten, Preis: 16,80 Euro
 Lokalgeschichte ist für den Jazz mittlerweile fast genauso wichtig wie Globalgeschichte. Man lebt schließlich im eigenen Viertel und will auch da die Musik hören. Aber mehr noch: Man wird beeinflusst durch das, was um die Ecke geschieht, dadurch, wie die große weite Welt einem ganz nah bei zu Hause begegnet. So war es und so ist es selbst im Zeitalter des Internets nach wie vor. Mittlerweile gibt es viele Stadt-Jazz-Geschichten aus Deutschland, Bücher, in denen die lokalen und regionalen Entwicklungen nachverfolgt und dokumentiert werden.
Lokalgeschichte ist für den Jazz mittlerweile fast genauso wichtig wie Globalgeschichte. Man lebt schließlich im eigenen Viertel und will auch da die Musik hören. Aber mehr noch: Man wird beeinflusst durch das, was um die Ecke geschieht, dadurch, wie die große weite Welt einem ganz nah bei zu Hause begegnet. So war es und so ist es selbst im Zeitalter des Internets nach wie vor. Mittlerweile gibt es viele Stadt-Jazz-Geschichten aus Deutschland, Bücher, in denen die lokalen und regionalen Entwicklungen nachverfolgt und dokumentiert werden.
Krefeld war auf jeden Fall ein gutes Pflaster für den Jazz. Vor 50 Jahren wurde dort der Jazzkeller Krefeld eröffnet, in dem unter wechselnder Leitung durchgängig Jazz erklang. Dieses Buch beleuchtet die Geschichte des Clubs und seiner Pächter und wirft Schlaglichter auf die vielen Musiker, die mindestens einen Abend hier zu Hause waren. Natürlich ist das zu allererst eine Namensschlacht, denn keiner soll vergessen werden, die Stars nicht und die lokalen Größen (oder weniger Großen) genausowenig. Das könnte die umfangreiche, liebevoll gestaltete und reich bebilderte Dokumentation zu einer etwas anstrengenden Lektüre machen. Aber so soll man es wohl auch gar nicht lesen, sondern lieber blättern und sich gefangen nehmen lassen von den sehr unterschiedlichen Eindrücken, die sich einem mitteilen. Eine bunte Jazzgeschichte ist das allemal, die sich in den Bildern und kurzen Texten wiederfindet: von Blueslegenden über TradJazz, Mainstream bis hin zur deutschen und europäischen Avantgarde. Spannend vor allem die vielen zeitgenössischen Konzertberichte, insbesondere von Dita von Szadkowski, die als Faksimile abgedruckt sind und einem auch als Außenstehender die Zeit, die Atmosphäre und auch die Probleme einer meist mit viel ehrenamtlichem Engagement organisierten Jazzszene näher bringen.
Happy Birthday, Jazzkeller Krefeld. Ein halbes Jahrhundert habt Ihr hinter Euch — da geht doch noch was!
(Wolfram Knauer)
Jazz Calendiary 2008
von Patrick Hinely
Mit einem Vorwort von Tad Hershorn; deutsch/englisch
Bad Oeynhausen 2006 (jazzprezzo)
116 Seiten, fester Einband mit Wire-O-Bindung,
17,5 x 23,5 cm, ISBN 978-3-9810250-3-3, 16,80 Euro
In Kooperation mit dem Nieswand Verlag
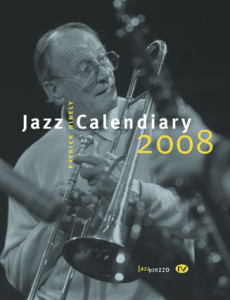 Auch in diesem Jahr beglückt uns der Jazzprezzo Verlag mit seinem neuen Jazz Calendiary 2008, das schon kultverdächtig ist. Man hat sich an das handliche, dank der Spiralbindung leicht zu blätternde Buch im täglichen Einsatz liebevoll gewöhnt. Auf der linken Seite finden sich wie gehabt Schwarzweiß-Fotos, in diesem Jahr des amerikanischen Fotografen Patrick Hinely, für jede Woche eines, und auf der rechten Seite genügend Platz für Termine, Anmerkungen, Notizen. Dickes Papier haben die Kalendermacher benutzt, angenehm rauh und beschreibbar und zugleich hochwertig glossy und damit fotogerecht. Mit den eindrücklichen Jazzbildern von Patrik Hinely erlebt man die Persönlichkeit der Musiker, sowohl „on stage“, wie beispielsweise eine dynamische Dee Dee Bridgewater beim Berliner Jazzfest oder Charlie Haden , der eins zu werden scheint mit seinem Bass. Aber es sind gerade auch die eher leiseren „Field-Fotos“, wie die eines nachdenklich-träumerischen Klaus Königs oder Lol Coxhill beim Kaffeetrinken in London, die einen mindestens für eine Woche in den Bann ziehen. Patrick Hinely arbeitet seit den 1970er Jahren als selbständiger Fotograf. Seine Bilder erscheinen in Zeitungen, Büchern, LPs und CDs weltweit. Jazz Calendiary 2008 – ein Schmuckstück für den Schreibtisch und nicht nur zum Verschenken.
Auch in diesem Jahr beglückt uns der Jazzprezzo Verlag mit seinem neuen Jazz Calendiary 2008, das schon kultverdächtig ist. Man hat sich an das handliche, dank der Spiralbindung leicht zu blätternde Buch im täglichen Einsatz liebevoll gewöhnt. Auf der linken Seite finden sich wie gehabt Schwarzweiß-Fotos, in diesem Jahr des amerikanischen Fotografen Patrick Hinely, für jede Woche eines, und auf der rechten Seite genügend Platz für Termine, Anmerkungen, Notizen. Dickes Papier haben die Kalendermacher benutzt, angenehm rauh und beschreibbar und zugleich hochwertig glossy und damit fotogerecht. Mit den eindrücklichen Jazzbildern von Patrik Hinely erlebt man die Persönlichkeit der Musiker, sowohl „on stage“, wie beispielsweise eine dynamische Dee Dee Bridgewater beim Berliner Jazzfest oder Charlie Haden , der eins zu werden scheint mit seinem Bass. Aber es sind gerade auch die eher leiseren „Field-Fotos“, wie die eines nachdenklich-träumerischen Klaus Königs oder Lol Coxhill beim Kaffeetrinken in London, die einen mindestens für eine Woche in den Bann ziehen. Patrick Hinely arbeitet seit den 1970er Jahren als selbständiger Fotograf. Seine Bilder erscheinen in Zeitungen, Büchern, LPs und CDs weltweit. Jazz Calendiary 2008 – ein Schmuckstück für den Schreibtisch und nicht nur zum Verschenken.
(Doris Schröder)
soeben erschienen:
 Rolf Kissling
Rolf Kissling
Jazz Calendiary 2009
Kalenderbuch mit
53 Duoton-Fotografien
Mit einem Vorwort von Hans-Jürgen Schaal
deutsch/englisch, 114 Seiten, fester Einband mit Wire-O-Bindung,
17,5 x 23,5 cm, ISBN 978-3-9810250-5-7, 16,80 Euro
Zu beziehen über den Buchhandel oder über www.jazzprezzo.de
Ronnie Scott’s Jazz Farrago. Compilation of Features from Jazz at Ronnie Scott’s Magazine
Herausgegeben von Jim Godbolt
London 2008, Hampstead Press
ISBN 978-0-9557628-0-2, Preis: £ 19,95

Der britische Jazzhistoriker Jim Godbolt ist seit 1979 Herausgeber der Clubzeitschrift des Londoner Ronnie Scott’s Club. Seine eigenen Kolumnen sind kenntnisreich genauso wie skuril-witzig und geizen nicht mit Selbstironie. Ein “Best of” der Anekdoten, Features und Interviews erschien nun in Buchform. “Jazz Farrago” enthält lesenswerte historische Berichte, etwa zum ersten Europabesuch Duke Ellingtons im Jahr 1933, zu Benny Goodmans Londoner Konzerten im Jahr 1949, zum legendären Club Eleven, in dem sich Ende der 1940er Jahre die Anhänger des modernen jazz in London trafen. Alun Morgan beleuchtet genau diese Szene in einem kurzen Beitrag, und Alain Presencer erinnert sich daran, wie er 1953 das legendäre Massey Hall Concert in Toronto besuchte, bei dem Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus und Max Roach mitwirkten. Interviews mit George Melly, John Dankworth, Spike Milligan, Charlie Watts und anderen geben weitere Einblicke in die britische Jazzszene, und Godbolt druckt außerdem ein legendäres Interview mit Ruby Braff ab, in dem Braff, der eh keine Lust auf ein interview hatte, irgendwann den Spieß umdreht und Godbolt die Fragepistole auf die Brust setzt. Ronnie Scott kommt selbst etliche Male zu Wort, erzählt davon, wie er einmal eine Bigband geleitet habe, von einem Besuch in Hongkong oder wie er einmal den Buckingham-Palast besucht habe. Weitere Profile stellen Zoot Sims, Tubby Hayes, Tony Crombie, Alan Clare und Bruce Turner, Wally Fawkes, Cleo Laine und Humphrey Lyttelton vor. Ein buntes Sammelsurium ist das alles, auch im Layout des Buchs – kurze Notizen genauso wie ein Tratsch aus der Szene und launige Kommentare über Gott und den Jazz. Unterhaltsam, kurzweilig und gespickt mit seltenen Fotos und Karikaturen.
(Wolfram Knauer)
Inside British Jazz.
Crossing Borders of Race, Nation and Class
Von Hilary Moore
Aldershot/Hampshire 2007
Ashgate Popular and Folk Music Series
ISBN 978-0-7546-5744-6
157 Seiten, 50 Britische Pfund
 Die Aufarbeitung der europäischen Jazzgeschichte geschieht immer noch vor allem regional. Ein Buch über die europäische Jazzgeschichte in all ihrer Diversität steht bislang aus. Doch die unterschiedlichen Monographien zu nationalen Jazzentwicklungen sind mittlerweile recht seriös geworden. Es geht nicht mehr bloß um Nennung von Namen und den Abgleich des Spielenkönnens “wie die Amerikaner”. Die Autoren arbeiten mittlerweile die spezifischen Besonderheiten der Jazzentwicklungen heraus, diskutieren Unterschiede und legen das neue Selbstbewusstsein der jungen Jazzmusiker auch an die Jazzgeschichte ihrer Länder an.
Die Aufarbeitung der europäischen Jazzgeschichte geschieht immer noch vor allem regional. Ein Buch über die europäische Jazzgeschichte in all ihrer Diversität steht bislang aus. Doch die unterschiedlichen Monographien zu nationalen Jazzentwicklungen sind mittlerweile recht seriös geworden. Es geht nicht mehr bloß um Nennung von Namen und den Abgleich des Spielenkönnens “wie die Amerikaner”. Die Autoren arbeiten mittlerweile die spezifischen Besonderheiten der Jazzentwicklungen heraus, diskutieren Unterschiede und legen das neue Selbstbewusstsein der jungen Jazzmusiker auch an die Jazzgeschichte ihrer Länder an.
“Inside British Jazz” ist ein Beispiel solch einer neuen, selbstbewussten Geschichtsschreibung. Die schottische Musik- und Kulturwissenschaftlerin Hilary Moore untersucht die Querbeziehungen afro-amerikanischer Musik mit der britischen Kultur des 20. Jahrhunderts. Sie fragt nach der sozialen Relevanz dieser Musik, nach Ansatzmöglichkeiten für jedwede Identifikation, nach der Bedeutung von Hautfarbe und Klassenzugehörigkeit für die musikalische Entwicklung der Protagonisten. Moore teilt ihr Buch dabei in vier Schwerpunktkapitel: Sie untersucht (1.) die frühen Jahre des Jazz in Großbritannien, fragt nach Konnotationen wie Umsturz, Befreiung und Krieg (den Folgen des I. Weltkriegs); (2.) die in der Arbeiterbewegung verankerte Trad-Jazz-Bewegung der Nachkriegszeit, die er auf Authentizität und Nostalgie abklopft; (3.) Free-Jazz-Versuche der 1960er Jahre, als Joe Harriott und andere sich in ihrer Art einer freien Improvisation deutlich von den amerikanischen Vorbildern wie beispielsweise Ornette Coleman unterschieden; und (4.) die Musiker des jungen Selbstbewusstseins der 1980er Jahre, insbesondere die Jazz Warriors um Courtney Pine, eine Bewegung junger schwarzer Musiker in Großbritannien mit oft afrikanischen oder karibischen Wurzeln. Moore hinterfragt die Behauptung, Hautfarbe würde heute doch keine Rolle mehr spielen und stellt insbesondere auch für die 1980er Jahre fest, dass Gruppenzugehörigkeit als Identifikationsfaktor nach wie vor sehr wichtig ist.
Moores Buch ist eine wenig veränderte Fassung ihrer Doktorarbeit, die sie 2004 an der University of Pennsylvania abgelegt hatte. Ihr Buch ist also ein Fachbuch, das immer wieder auf den wissenschaftlichen Diskurs verweist, innerhalb dessen auch sie sich bewegt. Moores Buch ergänzt zwei bereits veröffentlichte Studien – von Catherine Parsonage und von George McKay – zur Geschichte des Jazz in Großbritannien. Ihr gelingt es, einige neue Fäden zu spinnen, Verbindungen und Bedingtheiten aufzuzeigen. Und sie nimmt sich wenigstens ansatzweise einer Geschichte des aktuellen schwarzen Jazz in Großbritannien an, ein Thema, das sich zwangsläufig mit Rassismus, Kolonialismus und den sozial- und kulturpolitischen Entscheidungen der letzten Jahre beschäftigt. Eine willkommene Bereicherung der Literatur zum Jazz in Europa!
(Wolfram Knauer)
The Little Giant. The Story of Johnny Griffin
Von Mike Hennessey
London 2008 (Northway Publication)
19,99 Englische Pfund
ISBN: 978-0-9550908-5-1

Wenn er in Amerika geblieben wäre, wäre er schon lange tot, erzählt Johnny Griffin seinem Biographen Mike Hennessey in der neuen Biographie, die um den achtzigsten Geburtstag des Tenorsaxophonisten beim englischen Verlag Northway erschien. Er sei ein bekiffter Zombie gewesen, als er die USA verließ. Griffin lebt seit Mitte der 60er Jahre in Europa, hatte sich zusammen mit seiner Frau 1984 ein altes Schloss zwischen Poitiers und Limoges gekauft. Griffin gehört mit zu jenen amerikanischen Musikern, die Europa nicht nur als einen exzellenten Markt für ihre Musik, sondern auch als angenehmes Pflaster zum Leben entdeckten. Im Dezember 1962 war er zum ersten Mal nach Europa gekommen, auf einer Tour fürs Plattenlabel Riverside. In Paris traf er Bud Powell, und auch anderswo fühlte er sich wohl — er habe sich zum ersten Mal wirklich entspannen können. Die Europäer liebten ihn, und in Paris fand er auch jede Menge anderer Exilamerikaner vor, Musiker wie Kenny Clarke, Kenny Drew, Donald Byrd oder Jimmy Gourley. Er spielte in Schweden, Belgien, England und kehrte im März 1963 in die USA zurück und fragte sich sofort, was er dort eigentlich wolle. So entschied er sich, endgültig nach Europa zu ziehen und bestieg zusammen mit dem Sänger Babs Gonzales im Mai 1963 ein Schiff nach Rotterdam. Bis 1973 lebte er in Paris, dann zog er in die Nähe von Rotterdam, bis er 1984 ins schon erwähnte Chateau Bellevue zog. Mike Hennessey beschreibt das Leben Griffins lebendig und mit vielen Erinnerungseinschüben des Saxophonisten. Der berichtet über seine frühen Einflüsse und seine Jugend in Chicago, wo er an der DuSable High School Musikunterricht bei Captain Walter Henri Dyett erhielt, einem renomierten Lehrer, der auch etliche andere später berühmte Jazzmusiker auf ihren Weg gebracht hatte. Mit 15 arbeitete er mit dem Bluesgitarristen und -sänger T-Bone Walker, zwei Jahre später wurde er Mitglied in Lionel Hamptons Orchester. Er spielte mit Sonny Stitt, mit Gene Ammons und Lester Young, war in den 50er Jahren ein gefragter Saxophonist, gerade weil sein Stil als so antreibend und Kollegen herausfordernd rüberkam, insbesondere wenn er mit dem Eddie ‘Lockjaw’ Davis als “Tough Tenors” in Erscheinung trat. 1957 machte er Aufnahmen mit Art Blakey’s Jazz Messengers und wurde im März darauf Mitglied in der Band des Pianisten Thelonious Monk, den er bereits Ende der 40er Jahre kennengelernt hatte und der ihn für einen langen Gig im New Yorker Club Five Spot engagierte. Hennessey kann bei seinen Exkursen zu vielen Musikern, mit denen Griffin zusammengespielt hatte, zu Monk, Kenny Clarke und vielen anderen, auf eigene Interviews zurückgreifen. Auch Griffin spricht über diese Kollegen, die er bewundert. Und er spricht über Musik, die ihn eher abtörnt, die von Archie Shepp etwa oder von Ornette Coleman und Cecil Taylor. Und er äußert sich freimütig auch über die Tiefpunkte seines Lebens, vor allem über seine Probleme mit Alkohol, zeitweisen Gebrauch von Kokain und Heroin. Wäre er in Amerika geblieben, wäre er schon lange tot, sagt er (siehe oben). Glücklicherweise konnte Johnny Griffin am 24. April seine n 80sten Geburtstag feiern. Und Mike Hennesseys Buch feiert sein Leben. Eine Diskographie der Alben, bei denen Griffin als Bandleader verantwortlich zeichnet, ein Verzeichnis der Kompositionen des Saxophonisten sowie ein Namensregister beschließen das Buch, das weniger eine kritische Würdigung sein will als vielmehr faktische Lebensgeschichte eines Musikers zwischen den Welten.
(Wolfram Knauer)
[:]