Jazz. Schule. Medien.
edited by Wolfram Knauer
Hofheim 2010 (Wolke Verlag)
256 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-936000-92-4.
 Das neueste Buch des Jazzinstituts Darmstadt trägt den Titel “Jazz. Schule. Medien.” und befasst sich mit verschiedenen Aspekten von Jazzvermittlung. In einem ersten Block geht es dabei darum, welchen Stellenwert Jazz im schulischen Unterricht besitzt, wie er in Lehrpläne eingebaut werden kann, welche pädagogischen Ansätze sich mit jazz-affinen Themen verbinden lassen, worauf die Musiklehrerausbildung achten muss, um Jazz und Popularmusik an Allgemeinbildenden Schulen gezielt einsetzen zu können. In einem zweiten Block wird aus unterschiedlichen Sichtweisen der Stellenwert diskutiert, den Jazz in den tagesaktuellen Medien besitzt, also in Tageszeitungen, Blogs etc. Schließlich kommen auch Jazzmusiker selbst zu Wort, die über Strategien berichten, ihr Publikum zu erreichen, in einer Zeit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne Lust auf die Konzentration machen, die der Jazz verlangt, Neugier zu wecken auf das spontane Experiment der musikalischen Improvisation.
Das neueste Buch des Jazzinstituts Darmstadt trägt den Titel “Jazz. Schule. Medien.” und befasst sich mit verschiedenen Aspekten von Jazzvermittlung. In einem ersten Block geht es dabei darum, welchen Stellenwert Jazz im schulischen Unterricht besitzt, wie er in Lehrpläne eingebaut werden kann, welche pädagogischen Ansätze sich mit jazz-affinen Themen verbinden lassen, worauf die Musiklehrerausbildung achten muss, um Jazz und Popularmusik an Allgemeinbildenden Schulen gezielt einsetzen zu können. In einem zweiten Block wird aus unterschiedlichen Sichtweisen der Stellenwert diskutiert, den Jazz in den tagesaktuellen Medien besitzt, also in Tageszeitungen, Blogs etc. Schließlich kommen auch Jazzmusiker selbst zu Wort, die über Strategien berichten, ihr Publikum zu erreichen, in einer Zeit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne Lust auf die Konzentration machen, die der Jazz verlangt, Neugier zu wecken auf das spontane Experiment der musikalischen Improvisation.
Die in diesem Band enthaltenen Beiträge entstanden aus Anlass des 12. Darmstädter Jazzforums im September 2011, das der theoretischen Diskussion über Jazzvermittlung auch einige praktische Workshops und Konzerte zur Seite stellte. Mit der Publikation wollen wir den Leser mit in den Diskurs darüber einbinden, wie der Jazz auch in Zukunft ein breites Publikum erreichen kann, ohne sich zu verbiegen, ohne seine kreative Freiheit dreinzugeben.
Zu den Autoren zählen namhafte Forscher, Pädagogen, Journalisten und Musiker wie etwa Christian Broecking, Sigi Busch, Ralf Dombrowski, Bernd Hoffmann, Julia Hülsmann, Reinhard Köchl, Hans-Jürgen Linke, Angelika Niescier, Florian Ross, Michael Rüsenberg, Jürgen Terhag, Walter Turkenburg, Joe Viera, Nils Wülker und andere.
Jazz. Schule. Medien.
(Jazz School Media)
edited by Wolfram Knauer
Hofheim 2010 (Wolke Verlag)
256 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-936000-92-4.
The latest book from the Jazzinstitut Darmstadt is titled “Jazz. Schule. Medien.” (Jazz. School. Media.) and deals with different aspects of bringing jazz to both a general and a young audience. The first part of the book looks at educational aspects, asks how to integrate jazz in a school curriculum, which pedagogical approaches can be linked to jazz-related themes, what to watch out for at teacher training in order for teachers to be able to use jazz and popular music effectively in school. A second part of the book discusses how jazz is seen and reported about in (German) daily newspapers, Blogs etc. And finally, musicians themselves have a say and talk about their strategies to reach their audience, how in a time of short attention span they whet their listeners’ appetite for the concentration which jazz often needs, how they raise the curiosity of their audience for the spontaneous experiment of musical improvisation.
The book’s chapters have originally been written as papers for the 12th Darmstadt Jazzforum in September 2011, a conference which also featured workshops and concerts. With the book publication we invite the reader to participate in a discourse about how to reach a broader audience for jazz while staying true to oneself, keeping one’s creative freedom.
Among the authors are established scholars, educators, journalists and musicians such as Christian Broecking, Sigi Busch, Ralf Dombrowski, Bernd Hoffmann, Julia Hülsmann, Reinhard Köchl, Hans-Jürgen Linke, Angelika Niescier, Florian Ross, Michael Rüsenberg, Jürgen Terhag, Walter Turkenburg, Joe Viera, Nils Wülker and others.
“Jazz. Schule. Medien.” is a German language publication throughout!
Deutsche Jazzfotografen: Karlheinz Fürst
herausgegeben von Monika Fürst
Neckargemünd 2012 (Männeles Verlag / Jazzinstitut Darmstadt)
216 Seiten, 24,90 Euro
ISBN: 978-3-933968-20-3
 Geschichtsträchtig, aber dennoch zeitlos modern… So könnte man die Aufnahmen des deutschen Jazzfotografen Karlheinz Fürst charakterisieren. Noch jenseits digitaler Bearbeitung dokumentierte Karlheinz Fürst im Auftrag von Joachim Ernst Berendt in den Jahren 1958 bis 1963 wichtige Kapitel deutscher Jazzgeschichte mit regionalem Kolorit.
Geschichtsträchtig, aber dennoch zeitlos modern… So könnte man die Aufnahmen des deutschen Jazzfotografen Karlheinz Fürst charakterisieren. Noch jenseits digitaler Bearbeitung dokumentierte Karlheinz Fürst im Auftrag von Joachim Ernst Berendt in den Jahren 1958 bis 1963 wichtige Kapitel deutscher Jazzgeschichte mit regionalem Kolorit.
Karlheinz Fürst gehörte von Anfang an zu den fotografischen Pionieren in dem kompromisslosen Verzicht auf Blitzlicht zugunsten des künstlerischen Ausdrucks. Die auf den ersten Blick scheinbare Unschärfe und Grobkörnigkeit etablierte sich unter den künstlerischen Fotografen schnell zu einem ausgesuchten Stilmittel.
Aus Anlass einer Ausstellung im Jazzinstitut Darmstadt erschien nun der zweite Band der Reihe “Deutsche Jazzfotografen” mit Fotos von Karlheinz Fürst. Der von der Tochter des Fotografen Marion Fürst in Zusammenarbeit mit dem Jazzinstitut Darmstadt herausgegebene Band “Deutsche Jazzfotografen: Karlheinz Fürst” ist 216 Seiten stark und enthält neben den ausdrucksstarken Fotos aus den 1950er und frühen 1960er Jahren einen sehr persönlichen Aufsatz der Herausgeberin sowie einen kenntnisreichen Rückblick auf die deutsche Jazzszene jener Zeit von Matthias Spindler.
(Doris Schröder / Wolfram Knauer, Dezember 2012)
Lennie Tristano. C-Minor Complex
von Marco Di Battista
Raleigh/NC 2012 (Lulu Enterprises)
80 Seiten, 10,00 Euro
ISBN: 978-1-291-08480-1
www.marcodibattista.com
 Lennie Tristanos Aufnahme von “C-Minor Complex” vom Herbst 1961 ist eine musikalische tour-de-force, ein hervorragendes Beispiel für Tristanos Fähigkeit in Linien zu denken und zu musizieren. Der italienische Pianist Marco di Battista hat sich Tristanos Aufnahme als Musterbeispiel seiner Annäherung an sein musikalisches Vorbild genommen.
Lennie Tristanos Aufnahme von “C-Minor Complex” vom Herbst 1961 ist eine musikalische tour-de-force, ein hervorragendes Beispiel für Tristanos Fähigkeit in Linien zu denken und zu musizieren. Der italienische Pianist Marco di Battista hat sich Tristanos Aufnahme als Musterbeispiel seiner Annäherung an sein musikalisches Vorbild genommen.
Im ersten Kapitel stellt er den historischen Kontext vor, aus dem heraus Tristanos Kunst zu verstehen ist. Kapitel 2 verweist auf musikalische Einflüsse (und lässt auch die italienische Herkunft der Familie nicht unerwähnt). Im dritten Kapitel verfolgt die Battista die musikalische Karriere des Meisters, um in den Kapiteln 4 bis 6 zur formalen und harmonischen Analyse des “C-Minor Complex” zu kommen. Er hebt den Anschlag hervor und verweist auf die harmonischen Bezüge zu “Pennies from Heaven” bzw. Tristanos eigenem “Lennie’s Pennies”. Die gleichmäßige Rhythmik erinnert ihn an den gleichmäßigen Puls, der beispielsweise englischer Renaissancemusik von William Byrd und anderen zugrundeliegt. Seine harmonische Analyse benennt besondere Alterationen, aber auch Unterschiede etwa zu “Lennie’s Pennies”. Insbesondere interessiert ihn dabei das Ineinandergreifen von Polyrhythmik, harmonischem Verlauf und melodischer Erfindung.
Das Buch schließt mit einer Komplett-Transkription der fünfeinhalbminütigen Aufnahme.
Wolfram Knauer (Dezember 2014)
Doc. The Story of a Birmingham Jazz Man
von Frank ‘Doc’ Adams & Burgin Mathews
Tuscaloosa/AL 2012 (The University of Alabama Press)
267 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1780-5
 Frank Adams gehört zu den Musikern des Jazz, die vielleicht allein deshalb keine große Karriere machten, weil sie sich nie entscheiden konnten, in die großen Jazzstädte zu ziehen. 1928 in Birmingham, Alabama, geboren, spielte der Klarinettist und Saxophonist zwar mit Jazzgrößen wie dem jungen Sun Ra (als dieser noch Sonny Blount hieß) und in den 1940er Jahren sogar eine kurze Weile mit Duke Ellingtons Orchester, blieb, abgesehen von seinen Studienjahren an der Howard University in Washington, ansonsten aber die meiste Zeit in seiner Heimatstadt. Sogar ein Angebot der Count Basie Band lehnte er ab, weil er sich lieber um seine Familie und seine Schüler kümmern wollte. In Birmingham, Alabama, ist Frank Adams seit langem eine Jazzlegende und in der Community so beliebt, dass er allgemein nur mit seinem Spitznamen “Doc” gerufen wird.
Frank Adams gehört zu den Musikern des Jazz, die vielleicht allein deshalb keine große Karriere machten, weil sie sich nie entscheiden konnten, in die großen Jazzstädte zu ziehen. 1928 in Birmingham, Alabama, geboren, spielte der Klarinettist und Saxophonist zwar mit Jazzgrößen wie dem jungen Sun Ra (als dieser noch Sonny Blount hieß) und in den 1940er Jahren sogar eine kurze Weile mit Duke Ellingtons Orchester, blieb, abgesehen von seinen Studienjahren an der Howard University in Washington, ansonsten aber die meiste Zeit in seiner Heimatstadt. Sogar ein Angebot der Count Basie Band lehnte er ab, weil er sich lieber um seine Familie und seine Schüler kümmern wollte. In Birmingham, Alabama, ist Frank Adams seit langem eine Jazzlegende und in der Community so beliebt, dass er allgemein nur mit seinem Spitznamen “Doc” gerufen wird.
Frank Adams Autobiographie erzählt verschiedene Geschichten. Da geht es zum einen um einen Musiker, dem die Einbindung seiner Kunst in die Community immer am Herzen lag. Da geht es zum zweiten um die schwarze Gesellschaft in den tiefen Südstaaten, wo Adams’ Vater seine eigene Zeitung, den Birmingham Reporter herausgegeben hatte und die Familie eine hoch angesehene Stellung besaß. Es geht schließlich um die Erdung, die auch solche Musiker, die ihre Heimat verlassen, letzten Endes aus ihrer Herkunft erfahren, eine Erdung, wie Adams sie bei seinen Kollegen Blount (also Sun Ra) und Erskine Hawkins konstatiert.
Vor allem aber geht es um ihn selbst, um Frank Adams, der sich an seinen ersten Ton auf der Klarinette seines Bruders erinnert, ein G, und an eine eher unbeschwerte Kindheit in einer engen Familie, deren Bande mit seiner Großmutter bis fast an die Zeit der Sklaverei zurückreichten. Diese habe immer, wenn ihm etwas gelungen sei, gesagt, “No ladder child could do better”, und erst viel später sei ihm aufgegangen, dass “ladder” für “Mulatto” stand und sie ihn loben wollte, dass er als schwarzer Junge besser gewesen sei als ein hellerer Mulatte, die allgemein für klüger gehalten wurden. Der Rassismus war eben etwas, was damals wie heute nicht nur das Verhalten der Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft bestimmte, sondern auch ihr eigenes Selbstverständnis.
Zur Musik kam Adams wie so viele andere Musiker seiner Generation durch die Kirche; eines der ersten Jazzkonzerte, an das das er erinnert, war das Duke Ellington Orchester. In der Lincoln Elementary High School erhielt er Unterricht beim Neffen von W.C. Handy und spielte bald darauf in der Band von Fess Whatley, einer lokalen Legende, der Musiker wie Erskine Hawkins und andere hervorgebracht hatte. Wenig später rief Sonny Blount bei seiner Mutter an und fragte um Erlaubnis, dass ihr Sohn in seiner Band spielen könne. Adams berichtet von Sun Ras Wohnung in Birmingham, von seinem musikalischen Ansatz, von der Art und Weise, wie er seine Musiker, von denen die meisten eh keine Noten lesen konnten, improvisieren ließ, wie er von ihnen erwartete, dass sie etwas von sich selbst in ihrer Musik preisgaben. Schon in der High School hatte Adams Gelegenheit, mit verschiedenen Revue-Truppen zu touren. Nach dem Schulabschluss erhielt er dann ein Stipendium an der Howard University in Washington, D.C. Nebenbei spielte er immer wieder Ersatzgigs im Howard Theatre oder in anderen Clubs der Stadt. In dieser Zeit buchte Jimmy Hamilton ihn als Ersatz für Hilton Jefferson, der sich das Bein gebrochen hatte, für das Duke Ellington Orchester.
1950 kehrte Adams nach Birmingham zurück und nahm eine Stelle als Grundschullehrer an, die er in der Folge 27 Jahre bekleidete. Er erzählt, wie er jetzt als Lehrer den jungen Schüler das weitergab, was er einst selbst von seinen Lehrern gelernt hatte. Nebenbei trat er in den Clubs der Stadt auf und berichtet von einigen der Musiker, die in seiner Band spielten, unter ihnen etwa der Bassist Ivory Williams und der Trompeter Joe Guy, der eine Weile Billie Holidays Ehemann war. Er berichtet über sein Privatleben, Frau und Kinder, sowie über die Bürgerrechtsbewegung, die insbesondere in den amerikanischen Südstaaten alles verändern sollte.
Doc Evans’ Autobiographie ist mehr als ein musikalisches Fallbeispiel. In Zusammenarbeit mit Burgin Mathews gelingt es ihm, gelebte Geschichte erfahrbar zu machen. Er erzählt Hintergründe, die in vielen Jazzbüchern ausgeblendet werden, weil Realität Geschichte zu profan scheinen lassen kann. Das alles gelingt ihm in einem lockeren, sehr persönlich gehaltenen Ton, der die Lektüre seines Buchs zu einem Lesevergnügen werden lässt.
Wolfram Knauer (August 2014)
Creole Trombone. Kid Ory and the Early Years of Jazz
von John McCusker
Jackson/MS 2012 (University Press of Mississippi)
250 Seiten, 30 US-Dollar
ISBN: 978-1-61703-626-2
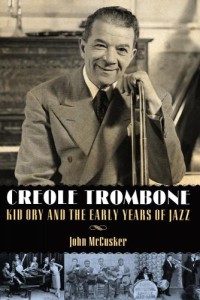 Kid Ory, meint John McCusker zu Beginn seiner Biographie, sei ein von der Jazzgeschichte zu Unrecht vernachlässigtes Brückenglied zwischen Jazzpionieren wie Buddy Bolden und späteren Jazzstars wie Louis Armstrong. Der Autor hat sich vor allem als Journalist und Fotograf für die New Orleans Times-Picayune einen Namen gemacht. Für sein Buch recherchierte er im Hogan Jazz Archive der Tulane University, konnte aber auch auf Manuskripte der Autobiographie Edward Kid Orys zurückgreifen, die ihm dessen Tochter Babette zur Verfügung stellte.
Kid Ory, meint John McCusker zu Beginn seiner Biographie, sei ein von der Jazzgeschichte zu Unrecht vernachlässigtes Brückenglied zwischen Jazzpionieren wie Buddy Bolden und späteren Jazzstars wie Louis Armstrong. Der Autor hat sich vor allem als Journalist und Fotograf für die New Orleans Times-Picayune einen Namen gemacht. Für sein Buch recherchierte er im Hogan Jazz Archive der Tulane University, konnte aber auch auf Manuskripte der Autobiographie Edward Kid Orys zurückgreifen, die ihm dessen Tochter Babette zur Verfügung stellte.
Kspan style=”font-size:10.0pt;font-family:”Arial”,”sans-serif”; mso-ansi-language:DE”>id Ory wurde 1886 auf der Woodland Plantation geboren, etwa 25 Meilen stromaufwärts von New Orleans. McCusker beschreibt die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf der Zuckerrohrplantage nach Abschaffung der Sklaverei. Er zeichnet die Herkunft der Vorfahren Orys nach, seines weißen Vaters, Sproß einer ehemaligen Sklavenhalterfamilie, sowie seiner Mutter, einer hellhäutigen Mulattin. Ory hatte sich selbst immer als Kreolen bezeichnet, was neben der Hautfarbe vor allem die Beschreibung kultureller Identität beinhaltete. Als Kind konnte er in den Gemeinden um sein Heimatdorf Kirchen- und Volkslieder hören, die meist auf Französisch gesungen wurden. James Brown Humphrey, der Leiter der Onward Brass Band, kam regelmäßig ins New Orleanser Hinterland, um den Brass Bands in den Dörfern und Plantagen ein ordentliches Repertoire zu vermitteln. All dies trug zur musikalischen Sozialisation Orys bei, der zuallererst Fan war, begeistert von der Musik, die er da hörte, die er mit Freunden nachsang, mit denen er außerdem archaische Zigarrenschachtelgeigen und -gitarren baute, während er sehnsüchtig darauf sparte, sich einmal ein richtiges Instrument leisten zu können.
Edward Orys Mutter starb, als er 14 Jahre alt war, sein Vater ein Jahr später. Der Junge lebte mit seinen Schwestern, arbeitete in einem Sägewerk und spielte in seiner Freizeit Gitarre. In einem Saloon ließ jemand den Hut herumgehen, als er den Blues spielte, und er stellte erstaunt fest, dass das Geld, das da reinkam, mehr war als er in zwei Monaten verdient hatte. 1905 reiste er zum ersten Mal nach New Orleans, wo er sich eine Ventilposaune kaufte. Die Stadt machte großen Eindruck auf ihn, noch mehr aber beeindruckte ihn sein erstes Treffen mit Buddy Bolden. McCusker beschreibt das musikalische Leben im New Orleans jener Jahre, Picknicks und Konzerte im Lincoln Park, Tanzveranstaltungen in der Masonic Hall, intensive Gottesdienste in den “Holly Roller”-Kirchen der Pfingstkirchler. Ory hörte alle möglichen Bands, aber die blues-getränkte Musik Boldens gefiel ihm am besten. 1907 zog er endgültig in die Mississippi-Metropole und schaffte es bald, seiner jungen Band ein Engagement im Lincoln Park zu verschaffen.
McCusker beschreibt die Spielorte für die Band, nennt Bandmitglieder wie Ed Garland und Johnny Dodds sowie Kollegen wie Freddie Keppard. Die Musikszene in New Orleans umfasste Brass Bands und Tanzorchester, Creole Bands, deren Mitglieder Noten lesen konnten, und Gut-Bucket Bands, die das nicht beherrschten. Zeitzeugen erzählen, dass es Ory, der sich 1909 eine Zugposaune gekauft und in der Folge seine Spieltechnik verändert hatte, damals gelungen sei, selbst einen Walzer “hot” klingen zu lassen. Die Stadt war reich Kneipen und Bordellen im Storyville-Viertel der Stadt; McCusker beschreibt die vielen “Charaktere”, und er stellt Orys eigene Aussage in Frage, ein Verhältnis mit Lulu White gehabt zu haben, der bekanntesten Zuhälterin vor Ort.
1913 hörte Ory Louis Armstrong in der Waisenhaus-Band, in der Satchmo damals seine ersten musikalischen Erfahrungen machte, und ließ ihn für ein paar Stücke einspringen. Um 1916 kam Joseph Oliver als Kornettist zu Ory, und gemeinsam entwickelten sie eine neue Art des Zusammenspiels, die sich erheblich von dem unterschied, was noch Buddy Bolden gemacht hatte. 1917 spielte die Original Dixieland Jazz Band ihre ersten Aufnahmen in New York ein, und McCusker erzählt entlang der ihm vorliegenden autobiographischen Notizen, wie das Bandkonzept der ODJB auch Ory beeinflusst habe. Das Rotlichtviertel wurde 1917 geschlossen; Oliver verließ die Stadt 1918, um nach Chicago zu gehen, und Ory ersetzte ihn durch den jungen Armstrong.
Neben der Schließung des Rotlichtviertels, neben dem allgegenwärtigen Rassismus im Süden und neben den besseren Löhnen, die man im Norden erzielen konnte, führt McCusker auch die Prohibition ins Feld, die die Kneipenszene in New Orleans verwandelte und vielen Musikern Auftrittsmöglichkeiten nahm. Ory blieb noch eine Weile, entschloss sich dann aber im August 1919 den Zug nach Los Angeles zu besteigen. Die nächsten sechs Jahre lebten er und seine Frau in Kalifornien, wo sie eine lebendige Musikszene entlang der Central Avenue in Los Angeles, aber auch an der Barbary Coast von San Francisco oder in Oakland vorfanden. Er arbeitete für die Spikes Brothers, Johnny und Reb Spikes, die damals wichtigsten Konzertorganisatoren an der Westküste, und spielte im Mai 1922 seine legendären ersten Plattenaufnahmen ein. 1925 frugen sowohl King Oliver wie auch Louis Armstrong bei Ory an, ob er nicht Lust hätte, ihren jeweiligen Bands beizutreten, die in Chicago spielten. Oliver brauchte Ersatz für seine Dixie Syncopators, und Armstrong einen regelmäßigen Posaunisten für seine Hot Five, die ja nur eine Studioband war. McCusker hört sich etliche der frühen Hot-Five-Aufnahmen an, und findet, dass es vielleicht gerade die archaische Rohheit Orys Posaune war, die diesen Aufnahmen ihren besonderen Charme verliehen. Daneben spielte der Posaunist mit Oliver und diversen anderen Bands und nahm außerdem Unterricht bei einem in Böhmen geborenen Posaunisten. Er ging mit Jelly Roll Morton und Johnny Dodds ins Studio und kehrte gegen Ende des Jahrzehnts zurück nach Kalifornien.
Hier hört McCuskers Geschichte auf, dem es vor allem um die prägende Zeit ging, jene Jahre, in denen Orys eigener Stil geprägt wurde und jene, in denen er dem Jazz seine eigene Prägung aufdrückte. Seltene Fotos ergänzen das Buch, kurze Auszüge aus dem autobiographischen Manuskript (das im Text selbst ebenfalls immer wieder länger zitiert wird) sowie die Lead Sheets für fünf von ihm nie aufgenommenen Kompositionen, unter anderem einem skurrilen Stück von 1942 mit dem Titel “Mussolini Carries the Drum for Hitler”.
“Creole Trombone” ist eine exzellente Studie zum frühen Jazz in New Orleans. John McCusker gelingt es sowohl Kid Orys Biographie in eine lesbare und nachempfindbare Linie zu bringen als auch dem Leser ein Gefühl für das Musikleben in New Orleans zu vermitteln, in dem Ory und andere Musiker seiner Generation ihr Auskommen finden mussten. Seine Mischung aus historischer Recherche, biographischen und autobiographischen Zitate sowie einem nüchternen, vorsichtig sich der Materie annähernden Stil, der jede Art von Heldenverehrung möglichst vermeidet, macht das Buch zu einer klugen Lektüre, die einen auch dort viel über die Musik lernen lässt, wo der Journalist McCusker über diese selbst eigentlich eher wenig schreibt.
Wolfram Knauer (Juni 2014)
Michel Petrucciani. Leben gegen die Zeit
von Benjamin Haley
Hamburg 2012 (edel)
288 Seiten, 29,95 Euro
ISBN: 978-3-8419-0174-3
 Roberto Saviano, der italienische Journalist und Camorra-Jäger, beginnt das Buch über Michel Petrucciani mit einer kurzen, eindringlichen Biographie des Künstlers, der Schilderung einer Karriere, die es nicht geben dürfte, weil der Künstler mit der Glasknochenkrankheit doch eigentlich nie Klavier hätte spielen können, die aber umso eindringlicher war, weil er eben nicht als behinderter Virtuose, sondern als Vollblutmusiker anerkannt und bewundert wurde, wo immer er auftrat. Michel Petruccianis Sohn Alexandre schreibt im Vorwort über seinen Vater: “Er war lustig, lachte stets und war sehr gelassen. Obwohl ihm das Leben nicht gerade die besten Karten in die Hand gegeben hatte, um trumpfen zu können. (…) Er hat dem Leben diesen Humor und diese mitreißende Freude entrissen, die man in der Mehrzahl seiner Kompositionen erlebt.”
Roberto Saviano, der italienische Journalist und Camorra-Jäger, beginnt das Buch über Michel Petrucciani mit einer kurzen, eindringlichen Biographie des Künstlers, der Schilderung einer Karriere, die es nicht geben dürfte, weil der Künstler mit der Glasknochenkrankheit doch eigentlich nie Klavier hätte spielen können, die aber umso eindringlicher war, weil er eben nicht als behinderter Virtuose, sondern als Vollblutmusiker anerkannt und bewundert wurde, wo immer er auftrat. Michel Petruccianis Sohn Alexandre schreibt im Vorwort über seinen Vater: “Er war lustig, lachte stets und war sehr gelassen. Obwohl ihm das Leben nicht gerade die besten Karten in die Hand gegeben hatte, um trumpfen zu können. (…) Er hat dem Leben diesen Humor und diese mitreißende Freude entrissen, die man in der Mehrzahl seiner Kompositionen erlebt.”
Der Autor und Musikwissenschaftler Benjamin Haley begegnete Michel Petrucciani erstmals 1995, als er in kontaktierte, weil er seine Magisterarbeit über den Pianisten schreiben wollte. Aus dem Kontakt entstand eine Freundschaft und, spätestens nach dem Tod des Pianisten, das Verlangen, dessen Leben zwischen künstlerischem Wollen und den Problemen des Alltags zu schildern. Für die vorliegende Biographie griff Haley auf eigene und bereits publizierte Interviews mit dem Pianisten zurück, führte daneben aber auch viele Gespräche mit Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen Petruccianis.
Haley beginnt seine Erzählung mit der Schilderung, wie der vierjährige Michel seine Eltern durch sein außergewöhnliches Gehör davon überzeugte, ihm erst ein Spielzeugklavier, dann ein richtiges Instrument zu besorgen. Sein Vater baute dem wachstumsgestörten Jungen eine Konstruktion, mithilfe derer er die Pedale erreichen konnte und ermunterte ihn darüber hinaus, sein Talent zu pflegen. Der Vater liebte Jazz, und als er eine Musikalienhandlung eröffnete, stellte er sicher, dass es darin auch ein Musikzimmer gab, in dem Michel üben konnte. “Ich bin nicht besonders begabt”, erklärte Michel später, “ich habe meinem Instrument nur unheimlich viel Zeit gewidmet.”
Wie erzählt man die Biographie eines so kurz gelebten Lebens? Benjamin Haley hat sich entschlossen, sie in Episoden zu erzählen. Nach dem Kindheitskapitel folgt eines über Michels Freund Manhu Roche, der ihm ein Schlagzeugset baute und ihn auf etlichen seiner Reisen begleitete. Ein weiteres Kapitel ist den Begegnungen mit großen Musikern gewidmet, Kenny Clarke etwa, Aldo Romano, Barre Phillips, aber auch einigen seiner Agenten und Produzenten. Anfang der 1980er Jahre nahm ein amerikanischer Freund Petrucciani mit nach Kalifornien und führte ihn in die Künstlerszene Big Surs ein. Der Saxophonist Charles Lloyd, der ihn dort kennenlernte, war von Petruccianis Kunst so bewegt, dass er , der sein Instrument fünf Jahre lang kaum mehr berührt hatte, ein Comeback anging. Petrucciani war schnell auch in den USA als Duopartner gefragt, spielte mit Lloyd, mit Lee Konitz, mit Charlie Haden. Er zog nach New York, trat mit seinem eigenem Trio auf, begleitet aber auch beispielsweise die Sängerin Sarah Vaughan oder spielte mit Dizzy Gillespie, David Sanborn, Stan Getz und vielen anderen.
Haley erzählt etliche der Anekdoten, von viele um den Pianisten existieren. Wie dieser die Hells Angels in Kalifornien mit Absicht gereizt habe, um dann auf einem Motorrad vornedrauf eine Runde mitzudrehen. Wie er Whitney Houston im Flieger zur Grammy-Verleihung kennengelernt habe und ihr dann in ihrem Hotelzimmer vorgespielt habe. Wie Oscar Peterson ihn erst habe abblitzen, sich dafür Jahre später aber mit Tränen in den Augen entschuldigt habe. Es sind Geschichten eines Menschen, dessen Schicksal viele betroffen machte, dessen Musik sie aber noch viel mehr berührte. Es sind Geschichten eines rastlosen Lebens zwischen den USA und Europa, eines Künstlers, der sich der Musik geweiht hatte, der daneben aber frech und lebensfroh war, Frauen genauso liebte wie gutes Essen oder Wein, der seine Prominenz genoss, weil sie ihm zeigte, dass er den Erwartungen aller ein Schnippchen geschlagen hatte.
Haleys Buch behält dabei neben allem Biographischen einen zutiefst persönlichen Ansatz, ist einem Freund gewidmet, lässt den Leser hinter die Fassade blicken. Zum Schluss finden sich einige Briefe Petruccianis an seinen Freund Manhu Roche sowie ein Ausblick auf das Nachwirken des Künstlers, der auf dem Père Lachaise in Paris nur wenige Schritte von der letzten Ruhestätte Frédéric Chopins entfernt begraben liegt.
Und als Anhang hat sich der deutsche Verlag entschlossen Petrucciani-Interviews von Ben Sidran sowie von Karl Lippegaus hinzuzufügen, der außerdem eine kommentierte Diskographie beigibt. Lippegaus ist auch der Übersetzer dieses Buchs, das nicht nur Michel-Petrucciani-Fans ans Herz gelegt sei. “Leben gegen die Zeit” erzählt weit mehr erzählt als “nur” eine Musikergeschichte. Es erzählt von der Kraft der Musik, vor allem aber von der Kraft eines mutigen, trotzigen und starken Mannes.
Wolfram Knauer (Juni 2014)
Sound Diplomacy. Music & Emotions in Transatlantic Relations 1850-1920
von Jessica C.E. Gienow-Hecht
Chicago 2012 (University of Chicago Press)
333 Seiten, 30 US-Dollar
ISBN: 978-0-226-29216-8
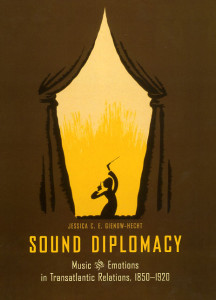 Kulturdiplomatie scheint ein Thema zu sein, das erst im Kalten Krieg entwickelt wurde, tatsächlich aber spielten kulturelle Beziehungen schon viel länger eine wichtige Rolle im politischen Geschäft, wie Jessica C.E. Gienow-Hecht in ihrem Buch über die kulturellen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland belegt. Während Frankreich auf diesem Gebiet vor allem in den Bildenden Künsten reüssierte und England allein der Sprache wegen eng mit den USA verbunden war, fokussierte sich die deutsch-amerikanische Freundschaft in den von Gienow-Hecht untersuchten Jahren 1850 bis 1920 vor allem auf die klassische Musik, und innerhalb dieser insbesondere auf Sinfonieorchester und ihre Dirigenten. Die Autorin interessieren vor allem die Konnotationen, Emotionen also, die sich mit deutscher Musik verbanden, ein seltsames Konzept von Männlichkeit und Zivilisation, das, ihrer Analyse zufolge, zumindest einen großen Teil der euro-amerikanischen Identität stark prägte.
Kulturdiplomatie scheint ein Thema zu sein, das erst im Kalten Krieg entwickelt wurde, tatsächlich aber spielten kulturelle Beziehungen schon viel länger eine wichtige Rolle im politischen Geschäft, wie Jessica C.E. Gienow-Hecht in ihrem Buch über die kulturellen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland belegt. Während Frankreich auf diesem Gebiet vor allem in den Bildenden Künsten reüssierte und England allein der Sprache wegen eng mit den USA verbunden war, fokussierte sich die deutsch-amerikanische Freundschaft in den von Gienow-Hecht untersuchten Jahren 1850 bis 1920 vor allem auf die klassische Musik, und innerhalb dieser insbesondere auf Sinfonieorchester und ihre Dirigenten. Die Autorin interessieren vor allem die Konnotationen, Emotionen also, die sich mit deutscher Musik verbanden, ein seltsames Konzept von Männlichkeit und Zivilisation, das, ihrer Analyse zufolge, zumindest einen großen Teil der euro-amerikanischen Identität stark prägte.
Gienow-Hecht beginnt ihre Studie in den 1850er Jahren, als die ersten Weltausstellungen nicht nur Warenmessen waren, sondern zugleich zu kulturellen Vergleichen animierten, neugierig machten auf fremde oder aber auf die Verwandtschaft der eigenen mit anderen Kulturen. Sie endet ihr Buch mit der Enttäuschung Amerikas über Deutschland in Folge des I. Weltkriegs und verweist im Epilog auf die Folgen der amerikanisch-deutschen Musikbeziehungen insbesondere nach dem II. Weltkrieg.
Thema ihres Buches ist zugleich die Beschreibung einer nationalen Musikkultur in Deutschland, die gerade im Dialog des kulturellen Transfers, in ihrer Spiegelung durch die amerikanische Rezeption als nationale kulturelle Identität besonders deutlich wird, und die Entwicklung einer anderen kulturellen Identität in den USA, die ihre eigene nationale Farbe im Vergleich entwickelt und am Beispiel misst. Ihr Buch betrachtet allerdings recht einseitig vor allem die Faszination amerikanischer Musiker und Hörer mit den deutschen Traditionen zwischen Beethoven und Wagner und erwähnt einzig in einer Fußnote die Tatsache, dass es bereits in derselben Zeit auch die gegenläufige Faszination europäischer Musiker und Hörer an amerikanischer Musik gab – allerdings nicht an amerikanischer Konzertmusik europäischer Provenienz, sondern an den archaischer wirkenden Spirituals der Fisk Jubilee Singers oder Unterhaltungsmusik reisender Minstrelgruppen.
Für die Jazzforschung lässt sich aus Gienow-Hechts Studie vor allem lernen, wie sie Subtexte der bi-nationalen Musikrezeption herauszuarbeiten versucht, Konnotationen beschreibt, nach ihren Ursachen fragt und ihre Auswirkungen betrachtet. Auch in der einseitigen Ausrichtung auf die amerikanische Rezeption deutscher Musik allerdings lässt sie einige Kapitel aus, die wenigstens am Rande erwähnenswert gewesen wären: die vielen Gesangsvereine etwa, die von Wisconsin bis Louisiana deutsches Musikbrauchtum pflegten zu einer Zeit, als die Unterscheidung zwischen E und U, zwischen hoher und niederer Musik noch nicht so ausgeprägt war wie im Zeitalter der Musikindustrie.
Alles in allem, eine sorgfältige Studie, die den Leser nichtsdestotrotz zu weiteren Fragen animiert, etwa nach genaueren Informationen über das Publikum, nach der Rezeption innerhalb anderer ethnischer Gruppen in den USA (also italienischen, französischen, irischen Einwanderern) und nicht zuletzt nach den Auswirkungen auf die Wahrnehmung indigener (also indianischer) oder anders-fremder (also afrikanischer bzw. afro-amerikanischer) Kulturtraditionen. Wer eine Abhandlung über gezielte politische Entscheidungen erwartet, mit Kultur Politik zu machen, wie der Titel des Buchs, “Sound Diplomacy”, wie aber vor allem unser Verständnis einer Kulturdiplomatie nach dem II. Weltkrieg erwarten lässt, wird enttäuscht. Gienow-Hecht zeigt stattdessen, wie Kultur als Sympathieträger genutzt wird, um bereits bestehende Bindungen zu stärken, und wie außermusikalische Konnotationen erkannt und genutzt werden – von amerikanischen Verteidigern europäischer Kulturtraditionen genauso wie von den europäischen Musikern und Dirigenten, die Amerika als einen großen Markt erkannten.
Wolfram Knauer (Mai 2014)
Jazz / Not Jazz. The Music and Its Boundaries
herausgegeben von David Ake & Charles Hiroshi Garrett & Daniel Goldmark
Berkeley 2012 (University of California Press)
301 Seiten, 36,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-520-27104-3
 Eine sinnvolle Definition eines Gegenstandes erhält man erst, wenn man seine Ränder beschreiben kann, wenn man also weiß, was er nicht ist. Die Frage, ob ein musikalischer Ausdruck von uns als Jazz oder nicht als Jazz beschrieben wird, sagt dabei zugleich etwas über unsere eigene ästhetische Position aus. “Jazz / Not Jazz” untersucht diese Randbereiche der Jazzdefinition, um sich so dem Gegenstand, dem Jazz selbst also, besser nähern zu können. Die Herausgeber siedeln ihr Buch dabei im Bereich der “new jazz studies” an, die den Gegenstand der Forschung immer im Kontext zu parallelen Entwicklungen, gesellschaftlichen Einflüssen, ästhetischen Zwängen oder den Auswirkungen künstlerischer Entscheidungen sehen.
Eine sinnvolle Definition eines Gegenstandes erhält man erst, wenn man seine Ränder beschreiben kann, wenn man also weiß, was er nicht ist. Die Frage, ob ein musikalischer Ausdruck von uns als Jazz oder nicht als Jazz beschrieben wird, sagt dabei zugleich etwas über unsere eigene ästhetische Position aus. “Jazz / Not Jazz” untersucht diese Randbereiche der Jazzdefinition, um sich so dem Gegenstand, dem Jazz selbst also, besser nähern zu können. Die Herausgeber siedeln ihr Buch dabei im Bereich der “new jazz studies” an, die den Gegenstand der Forschung immer im Kontext zu parallelen Entwicklungen, gesellschaftlichen Einflüssen, ästhetischen Zwängen oder den Auswirkungen künstlerischer Entscheidungen sehen.
Eric Porter blickt in seinem ersten Kapitel auf Strategien der Vereinnahmung bzw. der Distinktion in der Jazzgeschichte und der Jazzgeschichtsschreibung. Es geht um Stilvielfalt, um Akzeptanz bestimmter Entwicklungen oder der Abgrenzung anderer, um Inklusion und Exklusion sowohl innerhalb des amerikanischen Jazz als auch im globalen Verständnis von Jazz. Elijah Wood beginnt sein Kapitel mit dem Erstaunen über eine Aussage Louis Armstrongs, der in einem Blindfold Test seine unumschränkte Bewunderung für Guy Lombardo kundtat, der von der Jazzkritik eher als “King of Corn” abgetan wurde. Was, fragt Wald, faszinierte Armstrong so an Lombardos Musik, dass in seinen Aufnahmen aus den späten 1920er, frühen 1930er Jahren etwa der Klang des Saxophonsatzes deutlich an Lombardo orientiert war? Tatsächlich zeigten auch andere schwarze Bandleader Gefallen am Stil des weißen Kollegen, unter ihnen selbst Duke Ellington und Jimme Lunceford. Wald vergleicht den Einfluss Lombardos mit dem klassischer Musik auf viele der frühen Jazzmusiker und betrachtet vor diesem Hintergrund dann auch gleich noch die klassischen Erfahrungen Satchmos etwa mit Erskine Tates Orchestra.
Charles Hiroshi Garrett untersucht die humoristische Seite des Jazz, um anhand dieser Kategorie Veränderungen im Verhältnis der Musiker und ihres Publikums zu analysieren. Ken Prouty betrachtet die neuen, virtuellen Jazz Communities und ihr ästhetisches Verständnis dessen, was Jazz ist und was nicht. Er nimmt sich Plattformen wie Wikipedia oder All About Jazz vor, und analysiert neben den konkreten Inhalten auch die Veränderungen und Kommentare auf solchen Seiten. Christopher Washburn blickt auf das Phänomen das Latin Jazz und die unterschiedlichen Lokalisationen dieser Musik zwischen Afrika, Cuba, der Karibik und Lateinamerika und diskutiert das Selbstverständnis des Lincoln Center Afro-Latin Jazz Orchestra unter Leitung von Arturo O’Farrill sowie des Perkussionisten Ray Barretto.
John Howland vergleicht die unterschiedlichen Ansätze an Streicherarrangements im Jazz, von Adolph Deutschs Arrangement zu “Clap Yo’ Hands” für Paul Whiteman über Sy Olivers Arrangement zu “Blues in the Night” für Artie Shaw und Pete Rugolos “Lonesome Road” für Stan Kenton bis zu Jimmy Carrolls “Just Friends” für Charlie Parker. Daniel Goldmark diskutiert das Marketingproblem “Genre” anhand des Labels Atlantic Records und seiner Aufnahmen des Dudelsackspielers Rufus Harley und der Saxophonisten Yusef Lateef und Rahsaan Roland Kirk. Tamar Barzel beleuchtet Kompositions- und Improvisationsprozesse der New Yorker Downtown-Szene um John Zorn. Loren Kajikawa geht in seinem Beitrag von der politischen Bedeutung schwarzer Musik für den Black Revolutionary Nationalism aus und fragt nach ähnlichen Bezügen im asiatisch-amerikanischen Jazz.
Jessiva Bissett Perea fragt nach dem Stand der Jazzgesangsausbildung im Nordwesten der USA. David Ake diskutiert die unterschiedlichen Lernmethoden der Schule und der Straße, die Legenden, die sich um beide Wege zum Jazz ranken sowie die Auswirkungen dessen, wie man Musik lernt, auf die eigene Musik, ihre Ästhetik und die Art und Weise, wie sie rezipiert wird. Sherrie Tucker schließlich stellt die übliche Darstellung der Jazzgeschichte in Frage, indem sie den Blick insbesondere auf die Rolle von Frauen im Jazz richtet, und dabei nicht allein die bekannten Musikerinnen betrachtet, sondern auch Beispiele gibt, die in Jazzbüchern kaum genannt werden. Sie nimmt diesen “anderen” Blick auf den Jazz zum Anlass, sich generell mit Fragen des Forschungsinteresses im Jazz zu befassen.
“Jazz / Not Jazz” ist ein überaus anregendes Buch, das sehr unterschiedliche Ansätze versammelt, denen allen gemein ist, dass sie auf die Randbereiche dessen schauen, was wir sonst in Jazzgeschichtsbüchern oder selbst in den meisten wissenschaftlichen Publikationen über den Jazz lesen.
Wolfram Knauer (April 2014)
Oltre il Mito. Scritti sul linguaggio del Jazz
von Maurizio Franco
Lucca 2012 (Libreria Musicale Italiana)
151 Seiten, 25 Euro
ISBN: 978-88-7096-710-4
 Maurizio Franco ist ein italienischer Musikwissenschaftler, der in dem vorliegenden Buch diverse Aufsätze zu Jazzgeschichte, -ästhetik und -pädagogik zusammenfasst.
Maurizio Franco ist ein italienischer Musikwissenschaftler, der in dem vorliegenden Buch diverse Aufsätze zu Jazzgeschichte, -ästhetik und -pädagogik zusammenfasst.
Das Eingangskapitel seines Buchs befasst sich mit Sound und der Sprache des Jazz, wobei er die Soundcharakteristiken des Jazz sowohl mit solchen aus klassischer Musik vergleicht als auch mit ähnlichen Phänomenen etwa aus der Bildenden Kunst (Klangfarbe).
Zwei Kapitel widmen sich vorrangig der Improvisation: einmal dem improvisatorischen Zusammenspiel und der musikalischen Kommunikation im Ensemble; zum anderen den kreativen Prozessen, die im Improvisationsprozess stattfinden. Konkrete Beispiele untersucht er etwa anhand von Louis Armstrongs Aufnahme “Potato Head Blues” oder dem Mythos Charlie Parkers und der Realität des Bebop.
Er nähert sich der Personalstilistik Thelonious Monks und fragt nach dem Einfluss afrikanischer wie afro-lateinamerikanischer Musik auf den Jazz. Django Reinhardt erhält ein eigenes Kapitel, in dem Franco die Fusion, die dem Gitarristen zwischen Jazz und seinen eigenen Traditionen gelang, in Verbindung bringt zu späteren Projekten etwa von Anouar Brahem oder Rabih Abou-Khalil.
Die Musik Giorgio Gaslinis untersucht er im Hinblick auf die Verwendung von Dodekaphonie in seinen Kompositionen, die Musik Enrico Intras (und Luciano Berios) im Hinblick auf die Verbindungen zur elektroakustischen Musik ihrer Zeit.
In zwei abschließenden Kapiteln beschäftigt er sich dann noch mit Aspekten aktueller Jazzforschung und neuen Ansätzen für eine zeitgemäße Jazzdidaktik.
Francos Aufsätze bieten einen interessanten Einblick in einen Teil der italienischen Forschungsdiskussion (ja, es gibt nationale Unterschiede in den Ansätzen!). Sie sind Argumente in einem wissenschaftlichen Diskurs, was sich zumindest teilweise auch in der Komplexität der Texte niederschlägt. In der Gesamtheit aber ist es allemal eine bunte Mischung unterschiedlicher Ansätze, die zum weiteren Nachdenken anregt.
Wolfram Knauer (September 2013)
Rebelse Ritmes. Hoe jazz & literatuur elkaar vonden
von Matthijs de Ridder
Antwerpen 2012 (De Bezige Bij Antwerpen)
373 Seiten, 19,95 Euro
ISBN: 978-90-8542-315-7
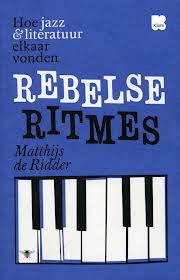 “Rebellische Rhythmen” nennt Matthijs de Ridder sein Buch, das eine Art kulturgeschichtlichen Abriss des Jazz im 20sten Jahrhundert versucht und im Untertitel das Aufzeigen von Parallelen in Jazz und Literatur verspricht.
“Rebellische Rhythmen” nennt Matthijs de Ridder sein Buch, das eine Art kulturgeschichtlichen Abriss des Jazz im 20sten Jahrhundert versucht und im Untertitel das Aufzeigen von Parallelen in Jazz und Literatur verspricht.
De Ridder interessiert sich vor allem für Beispiele aus der Jazzgeschichte, die gesellschaftlichen Wandel reflektieren. Er beginnt mit einem Kapitel über James Reese Europe, der – nomen est omen – den alten Kontinent mit einer neuen Art zu Musizieren konfrontierte. Er nähert sich dem Jazz in verschiedenen europäischen Ländern zwischen den Weltkriegen sowie der Faszination mit dieser Musik in literarischen Zeugnissen nationaler wie internationaler Autoren und betrachtet dabei konkret Belgien, Polen, die Tschechoslowakei, England, Italien, Frankreich, Dänemark und die Niederlande.
Ein Kapitel mit der Überschrift “Black, Brown en Bebop” widmet sich Duke Ellingtons Versuch, schwarze Geschichte in Musik zu fassen, als Einschub aber auch dem dunklen Kapitel der Band Charlie and his Orchestra in Hitler-Deutschland. De Ridder betrachtet Lyrik der 1940er und 1950er Jahre, die den existenzialistischen Geist nach Belgien und in die Niederlande trug. Er schreibt über die 1960er Jahre, als der Jazz auch als ein Symbol für die Bürgerrechtsbewegung gesehen wurde und er gibt Beispiele von Dizzy Gillespie über Charles Mingus, Max Roach bis Archie Shepp (und LeRoi Jones, um wieder zur Literatur zu leiten).
In einem weiteren Kapitel verbindet De Ridder die europäische Free-Jazz-Bewegung und ihre Reflexion in der Literatur der Zeit mit den 68er-Protesten. Er betrachtet die amerikanische Jazzdiplomatie von Louis Armstrong, Dave Brubeck und anderen, die für das amerikanische State Department auf Tournee in Ostblockländer geschickt wurden. Er befasst sich mit dem Protestpotential, das sich in Verbindung von Jazz und Literatur hinter dem Eisernen Vorhang entwickelte, verweist dabei insbesondere auf die Jazzsektion des tschechischen Musikerverbandes in Prag und auf Josef Skvoreckys Roman “Das Basssaxophon”. In den Jahren nach 9/11 ist ihm Gilad Atzmon und seine Vorstellung eines “musikalischen Jihad” ein eigenes Kapitel wert, das ihn bis in die jüngste Gegenwart bringt.
Matthijs de Ridders Buch wirkt im Versuch des Autoren, die gesellschaftliche Relevanz des Jazz nachzuzeichnen und zugleich Verbindungen zur literarischen Reflexion auf Jazz und Gesellschaft aufzuweisen, ein wenig wie “nicht Fisch, nicht Fleisch”. Man vergisst das jeweils andere Thema seitenweise, zumal die Beispiele, die er auswählt, durchaus repräsentativ sind und er sie interessant darstellt, und zwar sowohl die Beispiele aus der Jazzwelt wie auch jene aus der Welt der Literatur, in der neben bekannten Autoren wie Boris Vian, Paul van Ostaijen, Jean Cocteau, Claude McKay auch eine Reihe etwa belgischer oder niederländischer Autoren, die diesem Rezensenten beispielsweise bislang unbekannt waren. Es gibt also durchaus etwas zu entdecken zwischen den rebellischen Rhythmen dieser Buchseiten.
Wolfram Knauer (August 2013)
Mixed Messages. American Jazz Stories
von Peter Vacher
Nottingham 2012 (Five Leaves Publications)
314 Seiten, 14,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-907869-48-8
 Peter Vacher schreibt seit den 1970er Jahren für britische Jazzmagazine wie Jazz Journal und andere. In “Mixed Messages” hat er einundzwanzig Interviews mit amerikanischen Jazzmusikern zusammengefasst, die teils bekannter, weitgehend aber auch gar nicht so bekannt sind, die meisten von ihnen Musiker der älteren Generation, fast alle tätig im Genre des traditionellen oder des swingenden Mainstream-Jazz.
Peter Vacher schreibt seit den 1970er Jahren für britische Jazzmagazine wie Jazz Journal und andere. In “Mixed Messages” hat er einundzwanzig Interviews mit amerikanischen Jazzmusikern zusammengefasst, die teils bekannter, weitgehend aber auch gar nicht so bekannt sind, die meisten von ihnen Musiker der älteren Generation, fast alle tätig im Genre des traditionellen oder des swingenden Mainstream-Jazz.
Der Posaunist Louis Nelson erzählt über das New Orleans der 1930er und 1940er Jahre; der Bassist Norman Keenan über die Bands von Tiny Bradshaw und Lucky Millinder. Der Trompeter Gerald Wilson spricht über Einflüsse, Arrangementkonzepte und die Szene in Los Angeles, der Trompeter Fip Ricard über Territory Bands und Count Basie.
Ruby Braff äußert sich über Boston, den Jazz im Allgemeinen und Wynton Marsalis; Buster Cooper über seine Zeit mit Lionel Hampton und Duke Ellington. Ellington spielt auch im Interview mit dem Trompeter Bill Berry eine große Rolle, Hampton und Basie wiederum in den Erzählungen des Posaunisten Benny Powell.
Der Saxophonist Plas Johnson erzählt über den “Chitlin’ Circuit”, den er mit Johnny Otis und anderen Bands tourte, der Pianist Ace Carter über die Jazzszene in Cleveland, Ohio. Der Saxophonist Herman Riley berichtet über sein Leben und seine Arbeit in New Orleans und Los Angeles, der Saxophonist Lanny Morgan über seine Arbeit mit Maynard Ferguson.
Der Pianist Ellis Marsalis spricht über die moderne Jazzszene in New Orleans; der Saxophonist Houston Person über Orgel-Saxophon-Combos und seine Zusammenarbeit mit Etta Jones. Der Posaunist Tom Artin erzählt von seinen Erfahrungen auf der traditionellen Jazzszene der USA, der Trompeter von der Toshiko Akiyoshi Big Band und einem Engagement mit Bobby Short.
Der Bassist Rufus Reid nennt J.J. Johnson als role model, der Saxophonist John Stubblefield reflektiert über eine Karriere zwischen Don Byas, Charles Mingus und AACM. Judy Carmichael erzählt, wie sie dazu kam, Stride-Pianistin zu werden, Tardo Hammer über den Einfluss Lennie Tristanos. Der Trompeter Byron Stripling schließlich sagt, was er von Clark Terry lernte, wie es war mit Count Basie zu spielen, und warum die Jazzpädagogik ein wichtiges Instrument sei, das Wissen der großen Jazzmusiker weiterzureichen.
“Mixed Messages” ist eine abwechslungsreiche Sammlung von Erinnerungen an jazzmusikalische Aktivitäten, persönliche Erlebnisse und musikalische Erfahrungen. So “mixed”, wie der Buchtitel impliziert, sind die Botschaften der darin portraitierten Musiker allerdings gar nicht, dafür ist das stilistische Spektrum denn doch zu stark auf Musiker des swingenden Jazz beschränkt. Eine erkenntnisreiche Lektüre aber auf jeden Fall.
Wolfram Knauer (August 2013)
Vinyl. A History of the Analogue Record
von Richard Osborne
Farnham, Surrey 2012 (Ashgate)
213 Seiten, 55 Britische Pfund
ISBN: 978-1-4094-4027-7
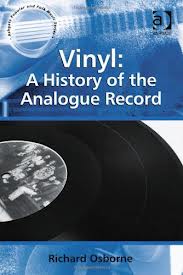 Erst wurde der Schallplatte mit dem Aufkommen der CD der Tod vorausgesagt, dann die CD durch MP3 und Downloads verdrängt. Seltsamerweise aber besteht jenes alte Musikspeichermedium weiterhin fort, und auch in Zeiten digitaler Archivierung resümieren die Experten: digital, okay, aber wir wissen nicht wie lang es hält; eine Schellackplatte dagegen ist erwiesenermaßen auch nach über 100 Jahren noch abspielbar. Richard Osborne widmet seine Studie der Analogschallplatte in jeder Form, denn auch wenn der Titel auf “Vinyl” verweist, schließt seine Darstellung auch die Vorgänger mit ein.
Erst wurde der Schallplatte mit dem Aufkommen der CD der Tod vorausgesagt, dann die CD durch MP3 und Downloads verdrängt. Seltsamerweise aber besteht jenes alte Musikspeichermedium weiterhin fort, und auch in Zeiten digitaler Archivierung resümieren die Experten: digital, okay, aber wir wissen nicht wie lang es hält; eine Schellackplatte dagegen ist erwiesenermaßen auch nach über 100 Jahren noch abspielbar. Richard Osborne widmet seine Studie der Analogschallplatte in jeder Form, denn auch wenn der Titel auf “Vinyl” verweist, schließt seine Darstellung auch die Vorgänger mit ein.
Osborne beginnt mit dem Patent für die Tonaufzeichnung über das Erstellung von Rillen und erklärt die Unterschiede der Erfindungen von Emile Berliner und Thomas Edison. Schon 1905 wurde in französischen Gerichten über das Urheberrecht bezüglich Schallaufzeichnungen gestritten, wobei das Argument dahin ging, dass, was auf Schallplatten an Texten vorhanden war, mit einer Lupe und entsprechender Übung zu lesen sein müsste, und daher das literarische Urheberrecht auch für Tonträger zu gelten habe. Im Kapitel über die Rille (“the groove”) reflektiert Osborne aber auch über Substantiv und Verb (the groove, to groove), über den rhythmischen Drive, der bei der rotierenden Schallplatte auditiv wie visuell wahrgenommen werden könne, über Experimente mit Schallplatten zwischen musique concrète und HipHop sowie über “Tod und den Groove”, die Tatsache also, dass man die Rillen der schwarzen Scheibe auch zu Tode hören könne.
Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit dem Format des Tonträgers Schallplatte zwischen Zylinder und Schellackplatte unterschiedlicher Größe. Es geht um die Labelgestaltung, wobei beim Label genau das gemeint ist, der Aufkleber in der Mitte der beiden Plattenseiten, die anfangs nur reine Information über das auf der Platte Enthaltene weitergab und später mehr und mehr zur Identifikation des “Labels”, also der Plattenfirma, wurde.
In den 1930er Jahren fand der neue Stoff Polyvinylchlorid Eingang in die Plattenindustrie und wurde zum Beispiel für die Produktion von Rundfunksendungen benutzt. Das Material war härter, erlaubte engere Rillen und konnte daher mehr Musik speichern. Anfang der 1940er Jahre wurde Schellack rationiert und daher presste man die legendären V-Discs der Kriegstage auf Vinyl; im Anschluss experimentierte das Label RCA mit Vinylproduktionen auch für kommerzielle Veröffentlichungen. Osborne erklärt ganz allgemein die Produktion von Platten von der Aufnahme bis zum fertigen Produkt, diskutiert die Auswirkungen der Plattenproduktion auf die Haltung der Künstler unterschiedlicher Genres, aber auch Reaktionen des Publikums und Weiterentwicklungen der Industrie.
Ein eigenes Kapitel widmet er dem Phänomen der Langspielplatte. Osborne beschreibt, wie längere Stücke Musik vor dem Zeitalter der LP präsentiert wurden, nennt Beispiele für Langspielplatten vor dem Zeitalter der Microgroove-LPs, die ersten Vinyl-LPs für Columbia und die britische EMI und diskutiert konkrete Beispiele, etwa die Präsentation klassischer Musik oder der Musik von Frank Sinatra auf LP, sowie die Idee des Konzeptalbums im Jazz oder die Probleme und Chancen der “B-Seite”. Neben dem Langspielformat gab es andere Formate, etwa die 45-RPM-Single, die 12-Inch-Single, die Osborne in eigenen Kapiteln behandelt. Schließlich geht er auf die Bedeutung der Covergestaltung für die Schallplatte ein, die weit mehr war als bloß ein Werbeträger, sondern ein Lebensgefühl vermitteln konnte.
Richard Osbornes Buch geht die Geschichte der Schallplatte pragmatisch an, verweist nur dort auf musikalische Genres, wo diese für das Medium oder das Medium für sie von Bedeutung sind. Sein Buch gibt einen brauchbaren Überblick, wirft genügend Fragen auf, beantwortet aber ganz bewusst nicht alle. Natürlich ließen sich das physikalische Aufnahme- und Wiedergabeverfahren noch exakter untersuchen, der gegenseitige Einfluss von Markt und Platte, unterschiedliche Vertriebsstrukturen, der Umgang mit neuen Aufnahmeverfahren, Live versus Studio und vieles mehr an Themen, die hier nur gestreift werden. Osbornes Verdienst ist vor allem sein breiter Ansatz, der Verbindungslinien zwischen Bessie Smith, Hillbilly-Musik, Motown-Sound und HipHop erlaubt und damit die Faszination richtig wiedergibt, die man bis heute in Schallplattenantiquariaten erfahren kann, in denen jede einzelne Scheibe wie eine kraftvolle Aussage wirkt, die im Diskurs der anderen mithalten will und kann. Ein ausführliches Literaturverzeichnis und ein Sach- und Personenindex runden das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2013)
Live at Montreux. Portraits
herausgegeben von Joe Bendinelli Negrone
Hamburg 2012 (Ear Books / Edel)
212 Seiten, 2 DVDs, 29,95 Euro
ISBN: 978-3-943573-00-8
 Claude Nobs gründete das Montreux Jazz Festival 1967 und machte es schnell zu einem der angesehensten Sommerfestivals der Welt. Das gelang ihm nicht nur, weil er mit vielen der Künstler befreundet war, sondern auch, weil er ein gutes Händchen dabei hatte, Plattenfirmen einzubinden, die die Konzerte dokumentierten und den Namen der Veranstaltung in aller Welt bekannt machten.
Claude Nobs gründete das Montreux Jazz Festival 1967 und machte es schnell zu einem der angesehensten Sommerfestivals der Welt. Das gelang ihm nicht nur, weil er mit vielen der Künstler befreundet war, sondern auch, weil er ein gutes Händchen dabei hatte, Plattenfirmen einzubinden, die die Konzerte dokumentierten und den Namen der Veranstaltung in aller Welt bekannt machten.
Auf 2012 Seiten präsentiert das vorliegende Buch Musikerfotos aus all diesen Jahren, in Schwarzweiß genauso wie in Farbe, mit den Musikern meist auf der Bühne, ab und an aber auch abseits der Bühne, vor dem Bandbus etwa (Muddy Waters) oder beim Tennisspielen (Dizzy Gillespie). Je Musiker zwei Seiten, ein Foto und eine knappe biographische Einordnung durch Alex Kandelhardt, das alles ohne erkennbare Ordnung.
Jazzmusiker und Musiker aus Rock, Pop und Soul durcheinander mit klarem Schwergewicht auf den populäreren Stilrichtungen – nicht ganz zu unrecht, hat sich Montreux doch schon lange vom reinen Jazz- zu einem populären …-und-auch-Jazz-Festival gewandelt.
Ein wenig schade ist es aber doch, dass dem Jazz auf den beiheftenden zwei DVDs kaum Tribut gezollt wird, abgesehen von einem Track der Band Weather Report, und weiteren von Nina Simone, George Benson und Quincy Jones. So ist der schwere Prachtband vor allem eine Erinnerung oder ein Coffee-Table-Geschenk an Montreux-Besucher, denen die Genreübergriffe noch nie etwas ausmachten.
Wolfram Knauer (Juli 2013)
Yes to the Mess. Surprising Leadership Lessons from Jazz
von Frank J. Barrett
Boston 2012 (Harvard Business Review Press)
202 Seiten, 27 US-Dollar
ISBN: 978-1-4221-6110-4
 Schon seit einigen Jahren wird Jazzimprovisation auch außerhalb der Musikschulen untersucht, insbesondere im Feld der Organisationswissenschaft, wo Jazz als Modell für besseres Management gehandelt wird. An den Studien beteiligt sind Wissenschaftler und Musiker aus den USA genauso wie aus Europa. Wissenschaftlich wird das Thema meist in Fachzeitschriften und wissenschaftlichen Aufsatzsammlungen abgehandelt, jetzt aber auch in dem eine breitere Leserschaft ansprechenden Buch des “Professor of Management and Global Public Policy” Frank J. Barrett. Der hat auf der einen Seite eine Dissertation über Organisationsverhalten geschrieben, auf der anderen Seite aber auch als Jazzpianist gearbeitet, und zwar nicht nur im Freundeskreis, sondern durchaus mit namhaften Kollegen, etwa als Pianist des Tommy Dorsey [Ghost] Orchestra.
Schon seit einigen Jahren wird Jazzimprovisation auch außerhalb der Musikschulen untersucht, insbesondere im Feld der Organisationswissenschaft, wo Jazz als Modell für besseres Management gehandelt wird. An den Studien beteiligt sind Wissenschaftler und Musiker aus den USA genauso wie aus Europa. Wissenschaftlich wird das Thema meist in Fachzeitschriften und wissenschaftlichen Aufsatzsammlungen abgehandelt, jetzt aber auch in dem eine breitere Leserschaft ansprechenden Buch des “Professor of Management and Global Public Policy” Frank J. Barrett. Der hat auf der einen Seite eine Dissertation über Organisationsverhalten geschrieben, auf der anderen Seite aber auch als Jazzpianist gearbeitet, und zwar nicht nur im Freundeskreis, sondern durchaus mit namhaften Kollegen, etwa als Pianist des Tommy Dorsey [Ghost] Orchestra.
Barrett beginnt mit einem aktuellen Beispiel. Unternehmen, schreibt er, hätten in der Regel Pläne für alles Mögliche, nur richte sich die Realität nicht nach diesen Plänen. Das Umwelt-Disaster von Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im April 2010 sei ein Beispiel dafür, wie alle Pläne bei unerwarteten Ereignissen nicht ausreichten und wie die Erfahrungen des Jazz im Unternehmensmanagement dazu beitragen könne, auf Unvorhergesehenes angemessen und produktiv zu reagieren. Barrett beschreibt das Improvisations-Paradox, dass also Jazzmusiker ihr ganzes Leben lang Phrasen und Patterns lernten, nur um diese nach Möglichkeit vergessen zu können, um auf musikalische Situationen angemessen reagieren zu können. Es sei die erlernte Sicherheit der (musikalischen) Sprache, die ihnen letztlich eine angemessene Reaktion erlaube.
In einem eigenen Kapitel ermutigt Barrett Manager, zum Durcheinander zu stehen, das sich aus der Entwicklung neuer Unternehmenskonzepte zwangsläufig ergebe. Auch hier weisen Jazzmusiker den Weg, erklärt er: Egal wie verworren musikalische Situationen erschienen, gelinge ihnen immer ein positiver Weg hin zu neuen Ufern. Barrett analysiert die verschiedenen Kompetenzen, die Jazzmusiker dazu befähigten, miteinander zu improvisieren und aufeinander zu reagieren und versucht aus seinen Beobachtungen Lehrsätze für die Organisationsforschung abzuleiten.
Ein eigenes Kapitel widmet Barrett der Gleichzeitigkeit von Performance und Experiment, dem Anerkennen von Fehlern als Ursache weiteren Lernens. Zwischenüberschriften wie “Taking Advantage of Errors” oder “Constructive Failure” zeigen dabei beispielhaft, wie er versucht, die Jazzerfahrungen ins Managementverhalten zu übersetzen.
In einem strukturkritischen Kapitel versucht er dem geheimnis auf den grund zu gehen, wie man maximaler Autonomie bei minimalen Strukturen erreichen könne. Er analysiert dabei den Zusammenhang zwischen Autonomie und Gruppendynamik auseinandersetzt und verlangt von Vorgesetzten, ihre Mitarbeiter als Individuen ernst zu nehmen.
“Learning and Hanging Out” heißt ein Kapitel, in dem Barrett Lernmuster analysiert, die er als sozialen Prozess beschreibt und als Investition in die Zukunft von Mitarbeitern genauso wie von Unternehmen. “Solo und Begleitung” überschreibt er ein weiteres Kapitel, in dem es darum geht, dass die Führungsrolle selten einem Einzelnen zustehe, wenn man das meiste aus der versammelten Kompetenz eines Unternehmens herausholen wolle. Zum Schluss des Buchs finden dann noch Merksätze, sozusagen “für die improvisierende Führungskraft”.
Barretts Buch ist auf diejenigen Kollegen im Managementbereich gerichtet, die sich mit Möglichkeiten einer anderen, einer inklusiveren und einer arbeitsteiligeren Unternehmungsführung befassen. Tatsächlich aber kann der Blick von außen, der Blick auf die Kompetenzen des Jazz auch vielen Musikern und Jazzliebhabern die Augen und Ohren öffnen. Barrett verweist auf viele aktuelle Beispielen, aus der Geschichte des Jazz genauso wie aus der Welt der Wirtschaft, und sorgt so für eine sachliche und dabei durchaus auch vergnügliche Lektüre dieses komplexen Themengebiets.
Wolfram Knauer (Juli 2013)
Miles Davis. The complete illustrated history
herausgegebene von Michael Dregni
Zürich 2012 (Edition Olms)
224 Seiten, 35 Euro
ISBN: 978-3-283-01211-3
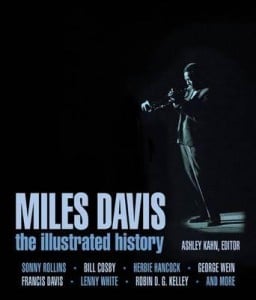 “The complete illustrated history” – der Untertitel des Buchs verrät den Ansatz: eine Mischung aus Biographie, musikalischer Würdigung und Fotoband über eine der schillerndsten Gestalten der Jazzgeschichte. Herausgeber Michael Dregni hat nicht nur namhafte Autoren verpflichtet, unter ihnen Ashley Kahn, Robin D.G. Kelley, Francis Davis, Gerald Early, Greg Tate, sondern darüber hinaus auch Stimmen von Musikerkollegen eingesammelt.
“The complete illustrated history” – der Untertitel des Buchs verrät den Ansatz: eine Mischung aus Biographie, musikalischer Würdigung und Fotoband über eine der schillerndsten Gestalten der Jazzgeschichte. Herausgeber Michael Dregni hat nicht nur namhafte Autoren verpflichtet, unter ihnen Ashley Kahn, Robin D.G. Kelley, Francis Davis, Gerald Early, Greg Tate, sondern darüber hinaus auch Stimmen von Musikerkollegen eingesammelt.
So erzählt Clark Terry etwas über die Musikszene in St. Louis in den 1940er Jahren und die Trompeter-Tradition in der Stadt, aber auch über die Tatsache, das Miles ihn, Clark Terry, immer wieder als einen seiner wichtigen Einflüsse bezeichnet habe. Sonny Rollins verrät, dass er zum ersten Mal 1948 mit Davis gespielt habe. Bill Cosby reflektiert über Miles, die Mode-Ikone. Vincent Bessières erzählt, wie Miles Davis 1949 zum ersten Mal nach Frankreich kam und sich in Paris verliebte. George Wein berichtet von Davis’ Auftritt beim Newport Jazz Festival 1955. Ron Carter und Herbie Hancock unterhalten sich über das Quintett der 1960er Jahre. Lenny White nimmt sich die Fusion-Periode und das Album “Bitches Brew” vor, auf dem er selbst mitwirkte. Nalini Jones schreibt über Miles’ teils agressive Beziehungen zu Frauen; Gerald Early betrachtet den Trompeter als Boxer und “black male hero”. Dave Liebman schließlich hat das Schlusswort, erinnert sich an Miles Tod, an die Trauerfeier.
Neben all diesen erhellenden Texten, die durchaus Neues über den Trompeter berichten, enthält das Buch jede Menge an Fotos, neben bekannten Bildern etliche, die zumindest dieser Rezensent noch nie gesehen hat, neben Fotos von Miles und seinen diversen Bands auch Abbildungen von Programmheften, Plattenlabels und -covern, Konzertanzeigen, Clubinterieurs – das alles in exzellenter Druckqualität. Ein schönes Buch zum Blättern, lesen und natürlich zum Vertiefen, während Aufnahmen des Meisters hört.
(Das einzige Manko des Buchs ist ein eher bibliographisches: Der Herausgeber Michael Dregni wird nur im Kleingedurckten am Ende des Bandes genannt, weder auf Umschlag noch sonstwo im Vortext. Aber das muss Dregni wohl mit den Herausgebern der amerikanischen bzw. britischen Originalausgabe klären; der vorliegende Band ist eine beim Schweizer Verlag Edition Olms gedruckte Lizenzausgabe.)
Wolfram Knauer (Juli 2013)
You’ll Know When You Get There. Herbie Hancock and the Mwandishi Band
von Bob Gluck
Chicago 2012 (University of Chicago Press)
262 Seiten, 37,50 US-Dollar
ISBN: 978-0-226-30004-7
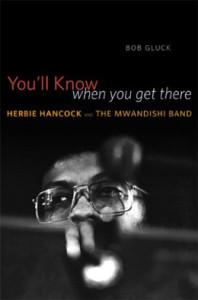 Herbie Hancocks Mwandishi-Band entstand aus seinem Sextett und wurde eine der einflussreichsten Bands, mit der er international von sich Reden machte. Die Bandmitglieder, neben Hancock der Bassist Buster Williams, der Schlagzeuger Billy Hart, der Saxophonist Bennie Maupin, der Posaunist Julian Priester und der Trompeter Eddie Henderson, nahmen alle Swahili-Namen an und formten Hancocks Ästhetik zwischen Bebop, Gospel, Blues, den psychedelischen Klängen zeitgenössischer Pop- und Soulmusik sowie den Klangexplorationen eines Karlheinz Stockhausen und anderer.
Herbie Hancocks Mwandishi-Band entstand aus seinem Sextett und wurde eine der einflussreichsten Bands, mit der er international von sich Reden machte. Die Bandmitglieder, neben Hancock der Bassist Buster Williams, der Schlagzeuger Billy Hart, der Saxophonist Bennie Maupin, der Posaunist Julian Priester und der Trompeter Eddie Henderson, nahmen alle Swahili-Namen an und formten Hancocks Ästhetik zwischen Bebop, Gospel, Blues, den psychedelischen Klängen zeitgenössischer Pop- und Soulmusik sowie den Klangexplorationen eines Karlheinz Stockhausen und anderer.
Bob Gluck erzählt die Geschichte der Band von den ersten bis zu den letzten Konzerten und widmet sich der Musik, die im Studio oder bei Konzerten aufgenommen wurde. Er setzt all das in den musikalischen wie gesellschaftlichen Kontext der Zeit, also Miles Davis, Black Power-Bewegung, Soul-Musik, Studentenbewegung, afrozentrische Symbolik und so weiter und so fort.
Gluck beginnt im November 1970 mit einem Engagement, das das Hancock Sextett im Chicagoer London House wahrnahm und bei dem sich bei ihm und seinen Mitmusikern eine Art spirituelle Wahlverwandtschaft herauskristallisierte, die Musikalisches, Persönliches und Weltanschauliches mit einander verband und ihnen klar machte, dass diese Band Potential hätte.
Im zweiten Kapitel geht Gluck zurück, erzählt Hancocks Lebensgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt, Kindheit, Jugend, erste musikalische Erfahrungen, Einflüsse wie Oscar Peterson, Hardbop oder Gospel, seine ersten Platten unter eigenem Namen, seine Zeit im Miles Davis Quintet, einen ästhetischen Weg zwischen Abstraktion und Emotion. Im nächsten Kapitel schildert er Hancocks Weg in die Selbständigkeit mit seinem ersten Sextett, das sich 1969 gründete, mit dem er bis ins Frühjahr 1970 unterwegs war und in dem er sein Interesse an elektronischen Instrumenten vertiefte. Ein eigenes Kapitel widmet sich genau diesen Soundexperimenten, die Hancock vor allem mit dem E-Piano und später mit Synthesizern vorantrieb. Gluck beschreibt die Verwendung elektrischer Instrumente auf “Bitches Brew”, “Fat Albert Rotunda” und als eine Möglichkeit des Sounddesigns.
Am 31. Juli 1970 wurde Hancocks Band in dem Woolman Rink im New Yorker Central Park gebucht, um als Vorgruppe für die populäre kalifornische Rockband Iron Butterfly zu spielen. Seine Musik erreichte das Publikum, das eigentlich einer ganz anderen Klangästhetik anhing, sicher auch wegen der Elektrifizierung der Instrumente, ihrer ganz anderen Soundästhetik und wegen der Möglichkeit die Lautstärke höher zu drehen. Bald jedenfalls wurde die Band auch auf andere Rockbühnen gebucht, insbesondere San Franciscos Fillmore West. Dann kam das London-House-Engagement, das Gluck bereits im ersten Kapitel seines Buchs beschrieben hatte, und Ende 1970 schließlich die Plattensitzung zum Album “Mwandishi”, dem Gluck ein eigenes Kapitel widmet und dabei nicht nur auf Erinnerungen der beteiligten Musiker zurückgreift, sondern die Musik darüber hinaus kritisch beleuchtet und analysiert. Im Dezember 1971 folgte die LP “Crossing”, für das Gluck den musikalischen Gehalt, aber auch die Technik der Prostproduction analysiert. Hancock brachte hierfür den Elektronikpionier Patrick Gleeson mit ins Boot, der bald ein siebtes Mitglied der Band wurde und Hancock dabei half, Dinge, die zuvor nur als Postproduction möglich waren, auch live umzusetzen, was 1972 schließlich im Album “Sextant” mündete.
Glücks widmet ein eigenes Kapitel der Idee musikalischer Kollektivität und der “open form”. Er stellt dafür die Experimente der Free-Jazz-Pioniere der 1960er Jahre der intuitiven freien Form gegenüber, die Miles Davis in seinen Bands entwickelte und beschreibt, wie Hancock aus beidem sein eigenes Bandkonzept formte. Er beleuchtet konkret die Benutzung von Ostinati, den Zusammenhang zwischen Form und musikalischem Fortschritt, und die Idee von Musik als spiritueller Praxis. Im vorletzten Kapitel geht Gluck auf kritische Stimmen ein, die Hancocks Tourneen der Jahre 1971 bis 1973 begleiteten. Musikalisch ging es weit voran, finanziell aber ließ sich die Band nicht länger halten. 1973 rief sein Management Hancock zu einem dringenden Treffen und erklärte ihm, dass er mit dieser Band nur drauflegte und sein durch Hits wie “Watermelon Man” mühsam Erspartes durchbringe. Eddie Henderson nahm noch zwei LPs unter eigenem Namen auf, bei der die meisten der Mwandishi-Mitglieder mitwirkten. Im Frühjahr 1973 ging die Band ein letztes Mal ins Studio, um den Soundtrack zum Film “The Spook Who Sat by the Door” einzuspielen. Im letzten Kapitel schließlich sammelt Gluck Stimmen von Musikerkollegen wie Bobby McFerrin, Wallace Roney, Billy Childs, Christian McBride, Mitchel Forman, Pat Metheny, Victor Lewis, und Mitgliedern der Band King Crimson , die bezeugen, wie sehr sie ihre Mwandishi-Erfahrungen beeinflusst hätten.
Glucks Buch beleuchtet ein in der Jazzgeschichte wenig behandeltes Kapitel der Fusion aus Jazz und Rock. Ihm gelingen analytische Annäherungen an die Aufnahmen, vor allem aber gelingt ihm ein Blick hinter die Beweggründe einer Band, die ihrer Zeit klanglich weit voraus schien und entsprechenden Einfluss hatte. Er schafft bei seinen Lesern ein Verständnis für die Aufnahmen der Herbie Hancock Mwandishi-Band, die er ins ästhetische und gesellschaftliche Umfeld ihrer Zeit einbettet. Glucks Gespräche mit den Bandmitgliedern vermitteln Insiderwissen, insbesondere in den analytischen Absätzen gerät die Lektüre allerdings stellenweise schon mal recht trocken. Ein ausführlicher und bis ins Detail aufgeschlüsselter Index erlaubt einen schnellen Zugang zu einzelnen Sachverhalten.
Wolfram Knauer (Juni 2013)
Dameronia. The Life and Music of Tadd Dameron
von Paul Combs
Ann Arbor 2012 (University of Michigan Press)
264 Seiten, Hardcover, 50 US-Dollar
ISBN: 978-0-472-11413-9
 Tadd Dameron ist einer der vielleicht am meisten unterbewerteten Musiker des Bebop, Pianist, vor allem aber Komponist und Arrangeur, der von seinen Kollegen hoch geschätzt wurde und dessen harmonische Weiterungen zum Teil bereits in seiner Arbeit für Jimmie Lunceford in den 1930er Jahren zu hören waren. In den 1950er Jahren verschwand er immer wieder von der Szene und starb 1965 im Alter von gerade mal 48 Jahren an den Folgen eines Hirntumors.
Tadd Dameron ist einer der vielleicht am meisten unterbewerteten Musiker des Bebop, Pianist, vor allem aber Komponist und Arrangeur, der von seinen Kollegen hoch geschätzt wurde und dessen harmonische Weiterungen zum Teil bereits in seiner Arbeit für Jimmie Lunceford in den 1930er Jahren zu hören waren. In den 1950er Jahren verschwand er immer wieder von der Szene und starb 1965 im Alter von gerade mal 48 Jahren an den Folgen eines Hirntumors.
Paul Combs widmet sein jüngst erschienenes Buch der Biographie Damerons genauso wie seiner Musik, und ihm gelingt damit ein gar nicht so leichter Spagat: ein Buch nämlich, das in flüssigem Stil sowohl die Lebensgeschichte Damerons erzählt als auch analytische Annäherungen an Damerons Stil enthält, die der Autor, wo nötig, auch mit Notenbeispielen verdeutlicht.
Combs beginnt in Cleveland, Ohio, wo Dameron 1917 zur Welt kam, und er sammelt, was immer er an biographischen Notizen zur Jugend des Pianisten findet. 1935 machte Tadd seinen Schulabschluss und arbeitete anschließend in der Band seines Saxophon spielenden Bruders Caesar und mit anderen vor allem regional aktiven Orchestern. In Interviews gab er meist 1938 als das Jahr an, an dem seine professionell Karriere begann, als er ein erstes Arrangement an die populäre Jeters-Pillars Band verkaufte. Combs hat hier wie an anderen Stellen seines Buchs Schwierigkeiten Fakten zu verifizieren, auch weil Dameron in Interviews voneinander abweichende Abweichungen über seine Karriere machte. 1940 jedenfalls befand Dameron sich in Kansas City und schrieb für Harlan Leonard. Von dessen Band auch stammen die ersten Tondokumente für Damerons Arrangierkunst, “Rock and Ride” und “400 Swing”, für die Combs nicht nur die Platten zur Analyse dienen, sondern beispielsweise auch der Klavierpart, den er im Nachlass der Pianistin Mary Lou Williams entdeckte.
Nach einem Jahr in Kansas City zog es Dameron nach New York, wo ihn Jimmie Lunceford als Arrangeur in sein Orchester holte. Combs beschreibt diverse der Arrangements aus dieser Zeit, aber auch Damerons “Mary Lou” für seine Kollegin aus Kansas City, das er offenbar für Andy Kirk geschrieben haben muss, das aber zu seinen Lebzeiten nie aufgeführt worden war. Bei Lunceford machte sich Dameron einen Namen als interessanter und verlässlicher Arrangeur, und so schrieb er bald schrieb auch für andere Bands, seit 1943 etwa für Count Basie. After hours gehörte er zu den Stammgästen der Bebop-Kneipen seiner Zeit, Minton’s Playhouse etwa oder Monroe’s Uptown House, wo er sich auch ans Klavier traute und enge Freundschaft mit Dizzy Gillespie und anderen Beboppern schloss. In seiner Kapitelüberschrift geht Combs gar so weit, Dameron als “Architekten des Bebop” zu bezeichnen, verfolgt darin dann seine Arbeit etwa für Modernisten wie Gillespie, Billy Eckstine, Georgie Auld, aber auch weitere Charts für Lunceford oder Buddy Rich. Einen größeren Markt erreichten seine Arrangements für Sarah Vaughans Musicraft-Aufnahmen vom Mai 1946. Gillespie ermutigte Dameron zu kompositorischen Experimenten, der Sänger Babs Gonzalez ermutigte ihn, sich mehr als Pianist einzubringen. 1948 spielte er mit Fats Navarro, Dexter Gordon und mit seiner eigenen Band im neuen Royal Roost in New York. Dort trat zur selben Zeit auch Miles Davis mit seiner Capital Band auf, und etwa zur selben Zeit wie Miles’ “Birth of the Cool” spielte auch Dameron Aufnahmen mit einer größeren Besetzung ein.
Mit Miles reiste Dameron 1949 zum ersten Mal nach Paris, um am dortigen Jazzfestival teilzunehmen, wenig später war er für ein paar Monate in London. Zurück in den USA schrieb er Arrangements für Ted Heath und Artie Shaw, verschwand dann in den frühen 1950er Jahren von der Szene, offensichtlich aus Gründen, die mit seinem Drogenkonsum zu tun hatten. Combs findet ihn in Cleveland und Atlantic City, hört Dameron-Arrangements von Bull Moose Jackson und die LP “A Study in Dameronia”, für die der Pianist den jungen Clifford Brown engagiert hatte. 1956 nahm er “Fontainebleau” auf, schrieb Arrangements für Carmen McRae und wurde im April zum ersten Mal wegen Drogenbesitz verhaftet. Die zweite Verhaftung im Januar 1958 führte zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe, die Dameron in Lexington, Lexington, Kentucky, absitzen musste. Nach seiner Entlassung 1961 versuchte er seine Karriere wiederzubeleben und schrieb unter anderem Titel für Benny Goodmans Russland-Tournee. Im Frühsommer 1964 erhielt Dameron die Krebs-Diagnose; gut ein halbes Jahr später starb er kurz nach seinem 48sten Geburtstag.
Combs Buch gelingt die Verbindung von Biographie und Analyse, die den einen oder anderen Rezensenten bereits zur abfälligen Bemerkung verleitete, sein Buch benutze zu viele Fachausdrücke. Tatsächlich aber gibt Combs damit jedem seiner Leser genau das, was er möchte: Über die analytischen Teile kann man nämlich leicht und ohne Informationsverlust springen, kann auf der anderen Seite aber auch einzelne Titel heraussuchen und Combs analytische Einordnungen studieren. Ein ausführlicher Fußnotenapparat und ein ungemein exakt aufgeschlüsseltes Register ergänzen das Buch, das jedem seiner Leser gewiss ein neues und ziemlich umfassendes Bild dieses zu Unrecht oft vergessenen Komponisten gibt.
Wolfram Knauer (Mai 2013)
Wail. The Life of Bud Powell
von Peter Pullman
New York 2012 (Bop Changes)
476 Seiten, 19,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-9851418-1-3
Direktbezug über: www.wailthelifeofbudpowell.com
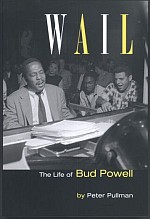 Die Geschichte des Jazz ist die Geschichte seiner Personen – und dabei oft die Geschichte gebrochener Persönlichkeiten. Dies ist weniger dem Fakt geschuldet, dass alle großen Jazzmusiker gebrochene Persönlichkeiten gewesen seien als vielmehr der Tatsache, dass über solche scheinbar weit leichter zu berichten ist als über Musiker ohne Macken, ohne psychische oder Suchtprobleme. Diese Tatsache führt allerdings auch dazu, dass Musiker recht schnell und ohne weiterreichende Recherche in eine Schublade gesteckt wurden, “Junkie”, “Alkoholiker”, “mentale Probleme”.
Die Geschichte des Jazz ist die Geschichte seiner Personen – und dabei oft die Geschichte gebrochener Persönlichkeiten. Dies ist weniger dem Fakt geschuldet, dass alle großen Jazzmusiker gebrochene Persönlichkeiten gewesen seien als vielmehr der Tatsache, dass über solche scheinbar weit leichter zu berichten ist als über Musiker ohne Macken, ohne psychische oder Suchtprobleme. Diese Tatsache führt allerdings auch dazu, dass Musiker recht schnell und ohne weiterreichende Recherche in eine Schublade gesteckt wurden, “Junkie”, “Alkoholiker”, “mentale Probleme”.
Der New Yorker Journalist und Autor Peter Pullman hat sich bereits seit langem mit Bud Powells Leben und Musik befasst, nicht zuletzt im Text des ausführlichen Begleitbüchlein zu einer CD-Ausgabe aller Verve-Einspielungen des Pianisten, das ihm eine Grammy-Nominierung einbrachte. Spätestens dabei biss er sich am Leben und Schaffen des Pianisten fest, ging in Archive, sprach mit Zeitzeugen, durchwühlte die Jazzpresse und veröffentlichte schließlich sein Buch “Wail. The Life of Bud Powell”, das ohne große Umschweife als “definitive” Bud-Powell-Biographie bezeichnet werden muss.
Pullman beginnt mit der Familiengeschichte des Pianisten, mit den Großeltern und Eltern. Er zeichnet deren soziale und Lebenssituation in Petersburg, Virginia, nach, der Region, aus der Powells Eltern kamen, genauso wie jene in Harlem, wo Bud Powell am 27. September 1924 geboren wurde. Buds Vater war selbst Pianist, und Powell bezeichnete ihn des öfteren als den besten Stride-Pianisten in Harlem. Bud nahm Klavierunterricht und trat etwa 1935 erstmals öffentlich auf, wahrscheinlich bei einer jener legendären Rent Parties, und vielleicht mit dem “Carolina Shout” von James P. Johnson, dem ersten Jazzstück, das er eigenen Angaben zufolge gemeistert hatte. Hier und in anderen Harlemer Clubs kam er mit Kollegen wie Willie ‘The Lion’ Smith oder Art Tatum zusammen, hier entwickelte er die Grundlagen eines Stils.
Pullman sieht auf die jungen Musiker, die Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre bei Jam Sessions in Harlem ihre eigenen musikalischen Ideen entwickelten. Wann immer er konnte, nahm Powell an solchen Sessions Teil, spielte daneben Anfang der 1940er Jahre aber auch Tanzmusik mit weniger bekannten Bandleadern. Pullman beschreibt, wie Kenny Clark, Thelonious Monk und andere sich bei Sessions im Minton’s oder im Monroe’s Uptown House mit harmonischen Weiterungen der Jazzsprache beschäftigten, wie Powell und Elmo Hope gemeinsam Bachs Klaviermusik studierten, oder welchen Einfluss insbesondere Monks Ästhetik auf den jungen Pianisten hatte. 1943 wird sein Spiel erstmals in der Fachpresse hervorgehoben; Powell spielte damals erst mit der Band George Treadwells, dann im Orchester des Trompeters Cootie Williams, mit dem er auch seine ersten Platteneinspielungen machte.
Es waren sicher nicht die Frustrationen, die Musiker in solchen Bigbands hatten und die Pullman beschreibt, die zu Powells mentalen Problemen führten. Diese jedenfalls manifestierten sich erstmals Mitte der 1940er Jahre. Im Januar 1945 wurde er für fast drei Monate in die Psychiatrie eingewiesen, mit der Diagnose “Manisch-depressive Psychose, Manischer Typ”. Nach seiner Entlassung spielte der Pianist erst in Dizzy Gillespies Band, bald mit beiden der Heroen des Bebop, Dizzy und Charlie Parker.
Powells Bebop-Karriere sieht ihn mit Kollegen wie Diz, Bird, Dexter Gordon, J.J. Johnson, aber auch mit ersten eigenen Projekten. Wegen seines Anschlags, erzählt Pullman, war Powell auf der 52nd Street als “Hammerfinger” bekannt. Seine Gesundheit aber führte zu dauernden Querschlägen: Nach nur einem Drink, erklärt Pullmann, konnte seine Verfassung ganz plötzlich umkippen. Eines Abends geriet er in einen Kampf und wurde verwundet ins Krankenhaus eingeliefert, das ihn wegen seiner Verhaltensauffälligkeit gleich weiter an die Psychiatrie überwies.
In einem eigenen Kapitel widmet sich Pullmann nun der Krankengeschichte Powells, seines Verhältnisses zum Vater, beschreibt den Kontext, in dem psychiatrische Therapien 1947 durchgeführt wurden, aber die Elektroschocktherapie, der der Pianist im Frühjahr 1948 unterzogen wurde. Erst nach fast einem Jahr wurde Powell wieder in die Obhut seiner Mutter entlassen.
Ende 1948 landete Bud einen längeren Gig im Clique Club (dem späteren Birdland), wo er feststellte, dass er selbst mittlerweile zu einem Einfluss auf andere Pianisten geworden war. Er machte erste Aufnahmen für Blue Note, hatte bald ein längeres Engagement im neuen Birdland, spielte Platten für Norman Granz’ Label Mercury ein. Er vertraute sich einem eigenen Manager an, und damit begann für ihn eine Zeit der musikalischen genauso wie der psychischen Stabilität. Mitte der 1950er Jahre aber gab es auch wieder Rückfälle, Engagements, bei denen Powell Schwierigkeiten hatte, einen Set zu Ende zu bringen. Pullman erklärt die Umstände verschiedener Aufnahme-Sessions und in einem eigenen Kapitel Powells ersten Europa-Besuch, den er 1956 im Rahmen der Tournee “Birdland 56” absolvierte und bei dem er erstmals in Paris, den Niederlanden und Deutschland zu hören war.
Diese Europa-Reise hatte ihn offenbar so beflügelt, dass der Pianist sich wenig später entschloss, für länger nach Paris zu gehen. Pullman beschreibt die Pariser Jazzszene der Zeit zwischen Existenzialismus und Exil-Amerikanern, als Powell ein Dauerengagement im Club Saint-Germain erhielt, zwischendurch aber auch durch Europa tourte. Der Pariser Gig brachte Stabilität ins Leben des Pianisten, erzählt Pullman, schildert daneben etwa eine Begegnung Powells mit Duke Ellington, der gerade in der Stadt weilte, um den Film “Paris Blues” zu drehen, oder ein Treffen Powells und Thelonious Monks, die im selben Konzert auftraten, was zu Konkurrenzängsten insbesondere bei Monk führte. 1962 nahm Powell ein längeres Engagement im Kopenhagener Café Montmartre an, wo er den damals noch minderjährigen Niels Henning Ørsted-Pedersen unter seine Fittiche nahm.
Nach seiner Rückkehr nach Paris ging es wieder bergab. Powell, der immer Personen in seinem Leben brauchte, die sich um ihn kümmern, freundete sich nun mit Francis Paudras an, einem Fan, der sich darum bemühte, dass Powell genug zu essen hatte, dass er möglichst nicht zu viel trank, dass sein Tagesablauf konstant blieb. All das findet sich Jahrzehnte später in Bertrand Taverniers Film “Round Midnight” wieder, in dem Dexter Gordon den Saxophonisten Dale Turner verkörpert, eine Art Komposit aus Powells und Lester Youngs Biographien. Paudras also wurde Powells neuer Vertrauter, mit ihm reiste er im August 1964 für ein Engagement im Birdland zurück nach New York. Die amerikanische Presse berichtete breit über die Rückkehr des Pianisten, und als Paudras einen Monat später am Flughafen auf Powell wartete, die beiden Rückflugtickets in der Hand, wartete er vergebens. Ein neuer Manager sicherte sich die Vertretung des Pianisten, aber Powells Magie schien dahin, seine Konzerte, schildert Pullman, waren für alle Beteiligten teilweise nur noch peinlich. Im Juli 1966 wurde Powell erneut ins Krankenhaus eingeliefert, wenig später fiel er in ein Koma, aus dem er nicht mehr erwachte.
In “Wail. The Life of Bud Powell” gelingt Peter Pullman eine Annäherung an den Menschen, den Pianisten, den Komponisten und den Patienten Bud Powell, die dieses Buch zum Standardwerk über sein Leben und seine Kunst machen dürfte. Pullman hat es im Eigenverlag herausgebracht, was die angesichts des schier erschlagenden Informationsreichtums stellenweise schon recht anstrengende Bleiwüste entschuldigen mag. Man wünschte sich inhaltlich Kapitelüberschriften (statt einfach nur “Kapitel eins, zwei, drei”) und strukturierende Zwischenüberschriften auch innerhalb der Kapitel; man wünschte sich den einen oder anderen das Lesen erleichternden Anhang, etwa eine biographische Timeline oder zumindest eine ansatzweise Diskographie. Dass Pullman gänzlich auf Fotos verzichtet, mag eine Kostenentscheidung gewesen sein. Immerhin erschließt ein ausführlicher Index das Buch. Solch kritische Empfehlungen des Rezensenten allerdings ließen sich in einer etwaigen zukünftigen Neuauflage leicht erfüllen und sind nur Marginalien angesichts der “labor of love”, die Peter Pullman in diese wirklich definitive Bud-Powell-Biographie gesteckt hat.
Wolfram Knauer (Mai 2013)
Jazz unter Ulbricht und Honecker. Mein musikalisches Leben in der DDR
von Frieder W. Bergner
Ottstedt am Berge 2012 (Selbstverlag)
212 Seiten, 18 Euro (inklusive Versand) + CD: 21 Euro (inklusive Versand)
Bezug über www.friederwbergner.de
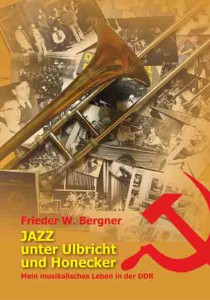 24 Jahre ist die Wende mittlerweile her, und ein paar Bücher haben die Jazz- und Bluesgeschichte der DDR bereits mit mehr oder weniger Abstand dokumentiert. Geschichte aber ist immer eine Schnittmenge der Erinnerung vieler Einzelner, und eine solche Erinnerung ist die des Posaunisten Frieder Bergner, dessen autobiographische Erzählung aus der Subjektivität des Autors heraus die Liebe zum Jazz und seine Musikerkarriere in den Kontext des gesellschaftlichen Alltags einbettet.
24 Jahre ist die Wende mittlerweile her, und ein paar Bücher haben die Jazz- und Bluesgeschichte der DDR bereits mit mehr oder weniger Abstand dokumentiert. Geschichte aber ist immer eine Schnittmenge der Erinnerung vieler Einzelner, und eine solche Erinnerung ist die des Posaunisten Frieder Bergner, dessen autobiographische Erzählung aus der Subjektivität des Autors heraus die Liebe zum Jazz und seine Musikerkarriere in den Kontext des gesellschaftlichen Alltags einbettet.
1954 in Zwickau geboren, zog Bergner 1960 nach Saalfeld, wo sein Vater als Ingenieur an der Herstellung des Zeiss Rechenautomaten mitarbeitete. Er berichtet von schweren Schuljahren und von seinen ersten musikalischen Gehversuchen bei den Thüringer Sängerknaben, mit denen er auf Tournee ging und von Zeit zu Zeit auch große Konzerte gab. Er erhielt Klavier- und Posaunenunterricht, würzt seine Berichte darüber mit Details des real existierenden Sozialismus, mit Geschichten über FDJler, die nach Westen gerichtete Fernsehantennen von den Häusern rissen, über den Besuch eines australischen Brieffreunds, dem bei der Einreise beinahe die drei LPs, die er als Geschenke mitgebracht hatte, abgenommen wurden, oder über seine erste Auslandsreise nach Ungarn. 1972 wurde Bergner an der Musikhochschule Dresden akzeptiert, kurz darauf allerdings bereits zum Wehrdienst einberufen, den er größtenteils als Sanitäter ableistete.
Als er das Studium wieder aufnahm, war er vom Unterricht bei Günter Hörig fasziniert; er erzählt von seiner Arbeit mit Studentenbands und von Musik zwischen modernem Jazz, Avantgarde und Rock ‘n’ Roll. Bergner arbeitete im Rundfunkblasorchester Leipzig, im Orchester Walter Eichenberg, später auch in der Leipziger Radio Big Band und schließlich auch in freien Ensembles, insbesondere im Duo mit dem Schlagzeuger Wolfram Dix. Mit der Hannes Zerbe Blechband reiste er in die Sowjetunion; 1984 zog er nach Weimar, wo er an der Musikhochschule unterrichtete, und spielte Mitte der 1980er Jahre erstmals im Westen Deutschlands in der Begleitband Joy Flemmings. Seine Anekdoten beleuchten das Leben im Osten Deutschlands genauso wie die Neugier auf die vermeintliche Freiheit im Westen. Vor allem beleuchten sie ein politisches System, das sich mehr und mehr selbst ad absurdum führt. Als einer seiner Studenten wegen Republikflucht angeklagt wird, muss Bergner aussagen, und seine Schilderung der Verhandlung und der Vorbereitung zu ihr liest sich wie das eine Fabel über einen untergehenden Staat.
Dem Titel entsprechend endet Bergers Rückschau auf sein Leben vor der Wende 1989 mit dem Ende der DDR. Es ist keine Geschichte des Jazz im Osten Deutschlands, sondern eine sehr persönliche autobiographische Erzählung, bei der Jazz eine genauso wichtige Rolle spielt wie persönliche Erlebnisse, politische Haltung, Freunde, Bekannte, Beziehungen, der Kampf mit dem Alkohol. Was Bergner mit diesem Ansatz gelingt, ist eine lesenswerte Atmosphäreschilderung, die vielleicht noch mehr an Information über das Gefühl eines Lebens in der DDR vermittelt als es nüchtern-sachliche Berichte vermögen würden.
Dem Buch liegt (bei Interesse) ein CD-Sampler mit Aufnahmen Bergners aus den Jahren zwischen 1979 und 2008 und in diversen Besertzungen und stilistischen Ausrichtungen bei.
Wolfram Knauer (Mai 2013)
James P. Johnson. 17 Selected Solos for Piano
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2009 (Blue Black Jazz)
Enthält: “The Harlem Strut”; “Carolina Shout”; “Riffs”; “Feeling Blue”; “Jingles”; “Crying for the Caroline”; “Modernistic”; “If Dreams Come True”; “Mule Walk Stomp”; “A Flat Dream”; “Daintiness Rag”; “I’m Gonna Sit Right Down”; “Keep Off the Grass”; “I’m Crazy ‘Bout My Baby”; “Twilight Rag”; “Jersey Sweet”; “Liza”
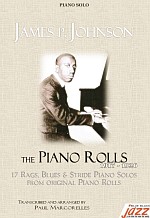 James P. Johnson. The Piano Roles, 1917-1926. 17 Rags, Blues & Stride Piano Solos from Original Piano Rolls
James P. Johnson. The Piano Roles, 1917-1926. 17 Rags, Blues & Stride Piano Solos from Original Piano Rolls
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2011 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Mama’s Blues”; “Caprice Rag”; “Steeplechase Rag”; “Stop It”; “Carolina Shout”; “Eccentricity”; “It Takes Love to Cure the Heart’s Disease”; “Dr. Jazz’s Razz Ma Taz”; “Roumania”; “Arkansas Blues”; “Joe Turner Blues”; “Harlem Strut”; “Railroad Man”; “Black Man”; “Charleston”; “Harlem Choc’late Babies on Parade”; “Sugar”
James P. Johnson, Volume 2. 17 Selected Solos for Piano
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2012 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Bleeding-Hearted Blues”; “You Can’t Do What My Last Man Did”; “Toddlin'”; “Scouting Around”; “Snowy Morning Blues”; “What Is This Thing Called Love”; “Fascination”; “Blueberry Rhyme”; “Squeeze Me”; “Honeysuckle Rose”; “Old Fashioned Love”; “Gut Stomp”; “Concerto Jazz-a-Mine”; “Keep Movin'”; “Arkansas Blues”; “Carolina Balmoral”; “Ain’t Cha Got Music”
Willie The Lion Smith. 16 Original Solos for Piano
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2009 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Concentratin'”; “Sneakaway”; “Echoes of Spring”; “Morning Air”; “Finger Buster”; “Fading Star”; “Rippling Waters”; “Stormy Weather”; “I’ll Follow You”; “Passionette”; “What Is There to Say?”; “Here Comes the Band”; “Cuttin’ Out”; “Portrait of the Duke”; “Zig Zag”; “Contrary Motion”
 Fats Waller, Volume 1. 17 Famous Solos for Piano
Fats Waller, Volume 1. 17 Famous Solos for Piano
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2009 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Blue Black Bottom”; “Numb Fumblin'”; “Love Me or Leave Me”; “Valentine Stomp”; “I’ve Got a Feeling I’m Falling”; “Smashing Thirds”; “Turn on the Heat”; “My Fate Is In Your Hands”; “African Ripples”; “Hallelujah”; “California, Here I Come”; “You’re the Top”; “Because Of Once Upon a Time”; “Faust Waltz”; “Intermezzo”; “Carolina Shout”; “Honeysuckle Rose”
Fats Waller, Volume 2. 17 Solos for Piano
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2009 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Muscle Shoals Blues”; “Birmingham Blues”; “Handful of Keys”; “Baby Oh, Where Can You Be?”; “Sweet Savannah Sue”; “Viper’s Drag”; “Alligator Crawl”; “Keepin’ Out of Mischief Now”; “Tea for Two”; “The London Suite: Piccadilly / Chelsea / Soho / Bond Street / Limehouse / Whitechapel”; “Rockin’ Chair”; “Rind Dem Bells”
Fats Waller, Volume 3. 18 Piano Greats
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2010 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Ain’t Misbehavin'”; “Gladyse”; “Waiting At the End of the Road”; “Goin’ About”; “My Feelings Are Hurt”; “Clothesline Ballet”; “Alligator Crawl”; “‘E’ Flat Blues”; “Zonky”; “Russian Fantasy”; “Basin Street Blues”; “Star Dust”; “I Ain’t Got Nobody”; “Hallelujah”; “St. Louis Blues”; “Then You’ll Remember Me”; “Georgia On My Mind”; “Martinique”
Donald Lambert. 15 Great Solos for Piano
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2009 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Anitra’s Dance”; “Pilgrim’s Chorus”; “Sextet”; “Elegie”; “Russian Lullaby”; “People Will Say We Are in Love”; “Hold Your Temper”; “Tea for Two”; “Trolley Song”; “Russian Rag”; “Save Your Sorrow”; “Pork and Beans”; “I’m Just Wild About Harry”; “As Time Goes By”; “Jumps”
Boogie Woogie. 17 Original Boogie-Woogie and Blues Piano Transcriptions
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2011 (Blue Black Jazz)
Enthält: Jimmy Blythe: “Chicago Stomp”; Clarence Pine Top Smith: “Jump Steady Blues”; Jimmy Yancey: “Yancey Stomp”, “The Mellow Blues”, “Yancey Bugle Call”; Albert Ammons: “Boogie Woogie Stomp”, “Suitcase Blues”, “12th Street Rag”, “Mecca Flat Blues”; Meade Lux Lewis: “Yancey Special”, “Honky Tonk Train Blues”; Pete Johnson: “Answer to the Boogie”, “Bottomland Boogie”, “Mr. Freddie Boogie”, “Shuffle Boogie”; Count Basie: “Boogie Woogie”; Mary Lou Williams: “Mary’s Boogie”
Preis je Heft: 44,95 Euro (PDF-Version); 51,95 Euro (gedruckte Version inkl. Versand innerhalb Europas)
Bestellung über: www.blueblackjazz.com
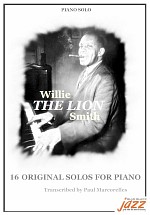 Stride Piano ist vielleicht eine der virtuosesten Spielarten des frühen Klavierjazz. Man spürt die Verankerung des Ragtime genauso wie jenes vorwärtstreibende Moment des Swing, die klaren Bässe und die verzierenden Melodieumspielungen, eine unbändige Lebensfreude, die einen fast unwillkürlich schmunzeln, lächeln, lachen lässt, wenn eine Melodie in seine Bestandteile auseinandergenommen wird, wenn der Pianist plötzlich in jenen typisch-antreibend-swingenden Rhythmus verfällt, wenn Riffs entstehen, linke und rechte Hand miteinander korrespondieren, plötzliche Umkehrungen der Oompah-Figuren der linken Hand einen kurzfristig aus der Bahn werfen, um gleich wieder in die Time zurückzufinden.
Stride Piano ist vielleicht eine der virtuosesten Spielarten des frühen Klavierjazz. Man spürt die Verankerung des Ragtime genauso wie jenes vorwärtstreibende Moment des Swing, die klaren Bässe und die verzierenden Melodieumspielungen, eine unbändige Lebensfreude, die einen fast unwillkürlich schmunzeln, lächeln, lachen lässt, wenn eine Melodie in seine Bestandteile auseinandergenommen wird, wenn der Pianist plötzlich in jenen typisch-antreibend-swingenden Rhythmus verfällt, wenn Riffs entstehen, linke und rechte Hand miteinander korrespondieren, plötzliche Umkehrungen der Oompah-Figuren der linken Hand einen kurzfristig aus der Bahn werfen, um gleich wieder in die Time zurückzufinden.
Paul Marcorelles hat das Stride-Idiom der großen Meister studiert und nun im Selbstverlag eine Reihe an Transkriptionsbänden herausgebracht, die ambitionierte Pianisten eine ganze Weile am Üben halten werden. Drei Bände mit insgesamt 51 Klaviersoli von James P. Johnson (darunter ein Band mit 17 Soli, die Marcorelles von Klavierwalzenaufnahmen abgehört hat), ebenso drei Bände mit insgesamt 52 Soli Fats Wallers, ein Band mit 16 Soli Willie “The Lion” Smiths, ein Band mit 15 Transkriptionen Donald Lamberts sowie ein Band mit 17 klassischen Boogie-Woogie-Titeln halten den Käufer / Spieler für eine Weile am Instrument. Die Klassiker sind dabei, etwa Johnsons “Carolina Shout” sowohl in der Version des Komponisten als auch in einer Fats Wallers, oder Johnsons legendärer “Charleston”, Wallers “Honeysuckle Rose”, “Ain’t Misbehavin'” oder seine komplette “London Suite” von 1938, Willie Smiths “Echoes of Spring” inder Transkription einer Aufnahme von 1965 oder sein seltenes “Contrary Motion”.
Die drei Bände mit Soli von James P. Johnson sind wahrscheinlich “the real thing”. Johnson gilt zu Recht als Vater des Stride; seine Stücke sind Klassiker, und seine Art der Interpretation ist bei aller Virtuosität am kantigsten. Neben frühen Hits wie “Modernistic” oder “If Dreams Come True” enthalten die drei Hefte auch späte Stride-Beispiele aus den 1940er Jahren, Titel, die den direkten Zusammenhang zwischen ihm und Thelonious Monk deutlich werden lassen (etwa seine Interpretation über Gershwins “Liza”). Mit dem “Concerto Jazz-A-Mine” von 1945 ist außerdem eines seiner Werke vertreten, das auf klassische Ambitionen zumindest verweist.
Die drei Waller-Alben enthalten wohl die meisten schon in anderen Transkriptionen oder transkriptions-ähnlichen Arrangements veröffentlichten Titel. “Numb Fumblin'”, “Valentine Stomp”, “Smashing Thirds” oder “African Ripples” erlauben damit (wem’s gefällt) auch einen interessanten Vergleich der Transkriptionsfassungen. Waller ist der Klassiker der hier vertretenen Pianisten: Seine musikalischen Ideen sind auch dort melodisch-harmonisch begründet, wo er in wildes Stride-Spiel ausbricht.
Willie “The Lion” Smith muss als der Lyriker unter den Stride-Pianisten gelten; zugleich ist er einer der späteren Vertreter des Stils wie die Tatsache belegt, dass die Transkriptionen, die Marcorelles vorlegt, aus den Jahren 1938 bis 1965 stammen. Neben Eigenkompositionen sind in diesem Heft auch Standards enthalten wie “Stormy Weather” oder ein emphatisches “What Is There to Say”, außerdem seine Hommage an Duke Ellington, “Portrait of the Duke”.
 Das Buch mit Donald Lamberts Soli enthält unter anderem Interpretationen klassischer Kompositionen wie Edvard Griegs “Anitra’s Dance”, Richard Wagners “Pilgrim’s Chorus” aus “Tannhäuser”, Gaetano Donizettis “Sextet” aus “Lucia di Lammermoor” und Jules Massenets “Elegie”; die von Lambert genommenen Tempi (oft Viertel = 240 und mehr, wie überhaupt die häufigste Tempoangaben in allen neun Heften “Presto” lautet) sind wohl erst nach erheblichen Fingerübungen einzuholen. Lamberts Version von Luckey Roberts “Pork and Beans” zeigt deutlich die Verankerung des Stride im klassischen Ragtime;
Das Buch mit Donald Lamberts Soli enthält unter anderem Interpretationen klassischer Kompositionen wie Edvard Griegs “Anitra’s Dance”, Richard Wagners “Pilgrim’s Chorus” aus “Tannhäuser”, Gaetano Donizettis “Sextet” aus “Lucia di Lammermoor” und Jules Massenets “Elegie”; die von Lambert genommenen Tempi (oft Viertel = 240 und mehr, wie überhaupt die häufigste Tempoangaben in allen neun Heften “Presto” lautet) sind wohl erst nach erheblichen Fingerübungen einzuholen. Lamberts Version von Luckey Roberts “Pork and Beans” zeigt deutlich die Verankerung des Stride im klassischen Ragtime;
Der Boogie-Band schließlich enthält Klassiker des Genres, Interpretationen von Jimmy Blythe, Clarence Pine Top Smith, Jimmy Yancey, Albert Ammons, Meade Lux Lewis (“Honky Tonk Train Blues”), Pete Johnson, Count Basie und Mary Lou Williams. Die typischen Boogiebässe bestimmen das Notenbild, rohe und ungeschliffene Klangausbrüche, energiegeladene Improvisationen und ab und an (insbesondere bei Pete Johnson) Anklänge ans Harlem Stride Piano, das auch die Blueser nicht kalt ließ.
Marcorelles notiert klassisch, was letzten Endes auch bedeutet, dass der Spieler den richtigen Swing selbst empfinden muss. Wie immer bei Transkriptionen lohnt der Vergleich mit der originalen Aufnahme (und hier hätte man sich eine exaktere Identifikation der Platte gewünscht, von der die einzelnen Transkriptionen genommen wurden), aber mit einiger Hörerfahrung wird es gelingen, die Stücke selbst dann zum Treiben zu bringen, wenn man sie zur Einstimmung erheblich langsamer nimmt als in den halsbrecherischen Tempi der Meister.
Transkriptionsfehler sind in diesen Heften kaum zu entdecken; ein Bleistift in der Nähe des Klaviers ist dennoch ganz hilfreich, um etwa Vorzeichenänderungen fortzuschreiben oder einzelne Noten schon mal enharmonisch zur harmonischen Basis passend darzustellen (was dem Rezensenten aber auch nur an ein oder zwei Stellen auffiel). Marcorelles verzichtet auf harmonische Analyse und Harmoniesymbole, also die Motivation zur Weiterimprovisation, aber wer diese Stücke meistert wird wahrscheinlich so in Schwung sein, dass die Hände allein weiterswingen.
Wolfram Knauer (Mai 2013)
Jazz en la BNE. El ruido alegre
von Jorge García
Madrid 2012 (Biblioteca Nacional de Espagna)
238 Seiten, 40 Euro
ISBN: 978-84-92462-24-7
 Jorge García hat die Geschichte des Jazz in Spanien an dem Ort erforscht, der alle Dokumente zur spanischen Geschichte sammelt: der Biblioteca Nacional de Espana in Madrid. Die von ihm kuratierte Ausstellung war in der spanischen Nationalbibliothek zu sehen. Wer sie nicht gesehen hat, kann das alles in diesem wunderschön gestalteten Katalog nachvollziehen, der den Leser zweisprachig (spanisch, englisch) in Wort und Bild durch die Rezeption des afro-amerikanischen Jazz in Spanien führt.
Jorge García hat die Geschichte des Jazz in Spanien an dem Ort erforscht, der alle Dokumente zur spanischen Geschichte sammelt: der Biblioteca Nacional de Espana in Madrid. Die von ihm kuratierte Ausstellung war in der spanischen Nationalbibliothek zu sehen. Wer sie nicht gesehen hat, kann das alles in diesem wunderschön gestalteten Katalog nachvollziehen, der den Leser zweisprachig (spanisch, englisch) in Wort und Bild durch die Rezeption des afro-amerikanischen Jazz in Spanien führt.
García beginnt mit Belegen über Minstrel-Shows, Cakewalk-Künstler, die frühen Modetänze, die noch vor dem I. Weltkrieg in Europa ankamen. Den Begriff “Jazz” selbst weist er zum ersten Mal im Januar 1918 in einer spanischen Zeitung nach, wenn er dort auch – wie anderswo in Europa auch – als Begriff für einen neuen Tanz verwandt wurde. Er findet Dokumente über frühe Musiker wie den Pianisten Billy Arnold, der angeblich Darius Milhauds Faszination am Jazz weckte, und er beleuchtet Musiker wie den Kubaner Ernesto Lecuona, der 1924 in Spanien ankam und großen Erfolg hatte. Als afro-amerikanische Musik eroberte der Jazz mit Tourneen wie denen von Josephine Baker, Louis Douglas oder Harry Fleming das Land. Sam Woodings Besuch im Jahr 1929 und Jack Hyltons Tournee ein Jahr später sind für García die Geburtsstunde eines spanischen Jazz. Nicht nur die Intellektuellen und Künstler des Landes seien damals nämlich von der Musik fasziniert gewesen, sondern auch Musiker, die danach strebten, “hot” zu spielen. Parallel zu ähnlichen Entwicklungen in anderen europäischen Städten gab es in Barcelona seit 1934 einen Hot Club, der unter der Franco-Diktatur aber wieder geschlossen wurde.
García streift die Haltung des faschistischen Regimes zum Jazz, die zu einem Jazzverbot im Rundfunk führte, dass clevere Radiomacher dadurch umgingen, dass sie die Aufnahmen einfach als “moderne Musik” bezeichneten. Er beleuchtet den Nachkriegsjazz mit Zentren insbesondere in Madrid und Barcelona, wo es sowohl eine gute spanische Szene gab als auch regelmäßig amerikanische Musiker zu hören waren. Seit den 1960er Jahren gab es zudem große Festivals wie das in San Sebastián, und Musiker wie Tete Montoliu oder Pedro Iturralde machten sich auch im Ausland einen Namen. Schon damals, mehr aber noch in den 1980er Jahren und später, entdeckten spanische Musiker die Zusammenhänge zwischen Jazz und ihren heimischen Klängen, insbesondere baskischer Volksmusik oder dem Flamenco. García erwähnt noch kurz die neue Generation an Musikern, die ihre Kunst mittlerweile wie anderswo auch an Hochschulen und Universitäten lernen kann.
Diesem knappen Durchgang durch die spanische Jazzgeschichte stehen im Hauptteil des Buchs die Abbildungen von Dokumenten aus der BNE gegenüber, Notenausgaben, Zeitungsausrisse, Programmflyer, Plakate, Cover von Jazzzeitschriften, Platten und CDs, Fotos einheimischer wie zu Besuch befindlicher Musiker, Comicbücher, die sich mit dem Jazz befassen und vieles mehr.
“Jazz en la BNE. El ruido alegre” ist damit ein lesens- genauso wie blätternswertes Buch, ein knapper Abriss spanischer Jazzgeschichte, der Anhaltspunkte gibt, nirgends wirklich die Musik beschreibt, aber durchaus neugierig macht auf das, was da seit 1920 an “fröhlichem Lärm” (so die Übersetzung des Untertitels des Buchs) zu hören war.
Wolfram Knauer (April 2013)
Benny Goodman’s Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert
von Catherine Tackley
New York 2012 (Oxford University Press)
223 Seiten, 17 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-539831-1
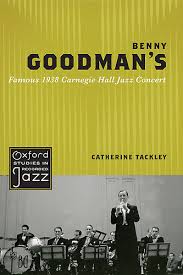 Benny Goodmans Carnegie-Hall-Konzert schrieb Jazzgeschichte, nicht nur, weil Benny Goodman eine der heiligsten Hallen des amerikanischen Musiklebens mit Jazz füllte, nicht nur, weil er bei jenem legendären Konzert am 16. Januar 1938 mit schwarzen wie weißen Musikern auftrat, sondern vor allem, weil die Musik, die an jenem Abend erklang, 1950 auf Langspielplatte herauskam und seither immer wieder veröffentlicht worden ist.
Benny Goodmans Carnegie-Hall-Konzert schrieb Jazzgeschichte, nicht nur, weil Benny Goodman eine der heiligsten Hallen des amerikanischen Musiklebens mit Jazz füllte, nicht nur, weil er bei jenem legendären Konzert am 16. Januar 1938 mit schwarzen wie weißen Musikern auftrat, sondern vor allem, weil die Musik, die an jenem Abend erklang, 1950 auf Langspielplatte herauskam und seither immer wieder veröffentlicht worden ist.
Die britische Musikwissenschaftlerin Catherine Tackley nähert sich der Legende des Carnegie-Konzert-Konzerts von unterschiedlichen Seiten. In einem ersten Abschnitt ihrer Monographie untersucht sie den Kontext, in dem das Konzert stand, die Bedeutung von Konzerten für und die Zusammensetzung des Publikums von Jazz in jenen Jahren, die Idee zum Konzert sowie die Entscheidungen zum Programmablauf.
Ein zweiter Teil des Buchs geht auf die Musik des Abends ein, wobei Tacklei keine Takt-für-Takt-Analyse vorlegen, sondern die Musik in einen Kontext einbetten will. Sie beschreibt die einzelnen Titel, vergleicht sie mit früheren Aufnahmen, verweist auf deutliche Einflüsse oder klar von Goodman verschiedene musikalische Konzepte der Swingära, stellt die Bedeutung des Arrangeurs Fletcher Hendersons für den Bigbandsound Goodmans heraus, fragt nach Konnotationen von Stücken wie “Loch Lomond” oder “Bei mir bist du schoen”. Sie analysiert die “Twenty Years of Jazz”, die der Klarinettist mitten im Konzert Revue passieren lässt, wobei sie besonders die von den Musikern evozierten Klischees von Jazzgeschichte herausstellt. Ähnlich geht sie die Jam Session über “Honeysuckle Rose” an, bei der neben Goodman und einigen seiner Musiker auch Kollegen aus den Bands von Count Basie und Duke Ellington zugegen waren. Schließlich widmet sie sich selbstverständlich noch den Trio- und Quartettteilen des Konzerts. Dieser ganze Abschnitt ihres Buchs arbeitet sowohl mit analytischen Anmerkungen als auch mit Transkriptionen.
Teil 3 ihres Buchs ist überschrieben mit “Representation” und beschäftigt sich mit der Legendenbildung um das Carnegie-Hall-Konzert, mit den diversen Schallplattenveröffentlichungen und ihrer Rezeption sowie mit späteren Versuchen Goodmans (durchaus auch in der Carnegie Hall) an das Konzept und den Erfolg des Konzerts anzuknüpfen
Tackley gelingt es insbesondere im Hauptteil ihres Buchs, ihre Analyse in die Beschreibung des Konzertgeschehens einzupassen. Ihr Text liest sich flüssig und spannend und sei damit nicht nur Goodman- oder Swingfans zur Lektüre empfohlen, sondern darüber hin aus jedem, der sich mit der Jazzgeschichte als einer Geschichte von Legenden befasst.
Wolfram Knauer (April 2013)
Putte Wickman, klarinettist
von Jan Bruér
Göteborg 2012 (Bo Ejeby Förlag)
286 Seiten, beiheftende CD, 250 Schwedische Kronen
ISBN: 978-91-88316-66-0
 Jan Bruér hat mit diesem Buch die definitive Biographie des schwedischen Klarinettisten Putte Wickman vogelegt. Wickmans Karriere begann Anfang der 1940er Jahre; mit 19 wurde er 1943 zum professionellen Musiker. Wickmann spielte Swingmusik mit einem Hang zum Modernen. Während andere europäische Klarinettisten seines Kalibers bald in die USA auswanderten (Åke Hasselgard, Rolf Kühn), blieb Wickman in Schweden. Er spielte Platten meist in kleinen, durchaus an Benny Goodman orientierten Besetzungen ein, erst unter anderen Bandleadern, dann ab Mitte der 1940er Jahre vor allem mit einem Sextett unter eigenem Namen. 1949 traf er beim Pariser Jazzfestival auf Charlie Parker, der seine Stilistik nachhaltig beeinflusste. In den 1950er Jahren wurde er einer der populärsten Jazzmusiker Schwedens und war regelmäßig auch anderswo in Europa zu hören, 1959 sogar bei einem Gedenkkonzert für Sidney Bechet in der New Yorker Carnegie Hall. Ab den 1970er Jahren gehörte Wickman zu den Veteranen des schwedischen Jazz und trat des öfteren mit seinen Mit-Veteranen Bengt Hallberg oder Arne Domnérus auf. 2006 verstarb er im Alter von 81 Jahren.
Jan Bruér hat mit diesem Buch die definitive Biographie des schwedischen Klarinettisten Putte Wickman vogelegt. Wickmans Karriere begann Anfang der 1940er Jahre; mit 19 wurde er 1943 zum professionellen Musiker. Wickmann spielte Swingmusik mit einem Hang zum Modernen. Während andere europäische Klarinettisten seines Kalibers bald in die USA auswanderten (Åke Hasselgard, Rolf Kühn), blieb Wickman in Schweden. Er spielte Platten meist in kleinen, durchaus an Benny Goodman orientierten Besetzungen ein, erst unter anderen Bandleadern, dann ab Mitte der 1940er Jahre vor allem mit einem Sextett unter eigenem Namen. 1949 traf er beim Pariser Jazzfestival auf Charlie Parker, der seine Stilistik nachhaltig beeinflusste. In den 1950er Jahren wurde er einer der populärsten Jazzmusiker Schwedens und war regelmäßig auch anderswo in Europa zu hören, 1959 sogar bei einem Gedenkkonzert für Sidney Bechet in der New Yorker Carnegie Hall. Ab den 1970er Jahren gehörte Wickman zu den Veteranen des schwedischen Jazz und trat des öfteren mit seinen Mit-Veteranen Bengt Hallberg oder Arne Domnérus auf. 2006 verstarb er im Alter von 81 Jahren.
Bruér hat sein Buch in zwei Teilen angelegt: einer klassischen Biographie mit Kommentaren von Zeitzeugen und Kollegen, sowie ausgedehnteren Interviews mit Familienmitgliedern wie Puttes Frau oder seinem Sohn, Mitmusikern sowie Kennern des schwedischen Jazz. Eine Chronologie seines Lebens sowie eine ausführliche Diskographie schließen sich an; ein Namensregister fehlt leider. Als Zugabe enthält das Buch allerdings eine CD, auf der sich Aufnahmen Wickmans aus den Jahren 1945 bis 2005 finden. Dabei sind skurrile Einspielungen wie die “Kivikspolka”, in der Wickmann per Overdub gleich drei Klarinettenstimmen gleichzeitig spielt, Aufnahmen mit Streichquartett, ein Radiomärchen mit Wickman und Lill-Babs, eine Quartettaufnahme mit Bobo Stenson und Palle Danielsson, den Ausschnitt einer Telemann-Komposition, die Wickman 1977 zusammen mit Svend Asmussen einspielte, sowie das Allegro aus Mozarts Klarinettenquintett, ein Duo mit Red Mitchell, der in den 1970er und 1980er Jahren in Schweden lebte, sowie Stücke, in denen Wickman sich freieren Spielweisen oder auch einer gemäßigten Fusion annäherte und anderes mehr.
Diese CD sowie die vielen Abbildungen des Buches mögen auch den des Schwedischen nicht mächtigen Käufer dieses Buchs entschädigen, das Bruér in Zusammenarbeit mit dem Schwedischen Viasarkiv herausgegeben hat und das in überaus ansprechendem Layout gestaltet ist.
Wolfram Knauer (April 2013)
Sugar Free Saxophone. The Life and Music of Jackie McLean
Von Derek Ansell
London 2012 (Northway Publications)
207 Seiten, 18 Britische Pfund
ISBN: 978-9.9557888-6-4
 Jackie McLean gehört zu den großen Hard-Bop-Saxophonisten, und Derek Ansell schickt sich in seinem Buch an, ihm ein Denkmal zu setzen. Ansell beginnt mit jener Anekdote aus dem Jahr 1949, als McLeans Mutter ihrem Sohn sagte, ein gewisser Charlie Parker habe angerufen und ihn gebeten, am Abend in einem blauen Anzug in den Chateau Gardens zu gehen und für ihn einzuspringen. Das Publikum sei ein wenig enttäuscht gewesen, als Art Blakey ansagte, dass Parker leider erst später käme und dieser junge Mann so lange spiele, aber dann habe er alles gegeben in einem Repertoire, das typischer Bird war. Und schließlich sei Parker doch noch gekommen, habe ihn ermutigt, auf der Bühne zu bleiben. Sie hätten ein paar Chorusse zusammen geblasen und nach dem Gig habe Parker ihm 15 Dollar in die Hand gedrückt.
Jackie McLean gehört zu den großen Hard-Bop-Saxophonisten, und Derek Ansell schickt sich in seinem Buch an, ihm ein Denkmal zu setzen. Ansell beginnt mit jener Anekdote aus dem Jahr 1949, als McLeans Mutter ihrem Sohn sagte, ein gewisser Charlie Parker habe angerufen und ihn gebeten, am Abend in einem blauen Anzug in den Chateau Gardens zu gehen und für ihn einzuspringen. Das Publikum sei ein wenig enttäuscht gewesen, als Art Blakey ansagte, dass Parker leider erst später käme und dieser junge Mann so lange spiele, aber dann habe er alles gegeben in einem Repertoire, das typischer Bird war. Und schließlich sei Parker doch noch gekommen, habe ihn ermutigt, auf der Bühne zu bleiben. Sie hätten ein paar Chorusse zusammen geblasen und nach dem Gig habe Parker ihm 15 Dollar in die Hand gedrückt.
Vom Meister abgesegnet, mit Bird oft genug verglichen und doch ein ganz eigener Stil – Jackie McLean nannte sich selbst gern mit Bezug auf seinen klaren, harten Ansatz den “sugar free saxophonist”. Ansell begleitet ihn in diesem Buch vor allem durch seine Plattenaufnahmen und einige dunkle Kapitel seines Lebens. Seine erste Plattensession hatte McLean mit Miles Davis, und kein geringerer als sein Vorbild Charlie Parker saß im Kontrollraum. Ansell berichtet über die Beziehung zwischen den beiden Saxophonisten, die nicht nur in Musik bestand, sondern auch in der Tatsache, dass Parker sich regelmäßig Geld oder auch das Instrument von seinem jüngeren Kollegen lieh.
Nach Parkers Tod begann McLeans Karriere erst richtig. Er ging mit Miles ins Studio, nahm eigene Platten auf, erst für Prestige, dann für Blue Note. Ansell beschreibt das Leben eines Jazzmusikers in den Mitt1950er Jahren und spart auch McLeans Suchtprobleme nicht aus – seine Heroinsucht hatte dazu geführt, dass er bald keine Cabaret Card mehr besaß, ohne die er in New Yorker Clubs nicht auftreten konnte. Fürs Theater galten solche Regeln allerdings nicht, und so war es ein Glück für ihn, dass er 1959 für Jack Gelbers Theaterstück “The Connection” engagiert wurde, für das eine komplette Band auf der Bühne mitwirkte. In den 1960er Jahren hörte McLean sehr bewusst auch auf einige der Neutöner des Jazz, nahm sogar eine Platte zusammen mit Ornette Coleman (an der Trompete) auf; seine eigene Musik aber blieb bei aller Freiheit doch immer dem Blues verbunden.
In den 1960er Jahren begann er außerdem eine Art zweite Karriere als Lehrer, erst in Community-Kulturprogrammen, später an Universitäten und bei Workshops. 1968 erhielt er einen Lehrauftrag an der University of Hartford und wurde zwei Jahre später reguläres Mitglied des Lehrkörpers. Er tourte in Europa und war insbesondere in Japan ein großer Star, wurde aber auch in den USA geehrt, 20902 etwa als Jazz Master des National Endowment for the Arts.
Ansell verfolgt McLeans Wirken bis zu seinem Tod im März 2006; tatsächlich aber ist sein Buch weniger Biographie als Schaffensgeschichte. Er berichtet über die Umstände der Plattensessions und ordnet sie in den Kontext des Jazzgeschehens der jeweiligen Zeit ein. Für McLean-Fans ist das Buch damit ganz sicher ein Muss; es beleuchtet ein Teilkapitel des Hardbop und insbesondere auch den ästhetischen Wandel zwischen Hard Bop und Free Jazz. Neues erfährt man dabei wenig, aber als Information über einen einflussreichen Saxophonisten ist die Lektüre auf jeden Fall zu empfehlen.
Wolfram Knauer (April 2013)
Tracking Jazz – The Ulster Way
von Brian Dempster
Antrim/Northern Ireland 2012 (Shanway Press)
216 Seiten, 18,50 Britische Pfund
ISBN: 978-0-9571006-1-9
 Für den 25. April 1925 dokumentiert Brian Dempster in der Glenarm Orange Hall in Glennarm Village den ersten Jazzevent in der nordirischen Provinz Ulster, eine Veranstaltung, bei der die braven Bürger der Stadt den “Belgium Burl” tanzten, wohl eine Version des American One-Step, begleitet von der jungen Glenarm Jazz Band. Vier Jahre später habe das Noble Sissle Orchestra im Empire Theatre in Belfast gespielt und gleich danach der Jazz in Nordirland zu blühen begonnen, schreibt Dempster.
Für den 25. April 1925 dokumentiert Brian Dempster in der Glenarm Orange Hall in Glennarm Village den ersten Jazzevent in der nordirischen Provinz Ulster, eine Veranstaltung, bei der die braven Bürger der Stadt den “Belgium Burl” tanzten, wohl eine Version des American One-Step, begleitet von der jungen Glenarm Jazz Band. Vier Jahre später habe das Noble Sissle Orchestra im Empire Theatre in Belfast gespielt und gleich danach der Jazz in Nordirland zu blühen begonnen, schreibt Dempster.
Die eigentliche Hochphase des Jazz in Irland aber begann seinem großformatigen und reich bebilderten Buch zufolge während des II. Weltkriegs, als die USA wichtige Stützpunkte in Belfast und Londonderry einrichteten. Dempster schildert die Karriere des Trompeters Ken Smiley und den Einfluss britischer New-Orleans- oder Trad-Jazz-Musiker wie Ken Colyer oder Acker Bilk. Die Sängerin Ottilie Patterson erhält ein eigenes Kapitel, genauso wie etliche lokale Bands und Musiker. In den 1950er Jahren gründete sich am Campbell College die Band Belmont Swing College, benannt nach dem Vorbild der Dutch Swing College Band. Dempster zählt die verschiedenen Orte auf, an denen Jazz in Belfast und drum herum zu hören war und geizt nicht mit Anekdoten. Die 1960er Jahren brachten den Aufstieg von Rock & Roll, zugleich aber auch eine Konzertreihe in der Whitla Hall, bei der neben den traditionellen Bands, die im Fokus dieses Buchs stehen, auch amerikanische Künstler aus dem Bereich des Mainstream und des modernen Jazz auf- oder – wie im Fall von Stan Getz, der sich 1966 kurz vor dem Konzert unwohl fühlte – auch schon mal nicht auftraten.
Dempster sammelt die Erinnerungen vieler (Amateur-)Musiker der Szene, des Klarinettisten Trevor Foster etwa oder des Bassisten David Smith; er erzählt die Geschichte der Belfast Jazz Society, und er erwähnt zumindest am Rande auch einige der politischen Probleme, die in jenen Jahren das tägliche Leben in Nordirland bestimmten. Im großen und ganzen bleibt sein Buch dabei ein Erinnerungsalbum mit vielen Fotos der beteiligten Mitspieler, einem durch die Seiten deutlich alternden Personal.
Ein ausführlicher Personenindex schließt das Buch ab, das sicher vor allem für Leser mit regionalen Vorlieben für Interesse ist.
Wolfram Knauer (April 2013)
Lonesome Roads and Streets of Dreams. Place, Mobility, and Race in Jazz of the 1930s and ’40s
von Andrew S. Berish
Chicago 2012 (University of Chicago Press)
313 Seiten, 30 US-Dollar
ISBN: 978-0-226-04495-8
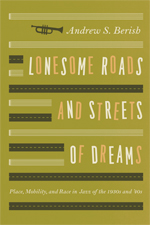 Phil Woods soll sich einmal folgendes Workshop-Setup gewünscht haben: Setzt die Teilnehmer in einen Bus, lasst sie vier Stunden lang fahren, zwei Stunden spielen, vier Stunden fahren, zwei Stunden spielen usw. Die Reisetätigkeit von Musikern ist heute erheblich leichter als früher, aber immer noch nimmt die Anreise zum Konzert in der Regel ein Vielfaches der Zeit ein, die der Musiker beim Konzert verbringt. Andrew S. Berish befasst sich in seinem Buch mit der Mobilität von Jazzmusikern in den 1930er und 1940er Jahren, als der Jazz eine Popmusik und One-Nighter-Tourneen an der Tagesordnung waren. Die Bands der Zeit waren auf Autos, Busse, in Ausnahmefällen auf Züge angewiesen, um enorme Strecken im Flächenland USA zurückzulegen. Ihre Fortbewegung fand dazu in einem Land statt, dessen soziale Struktur sich mit dem Reisen quasi veränderte, etwa durch die Rassentrennungsgesetze der Südstaaten. Sie durchreisten Landschaftsräume und soziale Räume, schufen in ihrer Musik aber auch ihre ganz eigenen Räume, in denen sie quasi die bessere aller Welten repräsentieren konnten, für sich genauso wie für ihr Publikum. Berish zeigt in vier konkreten Beispielen, wie Jazzmusikern ein solches Schaffen neuer Räume in den 1930er und 1940er Jahren gelang.
Phil Woods soll sich einmal folgendes Workshop-Setup gewünscht haben: Setzt die Teilnehmer in einen Bus, lasst sie vier Stunden lang fahren, zwei Stunden spielen, vier Stunden fahren, zwei Stunden spielen usw. Die Reisetätigkeit von Musikern ist heute erheblich leichter als früher, aber immer noch nimmt die Anreise zum Konzert in der Regel ein Vielfaches der Zeit ein, die der Musiker beim Konzert verbringt. Andrew S. Berish befasst sich in seinem Buch mit der Mobilität von Jazzmusikern in den 1930er und 1940er Jahren, als der Jazz eine Popmusik und One-Nighter-Tourneen an der Tagesordnung waren. Die Bands der Zeit waren auf Autos, Busse, in Ausnahmefällen auf Züge angewiesen, um enorme Strecken im Flächenland USA zurückzulegen. Ihre Fortbewegung fand dazu in einem Land statt, dessen soziale Struktur sich mit dem Reisen quasi veränderte, etwa durch die Rassentrennungsgesetze der Südstaaten. Sie durchreisten Landschaftsräume und soziale Räume, schufen in ihrer Musik aber auch ihre ganz eigenen Räume, in denen sie quasi die bessere aller Welten repräsentieren konnten, für sich genauso wie für ihr Publikum. Berish zeigt in vier konkreten Beispielen, wie Jazzmusikern ein solches Schaffen neuer Räume in den 1930er und 1940er Jahren gelang.
Im ersten Kapitel betrachtet der Autor dazu die Band des weißen Sweet-Bandleaders Jan Garber, der damals jeden Sommer im südkalifornischen Casino Ballroom spielte und übers Radio im ganzen Land zu hören war. Er beschreibt Garbers Musik – und hier insbesondere das Stück “Avalon” – als Teil eines Strebens, die Grenzen amerikanischer Raumvorstellungen gegen die Gefahr der Modernisierung mit ihrer Zergliederung und Demokratisierung zu verteidigen.
Im zweiten Kapitel beschäftigt er sich mit der Band Charlie Barnets, dessen musikalische Entwicklung von Sweet- in Hot-Band zugleich eine Entwicklung (oder “soziale Reise”, wie Berish sie nennt) von weißen zu schwarzen ästhetischen Idealen bezeichnete und betrachtet dazu insbesondere seine beiden Aufnahmen “Pompton Turnpike” und “Drop Me Off in Harlem”.
Im dritten Kapitel wendet er sich dem Orchester Duke Ellingtons zu, der wohl am meisten umherreisenden Band jener Zeit, die in ihrem Programm sehr bewusst mit Anspielungen an Orte arbeitete, bekannte Orte (Harlem) genauso wie exotische Orte (jungle style). Ellingtons Konzept von Ort suggeriere seinem Publikum, schlussfolgert Berish, dass andere Orte und Erfahrungen nicht nur möglich seien, sondern dass, mehr noch, alle Orte der Rekonstruktion offen stünden. Das Ellington-Kapitel widmet sich insbesondere Ellingtons “Air-Conditioned Jungle” sowie seiner “Deep South Suite”.
Im vierten Kapitel greift Berish sich den Gitarristen Charlie Christian heraus, der Einflüsse aus konkret zuordenbaren regionalen Jazzstilen aufgriff – Country Blues, Western Swing, Hillbilly, Kansas City –, und diese in Harlem in den modernen Jazz der Zeit, den Bebop überführte. Christians solistischer Ansatz, schreibt Berish, machte aus den fragmentierten geographischen Erfahrungen seines Lebens etwas Neues, einen musikalischen Ort, der integriert war, enorm mobil und in seiner ganzen Ausrichtung national. Seine musikalischen Anhaltspunkte in diesem Kapitel sind Christians Aufnahmen über “Flyin’ Home”, “Stompin’ at the Savoy” und “Solo Flight”.
Das Schlusskapitel greift eine neue Art des Reisens auf, das Fliegen. Hier nimmt Berish sich Jimmie Luncefords Aufnahme “Stratosphere” heraus, um die Faszination mit dem Fliegen als eine Hoffnung zu beschreiben, neue Formen von Beweglichkeit könnten auch die sozialen Barrieren der Zeit durchbrechen.
Berishs Ansatz in diesem Buch erlaubt einen sehr anderen Blick auf die von ihm behandelten Musiker, verbindet vor allem sehr geschickt Jazz- mit Kultur- und Sozialgeschichte und zeigt dabei in einem klugen und zugleich äußerst lesbaren Stil, wie sich anhand der Musik weit größere gesellschaftliche Erfahrungen darstellen lassen, die im Jazz ihren Widerhall gefunden haben.
Wolfram Knauer (April 2013)
Edinburgh Jazz Enlightenment. The Story of Edinburgh Traditional Jazz
von Graham Blamire
Petersborough/England 2012 (Fastprint Publishing)
596 Seiten, 16,99 Britische Pfund
ISBN: 978-178035-290-9
 Lokale Jazzgeschichten lassen sich von vielen Städten schreiben; ein 600-seitiges Buch über den Jazz einer Stadt mit nur mit einer Stilrichtung zu füllen, scheint dagegen schon weitaus schwieriger. Graham Blamire, selbst über lange Jahre Bassist in traditionellen Bands in Edinburgh, hat sich mit seinem Buch daran gemacht, genau dies zu tun, nämlich die Geschichte des traditionellen Jazz in Edinburgh zu erzählen.
Lokale Jazzgeschichten lassen sich von vielen Städten schreiben; ein 600-seitiges Buch über den Jazz einer Stadt mit nur mit einer Stilrichtung zu füllen, scheint dagegen schon weitaus schwieriger. Graham Blamire, selbst über lange Jahre Bassist in traditionellen Bands in Edinburgh, hat sich mit seinem Buch daran gemacht, genau dies zu tun, nämlich die Geschichte des traditionellen Jazz in Edinburgh zu erzählen.
Die großen Namen des britischen Trad Jazz tauchen dabei immer wieder auf, wobei Blamire versucht, zu zeigen, dass dieser sich nicht auf London beschränkte, sondern die Faszination mit älteren Stilen auch anderswo in Großbritannien eine lebendige Szene hervorbrachte. In einem seiner Eingangskapitel erklärt Blamire darüber hinaus seine Begrifflichkeit, unterscheidet zwischen “classic jazz” und “purist jazz”, benutzt den Terminus “traditional jazz” for alles bis zur Swingmusik und erklärt sein Unwohlsein beim begriff “contemporary jazz”.
Die dramatis personae seines Buchs sind in der traditionellen Jazzszene teils auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Blamire verfolgt ihre Aktivitäten, nennt Bandbesetzungen, Konzert- und Festivaldaten, erzählt Geschichten von Clubs und besonderen Ereignissen. Für den Außenstehenden mag das alles ein wenig schwer verdaulich sein; für diejenigen, die dabei waren, bietet es sicher eine gute Erinnerungsstütze. Auf Kontakte zu den moderneren Musikern geht Blamire fast gar nicht mehr ein in seinem Buch, diskutiert auch nicht weiter das ästhetische Selbstverständnis des von ihm gewählten Stils, und beklagt höchstens zum Schluss, dass es dem traditionellen Jazz (und damit meint er dann doch fast ausschließlich das, was allgemein mit Trad Jazz beschrieben wird) an Nachwuchs mangele.
Als Anhang findet sich eine Diskographie von Aufnahmen der im Buch genannten Musiker und Bands. Ein Index, der gerade für solch eine Regionalgeschichte sehr sinnvoll wäre, ist leider nicht vorhanden (kann aber auf Nachfrage vom Autor per Mail bezogen werden).
Wolfram Knauer (März 2013)
Keystone Korner. Portrait of a Jazz Club
herausgegeben von Sascha Feinstein & Kathy Sloane
Bloomington 2012 (Indiana University Press)
224 Seiten, 1 CD, 40 US-Dollar
ISBN: 978-0-253-35691-8
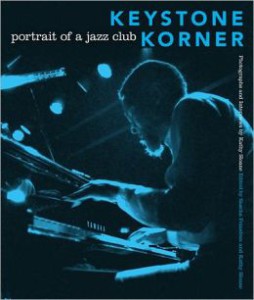 “Keystone Korner” hieß San Franciscos angesagtester Jazzclub der 1970er Jahre. Ale Großen des Jazz spielten dort, von Dexter Gordon bis zum Art Ensemble of Chicago, von Bill Evans über Rahsaan Roland Kirk, Charles Mingus bis zu Anthony Braxton.
“Keystone Korner” hieß San Franciscos angesagtester Jazzclub der 1970er Jahre. Ale Großen des Jazz spielten dort, von Dexter Gordon bis zum Art Ensemble of Chicago, von Bill Evans über Rahsaan Roland Kirk, Charles Mingus bis zu Anthony Braxton.
Die Fotografin Kathy Sloane war dort und hielt die Abende mit den Künstlern fest. Ihre Fotos zeigen Bühnengeschehen genauso wie Clubatmosphäre, Musiker, Publikum, Backstage-Bereich, Plakate, Handzettel und vieles mehr.
Darum herum hat Sascha Feinstein Aussagen mit dem Club Assoziierten gesammelt, Todd Baran an erster Stelle, dem Gründer und langjährigen Inhaber des Clubs, mit dem Koch, einer Kellnerin, den Tontechniker, mit Musikern wie Carl Burnett, George Cables, Billy Harper, Eddie Henderson, Calvin Keys, David Liebman, Eddie Marshall, Ronnie Matthews, Bob Stewart, Steve Turre und David Williams, sowie mit Künstlern und anderen regelmäßigen Besuchern, für die das Keystone Korner Teil ihres Lebens in der Bay Area war. Sie berichten vom Cluballtag, von zwischenmenschlichen Problemen und künstlerischen Höhepunkten, erzählen jede Menge Anekdoten.
Das Keystone Korner schloss 1983 aus finanziellen Gründen seine Pforten. Todd Barkan zog nach New York und machte bis zum letzten Jahre das Programm im Dizzy’s Club Coca Cola. Heute organisiert er eine “Keystone Korner Night” im New Yorker Iridium Club.
“Keystone Korner. Portrait of a Jazz Club” bebildert liebevoll die Erinnerung an eine Zeit, in der Musiker nicht nur in New York die Möglichkeit hatten, ein- oder mehrwöchige Engagements zu spielen. Die beiheftende CD enthält acht Tracks von Rahsaan Roland Kirk, McCoy Tyner, Woody Shaw, Dexter Gordon, Bill Evans, Stan Getz, Cedar Walton und Art Blakey, alle zwischen 1973 und 1982 live aufgenommen im Keystone Korner. Alle Titel sind bereits veröffentlicht; hier sind also keine Neuentdeckungen zu machen. Einen guten Höreindruck aber geben die Stücke allemal in die Atmosphäre eines legendären Clubs im San Francisco der 1970er Jahre.
Wolfram Knauer (März 2013)
Swingtime in Deutschland
von Stephan Wuthe
Berlin 2012 (Transit)
144 Seiten, 16,80 Euro
ISBN: 978-3-88747-271-9
 Die Jazzrezeption in Europa war nie so eindeutig, wie man es meinen möchte. Jazz wurde immer mit all seinen Konnotationen wahrgenommen: seiner afro-amerikanischen Herkunft, seiner emotionalen Kraft, dem Tanz. Die Musik war oft genug nur Vehikel, um all das andere zu transportieren, das die Menschen am Jazz faszinierte.
Die Jazzrezeption in Europa war nie so eindeutig, wie man es meinen möchte. Jazz wurde immer mit all seinen Konnotationen wahrgenommen: seiner afro-amerikanischen Herkunft, seiner emotionalen Kraft, dem Tanz. Die Musik war oft genug nur Vehikel, um all das andere zu transportieren, das die Menschen am Jazz faszinierte.
Stephan Wuthe hat ein Buch über die Swingbegeisterung in Deutschland geschrieben, und natürlich handelt sein Buch auch von einer Zeit, in der Jazz nicht systemkonform war, ja offiziell sanktioniert wurde. Mehr als die Verfolgung von Jazz und Jazzliebhabern aber interessieren ihn all die Elemente, die Fans in den 1930er Jahren an diese Musik banden. Er beschreibt die Szene in den Großstädten (und hier vor allem in Berlin), den Plattenmarkt, frühe Sammelleidenschaft unter den Fans, die Lokale, in denen die Musik zu hören (und nach ihr zu tanzen) war. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Erfolg amerikanischer Musikfilme nach 1933 und verweist auf das Echo auf die Hits dieser Filme in deutschen Kapellen. Vor allem aber betrachtet Wuthe den Swing als ein Tanzphänomen, beschreibt Modetänze und ihren Erfolg beim Publikum. “Verdunklungsschlager” nennt er Aufnahmen der frühen 1940er Jahre, die auf den Kriegsalltag der Menschen eingingen, nennt auch die Propagandaaufnahmen von Charlie and His Orchestra und ähnliche Aktivitäten, die in die andere Richtung, also auf Deutschland, gerichtet waren. In seinen letzten Kapiteln geht Wuthe dann noch schnell auf Swingtanzaktivitäten nach dem Krieg ein, in den 1940er und 1950er und dann erst wieder seit den 1990er Jahren.
Wuthes Buch ist reich und interessant bebildert und gerade in seinem Ansatz, nämlich das Drumherum zu beschreiben, eine vergnügliche Lektüre. Allzu kritische Distanz, eine musikalische Einordnung des Gehörten oder eine historisch genaue Aufarbeitung der Jahre, die den Hauptteil des Buchs umfassen, also 1933-1945, sollte man nicht erwarten – das ist auch nicht das Ziel des Autors. Liebevoll aufgemacht ist sein Buch eher ein ideales Geschenk für den Swingverrückten und Fan der deutschen Tanzmusik.
Wolfram Knauer (März 2013)
The Last Balladeer. The Johnny Hartman Story
von Gregg Akkerman
Lanham/MD 2012 (Scarecrow Press)
367 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8281-2
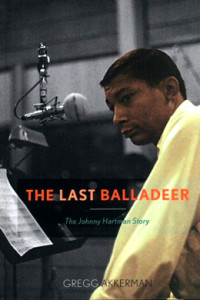 Vielen Jazzfreunden ist Johnny Hartman durch ein einziges Album bekannt, seine Zusammenarbeit mit John Coltrane nämlich von 1963. Als Gregg Akkerman vor wenigen Jahren mehr über den Sänger wissen wollte, suchte er nach einer Biographie und stellte fest, dass es eine solche nicht gab. Also sammelte er Dokumente über Hartman und die Welt, in der er lebte und wirkte, sprach mit Zeitzeugen und schrieb das Buch einfach selbst.
Vielen Jazzfreunden ist Johnny Hartman durch ein einziges Album bekannt, seine Zusammenarbeit mit John Coltrane nämlich von 1963. Als Gregg Akkerman vor wenigen Jahren mehr über den Sänger wissen wollte, suchte er nach einer Biographie und stellte fest, dass es eine solche nicht gab. Also sammelte er Dokumente über Hartman und die Welt, in der er lebte und wirkte, sprach mit Zeitzeugen und schrieb das Buch einfach selbst.
Das erste Kapitel seiner Biographie erzählt von Hartmans Jugend in Chicago, seiner Schulzeit in der DuSable High School, in der er Musikunterricht beim legendären “Captain Dyett” erhielt. 1943 wurde der 19jährige zur Armee eingezogen und bald als Sänger der Bigband der Special Services zugeordnet, mit der er bis zu seiner Entlassung im März 1946 aktiv war. Im August desselben Jahres hatte er ein Engagement im Chicagoer El Grotto Nightclub und wurde von der Presse seiner Stimme und seiner Ausstrahlung wegen als “Bronze Sinatra” gefeiert. 1947 engagierte ihn Earl Hines – Hines war auf den sonoren Balladensänger abonniert, seit Billy Eckstine diese Rolle in seiner Bigband populär gemacht hatte. Hines gab sein Orchester auf, als er Teil der Louis Armstrong All Stars wurde; im Juli 1948 sang Hartman dann mit Dizzy Gillespie, den ebenfalls die Stimmähnlichkeit zu Billy Eckstine, Dizzys früheren Chef, beeindruckt haben mag. Akkerman hört sich Studioaufnahmen und Livemitschnitte der Band an und durchforstet die Tagespresse nach Erwähnungen des Sängers.
1949 nahm Hartman ein paar Seiten mit dem Erroll Garner Trio auf und entschloss sich 1950, unter eigenem Namen zu reisen. Er wurde nicht nur in den Jazzgazetten erwähnt, sondern auch in populären Illustrierten. 1955 nahm er seine erste LP für das kurz zuvor gegründete Label Bethlehem auf, und Akkerman beschreibt die Produktionsbedingungen und den Erfolg der ersten beiden Platten, der aber nicht verhinderte, dass der Siegeszug des Rock ‘n’ Roll auch Hartman zu schaffen machte.
Akkerman begleitet Hartman nach in den 1960er Jahren England und Japan, beschreibt gelungene und weniger gelungene Bootleg-Mitschnitte seiner Konzerte und geht dann eingehend auf jenes Album ein, das den Sänger in der Jazzszene wieder bekannt machte, ein Kapitel, das überschrieben ist mit “The Mythology of a Classic”. Insbesondere “My One and Only Love” und “Lush Life” waren überzeugende Interpretationen, und doch konnte Hartman in der Folge nicht von der positiven Reaktion des Publikums und der Kritik profitieren.
Engagements in den USA hätten fürs Leben nicht ausgereicht, glücklicherweise war er overseas, insbesondere in Japan, sehr gefragt. Akkerman begleitet ihn durch die 1970er Jahre, eine Zeit, in der Hartman bei weitem nicht mehr den Erfolg zeitigen konnte wie als junger Mann, die dennoch kreative Jahre für ihn waren. Er blieb daneben auch ein gesellschaftlich gefragter Künstler. Allerdings litt er ein wenig darunter, als “musician’s musician” zu gelten und plante gegen Ende des Jahrzehnts vielleicht aus diesem Grunde Disco-Versionen von Jazzstandards, die allerdings nie realisiert wurden.
1983 dann versagte seine Stimme, und ein Arzt diagnostizierte Lungenkrebs. Im September desselben Jahres verstarb Hartman im Alter von 60 Jahren. Ein letztes Kapitel des Buchs betrachtet Wiederveröffentlichungen und posthume Würdigungen und holt Meinungen von Freunden und Musikerkollegen ein. Eine Diskographie, ein Song-Index, eine biographische Zeittafel und ein ausführliches Literaturverzeichnis beenden schließlich das Buch.
“The Last Balladeer” beschreibt die Lebensgeschichte eines Musikers, der zwischen Jazz und Pop agierte, auf beiden Feldern erfolgreich war, nie aber den Status erreichte, den seine Kollegen besaßen, die – wie etwa Tony Bennett – durchaus auf ihn als ihren Lieblingssänger verwiesen. Gregg Akkerman schreibt flüssig; er konzentriert sich vor allem auf Biographisches und auf den Hintergrund von Aufnahmen, weniger auf musikalische oder ästhetische Besonderheiten jenes Balladen-Belcanto, das Hartman pflegte wie wenige sonst. Sein Buch ist in der akribischen Recherche und seinem einfühlsamen Schreibstil auf jeden Fall eine willkommene Bereicherung der Jazzliteratur.
Wolfram Knauer (März 2013)
The Saxophone
von Stephen Cottrell
New Haven 2012 (Yale University Press)
390 Seiten, 40 US-Dollar
ISBN: 978-0-300-10041-9
 Eines der am meisten beachtetsten Instrumente sei das Saxophon, schreibt Stephen Cottrell im Vorwort zu seinem Buch und verweist auf Musiker wie Charlie Parker und John Coltrane sowie auf Staatsoberhäupter wie Bill Clinton und König Bhumibop Aduyadej; ernsthafte Literatur über das Instrument sei aber doch recht rar. Dem mag so sein (obwohl diesem Rezensenten eine ganze Handvoll Bücher einfallen, die sich mit dem Instrument, seiner spezifischen Bauweise und Klangtechnik sowie seinen Protagonisten auseinandersetzen); nun jedenfalls widmet sich Cottrell in einem umfangreichen Band der Buchreihe “Yale Musical Instrument Series” dem Saxophon in allen Bauvarianten und Spielarten.
Eines der am meisten beachtetsten Instrumente sei das Saxophon, schreibt Stephen Cottrell im Vorwort zu seinem Buch und verweist auf Musiker wie Charlie Parker und John Coltrane sowie auf Staatsoberhäupter wie Bill Clinton und König Bhumibop Aduyadej; ernsthafte Literatur über das Instrument sei aber doch recht rar. Dem mag so sein (obwohl diesem Rezensenten eine ganze Handvoll Bücher einfallen, die sich mit dem Instrument, seiner spezifischen Bauweise und Klangtechnik sowie seinen Protagonisten auseinandersetzen); nun jedenfalls widmet sich Cottrell in einem umfangreichen Band der Buchreihe “Yale Musical Instrument Series” dem Saxophon in allen Bauvarianten und Spielarten.
Er beginnt mit Generellem: den verschiedenen Instrumentengrößen, Mundstücken, dem Ansatz. Dann erzählt er das Leben von Adolphe Sax und beschreibt, wie dieser auf die Idee seiner Instrumentenerfindung kam. Er nennt Vorfahren, die unterschiedlichen Mitglieder der Saxophonfamilie, sieht sich die Patente an, die Sax für seine Erfindung eingereicht hatte, aber auch Patente anderer Instrumentenbauer bis hin zu mehr oder weniger skurrilen Varianten wie dem Grafton Plastiksaxophon, das sowohl Charlie Parker wie auch Ornette Coleman spielten, oder das Slide-Saxophon, das in den 1920er Jahren ab und an zum Einsatz kam. Er untersucht die industrielle Fertigung des Instruments im 19. Jahrhundert, beschreibt seine Vermarktung und den frühen Einsatz in klassischen und Opernkompositionen. Er verfolgt den Weg des Saxophons in die Vereinigten Staaten sowie seinen Siegeszug in den Militärkapellen auf beiden Seiten des Atlantiks.
Ein eigenes Kapitel widmet Cottrell der Verwendung des Saxophons in Vaudeville, Zirkus, Minstrelsy und Ragtime, erwähnt frühe Saxophonensembles wie die Brown Brothers, stellt eine Art “Saxophon Craze” fest und nennt erste Saxophonvirtuosen wie Rudy Wiedoeft und andere. Die Rolle des Instruments im Tanzorchester untersucht er genauso wie den Klang des Saxophonsatzes, der von Bandleadern und Arrangeuren immer geschickter eingesetzt wurde.
Dem Jazz widmet Cottrell ein eigenes Kapitel, nennt darin Solisten wie Sidney Bechet, Coleman Hawkins, johnny Hodges, Harry Carney, Lester Young, Charlie Parker, John Coltrane und Ornette Coleman. Das klassische Saxophon verfolge eine ganz andere Klangästhetik, die der Autor im Konzertsaal genauso wie auf der Opernbühne verfolgt, auch hier namhafte Virtuosen und Ensembles herausstellend. “Moderne und Postmoderne” lautet die Überschrift zu einem Kapitel, in dem die Genres dann etwas durcheinander purzeln, bevor sich Cottrell abschließend dem Saxophon als “Symbol und Ikone” näher, dabei sowohl auf positive, identitätsstiftende, wie negative, ausgrenzende Ikonographie verweist (für letztere steht das Plakat zur “Entartete Musik”-Ausstellung der Nazis) und schließlich auch die sexuellen Konnotationen der Instrumentenform nicht außer Acht lässt.
Alles in allem gelingt Cottrell dabei ein gut lesbarer Rundumschlag, bei dem kein Aspekt zu kurz kommt: Bauart, Tonbildung, Individualstil, Wirkung. Und gerade für uns Jazzer, die wir dieses Instrument natürlich vor allem mit den bekannten Namen verbinden, mag es recht interessant sein, einmal den Blick über den Tellerrand zu wagen, das zu betrachten, was davor lag und das, was andere draus machten. Im Anhang findet sich ein Faksimile des originalen Patents von Adolphe Sax.
Wolfram Knauer (März 2013)
What It Is. The Life of a Jazz Artist
von Dave Liebman & Lewis Porter
Lanham/MD 2012 (Scarecrow Press)
363 Seiten, 37,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8203-4
 Dave Liebman wurde einem breiten Publikum durch seine Arbeit erst mit Elvin Jones Anfang der 1970er Jahre und dann mit Miles Davis in der Mitte des Jahrzehnts bekannt. Seit Ende der 1970er Jahre war Liebman als Lehrer aktiv, gründete 1989 die International Association of Schools of Jazz und wird auf der ganzen Welt nicht nur als Saxophonist, sondern auch als Jazzpädagoge geschätzt.
Dave Liebman wurde einem breiten Publikum durch seine Arbeit erst mit Elvin Jones Anfang der 1970er Jahre und dann mit Miles Davis in der Mitte des Jahrzehnts bekannt. Seit Ende der 1970er Jahre war Liebman als Lehrer aktiv, gründete 1989 die International Association of Schools of Jazz und wird auf der ganzen Welt nicht nur als Saxophonist, sondern auch als Jazzpädagoge geschätzt.
Für seine Autobiographie hat Liebman den renommierten Jazzforscher Lewis Porter gebeten ihn zu interviewen. Porter entschied sich, das Ergebnis in Gesprächsform festzuhalten, in der Porter die Erinnerung Liebmans untermauern oder ergänzen kann und Liebmans Erzählfluss quasi durch seine Fragen strukturiert. Das liest sich durchweg flüssig und wirkt vielleicht gerade in dieser Form überaus authentisch.
Liebman nimmt kein Blatt vor den Mund. Er erzählt freimütig über seine Polio-Erkrankung, den Einfluss John Coltranes, Unterricht bei Lennie Tristano, seine Zeit in Charles Lloyds Band, seine Arbeit mit Chick Corea und Elvin Jones, Konzerte und Aufnahmen mit Miles Davis, seine Zusammenarbeit mit Richie Beirach und John Scofield, die Bands Lookout Farm und Quest, die Idee und den Zustand der Jazzpädagogik, seine Aktivitäten in der International Association of Schools of Jazz und vieles mehr.
Das alles schwankt zwischen Anekdoten und Tiefsinnigem. In Porter hat Liebman dabei einen Gesprächspartner, der nachfragt, der aber vor allem auch versteht, wovon Liebman redet und die richtigen Fragen nachschiebt, um sowohl den nicht mit Liebmans Karriere vertrauten Leser mitzunehmen als auch die Fragen zu stellen, die der Experte an den Saxophonisten hätte. Nirgends wird das Buch dabei zu technisch, und Liebmans Erinnerungen bewahren in der Gesprächsform sehr angenehm ihre Subjektivität.
Wolfram Knauer (März 2013)
ECM. Eine kulturelle Archäologie
von Okwui Enwezor & Markus Müller
München 2012 (Prestel)
304 Seiten, 49,95 Euro
ISBN: 978-3-7913-5284-8
 Seit 1969 prägt das Plattenlabel ECM die Musiklandschaft mit, hat dabei den Jazz, tatsächlich aber weit mehr als den Jazz neu definiert – oder zumindest anders, offenohriger definiert. ECM ist nicht nur eines der erfolgreichsten Plattenlabels auf dem Markt; es ist zugleich wohl das Label, über dessen Produktionen am meisten geschrieben wurde: von Musikwissenschaftlern, Kulturhistorikern, Kunstgeschichtlern und vielen anderen. Aus Anlass einer großen Ausstellung im Münchner Haus der Kunst haben Okwui Enwezor und Markus Müller einen Katalog herausgebracht, der sich zugleich als kulturelle Spurensuche oder, wie der Untertitel es nennt, als “kulturelle Archäologie” zu ECM versteht.
Seit 1969 prägt das Plattenlabel ECM die Musiklandschaft mit, hat dabei den Jazz, tatsächlich aber weit mehr als den Jazz neu definiert – oder zumindest anders, offenohriger definiert. ECM ist nicht nur eines der erfolgreichsten Plattenlabels auf dem Markt; es ist zugleich wohl das Label, über dessen Produktionen am meisten geschrieben wurde: von Musikwissenschaftlern, Kulturhistorikern, Kunstgeschichtlern und vielen anderen. Aus Anlass einer großen Ausstellung im Münchner Haus der Kunst haben Okwui Enwezor und Markus Müller einen Katalog herausgebracht, der sich zugleich als kulturelle Spurensuche oder, wie der Untertitel es nennt, als “kulturelle Archäologie” zu ECM versteht.
In einem ersten Kapitel erzählt Okwui Enwezor, Kurator des Hauses der Kunst, über die Konzeption der Ausstellung und das grundsätzliche Problem, Musik im Museum zu präsentieren. Markus Müller ordnet ECM im zweiten Kapitel in den “Kontext unabhängiger Schallplattenfirmen und der Selbstbestimmung von Musikern in den 50er, 60er und 70er Jahren” ein und verweist dabei auf Debut Records, die AACM, FMP und andere Projekte jener Jahre.
Ein Gespräch der Herausgeber mit Manfred Eicher, Steve Lake und Karl Lippegaus erlaubt einen spannenden Blick hinter die Kulissen, erzählt, wie das anfangs kleine Labelprojekt größer und professioneller und die Musikwelt neben der Auswahl der Künstler auch auf die klangliche Qualität der ECM-Alben aufmerksam wurde. Eicher betont dabei, wie wichtig ihm immer war, neben dem Verkaufbaren auch Platten zu machen, “die nicht produziert wurden, um verkauft zu werden, sondern damit es sie überhaupt gab”.
Wolfgang Sandner sondiert die Wege, auf denen ECM sowohl Jazz- wie auch Tonträgergeschichte schreiben konnte. Diedrich Diederichsen greift sich Paul Bley und Annette Peacock heraus und beschreibt in einem sehr persönlichen Artikel das, was er die “Beckett-Linie” bei ECM nennt. Kodwo Eshun reflektiert über das ästhetische und dabei zugleich gesellschaftliche Selbstverständnis des Trios Codona. Jürg Stenzl schaut auf den Regisseur Jean-Luc Godard und auf Manfred Eicher als Mehrfachbegabungen. Steve Lake folgt mit einer Label-Chronologie von 1969 bis 2012. Schließlich beendet eine Diskographie aller ECM-Produktionen bis Drucklegung das Buch.
Neben den lesenswerten und aus unterschiedlicher Sicht auf ECM blickenden Essays sind natürlich auch die Fotos zu erwähnen, die dieses Buch, das schließlich als “Ausstellungskatalog” daherkommt, zugleich zu einem spannenden Blättererlebnis machen. Viele seltene Abbildungen der Musiker, des Produzenten, privat, auf Tour, im Studio, streichen dann vor allem noch eins heraus: die zutiefst menschliche Seite hinter dem Erfolg von ECM.
Wolfram Knauer (März 2013)
Eurojazzland. Jazz and European Sources, Dynamics, and Contexts
herausgegeben von Luca Cerchiari & Laurent Cugny & Franz Kerschbaumer
Boston 2012 (Northeastern University Press)
484 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-58465-864-1
 Immer noch fehlt eine zusammenfassende Geschichte des Jazz in Europa, ein Buch, das nationale Entwicklungen genauso skizziert wie Einflüsse zwischen Regionen, das stilistische Identitäten beschreibt und die Abgrenzungen und Annäherungen an den US-amerikanischen Jazz analysiert. “Eurojazzland”, das sei vorab schon angemerkt, ist nicht dieses lang ersehnte Buch. Stattdessen ist es eine Sammlung mehr oder weniger disparater Essays, die sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit Beziehungen zwischen einem Kontinent (Europa) und einer Musik (dem Jazz) beschäftigen.
Immer noch fehlt eine zusammenfassende Geschichte des Jazz in Europa, ein Buch, das nationale Entwicklungen genauso skizziert wie Einflüsse zwischen Regionen, das stilistische Identitäten beschreibt und die Abgrenzungen und Annäherungen an den US-amerikanischen Jazz analysiert. “Eurojazzland”, das sei vorab schon angemerkt, ist nicht dieses lang ersehnte Buch. Stattdessen ist es eine Sammlung mehr oder weniger disparater Essays, die sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit Beziehungen zwischen einem Kontinent (Europa) und einer Musik (dem Jazz) beschäftigen.
Die Herausgeber haben ihren Band in drei Teile strukturiert: einen ersten, der sich mit “Europa als der Quelle des Jazz” befasst, also jene Wurzelstränge des Jazz sucht, die in Europa liegen; einen zweiten, der “Jazz Meets Europe” überschrieben ist; sowie einen dritten Teil, der den etwas unklaren Titel “The Circulation of Eurojazzland” trägt und theoretischere Ansätze hinterfragt, ob von musikwissenschaftlicher oder musikkritischer Seite.
Im ersten Teil sucht Franz Kerschbaumer nach irischen und schottischen Wurzeln des Jazz und findet Swingrhythmen in europäischem Folk und verschiedenster Popmusik. Bruce Boyd Raeburn, Kurator des Jazzarchivs in New Orleans, ist dem “Spanish Tinge” auf der Spur und findet, dass etliche der Bezüge zwischen New Orleans und Lateinamerika noch der Erforschung harren. Martin Guerpin fragt nach dem Interesse europäischer Komponisten am Jazz und untersucht Claude Debussys “Golliwog’s Cakewalk”, Erik Saties “Ragtime du Paquebot” und Darius Milhauds “La Création du Monde”. Vincent Cotro fragt sich, ob es eine spezifisch französische Tradition des Umgangs mit Streichinstrumenten im Jazz gibt. Luca Cerchiary sucht nach europäischen Wurzeln im Standardrepertoire des Jazz. Arrigo Cappelletti schließlich befasst sich mit pan-europäischen Projekten aktueller Improvisatoren.
Im zweiten Teil beschreibt Rainer E. Lotz interkulturelle Verbindungen in der Vorgeschichte des Jazz in Europa. Catherine Tackley Parsonage nähert sich Benny Carters britischen Jahren 1936-1937 an. John Edward Hasse untersucht die Besuche Duke Ellingtons in Frankreich zwischen 1933 und 1973. Manfred Straka beschreibt die verschiedenen Ausformungen der Cool-Jazz-Rezeption in Europa. Davide Ielmini spricht mit dem Komponisten Giorgio Gaslini über die Unterschiede der Jazzkomposition in den USA und hierzulande. Alyn Shiption versucht eine Annäherung ans New-Orleans-Revival und beschreibt die Unterschiede dieser Bewegung in Großbritannien und Frankreich. Ekkehard Jost fragt, wohin die Emanzipation der europäischen Avantgarde in den 1960er und frühen 1970er Jahren wohl geführt haben mag.
Im dritten Teil fragt Laurent Cugny nach der Rolle Europas in der “Entdeckung” oder wenigstens der Popularisierung des Jazz. Jürgen Arndt fragt nach kulturellen Dialogen und Spannungen zwischen Europa und Amerika im Rahmen der politischen Umwälzungen der 1960er Jahre. Tony Whyton wirft einen Blick auf Themen europäischer Jazzforschung. Mike Heffley entdeckt beim Blick auf Europa-Emigranten Joseph Schillinger, Joe Zawinul, Karl Berger und Marian McPartland seine eigene Geschichte. Gianfranco Salvatore fragt nach elektronischen Instrumentenerfindungen des 20sten Jahrhunderts, die auch im Jazz ihren Niederhall fanden. Herbert Hellhund versucht schließlich eine Übersicht über die Entwicklungen eines zeitgenössischen europäischen Jazz der Postmoderne zu geben.
All das also sind Schlaglichter auf Themen europäischer Jazzgeschichte, und jedes der Kapitel verdient Weiterdenken und Weiterforschen. Einmal mehr macht das Buch dabei bewusst, dass es an einer ordentlichen Vernetzung der europäischen Jazzforschung immer noch mangelt und – noch mehr als alles andere, an einem – englischsprachigen – Buch, das europäische Jazzgeschichte als eigenständiges Narrativ in all ihren Verbindungen und Zwängen erzählt. Es bleibt also noch einiges zu tun an Grundlagenforschung zum europäischen Jazz. Genügend – sehr unterschiedliche – Ansätze gibt es offenbar, wie dieses Buch zeigt.
Wolfram Knauer (März 2013)
Sam Morgan’s Jazz Band. Complete Recorded Works in Transcription
(MUSA = Music of the United States, Volume 24)
herausgegeben von John J. Joyce Jr. & Bruce Boyd Raeburn & Anthony M. Cummings
Middleton/WI 2012 (A-R Editions)
260 Seiten, 260 US-Dollar
ISBN: 978-0-89579-724-7
 Herausgeber Anthony Cummings stapelt hoch: Dieses Buch stelle nicht nur eine Gesamtausgabe dar, sondern sogar die erste wissenschaftliche Ausgabe des gesamten aufgenommenen Oeuvres eines Jazzmusikers. Nun hinterließ Sam Morgan nicht allzu viele Aufnahmen, so dass er sich sicher besser für eine solche Aufgabe anbietet als andere. King Oliver oder Jelly Roll Morton – von dem James Dapogney immerhin vor vielen Jahren eine nicht minder exzellente kritische Ausgabe herausbrachte – hätten viel zu viele Platten hinterlassen, als dass eine Gesamtausgabe möglich oder auch sinnvoll wäre. Der geringe Umfang des Repertoires allerdings war sicher nicht ausschlaggebend bei der Wahl Morgans; eher schon die unbestrittene Qualität der Aufnahmen, ihre Beispielhaftigkeit für einen frühen Jazzstil, wie er auch in New Orleans erklang. Anders als Oliver oder Morton nämlich wurden diese Platten in der Stadt am Mississippidelta selbst eingespielt, nicht also in Chicago oder Richmond oder wo immer sonst die meisten Dokumente des frühen Jazz entstanden.
Herausgeber Anthony Cummings stapelt hoch: Dieses Buch stelle nicht nur eine Gesamtausgabe dar, sondern sogar die erste wissenschaftliche Ausgabe des gesamten aufgenommenen Oeuvres eines Jazzmusikers. Nun hinterließ Sam Morgan nicht allzu viele Aufnahmen, so dass er sich sicher besser für eine solche Aufgabe anbietet als andere. King Oliver oder Jelly Roll Morton – von dem James Dapogney immerhin vor vielen Jahren eine nicht minder exzellente kritische Ausgabe herausbrachte – hätten viel zu viele Platten hinterlassen, als dass eine Gesamtausgabe möglich oder auch sinnvoll wäre. Der geringe Umfang des Repertoires allerdings war sicher nicht ausschlaggebend bei der Wahl Morgans; eher schon die unbestrittene Qualität der Aufnahmen, ihre Beispielhaftigkeit für einen frühen Jazzstil, wie er auch in New Orleans erklang. Anders als Oliver oder Morton nämlich wurden diese Platten in der Stadt am Mississippidelta selbst eingespielt, nicht also in Chicago oder Richmond oder wo immer sonst die meisten Dokumente des frühen Jazz entstanden.
In einem lesenswerten 20-seitigen Aufsatz erklärt Bruce Boyd Raeburn, der Leiter des Jazzarchivs an der Tulane University, was den frühen New-Orleans-Stil auszeichnet und welche Unterschiede es zu Beginn des 20sten Jahrhunderts in den musikalischen Konzepten früher Jazzmusiker gab. Vor allem beschreibt er die beiden konträren Pole von “hot” und “sweet”-Ansätzen, für die er exemplarisch die Bands von Sam Morgan und Armand Piron nennt. Er hinterfragt die Notenfestigkeit früher Jazzmusiker und diskutiert die Rolle von Hautfarbe, ethnischer Herkunft und Alter der Spieler. Schließlich beschreibt er die Arbeitsbedingungen der Band und die Umstände der Aufnahmen, um die es im Rest des Buchs geht.
John J. Joyce Jr. erklärt anschließend die Herangehensweise bei, also die technische Seite der Transkription. Die Ausgabe solle, so schreibt er, sowohl für Forscher als auch für Musiker nutzbar sein, daher habe man sich darauf geeinigt, so konventionell wie möglich zu notieren. Joyce nennt Schwierigkeiten, etwa das Auseinanderhalten der beiden Trompeter in den Aufnahmen. Auch die Notation des Schlagzeugparts sei eine besondere Herausforderung und das Banjo stellenweise kaum heraushörbar gewesen. Er benennt die Hilfsmittel, insbesondere Software, die den Transkribenden erlaubten, Klänge zu analysieren und in einzelne Linien zu strukturieren. Schließlich gibt er eine Legende der Notationsbeizeichen, die vor allem verschiedene Ansätze an einzelne Töne beschreiben.
Jeder einzelne der acht Transkriptionen – es sind dies: “Steppin’ on the Gas”, “Everybody’s Talking About Sammy”, “Mobile Stomp” und “Sing On”, aufgenommen am 14. April 1927, sowie “Short Dress Gal”, “Bogalusa Strut”, “Down By the Riverside” und “Over in the Gloryland”, aufgenommen am 22. Oktober 1927 – steht eine kurze formale Ablaufbeschreibung voran. Die Umschrift selbst dann nimmt je eine volle Seite ein mit Stimmlinien für Klarinette, zwei Saxophone, zwei Trompeten, Posaune, Bass, Banjo, Piano und Schlagzeug. Nach jeder Transkription gibt es einen kritischen Apparat mit Hinweisen auf transkriptorische Annäherungen und sonstige Besonderheiten, die im Notentext nicht näher bezeichnet werden konnten. Zum Schluss des Buchs findet sich dann noch eine Bibliographie über Sam Morgan mit Hinweisen auch auf Oral-History-Material und sonstige Quellen für eine eingehendere Weiter-Forschung an der Musik Sam Morgans.
Die MUSA-Reihe, eine Art Denkmälerausgabe zur amerikanischen Musik ist in ihrem stilübergreifenden Ansatz ein überaus wichtiges Projekt. Der Band zu Sam Morgan ist nach früheren Bänden mit Transkriptionen von Thomas ‘Fats’ Waller und Earl Hines der dritte dem Jazz gewidmete Band der Reihe. Er wird – sicher auch des stolzen Preises – vor allem in musikwissenschaftlichen Bibliotheken zu finden sein. Zugleich ist er beispielhaft dafür, wie eine kritische Ausgabe jazzmusikalischer Transkriptionen aussehen kann und stellt damit eine bedeutsame Ergänzung der Dokumentation der frühen Jazzgeschichte dar.
Wolfram Knauer (Februar 2013)
Jazz Puzzles, Volume 1
Von Dan Vernhettes & Bo Lindström
Saint Etienne 2012 (Jazz’edit)
240 Seiten, 40 Euro (+ 10 Euro Versandkosten)
ISBN: 9782953483116
www.jazzedit.org
 Mit “Traveling Blues” hatten Dan Vernhettes und Bo Lindström 2009 eine beispielhafte Studie über den Trompeter Tommy Ladnier vorgelegt, der sie jetzt, in der Aufmachung nicht weniger opulent, ein Buch folgen lassen, in dem sie sich vierzehn frühe Musiker der Jazzgeschichte vornehmen, um ihre Biographien teilweise neu aufzurollen, teilweise auf den neuesten Stand zu bringen.
Mit “Traveling Blues” hatten Dan Vernhettes und Bo Lindström 2009 eine beispielhafte Studie über den Trompeter Tommy Ladnier vorgelegt, der sie jetzt, in der Aufmachung nicht weniger opulent, ein Buch folgen lassen, in dem sie sich vierzehn frühe Musiker der Jazzgeschichte vornehmen, um ihre Biographien teilweise neu aufzurollen, teilweise auf den neuesten Stand zu bringen.
“Jazz Puzzles” heißt das Werk im LP-Format mit vielen sorgfältig reproduzierten Fotos und Dokumenten, für dass die beiden Autoren sich mit anderen Kennern des frühen New Orleans vernetzt und in Archiven insbesondere in und um New Orleans recherchiert haben. Sie beginnen mit der Geschichte des Bandleaders John Robichaux, dessen Biographie sie akribisch nachzeichnen, dabei neben den Lebens- auch die Spielorte und Arbeitsbedingungen erläutern und auf die Konkurrenz zu Buddy Bolden eingehen. Unter anderem beschreiben sie die Notensammlung der Band, die heute im Hogan Jazz Archive in New Orleans bewahrt wird. Wie einige andere der frühen Heroen der Musik in New Orleans nahm Robichaux, der bis in die 1930er Jahre hinein ein Society Orchester leitete, keine Schallplatten auf. Umso wertvoller daher die einfühlsamen Annäherungen aus biographischen Details an seine Musik.
In ihrem Kapitel über Buddy Bolden fassen Vernhettes und Lindström erst einmal die Literaturlage zusammen und gehen auch im Rest des Kapitels immer wieder auf widerstreitende Meinungen vorhergehender Autoren oder aber auf Mutmaßungen und Spekulationen ein, um diese mit Quellen zu verifizieren. Insbesondere fragen sie nach dem von Bolden gespielten Repertoire, nach den Bedürfnissen einer Tanzmusik in jener Zeit, nach dem karibischen Einfluss, nach Ragtime- und religiösen Elementen in seiner Musik sowie nach der Bedeutung des Blues für diese frühe Form des Jazz. Sie hinterfragen die Bedeutung des Wortes “ratty” in Bezug auf Boldens Spiel, befassen sich mit Papa Jack Laines Aussagen über den Jazz in New Orleans und dabei auch mit der kulturellen Durchlässigkeit zwischen Hautfarben und Ethnien. Sie untersuchen, wo Bolden tatsächlich spielte und beschreiben, wie sich seine allbekannten psychischen Probleme äußerten. Sie gehen der Legende eines verschollenen Buddy-Bolden-Zylinders nach und beschreiben die erhaltenen Bandfotografien. Schließlich gehen sie auf einige der direkt sich auf Bolden beziehenden Nachfahren des Kornettisten ein, die Eagle Band, Frankie Duson, Louis Knute, Edward Clem, John E. Pendleton und Albert Tig Chambers.
Ähnlich sorgfältig machen sich die Autoren auch auf die Spur weiterer Musiker, Manuel Perez etwa, der sich, wie sie schreiben, als Kreole nie ganz an das Hot-Jazz-Konzept der neuen Musik gewöhnt habe, oder Ernest Coucault, der in den 1920er Jahren als Trompeter der Sonny Clay Band in Kalifornien aufgenommen wurde und mit dieser Band 1928 auch nach Australien reiste. Sie gehen der Biographie King Olivers auf den Grund, bebildern das alles etwa mit einem Plakat, die einen Auftritt der Magnolia Band 1911 im Lincoln Park ankündigt, mit Einberufungsbefehlen für Honoré Dutrey und Peter Ciaccio, und folgen ihm erst nach Chicago, dann nach Kalifornien und zurück in die Windy City, wo sie sein Kapitel genau zu dem Zeitpunkt beenden, als Louis Armstrong zur Creole Jazz Band stößt. Der Trompeter Chris Kelly erhält ein eigenes Kapitel, dessen Spiel auch Armstrong beeinflusst habe, der aber genau wie andere seiner Zeitgenossen nie den Weg ins Plattenstudio fand. Freddie Keppard hatte zwar die Chance verspielt, die offiziell ersten Jazzaufnahmen zu machen, hinterließ aber immerhin bedeutende Einspielungen.
Andere Meister des frühen Jazz, die ausführlich beleuchtet werden, sind Lorenzo Tio Jr., Arnold Metoyer, Evan Thomas, Punch Miller, Buddy Petit, Sidney Bechet (in seinen ersten Jahren in New Orleans) und Kid Rena. Und nebenbei wird eingehend auch auf viele der Musiker eingehen, die irgendwann den Weg der Kapitelhelden kreuzten.
Dan Vernhettes und Bo Lindströms Buch bietet in jedem seiner Kapitel eine Unmenge an Details und kenntnisreichen Querverbindungen, die helfen, den frühen Jazz in New Orleans besser zu verstehen, die zugleich aber auch bewusst machen, wie komplex eine Beschreibung der Jazzgeschichte sein kann, nein, sein muss, um musikalische Einflüsse, Arbeitsbedingungen und ästhetische Entscheidungen zu erklären.
Die Puzzleteilchen, die Vernhettes und Lindström legen, haben klare Kanten und Konturen und erleichtern es uns andere Puzzlestückchen einzupassen. Die vielen Fotos, Dokumente und Karten lassen die Musikszene in New Orleans zwischen 1900 und 1920 erstaunlich klar auferstehen. Ein großartiges Buch, weiß Gott nicht nur für Freunde des traditionellen Jazz.
Wolfram Knauer (Februar 2013)
Brötzmann. Gespräche
Herausgegeben von Christoph J. Bauer
Berlin 2012 (Posth Verlag)
184 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944298-00-9
 Peter Brötzmann ist nicht aufs Saxophon gefallen, auf dem er seit vielen Jahren sagt, was er zu sagen hat. Aber er ist auch nicht auf den Mund gefallen und macht auch hier kein Federlesens. Im Gespräch mit dem Philosophen und Publizisten Christoph J. Bauer ist jetzt ein ungemein offenes, lesenswertes und diskussionsmunteres Buch erschienen, das den simplen Titel “Brötzmann. Gespräche” trägt, aber genauso gut als Versuch einer Autobiographie gelten könnte, die von Erinnerungen über Meinungen und Haltungen und zurück zu Erinnerungen führt, von ästhetischer Einordnung über Reflexionen zum Leben und Überleben als Musiker bis hin zu sehr Privatem. Das alles hat Bauer so niedergeschrieben, wie es im Gespräch erklang, als O-Ton Brötzmann, einzig gegliedert durch knappe Zwischenüberschriften, die dem Leser das Blättern erleichtern, ihn zum Querlesen einladen, welches immer wieder im Sich-Festlesen mündet.
Peter Brötzmann ist nicht aufs Saxophon gefallen, auf dem er seit vielen Jahren sagt, was er zu sagen hat. Aber er ist auch nicht auf den Mund gefallen und macht auch hier kein Federlesens. Im Gespräch mit dem Philosophen und Publizisten Christoph J. Bauer ist jetzt ein ungemein offenes, lesenswertes und diskussionsmunteres Buch erschienen, das den simplen Titel “Brötzmann. Gespräche” trägt, aber genauso gut als Versuch einer Autobiographie gelten könnte, die von Erinnerungen über Meinungen und Haltungen und zurück zu Erinnerungen führt, von ästhetischer Einordnung über Reflexionen zum Leben und Überleben als Musiker bis hin zu sehr Privatem. Das alles hat Bauer so niedergeschrieben, wie es im Gespräch erklang, als O-Ton Brötzmann, einzig gegliedert durch knappe Zwischenüberschriften, die dem Leser das Blättern erleichtern, ihn zum Querlesen einladen, welches immer wieder im Sich-Festlesen mündet.
Im Vorwort erklärt Bauer sein eigenes Interesse an Brötzmann, seiner Musik und dem Gespräch mit dem Saxophonisten. Die Idee zu dem Buch sei ihm nach der Lektüre eines Artikels in der Süddeutschen Zeitung gekommen, in dem Brötzmann zitiert wurde, er würde sein Tentet “über die musikalischen Belange hinaus auch als ein Beispiel gesellschaftlichen Zusammenlebens” verstehen. Das machte Bauer nun doppelt neugierig, und so näherte er sich in vier in Brötzmanns Wohnung geführten Gesprächen dessen Vorstellung von Musik, Gesellschaft, Ästhetik und vielem anderen.
Im Gespräch mauert Brötzmann nirgends, spricht über den Jazz als ursprünglich schwarze Musik und die Bedeutung von schwarz und weiß im heutigen amerikanischen Jazz. Er äußert sich zum Kommunismus, zum Sozialismus, zu den Zuständen in der DDR, zu politischem Bewusstsein und politischer Verantwortung der Musiker im Tentet, zu kulturellen Unterschiede etwa in Japan, zum Hören ganz allgemein, zu seiner Liebe zu Coleman Hawkins, Sonny Rollins, Don Byas und dem Blues oder zur Idee und der Realität des Free Jazz. Er reflektiert darüber, inwieweit Musik etwas mit Geschichtenerzählen zu tun habe und erinnert sich daran, wie seine Musik durchaus als Provokation aufgefasst wurde. Er erzählt von seinen Tourneen durch die USA und davon, wie schwierig das alles schon rein visa-organisatorisch sei. Er spricht über das Publikum, über Aufnahmetechnik, über Konkurrenz auf der Bühne und über Respekt – anderen Musikern genauso wie anderen Kulturen gegenüber. Fluxus ist ein Thema – Brötzmann hatte einst als Assistent für Nam June Paik gearbeitet –, und von da aus geht das Gespräch schnell zur eigenen Bildenden Kunst Brötzmanns und deren Zusammenhang mit der Musik. Die beiden sprechen über die Unterscheidung zwischen “U” und “E”, übers Globe Unity Orchestra und Krautrock, über Joachim Ernst Berendt, das Berliner Jazzfest und das Total Music Meeting als Gegenveranstaltung. Brötzmann äußert sich auch offen zu Alkohol und Drogen und ihren teilweise fatalen Auswirkungen, zu seiner eigenen Auseinandersetzung mit europäischen Philosophen, zum Thema der Sexualität, das insbesondere in seinen Bildern eine große Rolle spielt.
Das alles fasst Bauer schließlich in einem abschließenden vierzehnseitigen Essay zusammen, der versucht, die “soziale Struktur einer Gemeinschaft von Improvisatoren” zu ergründen. “Brötzmann. Gespräche” ist ungemein lesenswert, abwechslungsreich, informativ und intensiv – ein wenig wie Brötzmann selbst, möchte man meinen und doch wieder weit abgeklärter als seine Musik, deren Intensität ja vor allem in ihrer Direktheit entsteht, die ihrerseits im nachdenklichen Hinterfragen, wie es in diesem Buch deutlich wird, eine fast schon dialektische Untermauerung erfährt.
Wolfram Knauer (Dezember 2012)
Jazz Covers
herausgegeben von Joaquim Paulo & Julius Wiedemann
Köln 2012 (Taschen)
2 Bände, Hardcover im Schuber, 600 Seiten, 39,99 Euro
ISBN: 978-3-8365-2406-3
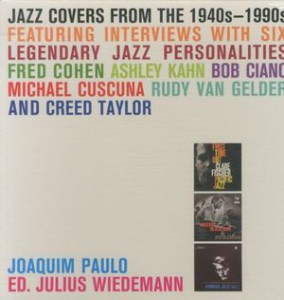 Als Musik des 20sten Jahrhunderts haben den Jazz die Entwürfe seiner Plattencover immer mit begleitet. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an Büchern über die Kunst der Plattengestaltung, darunter den großartigen Katalog einer Ausstellung in Valencia, die 1999 die Entstehung des Jazz-Plattencovers verfolgte und mit vielen Ausstellungsstücken aus dem Fundus des Jazzinstituts bestückt war.
Als Musik des 20sten Jahrhunderts haben den Jazz die Entwürfe seiner Plattencover immer mit begleitet. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an Büchern über die Kunst der Plattengestaltung, darunter den großartigen Katalog einer Ausstellung in Valencia, die 1999 die Entstehung des Jazz-Plattencovers verfolgte und mit vielen Ausstellungsstücken aus dem Fundus des Jazzinstituts bestückt war.
Nun haben Joaquim Paulo und Julius Wiedemann eine quasi lexikalische Sammlung wichtiger Plattencover herausgegeben, die diesmal nicht nach Künstlern oder Plattenlabels, sondern nach den Künstlern des Jazz sortiert ist. Das schwere, zweibändige, in einem dicken Pappschuber gelieferte Opus ist im LP-Format gehalten. Etliche der Abbildungen nehmen die ganze Seite ein, viele andere sind kleiner gehalten und haben kurze Beschreibungen entweder zu den Musikern der dargestellten Alben oder zu den Grafikern, die das Cover entworfen hatten. Diese Sortierung sorgt vor allem für Vielfalt und Überraschungsmomente, wenn beispielsweise Platten aus den 1950ern solchen aus den 1970ern gegenüberstehen. Das ist in etwa auch die Zeitspanne, die “Jazz Covers” umfasst, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, obwohl man sich schon fragen mag, warum nicht zumindest die 1980er Jahre noch mit berücksichtigt wurden, wo doch der große Einschnitt auch in die Gestaltung von Tonträgern erst Ende der 1980er mit dem Aufkommen der CD geschah.
Interviews mit dem Designer Bob Ciano, den Produzenten Michael Cuscuna und Creed Taylor, dem Kritiker und Fotografen Ashley Kahn und dem Plattenladenbesitzer Fred Cohen führen jeweils in die beiden Bände ein, die ansonsten vor allem zum Blättern einladen, zum Entdecken und – sofern die Aufnahmen vorhanden sind – zum Wiederhören.
Wolfram Knauer (Dezember 2012)
Pepper Adams’ Joy Road. An Annotated Discography
von Gary Carner
Lanham/MD 2012 (Scarecrow Press)
553 Seiten, 44,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8256-0
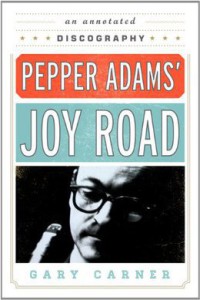 Musikwissenschaftlern wie Jazzforschern erkläre ich gelegentlich, Diskographien im Jazz würden meist von Privatforschern in ihrer Freizeit erstellt, seien aber tatsächlich in etwa den Werkverzeichnissen der klassischen Musik vergleichbar, mit denen Musikwissenschaftler sich schon mal einen Doktorgrad verdienen.
Musikwissenschaftlern wie Jazzforschern erkläre ich gelegentlich, Diskographien im Jazz würden meist von Privatforschern in ihrer Freizeit erstellt, seien aber tatsächlich in etwa den Werkverzeichnissen der klassischen Musik vergleichbar, mit denen Musikwissenschaftler sich schon mal einen Doktorgrad verdienen.
Ein wenig hinkt dieser Vergleich, denn anders als musikwissenschaftliche Werkverzeichnisse untersuchen Diskographien selten die Musik selbst, beschäftigen sich stattdessen in der Hauptsache mit der Verbreitung musikalischer Produkte, der Schallplatten also, veröffentlichter und nicht veröffentlichter Aufnahmen. Das kann für den “Leser” herkömmlicher Diskographien recht langweilig sein, da vieles an Information hinter den Listen versteckt ist, den Besetzungslisten, den Aufnahmedaten, den Informationen über Studio, Ort, vielleicht sogar Tageszeit, über Originalveröffentlichung, Zahl der Takes, Wiederveröffentlichung auf unterschiedlichsten Medien.
In den letzten Jahren sind einige beispielhafte Diskographien erschienen, in denen die ureigene Aufgabe der Diskographie, also das Auflisten von Aufnahmen, durch zusätzliche Information erweitert wurde, die teils biographischer Natur sind, teils auf Details der Musik eingehen. Gary Carners dickes Opus über den Baritonsaxophonisten Pepper Adams gehört zu dieser neuen Spezies von Diskographien, die weit mehr liefern als nur Daten und Fakten. Garner arbeite in den Mitt-1980er Jahren mit Adams an seiner Autobiographie, interviewte dann nach Adams Tod im Jahr 1986 viele der Kollegen, die mit dem Baritonsaxophonisten gespielt hatten oder im Studio zusammengetroffen waren. Mit Hilfe vieler diskographischer Freunde entdeckte er zudem etliche unveröffentlichte Aufnahmen.
Sein Buch beginnt im September 1947 mit einer unveröffentlichten Demo-Aufnahme aus Detroit, an der neben Pepper Adams auch der Pianist Tommy Flanagan beteiligt war; es endet im Juli 1986, nur drei Monate vor dem Tod des Musikers mit einem Rundfunkmitschnitt vom Montréal Jazz Festival. Dazwischen finden sich Hunderte Aufnahmen, bekannte genauso wie unbekannte, eingespielt im Studio oder mitgeschnitten bei Konzerten oder Festivals. In einem kurzen Anhang nennt Carner gerade mal vier Sessions, von denen er weiß, die er aber nie gehört hat bzw. die offenbar nirgends mehr existieren.
Ansonsten ist das Buch eine reiche Fundstelle für Details. Carner unterhielt sich mit vielen der an den Einspielungen beteiligten Musiker über die Atmosphäre im Studio, über Schwierigkeiten, über gelungene genauso wie misslungene Aufnahmen. Die Texte sind den entsprechenden Einträgen zugeordnet, was eher zum Blättern einlädt als dass es zur Lektüre in einem Stück ermutigt. Carners Einleitungen der O-Töne mögen auf Dauer etwas eintönig daherkommen: “xxx told the author”, “in an interview with the author”, “according to xxx in a letter to the author” etc., ein bis zweimal auf jeder Seite. Hier wären Fußnoten sicher die lesbarere Alternative gewesen.
Doch ist Carners Werk auch kein Lesebuch im üblichen Sinne. Es ist eine annotierte Diskographie und als solche ganz gewiss beispielhaft dafür, was diese Wissenschaft über das bloße Kartieren von Aufnahmedaten hinaus sonst noch vermag. Der nächste Schritt wäre die Verquickung dieses Ansatzes mit zumindest in Teilen analytischen Kommentaren zur Musik. Aber auch so ist Carners “Pepper Adams’ Joy Road” bereits jetzt das Standardwerk zum Baritonsaxophonisten Pepper Adams.
Wolfram Knauer (November 2012)
The Jazz Standards. A Guide to the Repertoire
Von Ted Gioia
New York 2012 (Oxford University Press)
5237 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-993739-4
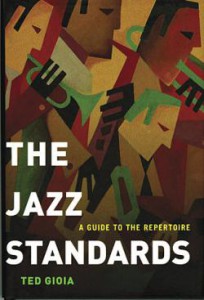 Hans-Jürgen Schaal hat Ted Gioias Buch über die Jazz-Standards eigentlich schon geschrieben, aber deutsche Literatur wird in englischsprachigen Ländern leider immer noch kaum berücksichtigt. Titel und Ansatz beider Bücher jedenfalls sind ähnlich, und wo Schaals Buch von 2001 320 Jazz-Standards listet, sind es bei Gioia “nur” etwa 250 Kompositionen.
Hans-Jürgen Schaal hat Ted Gioias Buch über die Jazz-Standards eigentlich schon geschrieben, aber deutsche Literatur wird in englischsprachigen Ländern leider immer noch kaum berücksichtigt. Titel und Ansatz beider Bücher jedenfalls sind ähnlich, und wo Schaals Buch von 2001 320 Jazz-Standards listet, sind es bei Gioia “nur” etwa 250 Kompositionen.
Dabei überschneiden sich die beiden Autoren keinesfalls; ihre Auswahl ist in Einzelheiten durchaus unterschiedlich. Schauen wir uns nur den Buchstaben “P” in beiden Büchern an: Schaal beginnt mit “Pannonica”, “Paradise Stomp”, “Parker’s Mood”, “Passion Flower”, die alle bei Gioia nicht vorkommen, der stattdessen mit “Peace” und “The Peacocks” beginnt, die wiederum Schaal nicht listet.
Wie Schaal widmet sich auch Gioia in seinen einzelnen Kapiteln jeweils kurz der Kompositions-Genese, um dann einen Blick auf die interessantesten Jazz-Interpretationen zu werfen. Am Schluss eines jeden Eintrags steht eine kurze Auflistung wichtiger Aufnahmen, ohne Hinweise allerdings auf aktuelle Plattenveröffentlichungen – das Buch ist für die Zukunft gedacht, und die Wiederveröffentlichungen insbesondere etlicher der älteren Aufnahmen sind einfach zu unübersichtlich, um eine einzelne herauszugreifen. Man findet die großen Aufnahmen aber auch schon mal solche, die man nicht erwartet, etwa, wenn Gioia unter “Struttin’ With Some Barbecue” eine Einspielung Paul Desmonds listet, der den Armstrong-Klassiker 1968 als “Samba With Some Barbeue” aufgenommen hatte. Neben den üblichen Plattenverweisen findet sich dabei ab und an auch ein Hinweis auf jüngere YouTube-Interpretationen. Gioia begründet seine Auswahl an Aufnahmen, dennoch mag jeder Leser seine eigenen Präferenzen wiederfinden oder auch vermissen, anders geht es nun mal nicht in solchen Nachschlagewerken.
Gioia widmet sich den großen Standards, Stücken von George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, genauso wie den von Jazzmusikern geschriebenen Favoriten, Titeln von Duke Ellington, Charlie Parker, Thelonious Monk. Europäische Nummern finden sich außer Toots Thielemans “Bluesette” und Django Reinhardts “Nuages” keine, und auch in den Hinweisen auf Platten sind kaum europäische Interpretationen zu finden. Die Erläuterungen zu den Titeln klären schon mal Legenden auf – etwa um die Urheberschaft von “Blue in Green” oder um das tatsächliche Geburtsjahr von Eubie Blake. Ab und an bietet Gioia auch persönliche Anekdoten, etwa, dass er “Stella By Starlight” in seinen 20ern so lange toll fand, bis er herausfand, dass seine Mutter den Text kannte (und er hatte gar nicht gewusst, dass das Stück einen Text besaß), worauf er sich nach einem Stück umsah, dass seine Mutter nicht mögen würde.
Gioias Einleitung zum Buch ist kurz und vergibt die Chance auf eine in solch einem Buch durchaus wünschenswerte Diskussion, was (1.) einen Jazz-Standard überhaupt ausmacht und wie sich die Repertoirewahl in den letzten Jahrzehnten verändert hat (und warum). Er erklärt, dass er Stücke ausgelassen hat, die in älteren Stilen zu den Standards zählen mögen, aber heute kaum mehr zu hören sind, und dass ihm Titel von Radiohead, Björk, Pat Metheny, Maria Schneider und anderen nicht stark genug im Umlauf schienen, um sie aufzunehmen. Und wer entgegnet, mit “Time After Time” fände sich immerhin Cyndi Laupers Stück im Buch, der irrt: Es handelt sich auch hier um ein älteres Stück von Jule Styne, das Sarah Vaughan 1946 zum ersten Mal mit Teddy Wilson eingespielt hat.
Im Vergleich der beiden Bücher – Schaal / Gioia – geben die beiden Autoren sich nichts; ihre Ansätze sind dafür zu ähnlich. Für Hörer, die ein wenig mehr über das Repertoire wissen wollen, das den Jazz beherrscht, sind beide Bücher eine empfehlenswerte Lektüre. Gioias “Jazz Standards” überzeugt insbesondere in der Lockerheit des Stils, der den Leser ermutigt, zu blättern, einzelne Stücke herauszugreifen, weiterzulesen, zu entdecken – und dann vielleicht gespannt an den eigenen Plattenschrank zu gehen, um die Musik zu hören.
Wolfram Knauer (November 2012)
Shall We Play That One Together. The Life and Art of Jazz Piano Legend Marian McPartland
Von Paul de Barros
New York 2012 (St. Martin’s Press)
484 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-0-312-55803-1
 Marian McPartland hat viele Karrieren: als Pianistin, als Rundfunkmoderatoren, als Beispiel für viele Frauen, die im Jazz nicht nur als Sängerinnen, sondern als Instrumentalistinnen ernst genommen werden wollten. Für ihre erfolgreiche Radioshow “Piano Jazz”, die seit 1978 auf National Public Radio läuft, gelang es ihr, mit dem Charme einer Frau, der Exotik einer amerikanisierten Britin, die ihren Akzent und ihre fast fan-hafte Bewunderung für die Jazzmusiker immer beibehalten hatte, und dem musikalischen Handwerkszeug, das allen Kollegen imponierte, ihren Hörern ein Fenster in die Werkstatt des Jazz zu öffnen, das bis heute beispiellos ist in der Offenheit, mit der die Gäste über stilistische Entscheidungen oder harmonische Progressionen redeten, als sei es eben doch nur ein professioneller Plausch zwischen zwei Kollegen.
Marian McPartland hat viele Karrieren: als Pianistin, als Rundfunkmoderatoren, als Beispiel für viele Frauen, die im Jazz nicht nur als Sängerinnen, sondern als Instrumentalistinnen ernst genommen werden wollten. Für ihre erfolgreiche Radioshow “Piano Jazz”, die seit 1978 auf National Public Radio läuft, gelang es ihr, mit dem Charme einer Frau, der Exotik einer amerikanisierten Britin, die ihren Akzent und ihre fast fan-hafte Bewunderung für die Jazzmusiker immer beibehalten hatte, und dem musikalischen Handwerkszeug, das allen Kollegen imponierte, ihren Hörern ein Fenster in die Werkstatt des Jazz zu öffnen, das bis heute beispiellos ist in der Offenheit, mit der die Gäste über stilistische Entscheidungen oder harmonische Progressionen redeten, als sei es eben doch nur ein professioneller Plausch zwischen zwei Kollegen.
Marian McPartland hat selbst über viele Jahre journalistisch gearbeitet, Kollegen interviewt, über Begegnungen und Konzerte berichtet. Nun hat Paul de Barros ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben, von den Kindheitstagen nahe Windsor Castle, ihre früh erkannte Musikalität – sie besitzt das absolute Gehör – und ihre erste Liebe zum Jazz, als sie in der Schule Aufnahmen von Bud Freeman, Muggsy Spanier, Sidney Bechet, dem Benny Goodman Trio und Duke Ellington hörte. Mit 17 bewarb sie sich an der Guildham School of Music and Drama in London und wurde angenommen. Bald nahm sie außerdem Stunden bei Billy Mayerl, der sie einlud, mit ihm auf Tournee zu gehen in einer Show mit vier Klaviervirtuosen. Sie genoss die Bühne und das Reisen und entschied sich, das Konservatorium ohne Abschluss zu verlassen. Sie machte sich einen Namen in England, dann aber kam der Krieg, und 1944 entschied sich Marian, als Musikerin an Tourneen der Truppenbetreuung teilzunehmen.
In den Ardennen traf sie den Kornettisten Jimmy McPartland, der in ähnlicher Mission zur Unterhaltung der amerikanischen Truppen unterwegs war. Die beiden heirateten, ein “odd couple”, wie Roy Eldridge sie später beschrieb, die “gute Tochter” aus England und der dem Alkohol zugeneigte Unterschichten-Trompeter aus Chicago. Sie reisten durch Europa, Garmisch, Paris, ein Nachmittag bei den Nürnberger Prozessen, wo sie Hermann Göring gegenübersaß, dann kehrten die beiden im April 1946 zurück – d.h. Marian zum ersten Mal – in die USA.
Paul de Barros unterbricht seine Biographie der Pianistin an dieser Stelle mit einem Exkurs, in dem er Herkunft und Karriere ihres Mannes erzählt, dessen Ruf ihr erheblich dabei behilflich war in New York musikalisch Fuß zu fassen. Die McPartlands lebten in New York und in Chicago, und de Barros erzählt von all den Schwierigkeiten, die die Ehe aushalten musste, meistens wegen Jimmys Alkoholsucht. Marian spielte in seiner Band, daneben aber ging sie jeden Abend aus, um andere Musiker zu hören. 1950 zogen sie zurück nach New York. 1951 nahm Marian ihre ersten Aufnahmen unter eigenem Namen auf, wenig später erhielt sie einen Gig im Embers Club, zu dem durch seltsamste Zufälle keine Geringeren als Roy Eldridge und Coleman Hawkins als “Sidemen” engagiert wurden. Die Presse wurde auf sie aufmerksam, und Marian McPartland zählte bald zu den wenigen Frauen, die als Instrumentalistinnen im Jazz ernst genommen wurden. Später wechselte sie ins Hickory House, wo die halbe New Yorker Jazzwelt regelmäßig vorbeischaute und sich ihrer bewusst wurde. Die Pianistin weiß viele Anekdoten aus diesem Engagement zu erzählen, und de Barros ergänzt diese um Informationen zum Familienleben der McPartlands, die neben einer Wohnung auf der 79sten Straße in Manhattan bald auch ein Häuschen in Long Island besaßen.
Marian erzählt offen von ihrer Beziehung zu Joe Morello, der sich scheiden ließ und sie aufforderte dasselbe zu tun und ihn zu heiraten. Das Jazzgeschäft ging in den 1960er Jahren zurück, und McPartlands neue Tätigkeit als Journalistin für Down Beat war in vielerlei Hinsicht eine Hilfe. Sie war unglücklich, ging regelmäßig zu einem Psychoanalytiker und ließ sich schließlich Ende 1967 von Jimmy scheiden. 1968 gründete sie das Label Halcyon Records, auf dem vor allem Pianisten dokumentiert werden sollten. Sie freundete sich mit dem Komponisten Alec Wilder an, dessen Stücke zu einem wichtigen Teil ihres Repertoires wurden. 1971 folgte sie Mary Lou Williams ins Cookery in Greenwich Village, spielte außerdem im Café Carlyle und ging seit Mitte der 1970er Jahre auch wieder vermehrt auf Tournee.
1978 produzierte Marian McPartland ihre erste “Piano Jazz”-Show mit der von ihr bewunderten Kollegin Mary Lou Williams. Die Geschichten insbesondere über die etwas schwierigeren der Gäste sind höchst amüsant zu lesen und machen einen neugierig diese Shows noch einmal zu hören. Anfang der 1980er Jahre zog sie wieder mit Jimmy McPartland zusammen, der Anfang 1991 starb. McPartland wurden mit zunehmendem Alter und wachsender Gebrechlichkeit ein wenig schwieriger für ihre Umwelt, beschwerte sich über dies und das, wurde ungeduldig, unfair zu denen, die sie umsorgten. Aber sie machte weiter ihre gefeierte Radio-Show, lud immer mehr junge Gäste ein, Kollegen wie Marilyn Crispell oder Brad Mehldau, selbst Elvis Costello. Am 6. Juni 2010 wurde Marian McPartland zum Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE) ernannt.
Paul de Baros’ Buch ist eine “labor of love”, zugleich ein ungemein offenes Buch über eine großartige Musikerin, eine Wanderin zwischen den Welten, die viel vom Jazz erhielt und viel zurückgab über all die Jahre. Ein dickes Buch, eine ungemein vergnügliche Lektüre, absolut empfehlenswert.
Wolfram Knauer (November 2012)
Storia del Jazz. Una prospettiva globale
Von Stefano Zenno
Viterbo 2012 (Stampa Alternativa)
602 Seiten, 25 Euro
ISBN: 978-88-6222-184-9
 Noch eine Jazzgeschichte, mag man denken, aber jede Generation sollte ihre eigene Sicht auf die Geschichte dieser Musik werfen, denn sowohl das Geschichtsbewusstsein wie auch das Wissen um Einflüsse und Wirkungsstränge der Historie ändern sich. Stefano Zenni also hat eine neue 600seitige Jazzgeschichte in italienischer Sprache geschrieben, aus Sicht eines Musikwissenschaftlers mehr als eines Historikers, mit Blick auf musikalische Entwicklungen mehr als auf Anekdoten.
Noch eine Jazzgeschichte, mag man denken, aber jede Generation sollte ihre eigene Sicht auf die Geschichte dieser Musik werfen, denn sowohl das Geschichtsbewusstsein wie auch das Wissen um Einflüsse und Wirkungsstränge der Historie ändern sich. Stefano Zenni also hat eine neue 600seitige Jazzgeschichte in italienischer Sprache geschrieben, aus Sicht eines Musikwissenschaftlers mehr als eines Historikers, mit Blick auf musikalische Entwicklungen mehr als auf Anekdoten.
Zenni verspricht zudem eine globale Perspektive, und es ist an dieser Stelle, an der sein Buch seinem eigenen Anspruch nicht ganz gerecht wird. Europa wird immer mal wieder erwähnt, aber die Diskussion um die Wertigkeit einer europäische Sichtweise auf den Jazz, die insbesondere in den letzten Jahren wieder zunahm, spiegelt sich in seinem Buch höchstens am Rande. Ansonsten ist die “Storia del Jazz” vor allem eine Fleißarbeit, dekliniert die Jazzgeschichte durch alle erdenklichen Aspekte, erwähnt Höhepunkte und Einflussstränge, wichtige Aufnahmen und ästhetische Bewegungen. Am sinnfälligsten ist Zennis neue Sicht auf die Jazzgeschichte dort, wo er Kapitelpaarungen vornimmt, die anderen so vielleicht nicht gleich in den Sinn gekommen wären: Bunny Berigan und Roy Eldridge etwa, Mildred Bailey und Billie Holiday, Fats Waller und Nat King Cole oder besonders Eric Dolphy und Bill Evans. Hier animiert er den Leser zum Nachdenken um Gemeinsamkeiten oder zumindest gemeinsame Auslöser für stilistische Entscheidungen und Entwicklungen.
Typographisch hätte man dem Buch eine bessere Absatzgliederung gewünscht; mit der Entscheidung alle Absätze ohne Einschub zu drucken wirken die Seiten über lange Strecken wie Bleiwüsten, durch die man sich kämpfen muss. Aber dann ist dies Buch sicher vor allem als Referenz etwa für Studierende gedacht oder als Nachschlagewerk für Fans. Dem entspricht eine sorgfältige Indizierung im Namens und Titelregister, die das Buch schnell erschließbar machen.
Wolfram Knauer (November 2012)
Born to Play. The Ruby Braff Discography and Directory of Performances
Von Thomas P. Hustad
Lanham/MD 2012 (Scarecrow Press)
683 Seiten, 59,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8264-5
A cumulative update with additions and corrections can be requested by the author himself: hustad@indiana.edu:
 Ruby Braff zählt zu den bedeutendsten Individualisten des Mainstream-Stils, der in den 1950er Jahren eine Art Amalgam aus swingendem Dixieland und antreibendem Swing präsentierte. Braff war vielleicht der größte Kammermusiker dieses Stilsegments, der in Dixielandensembles genauso mithielt wie in intimen Duobesetzungen etwa mit Ellis Larkins oder Dick Hyman. Thomas R. Hustad hatte noch zu Lebzeiten des 2003 verstorbenen Kornettisten mit der nun vorliegenden Diskographie begonnen und Braff die ersten Kapitel zeigen können. Der sei angetan davon gewesen, dass das Buch sich nicht wie eine Biographie um sein Leben, sondern ausschließlich um seine Musik drehen würde, berichtet Hustad im Vorwort seines fast 700 Seiten starken Werks, das tatsächlich weit mehr ist als eine reine Diskographie, neben den Daten und Titeln des Braffschen Aufnahmeschaffen nämlich auch alle Engagements verzeichnet, die Hustad dokumentieren konnte und zusätzlich aus Artikeln und Kritiken zitiert. So entsteht zwischen den trockenen Besetzungs- und Repertoirelisten das Bild eines umtriebigen, ungemein aktiven Musikers, der mit Swinggrößen genauso zusammenspielte wie er sich mit Musikern anderer Stile maß oder auch mal mit dem klassischen Beaux Arts String Quartet musizierte.
Ruby Braff zählt zu den bedeutendsten Individualisten des Mainstream-Stils, der in den 1950er Jahren eine Art Amalgam aus swingendem Dixieland und antreibendem Swing präsentierte. Braff war vielleicht der größte Kammermusiker dieses Stilsegments, der in Dixielandensembles genauso mithielt wie in intimen Duobesetzungen etwa mit Ellis Larkins oder Dick Hyman. Thomas R. Hustad hatte noch zu Lebzeiten des 2003 verstorbenen Kornettisten mit der nun vorliegenden Diskographie begonnen und Braff die ersten Kapitel zeigen können. Der sei angetan davon gewesen, dass das Buch sich nicht wie eine Biographie um sein Leben, sondern ausschließlich um seine Musik drehen würde, berichtet Hustad im Vorwort seines fast 700 Seiten starken Werks, das tatsächlich weit mehr ist als eine reine Diskographie, neben den Daten und Titeln des Braffschen Aufnahmeschaffen nämlich auch alle Engagements verzeichnet, die Hustad dokumentieren konnte und zusätzlich aus Artikeln und Kritiken zitiert. So entsteht zwischen den trockenen Besetzungs- und Repertoirelisten das Bild eines umtriebigen, ungemein aktiven Musikers, der mit Swinggrößen genauso zusammenspielte wie er sich mit Musikern anderer Stile maß oder auch mal mit dem klassischen Beaux Arts String Quartet musizierte.
Hustad beschreibt Braffs Bewunderung für Louis Armstrong genauso wie seine lebenslange Freundschaft zu anderen in Boston Geborenen wie dem Pianisten und Festivalmacher George Wein oder dem Kritiker Nat Hentoff. Seine ersten Nachweise für einen Braff-Auftritt stammen aus dem Jahr 1944, als der Kornettist gerade mal 17 Jahre alt war. Nur drei Jahre später immerhin stand er bereits mit Jazzgrößen wie Bud Freeman oder Hot Lips Page auf der Bühne. 1949 spielte er in der Band des Klarinettisten Edmond Hall und trat 1950 erstmals auch als Bandleader in Erscheinung. 1952 hörte ihn der Impresario John Hammond bei einem Festival an der Brandeis University und engagierte ihn für einige von ihm produzierte Mainstream-Aufnahmen für das Label Vanguard, die Braff auch nationale Aufmerksamkeit bescherten. Mitte der 1950er Jahre spielte Braff mit Jack Teagarden und Benny Goodman, nahm außerdem seine Duo-Platte mit dem Pianisten Ellis Larkins auf. Er trat auf großen Jazzfestivals auf und war auch im Fernsehen zu hören. Ab Mitte der 1960er Jahre tourte er regelmäßig durch Europa und baute sich insbesondere in Großbritannien eine große Fangemeinde auf. Er war Kornettist der ersten Wahl für George Weins Newport Jazz Festival All Stars und damit auch bei den vielen Festivals mit dabei, die Wein in den 1960er und 1970er Jahren in den USA und Europa etablierte. Wie Harry Edison der meist-gefeaturete Trompeter in Aufnahmen Frank Sinatras war, so wirkte Braff bei vielen Aufnahmen Tony Bennetts in der ersten Hälfte der 1970er Jahre mit. Er nahm Platten für die Labels Concord und Chiaroscuro auf, arbeitete mehr und mehr in Projekten des Pianisten Dick Hyman und gründete ein kurzlebiges, aber sehr erfolgreiches Quartett zusammen mit dem Gitarristen George Barnes. In den 1970er und frühen 1980er Jahren war Braff regelmäßiger Gast der Grand Parade du Jazz in Nizza, und Hustad listet all die unterschiedlichen Besetzungen, in denen der Kornettist dabei zu hören war. Auch in den 1980er Jahren gehörte Braff zu den aktivsten Musikern bei sogenannten Jazz Parties, also Festivals, die auf dem Prinzip der Jam Session basierten. 1993 nahm er seine erste Platte für das Label Arbors auf, dem er bis zu seinem Tod treu blieb.
Die Anlage des Buchs als Diskographie und chronologische Auftrittslistung macht die durchgehende Lektüre etwas schwierig; dafür aber macht das Blättern in dem Buch umso mehr Spaß, bei dem man viele nebensächliche Details verzeichnet findet, die zum einen den Alltag eines arbeitenden Musikers, zum anderen aber auch die Persönlichkeit Braffs beleuchten, der klare Vorstellungen davon hatte, unter welchen Umständen er auftrat. “Egal wo ich spiele – ich suche die Musiker aus. Ich wähle die Stücke aus. Niemand sonst. Ich begleite niemanden!” – so in einer Absage an das Angebot, für eine recht kleine Gage in einer Fernsehshow zu Ehren des Impresarios John Hammond neben Benny Goodman, George Benson, Benny Carter, Teddy Wilson, Red Norvo, Milt Hinton, Jo Jones und anderen aufzutreten. Diese Erklärung schloss er übrigens mit den Worten: “Ich habe kein Interesse an Eurer gottverdammten Show. Gibt’s sonst noch irgendwelche Fragen?”
Wolfram Knauer (November 2012)
Always in Trouble. An Oral History of ESP-Disk, the Most Outrageous Record Label in America
von Jason Weiss
Middletown/CT 2012 (Wesleyan University Press)
291 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8195-7159-5
 Zwischen 1964 und 1974 war das von Bernard Stollman gegründete Plattenlabel ESP-Disk’ vielleicht eines der einflussreichsten Labels des Avantgarde-Jazz. Neben Free-Jazz-Heroen wie Albert Ayler, Pharoah Sanders, Sun Ra brachte Stollman dabei auch Platten von Folk-Rock-Bands wie The Fugs oder Pearls Before Swine heraus. In seinem neuen Buch erzählt Jason Weiss die Geschichte des Labels, beispielhaft für die Biographie einer unabhängigen Plattenfirma im Amerika der Bürgerrechtsbewegung.
Zwischen 1964 und 1974 war das von Bernard Stollman gegründete Plattenlabel ESP-Disk’ vielleicht eines der einflussreichsten Labels des Avantgarde-Jazz. Neben Free-Jazz-Heroen wie Albert Ayler, Pharoah Sanders, Sun Ra brachte Stollman dabei auch Platten von Folk-Rock-Bands wie The Fugs oder Pearls Before Swine heraus. In seinem neuen Buch erzählt Jason Weiss die Geschichte des Labels, beispielhaft für die Biographie einer unabhängigen Plattenfirma im Amerika der Bürgerrechtsbewegung.
Stollman war ein aufstrebender Rechtsanwalt, der in den späten 1950er Jahren in der Esperanto-Bewegung aktiv war, die eine universelle Sprache befürwortete. Anfang der 160er Jahre hörte er die Musiker der sogenannten October Revolution in Jazz und nahm bald etliche der Künstler auf, die in dieser künstlerischen Bewegung mitmischten. In den zehn Jahren des Bestehens des Labels brachte er auf ESP-Disk’ 125 Platten heraus, die zwar von der Kritik hoch gelobt wurden, aber kaum Geld einbrachten. Eigentlich war das Label bereits nach vier Jahren pleite, aber Stollman hing an der Idee. Nachdem das Label endgültig abgewickelt war, nahm Stollman einen Rechtsanwalts-Job für die Regierung an. ESP führte ein seltsames Schattenleben, da die legendären Aufnahmen in Europa und Japan als Bootlegs auf dem Markt präsent gehalten wurden. Zehn Jahre nach seiner Pensionierung belebte Stollman das Label 2005 wieder und managt seither sowohl Wiederveröffentlichungen wie auch Neuproduktionen aus seinem Büro in einem ehemaligen Waschsalon im Viertel Bedford Stuyvesant von Brooklyn. Neben der Arbeit mit dem originären ESP-Material widmet sich Stollman dabei auch der Vertretung der musikalischen Nachlässe von Eric Dolphy, Bud Powell, Art Tatum, Sun Ra, Albert Ayler und einigen anderen, betreut dabei auch Wiederveröffentlichungen oft ursprünglich schwarz mitgeschnittener Konzertaufnahmen dieser Künstler.
All dies erfährt man im knappen Vorwort, in dem Weiss die Hintergründe des Labels zusammenfasst. Ansonsten lässt er die Macher reden. Den größten Teil des Buchs nimmt dabei Stollmans Erinnerung ein, der über seine eigene Herkunft aus einem jüdischen Elternhaus berichtet, über Militärdienst, Studium und erste Jazzkontakte. Stollman erzählt über die Idee zum Plattenlabel, den Kontakt zu und die Verträge mit Künstlern, über seine Naivität in geschäftlichen Dingen. In einem anderen Kapitel erklärt Stollman spätere Lizenzausgaben von ESP-Platten und beschreibt die Deals, die er mit den Lizenznehmern gemacht habe. Er erinnert sich an legendäre Sessions etwa mit Albert Ayler, Giuseppi Logan, Sun Ra, Frank Wright oder Yma Sumac. Er erzählt außerdem davon, wie er einmal Barbra Streisand zum Essen ausführte, die die Einladung nur annahm, weil sie dachte, er sei ihr Freund, der zufällig genau wie er hieß, über Begegnungen mit Jimi Hendrix, Yoko Ono und John Lennon, Janis Joplin sowie Emmylou Harris.
Der zweite Teil des Buchs stellt Stollmans Erinnerungen Interviews mit fast 40 Künstlern gegenüber, die über ihre Zusammenarbeit mit ihm und über ihre ESP-Platten berichten. Gunter Hampel etwa erzählt, dass Stollman ihn nie bezahlt habe, und er sich auch deshalb entschieden habe, sein eigenes Plattenlabel zu gründen. Auch andere Künstler klagten (wie so oft in dieser Industrie) über nicht eingehaltene finanzielle Zusagen, Milford Graves aber erklärt auch: “Wer sonst hätte uns damals aufgenommen?”
Jason Weiss’ Buch klammert also kein Thema aus und lässt die unterschiedlichen Sichtweisen der Partner bei den Plattenprojekten nebeneinander stehen. So ergibt sich in seinem lesenswerten Buch ein überaus stimmungsvolles Bild eines Labels, das eine der interessantesten amerikanischen Szenen der 1960er Jahre dokumentiert.
Wolfram Knauer (Oktober 2012)
Freie Hand
Roman, von Rainer Wieczorek
Berlin 2012 (Dittrich Verlag)
ISBN: 978-3-937717-83-8
 Rainer Wieczoreks Romane haben immer wieder Subplots aus dem Jazz. Wieczorek ist selbst Posaunist und hat über viele Jahre regelmäßig Jazzkonzerte organisiert. Sein neuester Roman ist von den bisherigen Büchern vielleicht der jazzhaltigste, auch deshalb, weil viele eigene Erinnerungen in das Buch über die Mühen kultureller Arbeit einflossen. Das Buch handelt von zwei ambitionierten Literaturliebhabern, einen Ort aufzubauen, der irgendwo zwischen Literatur- und Jazzclub angesiedelt ist und der Kulturszene ihrer Stadt neue Facetten beimischen soll.
Rainer Wieczoreks Romane haben immer wieder Subplots aus dem Jazz. Wieczorek ist selbst Posaunist und hat über viele Jahre regelmäßig Jazzkonzerte organisiert. Sein neuester Roman ist von den bisherigen Büchern vielleicht der jazzhaltigste, auch deshalb, weil viele eigene Erinnerungen in das Buch über die Mühen kultureller Arbeit einflossen. Das Buch handelt von zwei ambitionierten Literaturliebhabern, einen Ort aufzubauen, der irgendwo zwischen Literatur- und Jazzclub angesiedelt ist und der Kulturszene ihrer Stadt neue Facetten beimischen soll.
Sie bemühen sich um kommunale wie private Unterstützung, finden einen passenden Ort und sichern ihr Projekt auch finanziell erfolgreich ab. Ihr Club eröffnet und wird schnell zu einem angesagten kulturellen Treffpunkt. Sie etablieren eine Sachbuchreihe, eine weitere, die Hörspiele in den Mittelpunkt stellt, sowie eine mit Klassikern der Nachkriegsmoderne, die sie mit Musik kombinieren. Der Saxophonist Heinz Sauer wird zusammen mit dem Pianisten Bob Degen für einen Billie-Holiday-Abend gewonnen, bei dem eine Schauspielerin aus der Autobiographie der Sängerin liest. Sauer, charakterisiert Wieczorek seine Musik, spielt “Töne am Rande des Noch-Spielbaren, die stets bedroht waren vom Kontaktverlust, um sich dann, an der äußersten Kante stehend auffangen zu lassen vom Klavier oder sich ersatzweise einem leise verebbenden Nachspiel ergaben”. Oft schien “nur Bob Degen sicher zu wissen, an welcher Stelle sich Sauer befindet, von welchem Akkord die Töne, die jetzt erklingen, ihren Ausgang nahmen, bevor sie ihn vollständig verließen.”
Ein andermal ist Heinz Sauer zu einem Gesprächskonzert zu Gast, für das er den jungen Pianisten Michael Wollny mitbringt. Sauer erinnert sich an diesem Abend an seine Kindheit, an die Normalität des Nationalsozialismus, and sein Faible für den Jazz nach dem Krieg. Auch andere (real existierende) Musiker treten in Erscheinung, der Vibraphonist Christopher Dell etwa, der einen Gedichtabend begleitet, oder der Pianist Uli Partheil, der zu einem Gespräch mit dem Schriftdesigner Hermann Zapf spielt.
Die Kulturarbeit normalisiert sich, und neben vollen gibt es auch leere Säle, etwa bei jenem Abend, den die beiden “dem unbekannten Autor” widmen und bei dem ein Cellist und ein Pianist kurze Stücke von Anton Webern spielen, während die üblicherweise der Lesung vorbehaltene Zeit jetzt einfach der Stille dient. “Wir brauchen nicht jedesmal ein Publikum”, sinnieren sie, “stets aber die Möglichkeit eines Publikums, formulieren wir genauer: den Raum für ein Publikum.”
Dann setzen politische Veränderungen ein, die auch die Kultur in der Stadt betreffen. Und schließlich zieht ihr großzügiger Geldgeber sich mehr und mehr von seinen Zusagen zurück. Und so kommt es, “dass unsere Programme nur noch pro forma gedruckt wurden und zumeist nur eine einzige Veranstaltung enthielten, die ernsthaft mit Publikum rechnen konnte”. Der Niedergang ihres Projekts ist abzusehen, lässt sie aber nicht ohne Hoffnung. Es muss doch möglich sein, wieder so einen kunstsinnigen Geldgeber zu finden…
Alle Autoren, von denen Wieczorek in seinem Roman fasziniert ist, existieren genauso wie die Musiker, die er nennt und mit denen er auch in Wirklichkeit gern und oft zusammenarbeitete. Das Gesprächskonzert mit Heinz Sauer hat genauso stattgefunden wie die Gesprächsrunde mit Hermann Zapf. Und Dirk Lorenzen, dessen astrophysikalische Texte als eine Art Zwischenspiel dienen, als Blick von und auf “ganz außen” quasi, ist tatsächlich, wie von Wieczorek beschrieben, für viele der Himmelsgeschichten in der Sendung “Sternzeit” des Deutschlandfunks verantwortlich. Auch viele der anderen Personen der Erzählung haben Vorbilder in der realen Lebenswirklichkeit des Autors. Solche Kenntnis aber braucht es nicht, um den Roman, der gekonnt zwischen den Lieben Wieczoreks wechselt, als ein Buch zu genießen, dessen Thema Kreativität genauso ist wie der Raum, der unbedingt notwendig ist, um sie zu ermöglichen. Das Lesevergnügen ergibt sich aus der Leichtigkeit des sprachlichen Stils, aus der Balance zwischen Dialogen, Beschreibungen, Begeisterungsfähigkeit und der Gabe, auch Misserfolge als das wahrzunehmen, was sie sind: Versuche, die unternommen werden müssen, weil Kunst nun mal nur gedeiht, wenn man vorbehaltlos ihren Raum zugesteht.
Wolfram Knauer (August 2012)
Strictly a Musician. Dick Cary. A Biography and Discography
von Derek Coller
Sunland/CA 2012 (Dick Cary Music)
602 Seiten, 59,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-615-53867-9
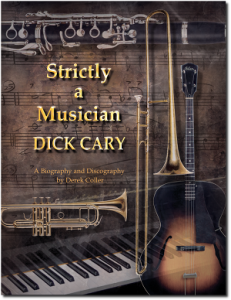 Dick Cary gehört vielleicht nicht zu den bekanntesten Namen der Jazzgeschichte. Als Pianist, Althorn-Spieler, Trompeter, Komponist und Arrangeur war er allerdings seit den frühen 1940er Jahren auf der traditionellen Jazzszene New Yorks überaus aktiv und spielte mit allen Musikern des Jazzrevivals jener Jahre, mit Eddie Condon, Billy Butterfield, Louis Armstrong, Jimmy Dorsey, Bobby Hackett und vielen anderen. Cary war darüber hinaus ein Musiker mit offenen Ohren, der Interesse auch an dem hatte, was Kollegen anderer Stilrichtungen damals entwickelten. Vor allem aber hinterließ der 1916 geborene und 1994 gestorbene Musiker Tagebücher, die mit wenigen Lücken sein Leben und seine Arbeit zwischen 1931 und 1992 dokumentieren.
Dick Cary gehört vielleicht nicht zu den bekanntesten Namen der Jazzgeschichte. Als Pianist, Althorn-Spieler, Trompeter, Komponist und Arrangeur war er allerdings seit den frühen 1940er Jahren auf der traditionellen Jazzszene New Yorks überaus aktiv und spielte mit allen Musikern des Jazzrevivals jener Jahre, mit Eddie Condon, Billy Butterfield, Louis Armstrong, Jimmy Dorsey, Bobby Hackett und vielen anderen. Cary war darüber hinaus ein Musiker mit offenen Ohren, der Interesse auch an dem hatte, was Kollegen anderer Stilrichtungen damals entwickelten. Vor allem aber hinterließ der 1916 geborene und 1994 gestorbene Musiker Tagebücher, die mit wenigen Lücken sein Leben und seine Arbeit zwischen 1931 und 1992 dokumentieren.
Derek Coller konnte auf diese Tagebücher zurückgreifen, um in seiner ungemein detaillierten Biographie die Lebensgeschichte Carys zu erzählen. Coller beschreibt die Jugend des in Connecticut geborenen Cary, erste Banderfahrungen, die nicht die besten waren (“Ich wurde aus der Band geworfen”) sowie erste Engagements, die Geld einbrachten. Die üblichen Einflüsse der Zeit galten auch für Cary, den Pianisten: Fats Waller, Earl Hines, Teddy Wilson, Art Tatum und Bob Zurke; seine ersten Arrangements brachten ihm 1939 fast einen Job mit Glenn Miller ein. Irgendwann Anfang der 1940er Jahre zog Cary mit Frau und Tochter nach New York, wo er einen Großteil seines Einkommens aus Arrangements bezog – allein zwischen 1940 und 1941 schrieb er mehr als 130 Arrangements für etwa 20 verschiedene Bands und Sänger/innen. Im Dezember 1941 trat er zum ersten Mal im legendären Club Nick’s in New Yorks Greenwich Village mit Eddie Condon, Pee Wee Russell und anderen Größen des Stils auf; meist war er dabei Pianist, hin und wieder trat er aber auch als Trompeter in Erscheinung.
Mitte der 1940er Jahre spielte Cary in der Bigband des Trompeters Billy Butterfield, in der er als 5. Trompeter, Althornist und Arrangeur angestellt war. 1947 wirkte er bei einem legendären Konzert der Armstrong All-Stars in der New Yorker Town Hall mit und wurde im Sommer des Jahres für sechs Monate reguläres Mitglied der All-Stars. Er spielte auf der 52nd Street, insbesondere im Club Jimmy Ryan’s, und er nahm Unterricht beim klassischen Komponisten Stefan Wolpe. Jimmy Dorsey engagierte ihn für seine Band, und Cary schrieb außerdem Musiken für Werbefilmchen und fürs Fernsehen. Auch in den 1950er Jahren gehörte er zu den verlässlichen Musikern der traditionellen Szene, trat mit Max Kaminsky auf sowie mit jeder Menge anderer namhafter Musiker, auch solchen der Swingära, die damals in Dixielandschuppen ihr Geld verdienen mussten. Ende der 1950er Jahre war er reguläres Mitglied der Band Bobby Hacketts; machte sich außerdem einen Namen als einer jener Arrangeure, die versuchten, dem traditionellen Jazz einen interessanteren Klang zu verleihen.
Anfang der 1960er Jahre zog Cary nach Kalifornien, trat wieder zunehmend als Althornist in Erscheinung und spielte in regelmäßig in Disneyland. Gegen Ende des Jahrzehnts wurde er außerdem Mitglied der World’s Greatest Jazz Band. In den 1970ern reiste er oft und gern nach Europa und trat hier auch mit vielen europäischen Bands als Gastsolist auf – nicht zuletzt mit der deutschen Barrelhouse Jazzband. Er wurde als Solist zu den populären “Jazz Party”-Festivals eingeladen und wirkte auf etlichen Platten mit. Anfang der 1990er Jahre wurde bei ihm eine Krebserkrankung festgestellt, an der er im April 1994 verstarb.
Derek Collers Buch ist allein schon dank der dem Autor zur Verfügung stehenden Tagebücher ungemein faktenreich. Coller listet Besetzungen und Konzertdaten, zitiert Cary und ordnet dessen Bemerkungen sogleich ins Jazzgeschehen der Zeit ein. Das sorgt nicht unbedingt für eine flüssige Lektüre, und doch gibt gerade diese Genauigkeit, mit der Coller Carys Leben dokumentiert, dem Buch eine besondere Qualität: Wir erfahren über die Jazzszene der Condon-Freunde aus erster Hand, über “die andere Seite” der 52nd Street sozusagen, die ansonsten vor allem für die Ausbildung des Bebop genannt wird. Das Privatleben Carys kommt bei alledem etwas kurz in der Darstellung. Nur ein kurzes zwischengeschobenes Kapitel gibt Aufschluss über Carys lebenslangen Kampf mit dem Alkohol. Und auch über die Musik selbst erfahren wir wenig. Dafür ist Collers Buch eine Fakten-Biographie und damit eine gute Quelle für Forscher, da es qua Tagebücher auf erstklassige Zeitzeugendetails verweist. Die Diskographie, die fast 100 Seiten des Buchs einnimmt, gibt einen Überblick über Carys Aufnahmeschaffen. Und der ausführliche Namensindex erschließt das Buch schnell für Forscher, die nach Fakten und Hinweisen suchen, die anderweitig schwer zu finden wären.
“Strictly a Musician” ist auf jeden Fall eine wichtige Ergänzung der jazzgeschichtlichen Forschung, die Fleißarbeit eines langjährigen Jazzjournalisten und Privatforschers und ein Buch, das sich nicht nur vom Umfang her mit Manfred Selchows wegweisenden Werken über Edmond Hall und Vic Dickenson vergleichen lässt.
Wolfram Knauer (September 2012)
Blues 2013. Rare Photographs by Martin Feldmann
Kalender von Martin Feldmann
Attendorn 2012 (Pixelbolide)
Kalender, 12 Monatsblätter, 24,95 Euro
www.blueskalender.de
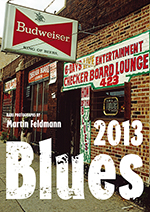 Martin Feldmann fotografiert seit den frühen 1980er Jahren Bluesmusiker für deutsche und amerikanische Fachmagazine, arbeitete außerdem lange Zeit für die Frankfurter Rundschau, für die er immer wieder Beiträge über Blues und Jazz verfasste.
Martin Feldmann fotografiert seit den frühen 1980er Jahren Bluesmusiker für deutsche und amerikanische Fachmagazine, arbeitete außerdem lange Zeit für die Frankfurter Rundschau, für die er immer wieder Beiträge über Blues und Jazz verfasste.
Jetzt hat Feldmann einen Blueskalender herausgebracht, für den er einige der aussagekräftigsten Bilder seiner diversen Bluesreisen in die USA aus den 1980er Jahren herausgesucht hat. Wir sehen Junior Wells im Club, Charles W. Thompson alias Jimmy Davis bei einem Straßenkonzert, Lefty Dizz auf einer Harley Davidson, Beverly Johnson mit schwarzen Netzhandschuhen, Wade Walton im Barbershop in Clarksdale, Mississippi, Little Milton beim Chicago Festival, Eddie Taylor im Golden Slipper, Chicago, Big Walter Horton, Magic Slim,Harry Caesar. Little Pat Rushing und Queen Silvia Embry. Sie alle sind in Schwarzweiß- und einigen Farbaufnahmen auf großformatige Kalenderblätter gedruckt, die kurze Zusatzinformationen bieten und jedem Raum automatisch eine bluesige Note verleihen.
Vielleicht sollte man dazu ein wenig Musik laufen lassen, damit man dem Blues, den man sowieso jeden Tag erfährt, visuell genauso wie tönend genügend positive Noten abgewinnen kann.
Wolfram Knauer (September 2012)
Jazz. Body and Soul. Photographs and Recollections
von Bob Willoughby
London 2012 (Evans Mitchell Books)
178 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-901268-58-4
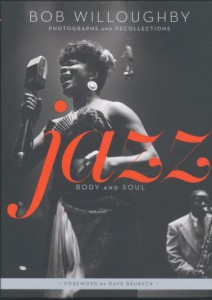 Der 2009 in Südfrankreich verstorbene Fotograf Bob Willoughby dokumentiert die Jazzgeschichte seit den frühen 1950er Jahren. Jetzt erschien ein von Willoughby noch zu Lebzeiten im Entwurf geplantes Buch seiner besten Aufnahmen, die zwischen 1950 und 1959 sowie zwischen 1992 und 1994 datieren. Die frühen Bilder wurden in Los Angeles aufgenommen, die späten Fotos auf Einladung Ulli Pfaus in der Liederhalle in Stuttgart. Willoughby begleitet seine Rückschau in Bildern dabei mit Erinnerungen an die Konzerte und die Künstler, die er da dokumentierte.
Der 2009 in Südfrankreich verstorbene Fotograf Bob Willoughby dokumentiert die Jazzgeschichte seit den frühen 1950er Jahren. Jetzt erschien ein von Willoughby noch zu Lebzeiten im Entwurf geplantes Buch seiner besten Aufnahmen, die zwischen 1950 und 1959 sowie zwischen 1992 und 1994 datieren. Die frühen Bilder wurden in Los Angeles aufgenommen, die späten Fotos auf Einladung Ulli Pfaus in der Liederhalle in Stuttgart. Willoughby begleitet seine Rückschau in Bildern dabei mit Erinnerungen an die Konzerte und die Künstler, die er da dokumentierte.
Neben den üblichen Konzertfotos – Musiker auf der Bühne – gibt es lebendige Backstagebilder, neben weithin bekannten Aufnahmen wie Willoughbys legendären Chet-Baker-Portraits auch selten bis nie gesehene Ansichten von Musikern bei der Arbeit. Der Index am Schluss des Buchs listet die Künstler: Billie Holiday, Miles Davis, Dave Brubeck, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Stan Kenton, Duke Ellington, Big Jay McNeely (der mit einer ganzen Fotoserie im Buch vertreten ist), Cal Tjader, Gerry Mulligan, Peggy Lee, Benny Goodman, Frank Sinatra, Wynton Marsalis und viele, viele mehr. Willoughbys kurze Erinnerungen geben nur kleine Einblicke in seine eigene Jazzsicht, referieren ansonsten eher bekanntes Wissen über die Musiker. Als Fotograf hatte er ein exzellentes Auge für die Musiker, die er ablichtete; und Ulli Pfau hatte nicht Unrecht, als er ihn 1992 als “elder statesman of jazz photography” bezeichnete.
Einige Höhepunkte beim Durchblättern: Bing Crosby und Frank Sinatra inmitten des Sets für den Film “Can-Can”; Louis Armstrong, Grace Kelly und Bing Crosby im Set für “High Society”; Benny Goodman in einem Duo mit Stan Getz; der überschlanke Gerry Mulligan, dessen Instrument quasi aus seinem Körper herauszuwachsen scheint; Paul Gonsalves vor dem Spiegel seiner Garderobe; Coleman Hawkins auf einen Stuhl gelehnt in die Kamera lächelnd; der blinde George Shearing, der sich für eine Ansage am Mikrophon festzuklammern scheint; Miles Davis, zurückgelehnt und entspannt; Lionel Hampton, der Milt Buckner über die Schulter schaut… Aber jeder Betrachter wird seine eigenen Höhepunkte in diesem Buch finden, das mit einem wunderbaren Backstagebild abschließt, auf dem Wycliffe Gordon backstage in Stuttgart im Fernsehmonitor seinem Chef Wynton Marsalis zusieht.
“Jazz – Body and Soul” präsentiert Willoughbys Aufnahmen in hervorragender Druckqualität in einer Hardcoverausgabe im Schuber und mit einem Vorwort Dave Brubecks, den Willoughby seit 1950 immer wieder ablichtete, in Bildern, die zum Teil auch ihren Weg auf Brubeck-Plattencover fanden. Ein schönes Geschenk für Jazzfans – auch an sich selbst.
Wolfram Knauer (September 2012)
Deep South. The Story of the Blues
von Peter Bölke
Hamburg 2012 (Edel ear book)
156 Seiten, 4 CDs, 39,95 Euro
ISBN: 978-3-94000-98-7
 Wie alle “earbooks” von Edel ist auch “Deep South” ein opulentes, hardcover-gebundenes Buch mit stabil in den Buchdeckel eingepassten Aussparungen für die beiheftenden vier CDs – und das alles zu einem mehr als angemessenen Preis.
Wie alle “earbooks” von Edel ist auch “Deep South” ein opulentes, hardcover-gebundenes Buch mit stabil in den Buchdeckel eingepassten Aussparungen für die beiheftenden vier CDs – und das alles zu einem mehr als angemessenen Preis.
Peter Bölkes parallel auf deutsch und englisch verfasste Texte zum Blues und seinen Künstlern ist eingängig und verständlich, nie zu tief greifend, dafür Legenden und Anekdoten weitertragend. Die vier Großkapitel, die dem Inhalt auf den CDs entsprechen, heißen “Rough Sound from the Delta” (Folk/Classic Blues), “Rockin’ the House” (Piano Blues), “Blue Notes from the Cookbook” (Jazz & Blues) sowie “Amplified, Young & White” (Electric Blues). Sie decken die Bluesgeschichte von den Anfängen (Mamie Smiths “Crazy Blues” von 1920) über Country-Blues, Boogie-Woogie, Blues-Interpretationen großer Jazzmusiker bis zum rockigen Blues der 1960er Jahre ab.
Was fehlt, mag jeder für sich entscheiden – dieser Rezensenten etwa vermisste den größte instrumentalen Blueskünstler des Jazz, nämlich Charlie Parker –, aber das wären genauso subjektive Entscheidungen wie Bölke sie für sich vorgenommen hat.
Das Buch ist reich und bunt bebildert mit bekannten und weniger bekannten Fotos der Künstler und einzelner Alben, gedruckt auf festem Papier, und in guter Tonqualität gepresst. Wie die meisten der ear books ist das alles in seinem Sampler-Ansatz weniger etwas für Sammler als für den beiläufigen Interessenten, aber auch für Bluesfans ganz gewiss ein willkommenes Geschenk.
Wolfram Knauer (August 2012)
Modern Piano Method. Klavier spielen – nach Noten und Akkorden
von Georg Boeßner
Frankfurt 2012 (Nordend Music)
144 Seiten, 1 CD, 24.,95 Euro
ISBN: 978-3-9812448-1-6
 Der Klavierunterricht, schreibt Georg Boeßner im Vorwort zu seiner Klavierschule, gehe zwar zunehmend auch in Richtung Pop, Rock und Jazz, auf dem Markt der Klavierschulen aber spiegele sich dieses Bedürfnis kaum wider, insbesondere, was die zur klassischen Notation gleichrangige Vermittlung des Spielens nach Akkordsymbolen beträfe.
Der Klavierunterricht, schreibt Georg Boeßner im Vorwort zu seiner Klavierschule, gehe zwar zunehmend auch in Richtung Pop, Rock und Jazz, auf dem Markt der Klavierschulen aber spiegele sich dieses Bedürfnis kaum wider, insbesondere, was die zur klassischen Notation gleichrangige Vermittlung des Spielens nach Akkordsymbolen beträfe.
Boeßners Schule also will beides miteinander verknüpfen. Er beginnt ganz am Anfang, Sitzhaltung, Tastatur, Notensystem, einfache Lieder. Dann kommen erste Akkorde, die Boeßner gleich nicht nur mit Noten, sondern eben auch mit Akkordsymbolen vorstellt.
Ein erster Blues, Einführung komplexerer Rhythmik, das Zusammenspiel rechter und linker Hand, und schließlich andere Tonarten (als das anfängliche C-Dur). Zwischendrin immer wieder Rückgriffe auf Essentials, Erklärungen der Intervalle etwa, der Dur- und Mollakkorde. Und neben Fingerübungen immer wieder kleine Stücke, die den Schüler bei Laune halten und ihn langsam ans Spielen heranführen – und zwar eben nicht nur ans sture Notenablesen, sondern auch ans Begreifen der harmonischen Grundlagen, das für spätere Improvisation so wichtig ist.
Die Selbstverständlichkeit dieses Ansatzes mag hoffentlich bewirken, dass die Nutzer seiner Klavierschule sich später viel leichter vom Notenblatt lösen können als diejenigen, die nach konventionellen Methoden ans Klavier herangeführt wurden.
Wolfram Knauer (August 2012)
The Ellington Century
von David Schiff
Berkeley 2012 (University of California Press)
319 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-520-24587-7
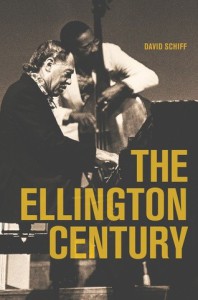 Noch ein Buch über Ellington, mag der eine oder andere sagen, aber David Schiffs “Ellington Century ist mehr als dies. Schiff versucht Ellington in die Musikgeschichte des 20sten Jahrhunderts einzuordnen und ihn dabei, wie der Duke sagen würde, “beyond categories” zu betrachten, also nicht nur in Bezug auf den Jazz-Background, aus dem er kam.
Noch ein Buch über Ellington, mag der eine oder andere sagen, aber David Schiffs “Ellington Century ist mehr als dies. Schiff versucht Ellington in die Musikgeschichte des 20sten Jahrhunderts einzuordnen und ihn dabei, wie der Duke sagen würde, “beyond categories” zu betrachten, also nicht nur in Bezug auf den Jazz-Background, aus dem er kam.
Schiff geht dafür in seinen Kapiteln zuallererst einmal von der Musik selbst aus. Er beginnt mit dem Kapitel “Such Sweet Thunder”, beschreibt Musik und Entstehungsgeschichte der Suite, erwähnt, dass die Komposition bei ihrer Premiere gleich neben Kurt Weills Violinkonzert gespielt wurde und stellt fest, dass die musikalischen Experimente des 20sten Jahrhunderts eben im Jazz genauso stattfanden wie in der sogenannten klassischen Moderne. Er erlaubt sich schließlich den Seitenblick auf Arnold Schönbergs Fünf Stücke für Orchester op. 16, “Farben”. “Blue Light: Color” heißt das zweite Kapitel, das solchen Farben in Ellingtons Musik auf den Grund zu gehen versucht. Schiff analysiert “Blue Light” im Lichte des Blues, “Ko-Ko” als “schwarze” Erfahrung, schließt dann Ausflüge an zu Schönbergs “Pierrot Lunaire” und zu Debussys Musik, um schließlich zu Ellingtons ganz eigener “Klangfarbenmelodie” zurückzukehren.
Im Kapitel “Cotton Tail” nähert sich Schiff dem Phänomen der Rhythmik in Ellingtons Musik, aber auch weit genereller dem Phänomen des swing. Er arbeitet dabei die Unterschiede zwischen pulsierendem Rhythmus, melodischem Rhythmus, einer vom Grundrhythmus abweichenden “supermelody” sowie dem Shout-Rhythmus heraus. Zugleich geht er auf die Unterschiede zwischen europäischer und afro-amerikanischer musikalischer Auffassung ein und diskutiert verschiedene Aufnahmen des “Tiger Rag” sowie James P. Johnsons “Carolina Shout” mit Hinblick auf ihre rhythmischen Qualitäten. Nach all diesen Argumenten animiert Schiff seine Leser dazu, “Cotton Tail” noch einmal zu hören und wahrzunehmen, mit wie viel verschiedenen Ebenen Ellington hier meisterhaft spielt. Auch dieses Kapitel kommt dabei nicht ohne einen Seitenblick auf die europäische Musiktradition aus und betrachtet dazu Béla Bartóks 5. Streichquartett, Igor Stravinski sowie John Cage, Charlie Parker und Eric Dolphy.
“Prelude to a Kiss” beschäftigt sich mit der Melodik Ellingtons und schaut daneben nicht nur auf klassische Beispiele, sondern auch auf die Tin Pan Alley-Schlager der Zeit. Schiff fragt nach der melodischen Sexualisierung im Jazz (und stützt sich dabei auf fragwürdige Analysen, nach denen in klassischer Musik Chromatik oft für Sexualität stünde). Er interpretiert Billy Strayhorns “Day Dream” als “Bluesisierung” des Songmodells und analysiert “U.M.M.G.” auf seine thematische Melodik hin.
“Satin Doll” ist das Kapitel über Ellingtons Harmonik überschrieben, in dem Schiff Parallelen zu anderen harmonisch besonders aktiven Künstlern von Bill Evans bis Charles Mingus aufzeigt, aber auch auf Ravel Debussy, Schostakowitsch verweist. “The Clothed Woman” analysiert er schließlich im Lichte der atonalen Experimente europäischer Komponisten des frühen 20sten Jahrhunderts.
Klangfarbe, Rhythmik, Melodik und Harmonik, schreibt Schiff, sind allerdings nur Werkzeuge. Für den Komponisten komme es letzten Endes darauf an, eine Geschichte zu erzählen. Der zweite Teil seines Buchs also widmet sich den Geschichten, die hinter Ellingtons Arbeit stecken, Geschichten, die sich mit Liebe, Sexualität, Rassismus, schwarzem Geschichts- und Kulturbewusstsein befassen. Als Beispiele analysiert er ausführlich die Suite “Such Sweet Thunder, Ellingtons vielleicht wichtigste Suite “Black, Brown and Beige” sowie seine “Sacred Concerts”.
David Schiffs “The Ellington Century” ist keine Biographie des Duke. Sie geht von der Musik aus und versucht diese in den Kontext musikalischer Entwicklungen des 20sten Jahrhunderts zu stellen und dadurch die Sonderstellung Ellingtons herauszuarbeiten. Der konstante Seitenblick insbesondere auf die europäische Kompositionstradition wirkt dabei weder herablassend noch anmaßend, sondern wird Ellingtons eigenem Musikverständnis gerecht und erlaubt in der Selbstverständlichkeit der Parallelbetrachtungen durchaus neue Erkenntnisse über Ellingtons Bedeutung.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
theoral, #4 / Nicola Brooks / Clayton Thomas
herausgegeben von Philipp Schmickl
Nickelsdorf 2012 (www.theoral.org)
 Philipp Schmickl nutzt die Gunst der Stunde, die Gunst des Ortes, nämlich Nickelsdorf, jenes Mekkas für freie Musik, zu Gesprächen mit Musikern anderen interessanten Menschen, und die Buchreihe theoral dokumentiert diese Gespräche so wie sie stattfanden, verbale Exkursionen inklusive.
Philipp Schmickl nutzt die Gunst der Stunde, die Gunst des Ortes, nämlich Nickelsdorf, jenes Mekkas für freie Musik, zu Gesprächen mit Musikern anderen interessanten Menschen, und die Buchreihe theoral dokumentiert diese Gespräche so wie sie stattfanden, verbale Exkursionen inklusive.
Mit Nicole Brooks unterhält er sich in Ausgabe 4 von theoral über Interviews, über die Faszination an der Lektüre eigener Tagebücher, über die Idee der Ehe, über Brooks Kindheit in New Mexico, über Reisen nach Brasilien und in die Tschechische Republik, über Männer, die ihr in verschiedenen Ländern auf der Straße folgten, über ihre Motivation zu reisen und über Planlosigkeit und Zufälle in ihren Reiseerfahrungen. Brooks ist einfach nur eine Besucherin des Nickelsdorfer Festivals, eine “freie” Reisende, eine Weltenbummlerin.
Mit Clayton Thomas hat Schmickl dann einen Musiker vor seinem Mikrophon, diesmal nicht in Nickelsdorf, sondern im Hotelzimmer in Sibiu, Rumänien. Thomas erzählt von seiner Kindheit in Tasmanien, von ersten Versuchen den Bass zu spielen, von ersten Reisen nach New York, wo er beim Vision Festival mit jeder Menge neuer Musik konfrontiert wurde, von ersten Gigs als Bassist in Sydney und New York, wo er 2002 schließlich auch selbst beim Vision Festival mitwirkte. Er berichtet vom NOW now Festival in Sydney, von seinem Umzug nach Berlin im Jahr 2007, und er reflektiert über Einflüsse wie William Parker und Barry Guy sowie über aktuelle Bandprojekte, an denen er beteiligt ist: das Splitter Orchestra etwa oder The Ames Room. Die beiden sprechen moch ein wenig übers Reisen, darüber, wie Thomas Musik “denkt”, sowie über Kunst und Revolution.
Schmickls Bücher vermitteln das großartige Gefühl unverfälschter und inspirierter Interviews, und diese Tatsache ist dem Herausgeber wohl bewusst, der sich im Vorwort etwa bei Christof Kurzmann bedankt, mit dem er sich vor dem Interview mit Brooks unterhalten habe und bei Tobias Delius, den er kurz vor demselben Interview habe spielen hören, und die ihn beide als Fragesteller und Gesprächspartner inspiriert hätten. Ein Lesevergnügen also, das gerade in der Gesprächhaftigkeit und in der Offenheit des Herausgebers, die Konversation in alle möglichen Richtungen abdriften zu lassen, eine Menge mehr über die Gesprächspartner vermittelt als es manch ein systematischerer Artikel vermögen würde.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
Jutta Hipp. Ihr Leben & Wirken. Malerin – Pianistin – Poetin. Eine Dokumentation
von Gerhard Evertz
Hannover 2012 (Eigenverlag)
196 Seiten
siehe auch: www.jazzbuch-hannover.de
 Als Gerhard Evertz 2004 sein Buch “Hannover – ein Stück Jazzgeschichte” herausbrachte, hatte er bei der Recherche jede Menge Material insbesondere über Jutta Hipp gefunden, die zwar gerade ein Mal in Hannover gespielt hatte, die aber enge verwandtschaftliche Beziehungen in die Stadt an der Leine besaß und behielt, nachdem sie 1955 nach New York ausgewandert war. Evertz sammelte die Dokumente und veröffentlichte sie nun in kleinster Auflage in einem Buch, das insbesondere wegen des umfangreichen Bildteils eine Lücke in der Dokumentation über die Musikerin schließt.
Als Gerhard Evertz 2004 sein Buch “Hannover – ein Stück Jazzgeschichte” herausbrachte, hatte er bei der Recherche jede Menge Material insbesondere über Jutta Hipp gefunden, die zwar gerade ein Mal in Hannover gespielt hatte, die aber enge verwandtschaftliche Beziehungen in die Stadt an der Leine besaß und behielt, nachdem sie 1955 nach New York ausgewandert war. Evertz sammelte die Dokumente und veröffentlichte sie nun in kleinster Auflage in einem Buch, das insbesondere wegen des umfangreichen Bildteils eine Lücke in der Dokumentation über die Musikerin schließt.
Sein Buch ist dabei weniger eine Biographie als vielmehr eine Sammlung von Materialien und Informationen, die er sortiert und Hipps verschiedenen Aktivitäten zuschreibt. Da gibt es Fotos, etwa in einer Privatwohnung in Leipzig, mit Dietrich Schulz-Köhn, Caterina Valente, Attila Zoller, mit ihrem in Hannover wohnenden Bruder, von Tourneen und privaten Feiern. Es findet sich das Programmblatt des Studiokonzerts, das sie im Oktober 1955 im Rathaus Hannover gab und das als “erstes Konzert in ihrer Heimatstadt Hannover und ihr letztes in Deutschland” annonciert wurde. Auch finden sich Briefsplitter aus ihrer New Yorker Zeit.
Einer Diskographie ihrer Aufnahmen hängt Evertz Abbildungen diverser Cover bei. Im Kapitel “Gemälde” dokumentiert er 65 Aquarelle, Landschaften, Dorf- und Stadtszenen, Personen – allerdings hat nur eines, betitelt “The Pianist” direkt mit Musik zu tun. Ein weiteres Kapitel dokumentiert Hipps Aktivitäten als Fotografin, erlaubt quasi den privaten Blick mithilfe ihres Auges durch den Sucher ihrer Kamera: Da ist ein Blick aus dem Fenster ihrer Wohnung, da sind Freunde im Restaurant, Musiker bei Freiluftkonzerten, wir sehen Charlie Parkers Wohnhaus, Louis Armstrongs Grab, aber auch Landschaftsaufnahmen, die wie Motive für ihre Aquarelle wirken.
Schließlich finden sich Hipps bekannte Zeichnungen großer Jazzmusiker: Lester Young, Horace Silver, Art Taylor, Barry Harris, Gerry Mulligan, Nica de Koenigswarter, Thelonious Monk, Peck Morrison, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Zoot Sims, Lester Young, Lionel Hampton, Lee Konitz, Attila Zoller, Hans Koller. Aber auch in Gedichten suchte die Pianistin einen kreativen Ausdruck; und Evertz versammelt solche über Lester Young, Horace Silver; Zoot Sims, Sonny Rollins, Billie Holiday, Miles Davis, Art Blakey, Dinah Washington, das Modern Jazz Quartet, Charlie Parker, Charles Mingus, Gerry Mulligan, Thelonious Monk, Erroll Garner, John Coltrane, Albert Mangelsdorff, Caterina Valente, Klaus Doldinger, Gunter Hampel, Connie Jackel, Horst Jankowski und Carlo Bohländer. Zum Schluss finden sich ausgewählte Pressenotizen über Jutta Hipp, die Evertz um eine Bibliographie weiterführender Literatur ergänzt.
“Jutta Hipp. Ihr Leben & Wirken” ist nur in einer Kleinstauflage im Eigenverlag des Autors erschienen und im Handel nicht erhältlich. Das ist insbesondere deshalb schade, weil das Buch einzelne Quellen zugänglich macht – und insbesondere einen Überblick über Hipps malerisches Wirken gibt –, die einen anderen Blick auf den Menschen Jutta Hipp erlauben.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
Listen, Whitey! The Sights and Sounds of Black Power, 1965-1975
von Pat Thomas
Seattle 2012 (Fantagraphics Books)
193 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-507-5
 In den 1960er Jahren war die schwarze Kulturszene in den USA genauso politisiert wie der Rest der amerikanischen Gesellschaft. Die Kunst wurde zum Sprachrohr erst der Bürgerrechts-, dann der Black-Power-Bewegung, die immer vehementer und durchaus auch nicht nur friedlich gleiche Rechte für die schwarze Bevölkerung einforderte. Pat Thomas dokumentiert die musikalische Begleitmusik dieser Jahre zwischen 1965 und 1975, als das schwarze Amerika die Geduld verlor und militant wurde, eine Begleitmusik, die nicht immer nur begleitete, sondern sich auch selbst schon mal zum Sprachrohr der Bewegung machte. Ihn interessiert dabei, wie jegliche schwarze Musik in die Zeit passte und von den Black Nationalists oder Black Panthers für ihre Zwecke genutzt wurde bzw. wie zugehörig sich die Musiker zu den diversen Bewegungen fühlten.
In den 1960er Jahren war die schwarze Kulturszene in den USA genauso politisiert wie der Rest der amerikanischen Gesellschaft. Die Kunst wurde zum Sprachrohr erst der Bürgerrechts-, dann der Black-Power-Bewegung, die immer vehementer und durchaus auch nicht nur friedlich gleiche Rechte für die schwarze Bevölkerung einforderte. Pat Thomas dokumentiert die musikalische Begleitmusik dieser Jahre zwischen 1965 und 1975, als das schwarze Amerika die Geduld verlor und militant wurde, eine Begleitmusik, die nicht immer nur begleitete, sondern sich auch selbst schon mal zum Sprachrohr der Bewegung machte. Ihn interessiert dabei, wie jegliche schwarze Musik in die Zeit passte und von den Black Nationalists oder Black Panthers für ihre Zwecke genutzt wurde bzw. wie zugehörig sich die Musiker zu den diversen Bewegungen fühlten.
Im ersten Kapitel führt Thomas in die Black-Power-Szene ein, erzählt die Geschichte der zunehmenden Militarisierung des schwarzen Teils der Bürgerrechtsbewegung, die spätestens nach den Morden an Martin Luther King und Malcolm X ein wahrnehmbarer und für viele Teile der amerikanischen Gesellschaft zunehmend furchteinflössender Bestandteil der politischen Wirklichkeit wurde. Im zweiten Kapitel geht er der Widerspiegelung dieser politischen Bewegung in der populären Musik nach, nennt Titel wie Aretha Franklins Version des alten Otis-Redding-Songs “Respect”, Marvin Gaye, James Brown, die Last Poets, Gil Scott-Heron, Jimi Hendrix und andere Musiker aus der Pop-, Soul- und Motownszene. Er diskutiert die acht Alben, die auf Motowns Unterlabel Black Forum erschienen und die vor allem Wortbeiträge präsentierte, politische Rede (King, Stokely Carmichael, Ossie Davis und Bill Cosby), Dichtung (Langston Hughes, Amiri Baraka, Festival of Black Poets in America), eine Dokumentation über die Schrecken des Vietnam-Kriegs, aber auch eine Art politische Gospelmusik (Elaine Brown).
Kapitel 3 widmet sich der Solidarität mit der Black-Power-Bewegung, die in der amerikanischen Linken breit aufgestellt war und weiße Musiker wie Bob Dylan, John Lennon und andere umfasste. Die Black Panthers waren aber auch selbst auf Platten vertreten mit politischen Reden und Aufrufen, etwa von Eldridge Cleaver. Auch das SNCC (Student Nonviolent Coordination Committee) brachte eigene Platten heraus, etwa von Stokely Carmichael oder H. Rap Brown (mit Leon Brown). Thomas erzählt über die Hintergründe für Oliver Nelsons Album “Black, Brown and Beautiful”, über Amiri Bakaras “A Black Mass” mit dem Sun Ra Arkestra, sowie über Musikerinnen, die der Sache genauso solidarisch gegenüberstanden wie ihre “Brothers”. Natürlich sind auch die Prediger mit von der Partie, Rev. Jesse Jackson etwa und andere, die ihre Predigten eben auch politischen Inhalten widmeten.
Für Jazzhörer am spannendsten ist Kapitel 9, “Jazz Artist Collectives and Black Consciousness”, das Aktivitäten und Aufnahmen von Charles Mingus mit Max Roach, Archie Shepp, dem Art Ensemble of Chicago, Clifford Thornton, Sonny Sharrock, Lou Donaldson, Eddie Gale, Horace Silver, Gary Bartz mit Andy Bey, Joe McPhee, Herbie Hancock, Mtume, The Tribe, Rahsaan Roland Kirk, Les McCann mit Eddie Harris, Donny Hathaway, Cannonball Adderley, Miles Davis mit John Coltrane, Pharoah Sanders mit Leon Thomas in den Kontext der politischen Bewegung jener Jahre setzt.
Pat Thomas Buch ist eine überaus wertvolle Ergänzung zur Musikgeschichte der 1960er und 1970er Jahre, gerade weil der Autor versucht, politische Kontexte herzustellen und zu erklären. Das Buch im Coffeetable-Format ist reich bebildert mit Plattenhüllen, seltenen Fotos, Zeitungsausrissen und Anzeigen. Ein ausführlicher Index und eine separat erhältliche CD mit Beispielen für die im Text erwähnte Musik runden das Konzept ab.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
Affirmation and Resistance. The Politics of the Jazz Life in the Self-Narratives of Louis Armstrong, Art Pepper, and Oscar Peterson
von Alexander J. Beissenhirtz
Kiel 2012 (Verlag Ludwig)
299 Seiten, 49,90 Euro
ISBN: 978-3-86935-146-9
 Die Jazz-Autobiographie ist fast schon ein eigenständiges Genre. Musiker, die über ihr Leben schreiben, verorten sich ganz bewusst und sehr persönlich in der Musikgeschichte. Im Idealfall, der auch für die drei hier untersuchten Bücher betrifft, vereinen sie Eigenschaften von Autobiographie, Memoiren, Biographie und Jazzgeschichtsschreibung. Für seine Dissertation wählt Alexander Beissenhirtz drei Autobiographien, die wichtige Themen des Jazz thematisieren, etwa die Spannung zwischen Popularkultur und Kunst, die Beziehungen zwischen der Persönlichkeit eines Musikers und seines Sounds, die Suche nach der eigenen Stimme, das “amerikanische” Element im Jazz, “race relations” sowie Drogen. Seine Fallbeispiele ordnet Beissenhirtz im einleitenden Kapitel ins literarische Genre der Autobiographie ein, aber auch ins fachspezifische Genre der Jazzliteratur. Und er fragt danach, welche Elemente von Affirmation und/oder Widerstand gegenüber den Werten einer amerikanischen Nationalkultur in diesen Büchern zu erkennen sind.
Die Jazz-Autobiographie ist fast schon ein eigenständiges Genre. Musiker, die über ihr Leben schreiben, verorten sich ganz bewusst und sehr persönlich in der Musikgeschichte. Im Idealfall, der auch für die drei hier untersuchten Bücher betrifft, vereinen sie Eigenschaften von Autobiographie, Memoiren, Biographie und Jazzgeschichtsschreibung. Für seine Dissertation wählt Alexander Beissenhirtz drei Autobiographien, die wichtige Themen des Jazz thematisieren, etwa die Spannung zwischen Popularkultur und Kunst, die Beziehungen zwischen der Persönlichkeit eines Musikers und seines Sounds, die Suche nach der eigenen Stimme, das “amerikanische” Element im Jazz, “race relations” sowie Drogen. Seine Fallbeispiele ordnet Beissenhirtz im einleitenden Kapitel ins literarische Genre der Autobiographie ein, aber auch ins fachspezifische Genre der Jazzliteratur. Und er fragt danach, welche Elemente von Affirmation und/oder Widerstand gegenüber den Werten einer amerikanischen Nationalkultur in diesen Büchern zu erkennen sind.
Im zweiten Kapitel setzt sich Beissenhirtz mit dem Problem einer Definition des Jazz auseinander und verweist auf die Dehnbarkeit dieses Begriffs. Er diskutiert den Unterschied zwischen selbst geschriebenen und durch Ghostwriter verfassten Autobiographien und ihren jeweiligen Bezug zum Primat der Authentizität, den jede Autobiographie zu erreichen trachtet. Sein drittes Kapitel ordnet das Genre der Jazz-Autobiographie in den Kontext der Jazzforschung ein, in der man viel zwischen den Zeilen lesen müsse, um Diskurse zu identifizieren, die von den Autoren nicht immer implizit angesprochen werden. Sein viertes Kapitel geht seiner Grundfrage nach, jener also, inwieweit Jazz als Affirmation amerikanischer Kultur oder aber als sozialer und politischer Widerstand gesehen wird, wobei Beissenhirtz als Gewährsleute für die beiden Ansätze auf der einen Seite Ralph Ellison, auf der anderen Amiri Baraka anführt. Die beide Pole verbindende Frage ist dabei auch die: Wie kann man Star sein, herausgehobenes Subjekt und dennoch Teil der Bewegung, Teil der Masse?
Die zweite Hälfte des Buchs geht dann in medias res: Beissenhirtz fragt danach, ob Louis Armstrong in seinen eigenen Schriften eher als Onkel Tom oder als Trickster rüberkommt. Er analysiert Armstrongs Stil sowohl in seinen veröffentlichten Büchern wie auch in Briefen und später veröffentlichten privaten Texten. Er begründet, warum “Satchmo. My Life in New Orleans” von 1954, anders als das bereits 1936 erschienene “Swing That Music” von Armstrong selbst und nicht zusammen mit einem Ghostwriter verfasst worden sein muss, und er vergleicht die Selbstdarstellung Satchmos in beiden Veröffentlichungen.
Art Peppers Autobiographie “Straight Life” von 1979 ist mehr Lebensbeichte als reine Autobiographie. Beissenhirtz vergleicht Peppers Selbstdarstellung im Buch mit anderswo abgedruckten Interviews des Saxophonisten und diskutiert ästhetische, soziale und sehr persönliche Ansichten Peppers vor dem Hintergrund der Fakten und seiner Aufnahmen.
Im dritten Fallbeispiel liest Beissenhirtz Oscar Petersons Autobiographie “A Jazz Odyssey” von 2002 als Affirmation des Jazz als “Amerikas klassische Musik”. Auch hier vergleicht er Petersons Selbstdarstellung mit den Fakten sowie mit der öffentlichen Wahrnehmung des Pianisten durch Kritiker oder Musikerkollegen. Er liest das Buch als den Versuch eines Künstlers, die Stellung des Jazz als ernsthafte Kunst auch in Wort und Schrift zu festigen. Er hinterfragt die Behauptung der Farbenblindheit, die Peterson in seinem Buch aufstellt, wenn es um die Hautfarbe der Mitmusiker geht, und kontrastiert diese mit Petersons durch seine Familie bedingte Unterstützung von Marcus Garveys Idealen.
Beissenhirtzes Buch ist als Dissertation an der FU Berlin angenommen wurden; entsprechend ist das resultierende Buch eine vor allem an einen Fachdiskurs gerichtete Publikation. Beissenhirtz macht auf Besonderheiten der Autobiographie im Jazz aufmerksam und liest die von ihm als Fallbeispiele angeführten Bücher kritisch, um sie für die Untermauerung seiner Thesen zu nutzen, dass nämlich die textliche Rekonstruktion von Musikerleben immer auch eine sehr bewusste Interpretation von Jazzdiskursen, wenn nicht gar einen Eingriff in solche darstellt.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
Africa Speaks, America Answers. Modern Jazz in Revolutionary Times
von Robin D.G. Kelley
Cambridge/MA 2012 (Harvard University Press)
244 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN 978-0-674-04624-5
 Als Robin D.G. Kelley im Frühjahr 2003 eingeladen wurde, Vorträge an der Harvard University zu halten, arbeitete er gerade an seiner Thelonious-Monk-Biographie. Statt einfach auf Kapitel daraus zurückzugreifen, entschied er sich für eine Reflektion über die Einflüsse zwischen Afrika und afro-amerikanischem Jazz, die er an vier konkreten Beispielen zeigen wollte. Aus seinen Vorträgen entwickelte sich ein tieferes Forschungsinteresse zum einen an den vier Protagonisten, die er ausgewählt hatte, zum zweiten am Thema Afrika / Jazz ganz allgemein, die schließlich zum vorliegenden Buch führten.
Als Robin D.G. Kelley im Frühjahr 2003 eingeladen wurde, Vorträge an der Harvard University zu halten, arbeitete er gerade an seiner Thelonious-Monk-Biographie. Statt einfach auf Kapitel daraus zurückzugreifen, entschied er sich für eine Reflektion über die Einflüsse zwischen Afrika und afro-amerikanischem Jazz, die er an vier konkreten Beispielen zeigen wollte. Aus seinen Vorträgen entwickelte sich ein tieferes Forschungsinteresse zum einen an den vier Protagonisten, die er ausgewählt hatte, zum zweiten am Thema Afrika / Jazz ganz allgemein, die schließlich zum vorliegenden Buch führten.
In den frühen 1960er Jahren, schreibt Kelley in seinem Vorwort, habe es ein verstärktes Interesse afro-amerikanischer Jazzmusiker an afrikanischen “Wurzeln” gegeben. Art Blakey, Randy Weston, Oliver Nelson, Max Roach nahmen Platten auf, die sich unterschiedliche Aspekte dieser Beziehung bezogen. Auch der Schlagzeuger Guy Warren zählte zu jenen Musikern, die eine Verbindung zwischen den beiden Kontinenten eruierten, nur dass er weder zu den Black Nationalists gehörte, bei denen eine Afrika-Schau damals in Mode war, noch überhaupt ein Afro-Amerikaner war – Warren nämlich war in Ghana geboren. Er rühmte sich selbst, afrikanische Elemente in den amerikanischen Jazz eingeführt zu haben, als niemand an so etwas interessiert gewesen sei. Warren ist einer der Musiker, denen ein Kapitel in Kelleys Buch gewidmet ist; die anderen sind Randy Weston, der sich seit den 1950er Jahren mit afrikanischen Rhythmen auseinandersetzte und Ende der 1960er Jahren in Marokko lebte, Ahmed Abdul-Malik, der in seiner Musik versuchte insbesondere nordafrikanische Melodik und Rhythmik mit dem Jazzidiom zu verbinden, sowie die südafrikanische Sängerin Sathima Bea Benjamin, die mit Warren das Schicksal teilte, weder “afrikanisch” noch “westlich” genug zu klingen, um auf dem Markt zu bestehen.
Kelleys Buch lehnt sich in der Konzentration auf vier Musterfälle an A.B. Spellmans epochales “Four Lives in the Bebop Business” von 1966 an. Neben Afrika sieht er als verbindendes Element seiner Protagonisten, dass sie alle aus den unterschiedlichen politischen wie ästhetischen Diskussionen der 1950er Jahre heraus ihre jeweils eigene Fusion angingen. Sie suchten in einer Zeit, in der das Wort “Freedom” wahrscheinlich das wichtigste Wort in der afrikanischen Diaspora war, nach “neuen emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten, neuen Wegen, Solidarität und Verbindungen zu erzeugen”.
Er beginnt mit der Geschichte des Ghanaers Guy Warren, der im Krieg unter die Fittiche eines amerikanischen Offiziers genommen wurde, der ihn zu seinem Assistenten machte und ihm den Weg in die USA ebnete. Warren jammte 1943 mit Miff Mole im New Yorker Nick’s Tavern, ging dann zurück nach Accra. Nach Ausflügen etwa mit einer afro-kubanischen Band kam er 1954 nach Chicago und stellte fest, dass sein Rhythmusgefühl, das nicht so sehr an Chano Pozo orientiert als vielmehr afrikanisch war, nicht ganz so gut ankam. 1956 nahm er eine LP auf, die vielleicht tatsächlich der erste Versuch einer Fusion beider Welten war: “Africa Speaks, America Answers”. 1958 folgte die LP “Themes for African Drums”, 1959 “Voice of Africa”, für die er Mühe hatte ein Label zu finden und die erst 1962 unter dem Titel “African Rhythms” veröffentlicht wurde. Kelley schreibt ausführlich über Warrens Frust gegenüber Kollegen wie Babatunde Olatunji, die in jenen Jahren stärker wahrgenommen wurde als er. Warren spielte 1969 mit britischen Musiker das Album “Afro-Jazz” ein, ging dann zurück nach Ghana, wo er 2008 starb.
Randy Westons afrikanische Reise begann in seiner Kindheit, als sein Vater, ein Anhänger Marcus Garveys, seinem Sohn von der glorreichen Vergangenheit Afrikas erzählte. In den 1950er Jahren war Weston quasi der Hauspianist im Music Inn in Lenox, Massachusetts, wo er unter anderem die Musikbeispiele für Marshall Stearns Vorträge über die Hintergründe der Jazzgeschichte spielte. Hier traf er auch auf den nigerianischen Trommler Babatunde Olatunji, der sein interesse an afrikanischer Kultur noch verstärkte. Als Ende der 1950er Jahre immer mehr afrikanische Staaten ihre Unabhängigkeit erhielten, komponierte Weston verschiedene Stücke, die sich mit afrikanischen Themen befassten und die 1959 in der LP “Uhuru Afrika” mündeten. 1961 besuchte er den fernen Kontinent zum ersten Mal, und Kelley erzählt die problematische Geschichte der American Society for African Culture, die damals ein Büro in Lagos eröffnetet, das zumindest zu Teilen von der CIA finanziert worden war. 1967 spielte Weston bei einem Festival in Rabat, verliebte sich in die Stadt und zog für fünf Jahre nach Marokko.
Ahmed Abdul-Malik hatte sich seit seiner Kindheit für arabische Musik interessiert und wollte seit den späten 1940er Jahren seine Liebe zum Jazz und zu “östlichen” Modi zusammenbringen. Kelley korrigiert die von Abdul-Malik selbst verbreitete Biographie und identifiziert dessen Vater als aus der Karibik (und nicht aus Afrika) eingewandert. Nach dem Tod seines Vaters konvertierte Abdul-Malik zum Islam und sprach schon in der Schulzeit fließend Arabisch. Kelley erzählt nebenbei, wie auch andere Musiker damals zum Islam konvertierten, verfolgt Abdul-Maliks Karriere und verknüpft diese mit seinem spirituellen Lebensweg, 1956 machte Abdul-Malik seine ersten Aufnahmen mit arabischen Musikern und wurde in seinen Plänen von Kollegen wie Thelonious Monk und John Coltrane ermutigt. Bald erschien “Jazz Sahara”, dann “East Meets West” und “The Music of Ahmed Abdul-Malik”. 1961 wurde der Bassist Mitglied der Band von Herbie Mann, der damals selbst großes Interesse an Musik der afrikanischen Diaspora hatte. Bis zu seinem Tod Anfang der 1990er Jahre behielt er sein Interesse an arabischer Musik und nahm in den 1980er Jahren sogar Unterricht bei einem Oud-Virtuosen.
Kelleys letztes Kapitel beschreibt die Lebensgeschichte der Sängerin Sathima Bea Benjamin. In Kapstadt aufgewachsen, interessierte sie, wie viele andere Altersgenossen auch, alles, was amerikanisch war. Sie wurde Lehrerin, sang nebenbei in Clubs. Kelley erzählt über die gemeinsame Liebe von Benjamin und Dollar Brand zur Musik Duke Ellingtons und beschreibt ausführlich vor allem die südafrikanische Jazzszene und die Herausarbeitung einer eigenen Identität bei Benjamin und Brand, irgendwo zwischen südafrikanischer und afro-amerikanischer Ästhetik. Ihre europäische und amerikanische Zeit interessiert ihn für dieses Kapitel weniger.
Robin D.G. Kelley gelingt es, das Thema der Interkulturalität, das seinem Buch zugrunde liegt, in seinen vier Fallbeispielen deutlich zu machen. Jedes Kapitel ist für sich spannend zu lesen; in der Verbindung der vier sehr unterschiedlichen ästhetischen Ansätze, musikalischen Persönlichkeiten und biographischen Lebenswege ergibt sich ein tatsächlicher Einblick in den musikalischen Dialog zwischen Afrika und Amerika in den 1950er und 1960er Jahren.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
Saxofone. Ein Kompendium
von Uwe Ladwig
Kiel 2012 (buchwerft verlag)
266 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-3-86342-280-6
 Alles, aber auch wirklich alles, was man über das Saxophon wissen will, kann man aus Uwe Ladwigs umfangreichen, sehr schön gestalteten und mit über 350 teils farbigen Fotos reich bebilderten Buch erfahren. Anders als in Ralf Dombrowskis “Portrait Saxofon” geht es dem Autor dabei allerdings nicht um die Interpreten, die hier nur eine kleine Nebenrolle spielen, sondern einzig um das Instrument selbst, in allen üblichen und unüblichen Bauarten und Varianten, vom Sopran- bis zum Basssaxophon.
Alles, aber auch wirklich alles, was man über das Saxophon wissen will, kann man aus Uwe Ladwigs umfangreichen, sehr schön gestalteten und mit über 350 teils farbigen Fotos reich bebilderten Buch erfahren. Anders als in Ralf Dombrowskis “Portrait Saxofon” geht es dem Autor dabei allerdings nicht um die Interpreten, die hier nur eine kleine Nebenrolle spielen, sondern einzig um das Instrument selbst, in allen üblichen und unüblichen Bauarten und Varianten, vom Sopran- bis zum Basssaxophon.
Ladwig beginnt – wie sollte es anders sein – mit Adolphe Sax, der das Instrument 1846 zum Patent einreichte (bereits vier Jahre zuvor hatte Hector Berlioz das Instrument in einem Zeitungsartikel erwähnt). Neben der Skizze zum Patentantrag und einer Diskussion zu Bohrungsvarianten finden sich detaillierte Ansichten eines frühen Instruments und Instrumentenkoffers.
Der Hauptteil des Buchs dekliniert dann die verschiedenen Hersteller durch. Ladwig beginnt in den USA mit Conn, Buescher, Martin etc. und benennt genauso ausführlich Firmen aus Europa, Asien und Südamerika. Neben kurzen Firmengeschichten klassifiziert er dabei die produzierten Instrumente und liefert zugleich einen Seriennummernkatalog, anhand dessen sich Instrumente datieren lassen. Neben den großen Firmen finden sich kleine, neben alteingesessenen neue Hersteller, jeweils mit detaillierten Beschreibungen und, wo immer möglich, Abbildungen.
Ladwig diskutiert Erfindungen und zusätzliche Patente zu Klappen oder Klappenverbindungen, zeigt Fabrikräume etwa der Firma Keilwerth, aber auch viele aussagekräftige Werbeseiten der Hersteller über die Jahrzehnte. In einem Appendix werden Sonderformen des Saxophons besprochen, etwa Kunststoffinstrumente (man denke an Charlie Parkers Massey-Hall-Konzert oder an Ornette Colemans Auftritte – beide spielten übrigens ein Instrument der Firma Grafton) und Saxophone aus Holz. Ladwig listet sogenannte “Stencils” auf, also Produktionen einer eingesessenen Firma für andere, oft kleinere Hersteller, und er beschreibt Werkzeuge und übliche Arbeitsvorgänge in der Saxophonwerkstatt, von der Instrumenten-Instandhaltung bis zur Koffer-Restaurierung. Zum Schluss gibt er noch Tipps zur Mikrophonierung von Saxophonen.
Ein ausführliches Register beschließt das Buch, das ohne Übertreibung als ein Standardbuch für Saxophonsammler und -bauer beschrieben werden kann. Neben all dem Wissen, das Ladwig in die Seiten packt, liest man sich dabei immer wieder an kuriosen Aspekten von Firmen- oder Baugeschichten fest.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
Visualizing Respect
Von Christian Broecking
Berlin 2012 (Broecking Verlag)
Books on Demand GmbH
54 Seiten, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-938763-33-9
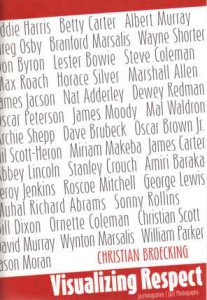 Christian Broecking, der Autor des Interview-Buches “Respekt! Die Geschichte der Fire Music”, komplettiert mit dem neuesten Fotobuch seine Story über die amerikanische Jazzszene der letzten 40 Jahre.
Christian Broecking, der Autor des Interview-Buches “Respekt! Die Geschichte der Fire Music”, komplettiert mit dem neuesten Fotobuch seine Story über die amerikanische Jazzszene der letzten 40 Jahre.
Die Fotos in dem Bildband „Visualizing Respekt“ dokumentieren die Interviewsituationen von 1992 bis 2012, die die Grundlage zu seiner profunden Analyse über Fragen nach schwarzer Geschichte und Identität bilden.
In sehr eindringlichen, nahezu umgebungslosen Musikerporträts scheint die Forderung nach gesellschaftlicher Teilhabe fast körperlich greifbar.
Nat Adderley, Amiri Baraka, Mal Waldron und viele andere geben sich und uns die Ehre.
Christian Broecking nimmt den Betrachter visuell mit in die Interviewsituation und schafft damit eine besondere Nähe zu den Protagonisten. Der direkte Blickkontakt der Musiker auf vielen Aufnahmen verfehlt nicht seinen suggestiven Effekt. Es sind sehr persönliche Off-Stage-Fotos, die den Menschen hinter der Musikerin und dem Musiker zeigen.
Dem Fotografen und Autor Christian Broecking ist damit eine authentische, kurzweilige Fotobroschüre moderner Jazzfotografie gelungen, deren wohltuende puristische Gestaltung und detailgenauen Fotos sich durchaus mit den großen Namen der Jazzfotografie messen können.
Doris Schröder (Juni 2012)
Jazz & Beyond, no. 1
von Heike Nierenz (Texte) & Norbert Guthier (Fotos)
Frankfurt 2012 (Norbert Guthier)
180 Seiten, 1 beiheftende CD, 24,90 Euro
ISBN: 978-3-981485-21-9
www.guthier.com
(Vertrieb über Jazzwerkstatt)
 Ausgangspunkt des Buchs in CD-Box-Größe sind die Fotos Norbert Guthiers, in denen die sechs ausgewählten Musiker nicht nur in üblichen Konzertposen zu sehen sind, sondern auch privat, beim Unterrichten, im Café, beim Aufbauen, beim Soundcheck etc. Heike Nierenz stellt den Bildern stimmungsvolle Texte gegenüber, in denen die Biographie der Künstler genauso erzählt wird wie ihre musikalische Philosophie. Und da erzählte Musik selbst dann einen merkwürdigen Beigeschmack hat, wenn man genügend Bilder zu sehen bekommt, ist dem Buch eine CD mit Aufnahmen der Vorgestellten beigelegt, bereits veröffentlichte Titel aus den letzten Jahren (leider sagt die enthaltene Diskographie nichts über die Aufnahmedaten aus), die das Lese- und Schauerlebnis vervollständigen.
Ausgangspunkt des Buchs in CD-Box-Größe sind die Fotos Norbert Guthiers, in denen die sechs ausgewählten Musiker nicht nur in üblichen Konzertposen zu sehen sind, sondern auch privat, beim Unterrichten, im Café, beim Aufbauen, beim Soundcheck etc. Heike Nierenz stellt den Bildern stimmungsvolle Texte gegenüber, in denen die Biographie der Künstler genauso erzählt wird wie ihre musikalische Philosophie. Und da erzählte Musik selbst dann einen merkwürdigen Beigeschmack hat, wenn man genügend Bilder zu sehen bekommt, ist dem Buch eine CD mit Aufnahmen der Vorgestellten beigelegt, bereits veröffentlichte Titel aus den letzten Jahren (leider sagt die enthaltene Diskographie nichts über die Aufnahmedaten aus), die das Lese- und Schauerlebnis vervollständigen.
Eine gelungene Auswahl aktueller Künstler, bebildert mit meist recht dunklen Schwarzweißfotos und einem flüssig zu lesenden Text auf Deutsch und Englisch.
Wolfram Knauer (April 2012)
Jazzgeschichten aus Europa
von Ekkehard Jost
Hofheim 2012 (Wolke Verlag)
334 Seiten, 24,80 Euro
ISBN: 978-3-936000-96-2
 Der Buchmarkt zum jazz ist mittlerweile fast unüberschaubar. Und doch fehlt immer noch eine schlüssige europäische Jazzgeschichte, ein Buch, in dem die verschiedenen Entwicklungen zwischen Adaption, Emanzipation und ästhetischer Eigenständigkeit des Jazz in Europa erzählt wird mit allen hellen und dunklen Facetten zwischen Exotik und Verbot, zwischen Nachahmung und freiem Experiment. Mit Ekkehard Jost hat nun Deutschlands wichtigster Jazzforscher sich daran gemacht diese Lücke zu schließen. Jost hatte 1987 mit “Europas Jazz” bereits ein Standardwerk zur Geschichte der Emanzipation des europäischen jazz zwischen 1960 und 1980 herausgebracht; sein neues Buch wirft den Blick jetzt noch weiter, betrachtet die Entwicklung von den frühen Jahren des 20. bis hinein in jüngste Entwicklungen des 21sten Jahrhunderts. Das Buch entstand aus einer erfolgreichen Sendereihe, die Jost für den WDR produziert hatte und in deren einzelnen Folgen er Schlaglichter auf wichtige Entwicklungen im europäischen Jazz warf. Aus diesem Ansatz heraus ist dann wohl auch der Titel des daraus entstandenen Buchs zu verstehen: ausdrücklich nicht eine “Jazzgeschichte Europas”, sondern “Jazzgeschichten aus Europa”.
Der Buchmarkt zum jazz ist mittlerweile fast unüberschaubar. Und doch fehlt immer noch eine schlüssige europäische Jazzgeschichte, ein Buch, in dem die verschiedenen Entwicklungen zwischen Adaption, Emanzipation und ästhetischer Eigenständigkeit des Jazz in Europa erzählt wird mit allen hellen und dunklen Facetten zwischen Exotik und Verbot, zwischen Nachahmung und freiem Experiment. Mit Ekkehard Jost hat nun Deutschlands wichtigster Jazzforscher sich daran gemacht diese Lücke zu schließen. Jost hatte 1987 mit “Europas Jazz” bereits ein Standardwerk zur Geschichte der Emanzipation des europäischen jazz zwischen 1960 und 1980 herausgebracht; sein neues Buch wirft den Blick jetzt noch weiter, betrachtet die Entwicklung von den frühen Jahren des 20. bis hinein in jüngste Entwicklungen des 21sten Jahrhunderts. Das Buch entstand aus einer erfolgreichen Sendereihe, die Jost für den WDR produziert hatte und in deren einzelnen Folgen er Schlaglichter auf wichtige Entwicklungen im europäischen Jazz warf. Aus diesem Ansatz heraus ist dann wohl auch der Titel des daraus entstandenen Buchs zu verstehen: ausdrücklich nicht eine “Jazzgeschichte Europas”, sondern “Jazzgeschichten aus Europa”.
Schon die Kapitelüberschriften hören sich nach Geschichten an, die man gerne hört. “Wie der Jazz nach Europa kam” erzählt Jost gleich im ersten Kapitel, berichtet dabei von Widerständen der Bürokratie gegen wilde Tänze, von James Reese Europes Hellfighters sowie von Sam Woodings Band. “Le Jazz en France” stellt die Faszination der Franzosen am Jazz in den 1920er Jahren vor und beleuchtet an einzelnen Beispielen beide Seiten der Faszination: die der (insbesondere schwarzen) Amerikaner, die sich zum Teil für länger in Frankreich niederließen, sowie die der französischen Musiker und Intellektuellen jener Jahre. Als typische Beispiele der französischen Seite jener Zeit greift er sich den Geiger Michel Warlop und den Gitarristen Django Reinhardt heraus.
Für die Frühzeit des Jazz in England geht Jost auf den Besuch der Original Dixieland Jazz Band ein und auf das Southern Syncopated Orchestra, erwähnt kurz die Besuche Armstrongs und Ellingtons und die Macht der britischen Musikergewerkschaft, die von den Mitt-1930er bis in die 1960er Jahre hinein erfolgreich verhinderte, dass amerikanische Musiker auf der Insel auftraten. Die Weimarer Republik führt Jost anhand von Eric Borchards Kapelle vor, zitiert Mike Danzi, wirft einen Blick auf die Berliner Unterhaltungsszene und lässt anhand der Reaktionen auf Ernst Kreneks Oper “Jonny spielt auf” den braunen Sumpf erahnen, der sich bald über Deutschland ausbreiten wird.
“Am Mittelmeer” heißt lakonisch das Kapitel, das einen kurzen Blick nach Spanien, vor allem aber nach Italien wirft. Die Sowjetunion verdient und erhält ein längeres Kapitel, in dem Jost Reaktion und Gegenreaktion von Jazzszene und System bis nach dem II. Weltkrieg abhandelt. In “Jazz unterm Hakenkreuz” skizziert er die unterschiedlichen Restriktionen, die in Deutschland Jazzmusik verfemten, ohne dass dafür eigens ein Jazzverbot ausgesprochen werden musste. Er entdeckt genügend interessante Musik und stellt kurz Freddie Brocksieper und Kurt Widmann vor, sowie mit Charlie and his Orchestra die vielleicht skurrilste Jazzformation jener dunklen Jahre.
“Im hohen Norden”, stellt Jost fest, habe der Jazz weit später Einzug gehalten als im südlicheren Europa, was vielleicht an der Abgelegenheit von den unterhaltungsmusikalischen Metropolen des Kontinents lag. “Frankreich in den Zeiten des Zweiten Weltkriegs” bringt uns zugleich in die direkte Nachkriegszeit und zeigt sehr deutlich, wie Jazz für ein anderes Gesellschaftsmodell steht, als Synonym für Freiheit wahrgenommen wird. Das Kapitel “Die Trümmerjahre” zeigt, wie Jazzmusiker und Jazzfans in der Nachkriegszeit aufholen, als sie endlich offen Swing hören können und sich den Bebop erobern müssen. Jost spricht über die Rundfunk-Bigbands, die sich in diesen Jahren gründen, über die US-Clubs, in denen junge deutsche Musiker ihr Handwerk verfeinern, über Johannes Rediske, Michael Naura, Helmut Brandt und Hans Koller, über Jutta Hipp, Wolfgang Sauer, Inge Brandenburg, aber auch über das Deutsche Jazz Festival in Frankfurt und die Resonanz darauf, über Zeitschriften wie das Jazz Podium und die Gondel sowie über den Jazz als einer (wenigstens kurzzeitigen) Jugendmusik.
Wie zwischengeschaltet wirkt das Kapitel “Americans in Europe”, und Jost hat ihm augenzwinkernd den Beisatz “Gäste oder Immigranten” beigegeben und berichtet mithilfe namhafter Zeitzeugen über die Beweggründe amerikanischer Jazzer, sich etwa in Paris oder anderswo in Europa niederzulassen. Die Amerikaner beeinflussten ganz sicher die “Modern Sounds”, denen Jost “quer durch Europa” folgt und dabei Schlaglichter auf Entwicklungen in Skandinavien, Großbritannien, Frankreich, Italien, der Sowjetunion, Polen und der DDR wirft. Kurz konstatiert Jost mit Gewährsmann Albert Mangelsdorff eine Krise des Jazz in den 1960er Jahre, stellt aber zugleich fest, dass Mangelsdorff und Musiker wie etwa Klaus Doldinger, Wolfgang Dauner und andere schnell einen Weg aus dieser Krise heraus fanden. Den Weg zur Eigenständigkeit hatte Jost bereits in seinem Buch von 1987 ausführlich beschrieben. Doch ist dieser Weg so wichtig, dass die “Wege des Free Jazz durch Europa” auch in diesem Buch das längste Kapitel ausmachen, nach “Modern Sounds” ein weiteres Kapitel, in dem Jost sich Land nach Land unter die Lupe nimmt. Den Osten spart er aus, denn der verdient gerade für diese Entwicklungsphase des europäischen Jazz einem eigenen Abschnitt.
Zum Schluss müssen wenige Beispiele aus der Menge der Entwicklungen die Klänge beispielhaft vertreten, die den Jazz nach 1970 und bis ins 21ste Jahrhundert prägen. Jost konstatiert zu Recht das “Ende linearer Vorwärtsbewegungen”, stellt “stilistischen Pluralismus und Regression” fest, sieht aber im Neobop keine europäische Kreation, sondern einen amerikanischen Import. Jost hält seine eigenen Vorbehalten nicht hinterm Berg, etwa wenn er Acid oder Techno Jazz knapp unter der Überschrift “Unheilige Allianzen” abhandelt. Hier ist nun auch Platz, kurz über die ökonomische Seite des Jazz also zu sprechen, also Plattenmarkt, Festivals und Clubs. Lesenswert schließlich noch sein Ausblick, den er mit einer knappen Analyse der unter “Jazz” firmierenden Musikrichtungen verbindet, um zu schlussfolgern, dass die “dynamische Strömung des Jazz schon jetzt und in Zukunft in zunehmendem Maße von Europa ausgehen wird”.
Anders als in “Europas Jazz” gibt es in “Jazzgeschichten aus Europa” kaum analytische Passagen. Jost erzählt Geschichten, und die Vielfalt der Entwicklungen erklärt den Ansatz des manchmal Anekdotischen, manchmal Sprunghaften genauso wie es wohl der Ursprung des Buchs in einem Sendemanuskript tun mag. Die Lektüre ist bei alledem leicht und vergnüglich. Jost wählt die Geschichten sehr bewusst aus, hinter die er seine Leser etwas tiefer führt, und es gelingt ihm dabei fast schon zwischen den Zeilen Gemeinsamkeiten wie Unterschiede deutlich zu machen und Lust zum Hinhören zu wecken. Wenigstens für die ersten Jahre bietet das Buch hierfür 28 Hörbeispiele an, die auf einer CD beiheften und die Jahre zwischen 1919 uns 1948 dokumentieren, zwischen James Reese Europes Hellfighters Band und Kurt Henkels “Rolly’s Bebop”.
Wolfram Knauer (April 2012)
Jazz Composition and Arranging in the Digital Age
von Richard Sussman & Michael Abene
New York 2012 (Oxford University Press)
505 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-538100-9
 Duke Ellington schrieb seine Musik im Zug, im Hotelzimmer, im Reisebus, in Restaurants. So sehr hat sich das gar nicht geändert, denn die Orte, an denen Jazzmusiker heute ihre Musik komponieren oder arrangieren, mögen immer noch Orte des temporären Lebens oder des Reisens sein. Nur das Medium hat sich geändert: Wo Ellington sein Notenpapier dabei hatte, bei Bedarf aber auch schon mal Notizen auf Servierten machte, da arbeitet der Komponist oder Arrangeur unserer Tage in der Regel mit seinem Laptop. Dieser ist aber natürlich nur ein Arbeitsmittel – die Kreativität und das musikalische Knowhow müssen nach wie vor vom Musiker selbst kommen.
Duke Ellington schrieb seine Musik im Zug, im Hotelzimmer, im Reisebus, in Restaurants. So sehr hat sich das gar nicht geändert, denn die Orte, an denen Jazzmusiker heute ihre Musik komponieren oder arrangieren, mögen immer noch Orte des temporären Lebens oder des Reisens sein. Nur das Medium hat sich geändert: Wo Ellington sein Notenpapier dabei hatte, bei Bedarf aber auch schon mal Notizen auf Servierten machte, da arbeitet der Komponist oder Arrangeur unserer Tage in der Regel mit seinem Laptop. Dieser ist aber natürlich nur ein Arbeitsmittel – die Kreativität und das musikalische Knowhow müssen nach wie vor vom Musiker selbst kommen.
Richard Sussman und Michael Abene legen mit diesem umfangreichen Buch nun Materialien vor, mit denen Musiker, die mit dem Computer als Hilfsmittel groß geworden sind, sich dem Thema Komposition und Arrangement nähern können. Es ist also eine Art zeitgemäßes Arrangierlehrbuch, in dem Grundlagen (etwa die verschiedenen Tonlagen der Instrumente) genauso behandelt werden wie computerspezifische Notationsfragen. Die Autoren haben das Buch in drei Teilen aufgebaut. In den ersten fünf Kapiteln resümieren sie die Basics des Handwerks. Im zweiten Tel widmen sie sich den Besonderheiten des Arrangements für kleine Ensembles. Im dritten Teil dann nehmen sie sich der Komposition für Bigband und große Ensembles an. In allen Kapiteln finden sich neben arrangierspezifischen Tipps Erläuterungen von Notationssoftware und anderen Computerprogrammen, die dem Arrangeur heutzutage das Leben erleichtern. Eine begleitende Website schließlich bietet Musikbeispiele, weitere Notenbeispiele, Softwarefiles und weiterführende Hinweise.
Bei aller Technik sollte man sich vom digitalen Aspekt des Herangehens der beiden Autoren aber nicht abschrecken lassen: In der Hauptsache geht es bei ihnen eben doch um das Handwerk des Töne-Zusammenfügens, des Klänge-Schmiedens, des Sound-Kreierens. Und so sind die Hinweise auf Software meistens Asides, zusätzliche Tipps zum zeitsparenden Arbeiten.
Das Buch ist ein wichtiges Unterrichtswerk für angehende Arrangeure, eine up-to-date-Fassung dessen, was Don Sebesky 1974 mit seinem Buch “The Contemporary Arranger” vorlegte oder Sammy Nestico 1993 mit “The Complete Arranger”. Und es ermutigt die kreativen Leser hoffentlich, wie Abene in seinem Vorwort auffordert, alle Möglichkeiten des Zusammenklingens zu erkunden.
Wolfram Knauer (April 2012)
Taj Mahal Foxtrot. The Storyy of Bombay’s Jazz Age
von Naresh Fernandes
New Delhi 2012 (Roli Books)
192 Seiten, 1.295 Rupien
ISBN: 978-81-7436-759-4
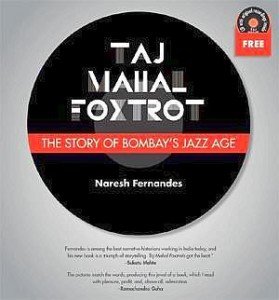 Selbst beim Jazz denken wir oft viel zu eurozentrisch: Wenn wir sagen, der Jazz eroberte kurz nach seiner Geburt die Welt, meinen wir zumeist Europa. Dabei wurde Jazz tatsächlich innerhalb weniger Jahre zu einer Art erster Weltmusik, die modische Tänze selbst an entlegenen Orten begleitete. Das vorliegende Buch dokumentiert ein in Jazzgeschichtsbüchern eher selten gestreiftes Kapitel, die lebendige Jazzszene in Bombay, die in den 1930er Jahren amerikanische Musiker wie Teddy Weatherford und Leon Abbey anzog.
Selbst beim Jazz denken wir oft viel zu eurozentrisch: Wenn wir sagen, der Jazz eroberte kurz nach seiner Geburt die Welt, meinen wir zumeist Europa. Dabei wurde Jazz tatsächlich innerhalb weniger Jahre zu einer Art erster Weltmusik, die modische Tänze selbst an entlegenen Orten begleitete. Das vorliegende Buch dokumentiert ein in Jazzgeschichtsbüchern eher selten gestreiftes Kapitel, die lebendige Jazzszene in Bombay, die in den 1930er Jahren amerikanische Musiker wie Teddy Weatherford und Leon Abbey anzog.
Der Journalist Naresh Fernandes wollte eigentlich nur ein wenig Tratsch über die Welt der goanischen Musiker im Bombay der 1960er Jahre sammeln und interviewte zu diesem Zweck den Vater einer guten Freundin, von dem er wusste, dass er damals in Jazzbands und den Filmstudios gespielt hatte. Der Trompeter Frank Fernand war alt und schwach und kriegte immer nur stoßweise Sätze heraus, Fernandes aber wurde schnell klar, dass er mit einem Zeitzeugen sprach, der seit den Mitt-1930er Jahren auf der Jazzszene unterwegs war. Er machte sich an die Arbeit, Dokumente zu sammeln über die Frühgeschichte des Jazz in Bombay, über afro-amerikanische Musiker, die Bombay zu ihrer zweiten Heimat machten und über die Hindi-Filmstudios, die in den 1950er Jahren auch Jazz als Begleitmusik benutzten.
Fernandes beginnt sein Buch im Taj Mahal Hotel in Downtown-Bombay im Jahr 1935, in dem die Band des amerikanischen Geigers Leon Abbey zum Tanz aufspielt. Swing war die Mode in Paris und London und strahlte von dort in die Kolonien, und Abbeys Band war für die Besucher im Taj Mahal mehr eine Repräsentation europäischen mondänen Lebens als eine bewusste Rezeption amerikanischer Musik. Der Swing dieser Jahre wurde aber bald so populär, dass auf der Rückseite einer Broschüre des Bombay Swing Club aus dem Jahr 1948, also gerade mal ein Jahr nach der Unabhängigkeitserklärung des Landes, nicht weniger als 70 Bands verzeichnet sind, die in Bombay für Unterhaltung sorgten.
Leon Abbey und Weatherford erhalten eigene Kapitel im Buch. Zwischendurch schaut Fernandes noch weiter zurück und entdeckt, dass bereits im 19. Jahrhundert reisende Minstrelgruppen in Indien Station gemacht hatten. Er wirft außerdem einen Blick aufs klassische Musikleben der Stadt in den 1920er und 1930er Jahren. Wie in Europa mussten auch die indischen Musiker die Eigenarten des Jazz erst lernen, die dabei durchaus Parallelen zur heimischen Musiktradition besaß: Nichts war notiert, und um die Musik spielen zu können, musste man sie fühlen.
Fernandes verfolgt den Siegeszug dieser Musik, der 1946 zur Gründung der Jazz Society und 1948 des Bombay Jazz Club führte, die sich beide ernsthaft mit der Musik auseinandersetzten, Plattenabende und Jam Sessions organisierten. Jazz war schon lange im Unterhaltungsmainstream des Landes angekommen, was nur noch von der Tatsache unterstrichen wurde, dass Komponisten und Musiker für Hindi-Filme in den 1950er Jahren ausgiebig Gebrauch von Jazzrhythmen und -sounds Gebrauch machten. 1952 erschien die erste, wenn auch kurzlebige indische Jazzzeitschrift, Blue Rhythm.
Ein eigenes Kapitel ist dem Pianisten Dizzy Sal gewidmet, der 1959 in die USA ging, um am Berklee College zu studieren, ein weiteres Kapitel den Besuchen amerikanischer Stars wie Dave Brubeck, Duke Ellington, Louis Armstrong oder Jack Teagarden, die von den Fans mit Begeisterung aufgenommen wurden, auch wenn sie den kulturpolitischen Agenten der US-Regierung skeptisch gegenüberstanden, die in jenen Jahren als pro-pakistanisch angesehen wurde.
Mit etwas Verspätung löst die Rockmusik in den späten 1960er Jahren den Jazz schließlich als populäre Musik ab. Hier ist denn auch für Fernandes die Geschichte des Jazz Age in Bombay zu Ende.
“Taj Mahal Foxtrot” beleuchtet ein bemerkenswertes Kapitel globaler Jazzgeschichte. Fernandes gelingt es etliche Dokumente ausfindig zu machen, die sowohl die Faszination indischer Musiker mit dem Jazz als auch den Reiz des Exotischen für viele Jazzmusiker greifbar machen. Fernandes erzählt von Spielorten und Musikerbiographien, lässt dabei die Musik selbst allerdings etwas außen vor. Man liest kaum über konkrete Stücke, über den Lernprozess indischer Musiker, über die soziale Rolle, die das Spielen in einer Swingband (und damit zumeist in einem der großen Hotels Bombays) bedeutete. Auch die Einflüsse, die indische Musik im Westen hinterließ, streift Fernandes nur am Rande. Das alles wird wettgemacht durch die einzigartigen Dokumente und Fotos, die er sammelt und abdruckt, durch eine beiheftende CD, auf der sich einzelne Titel finden, und schließlich durch eine Website (www.tajmahalfoxtrot.com), in der den Kapiteln Musik- und Videobeispiele zugeordnet werden.
“Taj Mahal Foxtrot” ist ein empfehlenswertes Buch, die Geschichte einer regionalen Jazzszene, die auch den Leser in den Bann zu ziehen vermag, der noch nie in Bombay (Mumbai) war.
Wolfram Knauer (April 2012)
Harlem Jazz Adventures. A European Jazz Baron’s Memoir, 1936-1969
von Timme Rosenkrantz (herausgegeben von Fradley Hamilton Garner)
Lanham/MD 2012 (Scarecrow Press)
297 Seiten, 75,00 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8209-6
 Im Februar 1934 landete Baron Timme Rosenkrantz, keine 23 Jahre alt, mit dem Schiff aus seinem Geburtsland Dänemark in New York an. Der Baron, dessen Vorfahre bereits in Shakespears Hamlet erwähnt wurde, zog in ein Hotel auf der 70sten Straße und war voll der Vorfreude auf den Jazz, wegen dessen er in die USA gekommen war. Er ging in den Commodore Music Shop auf der 42sten Straße, um sich vom Besitzer Milt Gabler Tipps geben zu lassen, doch der teilte ihm als erstes mit, dass die meisten der großen Jazzmusiker, von denen Rosenkrantz schwärmte, mittlerweile in den Studios arbeiteten, Wiener Walzer und Schlager spielten. Nur einen Club gäbe es noch, das Onyx auf der 52sten Straße. Rosenkrantz aber ließ sich nicht entmutigen und entdeckte dabei den Jazz, den es natürlich nach wie vor gab in New York. Er hörte Don Redman im Apollo, traf den jungen John Hammond, erlebte Chick Webb im Savoy und war fasziniert vom Sänger Leo Watson.
Im Februar 1934 landete Baron Timme Rosenkrantz, keine 23 Jahre alt, mit dem Schiff aus seinem Geburtsland Dänemark in New York an. Der Baron, dessen Vorfahre bereits in Shakespears Hamlet erwähnt wurde, zog in ein Hotel auf der 70sten Straße und war voll der Vorfreude auf den Jazz, wegen dessen er in die USA gekommen war. Er ging in den Commodore Music Shop auf der 42sten Straße, um sich vom Besitzer Milt Gabler Tipps geben zu lassen, doch der teilte ihm als erstes mit, dass die meisten der großen Jazzmusiker, von denen Rosenkrantz schwärmte, mittlerweile in den Studios arbeiteten, Wiener Walzer und Schlager spielten. Nur einen Club gäbe es noch, das Onyx auf der 52sten Straße. Rosenkrantz aber ließ sich nicht entmutigen und entdeckte dabei den Jazz, den es natürlich nach wie vor gab in New York. Er hörte Don Redman im Apollo, traf den jungen John Hammond, erlebte Chick Webb im Savoy und war fasziniert vom Sänger Leo Watson.
Timmes Vater Palle Rosenkrantz war Dänemarks erster Krimiautor und hatte ihm einige Referenzschreiben mit auf den Weg gegeben. Die langweiligen Bekannten seines Vaters, zu denen ihm diese Schreiben die Türen öffneten, interessierten ihn aber weit weniger als die Musik Benny Carters oder Teddy Wilsons. Er begleitete Billie Holiday auf eine private Party, berichtet, wie der Saxophonist und Bandleader Charlie Barnet bei Musikern wie Eddie Condon oder Red McKenzie nicht zu beliebt gewesen sei. Um Benny Goodman im Casino de Paree zu hören, verpflichtete er sich sogar als Eintänzer. Er freundete sich mit Willie ‘The Lion’ Smith an, traf Art Tatum, besuchte Fats Waller in seinem Apartment und rauchte seinen ersten Joint, den ihm kein geringerer als Mezz Mezzrow besorgte.
Für eine Weile kehrte er nach Kopenhagen zurück, war aber bereits 1937 wieder zurück in New York. Wir lesen von Slim Gaillard und Slam Steward sowie der Sängerin Inez Cavanaugh (die seine Lebensgefährtin werden sollte), von W.C. Handy, Louis Armstrong und Bill Coleman. 1940 eröffneten Rosenkrantz und Cavanaugh in Harlem einen Plattenladen, den sie vier Jahre später wieder schließen mussten, weil die Geschäfte in Kriegszeiten einfach nicht gut genug gingen.
Rosenkrantz berichtet über das legendäre Nick’s in Greenwich Village und über seine Freundschaft zu Duke Ellington oder Stuff Smith und erhalten einen Einblick in die musikalische Welt, in der auch der Bebop geboren wurde. Rosenkrantz war dabei immer mehr als nur ein beobachtender Begleiter der Musiker; er produzierte Konzerte und teilweise auch Plattensessions, darunter legendäre Aufnahmesitzungen mit Erroll Garner. Eine Liste der von ihm produzierten Sessions ist im Anhang des Buches enthalten. Auch wenn der Untertitel Memoiren bis 1969 verspricht, hören Rosenkrantzs eigene Erinnerungen weitgehend in den Mitt-1940er Jahren auf. Das ursprünglich auf Dänisch verfasste Buch wird ergänzt um eine Würdigung des Saxophonisten Coleman Hawkins aus Anlass dessen Todes im Jahr 1969 sowie um ein von seine Nichte verfasstes Nachwort, in dem auch sein Club “Timme’s” gewürdigt wird, den er in den 1960er Jahren in Kopenhagen gründete.
Seine Erinnerungen verfasste Rosenkrantz 1964 auf Dänisch, und es ist an der Zeit, dass dieser Zeitzeugenbericht auch einer breiteren Leserschaft zugänglich gemacht wird. Fradley Garner, ein seit 1960 in Kopenhagen lebender Amerikaner, hat sich der verdienstvollen Aufgabe angenommen, eine leicht annotierte und um erklärende Interviewausschnitte mit anderen Zeitzeugen bereicherte englische Übersetzung des Buchs herauszugeben, das einen überaus lebendigen Einblick in die swingende Musik der 1930er bis 1950er Jahre gibt, geschrieben von einem Outsider, der vielleicht gerade deshalb einen objektiveren, einen distanzierteren, einen kritischeren und manchmal verwunderteren Blick auf die Jazzgeschichte besaß als das Einheimischen gelungen wäre.
Timme Rosenkrantzs “Harlem Jazz Adventures” erlauben einen einzigartigen Einblick in die musikalische Welt New Yorks in den 1930er bis 1940er Jahren, jene Zeit des Umbruchs zwischen Swing und Bebop, als die Musiker mit ästhetischem Selbstbewusstsein und Tatendrang den Jazz fortentwickelten. Zwischen den vielen Anekdoten aber, die das Buch so ungemein kurzweilig machen, entdeckt man immer wieder die Ernsthaftigkeit, mit der die Musiker ihre Kunst vorantrieben.
Mehr zum Buch auf der Website: http://www.jazzbaron.com/
Wolfram Knauer (März 2012)
Black Box Pop. Analysen populärer Musik
herausgegeben von Dietrich Helms & Thomas Phleps
Bielefeld 2012 (transcript)
282 Seiten, 24,95 Euro
ISBN: 978-3-8376-1878-5
 Band 38 der ASPM Beiträge zur Popularmusikforschung enthält allgemeine und spezifische Texte zum Thema “Analyse” von Popmusik. Es geht um analytische Methoden (Frank Riedemann, Allan Moore, Simon Zagorski-Thomas), um die Frage, was in diesem Bereich Analyse überhaupt leisten kann (Simon Obert, André Doehring), und es geht um ein paar konkrete Beispiele, etwa die ausführliche historische Genese der Songformen populärer Musik (Ralf von Appen und Markus Frei-Hauenschild), Johnny Cashs “Hurt”, das Steffen just in verschiedenen Versionen vergleicht, oder um das Timing im Spiel von Jazzgitarristen, das Márton Szegedi bei John Scofield, Pat Metheny, Bill frisell, Mike Stern untersucht. Christa Bruckner-Haring fragt danac, was vom Danzón in Gonzalo Rubalcabas Spiel fortlebt, und Helmut Rösing rekapituliert Methoden musikalischer Analyse, um Copyright-Fragen etwa bei Plagiatsvorwürfen zu klären.
Band 38 der ASPM Beiträge zur Popularmusikforschung enthält allgemeine und spezifische Texte zum Thema “Analyse” von Popmusik. Es geht um analytische Methoden (Frank Riedemann, Allan Moore, Simon Zagorski-Thomas), um die Frage, was in diesem Bereich Analyse überhaupt leisten kann (Simon Obert, André Doehring), und es geht um ein paar konkrete Beispiele, etwa die ausführliche historische Genese der Songformen populärer Musik (Ralf von Appen und Markus Frei-Hauenschild), Johnny Cashs “Hurt”, das Steffen just in verschiedenen Versionen vergleicht, oder um das Timing im Spiel von Jazzgitarristen, das Márton Szegedi bei John Scofield, Pat Metheny, Bill frisell, Mike Stern untersucht. Christa Bruckner-Haring fragt danac, was vom Danzón in Gonzalo Rubalcabas Spiel fortlebt, und Helmut Rösing rekapituliert Methoden musikalischer Analyse, um Copyright-Fragen etwa bei Plagiatsvorwürfen zu klären.
Das Buch versammelt einen bunten Fundus interessanter Ansätze und dokumentiert zugleich die 21. Arbeitstagung des Arbeitskreises Studium Populärer Musik (ASPM) im November 2010 in Mannheim.
(Wolfram Knauer, Januar 2012)Jazz. Schule. Medien.
edited by Wolfram Knauer
Hofheim 2010 (Wolke Verlag)
256 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-936000-92-4.
 Das neueste Buch des Jazzinstituts Darmstadt trägt den Titel “Jazz. Schule. Medien.” und befasst sich mit verschiedenen Aspekten von Jazzvermittlung. In einem ersten Block geht es dabei darum, welchen Stellenwert Jazz im schulischen Unterricht besitzt, wie er in Lehrpläne eingebaut werden kann, welche pädagogischen Ansätze sich mit jazz-affinen Themen verbinden lassen, worauf die Musiklehrerausbildung achten muss, um Jazz und Popularmusik an Allgemeinbildenden Schulen gezielt einsetzen zu können. In einem zweiten Block wird aus unterschiedlichen Sichtweisen der Stellenwert diskutiert, den Jazz in den tagesaktuellen Medien besitzt, also in Tageszeitungen, Blogs etc. Schließlich kommen auch Jazzmusiker selbst zu Wort, die über Strategien berichten, ihr Publikum zu erreichen, in einer Zeit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne Lust auf die Konzentration machen, die der Jazz verlangt, Neugier zu wecken auf das spontane Experiment der musikalischen Improvisation.
Das neueste Buch des Jazzinstituts Darmstadt trägt den Titel “Jazz. Schule. Medien.” und befasst sich mit verschiedenen Aspekten von Jazzvermittlung. In einem ersten Block geht es dabei darum, welchen Stellenwert Jazz im schulischen Unterricht besitzt, wie er in Lehrpläne eingebaut werden kann, welche pädagogischen Ansätze sich mit jazz-affinen Themen verbinden lassen, worauf die Musiklehrerausbildung achten muss, um Jazz und Popularmusik an Allgemeinbildenden Schulen gezielt einsetzen zu können. In einem zweiten Block wird aus unterschiedlichen Sichtweisen der Stellenwert diskutiert, den Jazz in den tagesaktuellen Medien besitzt, also in Tageszeitungen, Blogs etc. Schließlich kommen auch Jazzmusiker selbst zu Wort, die über Strategien berichten, ihr Publikum zu erreichen, in einer Zeit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne Lust auf die Konzentration machen, die der Jazz verlangt, Neugier zu wecken auf das spontane Experiment der musikalischen Improvisation.
Die in diesem Band enthaltenen Beiträge entstanden aus Anlass des 12. Darmstädter Jazzforums im September 2011, das der theoretischen Diskussion über Jazzvermittlung auch einige praktische Workshops und Konzerte zur Seite stellte. Mit der Publikation wollen wir den Leser mit in den Diskurs darüber einbinden, wie der Jazz auch in Zukunft ein breites Publikum erreichen kann, ohne sich zu verbiegen, ohne seine kreative Freiheit dreinzugeben.
Zu den Autoren zählen namhafte Forscher, Pädagogen, Journalisten und Musiker wie etwa Christian Broecking, Sigi Busch, Ralf Dombrowski, Bernd Hoffmann, Julia Hülsmann, Reinhard Köchl, Hans-Jürgen Linke, Angelika Niescier, Florian Ross, Michael Rüsenberg, Jürgen Terhag, Walter Turkenburg, Joe Viera, Nils Wülker und andere.
Jazz. Schule. Medien.
(Jazz School Media)
edited by Wolfram Knauer
Hofheim 2010 (Wolke Verlag)
256 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-936000-92-4.
The latest book from the Jazzinstitut Darmstadt is titled “Jazz. Schule. Medien.” (Jazz. School. Media.) and deals with different aspects of bringing jazz to both a general and a young audience. The first part of the book looks at educational aspects, asks how to integrate jazz in a school curriculum, which pedagogical approaches can be linked to jazz-related themes, what to watch out for at teacher training in order for teachers to be able to use jazz and popular music effectively in school. A second part of the book discusses how jazz is seen and reported about in (German) daily newspapers, Blogs etc. And finally, musicians themselves have a say and talk about their strategies to reach their audience, how in a time of short attention span they whet their listeners’ appetite for the concentration which jazz often needs, how they raise the curiosity of their audience for the spontaneous experiment of musical improvisation.
The book’s chapters have originally been written as papers for the 12th Darmstadt Jazzforum in September 2011, a conference which also featured workshops and concerts. With the book publication we invite the reader to participate in a discourse about how to reach a broader audience for jazz while staying true to oneself, keeping one’s creative freedom.
Among the authors are established scholars, educators, journalists and musicians such as Christian Broecking, Sigi Busch, Ralf Dombrowski, Bernd Hoffmann, Julia Hülsmann, Reinhard Köchl, Hans-Jürgen Linke, Angelika Niescier, Florian Ross, Michael Rüsenberg, Jürgen Terhag, Walter Turkenburg, Joe Viera, Nils Wülker and others.
“Jazz. Schule. Medien.” is a German language publication throughout!
Deutsche Jazzfotografen: Karlheinz Fürst
herausgegeben von Monika Fürst
Neckargemünd 2012 (Männeles Verlag / Jazzinstitut Darmstadt)
216 Seiten, 24,90 Euro
ISBN: 978-3-933968-20-3
 Geschichtsträchtig, aber dennoch zeitlos modern… So könnte man die Aufnahmen des deutschen Jazzfotografen Karlheinz Fürst charakterisieren. Noch jenseits digitaler Bearbeitung dokumentierte Karlheinz Fürst im Auftrag von Joachim Ernst Berendt in den Jahren 1958 bis 1963 wichtige Kapitel deutscher Jazzgeschichte mit regionalem Kolorit.
Geschichtsträchtig, aber dennoch zeitlos modern… So könnte man die Aufnahmen des deutschen Jazzfotografen Karlheinz Fürst charakterisieren. Noch jenseits digitaler Bearbeitung dokumentierte Karlheinz Fürst im Auftrag von Joachim Ernst Berendt in den Jahren 1958 bis 1963 wichtige Kapitel deutscher Jazzgeschichte mit regionalem Kolorit.
Karlheinz Fürst gehörte von Anfang an zu den fotografischen Pionieren in dem kompromisslosen Verzicht auf Blitzlicht zugunsten des künstlerischen Ausdrucks. Die auf den ersten Blick scheinbare Unschärfe und Grobkörnigkeit etablierte sich unter den künstlerischen Fotografen schnell zu einem ausgesuchten Stilmittel.
Aus Anlass einer Ausstellung im Jazzinstitut Darmstadt erschien nun der zweite Band der Reihe “Deutsche Jazzfotografen” mit Fotos von Karlheinz Fürst. Der von der Tochter des Fotografen Marion Fürst in Zusammenarbeit mit dem Jazzinstitut Darmstadt herausgegebene Band “Deutsche Jazzfotografen: Karlheinz Fürst” ist 216 Seiten stark und enthält neben den ausdrucksstarken Fotos aus den 1950er und frühen 1960er Jahren einen sehr persönlichen Aufsatz der Herausgeberin sowie einen kenntnisreichen Rückblick auf die deutsche Jazzszene jener Zeit von Matthias Spindler.
(Doris Schröder / Wolfram Knauer, Dezember 2012)
Lennie Tristano. C-Minor Complex
von Marco Di Battista
Raleigh/NC 2012 (Lulu Enterprises)
80 Seiten, 10,00 Euro
ISBN: 978-1-291-08480-1
www.marcodibattista.com
 Lennie Tristanos Aufnahme von “C-Minor Complex” vom Herbst 1961 ist eine musikalische tour-de-force, ein hervorragendes Beispiel für Tristanos Fähigkeit in Linien zu denken und zu musizieren. Der italienische Pianist Marco di Battista hat sich Tristanos Aufnahme als Musterbeispiel seiner Annäherung an sein musikalisches Vorbild genommen.
Lennie Tristanos Aufnahme von “C-Minor Complex” vom Herbst 1961 ist eine musikalische tour-de-force, ein hervorragendes Beispiel für Tristanos Fähigkeit in Linien zu denken und zu musizieren. Der italienische Pianist Marco di Battista hat sich Tristanos Aufnahme als Musterbeispiel seiner Annäherung an sein musikalisches Vorbild genommen.
Im ersten Kapitel stellt er den historischen Kontext vor, aus dem heraus Tristanos Kunst zu verstehen ist. Kapitel 2 verweist auf musikalische Einflüsse (und lässt auch die italienische Herkunft der Familie nicht unerwähnt). Im dritten Kapitel verfolgt die Battista die musikalische Karriere des Meisters, um in den Kapiteln 4 bis 6 zur formalen und harmonischen Analyse des “C-Minor Complex” zu kommen. Er hebt den Anschlag hervor und verweist auf die harmonischen Bezüge zu “Pennies from Heaven” bzw. Tristanos eigenem “Lennie’s Pennies”. Die gleichmäßige Rhythmik erinnert ihn an den gleichmäßigen Puls, der beispielsweise englischer Renaissancemusik von William Byrd und anderen zugrundeliegt. Seine harmonische Analyse benennt besondere Alterationen, aber auch Unterschiede etwa zu “Lennie’s Pennies”. Insbesondere interessiert ihn dabei das Ineinandergreifen von Polyrhythmik, harmonischem Verlauf und melodischer Erfindung.
Das Buch schließt mit einer Komplett-Transkription der fünfeinhalbminütigen Aufnahme.
Wolfram Knauer (Dezember 2014)
Doc. The Story of a Birmingham Jazz Man
von Frank ‘Doc’ Adams & Burgin Mathews
Tuscaloosa/AL 2012 (The University of Alabama Press)
267 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8173-1780-5
 Frank Adams gehört zu den Musikern des Jazz, die vielleicht allein deshalb keine große Karriere machten, weil sie sich nie entscheiden konnten, in die großen Jazzstädte zu ziehen. 1928 in Birmingham, Alabama, geboren, spielte der Klarinettist und Saxophonist zwar mit Jazzgrößen wie dem jungen Sun Ra (als dieser noch Sonny Blount hieß) und in den 1940er Jahren sogar eine kurze Weile mit Duke Ellingtons Orchester, blieb, abgesehen von seinen Studienjahren an der Howard University in Washington, ansonsten aber die meiste Zeit in seiner Heimatstadt. Sogar ein Angebot der Count Basie Band lehnte er ab, weil er sich lieber um seine Familie und seine Schüler kümmern wollte. In Birmingham, Alabama, ist Frank Adams seit langem eine Jazzlegende und in der Community so beliebt, dass er allgemein nur mit seinem Spitznamen “Doc” gerufen wird.
Frank Adams gehört zu den Musikern des Jazz, die vielleicht allein deshalb keine große Karriere machten, weil sie sich nie entscheiden konnten, in die großen Jazzstädte zu ziehen. 1928 in Birmingham, Alabama, geboren, spielte der Klarinettist und Saxophonist zwar mit Jazzgrößen wie dem jungen Sun Ra (als dieser noch Sonny Blount hieß) und in den 1940er Jahren sogar eine kurze Weile mit Duke Ellingtons Orchester, blieb, abgesehen von seinen Studienjahren an der Howard University in Washington, ansonsten aber die meiste Zeit in seiner Heimatstadt. Sogar ein Angebot der Count Basie Band lehnte er ab, weil er sich lieber um seine Familie und seine Schüler kümmern wollte. In Birmingham, Alabama, ist Frank Adams seit langem eine Jazzlegende und in der Community so beliebt, dass er allgemein nur mit seinem Spitznamen “Doc” gerufen wird.
Frank Adams Autobiographie erzählt verschiedene Geschichten. Da geht es zum einen um einen Musiker, dem die Einbindung seiner Kunst in die Community immer am Herzen lag. Da geht es zum zweiten um die schwarze Gesellschaft in den tiefen Südstaaten, wo Adams’ Vater seine eigene Zeitung, den Birmingham Reporter herausgegeben hatte und die Familie eine hoch angesehene Stellung besaß. Es geht schließlich um die Erdung, die auch solche Musiker, die ihre Heimat verlassen, letzten Endes aus ihrer Herkunft erfahren, eine Erdung, wie Adams sie bei seinen Kollegen Blount (also Sun Ra) und Erskine Hawkins konstatiert.
Vor allem aber geht es um ihn selbst, um Frank Adams, der sich an seinen ersten Ton auf der Klarinette seines Bruders erinnert, ein G, und an eine eher unbeschwerte Kindheit in einer engen Familie, deren Bande mit seiner Großmutter bis fast an die Zeit der Sklaverei zurückreichten. Diese habe immer, wenn ihm etwas gelungen sei, gesagt, “No ladder child could do better”, und erst viel später sei ihm aufgegangen, dass “ladder” für “Mulatto” stand und sie ihn loben wollte, dass er als schwarzer Junge besser gewesen sei als ein hellerer Mulatte, die allgemein für klüger gehalten wurden. Der Rassismus war eben etwas, was damals wie heute nicht nur das Verhalten der Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft bestimmte, sondern auch ihr eigenes Selbstverständnis.
Zur Musik kam Adams wie so viele andere Musiker seiner Generation durch die Kirche; eines der ersten Jazzkonzerte, an das das er erinnert, war das Duke Ellington Orchester. In der Lincoln Elementary High School erhielt er Unterricht beim Neffen von W.C. Handy und spielte bald darauf in der Band von Fess Whatley, einer lokalen Legende, der Musiker wie Erskine Hawkins und andere hervorgebracht hatte. Wenig später rief Sonny Blount bei seiner Mutter an und fragte um Erlaubnis, dass ihr Sohn in seiner Band spielen könne. Adams berichtet von Sun Ras Wohnung in Birmingham, von seinem musikalischen Ansatz, von der Art und Weise, wie er seine Musiker, von denen die meisten eh keine Noten lesen konnten, improvisieren ließ, wie er von ihnen erwartete, dass sie etwas von sich selbst in ihrer Musik preisgaben. Schon in der High School hatte Adams Gelegenheit, mit verschiedenen Revue-Truppen zu touren. Nach dem Schulabschluss erhielt er dann ein Stipendium an der Howard University in Washington, D.C. Nebenbei spielte er immer wieder Ersatzgigs im Howard Theatre oder in anderen Clubs der Stadt. In dieser Zeit buchte Jimmy Hamilton ihn als Ersatz für Hilton Jefferson, der sich das Bein gebrochen hatte, für das Duke Ellington Orchester.
1950 kehrte Adams nach Birmingham zurück und nahm eine Stelle als Grundschullehrer an, die er in der Folge 27 Jahre bekleidete. Er erzählt, wie er jetzt als Lehrer den jungen Schüler das weitergab, was er einst selbst von seinen Lehrern gelernt hatte. Nebenbei trat er in den Clubs der Stadt auf und berichtet von einigen der Musiker, die in seiner Band spielten, unter ihnen etwa der Bassist Ivory Williams und der Trompeter Joe Guy, der eine Weile Billie Holidays Ehemann war. Er berichtet über sein Privatleben, Frau und Kinder, sowie über die Bürgerrechtsbewegung, die insbesondere in den amerikanischen Südstaaten alles verändern sollte.
Doc Evans’ Autobiographie ist mehr als ein musikalisches Fallbeispiel. In Zusammenarbeit mit Burgin Mathews gelingt es ihm, gelebte Geschichte erfahrbar zu machen. Er erzählt Hintergründe, die in vielen Jazzbüchern ausgeblendet werden, weil Realität Geschichte zu profan scheinen lassen kann. Das alles gelingt ihm in einem lockeren, sehr persönlich gehaltenen Ton, der die Lektüre seines Buchs zu einem Lesevergnügen werden lässt.
Wolfram Knauer (August 2014)
Creole Trombone. Kid Ory and the Early Years of Jazz
von John McCusker
Jackson/MS 2012 (University Press of Mississippi)
250 Seiten, 30 US-Dollar
ISBN: 978-1-61703-626-2
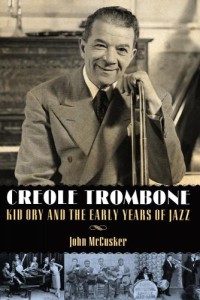 Kid Ory, meint John McCusker zu Beginn seiner Biographie, sei ein von der Jazzgeschichte zu Unrecht vernachlässigtes Brückenglied zwischen Jazzpionieren wie Buddy Bolden und späteren Jazzstars wie Louis Armstrong. Der Autor hat sich vor allem als Journalist und Fotograf für die New Orleans Times-Picayune einen Namen gemacht. Für sein Buch recherchierte er im Hogan Jazz Archive der Tulane University, konnte aber auch auf Manuskripte der Autobiographie Edward Kid Orys zurückgreifen, die ihm dessen Tochter Babette zur Verfügung stellte.
Kid Ory, meint John McCusker zu Beginn seiner Biographie, sei ein von der Jazzgeschichte zu Unrecht vernachlässigtes Brückenglied zwischen Jazzpionieren wie Buddy Bolden und späteren Jazzstars wie Louis Armstrong. Der Autor hat sich vor allem als Journalist und Fotograf für die New Orleans Times-Picayune einen Namen gemacht. Für sein Buch recherchierte er im Hogan Jazz Archive der Tulane University, konnte aber auch auf Manuskripte der Autobiographie Edward Kid Orys zurückgreifen, die ihm dessen Tochter Babette zur Verfügung stellte.
Kspan style=”font-size:10.0pt;font-family:”Arial”,”sans-serif”; mso-ansi-language:DE”>id Ory wurde 1886 auf der Woodland Plantation geboren, etwa 25 Meilen stromaufwärts von New Orleans. McCusker beschreibt die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf der Zuckerrohrplantage nach Abschaffung der Sklaverei. Er zeichnet die Herkunft der Vorfahren Orys nach, seines weißen Vaters, Sproß einer ehemaligen Sklavenhalterfamilie, sowie seiner Mutter, einer hellhäutigen Mulattin. Ory hatte sich selbst immer als Kreolen bezeichnet, was neben der Hautfarbe vor allem die Beschreibung kultureller Identität beinhaltete. Als Kind konnte er in den Gemeinden um sein Heimatdorf Kirchen- und Volkslieder hören, die meist auf Französisch gesungen wurden. James Brown Humphrey, der Leiter der Onward Brass Band, kam regelmäßig ins New Orleanser Hinterland, um den Brass Bands in den Dörfern und Plantagen ein ordentliches Repertoire zu vermitteln. All dies trug zur musikalischen Sozialisation Orys bei, der zuallererst Fan war, begeistert von der Musik, die er da hörte, die er mit Freunden nachsang, mit denen er außerdem archaische Zigarrenschachtelgeigen und -gitarren baute, während er sehnsüchtig darauf sparte, sich einmal ein richtiges Instrument leisten zu können.
Edward Orys Mutter starb, als er 14 Jahre alt war, sein Vater ein Jahr später. Der Junge lebte mit seinen Schwestern, arbeitete in einem Sägewerk und spielte in seiner Freizeit Gitarre. In einem Saloon ließ jemand den Hut herumgehen, als er den Blues spielte, und er stellte erstaunt fest, dass das Geld, das da reinkam, mehr war als er in zwei Monaten verdient hatte. 1905 reiste er zum ersten Mal nach New Orleans, wo er sich eine Ventilposaune kaufte. Die Stadt machte großen Eindruck auf ihn, noch mehr aber beeindruckte ihn sein erstes Treffen mit Buddy Bolden. McCusker beschreibt das musikalische Leben im New Orleans jener Jahre, Picknicks und Konzerte im Lincoln Park, Tanzveranstaltungen in der Masonic Hall, intensive Gottesdienste in den “Holly Roller”-Kirchen der Pfingstkirchler. Ory hörte alle möglichen Bands, aber die blues-getränkte Musik Boldens gefiel ihm am besten. 1907 zog er endgültig in die Mississippi-Metropole und schaffte es bald, seiner jungen Band ein Engagement im Lincoln Park zu verschaffen.
McCusker beschreibt die Spielorte für die Band, nennt Bandmitglieder wie Ed Garland und Johnny Dodds sowie Kollegen wie Freddie Keppard. Die Musikszene in New Orleans umfasste Brass Bands und Tanzorchester, Creole Bands, deren Mitglieder Noten lesen konnten, und Gut-Bucket Bands, die das nicht beherrschten. Zeitzeugen erzählen, dass es Ory, der sich 1909 eine Zugposaune gekauft und in der Folge seine Spieltechnik verändert hatte, damals gelungen sei, selbst einen Walzer “hot” klingen zu lassen. Die Stadt war reich Kneipen und Bordellen im Storyville-Viertel der Stadt; McCusker beschreibt die vielen “Charaktere”, und er stellt Orys eigene Aussage in Frage, ein Verhältnis mit Lulu White gehabt zu haben, der bekanntesten Zuhälterin vor Ort.
1913 hörte Ory Louis Armstrong in der Waisenhaus-Band, in der Satchmo damals seine ersten musikalischen Erfahrungen machte, und ließ ihn für ein paar Stücke einspringen. Um 1916 kam Joseph Oliver als Kornettist zu Ory, und gemeinsam entwickelten sie eine neue Art des Zusammenspiels, die sich erheblich von dem unterschied, was noch Buddy Bolden gemacht hatte. 1917 spielte die Original Dixieland Jazz Band ihre ersten Aufnahmen in New York ein, und McCusker erzählt entlang der ihm vorliegenden autobiographischen Notizen, wie das Bandkonzept der ODJB auch Ory beeinflusst habe. Das Rotlichtviertel wurde 1917 geschlossen; Oliver verließ die Stadt 1918, um nach Chicago zu gehen, und Ory ersetzte ihn durch den jungen Armstrong.
Neben der Schließung des Rotlichtviertels, neben dem allgegenwärtigen Rassismus im Süden und neben den besseren Löhnen, die man im Norden erzielen konnte, führt McCusker auch die Prohibition ins Feld, die die Kneipenszene in New Orleans verwandelte und vielen Musikern Auftrittsmöglichkeiten nahm. Ory blieb noch eine Weile, entschloss sich dann aber im August 1919 den Zug nach Los Angeles zu besteigen. Die nächsten sechs Jahre lebten er und seine Frau in Kalifornien, wo sie eine lebendige Musikszene entlang der Central Avenue in Los Angeles, aber auch an der Barbary Coast von San Francisco oder in Oakland vorfanden. Er arbeitete für die Spikes Brothers, Johnny und Reb Spikes, die damals wichtigsten Konzertorganisatoren an der Westküste, und spielte im Mai 1922 seine legendären ersten Plattenaufnahmen ein. 1925 frugen sowohl King Oliver wie auch Louis Armstrong bei Ory an, ob er nicht Lust hätte, ihren jeweiligen Bands beizutreten, die in Chicago spielten. Oliver brauchte Ersatz für seine Dixie Syncopators, und Armstrong einen regelmäßigen Posaunisten für seine Hot Five, die ja nur eine Studioband war. McCusker hört sich etliche der frühen Hot-Five-Aufnahmen an, und findet, dass es vielleicht gerade die archaische Rohheit Orys Posaune war, die diesen Aufnahmen ihren besonderen Charme verliehen. Daneben spielte der Posaunist mit Oliver und diversen anderen Bands und nahm außerdem Unterricht bei einem in Böhmen geborenen Posaunisten. Er ging mit Jelly Roll Morton und Johnny Dodds ins Studio und kehrte gegen Ende des Jahrzehnts zurück nach Kalifornien.
Hier hört McCuskers Geschichte auf, dem es vor allem um die prägende Zeit ging, jene Jahre, in denen Orys eigener Stil geprägt wurde und jene, in denen er dem Jazz seine eigene Prägung aufdrückte. Seltene Fotos ergänzen das Buch, kurze Auszüge aus dem autobiographischen Manuskript (das im Text selbst ebenfalls immer wieder länger zitiert wird) sowie die Lead Sheets für fünf von ihm nie aufgenommenen Kompositionen, unter anderem einem skurrilen Stück von 1942 mit dem Titel “Mussolini Carries the Drum for Hitler”.
“Creole Trombone” ist eine exzellente Studie zum frühen Jazz in New Orleans. John McCusker gelingt es sowohl Kid Orys Biographie in eine lesbare und nachempfindbare Linie zu bringen als auch dem Leser ein Gefühl für das Musikleben in New Orleans zu vermitteln, in dem Ory und andere Musiker seiner Generation ihr Auskommen finden mussten. Seine Mischung aus historischer Recherche, biographischen und autobiographischen Zitate sowie einem nüchternen, vorsichtig sich der Materie annähernden Stil, der jede Art von Heldenverehrung möglichst vermeidet, macht das Buch zu einer klugen Lektüre, die einen auch dort viel über die Musik lernen lässt, wo der Journalist McCusker über diese selbst eigentlich eher wenig schreibt.
Wolfram Knauer (Juni 2014)
Michel Petrucciani. Leben gegen die Zeit
von Benjamin Haley
Hamburg 2012 (edel)
288 Seiten, 29,95 Euro
ISBN: 978-3-8419-0174-3
 Roberto Saviano, der italienische Journalist und Camorra-Jäger, beginnt das Buch über Michel Petrucciani mit einer kurzen, eindringlichen Biographie des Künstlers, der Schilderung einer Karriere, die es nicht geben dürfte, weil der Künstler mit der Glasknochenkrankheit doch eigentlich nie Klavier hätte spielen können, die aber umso eindringlicher war, weil er eben nicht als behinderter Virtuose, sondern als Vollblutmusiker anerkannt und bewundert wurde, wo immer er auftrat. Michel Petruccianis Sohn Alexandre schreibt im Vorwort über seinen Vater: “Er war lustig, lachte stets und war sehr gelassen. Obwohl ihm das Leben nicht gerade die besten Karten in die Hand gegeben hatte, um trumpfen zu können. (…) Er hat dem Leben diesen Humor und diese mitreißende Freude entrissen, die man in der Mehrzahl seiner Kompositionen erlebt.”
Roberto Saviano, der italienische Journalist und Camorra-Jäger, beginnt das Buch über Michel Petrucciani mit einer kurzen, eindringlichen Biographie des Künstlers, der Schilderung einer Karriere, die es nicht geben dürfte, weil der Künstler mit der Glasknochenkrankheit doch eigentlich nie Klavier hätte spielen können, die aber umso eindringlicher war, weil er eben nicht als behinderter Virtuose, sondern als Vollblutmusiker anerkannt und bewundert wurde, wo immer er auftrat. Michel Petruccianis Sohn Alexandre schreibt im Vorwort über seinen Vater: “Er war lustig, lachte stets und war sehr gelassen. Obwohl ihm das Leben nicht gerade die besten Karten in die Hand gegeben hatte, um trumpfen zu können. (…) Er hat dem Leben diesen Humor und diese mitreißende Freude entrissen, die man in der Mehrzahl seiner Kompositionen erlebt.”
Der Autor und Musikwissenschaftler Benjamin Haley begegnete Michel Petrucciani erstmals 1995, als er in kontaktierte, weil er seine Magisterarbeit über den Pianisten schreiben wollte. Aus dem Kontakt entstand eine Freundschaft und, spätestens nach dem Tod des Pianisten, das Verlangen, dessen Leben zwischen künstlerischem Wollen und den Problemen des Alltags zu schildern. Für die vorliegende Biographie griff Haley auf eigene und bereits publizierte Interviews mit dem Pianisten zurück, führte daneben aber auch viele Gespräche mit Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen Petruccianis.
Haley beginnt seine Erzählung mit der Schilderung, wie der vierjährige Michel seine Eltern durch sein außergewöhnliches Gehör davon überzeugte, ihm erst ein Spielzeugklavier, dann ein richtiges Instrument zu besorgen. Sein Vater baute dem wachstumsgestörten Jungen eine Konstruktion, mithilfe derer er die Pedale erreichen konnte und ermunterte ihn darüber hinaus, sein Talent zu pflegen. Der Vater liebte Jazz, und als er eine Musikalienhandlung eröffnete, stellte er sicher, dass es darin auch ein Musikzimmer gab, in dem Michel üben konnte. “Ich bin nicht besonders begabt”, erklärte Michel später, “ich habe meinem Instrument nur unheimlich viel Zeit gewidmet.”
Wie erzählt man die Biographie eines so kurz gelebten Lebens? Benjamin Haley hat sich entschlossen, sie in Episoden zu erzählen. Nach dem Kindheitskapitel folgt eines über Michels Freund Manhu Roche, der ihm ein Schlagzeugset baute und ihn auf etlichen seiner Reisen begleitete. Ein weiteres Kapitel ist den Begegnungen mit großen Musikern gewidmet, Kenny Clarke etwa, Aldo Romano, Barre Phillips, aber auch einigen seiner Agenten und Produzenten. Anfang der 1980er Jahre nahm ein amerikanischer Freund Petrucciani mit nach Kalifornien und führte ihn in die Künstlerszene Big Surs ein. Der Saxophonist Charles Lloyd, der ihn dort kennenlernte, war von Petruccianis Kunst so bewegt, dass er , der sein Instrument fünf Jahre lang kaum mehr berührt hatte, ein Comeback anging. Petrucciani war schnell auch in den USA als Duopartner gefragt, spielte mit Lloyd, mit Lee Konitz, mit Charlie Haden. Er zog nach New York, trat mit seinem eigenem Trio auf, begleitet aber auch beispielsweise die Sängerin Sarah Vaughan oder spielte mit Dizzy Gillespie, David Sanborn, Stan Getz und vielen anderen.
Haley erzählt etliche der Anekdoten, von viele um den Pianisten existieren. Wie dieser die Hells Angels in Kalifornien mit Absicht gereizt habe, um dann auf einem Motorrad vornedrauf eine Runde mitzudrehen. Wie er Whitney Houston im Flieger zur Grammy-Verleihung kennengelernt habe und ihr dann in ihrem Hotelzimmer vorgespielt habe. Wie Oscar Peterson ihn erst habe abblitzen, sich dafür Jahre später aber mit Tränen in den Augen entschuldigt habe. Es sind Geschichten eines Menschen, dessen Schicksal viele betroffen machte, dessen Musik sie aber noch viel mehr berührte. Es sind Geschichten eines rastlosen Lebens zwischen den USA und Europa, eines Künstlers, der sich der Musik geweiht hatte, der daneben aber frech und lebensfroh war, Frauen genauso liebte wie gutes Essen oder Wein, der seine Prominenz genoss, weil sie ihm zeigte, dass er den Erwartungen aller ein Schnippchen geschlagen hatte.
Haleys Buch behält dabei neben allem Biographischen einen zutiefst persönlichen Ansatz, ist einem Freund gewidmet, lässt den Leser hinter die Fassade blicken. Zum Schluss finden sich einige Briefe Petruccianis an seinen Freund Manhu Roche sowie ein Ausblick auf das Nachwirken des Künstlers, der auf dem Père Lachaise in Paris nur wenige Schritte von der letzten Ruhestätte Frédéric Chopins entfernt begraben liegt.
Und als Anhang hat sich der deutsche Verlag entschlossen Petrucciani-Interviews von Ben Sidran sowie von Karl Lippegaus hinzuzufügen, der außerdem eine kommentierte Diskographie beigibt. Lippegaus ist auch der Übersetzer dieses Buchs, das nicht nur Michel-Petrucciani-Fans ans Herz gelegt sei. “Leben gegen die Zeit” erzählt weit mehr erzählt als “nur” eine Musikergeschichte. Es erzählt von der Kraft der Musik, vor allem aber von der Kraft eines mutigen, trotzigen und starken Mannes.
Wolfram Knauer (Juni 2014)
Sound Diplomacy. Music & Emotions in Transatlantic Relations 1850-1920
von Jessica C.E. Gienow-Hecht
Chicago 2012 (University of Chicago Press)
333 Seiten, 30 US-Dollar
ISBN: 978-0-226-29216-8
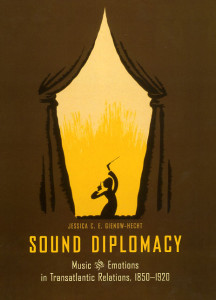 Kulturdiplomatie scheint ein Thema zu sein, das erst im Kalten Krieg entwickelt wurde, tatsächlich aber spielten kulturelle Beziehungen schon viel länger eine wichtige Rolle im politischen Geschäft, wie Jessica C.E. Gienow-Hecht in ihrem Buch über die kulturellen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland belegt. Während Frankreich auf diesem Gebiet vor allem in den Bildenden Künsten reüssierte und England allein der Sprache wegen eng mit den USA verbunden war, fokussierte sich die deutsch-amerikanische Freundschaft in den von Gienow-Hecht untersuchten Jahren 1850 bis 1920 vor allem auf die klassische Musik, und innerhalb dieser insbesondere auf Sinfonieorchester und ihre Dirigenten. Die Autorin interessieren vor allem die Konnotationen, Emotionen also, die sich mit deutscher Musik verbanden, ein seltsames Konzept von Männlichkeit und Zivilisation, das, ihrer Analyse zufolge, zumindest einen großen Teil der euro-amerikanischen Identität stark prägte.
Kulturdiplomatie scheint ein Thema zu sein, das erst im Kalten Krieg entwickelt wurde, tatsächlich aber spielten kulturelle Beziehungen schon viel länger eine wichtige Rolle im politischen Geschäft, wie Jessica C.E. Gienow-Hecht in ihrem Buch über die kulturellen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland belegt. Während Frankreich auf diesem Gebiet vor allem in den Bildenden Künsten reüssierte und England allein der Sprache wegen eng mit den USA verbunden war, fokussierte sich die deutsch-amerikanische Freundschaft in den von Gienow-Hecht untersuchten Jahren 1850 bis 1920 vor allem auf die klassische Musik, und innerhalb dieser insbesondere auf Sinfonieorchester und ihre Dirigenten. Die Autorin interessieren vor allem die Konnotationen, Emotionen also, die sich mit deutscher Musik verbanden, ein seltsames Konzept von Männlichkeit und Zivilisation, das, ihrer Analyse zufolge, zumindest einen großen Teil der euro-amerikanischen Identität stark prägte.
Gienow-Hecht beginnt ihre Studie in den 1850er Jahren, als die ersten Weltausstellungen nicht nur Warenmessen waren, sondern zugleich zu kulturellen Vergleichen animierten, neugierig machten auf fremde oder aber auf die Verwandtschaft der eigenen mit anderen Kulturen. Sie endet ihr Buch mit der Enttäuschung Amerikas über Deutschland in Folge des I. Weltkriegs und verweist im Epilog auf die Folgen der amerikanisch-deutschen Musikbeziehungen insbesondere nach dem II. Weltkrieg.
Thema ihres Buches ist zugleich die Beschreibung einer nationalen Musikkultur in Deutschland, die gerade im Dialog des kulturellen Transfers, in ihrer Spiegelung durch die amerikanische Rezeption als nationale kulturelle Identität besonders deutlich wird, und die Entwicklung einer anderen kulturellen Identität in den USA, die ihre eigene nationale Farbe im Vergleich entwickelt und am Beispiel misst. Ihr Buch betrachtet allerdings recht einseitig vor allem die Faszination amerikanischer Musiker und Hörer mit den deutschen Traditionen zwischen Beethoven und Wagner und erwähnt einzig in einer Fußnote die Tatsache, dass es bereits in derselben Zeit auch die gegenläufige Faszination europäischer Musiker und Hörer an amerikanischer Musik gab – allerdings nicht an amerikanischer Konzertmusik europäischer Provenienz, sondern an den archaischer wirkenden Spirituals der Fisk Jubilee Singers oder Unterhaltungsmusik reisender Minstrelgruppen.
Für die Jazzforschung lässt sich aus Gienow-Hechts Studie vor allem lernen, wie sie Subtexte der bi-nationalen Musikrezeption herauszuarbeiten versucht, Konnotationen beschreibt, nach ihren Ursachen fragt und ihre Auswirkungen betrachtet. Auch in der einseitigen Ausrichtung auf die amerikanische Rezeption deutscher Musik allerdings lässt sie einige Kapitel aus, die wenigstens am Rande erwähnenswert gewesen wären: die vielen Gesangsvereine etwa, die von Wisconsin bis Louisiana deutsches Musikbrauchtum pflegten zu einer Zeit, als die Unterscheidung zwischen E und U, zwischen hoher und niederer Musik noch nicht so ausgeprägt war wie im Zeitalter der Musikindustrie.
Alles in allem, eine sorgfältige Studie, die den Leser nichtsdestotrotz zu weiteren Fragen animiert, etwa nach genaueren Informationen über das Publikum, nach der Rezeption innerhalb anderer ethnischer Gruppen in den USA (also italienischen, französischen, irischen Einwanderern) und nicht zuletzt nach den Auswirkungen auf die Wahrnehmung indigener (also indianischer) oder anders-fremder (also afrikanischer bzw. afro-amerikanischer) Kulturtraditionen. Wer eine Abhandlung über gezielte politische Entscheidungen erwartet, mit Kultur Politik zu machen, wie der Titel des Buchs, “Sound Diplomacy”, wie aber vor allem unser Verständnis einer Kulturdiplomatie nach dem II. Weltkrieg erwarten lässt, wird enttäuscht. Gienow-Hecht zeigt stattdessen, wie Kultur als Sympathieträger genutzt wird, um bereits bestehende Bindungen zu stärken, und wie außermusikalische Konnotationen erkannt und genutzt werden – von amerikanischen Verteidigern europäischer Kulturtraditionen genauso wie von den europäischen Musikern und Dirigenten, die Amerika als einen großen Markt erkannten.
Wolfram Knauer (Mai 2014)
Jazz / Not Jazz. The Music and Its Boundaries
herausgegeben von David Ake & Charles Hiroshi Garrett & Daniel Goldmark
Berkeley 2012 (University of California Press)
301 Seiten, 36,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-520-27104-3
 Eine sinnvolle Definition eines Gegenstandes erhält man erst, wenn man seine Ränder beschreiben kann, wenn man also weiß, was er nicht ist. Die Frage, ob ein musikalischer Ausdruck von uns als Jazz oder nicht als Jazz beschrieben wird, sagt dabei zugleich etwas über unsere eigene ästhetische Position aus. “Jazz / Not Jazz” untersucht diese Randbereiche der Jazzdefinition, um sich so dem Gegenstand, dem Jazz selbst also, besser nähern zu können. Die Herausgeber siedeln ihr Buch dabei im Bereich der “new jazz studies” an, die den Gegenstand der Forschung immer im Kontext zu parallelen Entwicklungen, gesellschaftlichen Einflüssen, ästhetischen Zwängen oder den Auswirkungen künstlerischer Entscheidungen sehen.
Eine sinnvolle Definition eines Gegenstandes erhält man erst, wenn man seine Ränder beschreiben kann, wenn man also weiß, was er nicht ist. Die Frage, ob ein musikalischer Ausdruck von uns als Jazz oder nicht als Jazz beschrieben wird, sagt dabei zugleich etwas über unsere eigene ästhetische Position aus. “Jazz / Not Jazz” untersucht diese Randbereiche der Jazzdefinition, um sich so dem Gegenstand, dem Jazz selbst also, besser nähern zu können. Die Herausgeber siedeln ihr Buch dabei im Bereich der “new jazz studies” an, die den Gegenstand der Forschung immer im Kontext zu parallelen Entwicklungen, gesellschaftlichen Einflüssen, ästhetischen Zwängen oder den Auswirkungen künstlerischer Entscheidungen sehen.
Eric Porter blickt in seinem ersten Kapitel auf Strategien der Vereinnahmung bzw. der Distinktion in der Jazzgeschichte und der Jazzgeschichtsschreibung. Es geht um Stilvielfalt, um Akzeptanz bestimmter Entwicklungen oder der Abgrenzung anderer, um Inklusion und Exklusion sowohl innerhalb des amerikanischen Jazz als auch im globalen Verständnis von Jazz. Elijah Wood beginnt sein Kapitel mit dem Erstaunen über eine Aussage Louis Armstrongs, der in einem Blindfold Test seine unumschränkte Bewunderung für Guy Lombardo kundtat, der von der Jazzkritik eher als “King of Corn” abgetan wurde. Was, fragt Wald, faszinierte Armstrong so an Lombardos Musik, dass in seinen Aufnahmen aus den späten 1920er, frühen 1930er Jahren etwa der Klang des Saxophonsatzes deutlich an Lombardo orientiert war? Tatsächlich zeigten auch andere schwarze Bandleader Gefallen am Stil des weißen Kollegen, unter ihnen selbst Duke Ellington und Jimme Lunceford. Wald vergleicht den Einfluss Lombardos mit dem klassischer Musik auf viele der frühen Jazzmusiker und betrachtet vor diesem Hintergrund dann auch gleich noch die klassischen Erfahrungen Satchmos etwa mit Erskine Tates Orchestra.
Charles Hiroshi Garrett untersucht die humoristische Seite des Jazz, um anhand dieser Kategorie Veränderungen im Verhältnis der Musiker und ihres Publikums zu analysieren. Ken Prouty betrachtet die neuen, virtuellen Jazz Communities und ihr ästhetisches Verständnis dessen, was Jazz ist und was nicht. Er nimmt sich Plattformen wie Wikipedia oder All About Jazz vor, und analysiert neben den konkreten Inhalten auch die Veränderungen und Kommentare auf solchen Seiten. Christopher Washburn blickt auf das Phänomen das Latin Jazz und die unterschiedlichen Lokalisationen dieser Musik zwischen Afrika, Cuba, der Karibik und Lateinamerika und diskutiert das Selbstverständnis des Lincoln Center Afro-Latin Jazz Orchestra unter Leitung von Arturo O’Farrill sowie des Perkussionisten Ray Barretto.
John Howland vergleicht die unterschiedlichen Ansätze an Streicherarrangements im Jazz, von Adolph Deutschs Arrangement zu “Clap Yo’ Hands” für Paul Whiteman über Sy Olivers Arrangement zu “Blues in the Night” für Artie Shaw und Pete Rugolos “Lonesome Road” für Stan Kenton bis zu Jimmy Carrolls “Just Friends” für Charlie Parker. Daniel Goldmark diskutiert das Marketingproblem “Genre” anhand des Labels Atlantic Records und seiner Aufnahmen des Dudelsackspielers Rufus Harley und der Saxophonisten Yusef Lateef und Rahsaan Roland Kirk. Tamar Barzel beleuchtet Kompositions- und Improvisationsprozesse der New Yorker Downtown-Szene um John Zorn. Loren Kajikawa geht in seinem Beitrag von der politischen Bedeutung schwarzer Musik für den Black Revolutionary Nationalism aus und fragt nach ähnlichen Bezügen im asiatisch-amerikanischen Jazz.
Jessiva Bissett Perea fragt nach dem Stand der Jazzgesangsausbildung im Nordwesten der USA. David Ake diskutiert die unterschiedlichen Lernmethoden der Schule und der Straße, die Legenden, die sich um beide Wege zum Jazz ranken sowie die Auswirkungen dessen, wie man Musik lernt, auf die eigene Musik, ihre Ästhetik und die Art und Weise, wie sie rezipiert wird. Sherrie Tucker schließlich stellt die übliche Darstellung der Jazzgeschichte in Frage, indem sie den Blick insbesondere auf die Rolle von Frauen im Jazz richtet, und dabei nicht allein die bekannten Musikerinnen betrachtet, sondern auch Beispiele gibt, die in Jazzbüchern kaum genannt werden. Sie nimmt diesen “anderen” Blick auf den Jazz zum Anlass, sich generell mit Fragen des Forschungsinteresses im Jazz zu befassen.
“Jazz / Not Jazz” ist ein überaus anregendes Buch, das sehr unterschiedliche Ansätze versammelt, denen allen gemein ist, dass sie auf die Randbereiche dessen schauen, was wir sonst in Jazzgeschichtsbüchern oder selbst in den meisten wissenschaftlichen Publikationen über den Jazz lesen.
Wolfram Knauer (April 2014)
Oltre il Mito. Scritti sul linguaggio del Jazz
von Maurizio Franco
Lucca 2012 (Libreria Musicale Italiana)
151 Seiten, 25 Euro
ISBN: 978-88-7096-710-4
 Maurizio Franco ist ein italienischer Musikwissenschaftler, der in dem vorliegenden Buch diverse Aufsätze zu Jazzgeschichte, -ästhetik und -pädagogik zusammenfasst.
Maurizio Franco ist ein italienischer Musikwissenschaftler, der in dem vorliegenden Buch diverse Aufsätze zu Jazzgeschichte, -ästhetik und -pädagogik zusammenfasst.
Das Eingangskapitel seines Buchs befasst sich mit Sound und der Sprache des Jazz, wobei er die Soundcharakteristiken des Jazz sowohl mit solchen aus klassischer Musik vergleicht als auch mit ähnlichen Phänomenen etwa aus der Bildenden Kunst (Klangfarbe).
Zwei Kapitel widmen sich vorrangig der Improvisation: einmal dem improvisatorischen Zusammenspiel und der musikalischen Kommunikation im Ensemble; zum anderen den kreativen Prozessen, die im Improvisationsprozess stattfinden. Konkrete Beispiele untersucht er etwa anhand von Louis Armstrongs Aufnahme “Potato Head Blues” oder dem Mythos Charlie Parkers und der Realität des Bebop.
Er nähert sich der Personalstilistik Thelonious Monks und fragt nach dem Einfluss afrikanischer wie afro-lateinamerikanischer Musik auf den Jazz. Django Reinhardt erhält ein eigenes Kapitel, in dem Franco die Fusion, die dem Gitarristen zwischen Jazz und seinen eigenen Traditionen gelang, in Verbindung bringt zu späteren Projekten etwa von Anouar Brahem oder Rabih Abou-Khalil.
Die Musik Giorgio Gaslinis untersucht er im Hinblick auf die Verwendung von Dodekaphonie in seinen Kompositionen, die Musik Enrico Intras (und Luciano Berios) im Hinblick auf die Verbindungen zur elektroakustischen Musik ihrer Zeit.
In zwei abschließenden Kapiteln beschäftigt er sich dann noch mit Aspekten aktueller Jazzforschung und neuen Ansätzen für eine zeitgemäße Jazzdidaktik.
Francos Aufsätze bieten einen interessanten Einblick in einen Teil der italienischen Forschungsdiskussion (ja, es gibt nationale Unterschiede in den Ansätzen!). Sie sind Argumente in einem wissenschaftlichen Diskurs, was sich zumindest teilweise auch in der Komplexität der Texte niederschlägt. In der Gesamtheit aber ist es allemal eine bunte Mischung unterschiedlicher Ansätze, die zum weiteren Nachdenken anregt.
Wolfram Knauer (September 2013)
Rebelse Ritmes. Hoe jazz & literatuur elkaar vonden
von Matthijs de Ridder
Antwerpen 2012 (De Bezige Bij Antwerpen)
373 Seiten, 19,95 Euro
ISBN: 978-90-8542-315-7
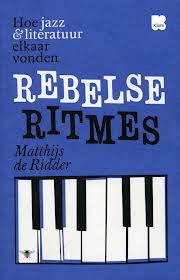 “Rebellische Rhythmen” nennt Matthijs de Ridder sein Buch, das eine Art kulturgeschichtlichen Abriss des Jazz im 20sten Jahrhundert versucht und im Untertitel das Aufzeigen von Parallelen in Jazz und Literatur verspricht.
“Rebellische Rhythmen” nennt Matthijs de Ridder sein Buch, das eine Art kulturgeschichtlichen Abriss des Jazz im 20sten Jahrhundert versucht und im Untertitel das Aufzeigen von Parallelen in Jazz und Literatur verspricht.
De Ridder interessiert sich vor allem für Beispiele aus der Jazzgeschichte, die gesellschaftlichen Wandel reflektieren. Er beginnt mit einem Kapitel über James Reese Europe, der – nomen est omen – den alten Kontinent mit einer neuen Art zu Musizieren konfrontierte. Er nähert sich dem Jazz in verschiedenen europäischen Ländern zwischen den Weltkriegen sowie der Faszination mit dieser Musik in literarischen Zeugnissen nationaler wie internationaler Autoren und betrachtet dabei konkret Belgien, Polen, die Tschechoslowakei, England, Italien, Frankreich, Dänemark und die Niederlande.
Ein Kapitel mit der Überschrift “Black, Brown en Bebop” widmet sich Duke Ellingtons Versuch, schwarze Geschichte in Musik zu fassen, als Einschub aber auch dem dunklen Kapitel der Band Charlie and his Orchestra in Hitler-Deutschland. De Ridder betrachtet Lyrik der 1940er und 1950er Jahre, die den existenzialistischen Geist nach Belgien und in die Niederlande trug. Er schreibt über die 1960er Jahre, als der Jazz auch als ein Symbol für die Bürgerrechtsbewegung gesehen wurde und er gibt Beispiele von Dizzy Gillespie über Charles Mingus, Max Roach bis Archie Shepp (und LeRoi Jones, um wieder zur Literatur zu leiten).
In einem weiteren Kapitel verbindet De Ridder die europäische Free-Jazz-Bewegung und ihre Reflexion in der Literatur der Zeit mit den 68er-Protesten. Er betrachtet die amerikanische Jazzdiplomatie von Louis Armstrong, Dave Brubeck und anderen, die für das amerikanische State Department auf Tournee in Ostblockländer geschickt wurden. Er befasst sich mit dem Protestpotential, das sich in Verbindung von Jazz und Literatur hinter dem Eisernen Vorhang entwickelte, verweist dabei insbesondere auf die Jazzsektion des tschechischen Musikerverbandes in Prag und auf Josef Skvoreckys Roman “Das Basssaxophon”. In den Jahren nach 9/11 ist ihm Gilad Atzmon und seine Vorstellung eines “musikalischen Jihad” ein eigenes Kapitel wert, das ihn bis in die jüngste Gegenwart bringt.
Matthijs de Ridders Buch wirkt im Versuch des Autoren, die gesellschaftliche Relevanz des Jazz nachzuzeichnen und zugleich Verbindungen zur literarischen Reflexion auf Jazz und Gesellschaft aufzuweisen, ein wenig wie “nicht Fisch, nicht Fleisch”. Man vergisst das jeweils andere Thema seitenweise, zumal die Beispiele, die er auswählt, durchaus repräsentativ sind und er sie interessant darstellt, und zwar sowohl die Beispiele aus der Jazzwelt wie auch jene aus der Welt der Literatur, in der neben bekannten Autoren wie Boris Vian, Paul van Ostaijen, Jean Cocteau, Claude McKay auch eine Reihe etwa belgischer oder niederländischer Autoren, die diesem Rezensenten beispielsweise bislang unbekannt waren. Es gibt also durchaus etwas zu entdecken zwischen den rebellischen Rhythmen dieser Buchseiten.
Wolfram Knauer (August 2013)
Mixed Messages. American Jazz Stories
von Peter Vacher
Nottingham 2012 (Five Leaves Publications)
314 Seiten, 14,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1-907869-48-8
 Peter Vacher schreibt seit den 1970er Jahren für britische Jazzmagazine wie Jazz Journal und andere. In “Mixed Messages” hat er einundzwanzig Interviews mit amerikanischen Jazzmusikern zusammengefasst, die teils bekannter, weitgehend aber auch gar nicht so bekannt sind, die meisten von ihnen Musiker der älteren Generation, fast alle tätig im Genre des traditionellen oder des swingenden Mainstream-Jazz.
Peter Vacher schreibt seit den 1970er Jahren für britische Jazzmagazine wie Jazz Journal und andere. In “Mixed Messages” hat er einundzwanzig Interviews mit amerikanischen Jazzmusikern zusammengefasst, die teils bekannter, weitgehend aber auch gar nicht so bekannt sind, die meisten von ihnen Musiker der älteren Generation, fast alle tätig im Genre des traditionellen oder des swingenden Mainstream-Jazz.
Der Posaunist Louis Nelson erzählt über das New Orleans der 1930er und 1940er Jahre; der Bassist Norman Keenan über die Bands von Tiny Bradshaw und Lucky Millinder. Der Trompeter Gerald Wilson spricht über Einflüsse, Arrangementkonzepte und die Szene in Los Angeles, der Trompeter Fip Ricard über Territory Bands und Count Basie.
Ruby Braff äußert sich über Boston, den Jazz im Allgemeinen und Wynton Marsalis; Buster Cooper über seine Zeit mit Lionel Hampton und Duke Ellington. Ellington spielt auch im Interview mit dem Trompeter Bill Berry eine große Rolle, Hampton und Basie wiederum in den Erzählungen des Posaunisten Benny Powell.
Der Saxophonist Plas Johnson erzählt über den “Chitlin’ Circuit”, den er mit Johnny Otis und anderen Bands tourte, der Pianist Ace Carter über die Jazzszene in Cleveland, Ohio. Der Saxophonist Herman Riley berichtet über sein Leben und seine Arbeit in New Orleans und Los Angeles, der Saxophonist Lanny Morgan über seine Arbeit mit Maynard Ferguson.
Der Pianist Ellis Marsalis spricht über die moderne Jazzszene in New Orleans; der Saxophonist Houston Person über Orgel-Saxophon-Combos und seine Zusammenarbeit mit Etta Jones. Der Posaunist Tom Artin erzählt von seinen Erfahrungen auf der traditionellen Jazzszene der USA, der Trompeter von der Toshiko Akiyoshi Big Band und einem Engagement mit Bobby Short.
Der Bassist Rufus Reid nennt J.J. Johnson als role model, der Saxophonist John Stubblefield reflektiert über eine Karriere zwischen Don Byas, Charles Mingus und AACM. Judy Carmichael erzählt, wie sie dazu kam, Stride-Pianistin zu werden, Tardo Hammer über den Einfluss Lennie Tristanos. Der Trompeter Byron Stripling schließlich sagt, was er von Clark Terry lernte, wie es war mit Count Basie zu spielen, und warum die Jazzpädagogik ein wichtiges Instrument sei, das Wissen der großen Jazzmusiker weiterzureichen.
“Mixed Messages” ist eine abwechslungsreiche Sammlung von Erinnerungen an jazzmusikalische Aktivitäten, persönliche Erlebnisse und musikalische Erfahrungen. So “mixed”, wie der Buchtitel impliziert, sind die Botschaften der darin portraitierten Musiker allerdings gar nicht, dafür ist das stilistische Spektrum denn doch zu stark auf Musiker des swingenden Jazz beschränkt. Eine erkenntnisreiche Lektüre aber auf jeden Fall.
Wolfram Knauer (August 2013)
Vinyl. A History of the Analogue Record
von Richard Osborne
Farnham, Surrey 2012 (Ashgate)
213 Seiten, 55 Britische Pfund
ISBN: 978-1-4094-4027-7
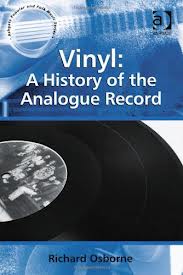 Erst wurde der Schallplatte mit dem Aufkommen der CD der Tod vorausgesagt, dann die CD durch MP3 und Downloads verdrängt. Seltsamerweise aber besteht jenes alte Musikspeichermedium weiterhin fort, und auch in Zeiten digitaler Archivierung resümieren die Experten: digital, okay, aber wir wissen nicht wie lang es hält; eine Schellackplatte dagegen ist erwiesenermaßen auch nach über 100 Jahren noch abspielbar. Richard Osborne widmet seine Studie der Analogschallplatte in jeder Form, denn auch wenn der Titel auf “Vinyl” verweist, schließt seine Darstellung auch die Vorgänger mit ein.
Erst wurde der Schallplatte mit dem Aufkommen der CD der Tod vorausgesagt, dann die CD durch MP3 und Downloads verdrängt. Seltsamerweise aber besteht jenes alte Musikspeichermedium weiterhin fort, und auch in Zeiten digitaler Archivierung resümieren die Experten: digital, okay, aber wir wissen nicht wie lang es hält; eine Schellackplatte dagegen ist erwiesenermaßen auch nach über 100 Jahren noch abspielbar. Richard Osborne widmet seine Studie der Analogschallplatte in jeder Form, denn auch wenn der Titel auf “Vinyl” verweist, schließt seine Darstellung auch die Vorgänger mit ein.
Osborne beginnt mit dem Patent für die Tonaufzeichnung über das Erstellung von Rillen und erklärt die Unterschiede der Erfindungen von Emile Berliner und Thomas Edison. Schon 1905 wurde in französischen Gerichten über das Urheberrecht bezüglich Schallaufzeichnungen gestritten, wobei das Argument dahin ging, dass, was auf Schallplatten an Texten vorhanden war, mit einer Lupe und entsprechender Übung zu lesen sein müsste, und daher das literarische Urheberrecht auch für Tonträger zu gelten habe. Im Kapitel über die Rille (“the groove”) reflektiert Osborne aber auch über Substantiv und Verb (the groove, to groove), über den rhythmischen Drive, der bei der rotierenden Schallplatte auditiv wie visuell wahrgenommen werden könne, über Experimente mit Schallplatten zwischen musique concrète und HipHop sowie über “Tod und den Groove”, die Tatsache also, dass man die Rillen der schwarzen Scheibe auch zu Tode hören könne.
Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit dem Format des Tonträgers Schallplatte zwischen Zylinder und Schellackplatte unterschiedlicher Größe. Es geht um die Labelgestaltung, wobei beim Label genau das gemeint ist, der Aufkleber in der Mitte der beiden Plattenseiten, die anfangs nur reine Information über das auf der Platte Enthaltene weitergab und später mehr und mehr zur Identifikation des “Labels”, also der Plattenfirma, wurde.
In den 1930er Jahren fand der neue Stoff Polyvinylchlorid Eingang in die Plattenindustrie und wurde zum Beispiel für die Produktion von Rundfunksendungen benutzt. Das Material war härter, erlaubte engere Rillen und konnte daher mehr Musik speichern. Anfang der 1940er Jahre wurde Schellack rationiert und daher presste man die legendären V-Discs der Kriegstage auf Vinyl; im Anschluss experimentierte das Label RCA mit Vinylproduktionen auch für kommerzielle Veröffentlichungen. Osborne erklärt ganz allgemein die Produktion von Platten von der Aufnahme bis zum fertigen Produkt, diskutiert die Auswirkungen der Plattenproduktion auf die Haltung der Künstler unterschiedlicher Genres, aber auch Reaktionen des Publikums und Weiterentwicklungen der Industrie.
Ein eigenes Kapitel widmet er dem Phänomen der Langspielplatte. Osborne beschreibt, wie längere Stücke Musik vor dem Zeitalter der LP präsentiert wurden, nennt Beispiele für Langspielplatten vor dem Zeitalter der Microgroove-LPs, die ersten Vinyl-LPs für Columbia und die britische EMI und diskutiert konkrete Beispiele, etwa die Präsentation klassischer Musik oder der Musik von Frank Sinatra auf LP, sowie die Idee des Konzeptalbums im Jazz oder die Probleme und Chancen der “B-Seite”. Neben dem Langspielformat gab es andere Formate, etwa die 45-RPM-Single, die 12-Inch-Single, die Osborne in eigenen Kapiteln behandelt. Schließlich geht er auf die Bedeutung der Covergestaltung für die Schallplatte ein, die weit mehr war als bloß ein Werbeträger, sondern ein Lebensgefühl vermitteln konnte.
Richard Osbornes Buch geht die Geschichte der Schallplatte pragmatisch an, verweist nur dort auf musikalische Genres, wo diese für das Medium oder das Medium für sie von Bedeutung sind. Sein Buch gibt einen brauchbaren Überblick, wirft genügend Fragen auf, beantwortet aber ganz bewusst nicht alle. Natürlich ließen sich das physikalische Aufnahme- und Wiedergabeverfahren noch exakter untersuchen, der gegenseitige Einfluss von Markt und Platte, unterschiedliche Vertriebsstrukturen, der Umgang mit neuen Aufnahmeverfahren, Live versus Studio und vieles mehr an Themen, die hier nur gestreift werden. Osbornes Verdienst ist vor allem sein breiter Ansatz, der Verbindungslinien zwischen Bessie Smith, Hillbilly-Musik, Motown-Sound und HipHop erlaubt und damit die Faszination richtig wiedergibt, die man bis heute in Schallplattenantiquariaten erfahren kann, in denen jede einzelne Scheibe wie eine kraftvolle Aussage wirkt, die im Diskurs der anderen mithalten will und kann. Ein ausführliches Literaturverzeichnis und ein Sach- und Personenindex runden das Buch ab.
Wolfram Knauer (August 2013)
Live at Montreux. Portraits
herausgegeben von Joe Bendinelli Negrone
Hamburg 2012 (Ear Books / Edel)
212 Seiten, 2 DVDs, 29,95 Euro
ISBN: 978-3-943573-00-8
 Claude Nobs gründete das Montreux Jazz Festival 1967 und machte es schnell zu einem der angesehensten Sommerfestivals der Welt. Das gelang ihm nicht nur, weil er mit vielen der Künstler befreundet war, sondern auch, weil er ein gutes Händchen dabei hatte, Plattenfirmen einzubinden, die die Konzerte dokumentierten und den Namen der Veranstaltung in aller Welt bekannt machten.
Claude Nobs gründete das Montreux Jazz Festival 1967 und machte es schnell zu einem der angesehensten Sommerfestivals der Welt. Das gelang ihm nicht nur, weil er mit vielen der Künstler befreundet war, sondern auch, weil er ein gutes Händchen dabei hatte, Plattenfirmen einzubinden, die die Konzerte dokumentierten und den Namen der Veranstaltung in aller Welt bekannt machten.
Auf 2012 Seiten präsentiert das vorliegende Buch Musikerfotos aus all diesen Jahren, in Schwarzweiß genauso wie in Farbe, mit den Musikern meist auf der Bühne, ab und an aber auch abseits der Bühne, vor dem Bandbus etwa (Muddy Waters) oder beim Tennisspielen (Dizzy Gillespie). Je Musiker zwei Seiten, ein Foto und eine knappe biographische Einordnung durch Alex Kandelhardt, das alles ohne erkennbare Ordnung.
Jazzmusiker und Musiker aus Rock, Pop und Soul durcheinander mit klarem Schwergewicht auf den populäreren Stilrichtungen – nicht ganz zu unrecht, hat sich Montreux doch schon lange vom reinen Jazz- zu einem populären …-und-auch-Jazz-Festival gewandelt.
Ein wenig schade ist es aber doch, dass dem Jazz auf den beiheftenden zwei DVDs kaum Tribut gezollt wird, abgesehen von einem Track der Band Weather Report, und weiteren von Nina Simone, George Benson und Quincy Jones. So ist der schwere Prachtband vor allem eine Erinnerung oder ein Coffee-Table-Geschenk an Montreux-Besucher, denen die Genreübergriffe noch nie etwas ausmachten.
Wolfram Knauer (Juli 2013)
Yes to the Mess. Surprising Leadership Lessons from Jazz
von Frank J. Barrett
Boston 2012 (Harvard Business Review Press)
202 Seiten, 27 US-Dollar
ISBN: 978-1-4221-6110-4
 Schon seit einigen Jahren wird Jazzimprovisation auch außerhalb der Musikschulen untersucht, insbesondere im Feld der Organisationswissenschaft, wo Jazz als Modell für besseres Management gehandelt wird. An den Studien beteiligt sind Wissenschaftler und Musiker aus den USA genauso wie aus Europa. Wissenschaftlich wird das Thema meist in Fachzeitschriften und wissenschaftlichen Aufsatzsammlungen abgehandelt, jetzt aber auch in dem eine breitere Leserschaft ansprechenden Buch des “Professor of Management and Global Public Policy” Frank J. Barrett. Der hat auf der einen Seite eine Dissertation über Organisationsverhalten geschrieben, auf der anderen Seite aber auch als Jazzpianist gearbeitet, und zwar nicht nur im Freundeskreis, sondern durchaus mit namhaften Kollegen, etwa als Pianist des Tommy Dorsey [Ghost] Orchestra.
Schon seit einigen Jahren wird Jazzimprovisation auch außerhalb der Musikschulen untersucht, insbesondere im Feld der Organisationswissenschaft, wo Jazz als Modell für besseres Management gehandelt wird. An den Studien beteiligt sind Wissenschaftler und Musiker aus den USA genauso wie aus Europa. Wissenschaftlich wird das Thema meist in Fachzeitschriften und wissenschaftlichen Aufsatzsammlungen abgehandelt, jetzt aber auch in dem eine breitere Leserschaft ansprechenden Buch des “Professor of Management and Global Public Policy” Frank J. Barrett. Der hat auf der einen Seite eine Dissertation über Organisationsverhalten geschrieben, auf der anderen Seite aber auch als Jazzpianist gearbeitet, und zwar nicht nur im Freundeskreis, sondern durchaus mit namhaften Kollegen, etwa als Pianist des Tommy Dorsey [Ghost] Orchestra.
Barrett beginnt mit einem aktuellen Beispiel. Unternehmen, schreibt er, hätten in der Regel Pläne für alles Mögliche, nur richte sich die Realität nicht nach diesen Plänen. Das Umwelt-Disaster von Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im April 2010 sei ein Beispiel dafür, wie alle Pläne bei unerwarteten Ereignissen nicht ausreichten und wie die Erfahrungen des Jazz im Unternehmensmanagement dazu beitragen könne, auf Unvorhergesehenes angemessen und produktiv zu reagieren. Barrett beschreibt das Improvisations-Paradox, dass also Jazzmusiker ihr ganzes Leben lang Phrasen und Patterns lernten, nur um diese nach Möglichkeit vergessen zu können, um auf musikalische Situationen angemessen reagieren zu können. Es sei die erlernte Sicherheit der (musikalischen) Sprache, die ihnen letztlich eine angemessene Reaktion erlaube.
In einem eigenen Kapitel ermutigt Barrett Manager, zum Durcheinander zu stehen, das sich aus der Entwicklung neuer Unternehmenskonzepte zwangsläufig ergebe. Auch hier weisen Jazzmusiker den Weg, erklärt er: Egal wie verworren musikalische Situationen erschienen, gelinge ihnen immer ein positiver Weg hin zu neuen Ufern. Barrett analysiert die verschiedenen Kompetenzen, die Jazzmusiker dazu befähigten, miteinander zu improvisieren und aufeinander zu reagieren und versucht aus seinen Beobachtungen Lehrsätze für die Organisationsforschung abzuleiten.
Ein eigenes Kapitel widmet Barrett der Gleichzeitigkeit von Performance und Experiment, dem Anerkennen von Fehlern als Ursache weiteren Lernens. Zwischenüberschriften wie “Taking Advantage of Errors” oder “Constructive Failure” zeigen dabei beispielhaft, wie er versucht, die Jazzerfahrungen ins Managementverhalten zu übersetzen.
In einem strukturkritischen Kapitel versucht er dem geheimnis auf den grund zu gehen, wie man maximaler Autonomie bei minimalen Strukturen erreichen könne. Er analysiert dabei den Zusammenhang zwischen Autonomie und Gruppendynamik auseinandersetzt und verlangt von Vorgesetzten, ihre Mitarbeiter als Individuen ernst zu nehmen.
“Learning and Hanging Out” heißt ein Kapitel, in dem Barrett Lernmuster analysiert, die er als sozialen Prozess beschreibt und als Investition in die Zukunft von Mitarbeitern genauso wie von Unternehmen. “Solo und Begleitung” überschreibt er ein weiteres Kapitel, in dem es darum geht, dass die Führungsrolle selten einem Einzelnen zustehe, wenn man das meiste aus der versammelten Kompetenz eines Unternehmens herausholen wolle. Zum Schluss des Buchs finden dann noch Merksätze, sozusagen “für die improvisierende Führungskraft”.
Barretts Buch ist auf diejenigen Kollegen im Managementbereich gerichtet, die sich mit Möglichkeiten einer anderen, einer inklusiveren und einer arbeitsteiligeren Unternehmungsführung befassen. Tatsächlich aber kann der Blick von außen, der Blick auf die Kompetenzen des Jazz auch vielen Musikern und Jazzliebhabern die Augen und Ohren öffnen. Barrett verweist auf viele aktuelle Beispielen, aus der Geschichte des Jazz genauso wie aus der Welt der Wirtschaft, und sorgt so für eine sachliche und dabei durchaus auch vergnügliche Lektüre dieses komplexen Themengebiets.
Wolfram Knauer (Juli 2013)
Miles Davis. The complete illustrated history
herausgegebene von Michael Dregni
Zürich 2012 (Edition Olms)
224 Seiten, 35 Euro
ISBN: 978-3-283-01211-3
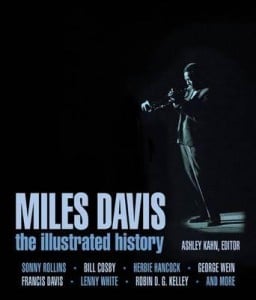 “The complete illustrated history” – der Untertitel des Buchs verrät den Ansatz: eine Mischung aus Biographie, musikalischer Würdigung und Fotoband über eine der schillerndsten Gestalten der Jazzgeschichte. Herausgeber Michael Dregni hat nicht nur namhafte Autoren verpflichtet, unter ihnen Ashley Kahn, Robin D.G. Kelley, Francis Davis, Gerald Early, Greg Tate, sondern darüber hinaus auch Stimmen von Musikerkollegen eingesammelt.
“The complete illustrated history” – der Untertitel des Buchs verrät den Ansatz: eine Mischung aus Biographie, musikalischer Würdigung und Fotoband über eine der schillerndsten Gestalten der Jazzgeschichte. Herausgeber Michael Dregni hat nicht nur namhafte Autoren verpflichtet, unter ihnen Ashley Kahn, Robin D.G. Kelley, Francis Davis, Gerald Early, Greg Tate, sondern darüber hinaus auch Stimmen von Musikerkollegen eingesammelt.
So erzählt Clark Terry etwas über die Musikszene in St. Louis in den 1940er Jahren und die Trompeter-Tradition in der Stadt, aber auch über die Tatsache, das Miles ihn, Clark Terry, immer wieder als einen seiner wichtigen Einflüsse bezeichnet habe. Sonny Rollins verrät, dass er zum ersten Mal 1948 mit Davis gespielt habe. Bill Cosby reflektiert über Miles, die Mode-Ikone. Vincent Bessières erzählt, wie Miles Davis 1949 zum ersten Mal nach Frankreich kam und sich in Paris verliebte. George Wein berichtet von Davis’ Auftritt beim Newport Jazz Festival 1955. Ron Carter und Herbie Hancock unterhalten sich über das Quintett der 1960er Jahre. Lenny White nimmt sich die Fusion-Periode und das Album “Bitches Brew” vor, auf dem er selbst mitwirkte. Nalini Jones schreibt über Miles’ teils agressive Beziehungen zu Frauen; Gerald Early betrachtet den Trompeter als Boxer und “black male hero”. Dave Liebman schließlich hat das Schlusswort, erinnert sich an Miles Tod, an die Trauerfeier.
Neben all diesen erhellenden Texten, die durchaus Neues über den Trompeter berichten, enthält das Buch jede Menge an Fotos, neben bekannten Bildern etliche, die zumindest dieser Rezensent noch nie gesehen hat, neben Fotos von Miles und seinen diversen Bands auch Abbildungen von Programmheften, Plattenlabels und -covern, Konzertanzeigen, Clubinterieurs – das alles in exzellenter Druckqualität. Ein schönes Buch zum Blättern, lesen und natürlich zum Vertiefen, während Aufnahmen des Meisters hört.
(Das einzige Manko des Buchs ist ein eher bibliographisches: Der Herausgeber Michael Dregni wird nur im Kleingedurckten am Ende des Bandes genannt, weder auf Umschlag noch sonstwo im Vortext. Aber das muss Dregni wohl mit den Herausgebern der amerikanischen bzw. britischen Originalausgabe klären; der vorliegende Band ist eine beim Schweizer Verlag Edition Olms gedruckte Lizenzausgabe.)
Wolfram Knauer (Juli 2013)
You’ll Know When You Get There. Herbie Hancock and the Mwandishi Band
von Bob Gluck
Chicago 2012 (University of Chicago Press)
262 Seiten, 37,50 US-Dollar
ISBN: 978-0-226-30004-7
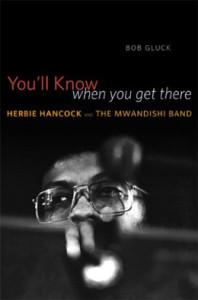 Herbie Hancocks Mwandishi-Band entstand aus seinem Sextett und wurde eine der einflussreichsten Bands, mit der er international von sich Reden machte. Die Bandmitglieder, neben Hancock der Bassist Buster Williams, der Schlagzeuger Billy Hart, der Saxophonist Bennie Maupin, der Posaunist Julian Priester und der Trompeter Eddie Henderson, nahmen alle Swahili-Namen an und formten Hancocks Ästhetik zwischen Bebop, Gospel, Blues, den psychedelischen Klängen zeitgenössischer Pop- und Soulmusik sowie den Klangexplorationen eines Karlheinz Stockhausen und anderer.
Herbie Hancocks Mwandishi-Band entstand aus seinem Sextett und wurde eine der einflussreichsten Bands, mit der er international von sich Reden machte. Die Bandmitglieder, neben Hancock der Bassist Buster Williams, der Schlagzeuger Billy Hart, der Saxophonist Bennie Maupin, der Posaunist Julian Priester und der Trompeter Eddie Henderson, nahmen alle Swahili-Namen an und formten Hancocks Ästhetik zwischen Bebop, Gospel, Blues, den psychedelischen Klängen zeitgenössischer Pop- und Soulmusik sowie den Klangexplorationen eines Karlheinz Stockhausen und anderer.
Bob Gluck erzählt die Geschichte der Band von den ersten bis zu den letzten Konzerten und widmet sich der Musik, die im Studio oder bei Konzerten aufgenommen wurde. Er setzt all das in den musikalischen wie gesellschaftlichen Kontext der Zeit, also Miles Davis, Black Power-Bewegung, Soul-Musik, Studentenbewegung, afrozentrische Symbolik und so weiter und so fort.
Gluck beginnt im November 1970 mit einem Engagement, das das Hancock Sextett im Chicagoer London House wahrnahm und bei dem sich bei ihm und seinen Mitmusikern eine Art spirituelle Wahlverwandtschaft herauskristallisierte, die Musikalisches, Persönliches und Weltanschauliches mit einander verband und ihnen klar machte, dass diese Band Potential hätte.
Im zweiten Kapitel geht Gluck zurück, erzählt Hancocks Lebensgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt, Kindheit, Jugend, erste musikalische Erfahrungen, Einflüsse wie Oscar Peterson, Hardbop oder Gospel, seine ersten Platten unter eigenem Namen, seine Zeit im Miles Davis Quintet, einen ästhetischen Weg zwischen Abstraktion und Emotion. Im nächsten Kapitel schildert er Hancocks Weg in die Selbständigkeit mit seinem ersten Sextett, das sich 1969 gründete, mit dem er bis ins Frühjahr 1970 unterwegs war und in dem er sein Interesse an elektronischen Instrumenten vertiefte. Ein eigenes Kapitel widmet sich genau diesen Soundexperimenten, die Hancock vor allem mit dem E-Piano und später mit Synthesizern vorantrieb. Gluck beschreibt die Verwendung elektrischer Instrumente auf “Bitches Brew”, “Fat Albert Rotunda” und als eine Möglichkeit des Sounddesigns.
Am 31. Juli 1970 wurde Hancocks Band in dem Woolman Rink im New Yorker Central Park gebucht, um als Vorgruppe für die populäre kalifornische Rockband Iron Butterfly zu spielen. Seine Musik erreichte das Publikum, das eigentlich einer ganz anderen Klangästhetik anhing, sicher auch wegen der Elektrifizierung der Instrumente, ihrer ganz anderen Soundästhetik und wegen der Möglichkeit die Lautstärke höher zu drehen. Bald jedenfalls wurde die Band auch auf andere Rockbühnen gebucht, insbesondere San Franciscos Fillmore West. Dann kam das London-House-Engagement, das Gluck bereits im ersten Kapitel seines Buchs beschrieben hatte, und Ende 1970 schließlich die Plattensitzung zum Album “Mwandishi”, dem Gluck ein eigenes Kapitel widmet und dabei nicht nur auf Erinnerungen der beteiligten Musiker zurückgreift, sondern die Musik darüber hinaus kritisch beleuchtet und analysiert. Im Dezember 1971 folgte die LP “Crossing”, für das Gluck den musikalischen Gehalt, aber auch die Technik der Prostproduction analysiert. Hancock brachte hierfür den Elektronikpionier Patrick Gleeson mit ins Boot, der bald ein siebtes Mitglied der Band wurde und Hancock dabei half, Dinge, die zuvor nur als Postproduction möglich waren, auch live umzusetzen, was 1972 schließlich im Album “Sextant” mündete.
Glücks widmet ein eigenes Kapitel der Idee musikalischer Kollektivität und der “open form”. Er stellt dafür die Experimente der Free-Jazz-Pioniere der 1960er Jahre der intuitiven freien Form gegenüber, die Miles Davis in seinen Bands entwickelte und beschreibt, wie Hancock aus beidem sein eigenes Bandkonzept formte. Er beleuchtet konkret die Benutzung von Ostinati, den Zusammenhang zwischen Form und musikalischem Fortschritt, und die Idee von Musik als spiritueller Praxis. Im vorletzten Kapitel geht Gluck auf kritische Stimmen ein, die Hancocks Tourneen der Jahre 1971 bis 1973 begleiteten. Musikalisch ging es weit voran, finanziell aber ließ sich die Band nicht länger halten. 1973 rief sein Management Hancock zu einem dringenden Treffen und erklärte ihm, dass er mit dieser Band nur drauflegte und sein durch Hits wie “Watermelon Man” mühsam Erspartes durchbringe. Eddie Henderson nahm noch zwei LPs unter eigenem Namen auf, bei der die meisten der Mwandishi-Mitglieder mitwirkten. Im Frühjahr 1973 ging die Band ein letztes Mal ins Studio, um den Soundtrack zum Film “The Spook Who Sat by the Door” einzuspielen. Im letzten Kapitel schließlich sammelt Gluck Stimmen von Musikerkollegen wie Bobby McFerrin, Wallace Roney, Billy Childs, Christian McBride, Mitchel Forman, Pat Metheny, Victor Lewis, und Mitgliedern der Band King Crimson , die bezeugen, wie sehr sie ihre Mwandishi-Erfahrungen beeinflusst hätten.
Glucks Buch beleuchtet ein in der Jazzgeschichte wenig behandeltes Kapitel der Fusion aus Jazz und Rock. Ihm gelingen analytische Annäherungen an die Aufnahmen, vor allem aber gelingt ihm ein Blick hinter die Beweggründe einer Band, die ihrer Zeit klanglich weit voraus schien und entsprechenden Einfluss hatte. Er schafft bei seinen Lesern ein Verständnis für die Aufnahmen der Herbie Hancock Mwandishi-Band, die er ins ästhetische und gesellschaftliche Umfeld ihrer Zeit einbettet. Glucks Gespräche mit den Bandmitgliedern vermitteln Insiderwissen, insbesondere in den analytischen Absätzen gerät die Lektüre allerdings stellenweise schon mal recht trocken. Ein ausführlicher und bis ins Detail aufgeschlüsselter Index erlaubt einen schnellen Zugang zu einzelnen Sachverhalten.
Wolfram Knauer (Juni 2013)
Dameronia. The Life and Music of Tadd Dameron
von Paul Combs
Ann Arbor 2012 (University of Michigan Press)
264 Seiten, Hardcover, 50 US-Dollar
ISBN: 978-0-472-11413-9
 Tadd Dameron ist einer der vielleicht am meisten unterbewerteten Musiker des Bebop, Pianist, vor allem aber Komponist und Arrangeur, der von seinen Kollegen hoch geschätzt wurde und dessen harmonische Weiterungen zum Teil bereits in seiner Arbeit für Jimmie Lunceford in den 1930er Jahren zu hören waren. In den 1950er Jahren verschwand er immer wieder von der Szene und starb 1965 im Alter von gerade mal 48 Jahren an den Folgen eines Hirntumors.
Tadd Dameron ist einer der vielleicht am meisten unterbewerteten Musiker des Bebop, Pianist, vor allem aber Komponist und Arrangeur, der von seinen Kollegen hoch geschätzt wurde und dessen harmonische Weiterungen zum Teil bereits in seiner Arbeit für Jimmie Lunceford in den 1930er Jahren zu hören waren. In den 1950er Jahren verschwand er immer wieder von der Szene und starb 1965 im Alter von gerade mal 48 Jahren an den Folgen eines Hirntumors.
Paul Combs widmet sein jüngst erschienenes Buch der Biographie Damerons genauso wie seiner Musik, und ihm gelingt damit ein gar nicht so leichter Spagat: ein Buch nämlich, das in flüssigem Stil sowohl die Lebensgeschichte Damerons erzählt als auch analytische Annäherungen an Damerons Stil enthält, die der Autor, wo nötig, auch mit Notenbeispielen verdeutlicht.
Combs beginnt in Cleveland, Ohio, wo Dameron 1917 zur Welt kam, und er sammelt, was immer er an biographischen Notizen zur Jugend des Pianisten findet. 1935 machte Tadd seinen Schulabschluss und arbeitete anschließend in der Band seines Saxophon spielenden Bruders Caesar und mit anderen vor allem regional aktiven Orchestern. In Interviews gab er meist 1938 als das Jahr an, an dem seine professionell Karriere begann, als er ein erstes Arrangement an die populäre Jeters-Pillars Band verkaufte. Combs hat hier wie an anderen Stellen seines Buchs Schwierigkeiten Fakten zu verifizieren, auch weil Dameron in Interviews voneinander abweichende Abweichungen über seine Karriere machte. 1940 jedenfalls befand Dameron sich in Kansas City und schrieb für Harlan Leonard. Von dessen Band auch stammen die ersten Tondokumente für Damerons Arrangierkunst, “Rock and Ride” und “400 Swing”, für die Combs nicht nur die Platten zur Analyse dienen, sondern beispielsweise auch der Klavierpart, den er im Nachlass der Pianistin Mary Lou Williams entdeckte.
Nach einem Jahr in Kansas City zog es Dameron nach New York, wo ihn Jimmie Lunceford als Arrangeur in sein Orchester holte. Combs beschreibt diverse der Arrangements aus dieser Zeit, aber auch Damerons “Mary Lou” für seine Kollegin aus Kansas City, das er offenbar für Andy Kirk geschrieben haben muss, das aber zu seinen Lebzeiten nie aufgeführt worden war. Bei Lunceford machte sich Dameron einen Namen als interessanter und verlässlicher Arrangeur, und so schrieb er bald schrieb auch für andere Bands, seit 1943 etwa für Count Basie. After hours gehörte er zu den Stammgästen der Bebop-Kneipen seiner Zeit, Minton’s Playhouse etwa oder Monroe’s Uptown House, wo er sich auch ans Klavier traute und enge Freundschaft mit Dizzy Gillespie und anderen Beboppern schloss. In seiner Kapitelüberschrift geht Combs gar so weit, Dameron als “Architekten des Bebop” zu bezeichnen, verfolgt darin dann seine Arbeit etwa für Modernisten wie Gillespie, Billy Eckstine, Georgie Auld, aber auch weitere Charts für Lunceford oder Buddy Rich. Einen größeren Markt erreichten seine Arrangements für Sarah Vaughans Musicraft-Aufnahmen vom Mai 1946. Gillespie ermutigte Dameron zu kompositorischen Experimenten, der Sänger Babs Gonzalez ermutigte ihn, sich mehr als Pianist einzubringen. 1948 spielte er mit Fats Navarro, Dexter Gordon und mit seiner eigenen Band im neuen Royal Roost in New York. Dort trat zur selben Zeit auch Miles Davis mit seiner Capital Band auf, und etwa zur selben Zeit wie Miles’ “Birth of the Cool” spielte auch Dameron Aufnahmen mit einer größeren Besetzung ein.
Mit Miles reiste Dameron 1949 zum ersten Mal nach Paris, um am dortigen Jazzfestival teilzunehmen, wenig später war er für ein paar Monate in London. Zurück in den USA schrieb er Arrangements für Ted Heath und Artie Shaw, verschwand dann in den frühen 1950er Jahren von der Szene, offensichtlich aus Gründen, die mit seinem Drogenkonsum zu tun hatten. Combs findet ihn in Cleveland und Atlantic City, hört Dameron-Arrangements von Bull Moose Jackson und die LP “A Study in Dameronia”, für die der Pianist den jungen Clifford Brown engagiert hatte. 1956 nahm er “Fontainebleau” auf, schrieb Arrangements für Carmen McRae und wurde im April zum ersten Mal wegen Drogenbesitz verhaftet. Die zweite Verhaftung im Januar 1958 führte zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe, die Dameron in Lexington, Lexington, Kentucky, absitzen musste. Nach seiner Entlassung 1961 versuchte er seine Karriere wiederzubeleben und schrieb unter anderem Titel für Benny Goodmans Russland-Tournee. Im Frühsommer 1964 erhielt Dameron die Krebs-Diagnose; gut ein halbes Jahr später starb er kurz nach seinem 48sten Geburtstag.
Combs Buch gelingt die Verbindung von Biographie und Analyse, die den einen oder anderen Rezensenten bereits zur abfälligen Bemerkung verleitete, sein Buch benutze zu viele Fachausdrücke. Tatsächlich aber gibt Combs damit jedem seiner Leser genau das, was er möchte: Über die analytischen Teile kann man nämlich leicht und ohne Informationsverlust springen, kann auf der anderen Seite aber auch einzelne Titel heraussuchen und Combs analytische Einordnungen studieren. Ein ausführlicher Fußnotenapparat und ein ungemein exakt aufgeschlüsseltes Register ergänzen das Buch, das jedem seiner Leser gewiss ein neues und ziemlich umfassendes Bild dieses zu Unrecht oft vergessenen Komponisten gibt.
Wolfram Knauer (Mai 2013)
Wail. The Life of Bud Powell
von Peter Pullman
New York 2012 (Bop Changes)
476 Seiten, 19,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-9851418-1-3
Direktbezug über: www.wailthelifeofbudpowell.com
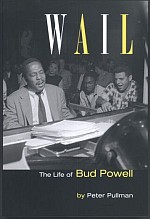 Die Geschichte des Jazz ist die Geschichte seiner Personen – und dabei oft die Geschichte gebrochener Persönlichkeiten. Dies ist weniger dem Fakt geschuldet, dass alle großen Jazzmusiker gebrochene Persönlichkeiten gewesen seien als vielmehr der Tatsache, dass über solche scheinbar weit leichter zu berichten ist als über Musiker ohne Macken, ohne psychische oder Suchtprobleme. Diese Tatsache führt allerdings auch dazu, dass Musiker recht schnell und ohne weiterreichende Recherche in eine Schublade gesteckt wurden, “Junkie”, “Alkoholiker”, “mentale Probleme”.
Die Geschichte des Jazz ist die Geschichte seiner Personen – und dabei oft die Geschichte gebrochener Persönlichkeiten. Dies ist weniger dem Fakt geschuldet, dass alle großen Jazzmusiker gebrochene Persönlichkeiten gewesen seien als vielmehr der Tatsache, dass über solche scheinbar weit leichter zu berichten ist als über Musiker ohne Macken, ohne psychische oder Suchtprobleme. Diese Tatsache führt allerdings auch dazu, dass Musiker recht schnell und ohne weiterreichende Recherche in eine Schublade gesteckt wurden, “Junkie”, “Alkoholiker”, “mentale Probleme”.
Der New Yorker Journalist und Autor Peter Pullman hat sich bereits seit langem mit Bud Powells Leben und Musik befasst, nicht zuletzt im Text des ausführlichen Begleitbüchlein zu einer CD-Ausgabe aller Verve-Einspielungen des Pianisten, das ihm eine Grammy-Nominierung einbrachte. Spätestens dabei biss er sich am Leben und Schaffen des Pianisten fest, ging in Archive, sprach mit Zeitzeugen, durchwühlte die Jazzpresse und veröffentlichte schließlich sein Buch “Wail. The Life of Bud Powell”, das ohne große Umschweife als “definitive” Bud-Powell-Biographie bezeichnet werden muss.
Pullman beginnt mit der Familiengeschichte des Pianisten, mit den Großeltern und Eltern. Er zeichnet deren soziale und Lebenssituation in Petersburg, Virginia, nach, der Region, aus der Powells Eltern kamen, genauso wie jene in Harlem, wo Bud Powell am 27. September 1924 geboren wurde. Buds Vater war selbst Pianist, und Powell bezeichnete ihn des öfteren als den besten Stride-Pianisten in Harlem. Bud nahm Klavierunterricht und trat etwa 1935 erstmals öffentlich auf, wahrscheinlich bei einer jener legendären Rent Parties, und vielleicht mit dem “Carolina Shout” von James P. Johnson, dem ersten Jazzstück, das er eigenen Angaben zufolge gemeistert hatte. Hier und in anderen Harlemer Clubs kam er mit Kollegen wie Willie ‘The Lion’ Smith oder Art Tatum zusammen, hier entwickelte er die Grundlagen eines Stils.
Pullman sieht auf die jungen Musiker, die Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre bei Jam Sessions in Harlem ihre eigenen musikalischen Ideen entwickelten. Wann immer er konnte, nahm Powell an solchen Sessions Teil, spielte daneben Anfang der 1940er Jahre aber auch Tanzmusik mit weniger bekannten Bandleadern. Pullman beschreibt, wie Kenny Clark, Thelonious Monk und andere sich bei Sessions im Minton’s oder im Monroe’s Uptown House mit harmonischen Weiterungen der Jazzsprache beschäftigten, wie Powell und Elmo Hope gemeinsam Bachs Klaviermusik studierten, oder welchen Einfluss insbesondere Monks Ästhetik auf den jungen Pianisten hatte. 1943 wird sein Spiel erstmals in der Fachpresse hervorgehoben; Powell spielte damals erst mit der Band George Treadwells, dann im Orchester des Trompeters Cootie Williams, mit dem er auch seine ersten Platteneinspielungen machte.
Es waren sicher nicht die Frustrationen, die Musiker in solchen Bigbands hatten und die Pullman beschreibt, die zu Powells mentalen Problemen führten. Diese jedenfalls manifestierten sich erstmals Mitte der 1940er Jahre. Im Januar 1945 wurde er für fast drei Monate in die Psychiatrie eingewiesen, mit der Diagnose “Manisch-depressive Psychose, Manischer Typ”. Nach seiner Entlassung spielte der Pianist erst in Dizzy Gillespies Band, bald mit beiden der Heroen des Bebop, Dizzy und Charlie Parker.
Powells Bebop-Karriere sieht ihn mit Kollegen wie Diz, Bird, Dexter Gordon, J.J. Johnson, aber auch mit ersten eigenen Projekten. Wegen seines Anschlags, erzählt Pullman, war Powell auf der 52nd Street als “Hammerfinger” bekannt. Seine Gesundheit aber führte zu dauernden Querschlägen: Nach nur einem Drink, erklärt Pullmann, konnte seine Verfassung ganz plötzlich umkippen. Eines Abends geriet er in einen Kampf und wurde verwundet ins Krankenhaus eingeliefert, das ihn wegen seiner Verhaltensauffälligkeit gleich weiter an die Psychiatrie überwies.
In einem eigenen Kapitel widmet sich Pullmann nun der Krankengeschichte Powells, seines Verhältnisses zum Vater, beschreibt den Kontext, in dem psychiatrische Therapien 1947 durchgeführt wurden, aber die Elektroschocktherapie, der der Pianist im Frühjahr 1948 unterzogen wurde. Erst nach fast einem Jahr wurde Powell wieder in die Obhut seiner Mutter entlassen.
Ende 1948 landete Bud einen längeren Gig im Clique Club (dem späteren Birdland), wo er feststellte, dass er selbst mittlerweile zu einem Einfluss auf andere Pianisten geworden war. Er machte erste Aufnahmen für Blue Note, hatte bald ein längeres Engagement im neuen Birdland, spielte Platten für Norman Granz’ Label Mercury ein. Er vertraute sich einem eigenen Manager an, und damit begann für ihn eine Zeit der musikalischen genauso wie der psychischen Stabilität. Mitte der 1950er Jahre aber gab es auch wieder Rückfälle, Engagements, bei denen Powell Schwierigkeiten hatte, einen Set zu Ende zu bringen. Pullman erklärt die Umstände verschiedener Aufnahme-Sessions und in einem eigenen Kapitel Powells ersten Europa-Besuch, den er 1956 im Rahmen der Tournee “Birdland 56” absolvierte und bei dem er erstmals in Paris, den Niederlanden und Deutschland zu hören war.
Diese Europa-Reise hatte ihn offenbar so beflügelt, dass der Pianist sich wenig später entschloss, für länger nach Paris zu gehen. Pullman beschreibt die Pariser Jazzszene der Zeit zwischen Existenzialismus und Exil-Amerikanern, als Powell ein Dauerengagement im Club Saint-Germain erhielt, zwischendurch aber auch durch Europa tourte. Der Pariser Gig brachte Stabilität ins Leben des Pianisten, erzählt Pullman, schildert daneben etwa eine Begegnung Powells mit Duke Ellington, der gerade in der Stadt weilte, um den Film “Paris Blues” zu drehen, oder ein Treffen Powells und Thelonious Monks, die im selben Konzert auftraten, was zu Konkurrenzängsten insbesondere bei Monk führte. 1962 nahm Powell ein längeres Engagement im Kopenhagener Café Montmartre an, wo er den damals noch minderjährigen Niels Henning Ørsted-Pedersen unter seine Fittiche nahm.
Nach seiner Rückkehr nach Paris ging es wieder bergab. Powell, der immer Personen in seinem Leben brauchte, die sich um ihn kümmern, freundete sich nun mit Francis Paudras an, einem Fan, der sich darum bemühte, dass Powell genug zu essen hatte, dass er möglichst nicht zu viel trank, dass sein Tagesablauf konstant blieb. All das findet sich Jahrzehnte später in Bertrand Taverniers Film “Round Midnight” wieder, in dem Dexter Gordon den Saxophonisten Dale Turner verkörpert, eine Art Komposit aus Powells und Lester Youngs Biographien. Paudras also wurde Powells neuer Vertrauter, mit ihm reiste er im August 1964 für ein Engagement im Birdland zurück nach New York. Die amerikanische Presse berichtete breit über die Rückkehr des Pianisten, und als Paudras einen Monat später am Flughafen auf Powell wartete, die beiden Rückflugtickets in der Hand, wartete er vergebens. Ein neuer Manager sicherte sich die Vertretung des Pianisten, aber Powells Magie schien dahin, seine Konzerte, schildert Pullman, waren für alle Beteiligten teilweise nur noch peinlich. Im Juli 1966 wurde Powell erneut ins Krankenhaus eingeliefert, wenig später fiel er in ein Koma, aus dem er nicht mehr erwachte.
In “Wail. The Life of Bud Powell” gelingt Peter Pullman eine Annäherung an den Menschen, den Pianisten, den Komponisten und den Patienten Bud Powell, die dieses Buch zum Standardwerk über sein Leben und seine Kunst machen dürfte. Pullman hat es im Eigenverlag herausgebracht, was die angesichts des schier erschlagenden Informationsreichtums stellenweise schon recht anstrengende Bleiwüste entschuldigen mag. Man wünschte sich inhaltlich Kapitelüberschriften (statt einfach nur “Kapitel eins, zwei, drei”) und strukturierende Zwischenüberschriften auch innerhalb der Kapitel; man wünschte sich den einen oder anderen das Lesen erleichternden Anhang, etwa eine biographische Timeline oder zumindest eine ansatzweise Diskographie. Dass Pullman gänzlich auf Fotos verzichtet, mag eine Kostenentscheidung gewesen sein. Immerhin erschließt ein ausführlicher Index das Buch. Solch kritische Empfehlungen des Rezensenten allerdings ließen sich in einer etwaigen zukünftigen Neuauflage leicht erfüllen und sind nur Marginalien angesichts der “labor of love”, die Peter Pullman in diese wirklich definitive Bud-Powell-Biographie gesteckt hat.
Wolfram Knauer (Mai 2013)
Jazz unter Ulbricht und Honecker. Mein musikalisches Leben in der DDR
von Frieder W. Bergner
Ottstedt am Berge 2012 (Selbstverlag)
212 Seiten, 18 Euro (inklusive Versand) + CD: 21 Euro (inklusive Versand)
Bezug über www.friederwbergner.de
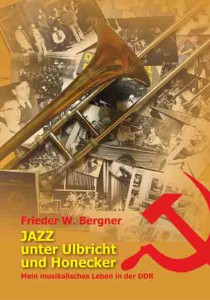 24 Jahre ist die Wende mittlerweile her, und ein paar Bücher haben die Jazz- und Bluesgeschichte der DDR bereits mit mehr oder weniger Abstand dokumentiert. Geschichte aber ist immer eine Schnittmenge der Erinnerung vieler Einzelner, und eine solche Erinnerung ist die des Posaunisten Frieder Bergner, dessen autobiographische Erzählung aus der Subjektivität des Autors heraus die Liebe zum Jazz und seine Musikerkarriere in den Kontext des gesellschaftlichen Alltags einbettet.
24 Jahre ist die Wende mittlerweile her, und ein paar Bücher haben die Jazz- und Bluesgeschichte der DDR bereits mit mehr oder weniger Abstand dokumentiert. Geschichte aber ist immer eine Schnittmenge der Erinnerung vieler Einzelner, und eine solche Erinnerung ist die des Posaunisten Frieder Bergner, dessen autobiographische Erzählung aus der Subjektivität des Autors heraus die Liebe zum Jazz und seine Musikerkarriere in den Kontext des gesellschaftlichen Alltags einbettet.
1954 in Zwickau geboren, zog Bergner 1960 nach Saalfeld, wo sein Vater als Ingenieur an der Herstellung des Zeiss Rechenautomaten mitarbeitete. Er berichtet von schweren Schuljahren und von seinen ersten musikalischen Gehversuchen bei den Thüringer Sängerknaben, mit denen er auf Tournee ging und von Zeit zu Zeit auch große Konzerte gab. Er erhielt Klavier- und Posaunenunterricht, würzt seine Berichte darüber mit Details des real existierenden Sozialismus, mit Geschichten über FDJler, die nach Westen gerichtete Fernsehantennen von den Häusern rissen, über den Besuch eines australischen Brieffreunds, dem bei der Einreise beinahe die drei LPs, die er als Geschenke mitgebracht hatte, abgenommen wurden, oder über seine erste Auslandsreise nach Ungarn. 1972 wurde Bergner an der Musikhochschule Dresden akzeptiert, kurz darauf allerdings bereits zum Wehrdienst einberufen, den er größtenteils als Sanitäter ableistete.
Als er das Studium wieder aufnahm, war er vom Unterricht bei Günter Hörig fasziniert; er erzählt von seiner Arbeit mit Studentenbands und von Musik zwischen modernem Jazz, Avantgarde und Rock ‘n’ Roll. Bergner arbeitete im Rundfunkblasorchester Leipzig, im Orchester Walter Eichenberg, später auch in der Leipziger Radio Big Band und schließlich auch in freien Ensembles, insbesondere im Duo mit dem Schlagzeuger Wolfram Dix. Mit der Hannes Zerbe Blechband reiste er in die Sowjetunion; 1984 zog er nach Weimar, wo er an der Musikhochschule unterrichtete, und spielte Mitte der 1980er Jahre erstmals im Westen Deutschlands in der Begleitband Joy Flemmings. Seine Anekdoten beleuchten das Leben im Osten Deutschlands genauso wie die Neugier auf die vermeintliche Freiheit im Westen. Vor allem beleuchten sie ein politisches System, das sich mehr und mehr selbst ad absurdum führt. Als einer seiner Studenten wegen Republikflucht angeklagt wird, muss Bergner aussagen, und seine Schilderung der Verhandlung und der Vorbereitung zu ihr liest sich wie das eine Fabel über einen untergehenden Staat.
Dem Titel entsprechend endet Bergers Rückschau auf sein Leben vor der Wende 1989 mit dem Ende der DDR. Es ist keine Geschichte des Jazz im Osten Deutschlands, sondern eine sehr persönliche autobiographische Erzählung, bei der Jazz eine genauso wichtige Rolle spielt wie persönliche Erlebnisse, politische Haltung, Freunde, Bekannte, Beziehungen, der Kampf mit dem Alkohol. Was Bergner mit diesem Ansatz gelingt, ist eine lesenswerte Atmosphäreschilderung, die vielleicht noch mehr an Information über das Gefühl eines Lebens in der DDR vermittelt als es nüchtern-sachliche Berichte vermögen würden.
Dem Buch liegt (bei Interesse) ein CD-Sampler mit Aufnahmen Bergners aus den Jahren zwischen 1979 und 2008 und in diversen Besertzungen und stilistischen Ausrichtungen bei.
Wolfram Knauer (Mai 2013)
James P. Johnson. 17 Selected Solos for Piano
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2009 (Blue Black Jazz)
Enthält: “The Harlem Strut”; “Carolina Shout”; “Riffs”; “Feeling Blue”; “Jingles”; “Crying for the Caroline”; “Modernistic”; “If Dreams Come True”; “Mule Walk Stomp”; “A Flat Dream”; “Daintiness Rag”; “I’m Gonna Sit Right Down”; “Keep Off the Grass”; “I’m Crazy ‘Bout My Baby”; “Twilight Rag”; “Jersey Sweet”; “Liza”
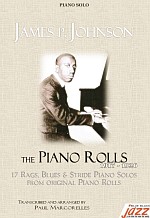 James P. Johnson. The Piano Roles, 1917-1926. 17 Rags, Blues & Stride Piano Solos from Original Piano Rolls
James P. Johnson. The Piano Roles, 1917-1926. 17 Rags, Blues & Stride Piano Solos from Original Piano Rolls
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2011 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Mama’s Blues”; “Caprice Rag”; “Steeplechase Rag”; “Stop It”; “Carolina Shout”; “Eccentricity”; “It Takes Love to Cure the Heart’s Disease”; “Dr. Jazz’s Razz Ma Taz”; “Roumania”; “Arkansas Blues”; “Joe Turner Blues”; “Harlem Strut”; “Railroad Man”; “Black Man”; “Charleston”; “Harlem Choc’late Babies on Parade”; “Sugar”
James P. Johnson, Volume 2. 17 Selected Solos for Piano
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2012 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Bleeding-Hearted Blues”; “You Can’t Do What My Last Man Did”; “Toddlin'”; “Scouting Around”; “Snowy Morning Blues”; “What Is This Thing Called Love”; “Fascination”; “Blueberry Rhyme”; “Squeeze Me”; “Honeysuckle Rose”; “Old Fashioned Love”; “Gut Stomp”; “Concerto Jazz-a-Mine”; “Keep Movin'”; “Arkansas Blues”; “Carolina Balmoral”; “Ain’t Cha Got Music”
Willie The Lion Smith. 16 Original Solos for Piano
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2009 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Concentratin'”; “Sneakaway”; “Echoes of Spring”; “Morning Air”; “Finger Buster”; “Fading Star”; “Rippling Waters”; “Stormy Weather”; “I’ll Follow You”; “Passionette”; “What Is There to Say?”; “Here Comes the Band”; “Cuttin’ Out”; “Portrait of the Duke”; “Zig Zag”; “Contrary Motion”
 Fats Waller, Volume 1. 17 Famous Solos for Piano
Fats Waller, Volume 1. 17 Famous Solos for Piano
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2009 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Blue Black Bottom”; “Numb Fumblin'”; “Love Me or Leave Me”; “Valentine Stomp”; “I’ve Got a Feeling I’m Falling”; “Smashing Thirds”; “Turn on the Heat”; “My Fate Is In Your Hands”; “African Ripples”; “Hallelujah”; “California, Here I Come”; “You’re the Top”; “Because Of Once Upon a Time”; “Faust Waltz”; “Intermezzo”; “Carolina Shout”; “Honeysuckle Rose”
Fats Waller, Volume 2. 17 Solos for Piano
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2009 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Muscle Shoals Blues”; “Birmingham Blues”; “Handful of Keys”; “Baby Oh, Where Can You Be?”; “Sweet Savannah Sue”; “Viper’s Drag”; “Alligator Crawl”; “Keepin’ Out of Mischief Now”; “Tea for Two”; “The London Suite: Piccadilly / Chelsea / Soho / Bond Street / Limehouse / Whitechapel”; “Rockin’ Chair”; “Rind Dem Bells”
Fats Waller, Volume 3. 18 Piano Greats
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2010 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Ain’t Misbehavin'”; “Gladyse”; “Waiting At the End of the Road”; “Goin’ About”; “My Feelings Are Hurt”; “Clothesline Ballet”; “Alligator Crawl”; “‘E’ Flat Blues”; “Zonky”; “Russian Fantasy”; “Basin Street Blues”; “Star Dust”; “I Ain’t Got Nobody”; “Hallelujah”; “St. Louis Blues”; “Then You’ll Remember Me”; “Georgia On My Mind”; “Martinique”
Donald Lambert. 15 Great Solos for Piano
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2009 (Blue Black Jazz)
Enthält: “Anitra’s Dance”; “Pilgrim’s Chorus”; “Sextet”; “Elegie”; “Russian Lullaby”; “People Will Say We Are in Love”; “Hold Your Temper”; “Tea for Two”; “Trolley Song”; “Russian Rag”; “Save Your Sorrow”; “Pork and Beans”; “I’m Just Wild About Harry”; “As Time Goes By”; “Jumps”
Boogie Woogie. 17 Original Boogie-Woogie and Blues Piano Transcriptions
transkribiert von Paul Marcorelles
Toulouse 2011 (Blue Black Jazz)
Enthält: Jimmy Blythe: “Chicago Stomp”; Clarence Pine Top Smith: “Jump Steady Blues”; Jimmy Yancey: “Yancey Stomp”, “The Mellow Blues”, “Yancey Bugle Call”; Albert Ammons: “Boogie Woogie Stomp”, “Suitcase Blues”, “12th Street Rag”, “Mecca Flat Blues”; Meade Lux Lewis: “Yancey Special”, “Honky Tonk Train Blues”; Pete Johnson: “Answer to the Boogie”, “Bottomland Boogie”, “Mr. Freddie Boogie”, “Shuffle Boogie”; Count Basie: “Boogie Woogie”; Mary Lou Williams: “Mary’s Boogie”
Preis je Heft: 44,95 Euro (PDF-Version); 51,95 Euro (gedruckte Version inkl. Versand innerhalb Europas)
Bestellung über: www.blueblackjazz.com
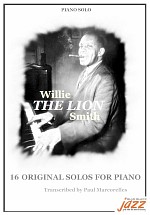 Stride Piano ist vielleicht eine der virtuosesten Spielarten des frühen Klavierjazz. Man spürt die Verankerung des Ragtime genauso wie jenes vorwärtstreibende Moment des Swing, die klaren Bässe und die verzierenden Melodieumspielungen, eine unbändige Lebensfreude, die einen fast unwillkürlich schmunzeln, lächeln, lachen lässt, wenn eine Melodie in seine Bestandteile auseinandergenommen wird, wenn der Pianist plötzlich in jenen typisch-antreibend-swingenden Rhythmus verfällt, wenn Riffs entstehen, linke und rechte Hand miteinander korrespondieren, plötzliche Umkehrungen der Oompah-Figuren der linken Hand einen kurzfristig aus der Bahn werfen, um gleich wieder in die Time zurückzufinden.
Stride Piano ist vielleicht eine der virtuosesten Spielarten des frühen Klavierjazz. Man spürt die Verankerung des Ragtime genauso wie jenes vorwärtstreibende Moment des Swing, die klaren Bässe und die verzierenden Melodieumspielungen, eine unbändige Lebensfreude, die einen fast unwillkürlich schmunzeln, lächeln, lachen lässt, wenn eine Melodie in seine Bestandteile auseinandergenommen wird, wenn der Pianist plötzlich in jenen typisch-antreibend-swingenden Rhythmus verfällt, wenn Riffs entstehen, linke und rechte Hand miteinander korrespondieren, plötzliche Umkehrungen der Oompah-Figuren der linken Hand einen kurzfristig aus der Bahn werfen, um gleich wieder in die Time zurückzufinden.
Paul Marcorelles hat das Stride-Idiom der großen Meister studiert und nun im Selbstverlag eine Reihe an Transkriptionsbänden herausgebracht, die ambitionierte Pianisten eine ganze Weile am Üben halten werden. Drei Bände mit insgesamt 51 Klaviersoli von James P. Johnson (darunter ein Band mit 17 Soli, die Marcorelles von Klavierwalzenaufnahmen abgehört hat), ebenso drei Bände mit insgesamt 52 Soli Fats Wallers, ein Band mit 16 Soli Willie “The Lion” Smiths, ein Band mit 15 Transkriptionen Donald Lamberts sowie ein Band mit 17 klassischen Boogie-Woogie-Titeln halten den Käufer / Spieler für eine Weile am Instrument. Die Klassiker sind dabei, etwa Johnsons “Carolina Shout” sowohl in der Version des Komponisten als auch in einer Fats Wallers, oder Johnsons legendärer “Charleston”, Wallers “Honeysuckle Rose”, “Ain’t Misbehavin'” oder seine komplette “London Suite” von 1938, Willie Smiths “Echoes of Spring” inder Transkription einer Aufnahme von 1965 oder sein seltenes “Contrary Motion”.
Die drei Bände mit Soli von James P. Johnson sind wahrscheinlich “the real thing”. Johnson gilt zu Recht als Vater des Stride; seine Stücke sind Klassiker, und seine Art der Interpretation ist bei aller Virtuosität am kantigsten. Neben frühen Hits wie “Modernistic” oder “If Dreams Come True” enthalten die drei Hefte auch späte Stride-Beispiele aus den 1940er Jahren, Titel, die den direkten Zusammenhang zwischen ihm und Thelonious Monk deutlich werden lassen (etwa seine Interpretation über Gershwins “Liza”). Mit dem “Concerto Jazz-A-Mine” von 1945 ist außerdem eines seiner Werke vertreten, das auf klassische Ambitionen zumindest verweist.
Die drei Waller-Alben enthalten wohl die meisten schon in anderen Transkriptionen oder transkriptions-ähnlichen Arrangements veröffentlichten Titel. “Numb Fumblin'”, “Valentine Stomp”, “Smashing Thirds” oder “African Ripples” erlauben damit (wem’s gefällt) auch einen interessanten Vergleich der Transkriptionsfassungen. Waller ist der Klassiker der hier vertretenen Pianisten: Seine musikalischen Ideen sind auch dort melodisch-harmonisch begründet, wo er in wildes Stride-Spiel ausbricht.
Willie “The Lion” Smith muss als der Lyriker unter den Stride-Pianisten gelten; zugleich ist er einer der späteren Vertreter des Stils wie die Tatsache belegt, dass die Transkriptionen, die Marcorelles vorlegt, aus den Jahren 1938 bis 1965 stammen. Neben Eigenkompositionen sind in diesem Heft auch Standards enthalten wie “Stormy Weather” oder ein emphatisches “What Is There to Say”, außerdem seine Hommage an Duke Ellington, “Portrait of the Duke”.
 Das Buch mit Donald Lamberts Soli enthält unter anderem Interpretationen klassischer Kompositionen wie Edvard Griegs “Anitra’s Dance”, Richard Wagners “Pilgrim’s Chorus” aus “Tannhäuser”, Gaetano Donizettis “Sextet” aus “Lucia di Lammermoor” und Jules Massenets “Elegie”; die von Lambert genommenen Tempi (oft Viertel = 240 und mehr, wie überhaupt die häufigste Tempoangaben in allen neun Heften “Presto” lautet) sind wohl erst nach erheblichen Fingerübungen einzuholen. Lamberts Version von Luckey Roberts “Pork and Beans” zeigt deutlich die Verankerung des Stride im klassischen Ragtime;
Das Buch mit Donald Lamberts Soli enthält unter anderem Interpretationen klassischer Kompositionen wie Edvard Griegs “Anitra’s Dance”, Richard Wagners “Pilgrim’s Chorus” aus “Tannhäuser”, Gaetano Donizettis “Sextet” aus “Lucia di Lammermoor” und Jules Massenets “Elegie”; die von Lambert genommenen Tempi (oft Viertel = 240 und mehr, wie überhaupt die häufigste Tempoangaben in allen neun Heften “Presto” lautet) sind wohl erst nach erheblichen Fingerübungen einzuholen. Lamberts Version von Luckey Roberts “Pork and Beans” zeigt deutlich die Verankerung des Stride im klassischen Ragtime;
Der Boogie-Band schließlich enthält Klassiker des Genres, Interpretationen von Jimmy Blythe, Clarence Pine Top Smith, Jimmy Yancey, Albert Ammons, Meade Lux Lewis (“Honky Tonk Train Blues”), Pete Johnson, Count Basie und Mary Lou Williams. Die typischen Boogiebässe bestimmen das Notenbild, rohe und ungeschliffene Klangausbrüche, energiegeladene Improvisationen und ab und an (insbesondere bei Pete Johnson) Anklänge ans Harlem Stride Piano, das auch die Blueser nicht kalt ließ.
Marcorelles notiert klassisch, was letzten Endes auch bedeutet, dass der Spieler den richtigen Swing selbst empfinden muss. Wie immer bei Transkriptionen lohnt der Vergleich mit der originalen Aufnahme (und hier hätte man sich eine exaktere Identifikation der Platte gewünscht, von der die einzelnen Transkriptionen genommen wurden), aber mit einiger Hörerfahrung wird es gelingen, die Stücke selbst dann zum Treiben zu bringen, wenn man sie zur Einstimmung erheblich langsamer nimmt als in den halsbrecherischen Tempi der Meister.
Transkriptionsfehler sind in diesen Heften kaum zu entdecken; ein Bleistift in der Nähe des Klaviers ist dennoch ganz hilfreich, um etwa Vorzeichenänderungen fortzuschreiben oder einzelne Noten schon mal enharmonisch zur harmonischen Basis passend darzustellen (was dem Rezensenten aber auch nur an ein oder zwei Stellen auffiel). Marcorelles verzichtet auf harmonische Analyse und Harmoniesymbole, also die Motivation zur Weiterimprovisation, aber wer diese Stücke meistert wird wahrscheinlich so in Schwung sein, dass die Hände allein weiterswingen.
Wolfram Knauer (Mai 2013)
Jazz en la BNE. El ruido alegre
von Jorge García
Madrid 2012 (Biblioteca Nacional de Espagna)
238 Seiten, 40 Euro
ISBN: 978-84-92462-24-7
 Jorge García hat die Geschichte des Jazz in Spanien an dem Ort erforscht, der alle Dokumente zur spanischen Geschichte sammelt: der Biblioteca Nacional de Espana in Madrid. Die von ihm kuratierte Ausstellung war in der spanischen Nationalbibliothek zu sehen. Wer sie nicht gesehen hat, kann das alles in diesem wunderschön gestalteten Katalog nachvollziehen, der den Leser zweisprachig (spanisch, englisch) in Wort und Bild durch die Rezeption des afro-amerikanischen Jazz in Spanien führt.
Jorge García hat die Geschichte des Jazz in Spanien an dem Ort erforscht, der alle Dokumente zur spanischen Geschichte sammelt: der Biblioteca Nacional de Espana in Madrid. Die von ihm kuratierte Ausstellung war in der spanischen Nationalbibliothek zu sehen. Wer sie nicht gesehen hat, kann das alles in diesem wunderschön gestalteten Katalog nachvollziehen, der den Leser zweisprachig (spanisch, englisch) in Wort und Bild durch die Rezeption des afro-amerikanischen Jazz in Spanien führt.
García beginnt mit Belegen über Minstrel-Shows, Cakewalk-Künstler, die frühen Modetänze, die noch vor dem I. Weltkrieg in Europa ankamen. Den Begriff “Jazz” selbst weist er zum ersten Mal im Januar 1918 in einer spanischen Zeitung nach, wenn er dort auch – wie anderswo in Europa auch – als Begriff für einen neuen Tanz verwandt wurde. Er findet Dokumente über frühe Musiker wie den Pianisten Billy Arnold, der angeblich Darius Milhauds Faszination am Jazz weckte, und er beleuchtet Musiker wie den Kubaner Ernesto Lecuona, der 1924 in Spanien ankam und großen Erfolg hatte. Als afro-amerikanische Musik eroberte der Jazz mit Tourneen wie denen von Josephine Baker, Louis Douglas oder Harry Fleming das Land. Sam Woodings Besuch im Jahr 1929 und Jack Hyltons Tournee ein Jahr später sind für García die Geburtsstunde eines spanischen Jazz. Nicht nur die Intellektuellen und Künstler des Landes seien damals nämlich von der Musik fasziniert gewesen, sondern auch Musiker, die danach strebten, “hot” zu spielen. Parallel zu ähnlichen Entwicklungen in anderen europäischen Städten gab es in Barcelona seit 1934 einen Hot Club, der unter der Franco-Diktatur aber wieder geschlossen wurde.
García streift die Haltung des faschistischen Regimes zum Jazz, die zu einem Jazzverbot im Rundfunk führte, dass clevere Radiomacher dadurch umgingen, dass sie die Aufnahmen einfach als “moderne Musik” bezeichneten. Er beleuchtet den Nachkriegsjazz mit Zentren insbesondere in Madrid und Barcelona, wo es sowohl eine gute spanische Szene gab als auch regelmäßig amerikanische Musiker zu hören waren. Seit den 1960er Jahren gab es zudem große Festivals wie das in San Sebastián, und Musiker wie Tete Montoliu oder Pedro Iturralde machten sich auch im Ausland einen Namen. Schon damals, mehr aber noch in den 1980er Jahren und später, entdeckten spanische Musiker die Zusammenhänge zwischen Jazz und ihren heimischen Klängen, insbesondere baskischer Volksmusik oder dem Flamenco. García erwähnt noch kurz die neue Generation an Musikern, die ihre Kunst mittlerweile wie anderswo auch an Hochschulen und Universitäten lernen kann.
Diesem knappen Durchgang durch die spanische Jazzgeschichte stehen im Hauptteil des Buchs die Abbildungen von Dokumenten aus der BNE gegenüber, Notenausgaben, Zeitungsausrisse, Programmflyer, Plakate, Cover von Jazzzeitschriften, Platten und CDs, Fotos einheimischer wie zu Besuch befindlicher Musiker, Comicbücher, die sich mit dem Jazz befassen und vieles mehr.
“Jazz en la BNE. El ruido alegre” ist damit ein lesens- genauso wie blätternswertes Buch, ein knapper Abriss spanischer Jazzgeschichte, der Anhaltspunkte gibt, nirgends wirklich die Musik beschreibt, aber durchaus neugierig macht auf das, was da seit 1920 an “fröhlichem Lärm” (so die Übersetzung des Untertitels des Buchs) zu hören war.
Wolfram Knauer (April 2013)
Benny Goodman’s Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert
von Catherine Tackley
New York 2012 (Oxford University Press)
223 Seiten, 17 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-539831-1
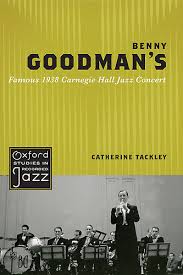 Benny Goodmans Carnegie-Hall-Konzert schrieb Jazzgeschichte, nicht nur, weil Benny Goodman eine der heiligsten Hallen des amerikanischen Musiklebens mit Jazz füllte, nicht nur, weil er bei jenem legendären Konzert am 16. Januar 1938 mit schwarzen wie weißen Musikern auftrat, sondern vor allem, weil die Musik, die an jenem Abend erklang, 1950 auf Langspielplatte herauskam und seither immer wieder veröffentlicht worden ist.
Benny Goodmans Carnegie-Hall-Konzert schrieb Jazzgeschichte, nicht nur, weil Benny Goodman eine der heiligsten Hallen des amerikanischen Musiklebens mit Jazz füllte, nicht nur, weil er bei jenem legendären Konzert am 16. Januar 1938 mit schwarzen wie weißen Musikern auftrat, sondern vor allem, weil die Musik, die an jenem Abend erklang, 1950 auf Langspielplatte herauskam und seither immer wieder veröffentlicht worden ist.
Die britische Musikwissenschaftlerin Catherine Tackley nähert sich der Legende des Carnegie-Konzert-Konzerts von unterschiedlichen Seiten. In einem ersten Abschnitt ihrer Monographie untersucht sie den Kontext, in dem das Konzert stand, die Bedeutung von Konzerten für und die Zusammensetzung des Publikums von Jazz in jenen Jahren, die Idee zum Konzert sowie die Entscheidungen zum Programmablauf.
Ein zweiter Teil des Buchs geht auf die Musik des Abends ein, wobei Tacklei keine Takt-für-Takt-Analyse vorlegen, sondern die Musik in einen Kontext einbetten will. Sie beschreibt die einzelnen Titel, vergleicht sie mit früheren Aufnahmen, verweist auf deutliche Einflüsse oder klar von Goodman verschiedene musikalische Konzepte der Swingära, stellt die Bedeutung des Arrangeurs Fletcher Hendersons für den Bigbandsound Goodmans heraus, fragt nach Konnotationen von Stücken wie “Loch Lomond” oder “Bei mir bist du schoen”. Sie analysiert die “Twenty Years of Jazz”, die der Klarinettist mitten im Konzert Revue passieren lässt, wobei sie besonders die von den Musikern evozierten Klischees von Jazzgeschichte herausstellt. Ähnlich geht sie die Jam Session über “Honeysuckle Rose” an, bei der neben Goodman und einigen seiner Musiker auch Kollegen aus den Bands von Count Basie und Duke Ellington zugegen waren. Schließlich widmet sie sich selbstverständlich noch den Trio- und Quartettteilen des Konzerts. Dieser ganze Abschnitt ihres Buchs arbeitet sowohl mit analytischen Anmerkungen als auch mit Transkriptionen.
Teil 3 ihres Buchs ist überschrieben mit “Representation” und beschäftigt sich mit der Legendenbildung um das Carnegie-Hall-Konzert, mit den diversen Schallplattenveröffentlichungen und ihrer Rezeption sowie mit späteren Versuchen Goodmans (durchaus auch in der Carnegie Hall) an das Konzept und den Erfolg des Konzerts anzuknüpfen
Tackley gelingt es insbesondere im Hauptteil ihres Buchs, ihre Analyse in die Beschreibung des Konzertgeschehens einzupassen. Ihr Text liest sich flüssig und spannend und sei damit nicht nur Goodman- oder Swingfans zur Lektüre empfohlen, sondern darüber hin aus jedem, der sich mit der Jazzgeschichte als einer Geschichte von Legenden befasst.
Wolfram Knauer (April 2013)
Putte Wickman, klarinettist
von Jan Bruér
Göteborg 2012 (Bo Ejeby Förlag)
286 Seiten, beiheftende CD, 250 Schwedische Kronen
ISBN: 978-91-88316-66-0
 Jan Bruér hat mit diesem Buch die definitive Biographie des schwedischen Klarinettisten Putte Wickman vogelegt. Wickmans Karriere begann Anfang der 1940er Jahre; mit 19 wurde er 1943 zum professionellen Musiker. Wickmann spielte Swingmusik mit einem Hang zum Modernen. Während andere europäische Klarinettisten seines Kalibers bald in die USA auswanderten (Åke Hasselgard, Rolf Kühn), blieb Wickman in Schweden. Er spielte Platten meist in kleinen, durchaus an Benny Goodman orientierten Besetzungen ein, erst unter anderen Bandleadern, dann ab Mitte der 1940er Jahre vor allem mit einem Sextett unter eigenem Namen. 1949 traf er beim Pariser Jazzfestival auf Charlie Parker, der seine Stilistik nachhaltig beeinflusste. In den 1950er Jahren wurde er einer der populärsten Jazzmusiker Schwedens und war regelmäßig auch anderswo in Europa zu hören, 1959 sogar bei einem Gedenkkonzert für Sidney Bechet in der New Yorker Carnegie Hall. Ab den 1970er Jahren gehörte Wickman zu den Veteranen des schwedischen Jazz und trat des öfteren mit seinen Mit-Veteranen Bengt Hallberg oder Arne Domnérus auf. 2006 verstarb er im Alter von 81 Jahren.
Jan Bruér hat mit diesem Buch die definitive Biographie des schwedischen Klarinettisten Putte Wickman vogelegt. Wickmans Karriere begann Anfang der 1940er Jahre; mit 19 wurde er 1943 zum professionellen Musiker. Wickmann spielte Swingmusik mit einem Hang zum Modernen. Während andere europäische Klarinettisten seines Kalibers bald in die USA auswanderten (Åke Hasselgard, Rolf Kühn), blieb Wickman in Schweden. Er spielte Platten meist in kleinen, durchaus an Benny Goodman orientierten Besetzungen ein, erst unter anderen Bandleadern, dann ab Mitte der 1940er Jahre vor allem mit einem Sextett unter eigenem Namen. 1949 traf er beim Pariser Jazzfestival auf Charlie Parker, der seine Stilistik nachhaltig beeinflusste. In den 1950er Jahren wurde er einer der populärsten Jazzmusiker Schwedens und war regelmäßig auch anderswo in Europa zu hören, 1959 sogar bei einem Gedenkkonzert für Sidney Bechet in der New Yorker Carnegie Hall. Ab den 1970er Jahren gehörte Wickman zu den Veteranen des schwedischen Jazz und trat des öfteren mit seinen Mit-Veteranen Bengt Hallberg oder Arne Domnérus auf. 2006 verstarb er im Alter von 81 Jahren.
Bruér hat sein Buch in zwei Teilen angelegt: einer klassischen Biographie mit Kommentaren von Zeitzeugen und Kollegen, sowie ausgedehnteren Interviews mit Familienmitgliedern wie Puttes Frau oder seinem Sohn, Mitmusikern sowie Kennern des schwedischen Jazz. Eine Chronologie seines Lebens sowie eine ausführliche Diskographie schließen sich an; ein Namensregister fehlt leider. Als Zugabe enthält das Buch allerdings eine CD, auf der sich Aufnahmen Wickmans aus den Jahren 1945 bis 2005 finden. Dabei sind skurrile Einspielungen wie die “Kivikspolka”, in der Wickmann per Overdub gleich drei Klarinettenstimmen gleichzeitig spielt, Aufnahmen mit Streichquartett, ein Radiomärchen mit Wickman und Lill-Babs, eine Quartettaufnahme mit Bobo Stenson und Palle Danielsson, den Ausschnitt einer Telemann-Komposition, die Wickman 1977 zusammen mit Svend Asmussen einspielte, sowie das Allegro aus Mozarts Klarinettenquintett, ein Duo mit Red Mitchell, der in den 1970er und 1980er Jahren in Schweden lebte, sowie Stücke, in denen Wickman sich freieren Spielweisen oder auch einer gemäßigten Fusion annäherte und anderes mehr.
Diese CD sowie die vielen Abbildungen des Buches mögen auch den des Schwedischen nicht mächtigen Käufer dieses Buchs entschädigen, das Bruér in Zusammenarbeit mit dem Schwedischen Viasarkiv herausgegeben hat und das in überaus ansprechendem Layout gestaltet ist.
Wolfram Knauer (April 2013)
Sugar Free Saxophone. The Life and Music of Jackie McLean
Von Derek Ansell
London 2012 (Northway Publications)
207 Seiten, 18 Britische Pfund
ISBN: 978-9.9557888-6-4
 Jackie McLean gehört zu den großen Hard-Bop-Saxophonisten, und Derek Ansell schickt sich in seinem Buch an, ihm ein Denkmal zu setzen. Ansell beginnt mit jener Anekdote aus dem Jahr 1949, als McLeans Mutter ihrem Sohn sagte, ein gewisser Charlie Parker habe angerufen und ihn gebeten, am Abend in einem blauen Anzug in den Chateau Gardens zu gehen und für ihn einzuspringen. Das Publikum sei ein wenig enttäuscht gewesen, als Art Blakey ansagte, dass Parker leider erst später käme und dieser junge Mann so lange spiele, aber dann habe er alles gegeben in einem Repertoire, das typischer Bird war. Und schließlich sei Parker doch noch gekommen, habe ihn ermutigt, auf der Bühne zu bleiben. Sie hätten ein paar Chorusse zusammen geblasen und nach dem Gig habe Parker ihm 15 Dollar in die Hand gedrückt.
Jackie McLean gehört zu den großen Hard-Bop-Saxophonisten, und Derek Ansell schickt sich in seinem Buch an, ihm ein Denkmal zu setzen. Ansell beginnt mit jener Anekdote aus dem Jahr 1949, als McLeans Mutter ihrem Sohn sagte, ein gewisser Charlie Parker habe angerufen und ihn gebeten, am Abend in einem blauen Anzug in den Chateau Gardens zu gehen und für ihn einzuspringen. Das Publikum sei ein wenig enttäuscht gewesen, als Art Blakey ansagte, dass Parker leider erst später käme und dieser junge Mann so lange spiele, aber dann habe er alles gegeben in einem Repertoire, das typischer Bird war. Und schließlich sei Parker doch noch gekommen, habe ihn ermutigt, auf der Bühne zu bleiben. Sie hätten ein paar Chorusse zusammen geblasen und nach dem Gig habe Parker ihm 15 Dollar in die Hand gedrückt.
Vom Meister abgesegnet, mit Bird oft genug verglichen und doch ein ganz eigener Stil – Jackie McLean nannte sich selbst gern mit Bezug auf seinen klaren, harten Ansatz den “sugar free saxophonist”. Ansell begleitet ihn in diesem Buch vor allem durch seine Plattenaufnahmen und einige dunkle Kapitel seines Lebens. Seine erste Plattensession hatte McLean mit Miles Davis, und kein geringerer als sein Vorbild Charlie Parker saß im Kontrollraum. Ansell berichtet über die Beziehung zwischen den beiden Saxophonisten, die nicht nur in Musik bestand, sondern auch in der Tatsache, dass Parker sich regelmäßig Geld oder auch das Instrument von seinem jüngeren Kollegen lieh.
Nach Parkers Tod begann McLeans Karriere erst richtig. Er ging mit Miles ins Studio, nahm eigene Platten auf, erst für Prestige, dann für Blue Note. Ansell beschreibt das Leben eines Jazzmusikers in den Mitt1950er Jahren und spart auch McLeans Suchtprobleme nicht aus – seine Heroinsucht hatte dazu geführt, dass er bald keine Cabaret Card mehr besaß, ohne die er in New Yorker Clubs nicht auftreten konnte. Fürs Theater galten solche Regeln allerdings nicht, und so war es ein Glück für ihn, dass er 1959 für Jack Gelbers Theaterstück “The Connection” engagiert wurde, für das eine komplette Band auf der Bühne mitwirkte. In den 1960er Jahren hörte McLean sehr bewusst auch auf einige der Neutöner des Jazz, nahm sogar eine Platte zusammen mit Ornette Coleman (an der Trompete) auf; seine eigene Musik aber blieb bei aller Freiheit doch immer dem Blues verbunden.
In den 1960er Jahren begann er außerdem eine Art zweite Karriere als Lehrer, erst in Community-Kulturprogrammen, später an Universitäten und bei Workshops. 1968 erhielt er einen Lehrauftrag an der University of Hartford und wurde zwei Jahre später reguläres Mitglied des Lehrkörpers. Er tourte in Europa und war insbesondere in Japan ein großer Star, wurde aber auch in den USA geehrt, 20902 etwa als Jazz Master des National Endowment for the Arts.
Ansell verfolgt McLeans Wirken bis zu seinem Tod im März 2006; tatsächlich aber ist sein Buch weniger Biographie als Schaffensgeschichte. Er berichtet über die Umstände der Plattensessions und ordnet sie in den Kontext des Jazzgeschehens der jeweiligen Zeit ein. Für McLean-Fans ist das Buch damit ganz sicher ein Muss; es beleuchtet ein Teilkapitel des Hardbop und insbesondere auch den ästhetischen Wandel zwischen Hard Bop und Free Jazz. Neues erfährt man dabei wenig, aber als Information über einen einflussreichen Saxophonisten ist die Lektüre auf jeden Fall zu empfehlen.
Wolfram Knauer (April 2013)
Tracking Jazz – The Ulster Way
von Brian Dempster
Antrim/Northern Ireland 2012 (Shanway Press)
216 Seiten, 18,50 Britische Pfund
ISBN: 978-0-9571006-1-9
 Für den 25. April 1925 dokumentiert Brian Dempster in der Glenarm Orange Hall in Glennarm Village den ersten Jazzevent in der nordirischen Provinz Ulster, eine Veranstaltung, bei der die braven Bürger der Stadt den “Belgium Burl” tanzten, wohl eine Version des American One-Step, begleitet von der jungen Glenarm Jazz Band. Vier Jahre später habe das Noble Sissle Orchestra im Empire Theatre in Belfast gespielt und gleich danach der Jazz in Nordirland zu blühen begonnen, schreibt Dempster.
Für den 25. April 1925 dokumentiert Brian Dempster in der Glenarm Orange Hall in Glennarm Village den ersten Jazzevent in der nordirischen Provinz Ulster, eine Veranstaltung, bei der die braven Bürger der Stadt den “Belgium Burl” tanzten, wohl eine Version des American One-Step, begleitet von der jungen Glenarm Jazz Band. Vier Jahre später habe das Noble Sissle Orchestra im Empire Theatre in Belfast gespielt und gleich danach der Jazz in Nordirland zu blühen begonnen, schreibt Dempster.
Die eigentliche Hochphase des Jazz in Irland aber begann seinem großformatigen und reich bebilderten Buch zufolge während des II. Weltkriegs, als die USA wichtige Stützpunkte in Belfast und Londonderry einrichteten. Dempster schildert die Karriere des Trompeters Ken Smiley und den Einfluss britischer New-Orleans- oder Trad-Jazz-Musiker wie Ken Colyer oder Acker Bilk. Die Sängerin Ottilie Patterson erhält ein eigenes Kapitel, genauso wie etliche lokale Bands und Musiker. In den 1950er Jahren gründete sich am Campbell College die Band Belmont Swing College, benannt nach dem Vorbild der Dutch Swing College Band. Dempster zählt die verschiedenen Orte auf, an denen Jazz in Belfast und drum herum zu hören war und geizt nicht mit Anekdoten. Die 1960er Jahren brachten den Aufstieg von Rock & Roll, zugleich aber auch eine Konzertreihe in der Whitla Hall, bei der neben den traditionellen Bands, die im Fokus dieses Buchs stehen, auch amerikanische Künstler aus dem Bereich des Mainstream und des modernen Jazz auf- oder – wie im Fall von Stan Getz, der sich 1966 kurz vor dem Konzert unwohl fühlte – auch schon mal nicht auftraten.
Dempster sammelt die Erinnerungen vieler (Amateur-)Musiker der Szene, des Klarinettisten Trevor Foster etwa oder des Bassisten David Smith; er erzählt die Geschichte der Belfast Jazz Society, und er erwähnt zumindest am Rande auch einige der politischen Probleme, die in jenen Jahren das tägliche Leben in Nordirland bestimmten. Im großen und ganzen bleibt sein Buch dabei ein Erinnerungsalbum mit vielen Fotos der beteiligten Mitspieler, einem durch die Seiten deutlich alternden Personal.
Ein ausführlicher Personenindex schließt das Buch ab, das sicher vor allem für Leser mit regionalen Vorlieben für Interesse ist.
Wolfram Knauer (April 2013)
Lonesome Roads and Streets of Dreams. Place, Mobility, and Race in Jazz of the 1930s and ’40s
von Andrew S. Berish
Chicago 2012 (University of Chicago Press)
313 Seiten, 30 US-Dollar
ISBN: 978-0-226-04495-8
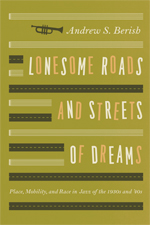 Phil Woods soll sich einmal folgendes Workshop-Setup gewünscht haben: Setzt die Teilnehmer in einen Bus, lasst sie vier Stunden lang fahren, zwei Stunden spielen, vier Stunden fahren, zwei Stunden spielen usw. Die Reisetätigkeit von Musikern ist heute erheblich leichter als früher, aber immer noch nimmt die Anreise zum Konzert in der Regel ein Vielfaches der Zeit ein, die der Musiker beim Konzert verbringt. Andrew S. Berish befasst sich in seinem Buch mit der Mobilität von Jazzmusikern in den 1930er und 1940er Jahren, als der Jazz eine Popmusik und One-Nighter-Tourneen an der Tagesordnung waren. Die Bands der Zeit waren auf Autos, Busse, in Ausnahmefällen auf Züge angewiesen, um enorme Strecken im Flächenland USA zurückzulegen. Ihre Fortbewegung fand dazu in einem Land statt, dessen soziale Struktur sich mit dem Reisen quasi veränderte, etwa durch die Rassentrennungsgesetze der Südstaaten. Sie durchreisten Landschaftsräume und soziale Räume, schufen in ihrer Musik aber auch ihre ganz eigenen Räume, in denen sie quasi die bessere aller Welten repräsentieren konnten, für sich genauso wie für ihr Publikum. Berish zeigt in vier konkreten Beispielen, wie Jazzmusikern ein solches Schaffen neuer Räume in den 1930er und 1940er Jahren gelang.
Phil Woods soll sich einmal folgendes Workshop-Setup gewünscht haben: Setzt die Teilnehmer in einen Bus, lasst sie vier Stunden lang fahren, zwei Stunden spielen, vier Stunden fahren, zwei Stunden spielen usw. Die Reisetätigkeit von Musikern ist heute erheblich leichter als früher, aber immer noch nimmt die Anreise zum Konzert in der Regel ein Vielfaches der Zeit ein, die der Musiker beim Konzert verbringt. Andrew S. Berish befasst sich in seinem Buch mit der Mobilität von Jazzmusikern in den 1930er und 1940er Jahren, als der Jazz eine Popmusik und One-Nighter-Tourneen an der Tagesordnung waren. Die Bands der Zeit waren auf Autos, Busse, in Ausnahmefällen auf Züge angewiesen, um enorme Strecken im Flächenland USA zurückzulegen. Ihre Fortbewegung fand dazu in einem Land statt, dessen soziale Struktur sich mit dem Reisen quasi veränderte, etwa durch die Rassentrennungsgesetze der Südstaaten. Sie durchreisten Landschaftsräume und soziale Räume, schufen in ihrer Musik aber auch ihre ganz eigenen Räume, in denen sie quasi die bessere aller Welten repräsentieren konnten, für sich genauso wie für ihr Publikum. Berish zeigt in vier konkreten Beispielen, wie Jazzmusikern ein solches Schaffen neuer Räume in den 1930er und 1940er Jahren gelang.
Im ersten Kapitel betrachtet der Autor dazu die Band des weißen Sweet-Bandleaders Jan Garber, der damals jeden Sommer im südkalifornischen Casino Ballroom spielte und übers Radio im ganzen Land zu hören war. Er beschreibt Garbers Musik – und hier insbesondere das Stück “Avalon” – als Teil eines Strebens, die Grenzen amerikanischer Raumvorstellungen gegen die Gefahr der Modernisierung mit ihrer Zergliederung und Demokratisierung zu verteidigen.
Im zweiten Kapitel beschäftigt er sich mit der Band Charlie Barnets, dessen musikalische Entwicklung von Sweet- in Hot-Band zugleich eine Entwicklung (oder “soziale Reise”, wie Berish sie nennt) von weißen zu schwarzen ästhetischen Idealen bezeichnete und betrachtet dazu insbesondere seine beiden Aufnahmen “Pompton Turnpike” und “Drop Me Off in Harlem”.
Im dritten Kapitel wendet er sich dem Orchester Duke Ellingtons zu, der wohl am meisten umherreisenden Band jener Zeit, die in ihrem Programm sehr bewusst mit Anspielungen an Orte arbeitete, bekannte Orte (Harlem) genauso wie exotische Orte (jungle style). Ellingtons Konzept von Ort suggeriere seinem Publikum, schlussfolgert Berish, dass andere Orte und Erfahrungen nicht nur möglich seien, sondern dass, mehr noch, alle Orte der Rekonstruktion offen stünden. Das Ellington-Kapitel widmet sich insbesondere Ellingtons “Air-Conditioned Jungle” sowie seiner “Deep South Suite”.
Im vierten Kapitel greift Berish sich den Gitarristen Charlie Christian heraus, der Einflüsse aus konkret zuordenbaren regionalen Jazzstilen aufgriff – Country Blues, Western Swing, Hillbilly, Kansas City –, und diese in Harlem in den modernen Jazz der Zeit, den Bebop überführte. Christians solistischer Ansatz, schreibt Berish, machte aus den fragmentierten geographischen Erfahrungen seines Lebens etwas Neues, einen musikalischen Ort, der integriert war, enorm mobil und in seiner ganzen Ausrichtung national. Seine musikalischen Anhaltspunkte in diesem Kapitel sind Christians Aufnahmen über “Flyin’ Home”, “Stompin’ at the Savoy” und “Solo Flight”.
Das Schlusskapitel greift eine neue Art des Reisens auf, das Fliegen. Hier nimmt Berish sich Jimmie Luncefords Aufnahme “Stratosphere” heraus, um die Faszination mit dem Fliegen als eine Hoffnung zu beschreiben, neue Formen von Beweglichkeit könnten auch die sozialen Barrieren der Zeit durchbrechen.
Berishs Ansatz in diesem Buch erlaubt einen sehr anderen Blick auf die von ihm behandelten Musiker, verbindet vor allem sehr geschickt Jazz- mit Kultur- und Sozialgeschichte und zeigt dabei in einem klugen und zugleich äußerst lesbaren Stil, wie sich anhand der Musik weit größere gesellschaftliche Erfahrungen darstellen lassen, die im Jazz ihren Widerhall gefunden haben.
Wolfram Knauer (April 2013)
Edinburgh Jazz Enlightenment. The Story of Edinburgh Traditional Jazz
von Graham Blamire
Petersborough/England 2012 (Fastprint Publishing)
596 Seiten, 16,99 Britische Pfund
ISBN: 978-178035-290-9
 Lokale Jazzgeschichten lassen sich von vielen Städten schreiben; ein 600-seitiges Buch über den Jazz einer Stadt mit nur mit einer Stilrichtung zu füllen, scheint dagegen schon weitaus schwieriger. Graham Blamire, selbst über lange Jahre Bassist in traditionellen Bands in Edinburgh, hat sich mit seinem Buch daran gemacht, genau dies zu tun, nämlich die Geschichte des traditionellen Jazz in Edinburgh zu erzählen.
Lokale Jazzgeschichten lassen sich von vielen Städten schreiben; ein 600-seitiges Buch über den Jazz einer Stadt mit nur mit einer Stilrichtung zu füllen, scheint dagegen schon weitaus schwieriger. Graham Blamire, selbst über lange Jahre Bassist in traditionellen Bands in Edinburgh, hat sich mit seinem Buch daran gemacht, genau dies zu tun, nämlich die Geschichte des traditionellen Jazz in Edinburgh zu erzählen.
Die großen Namen des britischen Trad Jazz tauchen dabei immer wieder auf, wobei Blamire versucht, zu zeigen, dass dieser sich nicht auf London beschränkte, sondern die Faszination mit älteren Stilen auch anderswo in Großbritannien eine lebendige Szene hervorbrachte. In einem seiner Eingangskapitel erklärt Blamire darüber hinaus seine Begrifflichkeit, unterscheidet zwischen “classic jazz” und “purist jazz”, benutzt den Terminus “traditional jazz” for alles bis zur Swingmusik und erklärt sein Unwohlsein beim begriff “contemporary jazz”.
Die dramatis personae seines Buchs sind in der traditionellen Jazzszene teils auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Blamire verfolgt ihre Aktivitäten, nennt Bandbesetzungen, Konzert- und Festivaldaten, erzählt Geschichten von Clubs und besonderen Ereignissen. Für den Außenstehenden mag das alles ein wenig schwer verdaulich sein; für diejenigen, die dabei waren, bietet es sicher eine gute Erinnerungsstütze. Auf Kontakte zu den moderneren Musikern geht Blamire fast gar nicht mehr ein in seinem Buch, diskutiert auch nicht weiter das ästhetische Selbstverständnis des von ihm gewählten Stils, und beklagt höchstens zum Schluss, dass es dem traditionellen Jazz (und damit meint er dann doch fast ausschließlich das, was allgemein mit Trad Jazz beschrieben wird) an Nachwuchs mangele.
Als Anhang findet sich eine Diskographie von Aufnahmen der im Buch genannten Musiker und Bands. Ein Index, der gerade für solch eine Regionalgeschichte sehr sinnvoll wäre, ist leider nicht vorhanden (kann aber auf Nachfrage vom Autor per Mail bezogen werden).
Wolfram Knauer (März 2013)
Keystone Korner. Portrait of a Jazz Club
herausgegeben von Sascha Feinstein & Kathy Sloane
Bloomington 2012 (Indiana University Press)
224 Seiten, 1 CD, 40 US-Dollar
ISBN: 978-0-253-35691-8
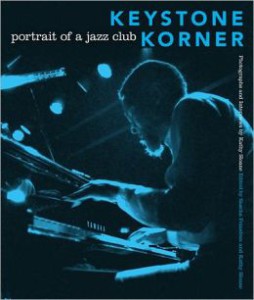 “Keystone Korner” hieß San Franciscos angesagtester Jazzclub der 1970er Jahre. Ale Großen des Jazz spielten dort, von Dexter Gordon bis zum Art Ensemble of Chicago, von Bill Evans über Rahsaan Roland Kirk, Charles Mingus bis zu Anthony Braxton.
“Keystone Korner” hieß San Franciscos angesagtester Jazzclub der 1970er Jahre. Ale Großen des Jazz spielten dort, von Dexter Gordon bis zum Art Ensemble of Chicago, von Bill Evans über Rahsaan Roland Kirk, Charles Mingus bis zu Anthony Braxton.
Die Fotografin Kathy Sloane war dort und hielt die Abende mit den Künstlern fest. Ihre Fotos zeigen Bühnengeschehen genauso wie Clubatmosphäre, Musiker, Publikum, Backstage-Bereich, Plakate, Handzettel und vieles mehr.
Darum herum hat Sascha Feinstein Aussagen mit dem Club Assoziierten gesammelt, Todd Baran an erster Stelle, dem Gründer und langjährigen Inhaber des Clubs, mit dem Koch, einer Kellnerin, den Tontechniker, mit Musikern wie Carl Burnett, George Cables, Billy Harper, Eddie Henderson, Calvin Keys, David Liebman, Eddie Marshall, Ronnie Matthews, Bob Stewart, Steve Turre und David Williams, sowie mit Künstlern und anderen regelmäßigen Besuchern, für die das Keystone Korner Teil ihres Lebens in der Bay Area war. Sie berichten vom Cluballtag, von zwischenmenschlichen Problemen und künstlerischen Höhepunkten, erzählen jede Menge Anekdoten.
Das Keystone Korner schloss 1983 aus finanziellen Gründen seine Pforten. Todd Barkan zog nach New York und machte bis zum letzten Jahre das Programm im Dizzy’s Club Coca Cola. Heute organisiert er eine “Keystone Korner Night” im New Yorker Iridium Club.
“Keystone Korner. Portrait of a Jazz Club” bebildert liebevoll die Erinnerung an eine Zeit, in der Musiker nicht nur in New York die Möglichkeit hatten, ein- oder mehrwöchige Engagements zu spielen. Die beiheftende CD enthält acht Tracks von Rahsaan Roland Kirk, McCoy Tyner, Woody Shaw, Dexter Gordon, Bill Evans, Stan Getz, Cedar Walton und Art Blakey, alle zwischen 1973 und 1982 live aufgenommen im Keystone Korner. Alle Titel sind bereits veröffentlicht; hier sind also keine Neuentdeckungen zu machen. Einen guten Höreindruck aber geben die Stücke allemal in die Atmosphäre eines legendären Clubs im San Francisco der 1970er Jahre.
Wolfram Knauer (März 2013)
Swingtime in Deutschland
von Stephan Wuthe
Berlin 2012 (Transit)
144 Seiten, 16,80 Euro
ISBN: 978-3-88747-271-9
 Die Jazzrezeption in Europa war nie so eindeutig, wie man es meinen möchte. Jazz wurde immer mit all seinen Konnotationen wahrgenommen: seiner afro-amerikanischen Herkunft, seiner emotionalen Kraft, dem Tanz. Die Musik war oft genug nur Vehikel, um all das andere zu transportieren, das die Menschen am Jazz faszinierte.
Die Jazzrezeption in Europa war nie so eindeutig, wie man es meinen möchte. Jazz wurde immer mit all seinen Konnotationen wahrgenommen: seiner afro-amerikanischen Herkunft, seiner emotionalen Kraft, dem Tanz. Die Musik war oft genug nur Vehikel, um all das andere zu transportieren, das die Menschen am Jazz faszinierte.
Stephan Wuthe hat ein Buch über die Swingbegeisterung in Deutschland geschrieben, und natürlich handelt sein Buch auch von einer Zeit, in der Jazz nicht systemkonform war, ja offiziell sanktioniert wurde. Mehr als die Verfolgung von Jazz und Jazzliebhabern aber interessieren ihn all die Elemente, die Fans in den 1930er Jahren an diese Musik banden. Er beschreibt die Szene in den Großstädten (und hier vor allem in Berlin), den Plattenmarkt, frühe Sammelleidenschaft unter den Fans, die Lokale, in denen die Musik zu hören (und nach ihr zu tanzen) war. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Erfolg amerikanischer Musikfilme nach 1933 und verweist auf das Echo auf die Hits dieser Filme in deutschen Kapellen. Vor allem aber betrachtet Wuthe den Swing als ein Tanzphänomen, beschreibt Modetänze und ihren Erfolg beim Publikum. “Verdunklungsschlager” nennt er Aufnahmen der frühen 1940er Jahre, die auf den Kriegsalltag der Menschen eingingen, nennt auch die Propagandaaufnahmen von Charlie and His Orchestra und ähnliche Aktivitäten, die in die andere Richtung, also auf Deutschland, gerichtet waren. In seinen letzten Kapiteln geht Wuthe dann noch schnell auf Swingtanzaktivitäten nach dem Krieg ein, in den 1940er und 1950er und dann erst wieder seit den 1990er Jahren.
Wuthes Buch ist reich und interessant bebildert und gerade in seinem Ansatz, nämlich das Drumherum zu beschreiben, eine vergnügliche Lektüre. Allzu kritische Distanz, eine musikalische Einordnung des Gehörten oder eine historisch genaue Aufarbeitung der Jahre, die den Hauptteil des Buchs umfassen, also 1933-1945, sollte man nicht erwarten – das ist auch nicht das Ziel des Autors. Liebevoll aufgemacht ist sein Buch eher ein ideales Geschenk für den Swingverrückten und Fan der deutschen Tanzmusik.
Wolfram Knauer (März 2013)
The Last Balladeer. The Johnny Hartman Story
von Gregg Akkerman
Lanham/MD 2012 (Scarecrow Press)
367 Seiten, 34,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8281-2
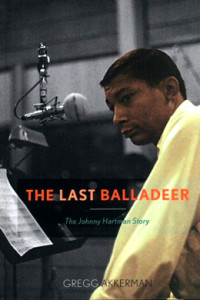 Vielen Jazzfreunden ist Johnny Hartman durch ein einziges Album bekannt, seine Zusammenarbeit mit John Coltrane nämlich von 1963. Als Gregg Akkerman vor wenigen Jahren mehr über den Sänger wissen wollte, suchte er nach einer Biographie und stellte fest, dass es eine solche nicht gab. Also sammelte er Dokumente über Hartman und die Welt, in der er lebte und wirkte, sprach mit Zeitzeugen und schrieb das Buch einfach selbst.
Vielen Jazzfreunden ist Johnny Hartman durch ein einziges Album bekannt, seine Zusammenarbeit mit John Coltrane nämlich von 1963. Als Gregg Akkerman vor wenigen Jahren mehr über den Sänger wissen wollte, suchte er nach einer Biographie und stellte fest, dass es eine solche nicht gab. Also sammelte er Dokumente über Hartman und die Welt, in der er lebte und wirkte, sprach mit Zeitzeugen und schrieb das Buch einfach selbst.
Das erste Kapitel seiner Biographie erzählt von Hartmans Jugend in Chicago, seiner Schulzeit in der DuSable High School, in der er Musikunterricht beim legendären “Captain Dyett” erhielt. 1943 wurde der 19jährige zur Armee eingezogen und bald als Sänger der Bigband der Special Services zugeordnet, mit der er bis zu seiner Entlassung im März 1946 aktiv war. Im August desselben Jahres hatte er ein Engagement im Chicagoer El Grotto Nightclub und wurde von der Presse seiner Stimme und seiner Ausstrahlung wegen als “Bronze Sinatra” gefeiert. 1947 engagierte ihn Earl Hines – Hines war auf den sonoren Balladensänger abonniert, seit Billy Eckstine diese Rolle in seiner Bigband populär gemacht hatte. Hines gab sein Orchester auf, als er Teil der Louis Armstrong All Stars wurde; im Juli 1948 sang Hartman dann mit Dizzy Gillespie, den ebenfalls die Stimmähnlichkeit zu Billy Eckstine, Dizzys früheren Chef, beeindruckt haben mag. Akkerman hört sich Studioaufnahmen und Livemitschnitte der Band an und durchforstet die Tagespresse nach Erwähnungen des Sängers.
1949 nahm Hartman ein paar Seiten mit dem Erroll Garner Trio auf und entschloss sich 1950, unter eigenem Namen zu reisen. Er wurde nicht nur in den Jazzgazetten erwähnt, sondern auch in populären Illustrierten. 1955 nahm er seine erste LP für das kurz zuvor gegründete Label Bethlehem auf, und Akkerman beschreibt die Produktionsbedingungen und den Erfolg der ersten beiden Platten, der aber nicht verhinderte, dass der Siegeszug des Rock ‘n’ Roll auch Hartman zu schaffen machte.
Akkerman begleitet Hartman nach in den 1960er Jahren England und Japan, beschreibt gelungene und weniger gelungene Bootleg-Mitschnitte seiner Konzerte und geht dann eingehend auf jenes Album ein, das den Sänger in der Jazzszene wieder bekannt machte, ein Kapitel, das überschrieben ist mit “The Mythology of a Classic”. Insbesondere “My One and Only Love” und “Lush Life” waren überzeugende Interpretationen, und doch konnte Hartman in der Folge nicht von der positiven Reaktion des Publikums und der Kritik profitieren.
Engagements in den USA hätten fürs Leben nicht ausgereicht, glücklicherweise war er overseas, insbesondere in Japan, sehr gefragt. Akkerman begleitet ihn durch die 1970er Jahre, eine Zeit, in der Hartman bei weitem nicht mehr den Erfolg zeitigen konnte wie als junger Mann, die dennoch kreative Jahre für ihn waren. Er blieb daneben auch ein gesellschaftlich gefragter Künstler. Allerdings litt er ein wenig darunter, als “musician’s musician” zu gelten und plante gegen Ende des Jahrzehnts vielleicht aus diesem Grunde Disco-Versionen von Jazzstandards, die allerdings nie realisiert wurden.
1983 dann versagte seine Stimme, und ein Arzt diagnostizierte Lungenkrebs. Im September desselben Jahres verstarb Hartman im Alter von 60 Jahren. Ein letztes Kapitel des Buchs betrachtet Wiederveröffentlichungen und posthume Würdigungen und holt Meinungen von Freunden und Musikerkollegen ein. Eine Diskographie, ein Song-Index, eine biographische Zeittafel und ein ausführliches Literaturverzeichnis beenden schließlich das Buch.
“The Last Balladeer” beschreibt die Lebensgeschichte eines Musikers, der zwischen Jazz und Pop agierte, auf beiden Feldern erfolgreich war, nie aber den Status erreichte, den seine Kollegen besaßen, die – wie etwa Tony Bennett – durchaus auf ihn als ihren Lieblingssänger verwiesen. Gregg Akkerman schreibt flüssig; er konzentriert sich vor allem auf Biographisches und auf den Hintergrund von Aufnahmen, weniger auf musikalische oder ästhetische Besonderheiten jenes Balladen-Belcanto, das Hartman pflegte wie wenige sonst. Sein Buch ist in der akribischen Recherche und seinem einfühlsamen Schreibstil auf jeden Fall eine willkommene Bereicherung der Jazzliteratur.
Wolfram Knauer (März 2013)
The Saxophone
von Stephen Cottrell
New Haven 2012 (Yale University Press)
390 Seiten, 40 US-Dollar
ISBN: 978-0-300-10041-9
 Eines der am meisten beachtetsten Instrumente sei das Saxophon, schreibt Stephen Cottrell im Vorwort zu seinem Buch und verweist auf Musiker wie Charlie Parker und John Coltrane sowie auf Staatsoberhäupter wie Bill Clinton und König Bhumibop Aduyadej; ernsthafte Literatur über das Instrument sei aber doch recht rar. Dem mag so sein (obwohl diesem Rezensenten eine ganze Handvoll Bücher einfallen, die sich mit dem Instrument, seiner spezifischen Bauweise und Klangtechnik sowie seinen Protagonisten auseinandersetzen); nun jedenfalls widmet sich Cottrell in einem umfangreichen Band der Buchreihe “Yale Musical Instrument Series” dem Saxophon in allen Bauvarianten und Spielarten.
Eines der am meisten beachtetsten Instrumente sei das Saxophon, schreibt Stephen Cottrell im Vorwort zu seinem Buch und verweist auf Musiker wie Charlie Parker und John Coltrane sowie auf Staatsoberhäupter wie Bill Clinton und König Bhumibop Aduyadej; ernsthafte Literatur über das Instrument sei aber doch recht rar. Dem mag so sein (obwohl diesem Rezensenten eine ganze Handvoll Bücher einfallen, die sich mit dem Instrument, seiner spezifischen Bauweise und Klangtechnik sowie seinen Protagonisten auseinandersetzen); nun jedenfalls widmet sich Cottrell in einem umfangreichen Band der Buchreihe “Yale Musical Instrument Series” dem Saxophon in allen Bauvarianten und Spielarten.
Er beginnt mit Generellem: den verschiedenen Instrumentengrößen, Mundstücken, dem Ansatz. Dann erzählt er das Leben von Adolphe Sax und beschreibt, wie dieser auf die Idee seiner Instrumentenerfindung kam. Er nennt Vorfahren, die unterschiedlichen Mitglieder der Saxophonfamilie, sieht sich die Patente an, die Sax für seine Erfindung eingereicht hatte, aber auch Patente anderer Instrumentenbauer bis hin zu mehr oder weniger skurrilen Varianten wie dem Grafton Plastiksaxophon, das sowohl Charlie Parker wie auch Ornette Coleman spielten, oder das Slide-Saxophon, das in den 1920er Jahren ab und an zum Einsatz kam. Er untersucht die industrielle Fertigung des Instruments im 19. Jahrhundert, beschreibt seine Vermarktung und den frühen Einsatz in klassischen und Opernkompositionen. Er verfolgt den Weg des Saxophons in die Vereinigten Staaten sowie seinen Siegeszug in den Militärkapellen auf beiden Seiten des Atlantiks.
Ein eigenes Kapitel widmet Cottrell der Verwendung des Saxophons in Vaudeville, Zirkus, Minstrelsy und Ragtime, erwähnt frühe Saxophonensembles wie die Brown Brothers, stellt eine Art “Saxophon Craze” fest und nennt erste Saxophonvirtuosen wie Rudy Wiedoeft und andere. Die Rolle des Instruments im Tanzorchester untersucht er genauso wie den Klang des Saxophonsatzes, der von Bandleadern und Arrangeuren immer geschickter eingesetzt wurde.
Dem Jazz widmet Cottrell ein eigenes Kapitel, nennt darin Solisten wie Sidney Bechet, Coleman Hawkins, johnny Hodges, Harry Carney, Lester Young, Charlie Parker, John Coltrane und Ornette Coleman. Das klassische Saxophon verfolge eine ganz andere Klangästhetik, die der Autor im Konzertsaal genauso wie auf der Opernbühne verfolgt, auch hier namhafte Virtuosen und Ensembles herausstellend. “Moderne und Postmoderne” lautet die Überschrift zu einem Kapitel, in dem die Genres dann etwas durcheinander purzeln, bevor sich Cottrell abschließend dem Saxophon als “Symbol und Ikone” näher, dabei sowohl auf positive, identitätsstiftende, wie negative, ausgrenzende Ikonographie verweist (für letztere steht das Plakat zur “Entartete Musik”-Ausstellung der Nazis) und schließlich auch die sexuellen Konnotationen der Instrumentenform nicht außer Acht lässt.
Alles in allem gelingt Cottrell dabei ein gut lesbarer Rundumschlag, bei dem kein Aspekt zu kurz kommt: Bauart, Tonbildung, Individualstil, Wirkung. Und gerade für uns Jazzer, die wir dieses Instrument natürlich vor allem mit den bekannten Namen verbinden, mag es recht interessant sein, einmal den Blick über den Tellerrand zu wagen, das zu betrachten, was davor lag und das, was andere draus machten. Im Anhang findet sich ein Faksimile des originalen Patents von Adolphe Sax.
Wolfram Knauer (März 2013)
What It Is. The Life of a Jazz Artist
von Dave Liebman & Lewis Porter
Lanham/MD 2012 (Scarecrow Press)
363 Seiten, 37,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8203-4
 Dave Liebman wurde einem breiten Publikum durch seine Arbeit erst mit Elvin Jones Anfang der 1970er Jahre und dann mit Miles Davis in der Mitte des Jahrzehnts bekannt. Seit Ende der 1970er Jahre war Liebman als Lehrer aktiv, gründete 1989 die International Association of Schools of Jazz und wird auf der ganzen Welt nicht nur als Saxophonist, sondern auch als Jazzpädagoge geschätzt.
Dave Liebman wurde einem breiten Publikum durch seine Arbeit erst mit Elvin Jones Anfang der 1970er Jahre und dann mit Miles Davis in der Mitte des Jahrzehnts bekannt. Seit Ende der 1970er Jahre war Liebman als Lehrer aktiv, gründete 1989 die International Association of Schools of Jazz und wird auf der ganzen Welt nicht nur als Saxophonist, sondern auch als Jazzpädagoge geschätzt.
Für seine Autobiographie hat Liebman den renommierten Jazzforscher Lewis Porter gebeten ihn zu interviewen. Porter entschied sich, das Ergebnis in Gesprächsform festzuhalten, in der Porter die Erinnerung Liebmans untermauern oder ergänzen kann und Liebmans Erzählfluss quasi durch seine Fragen strukturiert. Das liest sich durchweg flüssig und wirkt vielleicht gerade in dieser Form überaus authentisch.
Liebman nimmt kein Blatt vor den Mund. Er erzählt freimütig über seine Polio-Erkrankung, den Einfluss John Coltranes, Unterricht bei Lennie Tristano, seine Zeit in Charles Lloyds Band, seine Arbeit mit Chick Corea und Elvin Jones, Konzerte und Aufnahmen mit Miles Davis, seine Zusammenarbeit mit Richie Beirach und John Scofield, die Bands Lookout Farm und Quest, die Idee und den Zustand der Jazzpädagogik, seine Aktivitäten in der International Association of Schools of Jazz und vieles mehr.
Das alles schwankt zwischen Anekdoten und Tiefsinnigem. In Porter hat Liebman dabei einen Gesprächspartner, der nachfragt, der aber vor allem auch versteht, wovon Liebman redet und die richtigen Fragen nachschiebt, um sowohl den nicht mit Liebmans Karriere vertrauten Leser mitzunehmen als auch die Fragen zu stellen, die der Experte an den Saxophonisten hätte. Nirgends wird das Buch dabei zu technisch, und Liebmans Erinnerungen bewahren in der Gesprächsform sehr angenehm ihre Subjektivität.
Wolfram Knauer (März 2013)
ECM. Eine kulturelle Archäologie
von Okwui Enwezor & Markus Müller
München 2012 (Prestel)
304 Seiten, 49,95 Euro
ISBN: 978-3-7913-5284-8
 Seit 1969 prägt das Plattenlabel ECM die Musiklandschaft mit, hat dabei den Jazz, tatsächlich aber weit mehr als den Jazz neu definiert – oder zumindest anders, offenohriger definiert. ECM ist nicht nur eines der erfolgreichsten Plattenlabels auf dem Markt; es ist zugleich wohl das Label, über dessen Produktionen am meisten geschrieben wurde: von Musikwissenschaftlern, Kulturhistorikern, Kunstgeschichtlern und vielen anderen. Aus Anlass einer großen Ausstellung im Münchner Haus der Kunst haben Okwui Enwezor und Markus Müller einen Katalog herausgebracht, der sich zugleich als kulturelle Spurensuche oder, wie der Untertitel es nennt, als “kulturelle Archäologie” zu ECM versteht.
Seit 1969 prägt das Plattenlabel ECM die Musiklandschaft mit, hat dabei den Jazz, tatsächlich aber weit mehr als den Jazz neu definiert – oder zumindest anders, offenohriger definiert. ECM ist nicht nur eines der erfolgreichsten Plattenlabels auf dem Markt; es ist zugleich wohl das Label, über dessen Produktionen am meisten geschrieben wurde: von Musikwissenschaftlern, Kulturhistorikern, Kunstgeschichtlern und vielen anderen. Aus Anlass einer großen Ausstellung im Münchner Haus der Kunst haben Okwui Enwezor und Markus Müller einen Katalog herausgebracht, der sich zugleich als kulturelle Spurensuche oder, wie der Untertitel es nennt, als “kulturelle Archäologie” zu ECM versteht.
In einem ersten Kapitel erzählt Okwui Enwezor, Kurator des Hauses der Kunst, über die Konzeption der Ausstellung und das grundsätzliche Problem, Musik im Museum zu präsentieren. Markus Müller ordnet ECM im zweiten Kapitel in den “Kontext unabhängiger Schallplattenfirmen und der Selbstbestimmung von Musikern in den 50er, 60er und 70er Jahren” ein und verweist dabei auf Debut Records, die AACM, FMP und andere Projekte jener Jahre.
Ein Gespräch der Herausgeber mit Manfred Eicher, Steve Lake und Karl Lippegaus erlaubt einen spannenden Blick hinter die Kulissen, erzählt, wie das anfangs kleine Labelprojekt größer und professioneller und die Musikwelt neben der Auswahl der Künstler auch auf die klangliche Qualität der ECM-Alben aufmerksam wurde. Eicher betont dabei, wie wichtig ihm immer war, neben dem Verkaufbaren auch Platten zu machen, “die nicht produziert wurden, um verkauft zu werden, sondern damit es sie überhaupt gab”.
Wolfgang Sandner sondiert die Wege, auf denen ECM sowohl Jazz- wie auch Tonträgergeschichte schreiben konnte. Diedrich Diederichsen greift sich Paul Bley und Annette Peacock heraus und beschreibt in einem sehr persönlichen Artikel das, was er die “Beckett-Linie” bei ECM nennt. Kodwo Eshun reflektiert über das ästhetische und dabei zugleich gesellschaftliche Selbstverständnis des Trios Codona. Jürg Stenzl schaut auf den Regisseur Jean-Luc Godard und auf Manfred Eicher als Mehrfachbegabungen. Steve Lake folgt mit einer Label-Chronologie von 1969 bis 2012. Schließlich beendet eine Diskographie aller ECM-Produktionen bis Drucklegung das Buch.
Neben den lesenswerten und aus unterschiedlicher Sicht auf ECM blickenden Essays sind natürlich auch die Fotos zu erwähnen, die dieses Buch, das schließlich als “Ausstellungskatalog” daherkommt, zugleich zu einem spannenden Blättererlebnis machen. Viele seltene Abbildungen der Musiker, des Produzenten, privat, auf Tour, im Studio, streichen dann vor allem noch eins heraus: die zutiefst menschliche Seite hinter dem Erfolg von ECM.
Wolfram Knauer (März 2013)
Eurojazzland. Jazz and European Sources, Dynamics, and Contexts
herausgegeben von Luca Cerchiari & Laurent Cugny & Franz Kerschbaumer
Boston 2012 (Northeastern University Press)
484 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-58465-864-1
 Immer noch fehlt eine zusammenfassende Geschichte des Jazz in Europa, ein Buch, das nationale Entwicklungen genauso skizziert wie Einflüsse zwischen Regionen, das stilistische Identitäten beschreibt und die Abgrenzungen und Annäherungen an den US-amerikanischen Jazz analysiert. “Eurojazzland”, das sei vorab schon angemerkt, ist nicht dieses lang ersehnte Buch. Stattdessen ist es eine Sammlung mehr oder weniger disparater Essays, die sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit Beziehungen zwischen einem Kontinent (Europa) und einer Musik (dem Jazz) beschäftigen.
Immer noch fehlt eine zusammenfassende Geschichte des Jazz in Europa, ein Buch, das nationale Entwicklungen genauso skizziert wie Einflüsse zwischen Regionen, das stilistische Identitäten beschreibt und die Abgrenzungen und Annäherungen an den US-amerikanischen Jazz analysiert. “Eurojazzland”, das sei vorab schon angemerkt, ist nicht dieses lang ersehnte Buch. Stattdessen ist es eine Sammlung mehr oder weniger disparater Essays, die sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit Beziehungen zwischen einem Kontinent (Europa) und einer Musik (dem Jazz) beschäftigen.
Die Herausgeber haben ihren Band in drei Teile strukturiert: einen ersten, der sich mit “Europa als der Quelle des Jazz” befasst, also jene Wurzelstränge des Jazz sucht, die in Europa liegen; einen zweiten, der “Jazz Meets Europe” überschrieben ist; sowie einen dritten Teil, der den etwas unklaren Titel “The Circulation of Eurojazzland” trägt und theoretischere Ansätze hinterfragt, ob von musikwissenschaftlicher oder musikkritischer Seite.
Im ersten Teil sucht Franz Kerschbaumer nach irischen und schottischen Wurzeln des Jazz und findet Swingrhythmen in europäischem Folk und verschiedenster Popmusik. Bruce Boyd Raeburn, Kurator des Jazzarchivs in New Orleans, ist dem “Spanish Tinge” auf der Spur und findet, dass etliche der Bezüge zwischen New Orleans und Lateinamerika noch der Erforschung harren. Martin Guerpin fragt nach dem Interesse europäischer Komponisten am Jazz und untersucht Claude Debussys “Golliwog’s Cakewalk”, Erik Saties “Ragtime du Paquebot” und Darius Milhauds “La Création du Monde”. Vincent Cotro fragt sich, ob es eine spezifisch französische Tradition des Umgangs mit Streichinstrumenten im Jazz gibt. Luca Cerchiary sucht nach europäischen Wurzeln im Standardrepertoire des Jazz. Arrigo Cappelletti schließlich befasst sich mit pan-europäischen Projekten aktueller Improvisatoren.
Im zweiten Teil beschreibt Rainer E. Lotz interkulturelle Verbindungen in der Vorgeschichte des Jazz in Europa. Catherine Tackley Parsonage nähert sich Benny Carters britischen Jahren 1936-1937 an. John Edward Hasse untersucht die Besuche Duke Ellingtons in Frankreich zwischen 1933 und 1973. Manfred Straka beschreibt die verschiedenen Ausformungen der Cool-Jazz-Rezeption in Europa. Davide Ielmini spricht mit dem Komponisten Giorgio Gaslini über die Unterschiede der Jazzkomposition in den USA und hierzulande. Alyn Shiption versucht eine Annäherung ans New-Orleans-Revival und beschreibt die Unterschiede dieser Bewegung in Großbritannien und Frankreich. Ekkehard Jost fragt, wohin die Emanzipation der europäischen Avantgarde in den 1960er und frühen 1970er Jahren wohl geführt haben mag.
Im dritten Teil fragt Laurent Cugny nach der Rolle Europas in der “Entdeckung” oder wenigstens der Popularisierung des Jazz. Jürgen Arndt fragt nach kulturellen Dialogen und Spannungen zwischen Europa und Amerika im Rahmen der politischen Umwälzungen der 1960er Jahre. Tony Whyton wirft einen Blick auf Themen europäischer Jazzforschung. Mike Heffley entdeckt beim Blick auf Europa-Emigranten Joseph Schillinger, Joe Zawinul, Karl Berger und Marian McPartland seine eigene Geschichte. Gianfranco Salvatore fragt nach elektronischen Instrumentenerfindungen des 20sten Jahrhunderts, die auch im Jazz ihren Niederhall fanden. Herbert Hellhund versucht schließlich eine Übersicht über die Entwicklungen eines zeitgenössischen europäischen Jazz der Postmoderne zu geben.
All das also sind Schlaglichter auf Themen europäischer Jazzgeschichte, und jedes der Kapitel verdient Weiterdenken und Weiterforschen. Einmal mehr macht das Buch dabei bewusst, dass es an einer ordentlichen Vernetzung der europäischen Jazzforschung immer noch mangelt und – noch mehr als alles andere, an einem – englischsprachigen – Buch, das europäische Jazzgeschichte als eigenständiges Narrativ in all ihren Verbindungen und Zwängen erzählt. Es bleibt also noch einiges zu tun an Grundlagenforschung zum europäischen Jazz. Genügend – sehr unterschiedliche – Ansätze gibt es offenbar, wie dieses Buch zeigt.
Wolfram Knauer (März 2013)
Sam Morgan’s Jazz Band. Complete Recorded Works in Transcription
(MUSA = Music of the United States, Volume 24)
herausgegeben von John J. Joyce Jr. & Bruce Boyd Raeburn & Anthony M. Cummings
Middleton/WI 2012 (A-R Editions)
260 Seiten, 260 US-Dollar
ISBN: 978-0-89579-724-7
 Herausgeber Anthony Cummings stapelt hoch: Dieses Buch stelle nicht nur eine Gesamtausgabe dar, sondern sogar die erste wissenschaftliche Ausgabe des gesamten aufgenommenen Oeuvres eines Jazzmusikers. Nun hinterließ Sam Morgan nicht allzu viele Aufnahmen, so dass er sich sicher besser für eine solche Aufgabe anbietet als andere. King Oliver oder Jelly Roll Morton – von dem James Dapogney immerhin vor vielen Jahren eine nicht minder exzellente kritische Ausgabe herausbrachte – hätten viel zu viele Platten hinterlassen, als dass eine Gesamtausgabe möglich oder auch sinnvoll wäre. Der geringe Umfang des Repertoires allerdings war sicher nicht ausschlaggebend bei der Wahl Morgans; eher schon die unbestrittene Qualität der Aufnahmen, ihre Beispielhaftigkeit für einen frühen Jazzstil, wie er auch in New Orleans erklang. Anders als Oliver oder Morton nämlich wurden diese Platten in der Stadt am Mississippidelta selbst eingespielt, nicht also in Chicago oder Richmond oder wo immer sonst die meisten Dokumente des frühen Jazz entstanden.
Herausgeber Anthony Cummings stapelt hoch: Dieses Buch stelle nicht nur eine Gesamtausgabe dar, sondern sogar die erste wissenschaftliche Ausgabe des gesamten aufgenommenen Oeuvres eines Jazzmusikers. Nun hinterließ Sam Morgan nicht allzu viele Aufnahmen, so dass er sich sicher besser für eine solche Aufgabe anbietet als andere. King Oliver oder Jelly Roll Morton – von dem James Dapogney immerhin vor vielen Jahren eine nicht minder exzellente kritische Ausgabe herausbrachte – hätten viel zu viele Platten hinterlassen, als dass eine Gesamtausgabe möglich oder auch sinnvoll wäre. Der geringe Umfang des Repertoires allerdings war sicher nicht ausschlaggebend bei der Wahl Morgans; eher schon die unbestrittene Qualität der Aufnahmen, ihre Beispielhaftigkeit für einen frühen Jazzstil, wie er auch in New Orleans erklang. Anders als Oliver oder Morton nämlich wurden diese Platten in der Stadt am Mississippidelta selbst eingespielt, nicht also in Chicago oder Richmond oder wo immer sonst die meisten Dokumente des frühen Jazz entstanden.
In einem lesenswerten 20-seitigen Aufsatz erklärt Bruce Boyd Raeburn, der Leiter des Jazzarchivs an der Tulane University, was den frühen New-Orleans-Stil auszeichnet und welche Unterschiede es zu Beginn des 20sten Jahrhunderts in den musikalischen Konzepten früher Jazzmusiker gab. Vor allem beschreibt er die beiden konträren Pole von “hot” und “sweet”-Ansätzen, für die er exemplarisch die Bands von Sam Morgan und Armand Piron nennt. Er hinterfragt die Notenfestigkeit früher Jazzmusiker und diskutiert die Rolle von Hautfarbe, ethnischer Herkunft und Alter der Spieler. Schließlich beschreibt er die Arbeitsbedingungen der Band und die Umstände der Aufnahmen, um die es im Rest des Buchs geht.
John J. Joyce Jr. erklärt anschließend die Herangehensweise bei, also die technische Seite der Transkription. Die Ausgabe solle, so schreibt er, sowohl für Forscher als auch für Musiker nutzbar sein, daher habe man sich darauf geeinigt, so konventionell wie möglich zu notieren. Joyce nennt Schwierigkeiten, etwa das Auseinanderhalten der beiden Trompeter in den Aufnahmen. Auch die Notation des Schlagzeugparts sei eine besondere Herausforderung und das Banjo stellenweise kaum heraushörbar gewesen. Er benennt die Hilfsmittel, insbesondere Software, die den Transkribenden erlaubten, Klänge zu analysieren und in einzelne Linien zu strukturieren. Schließlich gibt er eine Legende der Notationsbeizeichen, die vor allem verschiedene Ansätze an einzelne Töne beschreiben.
Jeder einzelne der acht Transkriptionen – es sind dies: “Steppin’ on the Gas”, “Everybody’s Talking About Sammy”, “Mobile Stomp” und “Sing On”, aufgenommen am 14. April 1927, sowie “Short Dress Gal”, “Bogalusa Strut”, “Down By the Riverside” und “Over in the Gloryland”, aufgenommen am 22. Oktober 1927 – steht eine kurze formale Ablaufbeschreibung voran. Die Umschrift selbst dann nimmt je eine volle Seite ein mit Stimmlinien für Klarinette, zwei Saxophone, zwei Trompeten, Posaune, Bass, Banjo, Piano und Schlagzeug. Nach jeder Transkription gibt es einen kritischen Apparat mit Hinweisen auf transkriptorische Annäherungen und sonstige Besonderheiten, die im Notentext nicht näher bezeichnet werden konnten. Zum Schluss des Buchs findet sich dann noch eine Bibliographie über Sam Morgan mit Hinweisen auch auf Oral-History-Material und sonstige Quellen für eine eingehendere Weiter-Forschung an der Musik Sam Morgans.
Die MUSA-Reihe, eine Art Denkmälerausgabe zur amerikanischen Musik ist in ihrem stilübergreifenden Ansatz ein überaus wichtiges Projekt. Der Band zu Sam Morgan ist nach früheren Bänden mit Transkriptionen von Thomas ‘Fats’ Waller und Earl Hines der dritte dem Jazz gewidmete Band der Reihe. Er wird – sicher auch des stolzen Preises – vor allem in musikwissenschaftlichen Bibliotheken zu finden sein. Zugleich ist er beispielhaft dafür, wie eine kritische Ausgabe jazzmusikalischer Transkriptionen aussehen kann und stellt damit eine bedeutsame Ergänzung der Dokumentation der frühen Jazzgeschichte dar.
Wolfram Knauer (Februar 2013)
Jazz Puzzles, Volume 1
Von Dan Vernhettes & Bo Lindström
Saint Etienne 2012 (Jazz’edit)
240 Seiten, 40 Euro (+ 10 Euro Versandkosten)
ISBN: 9782953483116
www.jazzedit.org
 Mit “Traveling Blues” hatten Dan Vernhettes und Bo Lindström 2009 eine beispielhafte Studie über den Trompeter Tommy Ladnier vorgelegt, der sie jetzt, in der Aufmachung nicht weniger opulent, ein Buch folgen lassen, in dem sie sich vierzehn frühe Musiker der Jazzgeschichte vornehmen, um ihre Biographien teilweise neu aufzurollen, teilweise auf den neuesten Stand zu bringen.
Mit “Traveling Blues” hatten Dan Vernhettes und Bo Lindström 2009 eine beispielhafte Studie über den Trompeter Tommy Ladnier vorgelegt, der sie jetzt, in der Aufmachung nicht weniger opulent, ein Buch folgen lassen, in dem sie sich vierzehn frühe Musiker der Jazzgeschichte vornehmen, um ihre Biographien teilweise neu aufzurollen, teilweise auf den neuesten Stand zu bringen.
“Jazz Puzzles” heißt das Werk im LP-Format mit vielen sorgfältig reproduzierten Fotos und Dokumenten, für dass die beiden Autoren sich mit anderen Kennern des frühen New Orleans vernetzt und in Archiven insbesondere in und um New Orleans recherchiert haben. Sie beginnen mit der Geschichte des Bandleaders John Robichaux, dessen Biographie sie akribisch nachzeichnen, dabei neben den Lebens- auch die Spielorte und Arbeitsbedingungen erläutern und auf die Konkurrenz zu Buddy Bolden eingehen. Unter anderem beschreiben sie die Notensammlung der Band, die heute im Hogan Jazz Archive in New Orleans bewahrt wird. Wie einige andere der frühen Heroen der Musik in New Orleans nahm Robichaux, der bis in die 1930er Jahre hinein ein Society Orchester leitete, keine Schallplatten auf. Umso wertvoller daher die einfühlsamen Annäherungen aus biographischen Details an seine Musik.
In ihrem Kapitel über Buddy Bolden fassen Vernhettes und Lindström erst einmal die Literaturlage zusammen und gehen auch im Rest des Kapitels immer wieder auf widerstreitende Meinungen vorhergehender Autoren oder aber auf Mutmaßungen und Spekulationen ein, um diese mit Quellen zu verifizieren. Insbesondere fragen sie nach dem von Bolden gespielten Repertoire, nach den Bedürfnissen einer Tanzmusik in jener Zeit, nach dem karibischen Einfluss, nach Ragtime- und religiösen Elementen in seiner Musik sowie nach der Bedeutung des Blues für diese frühe Form des Jazz. Sie hinterfragen die Bedeutung des Wortes “ratty” in Bezug auf Boldens Spiel, befassen sich mit Papa Jack Laines Aussagen über den Jazz in New Orleans und dabei auch mit der kulturellen Durchlässigkeit zwischen Hautfarben und Ethnien. Sie untersuchen, wo Bolden tatsächlich spielte und beschreiben, wie sich seine allbekannten psychischen Probleme äußerten. Sie gehen der Legende eines verschollenen Buddy-Bolden-Zylinders nach und beschreiben die erhaltenen Bandfotografien. Schließlich gehen sie auf einige der direkt sich auf Bolden beziehenden Nachfahren des Kornettisten ein, die Eagle Band, Frankie Duson, Louis Knute, Edward Clem, John E. Pendleton und Albert Tig Chambers.
Ähnlich sorgfältig machen sich die Autoren auch auf die Spur weiterer Musiker, Manuel Perez etwa, der sich, wie sie schreiben, als Kreole nie ganz an das Hot-Jazz-Konzept der neuen Musik gewöhnt habe, oder Ernest Coucault, der in den 1920er Jahren als Trompeter der Sonny Clay Band in Kalifornien aufgenommen wurde und mit dieser Band 1928 auch nach Australien reiste. Sie gehen der Biographie King Olivers auf den Grund, bebildern das alles etwa mit einem Plakat, die einen Auftritt der Magnolia Band 1911 im Lincoln Park ankündigt, mit Einberufungsbefehlen für Honoré Dutrey und Peter Ciaccio, und folgen ihm erst nach Chicago, dann nach Kalifornien und zurück in die Windy City, wo sie sein Kapitel genau zu dem Zeitpunkt beenden, als Louis Armstrong zur Creole Jazz Band stößt. Der Trompeter Chris Kelly erhält ein eigenes Kapitel, dessen Spiel auch Armstrong beeinflusst habe, der aber genau wie andere seiner Zeitgenossen nie den Weg ins Plattenstudio fand. Freddie Keppard hatte zwar die Chance verspielt, die offiziell ersten Jazzaufnahmen zu machen, hinterließ aber immerhin bedeutende Einspielungen.
Andere Meister des frühen Jazz, die ausführlich beleuchtet werden, sind Lorenzo Tio Jr., Arnold Metoyer, Evan Thomas, Punch Miller, Buddy Petit, Sidney Bechet (in seinen ersten Jahren in New Orleans) und Kid Rena. Und nebenbei wird eingehend auch auf viele der Musiker eingehen, die irgendwann den Weg der Kapitelhelden kreuzten.
Dan Vernhettes und Bo Lindströms Buch bietet in jedem seiner Kapitel eine Unmenge an Details und kenntnisreichen Querverbindungen, die helfen, den frühen Jazz in New Orleans besser zu verstehen, die zugleich aber auch bewusst machen, wie komplex eine Beschreibung der Jazzgeschichte sein kann, nein, sein muss, um musikalische Einflüsse, Arbeitsbedingungen und ästhetische Entscheidungen zu erklären.
Die Puzzleteilchen, die Vernhettes und Lindström legen, haben klare Kanten und Konturen und erleichtern es uns andere Puzzlestückchen einzupassen. Die vielen Fotos, Dokumente und Karten lassen die Musikszene in New Orleans zwischen 1900 und 1920 erstaunlich klar auferstehen. Ein großartiges Buch, weiß Gott nicht nur für Freunde des traditionellen Jazz.
Wolfram Knauer (Februar 2013)
Brötzmann. Gespräche
Herausgegeben von Christoph J. Bauer
Berlin 2012 (Posth Verlag)
184 Seiten, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-944298-00-9
 Peter Brötzmann ist nicht aufs Saxophon gefallen, auf dem er seit vielen Jahren sagt, was er zu sagen hat. Aber er ist auch nicht auf den Mund gefallen und macht auch hier kein Federlesens. Im Gespräch mit dem Philosophen und Publizisten Christoph J. Bauer ist jetzt ein ungemein offenes, lesenswertes und diskussionsmunteres Buch erschienen, das den simplen Titel “Brötzmann. Gespräche” trägt, aber genauso gut als Versuch einer Autobiographie gelten könnte, die von Erinnerungen über Meinungen und Haltungen und zurück zu Erinnerungen führt, von ästhetischer Einordnung über Reflexionen zum Leben und Überleben als Musiker bis hin zu sehr Privatem. Das alles hat Bauer so niedergeschrieben, wie es im Gespräch erklang, als O-Ton Brötzmann, einzig gegliedert durch knappe Zwischenüberschriften, die dem Leser das Blättern erleichtern, ihn zum Querlesen einladen, welches immer wieder im Sich-Festlesen mündet.
Peter Brötzmann ist nicht aufs Saxophon gefallen, auf dem er seit vielen Jahren sagt, was er zu sagen hat. Aber er ist auch nicht auf den Mund gefallen und macht auch hier kein Federlesens. Im Gespräch mit dem Philosophen und Publizisten Christoph J. Bauer ist jetzt ein ungemein offenes, lesenswertes und diskussionsmunteres Buch erschienen, das den simplen Titel “Brötzmann. Gespräche” trägt, aber genauso gut als Versuch einer Autobiographie gelten könnte, die von Erinnerungen über Meinungen und Haltungen und zurück zu Erinnerungen führt, von ästhetischer Einordnung über Reflexionen zum Leben und Überleben als Musiker bis hin zu sehr Privatem. Das alles hat Bauer so niedergeschrieben, wie es im Gespräch erklang, als O-Ton Brötzmann, einzig gegliedert durch knappe Zwischenüberschriften, die dem Leser das Blättern erleichtern, ihn zum Querlesen einladen, welches immer wieder im Sich-Festlesen mündet.
Im Vorwort erklärt Bauer sein eigenes Interesse an Brötzmann, seiner Musik und dem Gespräch mit dem Saxophonisten. Die Idee zu dem Buch sei ihm nach der Lektüre eines Artikels in der Süddeutschen Zeitung gekommen, in dem Brötzmann zitiert wurde, er würde sein Tentet “über die musikalischen Belange hinaus auch als ein Beispiel gesellschaftlichen Zusammenlebens” verstehen. Das machte Bauer nun doppelt neugierig, und so näherte er sich in vier in Brötzmanns Wohnung geführten Gesprächen dessen Vorstellung von Musik, Gesellschaft, Ästhetik und vielem anderen.
Im Gespräch mauert Brötzmann nirgends, spricht über den Jazz als ursprünglich schwarze Musik und die Bedeutung von schwarz und weiß im heutigen amerikanischen Jazz. Er äußert sich zum Kommunismus, zum Sozialismus, zu den Zuständen in der DDR, zu politischem Bewusstsein und politischer Verantwortung der Musiker im Tentet, zu kulturellen Unterschiede etwa in Japan, zum Hören ganz allgemein, zu seiner Liebe zu Coleman Hawkins, Sonny Rollins, Don Byas und dem Blues oder zur Idee und der Realität des Free Jazz. Er reflektiert darüber, inwieweit Musik etwas mit Geschichtenerzählen zu tun habe und erinnert sich daran, wie seine Musik durchaus als Provokation aufgefasst wurde. Er erzählt von seinen Tourneen durch die USA und davon, wie schwierig das alles schon rein visa-organisatorisch sei. Er spricht über das Publikum, über Aufnahmetechnik, über Konkurrenz auf der Bühne und über Respekt – anderen Musikern genauso wie anderen Kulturen gegenüber. Fluxus ist ein Thema – Brötzmann hatte einst als Assistent für Nam June Paik gearbeitet –, und von da aus geht das Gespräch schnell zur eigenen Bildenden Kunst Brötzmanns und deren Zusammenhang mit der Musik. Die beiden sprechen über die Unterscheidung zwischen “U” und “E”, übers Globe Unity Orchestra und Krautrock, über Joachim Ernst Berendt, das Berliner Jazzfest und das Total Music Meeting als Gegenveranstaltung. Brötzmann äußert sich auch offen zu Alkohol und Drogen und ihren teilweise fatalen Auswirkungen, zu seiner eigenen Auseinandersetzung mit europäischen Philosophen, zum Thema der Sexualität, das insbesondere in seinen Bildern eine große Rolle spielt.
Das alles fasst Bauer schließlich in einem abschließenden vierzehnseitigen Essay zusammen, der versucht, die “soziale Struktur einer Gemeinschaft von Improvisatoren” zu ergründen. “Brötzmann. Gespräche” ist ungemein lesenswert, abwechslungsreich, informativ und intensiv – ein wenig wie Brötzmann selbst, möchte man meinen und doch wieder weit abgeklärter als seine Musik, deren Intensität ja vor allem in ihrer Direktheit entsteht, die ihrerseits im nachdenklichen Hinterfragen, wie es in diesem Buch deutlich wird, eine fast schon dialektische Untermauerung erfährt.
Wolfram Knauer (Dezember 2012)
Jazz Covers
herausgegeben von Joaquim Paulo & Julius Wiedemann
Köln 2012 (Taschen)
2 Bände, Hardcover im Schuber, 600 Seiten, 39,99 Euro
ISBN: 978-3-8365-2406-3
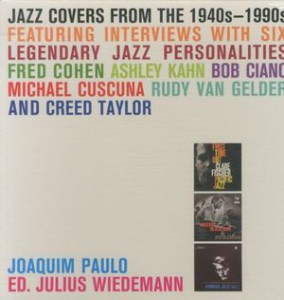 Als Musik des 20sten Jahrhunderts haben den Jazz die Entwürfe seiner Plattencover immer mit begleitet. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an Büchern über die Kunst der Plattengestaltung, darunter den großartigen Katalog einer Ausstellung in Valencia, die 1999 die Entstehung des Jazz-Plattencovers verfolgte und mit vielen Ausstellungsstücken aus dem Fundus des Jazzinstituts bestückt war.
Als Musik des 20sten Jahrhunderts haben den Jazz die Entwürfe seiner Plattencover immer mit begleitet. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an Büchern über die Kunst der Plattengestaltung, darunter den großartigen Katalog einer Ausstellung in Valencia, die 1999 die Entstehung des Jazz-Plattencovers verfolgte und mit vielen Ausstellungsstücken aus dem Fundus des Jazzinstituts bestückt war.
Nun haben Joaquim Paulo und Julius Wiedemann eine quasi lexikalische Sammlung wichtiger Plattencover herausgegeben, die diesmal nicht nach Künstlern oder Plattenlabels, sondern nach den Künstlern des Jazz sortiert ist. Das schwere, zweibändige, in einem dicken Pappschuber gelieferte Opus ist im LP-Format gehalten. Etliche der Abbildungen nehmen die ganze Seite ein, viele andere sind kleiner gehalten und haben kurze Beschreibungen entweder zu den Musikern der dargestellten Alben oder zu den Grafikern, die das Cover entworfen hatten. Diese Sortierung sorgt vor allem für Vielfalt und Überraschungsmomente, wenn beispielsweise Platten aus den 1950ern solchen aus den 1970ern gegenüberstehen. Das ist in etwa auch die Zeitspanne, die “Jazz Covers” umfasst, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, obwohl man sich schon fragen mag, warum nicht zumindest die 1980er Jahre noch mit berücksichtigt wurden, wo doch der große Einschnitt auch in die Gestaltung von Tonträgern erst Ende der 1980er mit dem Aufkommen der CD geschah.
Interviews mit dem Designer Bob Ciano, den Produzenten Michael Cuscuna und Creed Taylor, dem Kritiker und Fotografen Ashley Kahn und dem Plattenladenbesitzer Fred Cohen führen jeweils in die beiden Bände ein, die ansonsten vor allem zum Blättern einladen, zum Entdecken und – sofern die Aufnahmen vorhanden sind – zum Wiederhören.
Wolfram Knauer (Dezember 2012)
Pepper Adams’ Joy Road. An Annotated Discography
von Gary Carner
Lanham/MD 2012 (Scarecrow Press)
553 Seiten, 44,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8256-0
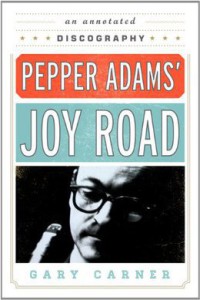 Musikwissenschaftlern wie Jazzforschern erkläre ich gelegentlich, Diskographien im Jazz würden meist von Privatforschern in ihrer Freizeit erstellt, seien aber tatsächlich in etwa den Werkverzeichnissen der klassischen Musik vergleichbar, mit denen Musikwissenschaftler sich schon mal einen Doktorgrad verdienen.
Musikwissenschaftlern wie Jazzforschern erkläre ich gelegentlich, Diskographien im Jazz würden meist von Privatforschern in ihrer Freizeit erstellt, seien aber tatsächlich in etwa den Werkverzeichnissen der klassischen Musik vergleichbar, mit denen Musikwissenschaftler sich schon mal einen Doktorgrad verdienen.
Ein wenig hinkt dieser Vergleich, denn anders als musikwissenschaftliche Werkverzeichnisse untersuchen Diskographien selten die Musik selbst, beschäftigen sich stattdessen in der Hauptsache mit der Verbreitung musikalischer Produkte, der Schallplatten also, veröffentlichter und nicht veröffentlichter Aufnahmen. Das kann für den “Leser” herkömmlicher Diskographien recht langweilig sein, da vieles an Information hinter den Listen versteckt ist, den Besetzungslisten, den Aufnahmedaten, den Informationen über Studio, Ort, vielleicht sogar Tageszeit, über Originalveröffentlichung, Zahl der Takes, Wiederveröffentlichung auf unterschiedlichsten Medien.
In den letzten Jahren sind einige beispielhafte Diskographien erschienen, in denen die ureigene Aufgabe der Diskographie, also das Auflisten von Aufnahmen, durch zusätzliche Information erweitert wurde, die teils biographischer Natur sind, teils auf Details der Musik eingehen. Gary Carners dickes Opus über den Baritonsaxophonisten Pepper Adams gehört zu dieser neuen Spezies von Diskographien, die weit mehr liefern als nur Daten und Fakten. Garner arbeite in den Mitt-1980er Jahren mit Adams an seiner Autobiographie, interviewte dann nach Adams Tod im Jahr 1986 viele der Kollegen, die mit dem Baritonsaxophonisten gespielt hatten oder im Studio zusammengetroffen waren. Mit Hilfe vieler diskographischer Freunde entdeckte er zudem etliche unveröffentlichte Aufnahmen.
Sein Buch beginnt im September 1947 mit einer unveröffentlichten Demo-Aufnahme aus Detroit, an der neben Pepper Adams auch der Pianist Tommy Flanagan beteiligt war; es endet im Juli 1986, nur drei Monate vor dem Tod des Musikers mit einem Rundfunkmitschnitt vom Montréal Jazz Festival. Dazwischen finden sich Hunderte Aufnahmen, bekannte genauso wie unbekannte, eingespielt im Studio oder mitgeschnitten bei Konzerten oder Festivals. In einem kurzen Anhang nennt Carner gerade mal vier Sessions, von denen er weiß, die er aber nie gehört hat bzw. die offenbar nirgends mehr existieren.
Ansonsten ist das Buch eine reiche Fundstelle für Details. Carner unterhielt sich mit vielen der an den Einspielungen beteiligten Musiker über die Atmosphäre im Studio, über Schwierigkeiten, über gelungene genauso wie misslungene Aufnahmen. Die Texte sind den entsprechenden Einträgen zugeordnet, was eher zum Blättern einlädt als dass es zur Lektüre in einem Stück ermutigt. Carners Einleitungen der O-Töne mögen auf Dauer etwas eintönig daherkommen: “xxx told the author”, “in an interview with the author”, “according to xxx in a letter to the author” etc., ein bis zweimal auf jeder Seite. Hier wären Fußnoten sicher die lesbarere Alternative gewesen.
Doch ist Carners Werk auch kein Lesebuch im üblichen Sinne. Es ist eine annotierte Diskographie und als solche ganz gewiss beispielhaft dafür, was diese Wissenschaft über das bloße Kartieren von Aufnahmedaten hinaus sonst noch vermag. Der nächste Schritt wäre die Verquickung dieses Ansatzes mit zumindest in Teilen analytischen Kommentaren zur Musik. Aber auch so ist Carners “Pepper Adams’ Joy Road” bereits jetzt das Standardwerk zum Baritonsaxophonisten Pepper Adams.
Wolfram Knauer (November 2012)
The Jazz Standards. A Guide to the Repertoire
Von Ted Gioia
New York 2012 (Oxford University Press)
5237 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-993739-4
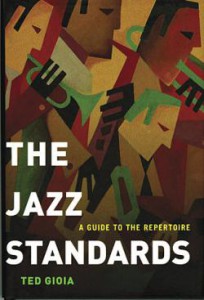 Hans-Jürgen Schaal hat Ted Gioias Buch über die Jazz-Standards eigentlich schon geschrieben, aber deutsche Literatur wird in englischsprachigen Ländern leider immer noch kaum berücksichtigt. Titel und Ansatz beider Bücher jedenfalls sind ähnlich, und wo Schaals Buch von 2001 320 Jazz-Standards listet, sind es bei Gioia “nur” etwa 250 Kompositionen.
Hans-Jürgen Schaal hat Ted Gioias Buch über die Jazz-Standards eigentlich schon geschrieben, aber deutsche Literatur wird in englischsprachigen Ländern leider immer noch kaum berücksichtigt. Titel und Ansatz beider Bücher jedenfalls sind ähnlich, und wo Schaals Buch von 2001 320 Jazz-Standards listet, sind es bei Gioia “nur” etwa 250 Kompositionen.
Dabei überschneiden sich die beiden Autoren keinesfalls; ihre Auswahl ist in Einzelheiten durchaus unterschiedlich. Schauen wir uns nur den Buchstaben “P” in beiden Büchern an: Schaal beginnt mit “Pannonica”, “Paradise Stomp”, “Parker’s Mood”, “Passion Flower”, die alle bei Gioia nicht vorkommen, der stattdessen mit “Peace” und “The Peacocks” beginnt, die wiederum Schaal nicht listet.
Wie Schaal widmet sich auch Gioia in seinen einzelnen Kapiteln jeweils kurz der Kompositions-Genese, um dann einen Blick auf die interessantesten Jazz-Interpretationen zu werfen. Am Schluss eines jeden Eintrags steht eine kurze Auflistung wichtiger Aufnahmen, ohne Hinweise allerdings auf aktuelle Plattenveröffentlichungen – das Buch ist für die Zukunft gedacht, und die Wiederveröffentlichungen insbesondere etlicher der älteren Aufnahmen sind einfach zu unübersichtlich, um eine einzelne herauszugreifen. Man findet die großen Aufnahmen aber auch schon mal solche, die man nicht erwartet, etwa, wenn Gioia unter “Struttin’ With Some Barbecue” eine Einspielung Paul Desmonds listet, der den Armstrong-Klassiker 1968 als “Samba With Some Barbeue” aufgenommen hatte. Neben den üblichen Plattenverweisen findet sich dabei ab und an auch ein Hinweis auf jüngere YouTube-Interpretationen. Gioia begründet seine Auswahl an Aufnahmen, dennoch mag jeder Leser seine eigenen Präferenzen wiederfinden oder auch vermissen, anders geht es nun mal nicht in solchen Nachschlagewerken.
Gioia widmet sich den großen Standards, Stücken von George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, genauso wie den von Jazzmusikern geschriebenen Favoriten, Titeln von Duke Ellington, Charlie Parker, Thelonious Monk. Europäische Nummern finden sich außer Toots Thielemans “Bluesette” und Django Reinhardts “Nuages” keine, und auch in den Hinweisen auf Platten sind kaum europäische Interpretationen zu finden. Die Erläuterungen zu den Titeln klären schon mal Legenden auf – etwa um die Urheberschaft von “Blue in Green” oder um das tatsächliche Geburtsjahr von Eubie Blake. Ab und an bietet Gioia auch persönliche Anekdoten, etwa, dass er “Stella By Starlight” in seinen 20ern so lange toll fand, bis er herausfand, dass seine Mutter den Text kannte (und er hatte gar nicht gewusst, dass das Stück einen Text besaß), worauf er sich nach einem Stück umsah, dass seine Mutter nicht mögen würde.
Gioias Einleitung zum Buch ist kurz und vergibt die Chance auf eine in solch einem Buch durchaus wünschenswerte Diskussion, was (1.) einen Jazz-Standard überhaupt ausmacht und wie sich die Repertoirewahl in den letzten Jahrzehnten verändert hat (und warum). Er erklärt, dass er Stücke ausgelassen hat, die in älteren Stilen zu den Standards zählen mögen, aber heute kaum mehr zu hören sind, und dass ihm Titel von Radiohead, Björk, Pat Metheny, Maria Schneider und anderen nicht stark genug im Umlauf schienen, um sie aufzunehmen. Und wer entgegnet, mit “Time After Time” fände sich immerhin Cyndi Laupers Stück im Buch, der irrt: Es handelt sich auch hier um ein älteres Stück von Jule Styne, das Sarah Vaughan 1946 zum ersten Mal mit Teddy Wilson eingespielt hat.
Im Vergleich der beiden Bücher – Schaal / Gioia – geben die beiden Autoren sich nichts; ihre Ansätze sind dafür zu ähnlich. Für Hörer, die ein wenig mehr über das Repertoire wissen wollen, das den Jazz beherrscht, sind beide Bücher eine empfehlenswerte Lektüre. Gioias “Jazz Standards” überzeugt insbesondere in der Lockerheit des Stils, der den Leser ermutigt, zu blättern, einzelne Stücke herauszugreifen, weiterzulesen, zu entdecken – und dann vielleicht gespannt an den eigenen Plattenschrank zu gehen, um die Musik zu hören.
Wolfram Knauer (November 2012)
Shall We Play That One Together. The Life and Art of Jazz Piano Legend Marian McPartland
Von Paul de Barros
New York 2012 (St. Martin’s Press)
484 Seiten, 35 US-Dollar
ISBN: 978-0-312-55803-1
 Marian McPartland hat viele Karrieren: als Pianistin, als Rundfunkmoderatoren, als Beispiel für viele Frauen, die im Jazz nicht nur als Sängerinnen, sondern als Instrumentalistinnen ernst genommen werden wollten. Für ihre erfolgreiche Radioshow “Piano Jazz”, die seit 1978 auf National Public Radio läuft, gelang es ihr, mit dem Charme einer Frau, der Exotik einer amerikanisierten Britin, die ihren Akzent und ihre fast fan-hafte Bewunderung für die Jazzmusiker immer beibehalten hatte, und dem musikalischen Handwerkszeug, das allen Kollegen imponierte, ihren Hörern ein Fenster in die Werkstatt des Jazz zu öffnen, das bis heute beispiellos ist in der Offenheit, mit der die Gäste über stilistische Entscheidungen oder harmonische Progressionen redeten, als sei es eben doch nur ein professioneller Plausch zwischen zwei Kollegen.
Marian McPartland hat viele Karrieren: als Pianistin, als Rundfunkmoderatoren, als Beispiel für viele Frauen, die im Jazz nicht nur als Sängerinnen, sondern als Instrumentalistinnen ernst genommen werden wollten. Für ihre erfolgreiche Radioshow “Piano Jazz”, die seit 1978 auf National Public Radio läuft, gelang es ihr, mit dem Charme einer Frau, der Exotik einer amerikanisierten Britin, die ihren Akzent und ihre fast fan-hafte Bewunderung für die Jazzmusiker immer beibehalten hatte, und dem musikalischen Handwerkszeug, das allen Kollegen imponierte, ihren Hörern ein Fenster in die Werkstatt des Jazz zu öffnen, das bis heute beispiellos ist in der Offenheit, mit der die Gäste über stilistische Entscheidungen oder harmonische Progressionen redeten, als sei es eben doch nur ein professioneller Plausch zwischen zwei Kollegen.
Marian McPartland hat selbst über viele Jahre journalistisch gearbeitet, Kollegen interviewt, über Begegnungen und Konzerte berichtet. Nun hat Paul de Barros ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben, von den Kindheitstagen nahe Windsor Castle, ihre früh erkannte Musikalität – sie besitzt das absolute Gehör – und ihre erste Liebe zum Jazz, als sie in der Schule Aufnahmen von Bud Freeman, Muggsy Spanier, Sidney Bechet, dem Benny Goodman Trio und Duke Ellington hörte. Mit 17 bewarb sie sich an der Guildham School of Music and Drama in London und wurde angenommen. Bald nahm sie außerdem Stunden bei Billy Mayerl, der sie einlud, mit ihm auf Tournee zu gehen in einer Show mit vier Klaviervirtuosen. Sie genoss die Bühne und das Reisen und entschied sich, das Konservatorium ohne Abschluss zu verlassen. Sie machte sich einen Namen in England, dann aber kam der Krieg, und 1944 entschied sich Marian, als Musikerin an Tourneen der Truppenbetreuung teilzunehmen.
In den Ardennen traf sie den Kornettisten Jimmy McPartland, der in ähnlicher Mission zur Unterhaltung der amerikanischen Truppen unterwegs war. Die beiden heirateten, ein “odd couple”, wie Roy Eldridge sie später beschrieb, die “gute Tochter” aus England und der dem Alkohol zugeneigte Unterschichten-Trompeter aus Chicago. Sie reisten durch Europa, Garmisch, Paris, ein Nachmittag bei den Nürnberger Prozessen, wo sie Hermann Göring gegenübersaß, dann kehrten die beiden im April 1946 zurück – d.h. Marian zum ersten Mal – in die USA.
Paul de Barros unterbricht seine Biographie der Pianistin an dieser Stelle mit einem Exkurs, in dem er Herkunft und Karriere ihres Mannes erzählt, dessen Ruf ihr erheblich dabei behilflich war in New York musikalisch Fuß zu fassen. Die McPartlands lebten in New York und in Chicago, und de Barros erzählt von all den Schwierigkeiten, die die Ehe aushalten musste, meistens wegen Jimmys Alkoholsucht. Marian spielte in seiner Band, daneben aber ging sie jeden Abend aus, um andere Musiker zu hören. 1950 zogen sie zurück nach New York. 1951 nahm Marian ihre ersten Aufnahmen unter eigenem Namen auf, wenig später erhielt sie einen Gig im Embers Club, zu dem durch seltsamste Zufälle keine Geringeren als Roy Eldridge und Coleman Hawkins als “Sidemen” engagiert wurden. Die Presse wurde auf sie aufmerksam, und Marian McPartland zählte bald zu den wenigen Frauen, die als Instrumentalistinnen im Jazz ernst genommen wurden. Später wechselte sie ins Hickory House, wo die halbe New Yorker Jazzwelt regelmäßig vorbeischaute und sich ihrer bewusst wurde. Die Pianistin weiß viele Anekdoten aus diesem Engagement zu erzählen, und de Barros ergänzt diese um Informationen zum Familienleben der McPartlands, die neben einer Wohnung auf der 79sten Straße in Manhattan bald auch ein Häuschen in Long Island besaßen.
Marian erzählt offen von ihrer Beziehung zu Joe Morello, der sich scheiden ließ und sie aufforderte dasselbe zu tun und ihn zu heiraten. Das Jazzgeschäft ging in den 1960er Jahren zurück, und McPartlands neue Tätigkeit als Journalistin für Down Beat war in vielerlei Hinsicht eine Hilfe. Sie war unglücklich, ging regelmäßig zu einem Psychoanalytiker und ließ sich schließlich Ende 1967 von Jimmy scheiden. 1968 gründete sie das Label Halcyon Records, auf dem vor allem Pianisten dokumentiert werden sollten. Sie freundete sich mit dem Komponisten Alec Wilder an, dessen Stücke zu einem wichtigen Teil ihres Repertoires wurden. 1971 folgte sie Mary Lou Williams ins Cookery in Greenwich Village, spielte außerdem im Café Carlyle und ging seit Mitte der 1970er Jahre auch wieder vermehrt auf Tournee.
1978 produzierte Marian McPartland ihre erste “Piano Jazz”-Show mit der von ihr bewunderten Kollegin Mary Lou Williams. Die Geschichten insbesondere über die etwas schwierigeren der Gäste sind höchst amüsant zu lesen und machen einen neugierig diese Shows noch einmal zu hören. Anfang der 1980er Jahre zog sie wieder mit Jimmy McPartland zusammen, der Anfang 1991 starb. McPartland wurden mit zunehmendem Alter und wachsender Gebrechlichkeit ein wenig schwieriger für ihre Umwelt, beschwerte sich über dies und das, wurde ungeduldig, unfair zu denen, die sie umsorgten. Aber sie machte weiter ihre gefeierte Radio-Show, lud immer mehr junge Gäste ein, Kollegen wie Marilyn Crispell oder Brad Mehldau, selbst Elvis Costello. Am 6. Juni 2010 wurde Marian McPartland zum Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE) ernannt.
Paul de Baros’ Buch ist eine “labor of love”, zugleich ein ungemein offenes Buch über eine großartige Musikerin, eine Wanderin zwischen den Welten, die viel vom Jazz erhielt und viel zurückgab über all die Jahre. Ein dickes Buch, eine ungemein vergnügliche Lektüre, absolut empfehlenswert.
Wolfram Knauer (November 2012)
Storia del Jazz. Una prospettiva globale
Von Stefano Zenno
Viterbo 2012 (Stampa Alternativa)
602 Seiten, 25 Euro
ISBN: 978-88-6222-184-9
 Noch eine Jazzgeschichte, mag man denken, aber jede Generation sollte ihre eigene Sicht auf die Geschichte dieser Musik werfen, denn sowohl das Geschichtsbewusstsein wie auch das Wissen um Einflüsse und Wirkungsstränge der Historie ändern sich. Stefano Zenni also hat eine neue 600seitige Jazzgeschichte in italienischer Sprache geschrieben, aus Sicht eines Musikwissenschaftlers mehr als eines Historikers, mit Blick auf musikalische Entwicklungen mehr als auf Anekdoten.
Noch eine Jazzgeschichte, mag man denken, aber jede Generation sollte ihre eigene Sicht auf die Geschichte dieser Musik werfen, denn sowohl das Geschichtsbewusstsein wie auch das Wissen um Einflüsse und Wirkungsstränge der Historie ändern sich. Stefano Zenni also hat eine neue 600seitige Jazzgeschichte in italienischer Sprache geschrieben, aus Sicht eines Musikwissenschaftlers mehr als eines Historikers, mit Blick auf musikalische Entwicklungen mehr als auf Anekdoten.
Zenni verspricht zudem eine globale Perspektive, und es ist an dieser Stelle, an der sein Buch seinem eigenen Anspruch nicht ganz gerecht wird. Europa wird immer mal wieder erwähnt, aber die Diskussion um die Wertigkeit einer europäische Sichtweise auf den Jazz, die insbesondere in den letzten Jahren wieder zunahm, spiegelt sich in seinem Buch höchstens am Rande. Ansonsten ist die “Storia del Jazz” vor allem eine Fleißarbeit, dekliniert die Jazzgeschichte durch alle erdenklichen Aspekte, erwähnt Höhepunkte und Einflussstränge, wichtige Aufnahmen und ästhetische Bewegungen. Am sinnfälligsten ist Zennis neue Sicht auf die Jazzgeschichte dort, wo er Kapitelpaarungen vornimmt, die anderen so vielleicht nicht gleich in den Sinn gekommen wären: Bunny Berigan und Roy Eldridge etwa, Mildred Bailey und Billie Holiday, Fats Waller und Nat King Cole oder besonders Eric Dolphy und Bill Evans. Hier animiert er den Leser zum Nachdenken um Gemeinsamkeiten oder zumindest gemeinsame Auslöser für stilistische Entscheidungen und Entwicklungen.
Typographisch hätte man dem Buch eine bessere Absatzgliederung gewünscht; mit der Entscheidung alle Absätze ohne Einschub zu drucken wirken die Seiten über lange Strecken wie Bleiwüsten, durch die man sich kämpfen muss. Aber dann ist dies Buch sicher vor allem als Referenz etwa für Studierende gedacht oder als Nachschlagewerk für Fans. Dem entspricht eine sorgfältige Indizierung im Namens und Titelregister, die das Buch schnell erschließbar machen.
Wolfram Knauer (November 2012)
Born to Play. The Ruby Braff Discography and Directory of Performances
Von Thomas P. Hustad
Lanham/MD 2012 (Scarecrow Press)
683 Seiten, 59,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8264-5
A cumulative update with additions and corrections can be requested by the author himself: hustad@indiana.edu:
 Ruby Braff zählt zu den bedeutendsten Individualisten des Mainstream-Stils, der in den 1950er Jahren eine Art Amalgam aus swingendem Dixieland und antreibendem Swing präsentierte. Braff war vielleicht der größte Kammermusiker dieses Stilsegments, der in Dixielandensembles genauso mithielt wie in intimen Duobesetzungen etwa mit Ellis Larkins oder Dick Hyman. Thomas R. Hustad hatte noch zu Lebzeiten des 2003 verstorbenen Kornettisten mit der nun vorliegenden Diskographie begonnen und Braff die ersten Kapitel zeigen können. Der sei angetan davon gewesen, dass das Buch sich nicht wie eine Biographie um sein Leben, sondern ausschließlich um seine Musik drehen würde, berichtet Hustad im Vorwort seines fast 700 Seiten starken Werks, das tatsächlich weit mehr ist als eine reine Diskographie, neben den Daten und Titeln des Braffschen Aufnahmeschaffen nämlich auch alle Engagements verzeichnet, die Hustad dokumentieren konnte und zusätzlich aus Artikeln und Kritiken zitiert. So entsteht zwischen den trockenen Besetzungs- und Repertoirelisten das Bild eines umtriebigen, ungemein aktiven Musikers, der mit Swinggrößen genauso zusammenspielte wie er sich mit Musikern anderer Stile maß oder auch mal mit dem klassischen Beaux Arts String Quartet musizierte.
Ruby Braff zählt zu den bedeutendsten Individualisten des Mainstream-Stils, der in den 1950er Jahren eine Art Amalgam aus swingendem Dixieland und antreibendem Swing präsentierte. Braff war vielleicht der größte Kammermusiker dieses Stilsegments, der in Dixielandensembles genauso mithielt wie in intimen Duobesetzungen etwa mit Ellis Larkins oder Dick Hyman. Thomas R. Hustad hatte noch zu Lebzeiten des 2003 verstorbenen Kornettisten mit der nun vorliegenden Diskographie begonnen und Braff die ersten Kapitel zeigen können. Der sei angetan davon gewesen, dass das Buch sich nicht wie eine Biographie um sein Leben, sondern ausschließlich um seine Musik drehen würde, berichtet Hustad im Vorwort seines fast 700 Seiten starken Werks, das tatsächlich weit mehr ist als eine reine Diskographie, neben den Daten und Titeln des Braffschen Aufnahmeschaffen nämlich auch alle Engagements verzeichnet, die Hustad dokumentieren konnte und zusätzlich aus Artikeln und Kritiken zitiert. So entsteht zwischen den trockenen Besetzungs- und Repertoirelisten das Bild eines umtriebigen, ungemein aktiven Musikers, der mit Swinggrößen genauso zusammenspielte wie er sich mit Musikern anderer Stile maß oder auch mal mit dem klassischen Beaux Arts String Quartet musizierte.
Hustad beschreibt Braffs Bewunderung für Louis Armstrong genauso wie seine lebenslange Freundschaft zu anderen in Boston Geborenen wie dem Pianisten und Festivalmacher George Wein oder dem Kritiker Nat Hentoff. Seine ersten Nachweise für einen Braff-Auftritt stammen aus dem Jahr 1944, als der Kornettist gerade mal 17 Jahre alt war. Nur drei Jahre später immerhin stand er bereits mit Jazzgrößen wie Bud Freeman oder Hot Lips Page auf der Bühne. 1949 spielte er in der Band des Klarinettisten Edmond Hall und trat 1950 erstmals auch als Bandleader in Erscheinung. 1952 hörte ihn der Impresario John Hammond bei einem Festival an der Brandeis University und engagierte ihn für einige von ihm produzierte Mainstream-Aufnahmen für das Label Vanguard, die Braff auch nationale Aufmerksamkeit bescherten. Mitte der 1950er Jahre spielte Braff mit Jack Teagarden und Benny Goodman, nahm außerdem seine Duo-Platte mit dem Pianisten Ellis Larkins auf. Er trat auf großen Jazzfestivals auf und war auch im Fernsehen zu hören. Ab Mitte der 1960er Jahre tourte er regelmäßig durch Europa und baute sich insbesondere in Großbritannien eine große Fangemeinde auf. Er war Kornettist der ersten Wahl für George Weins Newport Jazz Festival All Stars und damit auch bei den vielen Festivals mit dabei, die Wein in den 1960er und 1970er Jahren in den USA und Europa etablierte. Wie Harry Edison der meist-gefeaturete Trompeter in Aufnahmen Frank Sinatras war, so wirkte Braff bei vielen Aufnahmen Tony Bennetts in der ersten Hälfte der 1970er Jahre mit. Er nahm Platten für die Labels Concord und Chiaroscuro auf, arbeitete mehr und mehr in Projekten des Pianisten Dick Hyman und gründete ein kurzlebiges, aber sehr erfolgreiches Quartett zusammen mit dem Gitarristen George Barnes. In den 1970er und frühen 1980er Jahren war Braff regelmäßiger Gast der Grand Parade du Jazz in Nizza, und Hustad listet all die unterschiedlichen Besetzungen, in denen der Kornettist dabei zu hören war. Auch in den 1980er Jahren gehörte Braff zu den aktivsten Musikern bei sogenannten Jazz Parties, also Festivals, die auf dem Prinzip der Jam Session basierten. 1993 nahm er seine erste Platte für das Label Arbors auf, dem er bis zu seinem Tod treu blieb.
Die Anlage des Buchs als Diskographie und chronologische Auftrittslistung macht die durchgehende Lektüre etwas schwierig; dafür aber macht das Blättern in dem Buch umso mehr Spaß, bei dem man viele nebensächliche Details verzeichnet findet, die zum einen den Alltag eines arbeitenden Musikers, zum anderen aber auch die Persönlichkeit Braffs beleuchten, der klare Vorstellungen davon hatte, unter welchen Umständen er auftrat. “Egal wo ich spiele – ich suche die Musiker aus. Ich wähle die Stücke aus. Niemand sonst. Ich begleite niemanden!” – so in einer Absage an das Angebot, für eine recht kleine Gage in einer Fernsehshow zu Ehren des Impresarios John Hammond neben Benny Goodman, George Benson, Benny Carter, Teddy Wilson, Red Norvo, Milt Hinton, Jo Jones und anderen aufzutreten. Diese Erklärung schloss er übrigens mit den Worten: “Ich habe kein Interesse an Eurer gottverdammten Show. Gibt’s sonst noch irgendwelche Fragen?”
Wolfram Knauer (November 2012)
Always in Trouble. An Oral History of ESP-Disk, the Most Outrageous Record Label in America
von Jason Weiss
Middletown/CT 2012 (Wesleyan University Press)
291 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-8195-7159-5
 Zwischen 1964 und 1974 war das von Bernard Stollman gegründete Plattenlabel ESP-Disk’ vielleicht eines der einflussreichsten Labels des Avantgarde-Jazz. Neben Free-Jazz-Heroen wie Albert Ayler, Pharoah Sanders, Sun Ra brachte Stollman dabei auch Platten von Folk-Rock-Bands wie The Fugs oder Pearls Before Swine heraus. In seinem neuen Buch erzählt Jason Weiss die Geschichte des Labels, beispielhaft für die Biographie einer unabhängigen Plattenfirma im Amerika der Bürgerrechtsbewegung.
Zwischen 1964 und 1974 war das von Bernard Stollman gegründete Plattenlabel ESP-Disk’ vielleicht eines der einflussreichsten Labels des Avantgarde-Jazz. Neben Free-Jazz-Heroen wie Albert Ayler, Pharoah Sanders, Sun Ra brachte Stollman dabei auch Platten von Folk-Rock-Bands wie The Fugs oder Pearls Before Swine heraus. In seinem neuen Buch erzählt Jason Weiss die Geschichte des Labels, beispielhaft für die Biographie einer unabhängigen Plattenfirma im Amerika der Bürgerrechtsbewegung.
Stollman war ein aufstrebender Rechtsanwalt, der in den späten 1950er Jahren in der Esperanto-Bewegung aktiv war, die eine universelle Sprache befürwortete. Anfang der 160er Jahre hörte er die Musiker der sogenannten October Revolution in Jazz und nahm bald etliche der Künstler auf, die in dieser künstlerischen Bewegung mitmischten. In den zehn Jahren des Bestehens des Labels brachte er auf ESP-Disk’ 125 Platten heraus, die zwar von der Kritik hoch gelobt wurden, aber kaum Geld einbrachten. Eigentlich war das Label bereits nach vier Jahren pleite, aber Stollman hing an der Idee. Nachdem das Label endgültig abgewickelt war, nahm Stollman einen Rechtsanwalts-Job für die Regierung an. ESP führte ein seltsames Schattenleben, da die legendären Aufnahmen in Europa und Japan als Bootlegs auf dem Markt präsent gehalten wurden. Zehn Jahre nach seiner Pensionierung belebte Stollman das Label 2005 wieder und managt seither sowohl Wiederveröffentlichungen wie auch Neuproduktionen aus seinem Büro in einem ehemaligen Waschsalon im Viertel Bedford Stuyvesant von Brooklyn. Neben der Arbeit mit dem originären ESP-Material widmet sich Stollman dabei auch der Vertretung der musikalischen Nachlässe von Eric Dolphy, Bud Powell, Art Tatum, Sun Ra, Albert Ayler und einigen anderen, betreut dabei auch Wiederveröffentlichungen oft ursprünglich schwarz mitgeschnittener Konzertaufnahmen dieser Künstler.
All dies erfährt man im knappen Vorwort, in dem Weiss die Hintergründe des Labels zusammenfasst. Ansonsten lässt er die Macher reden. Den größten Teil des Buchs nimmt dabei Stollmans Erinnerung ein, der über seine eigene Herkunft aus einem jüdischen Elternhaus berichtet, über Militärdienst, Studium und erste Jazzkontakte. Stollman erzählt über die Idee zum Plattenlabel, den Kontakt zu und die Verträge mit Künstlern, über seine Naivität in geschäftlichen Dingen. In einem anderen Kapitel erklärt Stollman spätere Lizenzausgaben von ESP-Platten und beschreibt die Deals, die er mit den Lizenznehmern gemacht habe. Er erinnert sich an legendäre Sessions etwa mit Albert Ayler, Giuseppi Logan, Sun Ra, Frank Wright oder Yma Sumac. Er erzählt außerdem davon, wie er einmal Barbra Streisand zum Essen ausführte, die die Einladung nur annahm, weil sie dachte, er sei ihr Freund, der zufällig genau wie er hieß, über Begegnungen mit Jimi Hendrix, Yoko Ono und John Lennon, Janis Joplin sowie Emmylou Harris.
Der zweite Teil des Buchs stellt Stollmans Erinnerungen Interviews mit fast 40 Künstlern gegenüber, die über ihre Zusammenarbeit mit ihm und über ihre ESP-Platten berichten. Gunter Hampel etwa erzählt, dass Stollman ihn nie bezahlt habe, und er sich auch deshalb entschieden habe, sein eigenes Plattenlabel zu gründen. Auch andere Künstler klagten (wie so oft in dieser Industrie) über nicht eingehaltene finanzielle Zusagen, Milford Graves aber erklärt auch: “Wer sonst hätte uns damals aufgenommen?”
Jason Weiss’ Buch klammert also kein Thema aus und lässt die unterschiedlichen Sichtweisen der Partner bei den Plattenprojekten nebeneinander stehen. So ergibt sich in seinem lesenswerten Buch ein überaus stimmungsvolles Bild eines Labels, das eine der interessantesten amerikanischen Szenen der 1960er Jahre dokumentiert.
Wolfram Knauer (Oktober 2012)
Freie Hand
Roman, von Rainer Wieczorek
Berlin 2012 (Dittrich Verlag)
ISBN: 978-3-937717-83-8
 Rainer Wieczoreks Romane haben immer wieder Subplots aus dem Jazz. Wieczorek ist selbst Posaunist und hat über viele Jahre regelmäßig Jazzkonzerte organisiert. Sein neuester Roman ist von den bisherigen Büchern vielleicht der jazzhaltigste, auch deshalb, weil viele eigene Erinnerungen in das Buch über die Mühen kultureller Arbeit einflossen. Das Buch handelt von zwei ambitionierten Literaturliebhabern, einen Ort aufzubauen, der irgendwo zwischen Literatur- und Jazzclub angesiedelt ist und der Kulturszene ihrer Stadt neue Facetten beimischen soll.
Rainer Wieczoreks Romane haben immer wieder Subplots aus dem Jazz. Wieczorek ist selbst Posaunist und hat über viele Jahre regelmäßig Jazzkonzerte organisiert. Sein neuester Roman ist von den bisherigen Büchern vielleicht der jazzhaltigste, auch deshalb, weil viele eigene Erinnerungen in das Buch über die Mühen kultureller Arbeit einflossen. Das Buch handelt von zwei ambitionierten Literaturliebhabern, einen Ort aufzubauen, der irgendwo zwischen Literatur- und Jazzclub angesiedelt ist und der Kulturszene ihrer Stadt neue Facetten beimischen soll.
Sie bemühen sich um kommunale wie private Unterstützung, finden einen passenden Ort und sichern ihr Projekt auch finanziell erfolgreich ab. Ihr Club eröffnet und wird schnell zu einem angesagten kulturellen Treffpunkt. Sie etablieren eine Sachbuchreihe, eine weitere, die Hörspiele in den Mittelpunkt stellt, sowie eine mit Klassikern der Nachkriegsmoderne, die sie mit Musik kombinieren. Der Saxophonist Heinz Sauer wird zusammen mit dem Pianisten Bob Degen für einen Billie-Holiday-Abend gewonnen, bei dem eine Schauspielerin aus der Autobiographie der Sängerin liest. Sauer, charakterisiert Wieczorek seine Musik, spielt “Töne am Rande des Noch-Spielbaren, die stets bedroht waren vom Kontaktverlust, um sich dann, an der äußersten Kante stehend auffangen zu lassen vom Klavier oder sich ersatzweise einem leise verebbenden Nachspiel ergaben”. Oft schien “nur Bob Degen sicher zu wissen, an welcher Stelle sich Sauer befindet, von welchem Akkord die Töne, die jetzt erklingen, ihren Ausgang nahmen, bevor sie ihn vollständig verließen.”
Ein andermal ist Heinz Sauer zu einem Gesprächskonzert zu Gast, für das er den jungen Pianisten Michael Wollny mitbringt. Sauer erinnert sich an diesem Abend an seine Kindheit, an die Normalität des Nationalsozialismus, and sein Faible für den Jazz nach dem Krieg. Auch andere (real existierende) Musiker treten in Erscheinung, der Vibraphonist Christopher Dell etwa, der einen Gedichtabend begleitet, oder der Pianist Uli Partheil, der zu einem Gespräch mit dem Schriftdesigner Hermann Zapf spielt.
Die Kulturarbeit normalisiert sich, und neben vollen gibt es auch leere Säle, etwa bei jenem Abend, den die beiden “dem unbekannten Autor” widmen und bei dem ein Cellist und ein Pianist kurze Stücke von Anton Webern spielen, während die üblicherweise der Lesung vorbehaltene Zeit jetzt einfach der Stille dient. “Wir brauchen nicht jedesmal ein Publikum”, sinnieren sie, “stets aber die Möglichkeit eines Publikums, formulieren wir genauer: den Raum für ein Publikum.”
Dann setzen politische Veränderungen ein, die auch die Kultur in der Stadt betreffen. Und schließlich zieht ihr großzügiger Geldgeber sich mehr und mehr von seinen Zusagen zurück. Und so kommt es, “dass unsere Programme nur noch pro forma gedruckt wurden und zumeist nur eine einzige Veranstaltung enthielten, die ernsthaft mit Publikum rechnen konnte”. Der Niedergang ihres Projekts ist abzusehen, lässt sie aber nicht ohne Hoffnung. Es muss doch möglich sein, wieder so einen kunstsinnigen Geldgeber zu finden…
Alle Autoren, von denen Wieczorek in seinem Roman fasziniert ist, existieren genauso wie die Musiker, die er nennt und mit denen er auch in Wirklichkeit gern und oft zusammenarbeitete. Das Gesprächskonzert mit Heinz Sauer hat genauso stattgefunden wie die Gesprächsrunde mit Hermann Zapf. Und Dirk Lorenzen, dessen astrophysikalische Texte als eine Art Zwischenspiel dienen, als Blick von und auf “ganz außen” quasi, ist tatsächlich, wie von Wieczorek beschrieben, für viele der Himmelsgeschichten in der Sendung “Sternzeit” des Deutschlandfunks verantwortlich. Auch viele der anderen Personen der Erzählung haben Vorbilder in der realen Lebenswirklichkeit des Autors. Solche Kenntnis aber braucht es nicht, um den Roman, der gekonnt zwischen den Lieben Wieczoreks wechselt, als ein Buch zu genießen, dessen Thema Kreativität genauso ist wie der Raum, der unbedingt notwendig ist, um sie zu ermöglichen. Das Lesevergnügen ergibt sich aus der Leichtigkeit des sprachlichen Stils, aus der Balance zwischen Dialogen, Beschreibungen, Begeisterungsfähigkeit und der Gabe, auch Misserfolge als das wahrzunehmen, was sie sind: Versuche, die unternommen werden müssen, weil Kunst nun mal nur gedeiht, wenn man vorbehaltlos ihren Raum zugesteht.
Wolfram Knauer (August 2012)
Strictly a Musician. Dick Cary. A Biography and Discography
von Derek Coller
Sunland/CA 2012 (Dick Cary Music)
602 Seiten, 59,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-615-53867-9
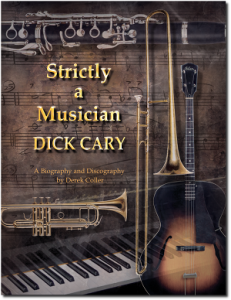 Dick Cary gehört vielleicht nicht zu den bekanntesten Namen der Jazzgeschichte. Als Pianist, Althorn-Spieler, Trompeter, Komponist und Arrangeur war er allerdings seit den frühen 1940er Jahren auf der traditionellen Jazzszene New Yorks überaus aktiv und spielte mit allen Musikern des Jazzrevivals jener Jahre, mit Eddie Condon, Billy Butterfield, Louis Armstrong, Jimmy Dorsey, Bobby Hackett und vielen anderen. Cary war darüber hinaus ein Musiker mit offenen Ohren, der Interesse auch an dem hatte, was Kollegen anderer Stilrichtungen damals entwickelten. Vor allem aber hinterließ der 1916 geborene und 1994 gestorbene Musiker Tagebücher, die mit wenigen Lücken sein Leben und seine Arbeit zwischen 1931 und 1992 dokumentieren.
Dick Cary gehört vielleicht nicht zu den bekanntesten Namen der Jazzgeschichte. Als Pianist, Althorn-Spieler, Trompeter, Komponist und Arrangeur war er allerdings seit den frühen 1940er Jahren auf der traditionellen Jazzszene New Yorks überaus aktiv und spielte mit allen Musikern des Jazzrevivals jener Jahre, mit Eddie Condon, Billy Butterfield, Louis Armstrong, Jimmy Dorsey, Bobby Hackett und vielen anderen. Cary war darüber hinaus ein Musiker mit offenen Ohren, der Interesse auch an dem hatte, was Kollegen anderer Stilrichtungen damals entwickelten. Vor allem aber hinterließ der 1916 geborene und 1994 gestorbene Musiker Tagebücher, die mit wenigen Lücken sein Leben und seine Arbeit zwischen 1931 und 1992 dokumentieren.
Derek Coller konnte auf diese Tagebücher zurückgreifen, um in seiner ungemein detaillierten Biographie die Lebensgeschichte Carys zu erzählen. Coller beschreibt die Jugend des in Connecticut geborenen Cary, erste Banderfahrungen, die nicht die besten waren (“Ich wurde aus der Band geworfen”) sowie erste Engagements, die Geld einbrachten. Die üblichen Einflüsse der Zeit galten auch für Cary, den Pianisten: Fats Waller, Earl Hines, Teddy Wilson, Art Tatum und Bob Zurke; seine ersten Arrangements brachten ihm 1939 fast einen Job mit Glenn Miller ein. Irgendwann Anfang der 1940er Jahre zog Cary mit Frau und Tochter nach New York, wo er einen Großteil seines Einkommens aus Arrangements bezog – allein zwischen 1940 und 1941 schrieb er mehr als 130 Arrangements für etwa 20 verschiedene Bands und Sänger/innen. Im Dezember 1941 trat er zum ersten Mal im legendären Club Nick’s in New Yorks Greenwich Village mit Eddie Condon, Pee Wee Russell und anderen Größen des Stils auf; meist war er dabei Pianist, hin und wieder trat er aber auch als Trompeter in Erscheinung.
Mitte der 1940er Jahre spielte Cary in der Bigband des Trompeters Billy Butterfield, in der er als 5. Trompeter, Althornist und Arrangeur angestellt war. 1947 wirkte er bei einem legendären Konzert der Armstrong All-Stars in der New Yorker Town Hall mit und wurde im Sommer des Jahres für sechs Monate reguläres Mitglied der All-Stars. Er spielte auf der 52nd Street, insbesondere im Club Jimmy Ryan’s, und er nahm Unterricht beim klassischen Komponisten Stefan Wolpe. Jimmy Dorsey engagierte ihn für seine Band, und Cary schrieb außerdem Musiken für Werbefilmchen und fürs Fernsehen. Auch in den 1950er Jahren gehörte er zu den verlässlichen Musikern der traditionellen Szene, trat mit Max Kaminsky auf sowie mit jeder Menge anderer namhafter Musiker, auch solchen der Swingära, die damals in Dixielandschuppen ihr Geld verdienen mussten. Ende der 1950er Jahre war er reguläres Mitglied der Band Bobby Hacketts; machte sich außerdem einen Namen als einer jener Arrangeure, die versuchten, dem traditionellen Jazz einen interessanteren Klang zu verleihen.
Anfang der 1960er Jahre zog Cary nach Kalifornien, trat wieder zunehmend als Althornist in Erscheinung und spielte in regelmäßig in Disneyland. Gegen Ende des Jahrzehnts wurde er außerdem Mitglied der World’s Greatest Jazz Band. In den 1970ern reiste er oft und gern nach Europa und trat hier auch mit vielen europäischen Bands als Gastsolist auf – nicht zuletzt mit der deutschen Barrelhouse Jazzband. Er wurde als Solist zu den populären “Jazz Party”-Festivals eingeladen und wirkte auf etlichen Platten mit. Anfang der 1990er Jahre wurde bei ihm eine Krebserkrankung festgestellt, an der er im April 1994 verstarb.
Derek Collers Buch ist allein schon dank der dem Autor zur Verfügung stehenden Tagebücher ungemein faktenreich. Coller listet Besetzungen und Konzertdaten, zitiert Cary und ordnet dessen Bemerkungen sogleich ins Jazzgeschehen der Zeit ein. Das sorgt nicht unbedingt für eine flüssige Lektüre, und doch gibt gerade diese Genauigkeit, mit der Coller Carys Leben dokumentiert, dem Buch eine besondere Qualität: Wir erfahren über die Jazzszene der Condon-Freunde aus erster Hand, über “die andere Seite” der 52nd Street sozusagen, die ansonsten vor allem für die Ausbildung des Bebop genannt wird. Das Privatleben Carys kommt bei alledem etwas kurz in der Darstellung. Nur ein kurzes zwischengeschobenes Kapitel gibt Aufschluss über Carys lebenslangen Kampf mit dem Alkohol. Und auch über die Musik selbst erfahren wir wenig. Dafür ist Collers Buch eine Fakten-Biographie und damit eine gute Quelle für Forscher, da es qua Tagebücher auf erstklassige Zeitzeugendetails verweist. Die Diskographie, die fast 100 Seiten des Buchs einnimmt, gibt einen Überblick über Carys Aufnahmeschaffen. Und der ausführliche Namensindex erschließt das Buch schnell für Forscher, die nach Fakten und Hinweisen suchen, die anderweitig schwer zu finden wären.
“Strictly a Musician” ist auf jeden Fall eine wichtige Ergänzung der jazzgeschichtlichen Forschung, die Fleißarbeit eines langjährigen Jazzjournalisten und Privatforschers und ein Buch, das sich nicht nur vom Umfang her mit Manfred Selchows wegweisenden Werken über Edmond Hall und Vic Dickenson vergleichen lässt.
Wolfram Knauer (September 2012)
Blues 2013. Rare Photographs by Martin Feldmann
Kalender von Martin Feldmann
Attendorn 2012 (Pixelbolide)
Kalender, 12 Monatsblätter, 24,95 Euro
www.blueskalender.de
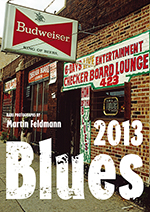 Martin Feldmann fotografiert seit den frühen 1980er Jahren Bluesmusiker für deutsche und amerikanische Fachmagazine, arbeitete außerdem lange Zeit für die Frankfurter Rundschau, für die er immer wieder Beiträge über Blues und Jazz verfasste.
Martin Feldmann fotografiert seit den frühen 1980er Jahren Bluesmusiker für deutsche und amerikanische Fachmagazine, arbeitete außerdem lange Zeit für die Frankfurter Rundschau, für die er immer wieder Beiträge über Blues und Jazz verfasste.
Jetzt hat Feldmann einen Blueskalender herausgebracht, für den er einige der aussagekräftigsten Bilder seiner diversen Bluesreisen in die USA aus den 1980er Jahren herausgesucht hat. Wir sehen Junior Wells im Club, Charles W. Thompson alias Jimmy Davis bei einem Straßenkonzert, Lefty Dizz auf einer Harley Davidson, Beverly Johnson mit schwarzen Netzhandschuhen, Wade Walton im Barbershop in Clarksdale, Mississippi, Little Milton beim Chicago Festival, Eddie Taylor im Golden Slipper, Chicago, Big Walter Horton, Magic Slim,Harry Caesar. Little Pat Rushing und Queen Silvia Embry. Sie alle sind in Schwarzweiß- und einigen Farbaufnahmen auf großformatige Kalenderblätter gedruckt, die kurze Zusatzinformationen bieten und jedem Raum automatisch eine bluesige Note verleihen.
Vielleicht sollte man dazu ein wenig Musik laufen lassen, damit man dem Blues, den man sowieso jeden Tag erfährt, visuell genauso wie tönend genügend positive Noten abgewinnen kann.
Wolfram Knauer (September 2012)
Jazz. Body and Soul. Photographs and Recollections
von Bob Willoughby
London 2012 (Evans Mitchell Books)
178 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-901268-58-4
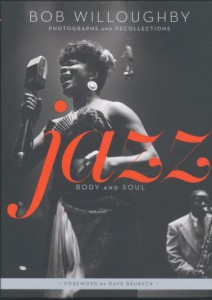 Der 2009 in Südfrankreich verstorbene Fotograf Bob Willoughby dokumentiert die Jazzgeschichte seit den frühen 1950er Jahren. Jetzt erschien ein von Willoughby noch zu Lebzeiten im Entwurf geplantes Buch seiner besten Aufnahmen, die zwischen 1950 und 1959 sowie zwischen 1992 und 1994 datieren. Die frühen Bilder wurden in Los Angeles aufgenommen, die späten Fotos auf Einladung Ulli Pfaus in der Liederhalle in Stuttgart. Willoughby begleitet seine Rückschau in Bildern dabei mit Erinnerungen an die Konzerte und die Künstler, die er da dokumentierte.
Der 2009 in Südfrankreich verstorbene Fotograf Bob Willoughby dokumentiert die Jazzgeschichte seit den frühen 1950er Jahren. Jetzt erschien ein von Willoughby noch zu Lebzeiten im Entwurf geplantes Buch seiner besten Aufnahmen, die zwischen 1950 und 1959 sowie zwischen 1992 und 1994 datieren. Die frühen Bilder wurden in Los Angeles aufgenommen, die späten Fotos auf Einladung Ulli Pfaus in der Liederhalle in Stuttgart. Willoughby begleitet seine Rückschau in Bildern dabei mit Erinnerungen an die Konzerte und die Künstler, die er da dokumentierte.
Neben den üblichen Konzertfotos – Musiker auf der Bühne – gibt es lebendige Backstagebilder, neben weithin bekannten Aufnahmen wie Willoughbys legendären Chet-Baker-Portraits auch selten bis nie gesehene Ansichten von Musikern bei der Arbeit. Der Index am Schluss des Buchs listet die Künstler: Billie Holiday, Miles Davis, Dave Brubeck, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Stan Kenton, Duke Ellington, Big Jay McNeely (der mit einer ganzen Fotoserie im Buch vertreten ist), Cal Tjader, Gerry Mulligan, Peggy Lee, Benny Goodman, Frank Sinatra, Wynton Marsalis und viele, viele mehr. Willoughbys kurze Erinnerungen geben nur kleine Einblicke in seine eigene Jazzsicht, referieren ansonsten eher bekanntes Wissen über die Musiker. Als Fotograf hatte er ein exzellentes Auge für die Musiker, die er ablichtete; und Ulli Pfau hatte nicht Unrecht, als er ihn 1992 als “elder statesman of jazz photography” bezeichnete.
Einige Höhepunkte beim Durchblättern: Bing Crosby und Frank Sinatra inmitten des Sets für den Film “Can-Can”; Louis Armstrong, Grace Kelly und Bing Crosby im Set für “High Society”; Benny Goodman in einem Duo mit Stan Getz; der überschlanke Gerry Mulligan, dessen Instrument quasi aus seinem Körper herauszuwachsen scheint; Paul Gonsalves vor dem Spiegel seiner Garderobe; Coleman Hawkins auf einen Stuhl gelehnt in die Kamera lächelnd; der blinde George Shearing, der sich für eine Ansage am Mikrophon festzuklammern scheint; Miles Davis, zurückgelehnt und entspannt; Lionel Hampton, der Milt Buckner über die Schulter schaut… Aber jeder Betrachter wird seine eigenen Höhepunkte in diesem Buch finden, das mit einem wunderbaren Backstagebild abschließt, auf dem Wycliffe Gordon backstage in Stuttgart im Fernsehmonitor seinem Chef Wynton Marsalis zusieht.
“Jazz – Body and Soul” präsentiert Willoughbys Aufnahmen in hervorragender Druckqualität in einer Hardcoverausgabe im Schuber und mit einem Vorwort Dave Brubecks, den Willoughby seit 1950 immer wieder ablichtete, in Bildern, die zum Teil auch ihren Weg auf Brubeck-Plattencover fanden. Ein schönes Geschenk für Jazzfans – auch an sich selbst.
Wolfram Knauer (September 2012)
Deep South. The Story of the Blues
von Peter Bölke
Hamburg 2012 (Edel ear book)
156 Seiten, 4 CDs, 39,95 Euro
ISBN: 978-3-94000-98-7
 Wie alle “earbooks” von Edel ist auch “Deep South” ein opulentes, hardcover-gebundenes Buch mit stabil in den Buchdeckel eingepassten Aussparungen für die beiheftenden vier CDs – und das alles zu einem mehr als angemessenen Preis.
Wie alle “earbooks” von Edel ist auch “Deep South” ein opulentes, hardcover-gebundenes Buch mit stabil in den Buchdeckel eingepassten Aussparungen für die beiheftenden vier CDs – und das alles zu einem mehr als angemessenen Preis.
Peter Bölkes parallel auf deutsch und englisch verfasste Texte zum Blues und seinen Künstlern ist eingängig und verständlich, nie zu tief greifend, dafür Legenden und Anekdoten weitertragend. Die vier Großkapitel, die dem Inhalt auf den CDs entsprechen, heißen “Rough Sound from the Delta” (Folk/Classic Blues), “Rockin’ the House” (Piano Blues), “Blue Notes from the Cookbook” (Jazz & Blues) sowie “Amplified, Young & White” (Electric Blues). Sie decken die Bluesgeschichte von den Anfängen (Mamie Smiths “Crazy Blues” von 1920) über Country-Blues, Boogie-Woogie, Blues-Interpretationen großer Jazzmusiker bis zum rockigen Blues der 1960er Jahre ab.
Was fehlt, mag jeder für sich entscheiden – dieser Rezensenten etwa vermisste den größte instrumentalen Blueskünstler des Jazz, nämlich Charlie Parker –, aber das wären genauso subjektive Entscheidungen wie Bölke sie für sich vorgenommen hat.
Das Buch ist reich und bunt bebildert mit bekannten und weniger bekannten Fotos der Künstler und einzelner Alben, gedruckt auf festem Papier, und in guter Tonqualität gepresst. Wie die meisten der ear books ist das alles in seinem Sampler-Ansatz weniger etwas für Sammler als für den beiläufigen Interessenten, aber auch für Bluesfans ganz gewiss ein willkommenes Geschenk.
Wolfram Knauer (August 2012)
Modern Piano Method. Klavier spielen – nach Noten und Akkorden
von Georg Boeßner
Frankfurt 2012 (Nordend Music)
144 Seiten, 1 CD, 24.,95 Euro
ISBN: 978-3-9812448-1-6
 Der Klavierunterricht, schreibt Georg Boeßner im Vorwort zu seiner Klavierschule, gehe zwar zunehmend auch in Richtung Pop, Rock und Jazz, auf dem Markt der Klavierschulen aber spiegele sich dieses Bedürfnis kaum wider, insbesondere, was die zur klassischen Notation gleichrangige Vermittlung des Spielens nach Akkordsymbolen beträfe.
Der Klavierunterricht, schreibt Georg Boeßner im Vorwort zu seiner Klavierschule, gehe zwar zunehmend auch in Richtung Pop, Rock und Jazz, auf dem Markt der Klavierschulen aber spiegele sich dieses Bedürfnis kaum wider, insbesondere, was die zur klassischen Notation gleichrangige Vermittlung des Spielens nach Akkordsymbolen beträfe.
Boeßners Schule also will beides miteinander verknüpfen. Er beginnt ganz am Anfang, Sitzhaltung, Tastatur, Notensystem, einfache Lieder. Dann kommen erste Akkorde, die Boeßner gleich nicht nur mit Noten, sondern eben auch mit Akkordsymbolen vorstellt.
Ein erster Blues, Einführung komplexerer Rhythmik, das Zusammenspiel rechter und linker Hand, und schließlich andere Tonarten (als das anfängliche C-Dur). Zwischendrin immer wieder Rückgriffe auf Essentials, Erklärungen der Intervalle etwa, der Dur- und Mollakkorde. Und neben Fingerübungen immer wieder kleine Stücke, die den Schüler bei Laune halten und ihn langsam ans Spielen heranführen – und zwar eben nicht nur ans sture Notenablesen, sondern auch ans Begreifen der harmonischen Grundlagen, das für spätere Improvisation so wichtig ist.
Die Selbstverständlichkeit dieses Ansatzes mag hoffentlich bewirken, dass die Nutzer seiner Klavierschule sich später viel leichter vom Notenblatt lösen können als diejenigen, die nach konventionellen Methoden ans Klavier herangeführt wurden.
Wolfram Knauer (August 2012)
The Ellington Century
von David Schiff
Berkeley 2012 (University of California Press)
319 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-520-24587-7
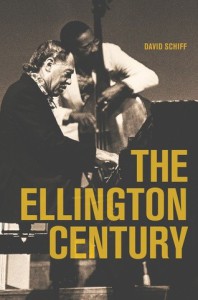 Noch ein Buch über Ellington, mag der eine oder andere sagen, aber David Schiffs “Ellington Century ist mehr als dies. Schiff versucht Ellington in die Musikgeschichte des 20sten Jahrhunderts einzuordnen und ihn dabei, wie der Duke sagen würde, “beyond categories” zu betrachten, also nicht nur in Bezug auf den Jazz-Background, aus dem er kam.
Noch ein Buch über Ellington, mag der eine oder andere sagen, aber David Schiffs “Ellington Century ist mehr als dies. Schiff versucht Ellington in die Musikgeschichte des 20sten Jahrhunderts einzuordnen und ihn dabei, wie der Duke sagen würde, “beyond categories” zu betrachten, also nicht nur in Bezug auf den Jazz-Background, aus dem er kam.
Schiff geht dafür in seinen Kapiteln zuallererst einmal von der Musik selbst aus. Er beginnt mit dem Kapitel “Such Sweet Thunder”, beschreibt Musik und Entstehungsgeschichte der Suite, erwähnt, dass die Komposition bei ihrer Premiere gleich neben Kurt Weills Violinkonzert gespielt wurde und stellt fest, dass die musikalischen Experimente des 20sten Jahrhunderts eben im Jazz genauso stattfanden wie in der sogenannten klassischen Moderne. Er erlaubt sich schließlich den Seitenblick auf Arnold Schönbergs Fünf Stücke für Orchester op. 16, “Farben”. “Blue Light: Color” heißt das zweite Kapitel, das solchen Farben in Ellingtons Musik auf den Grund zu gehen versucht. Schiff analysiert “Blue Light” im Lichte des Blues, “Ko-Ko” als “schwarze” Erfahrung, schließt dann Ausflüge an zu Schönbergs “Pierrot Lunaire” und zu Debussys Musik, um schließlich zu Ellingtons ganz eigener “Klangfarbenmelodie” zurückzukehren.
Im Kapitel “Cotton Tail” nähert sich Schiff dem Phänomen der Rhythmik in Ellingtons Musik, aber auch weit genereller dem Phänomen des swing. Er arbeitet dabei die Unterschiede zwischen pulsierendem Rhythmus, melodischem Rhythmus, einer vom Grundrhythmus abweichenden “supermelody” sowie dem Shout-Rhythmus heraus. Zugleich geht er auf die Unterschiede zwischen europäischer und afro-amerikanischer musikalischer Auffassung ein und diskutiert verschiedene Aufnahmen des “Tiger Rag” sowie James P. Johnsons “Carolina Shout” mit Hinblick auf ihre rhythmischen Qualitäten. Nach all diesen Argumenten animiert Schiff seine Leser dazu, “Cotton Tail” noch einmal zu hören und wahrzunehmen, mit wie viel verschiedenen Ebenen Ellington hier meisterhaft spielt. Auch dieses Kapitel kommt dabei nicht ohne einen Seitenblick auf die europäische Musiktradition aus und betrachtet dazu Béla Bartóks 5. Streichquartett, Igor Stravinski sowie John Cage, Charlie Parker und Eric Dolphy.
“Prelude to a Kiss” beschäftigt sich mit der Melodik Ellingtons und schaut daneben nicht nur auf klassische Beispiele, sondern auch auf die Tin Pan Alley-Schlager der Zeit. Schiff fragt nach der melodischen Sexualisierung im Jazz (und stützt sich dabei auf fragwürdige Analysen, nach denen in klassischer Musik Chromatik oft für Sexualität stünde). Er interpretiert Billy Strayhorns “Day Dream” als “Bluesisierung” des Songmodells und analysiert “U.M.M.G.” auf seine thematische Melodik hin.
“Satin Doll” ist das Kapitel über Ellingtons Harmonik überschrieben, in dem Schiff Parallelen zu anderen harmonisch besonders aktiven Künstlern von Bill Evans bis Charles Mingus aufzeigt, aber auch auf Ravel Debussy, Schostakowitsch verweist. “The Clothed Woman” analysiert er schließlich im Lichte der atonalen Experimente europäischer Komponisten des frühen 20sten Jahrhunderts.
Klangfarbe, Rhythmik, Melodik und Harmonik, schreibt Schiff, sind allerdings nur Werkzeuge. Für den Komponisten komme es letzten Endes darauf an, eine Geschichte zu erzählen. Der zweite Teil seines Buchs also widmet sich den Geschichten, die hinter Ellingtons Arbeit stecken, Geschichten, die sich mit Liebe, Sexualität, Rassismus, schwarzem Geschichts- und Kulturbewusstsein befassen. Als Beispiele analysiert er ausführlich die Suite “Such Sweet Thunder, Ellingtons vielleicht wichtigste Suite “Black, Brown and Beige” sowie seine “Sacred Concerts”.
David Schiffs “The Ellington Century” ist keine Biographie des Duke. Sie geht von der Musik aus und versucht diese in den Kontext musikalischer Entwicklungen des 20sten Jahrhunderts zu stellen und dadurch die Sonderstellung Ellingtons herauszuarbeiten. Der konstante Seitenblick insbesondere auf die europäische Kompositionstradition wirkt dabei weder herablassend noch anmaßend, sondern wird Ellingtons eigenem Musikverständnis gerecht und erlaubt in der Selbstverständlichkeit der Parallelbetrachtungen durchaus neue Erkenntnisse über Ellingtons Bedeutung.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
theoral, #4 / Nicola Brooks / Clayton Thomas
herausgegeben von Philipp Schmickl
Nickelsdorf 2012 (www.theoral.org)
 Philipp Schmickl nutzt die Gunst der Stunde, die Gunst des Ortes, nämlich Nickelsdorf, jenes Mekkas für freie Musik, zu Gesprächen mit Musikern anderen interessanten Menschen, und die Buchreihe theoral dokumentiert diese Gespräche so wie sie stattfanden, verbale Exkursionen inklusive.
Philipp Schmickl nutzt die Gunst der Stunde, die Gunst des Ortes, nämlich Nickelsdorf, jenes Mekkas für freie Musik, zu Gesprächen mit Musikern anderen interessanten Menschen, und die Buchreihe theoral dokumentiert diese Gespräche so wie sie stattfanden, verbale Exkursionen inklusive.
Mit Nicole Brooks unterhält er sich in Ausgabe 4 von theoral über Interviews, über die Faszination an der Lektüre eigener Tagebücher, über die Idee der Ehe, über Brooks Kindheit in New Mexico, über Reisen nach Brasilien und in die Tschechische Republik, über Männer, die ihr in verschiedenen Ländern auf der Straße folgten, über ihre Motivation zu reisen und über Planlosigkeit und Zufälle in ihren Reiseerfahrungen. Brooks ist einfach nur eine Besucherin des Nickelsdorfer Festivals, eine “freie” Reisende, eine Weltenbummlerin.
Mit Clayton Thomas hat Schmickl dann einen Musiker vor seinem Mikrophon, diesmal nicht in Nickelsdorf, sondern im Hotelzimmer in Sibiu, Rumänien. Thomas erzählt von seiner Kindheit in Tasmanien, von ersten Versuchen den Bass zu spielen, von ersten Reisen nach New York, wo er beim Vision Festival mit jeder Menge neuer Musik konfrontiert wurde, von ersten Gigs als Bassist in Sydney und New York, wo er 2002 schließlich auch selbst beim Vision Festival mitwirkte. Er berichtet vom NOW now Festival in Sydney, von seinem Umzug nach Berlin im Jahr 2007, und er reflektiert über Einflüsse wie William Parker und Barry Guy sowie über aktuelle Bandprojekte, an denen er beteiligt ist: das Splitter Orchestra etwa oder The Ames Room. Die beiden sprechen moch ein wenig übers Reisen, darüber, wie Thomas Musik “denkt”, sowie über Kunst und Revolution.
Schmickls Bücher vermitteln das großartige Gefühl unverfälschter und inspirierter Interviews, und diese Tatsache ist dem Herausgeber wohl bewusst, der sich im Vorwort etwa bei Christof Kurzmann bedankt, mit dem er sich vor dem Interview mit Brooks unterhalten habe und bei Tobias Delius, den er kurz vor demselben Interview habe spielen hören, und die ihn beide als Fragesteller und Gesprächspartner inspiriert hätten. Ein Lesevergnügen also, das gerade in der Gesprächhaftigkeit und in der Offenheit des Herausgebers, die Konversation in alle möglichen Richtungen abdriften zu lassen, eine Menge mehr über die Gesprächspartner vermittelt als es manch ein systematischerer Artikel vermögen würde.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
Jutta Hipp. Ihr Leben & Wirken. Malerin – Pianistin – Poetin. Eine Dokumentation
von Gerhard Evertz
Hannover 2012 (Eigenverlag)
196 Seiten
siehe auch: www.jazzbuch-hannover.de
 Als Gerhard Evertz 2004 sein Buch “Hannover – ein Stück Jazzgeschichte” herausbrachte, hatte er bei der Recherche jede Menge Material insbesondere über Jutta Hipp gefunden, die zwar gerade ein Mal in Hannover gespielt hatte, die aber enge verwandtschaftliche Beziehungen in die Stadt an der Leine besaß und behielt, nachdem sie 1955 nach New York ausgewandert war. Evertz sammelte die Dokumente und veröffentlichte sie nun in kleinster Auflage in einem Buch, das insbesondere wegen des umfangreichen Bildteils eine Lücke in der Dokumentation über die Musikerin schließt.
Als Gerhard Evertz 2004 sein Buch “Hannover – ein Stück Jazzgeschichte” herausbrachte, hatte er bei der Recherche jede Menge Material insbesondere über Jutta Hipp gefunden, die zwar gerade ein Mal in Hannover gespielt hatte, die aber enge verwandtschaftliche Beziehungen in die Stadt an der Leine besaß und behielt, nachdem sie 1955 nach New York ausgewandert war. Evertz sammelte die Dokumente und veröffentlichte sie nun in kleinster Auflage in einem Buch, das insbesondere wegen des umfangreichen Bildteils eine Lücke in der Dokumentation über die Musikerin schließt.
Sein Buch ist dabei weniger eine Biographie als vielmehr eine Sammlung von Materialien und Informationen, die er sortiert und Hipps verschiedenen Aktivitäten zuschreibt. Da gibt es Fotos, etwa in einer Privatwohnung in Leipzig, mit Dietrich Schulz-Köhn, Caterina Valente, Attila Zoller, mit ihrem in Hannover wohnenden Bruder, von Tourneen und privaten Feiern. Es findet sich das Programmblatt des Studiokonzerts, das sie im Oktober 1955 im Rathaus Hannover gab und das als “erstes Konzert in ihrer Heimatstadt Hannover und ihr letztes in Deutschland” annonciert wurde. Auch finden sich Briefsplitter aus ihrer New Yorker Zeit.
Einer Diskographie ihrer Aufnahmen hängt Evertz Abbildungen diverser Cover bei. Im Kapitel “Gemälde” dokumentiert er 65 Aquarelle, Landschaften, Dorf- und Stadtszenen, Personen – allerdings hat nur eines, betitelt “The Pianist” direkt mit Musik zu tun. Ein weiteres Kapitel dokumentiert Hipps Aktivitäten als Fotografin, erlaubt quasi den privaten Blick mithilfe ihres Auges durch den Sucher ihrer Kamera: Da ist ein Blick aus dem Fenster ihrer Wohnung, da sind Freunde im Restaurant, Musiker bei Freiluftkonzerten, wir sehen Charlie Parkers Wohnhaus, Louis Armstrongs Grab, aber auch Landschaftsaufnahmen, die wie Motive für ihre Aquarelle wirken.
Schließlich finden sich Hipps bekannte Zeichnungen großer Jazzmusiker: Lester Young, Horace Silver, Art Taylor, Barry Harris, Gerry Mulligan, Nica de Koenigswarter, Thelonious Monk, Peck Morrison, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Zoot Sims, Lester Young, Lionel Hampton, Lee Konitz, Attila Zoller, Hans Koller. Aber auch in Gedichten suchte die Pianistin einen kreativen Ausdruck; und Evertz versammelt solche über Lester Young, Horace Silver; Zoot Sims, Sonny Rollins, Billie Holiday, Miles Davis, Art Blakey, Dinah Washington, das Modern Jazz Quartet, Charlie Parker, Charles Mingus, Gerry Mulligan, Thelonious Monk, Erroll Garner, John Coltrane, Albert Mangelsdorff, Caterina Valente, Klaus Doldinger, Gunter Hampel, Connie Jackel, Horst Jankowski und Carlo Bohländer. Zum Schluss finden sich ausgewählte Pressenotizen über Jutta Hipp, die Evertz um eine Bibliographie weiterführender Literatur ergänzt.
“Jutta Hipp. Ihr Leben & Wirken” ist nur in einer Kleinstauflage im Eigenverlag des Autors erschienen und im Handel nicht erhältlich. Das ist insbesondere deshalb schade, weil das Buch einzelne Quellen zugänglich macht – und insbesondere einen Überblick über Hipps malerisches Wirken gibt –, die einen anderen Blick auf den Menschen Jutta Hipp erlauben.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
Listen, Whitey! The Sights and Sounds of Black Power, 1965-1975
von Pat Thomas
Seattle 2012 (Fantagraphics Books)
193 Seiten, 39,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-60699-507-5
 In den 1960er Jahren war die schwarze Kulturszene in den USA genauso politisiert wie der Rest der amerikanischen Gesellschaft. Die Kunst wurde zum Sprachrohr erst der Bürgerrechts-, dann der Black-Power-Bewegung, die immer vehementer und durchaus auch nicht nur friedlich gleiche Rechte für die schwarze Bevölkerung einforderte. Pat Thomas dokumentiert die musikalische Begleitmusik dieser Jahre zwischen 1965 und 1975, als das schwarze Amerika die Geduld verlor und militant wurde, eine Begleitmusik, die nicht immer nur begleitete, sondern sich auch selbst schon mal zum Sprachrohr der Bewegung machte. Ihn interessiert dabei, wie jegliche schwarze Musik in die Zeit passte und von den Black Nationalists oder Black Panthers für ihre Zwecke genutzt wurde bzw. wie zugehörig sich die Musiker zu den diversen Bewegungen fühlten.
In den 1960er Jahren war die schwarze Kulturszene in den USA genauso politisiert wie der Rest der amerikanischen Gesellschaft. Die Kunst wurde zum Sprachrohr erst der Bürgerrechts-, dann der Black-Power-Bewegung, die immer vehementer und durchaus auch nicht nur friedlich gleiche Rechte für die schwarze Bevölkerung einforderte. Pat Thomas dokumentiert die musikalische Begleitmusik dieser Jahre zwischen 1965 und 1975, als das schwarze Amerika die Geduld verlor und militant wurde, eine Begleitmusik, die nicht immer nur begleitete, sondern sich auch selbst schon mal zum Sprachrohr der Bewegung machte. Ihn interessiert dabei, wie jegliche schwarze Musik in die Zeit passte und von den Black Nationalists oder Black Panthers für ihre Zwecke genutzt wurde bzw. wie zugehörig sich die Musiker zu den diversen Bewegungen fühlten.
Im ersten Kapitel führt Thomas in die Black-Power-Szene ein, erzählt die Geschichte der zunehmenden Militarisierung des schwarzen Teils der Bürgerrechtsbewegung, die spätestens nach den Morden an Martin Luther King und Malcolm X ein wahrnehmbarer und für viele Teile der amerikanischen Gesellschaft zunehmend furchteinflössender Bestandteil der politischen Wirklichkeit wurde. Im zweiten Kapitel geht er der Widerspiegelung dieser politischen Bewegung in der populären Musik nach, nennt Titel wie Aretha Franklins Version des alten Otis-Redding-Songs “Respect”, Marvin Gaye, James Brown, die Last Poets, Gil Scott-Heron, Jimi Hendrix und andere Musiker aus der Pop-, Soul- und Motownszene. Er diskutiert die acht Alben, die auf Motowns Unterlabel Black Forum erschienen und die vor allem Wortbeiträge präsentierte, politische Rede (King, Stokely Carmichael, Ossie Davis und Bill Cosby), Dichtung (Langston Hughes, Amiri Baraka, Festival of Black Poets in America), eine Dokumentation über die Schrecken des Vietnam-Kriegs, aber auch eine Art politische Gospelmusik (Elaine Brown).
Kapitel 3 widmet sich der Solidarität mit der Black-Power-Bewegung, die in der amerikanischen Linken breit aufgestellt war und weiße Musiker wie Bob Dylan, John Lennon und andere umfasste. Die Black Panthers waren aber auch selbst auf Platten vertreten mit politischen Reden und Aufrufen, etwa von Eldridge Cleaver. Auch das SNCC (Student Nonviolent Coordination Committee) brachte eigene Platten heraus, etwa von Stokely Carmichael oder H. Rap Brown (mit Leon Brown). Thomas erzählt über die Hintergründe für Oliver Nelsons Album “Black, Brown and Beautiful”, über Amiri Bakaras “A Black Mass” mit dem Sun Ra Arkestra, sowie über Musikerinnen, die der Sache genauso solidarisch gegenüberstanden wie ihre “Brothers”. Natürlich sind auch die Prediger mit von der Partie, Rev. Jesse Jackson etwa und andere, die ihre Predigten eben auch politischen Inhalten widmeten.
Für Jazzhörer am spannendsten ist Kapitel 9, “Jazz Artist Collectives and Black Consciousness”, das Aktivitäten und Aufnahmen von Charles Mingus mit Max Roach, Archie Shepp, dem Art Ensemble of Chicago, Clifford Thornton, Sonny Sharrock, Lou Donaldson, Eddie Gale, Horace Silver, Gary Bartz mit Andy Bey, Joe McPhee, Herbie Hancock, Mtume, The Tribe, Rahsaan Roland Kirk, Les McCann mit Eddie Harris, Donny Hathaway, Cannonball Adderley, Miles Davis mit John Coltrane, Pharoah Sanders mit Leon Thomas in den Kontext der politischen Bewegung jener Jahre setzt.
Pat Thomas Buch ist eine überaus wertvolle Ergänzung zur Musikgeschichte der 1960er und 1970er Jahre, gerade weil der Autor versucht, politische Kontexte herzustellen und zu erklären. Das Buch im Coffeetable-Format ist reich bebildert mit Plattenhüllen, seltenen Fotos, Zeitungsausrissen und Anzeigen. Ein ausführlicher Index und eine separat erhältliche CD mit Beispielen für die im Text erwähnte Musik runden das Konzept ab.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
Affirmation and Resistance. The Politics of the Jazz Life in the Self-Narratives of Louis Armstrong, Art Pepper, and Oscar Peterson
von Alexander J. Beissenhirtz
Kiel 2012 (Verlag Ludwig)
299 Seiten, 49,90 Euro
ISBN: 978-3-86935-146-9
 Die Jazz-Autobiographie ist fast schon ein eigenständiges Genre. Musiker, die über ihr Leben schreiben, verorten sich ganz bewusst und sehr persönlich in der Musikgeschichte. Im Idealfall, der auch für die drei hier untersuchten Bücher betrifft, vereinen sie Eigenschaften von Autobiographie, Memoiren, Biographie und Jazzgeschichtsschreibung. Für seine Dissertation wählt Alexander Beissenhirtz drei Autobiographien, die wichtige Themen des Jazz thematisieren, etwa die Spannung zwischen Popularkultur und Kunst, die Beziehungen zwischen der Persönlichkeit eines Musikers und seines Sounds, die Suche nach der eigenen Stimme, das “amerikanische” Element im Jazz, “race relations” sowie Drogen. Seine Fallbeispiele ordnet Beissenhirtz im einleitenden Kapitel ins literarische Genre der Autobiographie ein, aber auch ins fachspezifische Genre der Jazzliteratur. Und er fragt danach, welche Elemente von Affirmation und/oder Widerstand gegenüber den Werten einer amerikanischen Nationalkultur in diesen Büchern zu erkennen sind.
Die Jazz-Autobiographie ist fast schon ein eigenständiges Genre. Musiker, die über ihr Leben schreiben, verorten sich ganz bewusst und sehr persönlich in der Musikgeschichte. Im Idealfall, der auch für die drei hier untersuchten Bücher betrifft, vereinen sie Eigenschaften von Autobiographie, Memoiren, Biographie und Jazzgeschichtsschreibung. Für seine Dissertation wählt Alexander Beissenhirtz drei Autobiographien, die wichtige Themen des Jazz thematisieren, etwa die Spannung zwischen Popularkultur und Kunst, die Beziehungen zwischen der Persönlichkeit eines Musikers und seines Sounds, die Suche nach der eigenen Stimme, das “amerikanische” Element im Jazz, “race relations” sowie Drogen. Seine Fallbeispiele ordnet Beissenhirtz im einleitenden Kapitel ins literarische Genre der Autobiographie ein, aber auch ins fachspezifische Genre der Jazzliteratur. Und er fragt danach, welche Elemente von Affirmation und/oder Widerstand gegenüber den Werten einer amerikanischen Nationalkultur in diesen Büchern zu erkennen sind.
Im zweiten Kapitel setzt sich Beissenhirtz mit dem Problem einer Definition des Jazz auseinander und verweist auf die Dehnbarkeit dieses Begriffs. Er diskutiert den Unterschied zwischen selbst geschriebenen und durch Ghostwriter verfassten Autobiographien und ihren jeweiligen Bezug zum Primat der Authentizität, den jede Autobiographie zu erreichen trachtet. Sein drittes Kapitel ordnet das Genre der Jazz-Autobiographie in den Kontext der Jazzforschung ein, in der man viel zwischen den Zeilen lesen müsse, um Diskurse zu identifizieren, die von den Autoren nicht immer implizit angesprochen werden. Sein viertes Kapitel geht seiner Grundfrage nach, jener also, inwieweit Jazz als Affirmation amerikanischer Kultur oder aber als sozialer und politischer Widerstand gesehen wird, wobei Beissenhirtz als Gewährsleute für die beiden Ansätze auf der einen Seite Ralph Ellison, auf der anderen Amiri Baraka anführt. Die beide Pole verbindende Frage ist dabei auch die: Wie kann man Star sein, herausgehobenes Subjekt und dennoch Teil der Bewegung, Teil der Masse?
Die zweite Hälfte des Buchs geht dann in medias res: Beissenhirtz fragt danach, ob Louis Armstrong in seinen eigenen Schriften eher als Onkel Tom oder als Trickster rüberkommt. Er analysiert Armstrongs Stil sowohl in seinen veröffentlichten Büchern wie auch in Briefen und später veröffentlichten privaten Texten. Er begründet, warum “Satchmo. My Life in New Orleans” von 1954, anders als das bereits 1936 erschienene “Swing That Music” von Armstrong selbst und nicht zusammen mit einem Ghostwriter verfasst worden sein muss, und er vergleicht die Selbstdarstellung Satchmos in beiden Veröffentlichungen.
Art Peppers Autobiographie “Straight Life” von 1979 ist mehr Lebensbeichte als reine Autobiographie. Beissenhirtz vergleicht Peppers Selbstdarstellung im Buch mit anderswo abgedruckten Interviews des Saxophonisten und diskutiert ästhetische, soziale und sehr persönliche Ansichten Peppers vor dem Hintergrund der Fakten und seiner Aufnahmen.
Im dritten Fallbeispiel liest Beissenhirtz Oscar Petersons Autobiographie “A Jazz Odyssey” von 2002 als Affirmation des Jazz als “Amerikas klassische Musik”. Auch hier vergleicht er Petersons Selbstdarstellung mit den Fakten sowie mit der öffentlichen Wahrnehmung des Pianisten durch Kritiker oder Musikerkollegen. Er liest das Buch als den Versuch eines Künstlers, die Stellung des Jazz als ernsthafte Kunst auch in Wort und Schrift zu festigen. Er hinterfragt die Behauptung der Farbenblindheit, die Peterson in seinem Buch aufstellt, wenn es um die Hautfarbe der Mitmusiker geht, und kontrastiert diese mit Petersons durch seine Familie bedingte Unterstützung von Marcus Garveys Idealen.
Beissenhirtzes Buch ist als Dissertation an der FU Berlin angenommen wurden; entsprechend ist das resultierende Buch eine vor allem an einen Fachdiskurs gerichtete Publikation. Beissenhirtz macht auf Besonderheiten der Autobiographie im Jazz aufmerksam und liest die von ihm als Fallbeispiele angeführten Bücher kritisch, um sie für die Untermauerung seiner Thesen zu nutzen, dass nämlich die textliche Rekonstruktion von Musikerleben immer auch eine sehr bewusste Interpretation von Jazzdiskursen, wenn nicht gar einen Eingriff in solche darstellt.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
Africa Speaks, America Answers. Modern Jazz in Revolutionary Times
von Robin D.G. Kelley
Cambridge/MA 2012 (Harvard University Press)
244 Seiten, 24,95 US-Dollar
ISBN 978-0-674-04624-5
 Als Robin D.G. Kelley im Frühjahr 2003 eingeladen wurde, Vorträge an der Harvard University zu halten, arbeitete er gerade an seiner Thelonious-Monk-Biographie. Statt einfach auf Kapitel daraus zurückzugreifen, entschied er sich für eine Reflektion über die Einflüsse zwischen Afrika und afro-amerikanischem Jazz, die er an vier konkreten Beispielen zeigen wollte. Aus seinen Vorträgen entwickelte sich ein tieferes Forschungsinteresse zum einen an den vier Protagonisten, die er ausgewählt hatte, zum zweiten am Thema Afrika / Jazz ganz allgemein, die schließlich zum vorliegenden Buch führten.
Als Robin D.G. Kelley im Frühjahr 2003 eingeladen wurde, Vorträge an der Harvard University zu halten, arbeitete er gerade an seiner Thelonious-Monk-Biographie. Statt einfach auf Kapitel daraus zurückzugreifen, entschied er sich für eine Reflektion über die Einflüsse zwischen Afrika und afro-amerikanischem Jazz, die er an vier konkreten Beispielen zeigen wollte. Aus seinen Vorträgen entwickelte sich ein tieferes Forschungsinteresse zum einen an den vier Protagonisten, die er ausgewählt hatte, zum zweiten am Thema Afrika / Jazz ganz allgemein, die schließlich zum vorliegenden Buch führten.
In den frühen 1960er Jahren, schreibt Kelley in seinem Vorwort, habe es ein verstärktes Interesse afro-amerikanischer Jazzmusiker an afrikanischen “Wurzeln” gegeben. Art Blakey, Randy Weston, Oliver Nelson, Max Roach nahmen Platten auf, die sich unterschiedliche Aspekte dieser Beziehung bezogen. Auch der Schlagzeuger Guy Warren zählte zu jenen Musikern, die eine Verbindung zwischen den beiden Kontinenten eruierten, nur dass er weder zu den Black Nationalists gehörte, bei denen eine Afrika-Schau damals in Mode war, noch überhaupt ein Afro-Amerikaner war – Warren nämlich war in Ghana geboren. Er rühmte sich selbst, afrikanische Elemente in den amerikanischen Jazz eingeführt zu haben, als niemand an so etwas interessiert gewesen sei. Warren ist einer der Musiker, denen ein Kapitel in Kelleys Buch gewidmet ist; die anderen sind Randy Weston, der sich seit den 1950er Jahren mit afrikanischen Rhythmen auseinandersetzte und Ende der 1960er Jahren in Marokko lebte, Ahmed Abdul-Malik, der in seiner Musik versuchte insbesondere nordafrikanische Melodik und Rhythmik mit dem Jazzidiom zu verbinden, sowie die südafrikanische Sängerin Sathima Bea Benjamin, die mit Warren das Schicksal teilte, weder “afrikanisch” noch “westlich” genug zu klingen, um auf dem Markt zu bestehen.
Kelleys Buch lehnt sich in der Konzentration auf vier Musterfälle an A.B. Spellmans epochales “Four Lives in the Bebop Business” von 1966 an. Neben Afrika sieht er als verbindendes Element seiner Protagonisten, dass sie alle aus den unterschiedlichen politischen wie ästhetischen Diskussionen der 1950er Jahre heraus ihre jeweils eigene Fusion angingen. Sie suchten in einer Zeit, in der das Wort “Freedom” wahrscheinlich das wichtigste Wort in der afrikanischen Diaspora war, nach “neuen emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten, neuen Wegen, Solidarität und Verbindungen zu erzeugen”.
Er beginnt mit der Geschichte des Ghanaers Guy Warren, der im Krieg unter die Fittiche eines amerikanischen Offiziers genommen wurde, der ihn zu seinem Assistenten machte und ihm den Weg in die USA ebnete. Warren jammte 1943 mit Miff Mole im New Yorker Nick’s Tavern, ging dann zurück nach Accra. Nach Ausflügen etwa mit einer afro-kubanischen Band kam er 1954 nach Chicago und stellte fest, dass sein Rhythmusgefühl, das nicht so sehr an Chano Pozo orientiert als vielmehr afrikanisch war, nicht ganz so gut ankam. 1956 nahm er eine LP auf, die vielleicht tatsächlich der erste Versuch einer Fusion beider Welten war: “Africa Speaks, America Answers”. 1958 folgte die LP “Themes for African Drums”, 1959 “Voice of Africa”, für die er Mühe hatte ein Label zu finden und die erst 1962 unter dem Titel “African Rhythms” veröffentlicht wurde. Kelley schreibt ausführlich über Warrens Frust gegenüber Kollegen wie Babatunde Olatunji, die in jenen Jahren stärker wahrgenommen wurde als er. Warren spielte 1969 mit britischen Musiker das Album “Afro-Jazz” ein, ging dann zurück nach Ghana, wo er 2008 starb.
Randy Westons afrikanische Reise begann in seiner Kindheit, als sein Vater, ein Anhänger Marcus Garveys, seinem Sohn von der glorreichen Vergangenheit Afrikas erzählte. In den 1950er Jahren war Weston quasi der Hauspianist im Music Inn in Lenox, Massachusetts, wo er unter anderem die Musikbeispiele für Marshall Stearns Vorträge über die Hintergründe der Jazzgeschichte spielte. Hier traf er auch auf den nigerianischen Trommler Babatunde Olatunji, der sein interesse an afrikanischer Kultur noch verstärkte. Als Ende der 1950er Jahre immer mehr afrikanische Staaten ihre Unabhängigkeit erhielten, komponierte Weston verschiedene Stücke, die sich mit afrikanischen Themen befassten und die 1959 in der LP “Uhuru Afrika” mündeten. 1961 besuchte er den fernen Kontinent zum ersten Mal, und Kelley erzählt die problematische Geschichte der American Society for African Culture, die damals ein Büro in Lagos eröffnetet, das zumindest zu Teilen von der CIA finanziert worden war. 1967 spielte Weston bei einem Festival in Rabat, verliebte sich in die Stadt und zog für fünf Jahre nach Marokko.
Ahmed Abdul-Malik hatte sich seit seiner Kindheit für arabische Musik interessiert und wollte seit den späten 1940er Jahren seine Liebe zum Jazz und zu “östlichen” Modi zusammenbringen. Kelley korrigiert die von Abdul-Malik selbst verbreitete Biographie und identifiziert dessen Vater als aus der Karibik (und nicht aus Afrika) eingewandert. Nach dem Tod seines Vaters konvertierte Abdul-Malik zum Islam und sprach schon in der Schulzeit fließend Arabisch. Kelley erzählt nebenbei, wie auch andere Musiker damals zum Islam konvertierten, verfolgt Abdul-Maliks Karriere und verknüpft diese mit seinem spirituellen Lebensweg, 1956 machte Abdul-Malik seine ersten Aufnahmen mit arabischen Musikern und wurde in seinen Plänen von Kollegen wie Thelonious Monk und John Coltrane ermutigt. Bald erschien “Jazz Sahara”, dann “East Meets West” und “The Music of Ahmed Abdul-Malik”. 1961 wurde der Bassist Mitglied der Band von Herbie Mann, der damals selbst großes Interesse an Musik der afrikanischen Diaspora hatte. Bis zu seinem Tod Anfang der 1990er Jahre behielt er sein Interesse an arabischer Musik und nahm in den 1980er Jahren sogar Unterricht bei einem Oud-Virtuosen.
Kelleys letztes Kapitel beschreibt die Lebensgeschichte der Sängerin Sathima Bea Benjamin. In Kapstadt aufgewachsen, interessierte sie, wie viele andere Altersgenossen auch, alles, was amerikanisch war. Sie wurde Lehrerin, sang nebenbei in Clubs. Kelley erzählt über die gemeinsame Liebe von Benjamin und Dollar Brand zur Musik Duke Ellingtons und beschreibt ausführlich vor allem die südafrikanische Jazzszene und die Herausarbeitung einer eigenen Identität bei Benjamin und Brand, irgendwo zwischen südafrikanischer und afro-amerikanischer Ästhetik. Ihre europäische und amerikanische Zeit interessiert ihn für dieses Kapitel weniger.
Robin D.G. Kelley gelingt es, das Thema der Interkulturalität, das seinem Buch zugrunde liegt, in seinen vier Fallbeispielen deutlich zu machen. Jedes Kapitel ist für sich spannend zu lesen; in der Verbindung der vier sehr unterschiedlichen ästhetischen Ansätze, musikalischen Persönlichkeiten und biographischen Lebenswege ergibt sich ein tatsächlicher Einblick in den musikalischen Dialog zwischen Afrika und Amerika in den 1950er und 1960er Jahren.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
Saxofone. Ein Kompendium
von Uwe Ladwig
Kiel 2012 (buchwerft verlag)
266 Seiten, 69 Euro
ISBN: 978-3-86342-280-6
 Alles, aber auch wirklich alles, was man über das Saxophon wissen will, kann man aus Uwe Ladwigs umfangreichen, sehr schön gestalteten und mit über 350 teils farbigen Fotos reich bebilderten Buch erfahren. Anders als in Ralf Dombrowskis “Portrait Saxofon” geht es dem Autor dabei allerdings nicht um die Interpreten, die hier nur eine kleine Nebenrolle spielen, sondern einzig um das Instrument selbst, in allen üblichen und unüblichen Bauarten und Varianten, vom Sopran- bis zum Basssaxophon.
Alles, aber auch wirklich alles, was man über das Saxophon wissen will, kann man aus Uwe Ladwigs umfangreichen, sehr schön gestalteten und mit über 350 teils farbigen Fotos reich bebilderten Buch erfahren. Anders als in Ralf Dombrowskis “Portrait Saxofon” geht es dem Autor dabei allerdings nicht um die Interpreten, die hier nur eine kleine Nebenrolle spielen, sondern einzig um das Instrument selbst, in allen üblichen und unüblichen Bauarten und Varianten, vom Sopran- bis zum Basssaxophon.
Ladwig beginnt – wie sollte es anders sein – mit Adolphe Sax, der das Instrument 1846 zum Patent einreichte (bereits vier Jahre zuvor hatte Hector Berlioz das Instrument in einem Zeitungsartikel erwähnt). Neben der Skizze zum Patentantrag und einer Diskussion zu Bohrungsvarianten finden sich detaillierte Ansichten eines frühen Instruments und Instrumentenkoffers.
Der Hauptteil des Buchs dekliniert dann die verschiedenen Hersteller durch. Ladwig beginnt in den USA mit Conn, Buescher, Martin etc. und benennt genauso ausführlich Firmen aus Europa, Asien und Südamerika. Neben kurzen Firmengeschichten klassifiziert er dabei die produzierten Instrumente und liefert zugleich einen Seriennummernkatalog, anhand dessen sich Instrumente datieren lassen. Neben den großen Firmen finden sich kleine, neben alteingesessenen neue Hersteller, jeweils mit detaillierten Beschreibungen und, wo immer möglich, Abbildungen.
Ladwig diskutiert Erfindungen und zusätzliche Patente zu Klappen oder Klappenverbindungen, zeigt Fabrikräume etwa der Firma Keilwerth, aber auch viele aussagekräftige Werbeseiten der Hersteller über die Jahrzehnte. In einem Appendix werden Sonderformen des Saxophons besprochen, etwa Kunststoffinstrumente (man denke an Charlie Parkers Massey-Hall-Konzert oder an Ornette Colemans Auftritte – beide spielten übrigens ein Instrument der Firma Grafton) und Saxophone aus Holz. Ladwig listet sogenannte “Stencils” auf, also Produktionen einer eingesessenen Firma für andere, oft kleinere Hersteller, und er beschreibt Werkzeuge und übliche Arbeitsvorgänge in der Saxophonwerkstatt, von der Instrumenten-Instandhaltung bis zur Koffer-Restaurierung. Zum Schluss gibt er noch Tipps zur Mikrophonierung von Saxophonen.
Ein ausführliches Register beschließt das Buch, das ohne Übertreibung als ein Standardbuch für Saxophonsammler und -bauer beschrieben werden kann. Neben all dem Wissen, das Ladwig in die Seiten packt, liest man sich dabei immer wieder an kuriosen Aspekten von Firmen- oder Baugeschichten fest.
Wolfram Knauer (Juli 2012)
Visualizing Respect
Von Christian Broecking
Berlin 2012 (Broecking Verlag)
Books on Demand GmbH
54 Seiten, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-938763-33-9
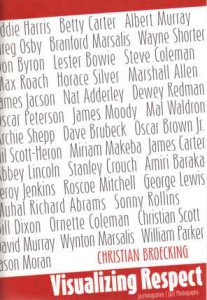 Christian Broecking, der Autor des Interview-Buches “Respekt! Die Geschichte der Fire Music”, komplettiert mit dem neuesten Fotobuch seine Story über die amerikanische Jazzszene der letzten 40 Jahre.
Christian Broecking, der Autor des Interview-Buches “Respekt! Die Geschichte der Fire Music”, komplettiert mit dem neuesten Fotobuch seine Story über die amerikanische Jazzszene der letzten 40 Jahre.
Die Fotos in dem Bildband „Visualizing Respekt“ dokumentieren die Interviewsituationen von 1992 bis 2012, die die Grundlage zu seiner profunden Analyse über Fragen nach schwarzer Geschichte und Identität bilden.
In sehr eindringlichen, nahezu umgebungslosen Musikerporträts scheint die Forderung nach gesellschaftlicher Teilhabe fast körperlich greifbar.
Nat Adderley, Amiri Baraka, Mal Waldron und viele andere geben sich und uns die Ehre.
Christian Broecking nimmt den Betrachter visuell mit in die Interviewsituation und schafft damit eine besondere Nähe zu den Protagonisten. Der direkte Blickkontakt der Musiker auf vielen Aufnahmen verfehlt nicht seinen suggestiven Effekt. Es sind sehr persönliche Off-Stage-Fotos, die den Menschen hinter der Musikerin und dem Musiker zeigen.
Dem Fotografen und Autor Christian Broecking ist damit eine authentische, kurzweilige Fotobroschüre moderner Jazzfotografie gelungen, deren wohltuende puristische Gestaltung und detailgenauen Fotos sich durchaus mit den großen Namen der Jazzfotografie messen können.
Doris Schröder (Juni 2012)
Jazz & Beyond, no. 1
von Heike Nierenz (Texte) & Norbert Guthier (Fotos)
Frankfurt 2012 (Norbert Guthier)
180 Seiten, 1 beiheftende CD, 24,90 Euro
ISBN: 978-3-981485-21-9
www.guthier.com
(Vertrieb über Jazzwerkstatt)
 Ausgangspunkt des Buchs in CD-Box-Größe sind die Fotos Norbert Guthiers, in denen die sechs ausgewählten Musiker nicht nur in üblichen Konzertposen zu sehen sind, sondern auch privat, beim Unterrichten, im Café, beim Aufbauen, beim Soundcheck etc. Heike Nierenz stellt den Bildern stimmungsvolle Texte gegenüber, in denen die Biographie der Künstler genauso erzählt wird wie ihre musikalische Philosophie. Und da erzählte Musik selbst dann einen merkwürdigen Beigeschmack hat, wenn man genügend Bilder zu sehen bekommt, ist dem Buch eine CD mit Aufnahmen der Vorgestellten beigelegt, bereits veröffentlichte Titel aus den letzten Jahren (leider sagt die enthaltene Diskographie nichts über die Aufnahmedaten aus), die das Lese- und Schauerlebnis vervollständigen.
Ausgangspunkt des Buchs in CD-Box-Größe sind die Fotos Norbert Guthiers, in denen die sechs ausgewählten Musiker nicht nur in üblichen Konzertposen zu sehen sind, sondern auch privat, beim Unterrichten, im Café, beim Aufbauen, beim Soundcheck etc. Heike Nierenz stellt den Bildern stimmungsvolle Texte gegenüber, in denen die Biographie der Künstler genauso erzählt wird wie ihre musikalische Philosophie. Und da erzählte Musik selbst dann einen merkwürdigen Beigeschmack hat, wenn man genügend Bilder zu sehen bekommt, ist dem Buch eine CD mit Aufnahmen der Vorgestellten beigelegt, bereits veröffentlichte Titel aus den letzten Jahren (leider sagt die enthaltene Diskographie nichts über die Aufnahmedaten aus), die das Lese- und Schauerlebnis vervollständigen.
Eine gelungene Auswahl aktueller Künstler, bebildert mit meist recht dunklen Schwarzweißfotos und einem flüssig zu lesenden Text auf Deutsch und Englisch.
Wolfram Knauer (April 2012)
Jazzgeschichten aus Europa
von Ekkehard Jost
Hofheim 2012 (Wolke Verlag)
334 Seiten, 24,80 Euro
ISBN: 978-3-936000-96-2
 Der Buchmarkt zum jazz ist mittlerweile fast unüberschaubar. Und doch fehlt immer noch eine schlüssige europäische Jazzgeschichte, ein Buch, in dem die verschiedenen Entwicklungen zwischen Adaption, Emanzipation und ästhetischer Eigenständigkeit des Jazz in Europa erzählt wird mit allen hellen und dunklen Facetten zwischen Exotik und Verbot, zwischen Nachahmung und freiem Experiment. Mit Ekkehard Jost hat nun Deutschlands wichtigster Jazzforscher sich daran gemacht diese Lücke zu schließen. Jost hatte 1987 mit “Europas Jazz” bereits ein Standardwerk zur Geschichte der Emanzipation des europäischen jazz zwischen 1960 und 1980 herausgebracht; sein neues Buch wirft den Blick jetzt noch weiter, betrachtet die Entwicklung von den frühen Jahren des 20. bis hinein in jüngste Entwicklungen des 21sten Jahrhunderts. Das Buch entstand aus einer erfolgreichen Sendereihe, die Jost für den WDR produziert hatte und in deren einzelnen Folgen er Schlaglichter auf wichtige Entwicklungen im europäischen Jazz warf. Aus diesem Ansatz heraus ist dann wohl auch der Titel des daraus entstandenen Buchs zu verstehen: ausdrücklich nicht eine “Jazzgeschichte Europas”, sondern “Jazzgeschichten aus Europa”.
Der Buchmarkt zum jazz ist mittlerweile fast unüberschaubar. Und doch fehlt immer noch eine schlüssige europäische Jazzgeschichte, ein Buch, in dem die verschiedenen Entwicklungen zwischen Adaption, Emanzipation und ästhetischer Eigenständigkeit des Jazz in Europa erzählt wird mit allen hellen und dunklen Facetten zwischen Exotik und Verbot, zwischen Nachahmung und freiem Experiment. Mit Ekkehard Jost hat nun Deutschlands wichtigster Jazzforscher sich daran gemacht diese Lücke zu schließen. Jost hatte 1987 mit “Europas Jazz” bereits ein Standardwerk zur Geschichte der Emanzipation des europäischen jazz zwischen 1960 und 1980 herausgebracht; sein neues Buch wirft den Blick jetzt noch weiter, betrachtet die Entwicklung von den frühen Jahren des 20. bis hinein in jüngste Entwicklungen des 21sten Jahrhunderts. Das Buch entstand aus einer erfolgreichen Sendereihe, die Jost für den WDR produziert hatte und in deren einzelnen Folgen er Schlaglichter auf wichtige Entwicklungen im europäischen Jazz warf. Aus diesem Ansatz heraus ist dann wohl auch der Titel des daraus entstandenen Buchs zu verstehen: ausdrücklich nicht eine “Jazzgeschichte Europas”, sondern “Jazzgeschichten aus Europa”.
Schon die Kapitelüberschriften hören sich nach Geschichten an, die man gerne hört. “Wie der Jazz nach Europa kam” erzählt Jost gleich im ersten Kapitel, berichtet dabei von Widerständen der Bürokratie gegen wilde Tänze, von James Reese Europes Hellfighters sowie von Sam Woodings Band. “Le Jazz en France” stellt die Faszination der Franzosen am Jazz in den 1920er Jahren vor und beleuchtet an einzelnen Beispielen beide Seiten der Faszination: die der (insbesondere schwarzen) Amerikaner, die sich zum Teil für länger in Frankreich niederließen, sowie die der französischen Musiker und Intellektuellen jener Jahre. Als typische Beispiele der französischen Seite jener Zeit greift er sich den Geiger Michel Warlop und den Gitarristen Django Reinhardt heraus.
Für die Frühzeit des Jazz in England geht Jost auf den Besuch der Original Dixieland Jazz Band ein und auf das Southern Syncopated Orchestra, erwähnt kurz die Besuche Armstrongs und Ellingtons und die Macht der britischen Musikergewerkschaft, die von den Mitt-1930er bis in die 1960er Jahre hinein erfolgreich verhinderte, dass amerikanische Musiker auf der Insel auftraten. Die Weimarer Republik führt Jost anhand von Eric Borchards Kapelle vor, zitiert Mike Danzi, wirft einen Blick auf die Berliner Unterhaltungsszene und lässt anhand der Reaktionen auf Ernst Kreneks Oper “Jonny spielt auf” den braunen Sumpf erahnen, der sich bald über Deutschland ausbreiten wird.
“Am Mittelmeer” heißt lakonisch das Kapitel, das einen kurzen Blick nach Spanien, vor allem aber nach Italien wirft. Die Sowjetunion verdient und erhält ein längeres Kapitel, in dem Jost Reaktion und Gegenreaktion von Jazzszene und System bis nach dem II. Weltkrieg abhandelt. In “Jazz unterm Hakenkreuz” skizziert er die unterschiedlichen Restriktionen, die in Deutschland Jazzmusik verfemten, ohne dass dafür eigens ein Jazzverbot ausgesprochen werden musste. Er entdeckt genügend interessante Musik und stellt kurz Freddie Brocksieper und Kurt Widmann vor, sowie mit Charlie and his Orchestra die vielleicht skurrilste Jazzformation jener dunklen Jahre.
“Im hohen Norden”, stellt Jost fest, habe der Jazz weit später Einzug gehalten als im südlicheren Europa, was vielleicht an der Abgelegenheit von den unterhaltungsmusikalischen Metropolen des Kontinents lag. “Frankreich in den Zeiten des Zweiten Weltkriegs” bringt uns zugleich in die direkte Nachkriegszeit und zeigt sehr deutlich, wie Jazz für ein anderes Gesellschaftsmodell steht, als Synonym für Freiheit wahrgenommen wird. Das Kapitel “Die Trümmerjahre” zeigt, wie Jazzmusiker und Jazzfans in der Nachkriegszeit aufholen, als sie endlich offen Swing hören können und sich den Bebop erobern müssen. Jost spricht über die Rundfunk-Bigbands, die sich in diesen Jahren gründen, über die US-Clubs, in denen junge deutsche Musiker ihr Handwerk verfeinern, über Johannes Rediske, Michael Naura, Helmut Brandt und Hans Koller, über Jutta Hipp, Wolfgang Sauer, Inge Brandenburg, aber auch über das Deutsche Jazz Festival in Frankfurt und die Resonanz darauf, über Zeitschriften wie das Jazz Podium und die Gondel sowie über den Jazz als einer (wenigstens kurzzeitigen) Jugendmusik.
Wie zwischengeschaltet wirkt das Kapitel “Americans in Europe”, und Jost hat ihm augenzwinkernd den Beisatz “Gäste oder Immigranten” beigegeben und berichtet mithilfe namhafter Zeitzeugen über die Beweggründe amerikanischer Jazzer, sich etwa in Paris oder anderswo in Europa niederzulassen. Die Amerikaner beeinflussten ganz sicher die “Modern Sounds”, denen Jost “quer durch Europa” folgt und dabei Schlaglichter auf Entwicklungen in Skandinavien, Großbritannien, Frankreich, Italien, der Sowjetunion, Polen und der DDR wirft. Kurz konstatiert Jost mit Gewährsmann Albert Mangelsdorff eine Krise des Jazz in den 1960er Jahre, stellt aber zugleich fest, dass Mangelsdorff und Musiker wie etwa Klaus Doldinger, Wolfgang Dauner und andere schnell einen Weg aus dieser Krise heraus fanden. Den Weg zur Eigenständigkeit hatte Jost bereits in seinem Buch von 1987 ausführlich beschrieben. Doch ist dieser Weg so wichtig, dass die “Wege des Free Jazz durch Europa” auch in diesem Buch das längste Kapitel ausmachen, nach “Modern Sounds” ein weiteres Kapitel, in dem Jost sich Land nach Land unter die Lupe nimmt. Den Osten spart er aus, denn der verdient gerade für diese Entwicklungsphase des europäischen Jazz einem eigenen Abschnitt.
Zum Schluss müssen wenige Beispiele aus der Menge der Entwicklungen die Klänge beispielhaft vertreten, die den Jazz nach 1970 und bis ins 21ste Jahrhundert prägen. Jost konstatiert zu Recht das “Ende linearer Vorwärtsbewegungen”, stellt “stilistischen Pluralismus und Regression” fest, sieht aber im Neobop keine europäische Kreation, sondern einen amerikanischen Import. Jost hält seine eigenen Vorbehalten nicht hinterm Berg, etwa wenn er Acid oder Techno Jazz knapp unter der Überschrift “Unheilige Allianzen” abhandelt. Hier ist nun auch Platz, kurz über die ökonomische Seite des Jazz also zu sprechen, also Plattenmarkt, Festivals und Clubs. Lesenswert schließlich noch sein Ausblick, den er mit einer knappen Analyse der unter “Jazz” firmierenden Musikrichtungen verbindet, um zu schlussfolgern, dass die “dynamische Strömung des Jazz schon jetzt und in Zukunft in zunehmendem Maße von Europa ausgehen wird”.
Anders als in “Europas Jazz” gibt es in “Jazzgeschichten aus Europa” kaum analytische Passagen. Jost erzählt Geschichten, und die Vielfalt der Entwicklungen erklärt den Ansatz des manchmal Anekdotischen, manchmal Sprunghaften genauso wie es wohl der Ursprung des Buchs in einem Sendemanuskript tun mag. Die Lektüre ist bei alledem leicht und vergnüglich. Jost wählt die Geschichten sehr bewusst aus, hinter die er seine Leser etwas tiefer führt, und es gelingt ihm dabei fast schon zwischen den Zeilen Gemeinsamkeiten wie Unterschiede deutlich zu machen und Lust zum Hinhören zu wecken. Wenigstens für die ersten Jahre bietet das Buch hierfür 28 Hörbeispiele an, die auf einer CD beiheften und die Jahre zwischen 1919 uns 1948 dokumentieren, zwischen James Reese Europes Hellfighters Band und Kurt Henkels “Rolly’s Bebop”.
Wolfram Knauer (April 2012)
Jazz Composition and Arranging in the Digital Age
von Richard Sussman & Michael Abene
New York 2012 (Oxford University Press)
505 Seiten, 39,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-538100-9
 Duke Ellington schrieb seine Musik im Zug, im Hotelzimmer, im Reisebus, in Restaurants. So sehr hat sich das gar nicht geändert, denn die Orte, an denen Jazzmusiker heute ihre Musik komponieren oder arrangieren, mögen immer noch Orte des temporären Lebens oder des Reisens sein. Nur das Medium hat sich geändert: Wo Ellington sein Notenpapier dabei hatte, bei Bedarf aber auch schon mal Notizen auf Servierten machte, da arbeitet der Komponist oder Arrangeur unserer Tage in der Regel mit seinem Laptop. Dieser ist aber natürlich nur ein Arbeitsmittel – die Kreativität und das musikalische Knowhow müssen nach wie vor vom Musiker selbst kommen.
Duke Ellington schrieb seine Musik im Zug, im Hotelzimmer, im Reisebus, in Restaurants. So sehr hat sich das gar nicht geändert, denn die Orte, an denen Jazzmusiker heute ihre Musik komponieren oder arrangieren, mögen immer noch Orte des temporären Lebens oder des Reisens sein. Nur das Medium hat sich geändert: Wo Ellington sein Notenpapier dabei hatte, bei Bedarf aber auch schon mal Notizen auf Servierten machte, da arbeitet der Komponist oder Arrangeur unserer Tage in der Regel mit seinem Laptop. Dieser ist aber natürlich nur ein Arbeitsmittel – die Kreativität und das musikalische Knowhow müssen nach wie vor vom Musiker selbst kommen.
Richard Sussman und Michael Abene legen mit diesem umfangreichen Buch nun Materialien vor, mit denen Musiker, die mit dem Computer als Hilfsmittel groß geworden sind, sich dem Thema Komposition und Arrangement nähern können. Es ist also eine Art zeitgemäßes Arrangierlehrbuch, in dem Grundlagen (etwa die verschiedenen Tonlagen der Instrumente) genauso behandelt werden wie computerspezifische Notationsfragen. Die Autoren haben das Buch in drei Teilen aufgebaut. In den ersten fünf Kapiteln resümieren sie die Basics des Handwerks. Im zweiten Tel widmen sie sich den Besonderheiten des Arrangements für kleine Ensembles. Im dritten Teil dann nehmen sie sich der Komposition für Bigband und große Ensembles an. In allen Kapiteln finden sich neben arrangierspezifischen Tipps Erläuterungen von Notationssoftware und anderen Computerprogrammen, die dem Arrangeur heutzutage das Leben erleichtern. Eine begleitende Website schließlich bietet Musikbeispiele, weitere Notenbeispiele, Softwarefiles und weiterführende Hinweise.
Bei aller Technik sollte man sich vom digitalen Aspekt des Herangehens der beiden Autoren aber nicht abschrecken lassen: In der Hauptsache geht es bei ihnen eben doch um das Handwerk des Töne-Zusammenfügens, des Klänge-Schmiedens, des Sound-Kreierens. Und so sind die Hinweise auf Software meistens Asides, zusätzliche Tipps zum zeitsparenden Arbeiten.
Das Buch ist ein wichtiges Unterrichtswerk für angehende Arrangeure, eine up-to-date-Fassung dessen, was Don Sebesky 1974 mit seinem Buch “The Contemporary Arranger” vorlegte oder Sammy Nestico 1993 mit “The Complete Arranger”. Und es ermutigt die kreativen Leser hoffentlich, wie Abene in seinem Vorwort auffordert, alle Möglichkeiten des Zusammenklingens zu erkunden.
Wolfram Knauer (April 2012)
Taj Mahal Foxtrot. The Storyy of Bombay’s Jazz Age
von Naresh Fernandes
New Delhi 2012 (Roli Books)
192 Seiten, 1.295 Rupien
ISBN: 978-81-7436-759-4
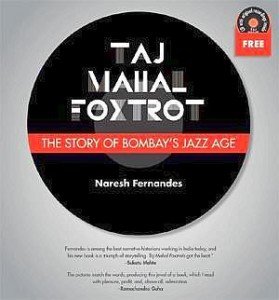 Selbst beim Jazz denken wir oft viel zu eurozentrisch: Wenn wir sagen, der Jazz eroberte kurz nach seiner Geburt die Welt, meinen wir zumeist Europa. Dabei wurde Jazz tatsächlich innerhalb weniger Jahre zu einer Art erster Weltmusik, die modische Tänze selbst an entlegenen Orten begleitete. Das vorliegende Buch dokumentiert ein in Jazzgeschichtsbüchern eher selten gestreiftes Kapitel, die lebendige Jazzszene in Bombay, die in den 1930er Jahren amerikanische Musiker wie Teddy Weatherford und Leon Abbey anzog.
Selbst beim Jazz denken wir oft viel zu eurozentrisch: Wenn wir sagen, der Jazz eroberte kurz nach seiner Geburt die Welt, meinen wir zumeist Europa. Dabei wurde Jazz tatsächlich innerhalb weniger Jahre zu einer Art erster Weltmusik, die modische Tänze selbst an entlegenen Orten begleitete. Das vorliegende Buch dokumentiert ein in Jazzgeschichtsbüchern eher selten gestreiftes Kapitel, die lebendige Jazzszene in Bombay, die in den 1930er Jahren amerikanische Musiker wie Teddy Weatherford und Leon Abbey anzog.
Der Journalist Naresh Fernandes wollte eigentlich nur ein wenig Tratsch über die Welt der goanischen Musiker im Bombay der 1960er Jahre sammeln und interviewte zu diesem Zweck den Vater einer guten Freundin, von dem er wusste, dass er damals in Jazzbands und den Filmstudios gespielt hatte. Der Trompeter Frank Fernand war alt und schwach und kriegte immer nur stoßweise Sätze heraus, Fernandes aber wurde schnell klar, dass er mit einem Zeitzeugen sprach, der seit den Mitt-1930er Jahren auf der Jazzszene unterwegs war. Er machte sich an die Arbeit, Dokumente zu sammeln über die Frühgeschichte des Jazz in Bombay, über afro-amerikanische Musiker, die Bombay zu ihrer zweiten Heimat machten und über die Hindi-Filmstudios, die in den 1950er Jahren auch Jazz als Begleitmusik benutzten.
Fernandes beginnt sein Buch im Taj Mahal Hotel in Downtown-Bombay im Jahr 1935, in dem die Band des amerikanischen Geigers Leon Abbey zum Tanz aufspielt. Swing war die Mode in Paris und London und strahlte von dort in die Kolonien, und Abbeys Band war für die Besucher im Taj Mahal mehr eine Repräsentation europäischen mondänen Lebens als eine bewusste Rezeption amerikanischer Musik. Der Swing dieser Jahre wurde aber bald so populär, dass auf der Rückseite einer Broschüre des Bombay Swing Club aus dem Jahr 1948, also gerade mal ein Jahr nach der Unabhängigkeitserklärung des Landes, nicht weniger als 70 Bands verzeichnet sind, die in Bombay für Unterhaltung sorgten.
Leon Abbey und Weatherford erhalten eigene Kapitel im Buch. Zwischendurch schaut Fernandes noch weiter zurück und entdeckt, dass bereits im 19. Jahrhundert reisende Minstrelgruppen in Indien Station gemacht hatten. Er wirft außerdem einen Blick aufs klassische Musikleben der Stadt in den 1920er und 1930er Jahren. Wie in Europa mussten auch die indischen Musiker die Eigenarten des Jazz erst lernen, die dabei durchaus Parallelen zur heimischen Musiktradition besaß: Nichts war notiert, und um die Musik spielen zu können, musste man sie fühlen.
Fernandes verfolgt den Siegeszug dieser Musik, der 1946 zur Gründung der Jazz Society und 1948 des Bombay Jazz Club führte, die sich beide ernsthaft mit der Musik auseinandersetzten, Plattenabende und Jam Sessions organisierten. Jazz war schon lange im Unterhaltungsmainstream des Landes angekommen, was nur noch von der Tatsache unterstrichen wurde, dass Komponisten und Musiker für Hindi-Filme in den 1950er Jahren ausgiebig Gebrauch von Jazzrhythmen und -sounds Gebrauch machten. 1952 erschien die erste, wenn auch kurzlebige indische Jazzzeitschrift, Blue Rhythm.
Ein eigenes Kapitel ist dem Pianisten Dizzy Sal gewidmet, der 1959 in die USA ging, um am Berklee College zu studieren, ein weiteres Kapitel den Besuchen amerikanischer Stars wie Dave Brubeck, Duke Ellington, Louis Armstrong oder Jack Teagarden, die von den Fans mit Begeisterung aufgenommen wurden, auch wenn sie den kulturpolitischen Agenten der US-Regierung skeptisch gegenüberstanden, die in jenen Jahren als pro-pakistanisch angesehen wurde.
Mit etwas Verspätung löst die Rockmusik in den späten 1960er Jahren den Jazz schließlich als populäre Musik ab. Hier ist denn auch für Fernandes die Geschichte des Jazz Age in Bombay zu Ende.
“Taj Mahal Foxtrot” beleuchtet ein bemerkenswertes Kapitel globaler Jazzgeschichte. Fernandes gelingt es etliche Dokumente ausfindig zu machen, die sowohl die Faszination indischer Musiker mit dem Jazz als auch den Reiz des Exotischen für viele Jazzmusiker greifbar machen. Fernandes erzählt von Spielorten und Musikerbiographien, lässt dabei die Musik selbst allerdings etwas außen vor. Man liest kaum über konkrete Stücke, über den Lernprozess indischer Musiker, über die soziale Rolle, die das Spielen in einer Swingband (und damit zumeist in einem der großen Hotels Bombays) bedeutete. Auch die Einflüsse, die indische Musik im Westen hinterließ, streift Fernandes nur am Rande. Das alles wird wettgemacht durch die einzigartigen Dokumente und Fotos, die er sammelt und abdruckt, durch eine beiheftende CD, auf der sich einzelne Titel finden, und schließlich durch eine Website (www.tajmahalfoxtrot.com), in der den Kapiteln Musik- und Videobeispiele zugeordnet werden.
“Taj Mahal Foxtrot” ist ein empfehlenswertes Buch, die Geschichte einer regionalen Jazzszene, die auch den Leser in den Bann zu ziehen vermag, der noch nie in Bombay (Mumbai) war.
Wolfram Knauer (April 2012)
Harlem Jazz Adventures. A European Jazz Baron’s Memoir, 1936-1969
von Timme Rosenkrantz (herausgegeben von Fradley Hamilton Garner)
Lanham/MD 2012 (Scarecrow Press)
297 Seiten, 75,00 US-Dollar
ISBN: 978-0-8108-8209-6
 Im Februar 1934 landete Baron Timme Rosenkrantz, keine 23 Jahre alt, mit dem Schiff aus seinem Geburtsland Dänemark in New York an. Der Baron, dessen Vorfahre bereits in Shakespears Hamlet erwähnt wurde, zog in ein Hotel auf der 70sten Straße und war voll der Vorfreude auf den Jazz, wegen dessen er in die USA gekommen war. Er ging in den Commodore Music Shop auf der 42sten Straße, um sich vom Besitzer Milt Gabler Tipps geben zu lassen, doch der teilte ihm als erstes mit, dass die meisten der großen Jazzmusiker, von denen Rosenkrantz schwärmte, mittlerweile in den Studios arbeiteten, Wiener Walzer und Schlager spielten. Nur einen Club gäbe es noch, das Onyx auf der 52sten Straße. Rosenkrantz aber ließ sich nicht entmutigen und entdeckte dabei den Jazz, den es natürlich nach wie vor gab in New York. Er hörte Don Redman im Apollo, traf den jungen John Hammond, erlebte Chick Webb im Savoy und war fasziniert vom Sänger Leo Watson.
Im Februar 1934 landete Baron Timme Rosenkrantz, keine 23 Jahre alt, mit dem Schiff aus seinem Geburtsland Dänemark in New York an. Der Baron, dessen Vorfahre bereits in Shakespears Hamlet erwähnt wurde, zog in ein Hotel auf der 70sten Straße und war voll der Vorfreude auf den Jazz, wegen dessen er in die USA gekommen war. Er ging in den Commodore Music Shop auf der 42sten Straße, um sich vom Besitzer Milt Gabler Tipps geben zu lassen, doch der teilte ihm als erstes mit, dass die meisten der großen Jazzmusiker, von denen Rosenkrantz schwärmte, mittlerweile in den Studios arbeiteten, Wiener Walzer und Schlager spielten. Nur einen Club gäbe es noch, das Onyx auf der 52sten Straße. Rosenkrantz aber ließ sich nicht entmutigen und entdeckte dabei den Jazz, den es natürlich nach wie vor gab in New York. Er hörte Don Redman im Apollo, traf den jungen John Hammond, erlebte Chick Webb im Savoy und war fasziniert vom Sänger Leo Watson.
Timmes Vater Palle Rosenkrantz war Dänemarks erster Krimiautor und hatte ihm einige Referenzschreiben mit auf den Weg gegeben. Die langweiligen Bekannten seines Vaters, zu denen ihm diese Schreiben die Türen öffneten, interessierten ihn aber weit weniger als die Musik Benny Carters oder Teddy Wilsons. Er begleitete Billie Holiday auf eine private Party, berichtet, wie der Saxophonist und Bandleader Charlie Barnet bei Musikern wie Eddie Condon oder Red McKenzie nicht zu beliebt gewesen sei. Um Benny Goodman im Casino de Paree zu hören, verpflichtete er sich sogar als Eintänzer. Er freundete sich mit Willie ‘The Lion’ Smith an, traf Art Tatum, besuchte Fats Waller in seinem Apartment und rauchte seinen ersten Joint, den ihm kein geringerer als Mezz Mezzrow besorgte.
Für eine Weile kehrte er nach Kopenhagen zurück, war aber bereits 1937 wieder zurück in New York. Wir lesen von Slim Gaillard und Slam Steward sowie der Sängerin Inez Cavanaugh (die seine Lebensgefährtin werden sollte), von W.C. Handy, Louis Armstrong und Bill Coleman. 1940 eröffneten Rosenkrantz und Cavanaugh in Harlem einen Plattenladen, den sie vier Jahre später wieder schließen mussten, weil die Geschäfte in Kriegszeiten einfach nicht gut genug gingen.
Rosenkrantz berichtet über das legendäre Nick’s in Greenwich Village und über seine Freundschaft zu Duke Ellington oder Stuff Smith und erhalten einen Einblick in die musikalische Welt, in der auch der Bebop geboren wurde. Rosenkrantz war dabei immer mehr als nur ein beobachtender Begleiter der Musiker; er produzierte Konzerte und teilweise auch Plattensessions, darunter legendäre Aufnahmesitzungen mit Erroll Garner. Eine Liste der von ihm produzierten Sessions ist im Anhang des Buches enthalten. Auch wenn der Untertitel Memoiren bis 1969 verspricht, hören Rosenkrantzs eigene Erinnerungen weitgehend in den Mitt-1940er Jahren auf. Das ursprünglich auf Dänisch verfasste Buch wird ergänzt um eine Würdigung des Saxophonisten Coleman Hawkins aus Anlass dessen Todes im Jahr 1969 sowie um ein von seine Nichte verfasstes Nachwort, in dem auch sein Club “Timme’s” gewürdigt wird, den er in den 1960er Jahren in Kopenhagen gründete.
Seine Erinnerungen verfasste Rosenkrantz 1964 auf Dänisch, und es ist an der Zeit, dass dieser Zeitzeugenbericht auch einer breiteren Leserschaft zugänglich gemacht wird. Fradley Garner, ein seit 1960 in Kopenhagen lebender Amerikaner, hat sich der verdienstvollen Aufgabe angenommen, eine leicht annotierte und um erklärende Interviewausschnitte mit anderen Zeitzeugen bereicherte englische Übersetzung des Buchs herauszugeben, das einen überaus lebendigen Einblick in die swingende Musik der 1930er bis 1950er Jahre gibt, geschrieben von einem Outsider, der vielleicht gerade deshalb einen objektiveren, einen distanzierteren, einen kritischeren und manchmal verwunderteren Blick auf die Jazzgeschichte besaß als das Einheimischen gelungen wäre.
Timme Rosenkrantzs “Harlem Jazz Adventures” erlauben einen einzigartigen Einblick in die musikalische Welt New Yorks in den 1930er bis 1940er Jahren, jene Zeit des Umbruchs zwischen Swing und Bebop, als die Musiker mit ästhetischem Selbstbewusstsein und Tatendrang den Jazz fortentwickelten. Zwischen den vielen Anekdoten aber, die das Buch so ungemein kurzweilig machen, entdeckt man immer wieder die Ernsthaftigkeit, mit der die Musiker ihre Kunst vorantrieben.
Mehr zum Buch auf der Website: http://www.jazzbaron.com/
Wolfram Knauer (März 2012)
Black Box Pop. Analysen populärer Musik
herausgegeben von Dietrich Helms & Thomas Phleps
Bielefeld 2012 (transcript)
282 Seiten, 24,95 Euro
ISBN: 978-3-8376-1878-5
 Band 38 der ASPM Beiträge zur Popularmusikforschung enthält allgemeine und spezifische Texte zum Thema “Analyse” von Popmusik. Es geht um analytische Methoden (Frank Riedemann, Allan Moore, Simon Zagorski-Thomas), um die Frage, was in diesem Bereich Analyse überhaupt leisten kann (Simon Obert, André Doehring), und es geht um ein paar konkrete Beispiele, etwa die ausführliche historische Genese der Songformen populärer Musik (Ralf von Appen und Markus Frei-Hauenschild), Johnny Cashs “Hurt”, das Steffen just in verschiedenen Versionen vergleicht, oder um das Timing im Spiel von Jazzgitarristen, das Márton Szegedi bei John Scofield, Pat Metheny, Bill frisell, Mike Stern untersucht. Christa Bruckner-Haring fragt danac, was vom Danzón in Gonzalo Rubalcabas Spiel fortlebt, und Helmut Rösing rekapituliert Methoden musikalischer Analyse, um Copyright-Fragen etwa bei Plagiatsvorwürfen zu klären.
Band 38 der ASPM Beiträge zur Popularmusikforschung enthält allgemeine und spezifische Texte zum Thema “Analyse” von Popmusik. Es geht um analytische Methoden (Frank Riedemann, Allan Moore, Simon Zagorski-Thomas), um die Frage, was in diesem Bereich Analyse überhaupt leisten kann (Simon Obert, André Doehring), und es geht um ein paar konkrete Beispiele, etwa die ausführliche historische Genese der Songformen populärer Musik (Ralf von Appen und Markus Frei-Hauenschild), Johnny Cashs “Hurt”, das Steffen just in verschiedenen Versionen vergleicht, oder um das Timing im Spiel von Jazzgitarristen, das Márton Szegedi bei John Scofield, Pat Metheny, Bill frisell, Mike Stern untersucht. Christa Bruckner-Haring fragt danac, was vom Danzón in Gonzalo Rubalcabas Spiel fortlebt, und Helmut Rösing rekapituliert Methoden musikalischer Analyse, um Copyright-Fragen etwa bei Plagiatsvorwürfen zu klären.
Das Buch versammelt einen bunten Fundus interessanter Ansätze und dokumentiert zugleich die 21. Arbeitstagung des Arbeitskreises Studium Populärer Musik (ASPM) im November 2010 in Mannheim.
(Wolfram Knauer, Januar 2012)